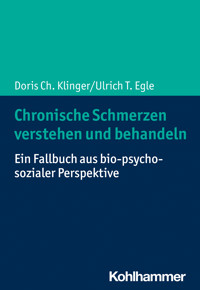
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bei der Behandlung chronischer Schmerzen spielt die Berücksichtigung der zugrundeliegenden Schmerzmechanismen eine wesentliche Rolle. Die bio-psycho-soziale Schmerztherapie stellt daher eine personalisierte Therapieplanung in den Mittelpunkt und befasst sich neben den Wechselwirkungen von biomedizinischen und psychosozialen Parametern auch mit dem Einfluss biographischer Prägungen auf das aktuelle Schmerzgeschehen. In diesem Buch werden die wissenschaftlichen Grundlagen eines bio-psycho-sozialen Krankheitsverständnisses und deren praktische Umsetzung anhand von repräsentativen Fallbeispielen ausführlich und gut verständlich dargestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort
1 Bio-psycho-soziales Schmerzverständnis
1.1 Einleitung
1.2 Entwicklung eines bio-psycho-sozialen Schmerzverständnisses
1.3 Bio-behaviorales Schmerzmodell
1.4 Pathogenese stressbedingter Schmerzen
1.5 Therapie
1.5.1 Schmerzinformation, Opiatentzug und Insomnie-Behandlung
1.5.2 Bearbeitung der Dysbalance bei den psychischen Grundbedürfnissen und der maladaptiven Konfliktbewältigungsstrategien
Literatur zur Vertiefung
2 Bio-psycho-soziale Anamnese
2.1 Ziele
2.2 Durchführung
2.3 Einfluss der Bindungstypologie auf die Arzt-Patient-Beziehung
2.3.1 Unsicher-vermeidend (abweisend) gebundene Patienten
2.3.2 Unsicher-verwickelt gebundene Patienten
Literatur zur Vertiefung
3 Herr F.: Chronische Schmerzen im rechten Unterschenkel und im Fuß; Opioidmedikation seit 3 Jahren
3.1 Biomedizinische Anamnese
3.2 Psychosoziale Anamnese
3.3 Bio-psycho-sozialer Befund
3.4 Therapieplanung
3.5 Therapieverlauf
4 Herr S.: Zahlreiche körperliche Symptome ohne organpathologischen Befund sowie körperbezogene Ängste
4.1 Biomedizinische Anamnese
4.2 Psychosoziale Anamnese
4.3 Bio-psycho-sozialer Befund
4.4 Therapieplanung
4.5 Therapieverlauf
5 Frau M.: Fibromyalgiesyndrom – chronische Schmerzen ohne körperlichen Befund sowie ausgeprägte Schlafstörungen
5.1 Biomedizinische Anamnese
5.2 Psychosoziale Anamnese
5.3 Bio-psycho-sozialer Befund
5.4 Therapieplanung
5.5 Therapieverlauf
6 Frau J.: Chronische Schmerzsymptomatik an Rücken und Extremitäten
6.1 Biomedizinische Anamnese
6.2 Psychosoziale Anamnese
6.3 Bio-psycho-sozialer Befund
6.4 Therapieplanung
6.5 Therapieverlauf
7 Frau A.: Armlähmung rechts mit chronischen Schmerzen und kein Arzt findet etwas
7.1 Biomedizinische Anamnese
7.2 Psychosoziale Anamnese
7.3 Bio-psycho-sozialer Befund
7.4 Therapieplanung
7.5 Therapieverlauf
8 Herr R.: Chronische Schmerzen, Herzbeschwerden, Angst und Arbeitsplatzprobleme
8.1 Biomedizinische Anamnese
8.2 Psychosoziale Anamnese
8.3 Bio-psycho-sozialer Befund
8.4 Therapieplanung
8.5 Therapieverlauf
9 Herr W.: Chronische Kopfschmerzen seit der Kindheit
9.1 Biomedizinische Anamnese
9.2 Psychosoziale Anamnese
9.3 Bio-psycho-sozialer Befund
9.4 Therapieplanung
9.5 Therapieverlauf
10 Frau L.: Chronische multilokuläre Schmerzen, Gangunsicherheit und multiple somatische Komorbiditäten
10.1 Biomedizinische Anamnese
10.2 Psychosoziale Anamnese
10.3 Bio-psycho-sozialer Befund
10.4 Therapieplanung
10.5 Therapieverlauf
11 Herr N.: Chronische Schmerzen im Schulter-Nacken-Rücken-Kopf-Kieferbereich, Posttraumatische Belastungsstörung
11.1 Biomedizinische Anamnese
11.2 Psychosoziale Anamnese
11.3 Bio-psycho-sozialer Befund
11.4 Therapieplanung
11.5 Therapieverlauf
12 Frau A.: Chronische Schmerzen bei Spinalkanalstenose im HWS-Bereich, mehrjährige Opiatbehandlung
12.1 Biomedizinische Anamnese
12.2 Psychosoziale Anamnese
12.3 Bio-psycho-sozialer Befund
12.4 Therapieplanung
12.5 Therapieverlauf
Literatur
Stichwortverzeichnis
Die AutorInnen
Dr. med. Doris Ch. Klinger ist Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Fachärztin für Allgemeinmedizin, spezielle und psychosomatische Schmerztherapeutin, Schmerzgutachterin, Musikpädagogin. Sie leitet als Klinische Direktorin die Vitos-Klinik für Psychosomatische Medizin in Weilmünster. Behandlungsschwerpunkte sind Stress- und stressinduzierte Schmerzerkrankungen. Tätigkeit an der Universitätsklinik in Mainz, anschließend Universitätsklinik in Frankfurt am Main. Des Weiteren Aufbau verschiedener Kliniken und Abteilungen in leitender Funktion, u. a. auch in der Schweiz.
Prof. Dr. med. Ulrich T. Egle, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Spezielle Schmerztherapie. Nach Emeritierung Senior Consultant an der Psychiatrischen Klinik Sanatorium Kilchberg in Zürich zur Etablierung eines Behandlungskonzepts für Patienten mit stressbedingten Schmerzzuständen. Psychiatrische, psychosomatische, psycho- und schmerztherapeutische Weiterbildung am Psychiatrischen Krankenhaus Haina/Kloster, an der Psychiatrischen Universitätsklinik Marburg sowie der Psychosomatischen Uniklinik Mainz. Dort Habilitation und C3-Professur für Psychosomatische Schmerzdiagnostik und -therapie. Ärztlicher Direktor zweier Reha-Kliniken in Südbaden (Gengenbach, Freiburg). Bisher Veröffentlichung von 13 Büchern und mehr als 300 Artikeln in Fachzeitschriften und als Buchbeiträge. 1990 Hans-Roemer-Preis des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin (DKPM), 2006 Walther-Engel-Preis der baden-württembergischen Zahnärztekammer, 2016 Heigl-Preis – jeweils zum Thema Psychosomatische Schmerztherapie.
Doris Ch. Klinger/Ulrich T. Egle
Chronische Schmerzen verstehen und behandeln
Ein Fallbuch aus bio-psycho-sozialer Perspektive
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-034238-5
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-034239-2epub:ISBN 978-3-17-034240-8
Vorwort
Das vorliegende »Fallbuch« entstand als Ergänzung zu dem Band »Psychosomatische Schmerztherapie«, der inzwischen in der 3. Auflage vorliegt (Egle & Zentgraf 2020). Immer wieder wurden wir nach Vorträgen oder in Seminaren gefragt, wie die praktische Umsetzung in Diagnostik und Therapie v. a. bei stressbedingten Schmerzstörungen abläuft und wie dies zum Verschwinden der chronischen Schmerzen führen kann. An zehn konstruierten und repräsentativen Fallbeispielen wollen wir dies vor dem Hintergrund eines bio-psycho-sozialen Schmerzverständnisses illustrieren. Die meisten Beispiele stammen aus dem stationären Bereich, d. h., es handelt sich um schwerer chronifizierte Schmerzpatienten, die sich in der Regel zuvor bereits verschiedenen schmerztherapeutischen Behandlungen ohne Erfolg unterzogen hatten und die teilweise auch einen ärztlich induzierten Opiatmissbrauch entwickelt hatten. Das dargestellte diagnostische und therapeutische Vorgehen ist jedoch – sieht man vom Opiatmissbrauch ab – auf eine ambulante Behandlung weitgehend übertragbar, soweit die über die Einzel- und Gruppen-Psychotherapie hinausgehenden Therapiemaßnahmen hinreichend berücksichtigt werden können.
Inhaltlich wichtig ist zunächst zu verstehen, dass bio-psycho-soziale Schmerztherapie einer personalisierten Therapieplanung bedarf, d. h. einer individuellen Abstimmung evidenzbasierter und neurobiologisch fundierter Therapiebausteine vor dem Hintergrund einer sorgfältigen Diagnostik, welche neben den Wechselwirkungen von biologischen und psychosozialen Parametern in der gegenwärtigen Lebenssituation auch den Einfluss biographischer Prägungen auf das aktuelle Schmerzgeschehen berücksichtigt. Diese Grundprinzipien wurden in den ersten beiden Kapiteln an den Anfang des Buches gestellt.
Die beiden Autoren verbindet eine mehr als 20-jährige Zusammenarbeit bei der Entwicklung und praktischen Umsetzung einer bio-psycho-sozialen Schmerztherapie in mehreren Kliniken. Für die Entwicklung dieses Therapiekonzepts wurde Ulrich Egle mit dem Heigl-Preis 2016 ausgezeichnet.
Danken möchten wir den Patienten, die ihre Zustimmung zur Publikation gaben und nach Ausbleiben einer anhaltenden Schmerzlinderung bei vorausgegangen Therapien bereit waren, aktiv an dieser bio-psycho-sozialen Behandlung mitzuarbeiten. Danken möchten wir auch Frau Stefanie Reutter vom Kohlhammer Verlag für die sorgfältige Lektorierung.
Weilmünster und Freiburg im August 2023
Doris KlingerUlrich T. Egle
1 Bio-psycho-soziales Schmerzverständnis
1.1 Einleitung
Seit den Schriften der französischen Philosophen und Wissenschaftstheoretiker Descartes (Lʼhomme, 1644) und Offrey de La Mettrie (Lʼhomme machine, 1748) wurde in der Medizin der menschliche Körper nach dem Modell einer hochkomplexen physikalisch-chemischen Maschine interpretiert.
»Krankheit ist nach diesem Modell eine räumlich lokalisierbare Störung in einem technischen Betrieb. Wie ein Techniker auf der Basis eines Schaltplanes den Betriebsschaden eines Autos, eines Fernsehers oder Computers lokalisieren und danach die Reparatur durchführen kann, so kann der Arzt eine Krankheit, die als Betriebsschaden im menschlichen Körper – als Klappenfehler im Herzen, als Geschwür im Magen oder als Enzymdefekt in einem Gewebe oder Transportsystem – lokalisiert wurde, mit gezielten technischen Eingriffen (chirurgischer oder medikamentöser Art) reparieren« (von Uexküll & Wesiack 1990, S. 5).
»Das Modell hat auch den Vorteil, immer modern zu sein, denn sobald die Technik eine neue, noch kompliziertere und noch leistungsfähigere Maschine erfindet, kann die Medizin ihr Bild des Maschinenmenschen entsprechend verfeinern, ohne das Grundprinzip preisgeben zu müssen« (von Uexküll & Wesiack 1990, S. 8).
Die Schwäche des »Maschinenmodells« liegt wesentlich in der Annahme begründet, der Reiz sei ein vom Organismus unabhängiger Parameter, auf dessen Applikation die Maschine warte, um zu reagieren. Sind der Organismus und seine Organe jedoch primär aktive Systeme, deren Funktionieren auf phylo- und ontogenetischen Prägungen beruht, kann ein aus der Umgebung einwirkender Vorgang im besten Falle das Verhalten des bereits aktiven Systems, d. h. dessen inneren Zustand, modulieren. Zur Beschreibung selbst einfacher biologischer Vorgänge sind deshalb lineare Ursache-Wirkungs-Modelle durch kybernetische Modelle zu ersetzen (vgl. von Uexküll & Wesiack 1988).
1.2 Entwicklung eines bio-psycho-sozialen Schmerzverständnisses
Aufbauend auf das Funktionskreismodell seines Vaters Jacob v. Uexküll – eines renommierten Biologen – bei Tieren entwickelte Thure v. Uexküll am Beispiel der essenziellen Hypertonie ein »Situationskreis-Modell«. Danach entsteht situativ eine individuelle Wirklichkeit aus Wahrnehmungen unseres Körpers und unserer Sinnesorgane nach physiologischen Programmen und verhaltensbezogenen Reaktionsschemata, die der Einzelne sich in seiner Biographie erworben hat (von Uexküll 1987).
»Das heißt, die in der Biografie erworbenen Muster der Wirklichkeitswahrnehmung und -deutung zusammen mit der jeweils aktuellen Verfassung des Subjekts ergeben zusammen die ›Wirklichkeit‹, auf die das Subjekt dann mit bereitgestellten psychophysiologischen Reaktionsmustern reagiert« (Roelcke 2021, S. 500).
Zeitlich parallel zu von Uexkülls Situationskreis-Modell entwickelte der amerikanische Internist, Psychiater und Psychoanalytiker G. L. Engel zur Überwindung des reduktionistischen Mensch-Maschinen-Modells in der Medizin das bio-psycho-soziale Krankheitsmodell (Engel 1977, 1980, 1997). Engel wurde zu Beginn seiner medizinischen Ausbildung sehr stark von einer physikalisch-chemischen Herangehensweise an den Kranken geprägt, erkannte jedoch mit zunehmender klinischer Erfahrung durch die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe des Psychiaters J. Romano, dass durch die beobachtende Haltung des Naturwissenschaftlers der Faktor Subjektivität, d. h. das individuelle Erleben des Patienten und die Kommunikation mit diesem, vernachlässigt wird. Er begann sich verstärkt mit der Schnittstelle von objektiven chemisch-physikalischen und ärztlichen (Untersuchungs-)Befunden einerseits und Beschwerdeschilderungen und Krankheitserleben des Patienten andererseits auseinanderzusetzen. Schließlich bezog er immer mehr lebensgeschichtliche Kontextfaktoren in der Gegenwart wie in der Vergangenheit seiner Patienten mit ein und gab diesen in seinen Publikationen eine immer größere Bedeutung, so z. B. in einer sorgfältigen klinisch-deskriptiven Beobachtungsstudie zur biographischen Entwicklung von Patienten mit medizinisch nicht erklärbaren chronischen Schmerzzuständen (Engel 1959). In seinem wegweisenden Science-Artikel illustrierte Engel (1977) am Beispiel des Diabetes mellitus und der Schizophrenie, dass bei körperlichen wie bei psychiatrischen Krankheitsbildern ein biomedizinisches Krankheitsverständnis in der Pathogenese ebenso wie in Diagnostik und Verlauf zu kurz greift und damit zusammenhängende Schwierigkeiten nur durch eine Erweiterung zu einem bio-psycho-sozialen Modell lösbar erschienen. In diesem ist der Mensch Teil umfassender übergeordneter Systeme (Zwei-Personen-Ebene, Familie, Gesellschaft, Kultur/Subkultur, Staat/Nation, Biosphäre) und selbst wiederum ein System aus mehreren Subsystemen (Nervensystem, Organsystem/Organe, Gewebe, Zelle, Organelle) bis hinab auf die molekulare Ebene (▸ Abb. 1.1; Engel 1977).
Abb. 1.1:Bio-psycho-soziales Krankheitsmodell
Diese Ebenen sind so integriert, dass das jeweilige Subsystem über eine gewisse Autonomie verfügt, gleichzeitig von den über- und untergeordneten Subsystemen aber auch beeinflusst und geregelt werden kann. Es handelt sich also um eine Hierarchie von Systemen mit Programmen aus Regulation und Gegenregulation, zugehörigen Soll- und Ist-Werten, die über Steuer- und Rückmelde-Variablen funktionieren und jeweils über eigene Zeichen und Kodierungen verfügen (Meyer 1989). Auf der physiologischen Ebene verständigen sich Nervensysteme und Organsysteme mit Hilfe biochemischer und elektrophysiologischer Signale, die von spezifischen Rezeptoren empfangen werden und der jeweiligen Prozessregulation dienen. Dabei lassen sich verschiedene Zeichensysteme unterscheiden, u. a. das immunologische, das endokrine und das neuronale. Auch bei den psychosozialen Systemen gibt es spezifische und voneinander differenzierte Zeichensysteme, welche die Kommunikation der Person mit ihrer Umwelt regulieren. Auf den verschiedenen biologischen ebenso wie den psychosozialen Systemebenen spielen als wesentliches Kontrollprinzip negative Feedback-Mechanismen eine zentrale Rolle (Carey et al. 2014).
Umwelt und Organismus bilden so ein sich dynamisch entwickelndes Gesamtsystem, das maßgeblich durch die individuelle Sozialisation bzw. Biographie des Einzelnen geprägt wird. Diese ist teilweise phylogenetisch vorgegeben, teilweise baut sie sich im Rahmen der Entwicklung im Austausch mit der Umwelt ontogenetisch auf.
Das enorme Ausmaß der Wechselwirkungen zwischen Organismus und Umwelt wurde in den letzten 20 Jahren durch wissenschaftliche Erkenntnisse zur erfahrungsgesteuerten neuronalen Plastizität (»synaptic modelling«) und insbesondere durch das neue Forschungsgebiet der Epigenetik zunehmend entschlüsselt. Nachgewiesen wurde ein permanentes Interagieren zwischen genetischer Ausstattung und Umweltbedingungen in Form eines An- und Abschaltens bestimmter Genabschnitte und damit einhergehender physiologischer und neurobiologischer Prozesse (vgl. Heim et al. 2020; Binder 2020). Dies beginnt bereits pränatal und setzt sich lebenslang in der Kindheit und über die Lebensspanne fort. Das bio-psycho-soziale Krankheitsmodell beschränkt sich insofern nicht auf eine additive Ergänzung des biomedizinischen Modells, vielmehr kommt es durch die Wechselwirkungen zwischen biologischen, psychischen und sozialen Parametern zu Emergenz-Effekten (van de Wiel & Paarlberg 2017; te Velde et al. 2016).
Auch in der Schmerztherapie wurde das Gehirn lange als eine Art Empfänger zur Dechiffrierung von Sinnesreizen und deren Beantwortung gesehen. Schmerz wurde ausschließlich als Warnsignal für eine Gewebe- bzw. Nervenschädigung interpretiert. Die vorherrschende Vorstellung der Schmerzverarbeitung im zentralen Nervensystem hatte viel Ähnlichkeit mit einer Art »Telefonkabel«, das Aktionspotenziale, in denen Informationen über Beginn, Dauer, Stärke, Lokalisation und Qualität eines peripheren nozizeptiven Reizes codiert sind, von einem Ort zu einem anderen leitet. Erstmals widersprachen vor mehr als 50 Jahren Melzack und Wall (1965) diesem reduktionistischen Reiz-Reaktions-Konzept und stellten die These auf, dass dieses sensorische System auf Rückenmarksebene durch ein deszendierend-hemmendes Kontrollsystem moduliert wird. Dieses hemmende System konnte Mitte der 1980er Jahre schließlich auch nachgewiesen werden (Basbaum & Fields 1984). Dies führte dann zu einer verstärkten Erforschung hemmender Schmerzmechanismen, während Faktoren, welche schmerzverstärkend wirksam werden können, in der Forschung zunächst weiterhin unberücksichtigt blieben. Erst später konnten zentrale Sensitivierungsprozesse nachgewiesen werden, durch die deutlich wurde, dass Schmerz nicht ausschließlich peripher bedingt sein muss und durch spinale und zentrale Einflussfaktoren wesentlich moduliert werden kann, sondern auch durch rein zentrale Einflussfaktoren induziert sein kann.
Die Hirnforschung der letzten 15 Jahre hat diese Vorstellung nochmals erheblich verändert. Zunächst wurde offensichtlich, dass es neurobiologisch in verschiedenen Teilen des limbischen Systems und des Präfrontalcortex eine weitreichende Überlappung zwischen Schmerz- und Stressverarbeitung im Gehirn gibt. Dies erklärt auch, warum in akuten Stresssituationen (z. B. nach Verkehrsunfall) Schmerz kaum wahrgenommen wird, während sich das Schmerzempfinden bei anhaltender Stressbelastung erheblich verstärken kann (Vachon-Presseau 2018). Dies führte zu einer Trennung von »sensation« (Sinnesreiz) und »perception« (Wahrnehmung). Bei der Perzeption spielt dabei die individuelle Erwartungshaltung für die Schmerzwahrnehmung eine viel wesentlichere Rolle als die Reizstärke. Das Gehirn wird heute als aktives Organ gesehen, das Vorhersagen und Hypothesen (»predictive coding«) von Sensationen generiert und sich nicht auf eine Reizwahrnehnung beschränkt. Dies ist energetisch deutlich ökonomischer und dient der Adaptation an Herausforderungen bzw. Stressoren (»Allostase«, Ploner et al. 2010; Picard & Friston 2014; Barrett & Simmons 2015). Bei der Erwartung bzw. Prädiktion spielen individuelle Prägungen bzw. Lernprozesse bis zurück in die Kindheit eine wesentliche Rolle. Erwartet man einen geringen Schmerz, so wird die Perzeption niedriger als die reale Reizstärke sein. Erwartet man einen starken Schmerz, so wird die Perzeption höher sein. Dies ist z. B. bei ängstlichen Menschen besonders ausgeprägt (Paulus & Stein 2010). Das Gehirn führt eine Art Kompromissbildung zwischen erwarteter Schmerzstärke und realer Stimulus-Intensität durch, d. h., es schafft eine subjektive Wirklichkeit innerhalb des Irrtumsbereichs (Hird et al. 2019). Diese Prinzipien spielen nicht nur beim Plazebo- und Nozebo-Effekt eine wesentliche Rolle, sondern bei jeder Art von Schmerzreiz und insbesondere bei chronischen Schmerzzuständen (Tracey 2010, Büchel et al. 2014). Die Schmerzerwartung ist insofern von der augenblicklichen biologischen, psychischen und sozialen Gesamtverfassung ebenso wie von vorausgegangenen Lernprozessen geprägt. Bei letzteren können körperliche Misshandlung und emotionale Deprivation in Kindheit und Jugend eine Rolle spielen, welche über epigenetische sowie psychoneuroendokrinologische und neuroinflammatorische Mechanismen lebenslang zu einer dysfunktionalen Stress- und Schmerzverarbeitung führen können (vgl. Egle et al. 2016).
1.3 Bio-behaviorales Schmerzmodell
Vom bio-psycho-sozialen ist ein bio-behaviorales Krankheitsmodell abzugrenzen. Bei diesem stehen die Auswirkungen einer Erkrankung auf das Verhalten des Patienten im Vordergrund. Eine biomedizinische Differenzierung hinsichtlich pathogenetischer Entstehungsmechanismen wird dabei meist genauso ausgespart wie die Bedeutung psychosozialer Einflussfaktoren in der biographischen Entwicklung und daraus resultierende psychophysiologische und neurobiologische Mechanismen. Es handelt sich um eine additive Ergänzung des biomedizinischen Konzepts mit dem Ziel, den Umgang des Patienten mit den Auswirkungen der Erkrankung im Alltag zu verbessern. Das biomedizinische Pathogenese-Konzept wird dabei nicht hinterfragt, biographische Prägungen im Rahmen der Entwicklung in Kindheit und Jugend werden nicht berücksichtigt. Exemplarisch ausgearbeitet wurde es zu Beginn der 1990er Jahre bei chronischen Schmerzzuständen (Waddell 1987; Loeser 1991; Gatchel et al. 2007). In einer sehr ausführlichen und bis heute weit mehr als tausendmal zitierten Übersichtsarbeit in einer renommierten psychologischen Fachzeitschrift (»Psychological Bulletin«) wird zwar auf Engels Modell Bezug genommen, ohne allerdings dessen Konzeption (Engel 1977, 1997) genauer darzustellen und sich an dieser zu orientieren. Die bio-psycho-sozialen Wechselwirkungen in der Entstehung von chronischen Schmerzen werden in den zahlreichen Publikationen von Gatchel und seiner Arbeitsgruppe bis heute (vgl. Hulla et al. 2019) ausgeklammert. Beim Thema Schmerzvulnerabilität wird auf »vorwiegend genetisch verankerte« Persönlichkeitsfaktoren verwiesen, welche das Bewältigungsverhalten beeinflussen können (Gatchel et al. 2007). Die bio-psycho-sozialen Wechselwirkungen beschränken sich auf eine – durchaus sorgfältige – Aufarbeitung psychosozialer Einflussfaktoren nach Auftreten der Schmerzen und deren Bedeutung für deren Chronifizierung im Hinblick auf dysfunktionale Kognitionen und Verhaltensweisen. Beim Auftreten von Schmerzen und v. a. deren Chronifizierung ist danach das individuelle Ausmaß des Leidens, das daraus resultierende Schmerzverhalten, die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens sowie das Ausmaß der Beeinträchtigung im Alltag in der Behandlung zusätzlich zu berücksichtigen. Die Ätiopathogenese der Schmerzen interessiert dabei genauso wenig wie vorausgegangene biographische Prägungen, welche die individuelle Erwartungshaltung (»predictive coding«) wesentlich beeinflussen können.
Dies trug seit seiner Einführung im deutschen Sprachraum (Egle & Hoffmann 1993) wesentlich zu einer erheblichen Unschärfe des Begriffs bio-psycho-soziale Schmerztherapie bei. Sehr häufig wird er heute synonym mit einer multimodalen oder interdisziplinären Therapie verwendet und beinhaltet, dass die biomedizinische Schmerztherapie in Form von Medikamenten oder invasiven Interventionen durch weitere Therapiemaßnahmen ergänzt wird. Eine personalisierte Therapieplanung vor dem Hintergrund einer sorgfältigen bio-psycho-sozialen Diagnostik und Differentialdiagnose liegt eher selten zugrunde – nicht zuletzt auch deshalb, weil die erforderlichen Personalressourcen meist fehlen, d. h. die damit verbundenen Kosten nicht durch eine entsprechende Vergütung abgedeckt sind.
1.4 Pathogenese stressbedingter Schmerzen
Emotionale (v. a. Angst und traumatische Prägungen) und kognitive Einflussfaktoren wirken sich ebenso wie körperliche und psychosoziale Stressoren modulierend auf das Schmerzempfinden aus (Wiech & Tracey 2009; Bushnell et al. 2013; Egloff et al. 2013). Ist das Einwirken dieser Faktoren kurz und intensiv (z. B. körperliches Trauma), so führt dies zur Einschränkung der Schmerzwahrnehmung (Butler & Finn 2009; Vachon-Presseau 2018), während über längere Zeit einwirkende negative Emotionen und Disstress eine Senkung der Schmerzschwelle und damit eine verstärkte Schmerzwahrnehmung zur Folge haben (Rhudy & Meagher 2000; Neugebauer 2007). In mehreren prospektiven Studien (Kivimäki et al. 2004; Gupta et al. 2006; Nicholl et al. 2009) ließ sich eine zeitlich enge Verknüpfung zwischen dem Auftreten einer chronischen Schmerzsymptomatik ohne nachweisbare Gewebeschädigung und einer anhaltend belasteten äußeren Stresssituation bei der Arbeit nachweisen. Das Risiko für das Auftreten einer Schmerzerkrankung stieg um bis auf das 20-Fache! Auch das Erleben von Zurückweisung und Ausgrenzung kann durch rein zentrale Prozesse (Wechselwirkungen zwischen Amygdala und Bereichen des vorderen Gyrus cinguli) Schmerz generieren (Eisenberger et al. 2012), dem auch für das Verständnis von Schmerzen im Zusammenhang mit Mobbing, Bossing und Migration eine wesentliche Bedeutung zukommt. Hingegen kann eine emotional Sicherheit gebende Hauptbezugsperson über die damit einhergehende Aktivierung des ventromedialen Präfrontalcortex, welche die Amygdala-Aktivierung reduziert, das Schmerzerleben verringern (Eisenberger et al. 2011). Eine wesentliche Rolle spielt dabei das »Bindungshormon« Oxytocin, das sowohl stress- als auch schmerzdämpfend wirkt (Rash et al. 2014).
Bereits 1959 wies der amerikanische Internist und Psychiater George L. Engel anhand sorgfältiger klinischer Beobachtungen darauf hin, dass bei einer Gruppe chronischer Schmerzpatienten ohne nachweisbare Gewebeschädigung auffallend häufig psychische Deprivation und Traumatisierungen in der Kindheit exploriert werden können (Engel 1959). Engel sprach von einer »pain-proneness«. Systematische wissenschaftliche Überprüfungen der von Engel herausgearbeiteten Kindheitsbelastungen belegten Engels klinische Beobachtungen (Adler et al. 1989; Egle et al. 1991; Egle & Nickel 1998; Imbierowicz & Egle 2003). Bondo Lind et al. (2014) sprechen von einer »emotionalen Vermeidungskultur«, in der diese Patienten aufgewachsen sind und die ihr späteres Leben im Umgang mit sich und anderen prägt. Lange wurde solchen Studien das meist retrospektive Erhebungsdesign angekreidet und die Ergebnisse wurden deshalb häufig als spekulativ abgetan. Eine kritische Sichtung solch retrospektiver Studien erbrachte diesbezüglich jedoch eher eine Unterschätzung, keinesfalls aber eine Überschätzung der gefundenen Zusammenhänge (Hardt & Rutter 2004; Hardt et al. 2006; Nelson et al. 2010). Auch wurden bereits bei Kindern und Jugendlichen mit somatoformen Beschwerden (v. a. mit rezidivierenden Bauch- oder Kopfschmerzen) familiäre Auffälligkeiten beobachtet: körperliche Erkrankungen oder Somatisierung bei den Eltern, unsicheres Bindungsverhalten, psychopathologische Auffälligkeiten bei nahen Familienangehörigen sowie ein dysfunktionales Familienklima (Spertus et al. 2003; Brown et al. 2005; Schulte & Petermann 2011). In verschiedenen Studien wurden bei Patienten mit »medizinisch nicht erklärbaren Körperbeschwerden« Störungen der Affektregulation und der Affektwahrnehmung (Alexithymie) beschrieben (Strathearn 2011). Diese geschieht vor dem Hintergrund einer unsicher-vermeidenden Bindung, welche in einer bevölkerungsbasierten Studie für die überwiegende Mehrheit dieser Patientengruppen belegt werden konnte (McWilliams 2017) und unter Stressbedingungen besonders auf Autonomie bezogene Verhaltensmuster (Selbstausgrenzung) aktiviert. Diese dienen der Vermeidung früh geprägter Zurückweisung, prädestinieren jedoch gleichzeitig für eine Selbstüberforderung.
Neben neuronalen Prozessen – so haben zahlreiche Forschungsergebnisse der letzten Jahre gezeigt – spielen dabei auch inflammatorische Mechanismen (proinflammatorische Cytokine) eine wesentliche Rolle (Xantos & Sandkühler 2014; Ji et al. 2016).
Der Beeinflussung der genannten Parameter kommt im Rahmen einer neurobiologisch fundierten Therapie eine zentrale Bedeutung zu.
1.5 Therapie
Die therapeutischen Möglichkeiten bei stressbedingten Schmerzerkrankungen sind heute oft dadurch eingeschränkt, dass breit angelegte »multimodale« Behandlungskonzepte ohne Differenzierung nach zugrundeliegenden Pathomechanismen und ohne Personalisierung zum Einsatz kommen, welche eine sorgfältige Differentialdiagnose ebenso wie Überlegungen zur differentiellen Indikationsstellung überflüssig machen. Trotz fehlendem Wirksamkeitsnachweis hinsichtlich Schmerzreduktion ebenso wie hinsichtlich Verbesserung der Alltagsbeeinträchtigung in Metaanalysen der Cochrane Collaboration (Eccleston et al. 2009; Williams et al. 2012, 2020) werden chronische Schmerzpatienten von psychologischen Schmerztherapeuten üblicherweise mit einem verhaltenstherapeutischen Schmerzbewältigungstraining (kognitiv oder operant) behandelt. Bereits vor 25 Jahren waren Studien, welche nach zugrunde liegendem Mechanismus Subgruppen bei chronischen Schmerzpatienten differenziert hatten (Konermann et al. 1995; Turk et al. 1998), zu dem Ergebnis gekommen, dass bei in der Kindheit traumatisierten bzw. mit interaktionellen Problemen belasteten Schmerzpatienten ein Schmerzbewältigungstraining wenig Erfolg versprechend ist. Trotzdem werden sie im Rahmen der stationären Versorgung dieser Patienten in Rehabilitationseinrichtungen ebenso wie im ambulanten Bereich oft als einzige Form von Psychotherapie weiterhin durchgeführt.
1.5.1 Schmerzinformation, Opiatentzug und Insomnie-Behandlung
Hilfreich ist zunächst eine genaue Information über die neurobiologischen Mechanismen sowie die psychosozialen Einflussfaktoren im Rahmen der zentralen Schmerzverarbeitung, was den Patienten die Möglichkeit einer kognitiven Neubewertung ihres bisherigen Schmerzverständnisses gibt (Nickel & Egle 2001; Schweickhardt et al. 2007; von Wachter 2011). Dies kann bereits zu einer signifikanten Schmerzreduktion beitragen (van Oosterwijck et al. 2013). Die Durchführung kann mit Hilfe des Gehirnschemas in Abbildung 1.2 erfolgen (▸ Abb. 1.2).
Eine ausführliche Information bietet auch die Grundlage, um bei Patienten mit langdauernder Analgetika- bzw. Opiatverordnung den vor einer psychotherapeutischen Behandlung dringend erforderlichen (Opiat-)Entzug durchführen zu können. Immer wieder konnten wir beobachten, dass dies bereits zu einer erheblichen Schmerzlinderung, in Einzelfällen sogar zu einem vollständigen Sistieren der Schmerzsymptomatik führte, sodass von einer medikamentenbedingten bzw. opiatinduzierten Hyperalgesie ausgegangen werden konnte.
Gleiches gilt auch für die ggf. früh zu beginnende Insomnie-Behandlung: Schlafstörungen führen grundsätzlich zu einer erhöhten Schmerzwahrnehmung (Fiedler et al. 2018). Dies gilt für REM- wie für Non-REM-Schlaf-Deprivation.
Abb. 1.2:Schmerz- und Stressverarbeitung im Gehirn als Modell für die Schmerzedukation
Die überwiegende Mehrheit aller Patienten mit stressbedingten Schmerzerkrankungen leidet unter einem nicht erholsamen Schlaf. Vor der Behandlung von Schlafstörungen steht zunächst eine sorgfältige Information, um den Patienten die o. g. Folgen von Schlafstörungen zu vermitteln und so ein Problembewusstsein für Faktoren und Verhaltensweisen zu schaffen, welche einem erholsamen Schlaf abträglich sind (oft Opiat- und/oder Alkoholkonsum, TV- oder PC-Überkonsum, aufgrund der Neigung zum Perfektionismus eingeschränkte Fähigkeit zum Abschalten bzw. Neigung zum Gedankenkreisen). Der Abbau von Verhalten, das einem erholsamen Schlaf abträglich ist, ist die erste Maßnahme der Behandlung von Insomnie. Dazu sind dem Patienten die sogenannten Schlafhygiene-Regeln als Hilfe zur Selbsthilfe zu vermitteln, wie z. B.
•
regelmäßiger Tagesrhythmus,
•
genügend körperliche Bewegung,
•
genügend Tageslicht,
•
Vermeidung von Tagesschlaf bzw. längerer Mittagsschlafpausen (> 20 Min.),
•
Vermittlung von Strategien wie z. B. Einschlafritualen,
•
Anwendung von Entspannungsverfahren.
Bei unzureichendem Erfolg der Selbsthilfe-Interventionen werden verhaltenstherapeutische Maßnahmen eingesetzt. Dazu zählen Techniken zur Reduktion nächtlichen Grübelns, Führen eines Schlafprotokolls sowie Schlafrestriktionsstrategien zur Neustrukturierung des Schlaf-Wach-Rhythmus (vgl. Egle & Zentgraf 2020).
Medikamente sollten nur als Ergänzung – unter ärztlicher bzw. therapeutischer Begleitung und möglichst nur kurzfristig – zu den o. g. Maßnahmen eingesetzt werden. Bei Ein- und Durchschlafstörungen gilt Trimipramin als besonders geeignet, da es im Vergleich zu den verwandten Substanzen die REM-Schlafphasen weniger beeinträchtigt. Meist sind schon Dosen von 5 bis 20 mg/d – am besten in Form von Tropfen gegeben – ausreichend. Zu beachten ist neben der Dosis auch die Halbwertszeit der Substanz und damit der Einnahmezeitpunkt, um nicht einen morgendlichen Überhang mit Tagesmüdigkeit zu erzeugen.
1.5.2 Bearbeitung der Dysbalance bei den psychischen Grundbedürfnissen und der maladaptiven Konfliktbewältigungsstrategien
Anschließend sollten die Klärung und Bearbeitung der Bindungs- und Beziehungsstörung, die sich bei diesen Patienten infolge der psychischen Traumatisierungen in Kindheit und Jugend entwickelt hat, psychotherapeutisch im Mittelpunkt stehen. Aufgrund ungünstiger früher Entwicklungsbedingungen in der Kindheit kommt es infolge einer inadäquaten Beantwortung psychischer Grundbedürfnisse seitens der Umgebung zu Vermeidungsschemata (Saariaho et al. 2011, 2012). Diese Vermeidungsschemata beinhalteten den Versuch, mit den Möglichkeiten eines Kindes den umweltbezogenen Herausforderungen zu begegnen. Der Behandlungsfokus ist also auf die Veränderung der »Beziehungsmuster« der Patientinnen/Patienten im Umgang mit sich wie mit anderen zu legen, mit deren Hilfe sie sich vor Zurückweisung und Enttäuschung schützen wollen. Bei Patienten mit stressinduzierter Hyperalgesie konnte beobachtet werden (vgl. Egle & Zentgraf 2014), dass die folgenden vermeidenden Verhaltensschemata bezogen auf die psychischen Grundbedürfnisse sehr häufig im Vordergrund stehen:
•
Grundbedürfnis Orientierung und Kontrolle: Das Verhalten ist bestimmt von einem ausgeprägten Kontrollverhalten und Perfektionismus. Alles wird vorgeplant, Spontaneität fehlt. Häufig handelt es sich um die Langzeitfolge des Einwirkens eines (alkoholabhängigen) zur Gewalt neigenden Vaters oder Stiefvaters oder anderer Bedingungen in der Ursprungsfamilie, die als unsicher oder gar bedrohlich erlebt wurden.
•
Grundbedürfnis Bindung: Das Verhalten ist geprägt von der Neigung zur Selbstausgrenzung. Die Betreffenden verlassen sich nur auf sich selbst und können kaum jemanden um etwas bitten. Es handelt sich dabei häufig um die Langzeitfolge strikter Erziehungsmethoden mit früher emotionaler Vernachlässigung bzw. Zurückweisung (unsicher-vermeidendes Bindungsverhalten).
•
Grundbedürfnis Selbstwerterhöhung/-schutz: Aufgrund des Fehlens von Lob und Anerkennung in der Primärfamilie kommt es zu einer ausgeprägten Aufmerksamkeitssuche in Form von Überaktivität (»Action Proneness«) und/oder Altruismus. Dies kann sich beruflich in einer permanenten Selbstüberforderung, insbesondere in einem sozialen Berufsfeld (z. B. Altenpflege), niederschlagen. Häufig handelt es sich um die Langzeitfolge verschiedener Formen früher Parentifizierung (vgl. Schier et al. 2015).
•
Grundbedürfnis Lustgewinn/Unlustvermeidung: Das Verhalten ist durch ausgeprägte Rationalität und das permanente Bemühen zu funktionieren (»Pflichterfüllung«) geprägt. Die Wahrnehmung eigener Bedürfnisse und Gefühle stellt hierbei einen Störfaktor dar und wird deshalb vermieden.
Frühe Erfahrungen, welche die emotionalen Grundbedürfnisse verletzen, führen zur Entwicklung motivationaler Schemata, die durch Vermeidungsstrategien geprägt sind, und zu einem inneren Erleben von Inkongruenz (Grawe 2004). Dies erhöht die spätere Stressvulnerabilität bei der Bewältigung belastender Lebensereignisse. Dabei spielen auch maladaptive Konfliktbewältigungsstrategien im Alltag, v. a. autoaggressive Konfliktverarbeitung, eine wesentliche Rolle, welche häufig eine Folge von Stresserfahrungen in Kindheit und Jugend sind (Nickel & Egle 2006). Das so entstandene innere Inkonsistenzerleben (vgl. Grawe 2004) bedingt einen Teufelskreis im Hinblick auf Stresserleben und -verarbeitung, der – induziert durch belastende Lebensereignisse oder »daily hassles« – letztlich zur Auslösung einer stressinduzierten Hyperalgesie (SIH) führen kann.
Nach der Information des Patienten/der Patientin (»Schmerzedukation«) ist es im Rahmen einer personalisierten Therapieplanung wichtig, mit ihm/ihr gemeinsam möglichst konkrete Therapieziele zu erarbeiteten. Dabei sind biologische (symptombezogene), psychische (im Umgang mit einem selbst) und soziale (im Umgang mit anderen) Ziele zu differenzieren und deren Überprüfbarkeit im Alltag festzulegen (▸ Abb. 1.3).
Abb. 1.3:Dokumentation bio-psycho-sozialer Therapieziele
Die Behandlung von SIH-Patienten in homogenen interaktionellen Gruppen (vgl. Nickel & Egle 2001, Dobersch et al. 2018) bietet nach vorausgegangener Information über die oben skizzierten neurobiologischen Zusammenhänge von Schmerz- und Stressverarbeitung im Gehirn die





























