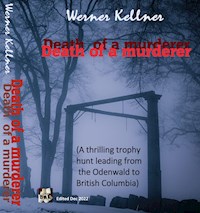3,99 €
Mehr erfahren.
Das Leben des Paul Brunner und seiner Frau Claudia ist eine Reise mit unbekanntem Ziel. Das ist an und für sich nichts Besonderes, denn wie jedes natürliche System unterliegt die Chronologie seines Lebens chaotischen Spielregeln und wird von Zufällen beeinflusst. Paul ist ein ehrgeiziger Manager eines florierenden Familienunternehmens in Darmstadt, in das er eingeheiratet hat. Seine Ehefrau, Claudia, ist die Erbin einer reichen Industriellenfamilie aus dem Odenwald. Für Paul ist nicht der katastrophale Flugzeugabsturz eine solche unvorstellbare Weichenstellung der Reise, sondern der drohende Rauswurf durch seinen Chef. Ob ihm der irre Zufall, durch den er dem todbringenden Unfallflug entgeht, eine Tür zur Freiheit öffnet? Zögerlich zunächst, dann immer entschlossener, versucht er verzweifelt sich aus seinem Beziehungskonflikt und dem Netz krimineller Intrigen und Profitgier zu befreien, und lässt sich auf ein riskantes Spiel ein. Der Einsatz ist hoch, der Ausgang offen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum neobooks
Werner Kellner
Chronologie einer Albtraumreise
Aufzeichnungen des Odenwälder Privatermittlers Willy Hamplmaier
(Beziehungsthriller)
Ausgabe vom November 2022.
Für Lucia.
Die handelnden Personen und die Schauplätze des folgenden Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit ist zufälliger und unbeabsichtigter Natur.
Die Protagonisten
Willy Hamplmaier, geboren 1955, ein gut vernetzter und umtriebiger Privatermittler in Michelstadt.
Karl Zobel, geboren 1956 in Erbach, Mehrheitsaktionär der Lebensmittelanlagenbau-AG, Darmstadt, Tochter Claudia.
Paul Brunner, geboren 8.2.1979 in Michelstadt, leitet die M&A Abteilung der LAG in Darmstadt. Wohnt mit seiner Familie in Dieburg.
Claudia Brunner, geborene Zobel, geboren 12.7.1976, leitet die Öffentlichkeitsarbeit der LAG, eine Tochter Marisa und einen Sohn Harald.
Betty Okabago, geboren 30.6.1997 in Vancouver, Kunststudentin mit indianischen Wurzeln.
Michael Stronghill, geboren 1993, Wirtschaftsanwalt aus Seattle, jobbte als Tenniscoach in Lagos, Portugal, wo er Paul und Claudia kennenlernte.
Die Antagonisten
Dr. Hohmeier, geboren am 1969, CEO der LAG in Darmstadt.
Robert Schmitt, geboren 4.2.1993 in Köln, Assistent von Dr. Hohmeier.
Willi Breitling, CFO der LAG
Jürgen Hamm, Controller der LAG
Erklärungsversuche zum Geschehen
Das Leben des Paul Brunner und seiner Frau Claudia ist eine Reise mit wechselnden Zielen. Wie jedes natürliche System unterliegt die Chronologie ihrer beider Lebensreise chaotischen Spielregeln und wird von Zufällen beeinflusst, deren Folgen nicht immer kontrolliert werden können.
Paul, ein ehrgeiziger Manager eines profitorientierten, globalen Familienunternehmens in Darmstadt, in das er eingeheiratet hat, reist zu der Niederlassung der Firma in Seattle. Seine Ehefrau, Claudia, ist die Erbin einer reichen Industriellenfamilie aus dem Odenwald.
Für Paul ist nicht der katastrophale Flugzeugabsturz eine solch unvorstellbare Weichenstellung seiner Reise, sondern der drohende Rauswurf durch seinen Chef. Unstrittig ist, dass der berufliche Druck durch den Vorstandsvorsitzenden auf ihn bedrohliche Ausmaße angenommen hat. Ob ihm der irre Zufall, durch den er dem todbringenden Unfallflug entgeht, eine Tür zur Freiheit öffnet? Oder ob ihn die chaotische Entwicklung ungebremst in eine völlig andere Richtung führt?
In turbulenten Zeiten beherrschen Emotionen und Verwirrung den kühlen Kopf. Die Protagonistin Claudia sucht immer stärker in der Religiosität Zuflucht, weil ihr der Glaube Halt und Stabilität vorgaukelt.
Geleitet von ähnlichen irrationalen Motiven gibt Paul reflexartig einem Fluchtimpuls nach. Er unterliegt der Versuchung, durch eine spontane Liebesbeziehung und das Vertrauen auf übersinnliche Traumwelten einer fremden Kultur seine Situation zu heilen. In der Folge erkennt Paul, dass nur die Rückkehr zu Ordnung und Disziplin sein zerbrechliches soziales Beziehungsgeflecht zu sichern vermögen. Zögerlich zunächst, dann immer entschlossener, versucht er verzweifelt sich aus seinem Beziehungskonflikt und dem Netz krimineller Profitgier zu befreien, und lässt sich auf ein riskantes Spiel ein. Der Einsatz ist hoch, der Ausgang offen.
Die Lektüre wird zeigen, ob die Chronologie des Ermittlers Willy Hamplmaier zusammen mit der dualen Narration der Protagonisten das Chaos zu entwirren vermag?
Prolog Willy Hamplmaiers Erzählung (1)
Ich muss gestehen, dass ich als Privatermittler zu diesem Fall wie die Jungfrau zum Kind kam. Außerdem gebe ich im Rückblick offen zu, dass ich die Gesamtsituation erst am Ende der verschiedenen Rechercheaufträge verstanden habe.
Ursachen und Zusammenhänge der Ereignisse traten erst im Nachhinein zutage, nachdem ich meine eigenen Aufzeichnungen neben die einzelnen Ermittlungsaufträge legte und mit den Tagebüchern der Betroffenen verglich.
Aber da war schon alles zu spät.
Bevor ich ins Detail gehe, darf ich mich als neutraler Erzähler kurz selbst vorstellen.
Ich heiße Willy Hamplmaier und komme aus Michelstadt im Odenwald, wo ich mich als Ex-Kripobeamter hauptberuflich um einen würdigen Abgang meiner toten Mitmenschen kümmere. Die Ausrichtung angemessener Flannerts für eine Trauerfeier als Vermächtnis des oder der Dahingeschiedenen ist mir ein spezielles Anliegen. Gelegentlich und für gute Freunde ermittle ich privat und darf stolz berichten, dass ich schon so manchen Familienzwist friedlich beilegen konnte.
Dieser Fall lag anders.
Dieser erste Auftrag, in dessen Mittelpunkt ein gewisser Paul Brunner stand, entstammte der Bitte meines langjährigen Schulfreundes Karl Zobel, vor mehr als vierzehn Jahren.
Mein Freund war dabei, seine Firma in Darmstadt, die sich mit der Herstellung von Anlagen zur Lebensmittelproduktion beschäftigte, in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln.
Er hatte mich damals gebeten, einen jungen Mann, den er als seinen persönlichen Assistenten einstellen wollte, auf Herz und Nieren zu prüfen und seine Eignung als möglichen Nachfolger zu bewerten.
Es ist bekannt und birgt ein gewisses Risiko, dass derartige langfristige Prognosen zu einem nicht unerheblichen Anteil auf der Fähigkeit basieren, das Innere einer Glaskugel zu interpretieren.
Eine Kunst, die nicht unbedingt zu meinen Stärken gehört. Meine bevorzugte Ermittlungsmethode beruht auf der Auswertung von Fakten, dem Gespräch mit Zeugen und deren individueller Bewertung.
Eine subjektive Note lässt sich dabei nicht ausschließen.
Seit seiner Schulzeit überließ Karl nie etwas dem Zufall. Er wollte sicher sein, dass der junge Mann, der ihm von einem Bekannten wärmstens als Kandidat für den Assistentenposten empfohlen worden war, seine Anforderungen erfüllen würde. Seine Kriterien an den Bewerber waren breit gefächert und hoch. Sie betrafen dessen fachliche Qualifikation, seinen Charakter und last not least sein soziales Umfeld. Da er als konservativer Vater an sein Erbe dachte, bat er mich über das berufliche Profil hinaus um eine private Einschätzung des Kandidaten. Ich sollte bewerten, ob sich der Kandidat, ein gewisser Paul Brunner, unter Umständen für eine dauerhafte Beziehung, Ehe nicht ausgeschlossen, mit seiner Tochter eignen würde.
Die Prüfung war für ihn wichtig, denn Claudia war sein einziges Kind und als spätere Alleinerbin seiner Mehrheitsanteile an seinem Unternehmen fest eingeplant. Er beabsichtigte nicht, unkalkulierbare Risiken auf der Nachwuchsseite einzugehen.
Er lachte nur, als ich ihm scherzhaft eine Genanalyse von Paul Brunner vorschlug, aber einer solchen Analyse hätte der Kandidat zustimmen müssen, und soweit wollte er dann doch nicht gehen.
Dementsprechend checkte ich auftragsgemäß Herkunft, Vorleben und Neigungen des Paul Brunner, der, wie sich herausstellte, aus Erbach im Odenwald stammte.
Das war a priori kein Nachteil, eher das Gegenteil, denn aus Michelstädter Sicht wohnten in Erbach die Leute mit dem ‚besseren Besteck‘. Ich hielt mich strikt an die Regel, dass Vorurteile und Schubladendenken, wie sie zwischen den Bürgern aus Michelstadt und Erbach gang und gäbe waren, in meiner Recherche keine Rolle spielen durfte.
Ich arbeitete mich gründlich durch die Aussagen seiner Lehrer am Gymnasium Michelstadt, gleich gegenüber von meinem Büro, einiger Schulfreunde und Studienkollegen. Als hilfreiche Quellen erwiesen sich das Rektorat der TU Darmstadt und eine Künstler-WG in Frankfurt, auf die ich zufällig stieß. Ich interviewte diskret seine Mutter, sein Vater lebte nicht mehr.
Ich lernte Paul Brunner innerhalb kürzester Zeit besser kennen, als er sich vermutlich selber kannte, denn in seinem Alter legte man keinen Wert auf eine ehrliche Selbstanalyse.
Dabei bekam ich ihn weder zu Gesicht noch sprach ich mit ihm.
Was ich aus den Befragungen nicht erkannte beziehungsweise nicht erkennen konnte, betraf sein Reaktionspotenzial für unerwartete Störungen, und wie er in kritischen Phasen auf Änderungen seines Umfeldes reagieren würde. Das bezieht sich auf meine zitierte Unfähigkeit des Glaskugellesens.
Weder er noch seine Familie waren mir bisher über den Weg gelaufen, aber ich konnte Karl bestätigen, dass das kleinbürgerliche und wertkonservative Elternhaus dem jungen Paul Brunner einen ausgeprägten Ordnungssinn und Hang zu Disziplin auf den Lebensweg mitgab. Dieser Drang, ein geordnetes und faktenbasiertes Leben zu führen, erklärte die Konfessionslosigkeit, welche in der Familie weiter gegeben wurde.
Ordnung, Disziplin und ein Wille, der gestaltete, das waren die wichtigsten Kriterien für Karl.
In Pauls Werdegang als Student gab es nur einige wenige und unbedeutende Schlenker, die man einem jungen Mann, der auf der Suche nach sich selbst war, zugestehen durfte und die ich in meinem Gutachten deshalb nicht explizit erwähnte.
Paul Brunner war eine eher introvertierte Persönlichkeit, die in jungen Jahren Mühe hatte, sich gegen die strengen Richtlinien des Vaters durchzusetzen. Anpassung unter Protest schien in der Schulzeit seine Devise zu sein. Er begann, dem Wunsch seines Erzeugers folgend, ein Jurastudium in Frankfurt und setzte die Hochschulausbildung stattdessen mit einem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der TU in Darmstadt fort, das er mit einem Einser-Abschluss krönte.
Dazwischen, es mutete fast wie ein Befreiungsschlag an, gönnte er sich nach dem Tod des Vaters die Erfüllung eines lang gehegten Traumes, indem er einen kleinen Exkurs in die regionale Kunstszene absolvierte.
Als er erkannte, dass ihm Kreativität in ausreichendem Maße nicht gegeben war, beendete er das Experiment und schlug einen Weg ein, der ihm geläufig war. Es gab danach keine Ausrutscher berichtenswerter Art.
Ich gab Karl das Profil eines integren Mannes durch, dem Ordnung etwas mehr und Disziplin etwas weniger wichtig waren.
Dafür war Paul Brunner relativ geradlinig seinen bisherigen Lebensweg gegangen, und sein Hang, Träume und Visionen zu realisieren, hielt sich in Grenzen. Er nannte ein ausgewogenes Maß an Risikobereitschaft sein eigen, wobei ich davon ausging, dass es exakt dem entsprach, was sich mein Auftraggeber von einem künftigen Nachfolger wünschte. Einheirat nicht ausgeschlossen.
Karl Zobel stellte ihn daraufhin ein.
Der Blick in den Abgrund
Pauls Erzählung (1): Die Katastrophe
Chicago, Sonntag, 14.7.2019, 0:35 Uhr
Nachts war das Wetter umgeschlagen.
Ich versuchte, mich in der flackernden Dunkelheit einer Gegend zu orientieren, die ich nie zuvor gesehen hatte, und verwünschte meine Entscheidung, den Schirm im Hotel gelassen zu haben. Als ich das Hilldon gegen Mitternacht verlassen hatte, blies ein frischer Wind durch die Straßenschluchten von Chicago und dunkle Wolken flogen in geringer Höhe über die Stadt, aber es hatte nicht nach Regen ausgesehen.
Der Wind hatte dann schnell an Stärke zugenommen und sich zu einem kräftigen Sturm entwickelt, gegen den ich mich seit einigen Minuten stemmte, und der mir fast den Atem nahm. Ein feiner, warmer Regen zerstach mir mit nadelspitzen und harten Tropfen das Gesicht. Die Hände tief in den Taschen meines Trenchcoats vergraben, kämpfte ich mich mit zusammengebissenen Zähnen gegen die Windböen voran.
Der Zustand innerer Ruhe und Gefasstheit, in dem ich mich befand, seit ich das Auto etwa eine Meile vor der Absturzstelle abgestellt hatte und zu Fuß weitergelaufen war, stand in direktem Widerspruch zu dem, was rings herum vorging.
Schon bei der Anfahrt auf der Interstate-90 hatten mich Rettungsfahrzeuge, die Polizei und die Feuerwehr überholt, während auf der Gegenfahrbahn Ambulanzen mit ihren schrillen Heultönen in Richtung Stadt unterwegs waren.
Ich fühlte mich, als ob meine Stromversorgung ausgefallen und nur die Notsysteme in Betrieb wären. Ich nahm jede Einzelheit, jede Bewegung und jedes Geräusch wahr, aber mein Gehirn dämpfte die Bildverarbeitung wie durch einen Filter.
Wie betäubt und durch eine dunkle Glasscheibe nahm ich das hektische Treiben vor mir wahr und fühlte den Hauch des Todes. Mein Sarkasmus, den ich mir in letzter Zeit angeeignet hatte, war einer ernüchternden Furcht gewichen, die mich fest umklammert hielt und meine Gedanken einschnürte.
Hatte ich anfangs nur das heftige Rauschen des Regens und dazwischen die Sirenen von Einsatzfahrzeugen gehört, so nahm ich jetzt andere Geräusche wahr, und eine gespenstisch beleuchtete Szene tauchte auf. Im gesamten Viertel war die Beleuchtung ausgefallen oder abgeschaltet, und unzählige Scheinwerfer verwandelten die Ruine und das Areal in eine unwirkliche Kulisse.
Ringsum blinkten die blauen und roten Lichter der Einsatzfahrzeuge, und aus den Trümmern des Supermarktes, in den der Jet gestürzt war, stieg leichter Rauch. Ein dicker Schaumteppich bedeckte alles.
Das Einkaufszentrum lag mitten in der Businessarea von Arlington Heights parallel zur Bundesstraße 14 unmittelbar am Rande eines Wohngebietes. Von dem rosa getünchten Gebäude waren aus der Frontseite großflächig Mauerteile herausgebrochen. Das Dach aus Stahlbetonfertigteilen war eingedrückt und durchgebrochen.
Die Stahlstützen der Tragekonstruktion, auf der die Reklametafeln zur Straßenseite grelles Neonlicht ausstrahlten, waren wie Streichhölzer geknickt, als ob eine Riesenfaust zugeschlagen hätte. Der Bug mit der Pilotenkanzel und einem Teil der ersten Klasse Kabine lag halb im Freien, und der übrige Rumpf krümmte sich aufgeschlitzt und aufgeklappt wie eine Sardinendose. Tragelemente der Stahlbetonstruktur und die stählernen Stützen der unzähligen Reklameflächen auf dem Flachdach hatten sich beim Aufprall des Flugzeuges in den Rumpf gebohrt, und diesen im Bodenbereich und entlang der Seiten aufgeschnitten und zerrissen. Metallteile und Mauerwerk waren geschwärzt von den Brandspuren des Feuers, das hier gewütet hatte, und jetzt so gut wie gelöscht war. Die Triebwerke hatten die Tragflächen mit den darin integrierten, vollen Kerosintanks schlagartig in Brand gesetzt, und das Feuermeer gab den wenigen Überlebenden, die den Aufprall überstanden hatten, geringe Chancen.
In Arlington Heights hatten sich vorwiegend Leute angesiedelt, die es sich leisten konnten, etwas außerhalb in gehobener Lage und doch nahe der City zu wohnen. Die Bungalows und die großzügigen Gartenanlagen verrieten, dass die beauftragten Architekten und Landschaftsgestalter ihr Handwerk verstanden.
Herum fliegende Teile waren ohne Ansehen der Person schrapnellartig in das Wohngebiet eingeschlagen und hatten eine Reihe von Bungalows in Brand gesetzt. Beim Vorbeilaufen sah ich die Anwohner in kleinen Gruppen mit Schirmen, notdürftig angezogen und eingehüllt in triefende, über Schlafanzüge geworfene Regenmäntel beisammen stehen und aufgeregt aufeinander einreden.
Obwohl die Polizei den Unfallort weiträumig abgesperrt hatte, konnte ich mir in dem Durcheinander von Feuerwehr und technischen Hilfsdiensten, die mit ersten Bergungsarbeiten beschäftigt waren, relativ problemlos Zutritt verschaffen.
Der heftige Regen dämpfte alle Geräusche und verlangte den Rettungsmannschaften das Äußerste ab. Mit angespannten und verschwitzten Gesichtern über verschmierten Overalls kämpften sie darum, Tote und Überlebende zu bergen.
Ich stieg über ausgefranstes Blech und verbogene Stahlteile und drückte mich an Gebäuden entlang, in denen Feuerwehrleute in grellorangen Schutzanzügen die letzten Brandnester beseitigten, in Richtung Supermarkt.
Die Leitstelle der Feuerwehr war unmittelbar vor dem total zerstörten Einkaufszentrum eingerichtet, aus dem mit schwerem Gerät zerborstene Teile des Gebäudes und des Wracks geborgen wurden.
Ich lief wie im Traum und war trotzdem auf eine seltsame Art wach, als ob ich im Auge eines Hurrikans stünde, um den herum alles durcheinanderwirbelte.
Die Maschine war inzwischen völlig ausgebrannt, und das gleißende Licht von Schneidbrennern, mit denen sich Helfer zu den eingeschlossenen und verbrannten Opfern den Weg freischnitten, übertönte die Scheinwerfer, die das Chaos in eine strahlende Helligkeit tauchten. Flugzeugteile, lagen weit auseinander, und Inspektoren der Bundesflugaufsicht hatten mit ihrer Arbeit begonnen.
Mannschaften waren mit Hunden und Sonden auf der Suche nach Opfern und Überlebenden. Am Rande des Parkplatzes vor dem Supermarkt war ein Zelt aufgebaut, in dem in Decken gehüllt und aufgereiht im grellen Scheinwerferlicht Leichen und einzelne Leichenteile der Absturzopfer lagen. Wenn man Robert, der sich unter den Opfern befand, schon gefunden hatte, sollte er dort aufgebahrt sein.
Nur weil ich aus einer spontanen Reaktion heraus, das Flugzeug nicht betreten hatte, lag meine Leiche jetzt nicht unter einer Decke in diesem Zelt oder ungeborgen im ausgebrannten Flugzeugrumpf.
Der Gedanke daran jagte mir eine Gänsehaut über den Rücken.
Der Albtraum, der mich vor der Landung in Chicago gefangen hielt, war Realität geworden.
Überall rannten Menschen hin und her, die Verletzten wurden in einem Sanitätszelt erstversorgt, sodass es schwerfiel, in all dem Durcheinander eine koordinierte Rettungsaktion zu erkennen.
Ich wandte mich an Beamte der Einsatzzentrale, um die Namen der tödlich verunglückten Unfallopfer in Erfahrung zu bringen. Ein junger, erschöpft wirkender Polizeibeamter versuchte, mich höflich aber dezidiert zurückzuweisen. Ich bedrängte ihn, und er ging mit mir zum Einsatzfahrzeug des leitenden Beamten. Als ich Roberts und meinen Namen nannte, nickte er kurz, wollte aber nicht offiziell Stellung nehmen.
Er reagierte zwar freundlicher, nachdem ich mich als Angehöriger ausgegeben hatte, dennoch ließ er sich keine Aussage entlocken. Er verwies auf die für acht Uhr morgens angesetzte Presseerklärung und bat mich, den Unfallbereich umgehend zu verlassen. Ich fragte, wie viele Überlebende man bisher geborgen hatte, und in welche Krankenhäuser man sie gebrachte hatte.
Er hatte sich bereits abgewandt und ließ meine Frage unbeantwortet verhallen.
Ich fuhr nach einer Stunde zurück ins Hotel und tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf, von denen jeder Recht behalten und mich in irgendeine Richtung steuern wollte.
Ich atmete tief durch und zwang mich zur Ruhe.
Hektischer Aktionismus hatte mir noch nie geholfen. Es war vernünftig, erst einmal die Pressekonferenz abzuwarten. Ausgeschlafen standen die Chancen auf eine Entscheidung besser, was als Nächstes zu tun sei.
Meine Armbanduhr zeigte halb zwei Uhr früh, und ich befand mich in diesem hellwachen Traumzustand, in dem ich mir mehr wie ein Beobachter als ein Betroffener vorkam. Ein ratloser Außenstehender, wie ich sarkastisch feststellen musste, und mein angekratztes Selbstbewusstsein leckte die Wunden, die ich mir so schnell hintereinander eingefangen hatte.
Ich fuhr ins Parkhaus, und die langen Reihen unbeleuchteter Scheinwerfer glotzten mich an wie die Augen von Toten.
Im Aufzug drückte ich die Lobby-Taste, um den Schlüssel an der Rezeption abzuholen und danach in die siebte Etage zu meinem Zimmer zu fahren.
Pauls Erzählung (2): vier Stunden zuvor
Chicago O’ Hare, Samstag, 13.7.2019, 21:05 Uhr
In meinen Ohren summte der Lärm der Menschen, die an mir vorüberhasteten, der Elektrokarren, die sich unbeirrt ihren Weg bahnten, und der pausenlosen Lautsprecheransagen. Wie in einem großen Organismus pulsierte das Leben auf O’ Hare, entfaltete sich in einer bunten Palette von Bewegungen, Geräuschen und Farben ohne die Zusammenhänge und die treibenden Kräfte dahinter zu offenbaren.
Das gleichmäßige Summen wirkte einschläfernd, und ich ließ die Gesprächsfetzen und Formen des strömenden Lebens an mir vorbeiziehen wie in einem Film, den ich schon zehnmal gesehen hatte.
Es war jetzt kurz nach neun Uhr, und so, wie ich die Sachlage einschätzte, blieb mir nichts anderes übrig, als mir ein Hotelzimmer zu besorgen.
Auf dem Weg aus der Abflughalle überlegte ich, wie ich am besten und ohne Zeitverlust in die Stadt käme.
Mit dem leichten Gepäck, das ich inzwischen hatte, und weil die Highways mit Sicherheit verstopft waren, hätte sich die Bahn als schnellstes Verkehrsmittel angeboten. Um diese Uhrzeit und mit dem zu erwartenden Publikum war das in Chicago unter Umständen keine reine Freude.
Ich hatte eine gehörige Portion Wut im Bauch, und mein Adrenalinspiegel hatte sein Höchstniveau bei Weitem nicht erreicht. Die wütende Stimmung gegen die unfairen Intrigen meines unmittelbaren Umfeldes ließ mich meinen Schritt beschleunigen, bis ich fast eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern umgerannt hätte. Ich presste mir eine Entschuldigung ab, holte tief Luft und versuchte, ein normales Tempo einzuschlagen und mich zu beruhigen.
Die Ankunftshalle war dicht gedrängt mit Menschen, und ich blickte mich suchend nach den Mietwagenständen um. Als Optimist wählte ich die Option Mietauto in der Erwartung, dass um diese Zeit der Verkehr abzuflauen begann. Die Stoßzeit sollte ohnehin vorbei sein, sodass ich damit mobiler wäre als mit einem Taxi. Ich sah das gelbe Car-Rental-Schild von Heerz-Cars schon von Weitem leuchten und strebte zielbewusst darauf zu.
Eine total desinteressiert wirkende junge Dame mit herzerfrischend grellen Farben im Gesicht gab sich keine Mühe, die Interessen ihres Brötchengebers und ihre eigenen unter einen Hut zu bringen. Sie stellte mit ihrer aufreizenden Art mein angekratztes Nervenkostüm auf eine weitere Probe. Dass sie das Ende ihrer Nachtschicht herbeisehnte, war unübersehbar.
Ich fragte nach einem Mittelklassewagen und sah genervt zu, wie sie lustlos prüfte, ob der von mir gewünschte Autotyp verfügbar war. Ich wartete nur auf den Moment, in dem sie beginnen würde, sich ihre Fingernägel zu lackieren, so überdrüssig schien sie meiner Belästigung zu sein. Endlich, das heißt konkret nach zwanzig Minuten, war alles geregelt, ich kannte Parkdeck und die Parkposition, an der ich den Wagen finden würde, und überließ sie dem geduldig und hinter mir wartenden Kunden.
Kaum war ich ein paar Meter gefahren, bereute ich, nicht doch die Bahn genommen zu haben. Trotz der späten Tageszeit quälte ich mich zwei Stunden lang im Stop-and-go durch den dichten Verkehr in die City.
Sicherheitshalber hatte ich vom Flughafen aus im Hilldon-Palmer-House angerufen, ob für diese Nacht ein Zimmer frei wäre, und eine Bestätigung erhalten. Ich hatte schon öfters hier übernachtet und liebte die Stimmung und das Flair des Ältesten aller Hilldonhotels, in dem die Eingangshalle mit üppigen Fresken und Säulen mit Stuck und Gemälden an den Wänden an das alte Europa erinnerten. Die Teppiche waren dezent auf die Ausgestaltung der riesigen Lobby abgestimmt und dämpften die Geräusche der sich unterhaltenden Gäste, die sich in den kleinen Ecken mit roten Plüschsitzgruppen etwas verloren ausnahmen.
Ich schlenderte zwischen den antik anmutenden Säulen hindurch, hinter denen sich die Rezeption verbarg, und wartete, bis ich an der Reihe war.
Das Mädchen am Empfang nahm meine Moneycard und den üblichen Vorabdruck und erkundigte sich lakonisch freundlich, wie ich mich fühlen würde. Wir plauderten zwanglos und, nachdem sie mir den Schlüssel ausgehändigt hatte, wünschte sie mir eine gute Nacht. Der Lift summte in die siebte Etage zu meinem Zimmer hoch.
Auf dem Weg zum Hotel hatte ich kurz an einem Supermarkt gehalten, um mir wenigstens die nötigsten Sachen wie einen Pyjama und Wäsche zum Wechseln einzukaufen. Ich stellte die Zahnbürste und meinen Rasierapparat ins Bad und legte die Klamotten sorgsam in den Schrank.
Der Kühlschrank war gut bestückt, und ein Jack Daniel‘s bot sich unaufdringlich an. Ich legte drei Eiswürfel ins Glas und schenkte mir einen Doppelten ein. Während ich den Schwenker vorsichtig bewegte, schmolz das Eis unter heftigem Knirschen und Knacken ab.
Bis der Whiskey die richtige Temperatur hatte, duschte ich abwechselnd heiß und kalt, um mich zu beruhigen.
Allmählich wurde ich wieder ein Mensch. Der Bourbon schmeckte exzellent, und genießerisch ließ ich den ersten Schluck über die Zunge fließen.
Ich schaltete den Fernseher ein und drückte mich durch die verschiedenen Kanäle, auf denen Shows und Sportübertragungen in buntem Spektrum liefen. Der Bildschirm schien sich nicht großer Beliebtheit beim Zimmerservice zu erfreuen, so verstaubt sah er aus. Mit einem Papiertaschentuch reinigte ich ihn so weit, dass das Bild halbwegs scharf war. Für Baseball hatte ich keinen Nerv und amerikanische Talk- und Spielshows interessierten mich nicht, sodass ich mir schon einen Pay-TV-Film ansehen wollte, als ich an einem Nachrichtensender mit aktuellen News hängen blieb. Ich schaltete zurück, weil ich auf den nächsten Kanal weitergezappt hatte, bis ich die Bilder und die Meldung, die für einige Sekunden über den Schirm huschten, verarbeitet hatte.
Es ging um den Absturz von Flug XL 2463 von Chicago mit Destination Seattle über dem Vorort Arlington Heights kurz nach dem Start gegen 20:30 Uhr.
Ich blinzelte und kniff vor Schreck die Augen zusammen. Ich öffnete die Lider wieder, aber die Meldung lief unbeirrt weiter.
Es gab bisher keine Erkenntnisse zu Überlebenden und bis jetzt waren einige Leichen in der näheren Umgebung der Einschlagstelle gefunden worden. Es gab weitere Tote und eine nicht genannte Zahl von Schwerstverletzten unter den Angestellten eines Einkaufszentrums, die dort Spätschicht hatten. Die Bewohner des angrenzenden Wohnviertels, auf das die Maschine abgestürzt war, verzeichneten ebenfalls eine Reihe von Opfern. Einige Zeugen hatten einen lauten Knall gehört, andere sprachen von einem zischenden Geräusch, als ob Luft aus einem Autoreifen entweicht, und dann war die Maschine vom Himmel gefallen.
Die Bilder vom Unfallort waren schrecklich, und es brannte an vielen Stellen. Aus dem massiven Einsatz von Feuerwehr, Krankenwagen und schwerem technischen Gerät zur Bergung der Opfer ließ sich der Umfang des Unglücks erahnen, ohne dass die genauen Ausmaße mitgeteilt wurden.
Am unteren Rand des Bildschirms lief eine Telefonnummer durch, über die Informationen zu den verunglückten Passagieren zu erfahren waren. Ein kurzer Anruf bestätigte mir, dass sich mein Name ebenso auf der vorläufigen Liste befand wie der von Robert Schmitt, aber eine offizielle Bestätigung erhielt ich nicht.
Ich ließ mich zurücksinken und hörte weiter den Nachrichten zu, ohne irgendwelche Einzelheiten wahrzunehmen. Die Stimme des Sprechers klang wie aus weiter Ferne.
Ich hielt es im Zimmer nicht mehr aus und verließ wie betäubt das Hotel. Ich lief durch die Stadt, bis der Michigan-Boulevard vor mir auftauchte. Ich wandte mich nach rechts und weiter durch den Grand Park zum Lake Michigan. Erschöpft sank ich am Ufer des Sees auf eine verschmutzte Bank.
Die Drohmail von Dr. Hohmeier lag mir unverdaut im Magen, da traf mich schon der nächste Schlag.
Ich starrte gedankenverloren auf das dunkle Wasser des Sees und die Erinnerung an den Albtraum vor dem Landeanflug behinderte mich zu konzentrieren.
Die neue Situation kam zu plötzlich und war zu betäubend, als dass ich eines klaren Gedankens fähig gewesen wäre.
Ich fühlte mich ausgetrickst von der Info über mein berufliches Ende. Ohne die spontane Entscheidung der Reiseunterbrechung wäre ich bei der Erledigung einer ungeliebten Aufgabe tödlich abgestürzt.
Das waren die Fakten.
Ohne mein Lebenszeichen oder eine Korrektur der Unfallmeldung würde man mich für tot erklären.
Dieser Absturz erschien mir wie ein Schlussstrich, den das Schicksal unter mein Leben der letzten Wochen und Monate ziehen wollte.
Die Tatsache, die mich aufatmen ließ, war, dass ich lebte.
Der Gedanke, dass der Zustand „tot zu sein“ gleichzusetzen war mit „frei sein“, kam so schnell, dass er mich ängstigte.
Ich war frei.
Ich war so frei wie nie.
Ich atmete tief durch und die frische Nachtluft trug dazu bei, dass ich begann, klarer zu sehen. Schaudernd stellte ich fest, dass ein Gefühl der Schadenfreude in mir hochkeimte und dann allmählich einer Flut sich überschlagender Gedanken wich. Der Spott, den ich verspürte, dass nicht alles nach Dr. Hohmeiers Kalkül lief, wurde nur getrübt durch den Tod unschuldiger Passagiere.
Je intensiver ich darüber nachdachte, umso mehr faszinierte mich die Vorstellung, frei zu sein.
Nicht die Gedanken waren frei, ich war es.
Claudia hätte anstelle von Freiheit von Flucht gesprochen.
Dabei war ich kein Aussteigertyp, niemand der sich in einem solchen Augenblick mit einem Segelboot nach der Einsamkeit der Weltmeere gesehnt hätte.
Ich hasste es, überrascht zu werden.
Nicht im Einzelfall und schon gar nicht in dieser Häufung.
Mein Weg war immer relativ geradlinig gewesen, und diese Berechenbarkeit zählte ich zu meinen Stärken.
Aber in letzter Zeit war einiges passiert, was mir die Karriere zu verhageln drohte. Ich kam mir vor, als ob mein einziger Ausweg, die Rettung von MPP Ltd[Fußnote 1]. wäre. Gehetzt lief ich auf einer einstürzenden Brücke, immer einige Meter vorneweg, bevor der Boden bröckelte und mir unter den Füßen wegzusacken drohte.
Der Sarkasmus, in den ich mich geflüchtet hatte, vermochte nicht, den Brückeneinsturz zu verhindern.
Das Gefühl, auf unbefestigtem Untergrund zu agieren, entwickelte sich aus kleinen Unstimmigkeiten in der Ehe mit Claudia, die zum Schluss immer unerfreulicher wurden. Es setzte sich in der Firma fort, in der mich mein Chef aufs Korn genommen hatte, und jetzt hatte er den Abzug für den Rausschmiss betätigt. Oder war es umgekehrt, und die Ereignisse in der Firma übertrugen sich auf meine Beziehung zu Claudia?
Ich konnte es nicht sagen, es war frustrierend.
Ich versuchte, mir vorzustellen, wie sie zu Hause auf meinen Unfalltod reagieren würden.
Ich war Claudia so nahe, dass ich den Schmerz, der sie unvorbereitet getroffen hatte, fast körperlich fühlte. Sie konnte nicht weinen, nicht vor den Kollegen, von denen sie die Nachricht erfahren hatte und nicht zu Hause. Sie würde mit tränenlosen Augen herumlaufen, um Fassung bemüht und mit Schock und Emotionen auf die Todesnachricht reagieren. Meine Familie war in den letzten Jahren meistens ohne mich ausgekommen. Marisa hing zwar stärker an mir, aber ihre Einstellung mir gegenüber wurde zunehmend kritischer. Harald hatte sich von mir fast abgenabelt, und obwohl ich mich ihm als Freund anbot, wich er mir aus. Und Claudia gab mir selten das Gefühl, dass unsere Liebe stark genug war, im beruflichen Stress zu überleben.
Dennoch bedränge mich der Gedanke, meine bessere Hälfte anzurufen, ohne sicher zu sein, ob damit unsere Beziehung reanimiert würde.
Sarkasmus und Selbstmitleid übermannten mich.
Die verstörenden Gefühle trieben mich so weit, zu glauben, dass sie mein zufälliges Ende als Befreiung von einem langen Irrweg bewerten könnte.
Einer Ehe, die ihr Vater eingefädelt hatte, ohne dass ich seine Erwartungen erfüllt hätte.
Ich schluckte.
Die Erbin der Firma hatte mich mehr als einmal spüren lassen, dass sie keinen Versager wollte.
Verdammt.
Ich fühlte mich nie als ein Loser. Mein Berufsleben hatte sich an einigen Stellen anders entwickelt, wie ich es geplant hatte. Aber ich war niemals ein Versager, mit dem man so umspringen konnte, wie es mein Chef seit kurzem Zeit praktizierte.
Ich dachte an meine so loyale Sekretärin, Marianne Kleinschmidt, die mich vor wenigen Stunden gewarnt hatte, und die jetzt von Dr. Hohmeier gezwungen wurde, die Vertragsentwürfe und die zugehörigen Arbeitsunterlagen zu rekonstruieren. Dr. Hohmeier würde toben, und er war stinksauer über die durch Roberts und meinen Tod zusätzlich aufgetretene Störung seiner desaströsen Maßnahmen. Er würde alles tun, um seinen Vorstandsposten über die Aktionärsversammlung hinaus zu retten.
Wenn ich mich jetzt telefonisch zurückmelden würde, müsste ich weiter nach seiner Pfeife tanzen, um danach in die Wüste geschickt zu werden. So wie die Mail formuliert war, hatte ihn Robert über meinen Betrugsverdacht vorgewarnt.
Ich hätte mich ohrfeigen können, dass ich im Flieger meinen Mund nicht hatte halten können. Zum Allermindesten bewies die Reaktion, dass mein Verdacht nicht unbegründet war. Ich war ihm auf die Schliche gekommen, ohne es beweisen zu können.
Damit würde ich mich aber nicht zufriedengeben, nicht nach dieser Drohung, die meine sicher geglaubte Welt ins Wanken brachte.
Für dieses Schwein würde ich nie mehr arbeiten, so viel stand fest.
Nie wieder.
Jetzt würden mir weder Wut und Sarkasmus weiterhelfen.
Diesmal ging es mir an die Substanz.
Was mich weitaus mehr beunruhigte, war die Möglichkeit, dass Claudia in dieses Komplott zumindest eingeweiht war. Manchmal hatte sich in der letzten Zeit bei mir der Eindruck verstärkt, dass wir auf eine Trennung zusteuerten, dass das Nebeneinander in unserer Ehe einen natürlichen Schlussstrich in der Firma bedeutete.
Ihr Seitensprung, die kritischen Streitgespräche und später die Sprachlosigkeit waren überdeutliche Indizien.
Ich stand auf und klopfte die Hose ab, bevor ich weiterlief in der Hoffnung, dass die frische Luft mein Bewusstsein ordnen könnte.
Die Zukunft erschien mir schwieriger denn je. Es gab nur den Weg der offiziellen Rückkehr und Eingliederung in einen Prozess, dessen Ende mir Schweißperlen auf die Stirn trieb. Oder die Alternative sich auf etwas völlig Neues und Unbekanntes einzulassen.
Alles oder Nichts stand auf dem Ticket meines restlichen Reiseprogramms.
Ich kam mir vor wie ein Tiger, der jahrelang seinen Käfig abgelaufen hatte, der jeden Winkel kannte, die Zahl der Gitterstäbe hatte sich in mein Gedächtnis eingebrannt und jetzt war die Käfigtür auf.
Sollte sich mein Verdacht, bezüglich geplanter Steuermanipulationen rund um die Ausschüttung der LAG-Dividende anlässlich der Hauptversammlung Anfang August bewahrheiten, dann war mir klar, was er tun würde.
Die Schwierigkeit bei einem derartigen Vorgang war, dass er erst nach Vollzug strafrechtlich relevant war. Das vertrauliche Protokoll, das ich zufällig entdeckt hatte, war als Beweis zu wenig. Im Licht der aktuellen Entwicklung war es nicht vermessen, anzunehmen, dass man es mir vorsätzlich untergejubelt hatte, um den Verdacht auf mich zu lenken?
Auf jeden Fall drohte mir das in der Mail zitierte Abstellgleis, und wenn der Steuerbetrug ruchbar geworden wäre, würde man mir den Betrug ohne Skrupel in die Schuhe schieben. Ich war sicher, dass derjenige, der hinter der durchgestochenen Info stand, damit vorsorglich eine Spur gelegt hatte, die den Verdacht der Aktienmanipulation auf mich lenken würde.
Im Hotel machte ich mich frustriert auf den Weg in die Bar. Mein Problem in Alkohol zu ertränken, das erschien mir in diesem Moment als der angenehmste Weg, um Abstand zu gewinnen.
An das Halbdunkel gewöhnten sich meine Augen recht schnell, aber die laute Musik machte jedes Gespräch unmöglich. Ich trank den Whiskey aus und ging, nachdem ich zwei Doppelte intus hatte, in Richtung Aufzug an der Rezeption vorbei.
Ich fuhr mit dem Lift wieder hoch und lief eine Weile gereizt auf und ab, und zu meinem Zorn auf Dr. Hohmeier gesellte sich Unmut über Claudia, und ich redete mir ein, dass sie ihre Finger im Spiel hatte.
Das Telefon stand da, ich hätte nur den Hörer abzunehmen brauchen, um meine Zweifel auszuräumen, aber ich schaffte es nicht.
Dabei hatte ich den Hörer schon in der Hand, um mich von der Rezeption durchstellen zu lassen.
Ich legte auf und grübelte, was ich ihr in drei Teufels Namen sagen sollte?
Auf jeden Fall brauchte ich ein Handy, denn meines war ja im Pilotenkoffer mitabgestürzt.
Wenn ich es ehrlich betrachtete, war ich im Gegensatz zu ihr eher der biedere Manager und nicht der erfolgshungrige Unternehmer. Schon gar nicht der smarte Nachfolger, den ihr Vater suchte.
Claudia hatte es immer vermieden, mich offen zu beeinflussen oder mir, wenn etwas schief lief, Vorhaltungen zu machen. Sie ging subtiler vor, wobei der Druck nicht weniger stark war.
Am Anfang unserer Ehe ärgerte ich mich oft genug über ihre dezenten Anregungen meine Karriere zu beschleunigen. Zuletzt hatte ich es entweder nicht mehr wahrgenommen, oder sie hatte es aufgegeben, mich herauszufordern. Bis zu unserer Krise vor zwei Tagen, als aus ihr herausbrach, was sich schon länger aufgestaut hatte.
Ich duschte und versuchte danach, zu schlafen. Obwohl mich der Jetlag quälte, konnte ich nicht einschlafen. Ich schaltete die Nachrichten nochmals ein, am Stand von 21:00 Uhr hatte sich nichts geändert, obwohl es zwischenzeitlich kurz vor Mitternacht war.
Der Nachrichtensprecher entschuldigte sich prompt damit, dass die Unfallstelle hermetisch abgeriegelt worden war. Es kursierten Gerüchte, dass die Unfallursache nicht durch technisches oder menschliches Versagen ausgelöst wurde, sondern dass man davon ausging, dass Fremdverschulden im Spiel wäre. Die Spekulationen reichten von fundamental islamistischen Kräften bis zur IRA. Alle Anzeichen deuteten auf eine Explosion im Inneren des Flugzeuges.
Erste Lokalpolitiker meldeten sich zu Wort sowie zwei konservative Kongressabgeordnete, die sich in utopischen Mutmaßungen ergingen.
Ich hörte und sah eine Weile zu, unschlüssig darüber, was ich tun sollte. Kurz entschlossen schaltete ich den Fernseher aus und zog mich wieder an. Da die Absturzstelle vom Zentrum nur fünfundzwanzig Meilen entfernt war, beschloss ich spontan, hinzufahren.
Pauls Erzählung (3): sechs Stunden zuvor
Chicago O’ Hare, Samstag, 13.7.2019, 19:10 Uhr
Wir flogen bei schönem Wetter über den Lake Michigan den Flughafen von Chicago an, und die Glasfronten der Wolkenkratzer von Downtown spiegelten die Strahlen der tief stehenden Sonne wider.
Der See war übersät mit einer Vielzahl von weißen Punkten, die sich, je tiefer die Maschine zur Landung anflog, als eine Armada von Segelbooten entpuppten. Es war Samstag Abend, und jeder, der es einrichten konnte, genoss das tolle Wetter draußen auf den leichten Wellen des Sees.
Die Maschine hatte ohne Verzögerung die Landeerlaubnis erhalten und steuerte nach einer kurzen Anflugschleife die Landebahn an, wo der Pilot sie mit einer butterweichen Landung aufsetzte.
Mit dem Aufsetzen verscheuchte ich die letzten Reste meines Albtraumes, der mich für kurze Zeit in einen Zustand der Angst versetzt hatte.
Ich saß allein am Steuerknüppel im leeren Cockpit eines abstürzenden Flugzeugs und versuchte, die Maschine hochzuziehen, die ungebremst im Tiefflug auf einen schwarzen Wald zuraste. Ich hörte die Schreie der Stewardessen und der Passagiere in Panik. Ich war allein auf mich gestellt und draußen tobte ein Unwetter, in dem Blitze zuckten und tennisballgroße Hagelkörner gegen die Cockpitscheibe prasselten. Mit dem Einschlag der Maschine, die eine brennende Schneise durch den Wald zog, erwachte ich.
Bevor ich in den kurzen Powernap geglitten war, hatte mich eine nie gekannte innere Unruhe erfasst und nicht mehr losgelassen. Es schien, als ob ich die Orientierung zu verlieren drohte.
Als ich verkrampft aus dem kurzen Albtraum hochschreckte, empfand ich Angst. Ein Gefühl, das ich auf Flügen ansonsten überhaupt nicht kannte.
Wir hatten die fast zweistündige Verspätung, die wir in Frankfurt beim Start verloren hatten, nicht mehr aufgeholt und waren um 18:30 Uhr auf O’ Hare in Chicago gelandet.
Wie üblich standen wir danach geschlagene 35 Minuten am Immigrationsschalter an, bevor wir das Gepäck abholen konnten.
Zudem hatten wir uns am Immigrationcounter präzise die Warteschlange mit dem pingeligsten Officer ausgesucht. Robert mit seiner fulminanten Menschenkenntnis hatte vorgeschlagen, diese Schlange zu nehmen, weil dort die Zahl der anstehenden, nicht weißen Reisenden am geringsten war. Dafür nahm es unser Mann aber umso genauer.
Unsere ständigen Blicke auf die Uhr, aus dem Bewusstsein, zu spät zu sein, denn der Anschlussflug startete um 19:15 Uhr, ließ ihn nicht schneller prüfen. Stur blieb er bei seinem Tempo und winkte die Leute erst nach minutenlanger Befragung aufreizend lässig durch. Weitere Minuten verloren wir, als er abgelöst wurde, mit der Übergabe an seinen Nachfolger, der aber den Verzug nicht mehr wettmachen konnte.
Nachdem wir endlich ordnungsgemäß eingereist waren und unser Gepäck vom Förderband genommen hatten, hasteten wir zum Shuttletrain, denn Transways Airlines starteten ab Terminal 2. Die Hoffnung war gering, dass dieser Flug ähnlich verspätet war.
War er nicht.
Auf dem Weg zur Station für den Shuttletrain checkten wir am ersten Bildschirm, den wir entdeckten, die Abflugsituation unseres gebuchten Fluges. Die Flugnummer tauchte nicht mehr auf und der Flug war, wie befürchtet, pünktlich gestartet.
„Scheiße“, fluchte Robert.
„Lass mal sehen, wann geht die nächste Maschine nach Seattle?“, sagte ich.
Wir checkten die verschiedenen inneramerikanischen Fluglinien, und die erste und einzig passende, die wir fanden, war ein Flug von American Xpressline.
„Bist du mit denen schon einmal geflogen?“, fragte mich Robert, und ich verneinte.
„Na schön, dann werden wir versuchen, die ganze Sache umzubuchen“, stöhnte Robert.
„Wo fliegen die denn ab?“, fragte er, und ich sagte nach neuerlichem Blick auf den Bildschirm.
„Terminal 3 und bis zum Boarding von XL 2463 um 20:00 Uhr bleibt nicht mehr allzu viel Zeit.“
Während der Shuttletrain über die Schienen glitt, verstaute ich sämtliche Unterlagen aus meinem Pilotenkoffer im einzucheckenden Reisegepäck, um Platz im Bordgepäck für eine Flasche Whiskey und ein paar Kleinigkeiten aus dem Duty Free Shop zu haben. Pass und Ticket schob ich in die Brusttasche.
In der Halle des Terminals 3 lag der XL-Schalter am äußersten Ende.
„Es scheint sich um einen dieser regionalen Billigflieger zu handeln“, sagte Robert gedehnt. Ich nahm das Ticket, und wir gingen mit unserem Gepäck zum XL-Schalter.
Die Maschine war fast voll, und wir hatten Glück, zwei Plätze zu ergattern und einzuchecken.
In der Businessclass war nur mehr ein Platz frei, der mir blieb, denn Robert schaffte es wie immer, als Vielflieger ein Upgrade in die 1. Klasse zu erhalten. Es war halb acht Uhr, und wir hatten genügend Zeit, um uns noch einen Drink in der VIP-Lounge zu genehmigen.
Auf dem Weg dorthin hob ich an einem Cardim- Cash-Terminal eintausendfünfhundert Dollar ab, weil Marianne vergessen hatte, mir den erbetenen Reisekostenvorschuss zu besorgen. Vorsorglich kaufte ich einen Tourguide von Seattle und Umgebung, um mich im Flugzeug etwas zu orientieren. Es war länger als ein Jahr her, seit ich zum letzten Mal zu einem Controlling-Gespräch mit der Geschäftsführung von MPP in Seattle weilte. Ich wünschte mir, dass sich wieder einmal die Gelegenheit für ein verlängertes Wochenende im Bundesstaat Washington ergeben würde. Es war zu lange her, das Flair der Region in Ruhe zu genießen.
Wir saßen schon eine ganze Weile in der VIP Lounge, checkten unsere Mails und ein Blick auf die Uhr bestätigte, dass wir uns allmählich auf den Weg zum Boarding machen sollten. Besser gesagt, saß ich in diesem Moment allein da, denn Robert war in der Toilette verschwunden.
Als er zurückkam, grinste er zufrieden und schlug nach einem Blick auf seine Armbanduhr einen letzten Drink vor, bevor wir uns auf den Weg zum Gate machten.
Ich packte den Laptop in den Pilotenkoffer ebenso wie das Handy und das iPad.
Wir tranken ein weiteres Dosenbier, als uns ein letzter Aufruf zum Boarding mahnte.
„Na gut, bevor wir die nächste Maschine auch noch verpassen, brechen wir eben auf“, sagte ich und trank mein Glas leer.
Fünf Minuten später trafen wir am XL-Schalter ein, wo sich eine größere Menschentraube um eine blonde Angestellte scharte.
Ein adrettes, aber total nervöses Mädchen, das Namensschild wies sie als Dorothy und Trainee aus, sorgte für ein gehöriges Durcheinander. Sie versuchte, von einer älteren Kollegin mehr verunsichert und gemaßregelt als unterstützt, eine vorgegebene Reihenfolge beim Einsteigen durchzusetzen. Aber kaum einer kümmerte sich um sie. Es fiel ihr schwer, mit einigen raubeinigen Texanern fertig zu werden, die ihren Spaß hatten und sie nach Machomanier anmachten. Als ihre Vorturnerin aus irgendeinem Grund verschwand, drohte das Chaos zu eskalieren.
„Lass uns an Bord gehen“, sagte Robert. „Sonst bricht hier endgültig alles zusammen. Hoffentlich ist die Crew nicht ähnlich unerfahren, das wäre ja beängstigend.“
Lachend gaben wir ihr die Bordkarten, und sie ließ Roberts und mein Ticket durch den Scanner laufen, während Robert wieder anfing, mit der Kleinen zu schäkern, und sie über ihre Nervosität hinaus noch gehörig ins Schwitzen brachte.
Mir hingegen fiel siedend heiß ein, dass ich vergessen hatte, den versprochenen Abschlussbericht, den ich auf dem Flug nach Chicago mühsam fertiggestellt hatte, sofort an die Geschäftsleitung zu schicken.
Mit dem iPad eine Arbeit von Sekunden und an Bord würde es schwierig werden.
Ich bat Robert unvermittelt, er sollte in die Maschine vorgehen, während ich das iPad aus dem Aktenkoffer angelte, und ihm diesen in die Hand drückte.
Ich informierte Dorothy, die mit rotem Kopf versuchte, Roberts Flirtversuchen auszuweichen, aber mehr als einen flüchtigen Blickkontakt konnte ich zu ihr nicht herstellen. Mein Zuruf, dass ich in zwei Minuten wieder da wäre, entging ihr wegen der nachdrängenden Passagiere.
Ich sah Robert heftig gestikulieren, dann verdrückte ich mich in den angrenzenden Wartebereich, öffnete das iPad und während ich die Mailnachricht mit dem angehängten Bericht an Dr. Hohmeier sendete, sah ich im Maileingang, dass mir Marianne etwas weitergeleitet hatte.
Eine Nachricht, die mein Leben ändern sollte.
Die Uhr zeigte fünf Minuten bis zum planmäßigen Abflug.
Ich öffnete Mariannes Mailnachricht.
Weiß der Teufel, wie sie an diese streng vertrauliche Info gekommen war, die wichtig genug erschien, um sie mir sofort weiterzuleiten.
Sie war ursprünglich an Robert Schmitt adressiert und stammte von Michael Hohmeier.
Ich las mit wachsender Unruhe, was meine loyale Sekretärin alarmiert hatte:
Robert,
Danke für den Hinweis, dass P. B. von der gemeinsam beschlossenen Linie ausscheren möchte und meine Vorstellungen hintertreibt. Du wirst mit sofortiger Wirkung die Führung des Projektes RESUS übernehmen.
Ich habe mich außerdem entschlossen, MPP nicht nur umzustrukturieren, sondern zu verkaufen.
Das bleibt aber vorerst topsecret!
Nach Eurer Rückkehr wirst du wie besprochen P. B’s Nachfolge antreten. Ich werde ihm einen „passenden“ Job in unserer Außenstelle in Düsseldorf anbieten.
Im Übrigen erwarte ich, dass du mir täglich einen Kurzbericht zusendest.
Michael
Ich las die Nachricht mehrmals.
Die Uhr zeigte zwei Minuten bis zum planmäßigen Abflug.
Ich wurde blass und erneut fielen mir Claudias Worte ein.
Ich saß wie betäubt im Wartebereich des XL-Schalters, ohne meine Umgebung wahrzunehmen, und war abgelenkt durch wirbelnde Gedanken, die versuchten die neue Situation zu verstehen und zu analysieren.
Der Schlag hatte mich völlig unvorbereitet getroffen, und ich rang mühsam um Fassung.
Robert agierte hinter meinem Rücken, um Dr. Hohmeier einen Gefallen zu tun. Dass MPP nicht die besten Performancedaten hatte, war allgemein bekannt, aber dass ein Verkauf ein existenzielles Problem der Niederlassung lösen könnte, das war mir neu. Von einem Verkauf war bisher überhaupt nicht die Rede. Es gab keinerlei Vorbereitungen dazu. Nach aktueller Planung war ein knackiges Restrukturierungsprogramm zur reinen Kosteneinsparung angesagt.
Ein Programm mit dem ich auf Kriegsfuß stand.
Mein Argwohn ein ungesetzliches Verschieben von Aktienpaketen entdeckt zu haben, war die Folge eines zufälligen Zugriffs auf ein verdächtiges Gesprächsprotokoll vor einiger Zeit.
Es ging nicht mehr nur um mein persönliches Karrierethema. Ein Verkauf von MPP würde nicht der Firma nutzen, sondern nur einigen Insidern, die sich des Betrugs und der Untreue schuldig machten.
Kurz vor der Hauptversammlung ein Filetstück der Firma zu verkaufen, ließ alle Alarmglocken bei mir läuten. Das Abschöpfen des Kurssprungs der Aktien des Mutterkonzerns vor der Dividendenausschüttung zum ‚Cum‘-Datum und einem Rückkauf der Aktien am ‚Ex‘-Tag, wäre allein schon ein illegaler Insidergewinn. Die Mehrwertsteuer sich mehrfach erstatten zu lassen, war ein zwischenzeitlich auch bei den Finanzbehörden bekannter Steuerbetrug, der einen weiteren netten Betrag in die Taschen der Betrüger spülen würde.
Aber ich hatte nur Indizien, keine Fakten.
Ich verstand jetzt einige von Roberts Bemerkungen auf dem Herflug besser. Der Saukerl wollte mir einreden, dass die amerikanische Filiale in Seattle das Hauptproblem der Firma sei. Dabei war die Muttergesellschaft die Verlustquelle unserer Geschäfte, weil sie unter Dr. Hohmeiers Strategie alle Risiken des südostasiatischen Marktes schlucken musste.
Und jetzt wollte man mich die Drecksarbeit in Seattle machen lassen, um mir hinterher Unfähigkeit in die Schuhe zu schieben. Ich war konsterniert über diese Unverfrorenheit und wütend über meine Naivität.
Dr. Hohmeier brauchte mich nur als Sündenbock auf dieser Albtraumreise, um mir seine Vergehen und Fehler in die Schuhe zu schieben. Ich ging die Liste meiner lieben Kollegen im Geiste durch, und es gab da schon einige, denen ich es zutraute, gegen mich zu intrigieren.
Alle meine Sinne sagten mir, dass ich noch lange nicht reif war für einen Bestatter.
Claudias Vorwarnungen beunruhigten mich weit mehr als alles andere. Wenn Sie in die Sache mitverwickelt war, dann könnte sowohl ihr Vater oder mein Vorstandschef dahinterstecken, mich aus der Firma zu drängen.
Andererseits war Karl Zobels Verhältnis zu Dr. Hohmeier seit Längerem von erheblichem Stress belastet, und ich hatte mir trotz aller Zweifel ausgerechnet, dass ein Erfolg mit MPP mir helfen würde, meine Reputation als Nachfolger bei Karl Zobel wieder herzustellen.
Ich hatte Claudia am Freitag nach unserem Streitgespräch als Zeichen meines guten Willens versprochen, mich mit ihrem Vater über den Konflikt, in dem ich steckte, und dessen Hintergründe ausführlich zu unterhalten. Unsere Ehe hatte im Laufe der Zeit einen bunten Strauß an Kratzern und Sprüngen eingesammelt. Ihre ständige Quengelei hätte ich locker hingenommen, aber ihr Seitensprung, dessen Eingeständnis ihr so unbedacht entschlüpft war, beunruhigte mich stärker, als ich mir eingestehen wollte.
Die ganze Sache stank gewaltig.
Wenn ich jetzt in die Maschine zurückging und nach Seattle flog, dann saß ich endgültig in der Falle. Dann war mein Schicksal in der Firma vorgezeichnet, so viel war mir klar.
Etwas zittrig ging ich in den Waschraum und spülte meine trockene Mundhöhle aus. Ich sah auf die Armbanduhr und zum ersten Mal keimte so etwas wie Trotz in mir auf.
Ich ging zurück in die Lounge, um mir einen Whiskey zu genehmigen. Ich trank in kleinen Schlucken und beobachtete auf dem Monitor gelassen die letzte Phase der Startvorbereitung des Fluges XL 2463nach Seattle.
Was ich brauchte, war Zeit zum Überlegen, und die musste ich mir jetzt sofort nehmen. Ich beschloss, erst einmal in Chicago zu bleiben, um mich zu sammeln und die nächsten Schritte in Ruhe und mit Sorgfalt zu überlegen. Dass Robert Zugriff auf meinen Pilotenkoffer und das Reisegepäck mit allen Unterlagen hatte, war zwar unschön, vorerst aber nicht mehr zu ändern.
So saß ich ohne Gepäck und mit einem iPad ohne Ladegerät, meinem Pass, den paar Dollars, die ich abgehoben hatte und diversen Plastikkarten in Chicago. Der Rest würde sich finden.
Als ich einen zweiten Bourbon on the rocks bestellte, hatte sich die Lounge geleert. Die Eiswürfel klirrten und die bernsteinfarbene Flüssigkeit übte eine beruhigende Wirkung auf mich aus.
Mit geschlossenen Augen und den Kopf zurückgelehnt las ich zum dritten Mal die Mailnachricht, die nur für Robert bestimmt war.
Der Whiskey tat mir gut, und ich trank das Glas leer. Ich bestellte noch einen.
Ich lehnte mich zurück, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und meine Gedanken glitten, ohne dass ich es wollte, in die Vergangenheit. Ich arbeitete jetzt seit vierzehn Jahren in der Firma meines Schwiegervaters, und im Alter von Einundvierzig war ich stolz darauf, eine Position direkt unter dem Vorstand erreicht zu haben.
Nach einer zweijährigen Einarbeitungsphase als Assistent des Firmengründers war ich in den Einkauf gewechselt und konnte spontan eine Reihe von Erfolgen einheimsen. Das war im Rückblick die beste Zeit meines Berufslebens. Ich bewegte fast alleinverantwortlich etwas, ohne in irgendein starres Firmenkorsett eingezwängt zu sein. Dieses Programm, an dem ich mit einem kleinen, aber feinen Team zur Verschlankung der Firmenprozesse gearbeitet hatte, machte Spaß und unsere Erfolge gaben uns mächtig Auftrieb.
Zu dieser Zeit erweiterte mein Schwiegervater, ich hatte es nie fertig gebracht, Karl Zobel mit dem Vornamen anzureden, die Geschäftsleitung. Er war der typische, hemdsärmelige Unternehmer, der sein Geschäft praktisch im Alleingang aufgebaut hatte, aber er wusste genau, dass er ab einem Umsatz von mehr als hundert Millionen pro Jahr in der Geschäftsführung Verstärkung brauchte. Er stellte einen gewissen Dr. Michael Hohmeier ein, der kurz davor eine Restrukturierung bei einem Werkzeugmaschinenbauer erfolgreich hinter sich gebracht hatte, und betraute ihn mit der kaufmännischen Geschäftsleitung.
Vor drei Jahren übernahm dann Dr. Hohmeier den Vorsitz im Vorstand und mein Schwiegervater wechselte in den Aufsichtsrat. Mit Karl Zobel verband mich von Anfang an ein offenes, obgleich nicht konfliktfreies Verhältnis, aber er war fair und förderte mich. Der Umgang wurde schwieriger, als ich versuchte, bei einigen Entscheidungen meinen Kopf gegen seine Ansichten durchzusetzen.
Ich änderte daraufhin mein Verhalten und fuhr künftig eine eher angepasste Schiene, aber da hatte ich seinen Vertrauensvorschuss schon abgebaut. Zu Dr. Hohmeier hatte ich von Anfang an ein gestörtes Verhältnis, denn er warf mir, wo er nur konnte, Knüppel zwischen die Beine. Wir erreichten nie einen Zustand, den man eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nennen würde. Manche Kollegen warfen ihm hinter vorgehaltener Hand unsaubere Praktiken vor. Offene Kritik gab es keine, denn alle hatten erlebt, wie schnell er jemanden feuerte, der sich auch nur ansatzweise gegen ihn stellte.
Um dieselbe Zeit als Karl Zobel Dr. Hohmeier den Vorstandsvorsitz übertrug, bat er mich, die Leitung der neu geschaffenen Akquisition&Merger Abteilung zu übernehmen. Dass ich damit zwar Dr. Hohmeier direkt unterstellt war, störte mich deshalb nicht, weil ich in engem Kontakt zum Gründerschwiegervater blieb. Optimist, der ich war, sah ich darin ein Zeichen, meinem Ziel einer Nachfolge wieder einen Schritt näher gekommen zu sein.
Eine meiner ersten Aufgaben war damals die Gründung der MPP Ltd. durch Mehrheitsbeteiligung und einen Aktientausch mit einem in Seattle ansässigen Investor, der die Firma zu Herstellung von Industrieanlagen zur Fleischverarbeitung als Sanierungsfall übernommen hatte. Großabnehmer waren insbesondere die Fast Food Ketten in USA, und es war unser Ziel, diese Anlagen weltweit zu vermarkten.
Die MPP Ltd. sollte Design und Patente sowie die Produktion einbringen, und wir übernahmen das Marketing, den Vertrieb und den Versand mitsamt der zugehörigen Logistik.
Die amerikanische Firma war kurz zuvor in eine kurzfristige Liquiditätskrise geraten und von dem Investor übernommen worden. Das Geschäftsergebnis der neuen Company unterlag in den Folgejahren heftigen Schwankungen und hatte nach einem einkalkulierten Einbruch im ersten Jahr im zweiten Finanzjahr wieder eine rote Null erreicht. Danach waren das Ergebnis und der Umsatz kontinuierlich gestiegen, ohne das vorgegebene Ziel zu erreichen.
Bezogen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Konkurrenz, die massivste Auftragsrückgänge zu verzeichnen hatte, war es auf dem hart umkämpften Markt in USA im Nachbeben der Finanzkrise ein respektables Resultat.
Dass sich die Sache nunmehr so entwickelte, dass mein Chef durch einen Verkauf der Filetstücke der amerikanischen Niederlassung mich als Sündenbock für das lausige Ergebnis der LAG[Fußnote 2] verantwortlich machen wollte, das hätte ich mir nie träumen lassen.
Ich war manchmal zu naiv.
Und jetzt wollte mich der Kerl eiskalt loswerden. Er benutzte mich als Opfer in seiner Machtprobe mit meinem Schwiegervater. Ich war relativ sicher, dass Karl Zobel nichts davon wusste.
Als das Mädchen den Whiskey brachte, leerte ich das Glas auf einen Zug und wünschte ihm die Pest an den Hals.
Pauls Erzählung (4): sieben Stunden zuvor
Ortszeit Frankfurt, Samstag, 13.7.2019, 18:00 Uhr
Die Flugroute des International Airlines Fluges von Rhein-Main in Frankfurt nach Chicago O’ Hare verlief weit nördlich, und wegen des schönen Wetters konnte man in Grönland fast die Eisbären erkennen, soweit und klar war die Sicht. Das Meer war gesprenkelt mit den weißen Tupfen der Eisberge, die auf dem Weg in wärmere Gefilde waren.
Wie ein gigantisches Selbstmordkommando zogen sie nach Süden, um sich auf ihrem Weg aufzulösen und dahinzuschmelzen.
So wenig, wie sie ihren Untergang aufhalten konnten, so gering lag es in meiner Macht, gegen diesen verrückten Vorstandsbeschluss anzugehen.
Die Maschine war mit fast eineinhalb Stunden Verspätung gestartet, weil sich ein Passagier, dessen Gepäck schon eingeladen war, nicht an Bord eingefunden hatte. Nachdem alle Gepäckstücke ausgeladen, identifiziert und wieder verladen waren, rollten wir um 16:00 Uhr zur Startposition.
Wenn ich diese Störung mit einem Blick in eine Glaskugel als Omen richtig gedeutet hätte, wäre der Flug angespannter verlaufen.
Seit zwei Stunden lagen wir auf Nordatlantikkurs und hatten die vorgesehene Reisehöhe erreicht, sodass wir etwas arbeiten konnten.
Die Crew rund um einen eifrigen Purser rekrutierte sich aus einer Mischung junger Stewards und Stewardessen, die den Kundenservice auf eine angenehme und unauffällige Art praktizierten. Robert Schmitt, der neben mir saß, nahm sofort, nachdem sich die auf unserer Seite zuständige junge Dame von ihrem Sitz losgeschnallt hatte, Augenkontakt zu ihr auf, um sie anzumachen. Er war groß und schlank, hatte dunkles Haar und eine lockere Umgangsart. Er war ein begehrter Junggeselle in der Firma und ließ keine Gelegenheit aus, um Erfahrungen zu sammeln, wie er das unter Kollegen ausdrückte.
Sein Alter war schwer zu schätzen. Er wirkte reifer und man hätte ihn locker auf Mitte bis Ende Dreißig geschätzt, obwohl er erst achtundzwanzig Jahre alt war. Er war in alle wesentlichen Aktionen involviert, die Dr. Hohmeier in den zwei zurückliegenden Jahren losgetreten hatte, und er agierte auf eine durchaus effektive Art und Weise. Bei den meisten Kollegen war er unbeliebt, weil er im Ruf stand, bei seinen Aktionen auf niemanden Rücksicht zu nehmen, solange es seinem Auftrag und Auftraggeber diente. Aus seiner Sicht eine nahe liegende Handlungsweise, die ihm aber mehr Feinde als Freunde einbrachte.
Ich war gespannt, auf welche Position ihn Dr. Hohmeier hieven wollte, denn mit zwei Jahren Assistententätigkeit, war das überfällig.
Nach dem leichten Mittagessen und einigen Gläsern Champagner arbeiteten wir nochmals die wichtigsten Punkte durch, wobei Robert mit seinen Gedanken ständig bei den vorübereilenden Mädchen war.
„Wieso hast du beim letzten Mal die Performance-Daten von MPP geschönt dargestellt?“, fand er plötzlich zum Thema.
Er sah von seinen Unterlagen auf, die er eher pro forma auf seinem Klapptisch ausgebreitet hatte, und blickte mich fragend an.
„Wie kommst du auf die Idee, dass die Daten geschönt sein könnten?“, fragte ich zurück.
„Das sind Fakten.“
„Ich habe den ursprünglichen Antrag zugrundegelegt, den Joe bei der Geschäftslagebesprechung im Mai 2018 vorgetragen hat, und diese Basisdaten habe ich benutzt. Was gibt es daran auszusetzen?“, fragte ich zurück.
Er schüttelte nur den Kopf.
„Wenn du nichts Besseres weißt, wäre es angemessen, die Klappe zu halten“, gab ich ihm hart zurück. Sein ständiges ‚wie-kannst-du-bloß‘ hing mir zum Hals heraus.
Sein verächtlicher Blick sprach Bände.
Robert Schmitt winkte einer der vorübereilenden Stewardessen zu und bestellte sein drittes Glas Champagner. Ich schloss mich an.
„Du zerstörst unsere Strategie. Michael will die Geschäftsleitung in Seattle an den Pranger stellen, und du lässt sie Pluspunkte zu sammeln. Du weißt, dass wir sie zurechtstutzen müssen. Da sind positive Zahlen und Schönfärberei taktisch unklug. Was ist daran nicht zu begreifen? Sei bloß vorsichtig, dass du Michael nicht in die Quere kommst.“
Nach meinem Geschmack ging er zu locker mit der geplanten Restrukturierung um, und als treuer Gefolgsmann des Vorstandes hatte er erkennbar den Auftrag mich einzunorden.
„Diese Strategie schadet dem Unternehmen. Das ist meine ehrliche Meinung. Der Einzige der davon profitieren könnte, ist dein Michael. Wenn mich mein Verdacht nicht trügt. Hat er dir eine Prämie vom Erlös aus Dividendenstripping versprochen?“, versuchte ich ihn mit einem Bluff zu provozieren.
Der Frontalangriff wirkte, denn er überlegte lange, bevor er antwortete.
Er nahm die Brille ab, putzte sie umständlich und tat auf pikiert. „Du spinnst! Unserem Vorstand liegt in erster Linie die Dividende der Aktionäre auf dem Herzen. Und wir tun doch alles, damit der Boss glänzt.“
„Robert, du musst zugeben, dass wir von einer umsatzstarken MPP wesentlich mehr profitieren, als den Laden umsatzmäßig so herunter zu fahren“, redete ich beschwörend auf ihn ein.
„Wie sich das anhört. Wir haben jede Menge investiert und bisher keinen Dollar Gewinn gemacht. Wir müssen die Kosten in den Griff kriegen. Und dass dazu Personalabbau notwendig ist, sollte dir klar sein.“
Auf meinen entgeisterten Gesichtsausdruck hin fügte er hinzu, „du willst doch nicht sagen, dass du deinen Traum von einer gesunden Wachstumsphase weiter fantasierst?“
„Du kennst meine Meinung“, sagte ich leichthin.
„Du bist und bleibst ein Loser“, keilte er zurück, wie immer unter der Gürtellinie.
Er starrte mich kalt an.
„Stell dir vor, dein geliebter Vorstand macht einen Fehler und wird abgesägt. Was denkst du, wie man den loyalen Diener seines Herrn behandelt?“, stichelte ich unbeirrt weiter in der Hoffnung, sein Selbstbewusstsein zu untergraben.
Sein Blick verdunkelte sich, aber er sagte nichts, und ich war der Meinung, dass das fürs Erste reichen müsste, um ihn wieder auf den Teppich zu holen.
„Du bist trotzdem ein Loser. Und was die richtige Seite anbelangt, solltest du dir die Frage stellen, ob du langfristig stabil positioniert bist. Eine Ehefrau als Grund reicht da manchmal nicht aus.“
Ich bedauerte, den Streit angefangen zu haben, denn auf diesem Niveau wollte ich nicht weiterdiskutieren.
Ich schwieg mich aus.
Er war mir zu glatt und smart.
Er hatte ja nicht die Verantwortung dafür, eine Fabrik bis auf wenige Kernbereiche zu schließen und dreihundertfünfzig Mann zu kündigen. Sein Job war es, die offenen Lieferverpflichtungen, die in den für die Restrukturierung vorgesehenen vier Wochen nicht mehr abzuarbeiten waren, entsprechend umzudirigieren.
Was hatte er schon zu verlieren.
Selbst wenn er Dr. Hohmeier als Protegé nicht mehr hätte, so war es in seinem Alter nicht weiter schwierig, einen neuen Job zu finden.
Dann entwarf ich die Mailnachricht, mit der ich auf O’ Hare meinen finalen Bericht zur Restrukturierung ins Büro schicken wollte.
Als Robert zurückkam, befand ich mich in einer aggressiven Stimmung und nahm den Faden wieder auf.
„Kannst du mir erklären, wozu wir überhaupt Controllings durchführen, wenn ihr euch, losgelöst von betriebswirtschaftlichen Ergebnissen, auf einer Spielwiese austobt, wo der persönlich Nutzen über dem Vorteil für die Firma steht?“
„Paul, du nervst. Wir haben während des April-Controlling-Meetings alles ordentlich für den Beschluss aufbereitet, den du mitgetragen hast. Wo ist denn dein Problem?“
„Du weißt sehr gut, dass ich nur unter Protest und vorbehaltlich zugestimmt habe. Mein Anliegen ist, dass ich nach wie vor glaube, dass MPP auf dem besten Weg zu einer Milchkuh ist, die Dr. Hohmeier, weil er etwas anderes kaschieren muss, schlachten möchte. Das müsstest sogar du verstehen “, verfiel ich wieder in den sarkastischen Ton von vorhin.
„Damit wirst du leben müssen“, spottete er. „Paul, ich glaube, du bist in der Firma der Einzige, der an den dauerhaften Erfolg von MPP geglaubt hat und glaubt. Leider siehst du keine Zusammenhänge. Selbst, wenn du recht hättest, würde das nicht Michaels Strategie kippen. Er will, egal wie, eine Wertsteigerung von MPP sehen“.
„Das ist doch Bullshit!“, schimpfte ich los, „aber sei unbesorgt, ich schaue mir das nicht mehr lange an. Ich habe mir vorgenommen, Karl Zobel vorher einzuschalten!“
„Mach, was du nicht lassen kannst. Wir werden schon sehen, wer am längeren Hebel sitzt“, sagte er und lehnte sich mit geschlossenen Augen zurück.
Pauls Erzählung (5): am Tag zuvor
Darmstadt, Freitag, 12.7.2019, 22:00 Uhr
„Claudia bist du schon lange zu Hause“, rief ich hoch, denn ich wähnte sie in der Küche. In der Garage war mir aufgefallen, dass sich die Motorhaube ihres roten Flitzers warm anfühlte.
Keine Antwort.