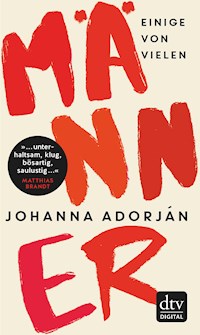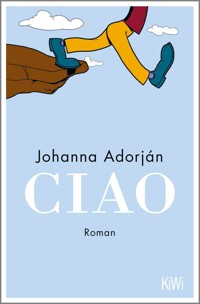
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Johanna Adorján entwirft mit »Ciao« eine Gesellschaftssatire, die extrem komisch ist und gleichzeitig ernsthaft gegenwärtig. Ist der Untergang des alten weißen Mannes beschlossene Sache oder sollte man mit dieser Spezies doch gnädig sein? Hans Benedek, einst ein gefragter Feuilletonist, hat seinen Bedeutungsverlust selbst noch gar nicht realisiert. Er wähnt sich weiterhin als Mann von beträchtlichem Einfluss, aber die Zeichen mehren sich, dass sich etwas verändert hat. Seine ständigen Affären mit Praktikantinnen sind nicht mehr so unbeschwert wie noch vor einigen Jahren. Seine Tochter beschimpft ihn als Mörder, da er immer noch Bacon zum Frühstück isst. Als seine Frau ihn auf die Idee bringt, ein Portrait über die gefragteste junge Feministin des Landes zu schreiben, wittert Hans seine Chance. Doch die Begegnung mit ihr wird Hans in einen Abgrund von bisher ungekannter Tiefe stürzen. Ein Roman über Menschen, über die die Zeit hinweggegangen ist. Über Leute von gestern im heutigen Leben. Übers Älterwerden. Und ein bisschen auch über die Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Johanna Adorján
Ciao
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Johanna Adorján
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Johanna Adorján
Johanna Adorján, geboren 1971 in Stockholm, wuchs in München auf und studierte Theater- und Opernregie. Seit 1994 arbeitet sie als Journalistin, ab 2001 fürs Feuilleton der ›Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung‹, heute für die ›Süddeutsche Zeitung‹. Ihr erstes Buch, der Bestseller ›Eine exklusive Liebe‹, erschien 2009 und wurde in 16 Sprachen übersetzt. 2013 folgte der Erzählungsband ›Meine 500 besten Freunde‹, 2016 ihr Roman ›Geteiltes Vergnügen‹, 2019 ihr Buch »Männer«. Johanna Adorján lebt in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Hans Benedek, einst ein gefragter Feuilletonist, hat seinen Bedeutungsverlust selbst noch gar nicht realisiert. Er wähnt sich weiterhin als Mann von beträchtlichem Einfluss, glaubt, dass alle Welt die Ohren spitzt, wenn er einen Gedanken formuliert. Aber die Zeichen mehren sich, dass sich etwas verändert hat. Seine ständigen Affären mit Praktikantinnen sind nicht mehr so unbeschwert wie noch vor einigen Jahren. Seine Tochter beschimpft ihn als Mörder, da er immer noch Bacon zum Frühstück isst. Als seine Frau ihn auf die Idee bringt, ein Portrait über die gefragteste junge Feministin des Landes zu schreiben, wittert Hans eine Chance. Doch die Begegnung mit ihr wird Hans in einen Abgrund von bisher ungekannter Tiefe stürzen.
Ein Roman über Menschen, über die die Zeit hinweggegangen ist. Über Leute von Gestern im heutigen Leben. Übers Älterwerden. Und ein bisschen auch über die Liebe.
Inhaltsverzeichnis
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
ALL THINGS MUST CHANGE OR REMAIN THE SAME.
1
Sie war schon da. Die weißblonden Haare vorm Gesicht, saß sie über ihr Handy gebeugt an der Bar.
»Oh nein, du warst zu früh«, sagte Henriette. Sie war gerannt und etwas außer Atem.
»Ich bin auch gerade erst gekommen«, sagte Xandi Lochner, vor der ein leeres Glas Weißwein stand. »Wahnsinnig netter Laden, kannte ich nicht.«
Bevor sie ihr Handy wegpackte, konnte Henriette erkennen, dass Twitter geöffnet gewesen war. Kurzer Moment der Unsicherheit, würde man sich die Hand geben oder mit Wangenküssen begrüßen, doch schon war Xandi von ihrem Hocker gerutscht, und sie umarmten sich, als würden sie sich ewig kennen. Dabei sahen sie sich zum ersten Mal.
Xandi war klein und roch nach einem Duft, den Henriette selbst früher benutzt hatte. Ein Öl aus dem Body Shop. War es Musk? Sie trug ein weißes Hemd und weite schwarze Hosen, die bis auf den Boden reichten, sodass sie die Schuhe völlig verdeckten. Ihre Haare sahen von Nahem so seidig und weich aus wie die eines kleinen Mädchens. Kein Härchen stand weg. Rechts und links von ihrem Mittelscheitel wuchs der Ansatz mehrere Zentimeter breit dunkel nach. Henriette beneidete sie darum, trotzdem nicht ungepflegt auszusehen, sondern cool. Es verlieh ihr etwas Punkiges. Ein Vorrecht der Jugend.
Das Restaurant war gut besucht. Auf den Tischen brannten Kerzen. Um die lange Tafel in der Mitte saß eine Gruppe laut durcheinandersprechender Spanier oder Lateinamerikaner und zauberte Urlaubsstimmung in den Raum. Henriette versuchte, die Aufmerksamkeit eines Kellners auf sich zu lenken, der jedoch ihr Winken gekonnt übersah. »Ich hab reserviert«, sagte sie zu Xandi, dabei hatte sie ihr das schon gemailt. Sie war nervös. Was wollte Xandi Lochner von ihr?
Zur Vorbereitung hatte sie sich deren Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Für eine Vierundzwanzigjährige war er beeindruckend lang. Es gab sogar einen eigenen Absatz mit der Überschrift »Kontroversen«.
Alexandra »Xandi« Lochner wurde kurz vor der Jahrtausendwende in Linz geboren, war in Wien aufgewachsen und lebte seit dem Studium in Deutschland. Als Neunzehnjährige wurde sie durch selbst gedrehte und auf YouTube veröffentlichte Videos bekannt, in denen sie an ihrem WG-Küchentisch sitzend satirisch das Weltgeschehen kommentierte. Recht schnell hatte sie dann Feminismus und Genderungerechtigkeit als Thema für sich entdeckt. Ihre Kommentare waren schärfer geworden, ihr Auftreten immer sicherer, ihre YouTube-Clips zirkulierten im Internet. Und dann hatte das Fernsehen sie entdeckt, denn eine junge schlagfertige Feministin, die nicht nur cool aussah mit ihren schwarz oder weißblond oder auch mal pink gefärbten Haaren, sondern sich in der Gegenwart mit ihren Benachteiligungen, Privilegien und Begrifflichkeiten auskannte wie früher Männer in ihrer Westentasche, war natürlich für jede Talkrunde ein Gewinn. Dort konnte man sie fortan oft sitzen sehen, und bevor die anderen Gäste noch laut fertig überlegt hatten, was man heutzutage denn eigentlich überhaupt noch sagen dürfe, hatte Xandi Lochner schon drei Mal fehlerfrei LGBTQ+ in einem Satz über Identitätspolitik untergebracht, und der alarmierende Hauch einer neuen Zeit wehte durch die abgestandene Luft des Fernsehstudios und riss die Zuschauer vor ihren Bildschirmen aus dem Dämmerschlaf.
Richtig berühmt wurde sie, als sie in einer Polit-Talkshow die homophoben Ansichten einer CSU-Politikerin fast gegen deren Willen aus ihr herauskitzelte. Sie ließ einfach nicht locker, war besser vorbereitet als die Moderatorin und konfrontierte diese arme Frau, die natürlich gar nicht arm war, sondern eine extrem unsympathische Fränkin mit Ansichten aus dem vorvergangenen Jahrhundert, mit einem belegten Zitat von ihr nach dem anderen. Ausschnitte aus dieser Sendung wurden tausendfach im Internet geteilt, die Politikerin trat kurze Zeit später zurück, angeblich aus persönlichen Gründen. Seither galt Xandi Lochner als eine Art moderner weiblicher Robin Hood, vor allem junge Frauen verehrten sie und sahen in ihr ein Vorbild. Aber es gab auch viele, die sie hassten. Sie veröffentlichte die Morddrohungen, die sie erhielt, in den sozialen Netzwerken.
Und jetzt hatte sie auch noch ihren ersten Roman geschrieben. »Es geht los« hieß er, vor drei Wochen erschienen. Ein Riesenbestseller. Natürlich. Die Verfasserin war ja aus dem Fernsehen bekannt. Er handelte von einer Zwölfjährigen, der eine gute Hexe verrät, wie die Welt zu retten ist. Henriette hatte ihn sogar gelesen, nachdem das Vorab-Presseexemplar, das ihr Mann nach Hause geschickt bekommen hatte, wochenlang unbeachtet auf einem der Bücherstapel in der Küche lag. Kein großer literarischer Wurf, dennoch hatte Henriette auf der letzten Seite Tränen in den Augen gehabt. Am Schluss stirbt das Mädchen beziehungsweise das Kind, das sich bis dahin als non-binär definiert (es opfert sich für die Welt). Und seit Henriette selbst Mutter war, konnte sie es nicht aushalten, von kranken oder sterbenden Kindern zu lesen. Die Vorstellung, dass der eigenen Tochter etwas zustoßen könnte, war zu brutal.
Die Kritik war überraschend gnädig mit Lochners schriftstellerischem Debüt umgegangen. Henriette nahm an, dass es am Thema lag: Dass nur die Jugend die Welt noch retten konnte. Aktueller ging es ja kaum.
Als der Kellner sich ihrer endlich annahm und sie an ihren Tisch führte, drehten sich die Köpfe einiger Gäste wie in einem Comic ein hektisches zweites Mal nach Xandi Lochner um. Sie schien aber keine Notiz davon zu nehmen, dass sie erkannt wurde, wahrscheinlich war sie es einfach gewohnt.
»Und, wie geht’s dir mit allem, du hast doch bestimmt gerade wahnsinnig viel um die Ohren«, sagte Henriette, nachdem sie sich gesetzt hatten und der Kellner verschwunden war, um die Speisekarten zu holen. »Ach, geht schon«, sagte Xandi Lochner, »macht eigentlich wahnsinnig viel Spaß.«
Jetzt im Sitzen sah ihr Kopf riesig aus, dachte Henriette. Beinahe, als wäre der Kopf einer anderen, viel größeren Person auf ihren zierlichen Körper draufgeschraubt. Wahrscheinlich hatte sie deswegen angenommen, Xandi Lochner sei größer als sie. Sie kannte diesen Effekt von Filmschauspielerinnen, die in echt auch oft überraschend klein waren unter einem riesigen breitflächigen Gesicht.
Henriette folgte Xandi Lochner auf Instagram und Twitter. Sie war eine der wenigen Prominenten, die sie dort nicht nervten. Dabei postete Xandi Lochner wahnsinnig viel, vor allem auf Twitter. Meistens kommentierte sie, was andere, in der Regel Männer, in der Öffentlichkeit falsch gemacht hatten. Auf Pointe geschrieben, nie gallig oder schlecht gelaunt. Henriette bewunderte sie dafür. Wann immer sie selbst sich daran versucht hatte, etwas im Internet zu kommentieren, hatte es klugscheißend und verbittert geklungen. Sie hatte das meiste nach ein paar Minuten wieder gelöscht und irgendwann eingesehen, kein Talent für dieses Medium zu haben. Aber das war ja in ihrem Fall auch völlig egal. Sie war eine Privatperson. Fast alle, die ihr auf Twitter folgten, waren mit ihr verwandt. Inzwischen las sie nur noch passiv mit.
Sie fragte sich, wie diese jungen Frauen das machten. Es gab auf einmal so viele, alle ungefähr zu der Zeit geboren, als sie Abitur machte, die sich selbstverständlich Feministinnen nannten, ohne die Abwehrreaktionen mitzudenken, die früher in Kauf genommen werden mussten, wenn man sich dazu bekannte. Iiih, Achselhaare, hatte es zu ihren Schulzeiten geheißen, iiiih Alice Schwarzer, iiih lila Latzhose. Am besten hatte man selbst am lautesten gelacht, um nicht als unsympathische Emanze dazustehen, oder, etwas später und eher im Nachtlebenkontext, als »unterfickt«.
Ob Xandi das alles überhaupt wusste? Henriette war immer noch verblüfft darüber, dass Xandi Lochner sie kontaktiert hatte, mittels einer Direktnachricht auf Twitter. Sie hatte keine Ahnung, wie sie sie gefunden hatte. Dass sie inzwischen Benedek hieß, konnte sie eigentlich nur aus dem Wikipedia-Eintrag über Hans haben, ihren Mann. Hans Benedek, Rubrik Leben, letzter Satz: Er lebt mit seiner Frau, der Dichterin Henriette Weiss, und ihrer Tochter in Berlin. Aber woher sollte sie wissen, dass sie mit dem Journalisten Hans Benedek verheiratet war?
Henriette hatte sich vorgenommen, an diesem Abend etwas darüber zu erfahren, wie das Leben aus Sicht einer zwei Jahrzehnte jüngeren Frau heutzutage aussah, einer jungen Frau, die vom Alter eigentlich näher an ihrer Tochter war und die ihr doch so wahnsinnig weit und irgendwie richtig vorkam. Als hätte sie das Herz auf dem rechten Fleck oder, wie ihr Mann immer sagte, wenn er seinen Redaktionsleiter nachahmte (was Henriette hasste, weil er dann ganz schlecht wienerte), als hätte sie »alle Tassen im Schrank«.
Dass Xandi Lochner ihren Gedichtband kannte, war ihr immer noch unbegreiflich. Er war vor über zwanzig Jahren erschienen, damals noch unter ihrem Mädchennamen, und für einen winzigen, längst vergessenen Moment hatte es ausgesehen, als wäre sie, Henriette Weiss, eine große literarische Hoffnung. Sie hatte sogar am Bachmann-Wettbewerb teilgenommen, hatte mehrere Tage in diesem entsetzlichen Klagenfurt zugebracht. Von der Veranstaltung, bei der sie nichts gewonnen hatte, war ihr hauptsächlich in Erinnerung, dass sie sich in ihren Jeans falsch angezogen fand.
»Summ diese Melancholie« stand über dem Porträt, das der inzwischen verstorbene Literaturkritiker Raoul Schellenberg über sie geschrieben hatte. Sie war den Verdacht nie losgeworden, dass sich dieser elegante ältere Herr, der ihres Wissens nach schwul gewesen war, in ihr Autorinnenfoto verguckt hatte. Auch andere Feuilletons hatten ihren Band wohlwollend besprochen, immer war dazu dieses Foto gedruckt worden. Es war ein Schwarz-Weiß-Porträt, auf dem sie sehnsuchtsvoll wie eine französische Chansonsängerin der Sechzigerjahre in die Kamera sah. Ja wirklich, sie ähnelte darauf ein wenig Juliette Gréco. Bis heute war es ihr nicht wieder gelungen, den Lidstrich so perfekt hinzubekommen.
Die Restbestände von »Frau mit Hut«, drei Umzugskartons voll, lagerten bei ihnen im Keller. Sie hatte sie mit mehreren Lagen Plastikfolie umwickelt, damit sie den nächsten Wasserschaden, mit dem in ihrem Altbau zu rechnen war, heil überstehen würden. »Frau mit Hut« war auch der Titel des ersten Gedichts, das Xandi, wie sie in ihrer ersten Nachricht geschrieben hatte, auswendig kannte. Mehr noch, sie hatte es sogar vertont. Nach einigen höflichen Nachrichten hatte Xandi ihr die Audiodatei gemailt. Auf gleichbleibender Tonhöhe sprach sie den Text über einem treibenden Elektrobeat. Ihre Stimme war heruntergepitcht, sie klang wie ein Mann. Seltsamerweise sprach aus ihrer Vertonung des Gedichts, in das Henriette ihre Wehmut darüber gepackt hatte, dass die Welt für Männer und Frauen eine andere war, Wut. Bei Xandi war kein Schmerz zu hören, es war eine Anklage.
»Warte.« Xandi machte sich an ihrer Tasche zu schaffen, eigentlich ein Beutel, dessen Träger diagonal um ihren Oberkörper gegurtet war, auf dieselbe unpraktische Weise, wie auch Henriettes Tochter Emma ihre Tasche trug. Xandi sah wirklich ein bisschen behindert aus, wie sie mit spitz angewinkelten Armen in ihrem Beutel auf Brusthöhe herumwühlte, dachte Henriette und korrigierte sich sofort. Nicht behindert: bemüht.
»Hier, schau«, sagte Xandi und zog ein abgegriffenes Taschenbuch hervor.
Henriette hatte es lange nicht gesehen. Auf dem Cover war ein altmodischer Damenhut abgebildet, so ein runder mit Tüll. Schlimm, immer schon gewesen, aber sie hatte sich gegen den Verlag nicht durchgesetzt.
»Musst du mir heute Abend noch signieren«, sagte Xandi. Sie winkte damit und packte es wieder ein.
Henriette hatte damals in Köln gewohnt, wo sie recht leidenschaftslos vergleichende Literaturwissenschaften studierte, war permanent wegen irgendeines Mannes unglücklich gewesen, was sie nicht davon abgehalten hatte, an die große Liebe zu glauben, es hatte sie im Gegenteil vielleicht sogar noch angespornt, und während sie sich allmählich zur Rotweinkennerin hochtrank, hatte sie heimlich sehnsüchtige Gedichte geschrieben, die sie niemandem zeigte. Geld hatte sie als Autorin einer Fernsehquizshow verdient, die so niveaulos gewesen war wie gut bezahlt. Einmal pro Woche verbrachte sie einen langen Tag im neonbeleuchteten Aufenthaltsraum eines Studios, in dem es nach Angebranntem roch. Auf braunen Thermoskannen klebten Zettel, auf denen K oder T stand, Kaffee oder Tee. Auf einem Teller lagen Gummibärchen und verschiedene Schokoriegel in Mini-Version. Noch heute konnte Henriette in kein Twix beißen, ohne dass sie ein Gefühl von absoluter Trostlosigkeit überkam.
Ihre Aufgabe hatte darin bestanden, zusammen mit einem Kollegen Antworten für die Kandidaten zu schreiben, die an der Show »Traumprinz sucht Traumprinzessin« teilnahmen, um dort ihren Traumprinzen oder ihre Traumprinzessin zu finden. Natürlich sollten diese Antworten in der Sendung spontan wirken. Natürlich wirkten sie wahnsinnig steif und auswendig gelernt. Die Kandidaten waren Anfang zwanzig und sportlich. Henriette hatte den Eindruck, dass viele von ihnen wirklich hofften, ihren Traumprinzen oder ihre Traumprinzessin in der Sendung kennenzulernen. Es lag eine nervöse Anspannung über der Szenerie, die sich in viel Herumgewitzel Luft machte. Männer und Frauen waren vor der Aufzeichnung streng voneinander getrennt und wurden von zwei verschiedenen Autorenteams betreut. Sie bekamen sich erst vor den Kameras zu Gesicht, mussten einige Aufgaben meistern und sich schließlich bei einem Tête-à-tête einer Art Kreuzverhör stellen, bei dem sie mit möglichst viel Schlagfertigkeit glänzen sollten. Und diese Schlagfertigkeit galt es, vorher mit den Autoren einzustudieren.
Etwa eine Stunde vor der Aufzeichnung kam der Redaktionsleiter dazu, um die Antworten, wie es hieß, »abzunehmen«. Das war der unangenehmste Teil der Arbeit. Der Redaktionsleiter hieß Eckhart und nannte sich Ecki. Vorname und Sie. Er trug eine Brille mit rotem Kunststoffgestell und war recht klein, hatte aber die Angewohnheit, sich so raumgreifend übers Sofa im Kandidatenraum zu fläzen, dass die Person, die neben ihm saß, kaum noch Platz hatte und entweder mit den Beinen oder mit dem Oberkörper an Ecki stieß. Oft war das Henriette. Während er die frisch ausgedruckten Textvorschläge las, rieb er sich am Kinn oder zog sich die Haut an den Backen lang und ließ sie wieder zurückschnalzen, als wäre sie aus Gummi. Manchmal machte er »Ha!« oder »Hoho« oder strich mit seinem Kugelschreiber etwas aus. War Henriette in dem Autorenteam, das die männlichen Kandidaten betreute, hatte sie mit Ecki nicht viel zu tun. Er las zügig, war oft gleich zufrieden, ließ sich hier und da zeigen, wer genau etwas sagen würde, stellte fest, dass der das bestimmt gut machen würde oder dass man dem aber noch sagen müsse, er solle das so oder so betonen. Und schon war er wieder weg.
Für die weiblichen Kandidaten nahm er sich mehr Zeit. Sie wurden eine nach der anderen herbeigerufen, um auf dem niedrigen Sessel neben dem Sofa Platz zu nehmen. Jede Antwort wurde von Ecki persönlich so umgeschrieben, dass etwas Zweideutiges mitschwang. »Ich liebe Obst, und ich wäre sehr interessiert an deiner Himbeere …«, »Meine Wohnung ist winzig. Also perfekt zum Zusammenkuscheln …«, »Ich nasche wahnsinnig gerne. Wenn ich dich so ansehe, könnte ich mir einiges vorstellen, was ich gerne vernaschen würde …«. Nichts war zu absurd, nichts zu unlustig, Hauptsache die Antwort endete im Vagen, endete offen, auf drei Punkten, auf denen man gemeinsam auf diesen oder jenen Höhepunkt zusteuern könnte …
Henriette hatte heute noch den Klang von Eckis Stimme im Ohr, wenn dieser eine besonders süße Obstsorte aussprach. »Deine Kirschen« Und »Banane« natürlich, immer wieder Banane. Die Mädchen, wie es damals noch hieß, waren zu unsicher und nervös, um dem wichtigen Mann, einem Redaktionsleiter, zu widersprechen. Und Henriette war es eigentlich egal. Es wurde schließlich niemand gezwungen, »und dann zeig ich dir mein Klavier und lass dich darauf« – kleiner, von Ecki vorgegebener Seufzer – »improvisieren« zu sagen. Sie taten es widerspruchslos. Sie merkten noch nicht einmal, was sie da sagten, so geeicht waren sie darauf, nach oben hin zu gefallen. Und was auch immer Henriette und ihr Kollege mit ihnen erarbeitet hatten, all die netten und zur jeweiligen Persönlichkeit passenden Zweizeiler, kamen den Kandidatinnen, nachdem ein Alpha-Mann drübergegangen war, im Nachhinein völlig lächerlich vor. Auf einmal beachteten sie Henriette nicht mehr. Den ganzen Tag hatten sie an ihren Lippen gehangen, ihr Gummibärchen vom Buffet mitgebracht, darauf bestanden, ihr noch mal und noch mal den Text vorzusagen. Und kaum hatte Ecki, der Chef, die Antworten abgenommen, beziehungsweise eben nicht, sondern komplett neu formuliert, garniert mit allerlei Früchtchen und Punkt Punkt Punkt, war sie in den Augen der einundzwanzigjährigen Steuerfachgehilfin aus Hildesheim, die zuvor gesagt hatte, sie wolle einfach auf keinen Fall als sexy Blondine rüberkommen, zur Idiotin mutiert.
»Ich möchte gerne dein Schokoladenhase sein … So?«
»Prima. Ganz wunderbar. Oder … wie war der Name? Sabrina? Schokoladenhäschen, das ist noch besser, sagen Sie Häschen …«
»Ich möchte gerne dein … Schokoladenhäschen sein?«
»Genauso. Wundervoll, Sabrina. Mmmmh.«
Was für eine deprimierende, lukrative Zeit.
Von Nahem sah Xandi ganz genauso aus wie auf ihren Pressefotos, die anlässlich des Erscheinens von »Es geht los« gerade überall zu sehen waren. Sogar eine Straßenbahn mit ihrem netten Kindergesicht darauf war an Henriette vorbeigefahren. Perfekte Haut, volle Lippen, kleine, mit knallblauem Kajal umrandete Augen, die sie beim Studieren der Karte zusammenkniff.
»Was ist denn Renke?«
Ihre dunklen buschigen Augenbrauen bildeten einen harten Kontrast zu den blondierten Haaren, was ihr punkiges Aussehen noch mal verstärkte. In einem Ohr hatte sie viele Piercings, wie Knöpfe, die ganze Seite hoch.
»Du trägst zwei Uhren?«
Xandi sah auf ihr Handgelenk. »Die eine geht nicht.«
Es kam Henriette immer noch wie ein Fehler vor, dass sie hier mit Xandi Lochner saß, der Xandi Lochner, und dass die sie, Henriette, für eine ernst zu nehmende Lyrikerin hielt. Sie hatten ihr Gedicht im Deutsch-Leistungskurs durchgenommen. Eine Information, die so verkehrt klang, dass Henriette sie nicht einzuordnen wusste. Es hatte irgendwie nichts mit ihr zu tun. Immerhin hatte es ihr jetzt diese Begegnung beschert, und wer weiß, vielleicht war dies seine eigentliche Bestimmung gewesen, der Grund, warum dieses Gedicht auf der Welt war, vielleicht war es also doch für etwas gut, dachte Henriette.
»So schade, dass du nur einen Gedichtband veröffentlicht hast«, sagte Xandi, ohne von der Karte aufzusehen. »Ich liebe Lyrik. Ich finde nichts größer als Lyrik. Nicht mal Pop.«
Ja, warum hatte sie nur einen Gedichtband geschrieben, dachte Henriette. Ihr Leben war anders verlaufen, als sie es sich vorgestellt hatte, als sie noch Gedichte schrieb. Hier eine verpatzte Beziehung, da ein Umzug für einen Job, der sich als schlechte Idee herausstellen sollte, was einen aber auch wieder Lebenszeit kostete. Drei Jahre hatte sie für einen Kunstbuchverlag einen schlecht bezahlten Lektorinnenjob gemacht. Ihre Hoffnung auf eine Festanstellung hatte sich als unbegründet herausgestellt. Naja, und dann hatte sie Hans kennengelernt. Es war bei einer Karnevalsveranstaltung gewesen. Er war von einem Bekannten mitgenommen worden, bei dem er gerade zu Besuch war, sie von ihrer Mitbewohnerin. Beide hassten sie Karneval. Beide standen sie am Rand, während alle anderen die soundsovielte Polonaise tanzten. Wahrscheinlich fanden jedes Jahr in Köln viele Paare auf diese Weise zueinander, missmutig gegen irgendeine Wand lehnend, möglichst weit weg von den Lautsprechern.
Sie verliebte sich so haltlos in ihn, dass Köln betreffend von Flucht gesprochen werden musste und was ihr bisheriges Leben anging, von einem Irrtum. Innerhalb von zwei Wochen hatte sie ihr Zimmer im Belgischen Viertel weitervermietet und alle ihre Sachen bei Hans in Berlin-Charlottenburg. Er hatte Platz. Er wohnte in einer 140-Quadratmeter-Wohnung mit Balkonen, Stuckdecken, einem Gästebad und Modernismus-Klassikern wie Eames-Lampen und dem Noguchi-Coffee-Table. Die Wohnung gehörte Hans’ Eltern, die in Heidelberg lebten. Sein Vater hatte früher beruflich öfters in Berlin zu tun gehabt. Heute waren sie nur noch selten in der Hauptstadt, und wenn, schliefen sie im Gästezimmer und störten nicht weiter. Die meiste Zeit reisten sie ohnehin um die Welt, wo sein Vater an Architekturkongressen teilnahm oder sie interessante Operninszenierungen sahen oder beides.
Hans war sehr groß, hatte volles Haar, jedenfalls von vorne, das Henriette immer noch als dunkelbraun wahrnahm, dabei war er inzwischen fast völlig grau. Sie würde ihn auch immer als schlank beschreiben. Sie sah ihn einfach noch so, wie sie ihn kennengelernt hatte: als langen schlanken Mann mit vollen dunklen Haaren, die er sich alle paar Sätze mit einer energischen Bewegung aus der Stirn strich, wobei seine Hand zuletzt auf dem Kopf verharrte, als könnte er sich von der Weichheit und Fülle seines eigenen Haares nicht lösen. Inzwischen ruhte die Hand genau auf der kahlen Stelle, weshalb Henriette ihn damit aufzog, dass er an seinem kreisrunden Haarausfall selbst schuld war.
Er trug immer ein hellblaues Hemd, das sich über dem Bauch seit Längerem beträchtlich wölbte. Oft steckte ein Kugelschreiber in der Brusttasche. Sein anderes Markenzeichen, wenn man so wollte, war, dass er seine weichen Lederslipper ohne Strümpfe trug, jedenfalls von April bis weit in den Oktober hinein. Wenn das mit den Temperaturen so weiterging – bisher war es der wärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen –, schaffte er es dieses Jahr vielleicht sogar bis November.
In den Kreisen, in denen sie verkehrten, war Hans ein wichtiger Mann. Er wurde ständig zu Abendessen bei Galeristen eingeladen, bekam zum Geburtstag Blumensträuße von offiziellen Stellen und von zwei Auktionshäusern je eine Kiste Champagner. Was Kunst anging, vor allem Gegenwartskunst, kam man in dieser Stadt, in diesem Land, nicht ganz an seinem Urteil vorbei. Er wusste um die Verantwortung, die damit einherging, und nahm es zum Beispiel nicht auf die leichte Schulter, jemanden zu verreißen, zumal er auch oft neuere, also noch nicht so arrivierte Künstler besprach. Henriette gefiel, dass er mit der Macht, die er sich im Laufe seiner Karriere erschrieben hatte, nicht leichtfertig umging. Es machte sie stolz, wenn Artikel von ihm in den sozialen Netzwerken herumgingen. Vielleicht stimmte es, was ihre Therapeutin einmal gesagt hatte, nicht als Vorwurf, sondern als Feststellung, dass sie auch durch ihren Mann lebte. Dass sein Erfolg auch irgendwie ihrer war.
Tatsächlich wusste Xandi Lochner, wer Henriettes Mann war. »Hans Benedek, wer kennt ihn nicht?«, sagte sie. Sie sei zwar nicht immer seiner Meinung, möge aber seine Art zu schreiben sehr. »Was Texteinstiege angeht, möchte ich sogar fast sagen, er ist so was wie ein Vorbild.«
Sie wollte wissen, wie lange Henriette schon mit ihm zusammen war.
»Oh Gott, fast zwanzig Jahre.«
Wie alt ihre Tochter war.
»Dreizehn.«
Wie lange Hans schon bei »Die Zeitung« war.
»Keine Ahnung. Ewig. Da war er schon, bevor wir uns kannten.«
Ob er gut mit dem Walter Windisch zurechtkomme?
Wie gut sie sich auskannte. Vielleicht weil Windisch wie sie aus Österreich kam?
»Total. Ja, die verstehen sich gut, die zwei.«
Ob Henriette gleich gewusst hatte, dass er es war?
»Naja, gewusst … Wir waren einfach sehr verliebt.«
»Waren?«
»Ich meine, diese Anfangsverliebtheit.«
»Ihr habt ja geheiratet.«
»Ja, aber da war Emma dann schon unterwegs.«
»Aber Heiraten ist doch wahnsinnig romantisch.«
Sie wollte wissen, wie Hans ihre Gedichte fand. »Weil es ja Männer gibt, die damit nicht klarkommen, wenn ihre Frau in Wahrheit das größere Genie ist.«
Sie sah aus, als meinte sie das gar nicht ironisch.
Als der Kellner kam, um ihre Bestellung entgegenzunehmen, war Xandi noch unschlüssig. Sie bat Henriette, als Erste zu bestellen.
»Einmal das Lammkotelett, bitte.«
»Gerne. Und Sie?«
Es stellte sich heraus, dass Xandi Veganerin war. Für die Küche kein Problem, wie der Kellner versicherte, man könne hierbei die Beilagen auch alleine als Hauptspeise essen, oder hier, dieses Gericht mit Quinoa sei ohnehin vegan.
Henriette ärgerte sich. Ihre Tochter war auch vegan. Jeder war heute vegan, sie hätte daran denken und auch etwas ohne Fleisch bestellen sollen. Wenigstens das, wenigstens ohne Fleisch. Sie fühlte sich, als hätte sie persönlich den Auftrag gegeben, ein Lamm zu töten, ein Lämmchen, das niemals älter hatte werden dürfen als allerhöchstens zwölf Monate, ein niedliches junges vierbeiniges Geschöpf, das nichts anderes im Sinn gehabt hatte, als herumzutollen, und das geschlachtet worden war, um ihr, Henriette, gleich mit einem Rosmarinzweig garniert unter einer gepfefferten Crème-fraîche-Sauce serviert zu werden. Und anschließend würden ihr Fleischfasern zwischen den Zähnen stecken, und sie würde versuchen müssen, die möglichst unauffällig herauszuziehen.
Bei der Getränkebestellung passierte gleich der nächste Fehler. Henriette nahm einen Weißwein, im festen Glauben, mit dieser Wahl nicht allein zu sein. »Du auch noch einen?«, fragte sie Xandi, doch die schüttelte den Kopf und wollte nur Mineralwasser. Das verunsicherte Henriette, die nun als Fleischesserin und Alkoholtrinkerin alleine dastand. Immerhin hatte Xandi ja schon ein Glas Wein getrunken. Oder war das am Ende etwas Alkoholfreies gewesen?
»Und was schreibst du gerade?«, fragte Xandi.
»Ich habe eigentlich nur diesen einen Lyrikband veröffentlicht. Ich schreibe gar nicht mehr.«
»Ach so. Und was arbeitest du?«
»Ich habe länger für ein Auktionshaus gearbeitet. Jetzt bin ich Yogalehrerin.«
Xandi sah enttäuscht aus. Oder projizierte Henriette das in sie hinein?
»Und was hast du studiert?«, fragte Henriette schnell, um von sich abzulenken.
»Germanistik und Soziologie. Aber abgebrochen. Und dann war ich noch in Leipzig am Literaturinstitut.«
»Ach, das ist ja interessant. Endlich kann ich mal jemanden fragen, was man da lernt!«
»Naja, literarisches Schreiben. Aber ich glaube, das kann man nicht lernen. Das kann man oder man kann es nicht, oder?«
Henriette nickte. Sie hatte keine Ahnung, ob das zutraf. Traf das zu? Am Ende konnte man es lernen, am Ende hätte sie es lernen sollen, dann wäre vielleicht mehr aus ihr geworden. Sie war Mitte vierzig, Ehefrau, Mutter, zertifizierte Yogalehrerin. Sie hatte eine fünfhundertstündige Ausbildung absolviert, die sehr teuer gewesen war, und unterrichtete vier Mal die Woche in einem kleinen Studio im Prenzlauer Berg, in dem die Teilnehmer für eine Stunde so viel bezahlten, wie sie für richtig hielten (oder sich leisten konnten). Davon wurde die Hälfte für nachhaltige Projekte gespendet. Aber das war natürlich kein richtiger Beruf. Oder? Die Wahrheit war, dass sie es sich als Frau von Hans Benedek leisten konnte, keinen Beruf zu haben. Was sie nicht stolz machte, aber nun mal so war. Sollte sie das mit dem Schreiben am Ende doch noch mal probieren? Wenigstens als Hobby? Oder war das eine lächerliche, pathetische Idee?
Der Kellner brachte das Essen. Das Lamm hatte eine sehr strenge Lammnote. Vielleicht, hoffte Henriette, war es doch schon etwas älter gewesen. Auf jeden Bissen packte sie viele grüne Bohnen, sodass man das Fleisch nicht sah.
Kommende Woche würde Xandis große Lesetour beginnen, vierzig Stationen in zwei Monaten. Man würde ihr einen Wagen mit Fahrer stellen, damit sie nicht dauernd Bahn fahren musste, und sie hatte Mitspracherecht bei den Hotels. Das schien sie zu freuen. Sie würde jetzt auch durch die Talkshows tingeln, »Auf Zack«, »Ois Bonanza?«, »Andreas’ Woche«, überall müsste sie hin. Sie fragte, ob Henriette auch mal auf Lesereise war. Nein, nie.
Es wurde jetzt immer schwieriger, Gesprächsthemen zu finden. Henriette bestellte sich noch ein Glas Weißwein.
Xandi machte Small Talk. Wie lange Henriette schon in Berlin lebte. Wo? Ach ja, Charlottenburg. Wie alt ihr Kind sei? Hatte sie ihr eigentlich schon gesagt. Wie groß die Wohnung? Ob sie fragen dürfe, wie hoch die Miete … Eigentumswohnung, ach so.
Es kam Henriette vor, als hätte sie einen Fehler gemacht. Aber welchen? Sie merkte, dass sie begann, zu lange zu lachen, während sie insgeheim fieberhaft nach Themen suchte, die ihr Gegenüber interessant finden könnte, dass sie unbedingt wollte, dass Xandi sie mochte. Doch die wirkte auf einmal, als wäre sie nicht mehr ganz da. Schlimmer, als wäre sie gelangweilt. War sie enttäuscht? Hatte sie sich von ihrer Lieblingslyrikerin etwas anderes erwartet?
Was fand sie eigentlich an dem Gedicht so besonders? Sie zu fragen, traute Henriette sich nicht. Der Moment war vorbei. Das Gespräch fand keinen roten Faden mehr. Xandi schien sich an den entstehenden Pausen nicht zu stören.
Irgendwann kam Henriette auf MeToo zu sprechen. Ein Fehler, den sie im Nachhinein dem Alkohol zuschob. Und ihrer zunehmenden Verunsicherung. Es ging zunächst um einen amerikanischen Comedian.
»Aber es gibt doch ein Recht auf Arschlochsein«, sagte sie gerade zum zweiten Mal. »Wenn ein Mann während eines Telefonats onaniert, kann man doch auflegen. Man muss doch nicht dranbleiben und abwarten, bis er kommt. Niemand zwingt einen. Die sind ja nicht mal im selben Raum.«
»Aber Henriette, das meinst du doch nicht ernst jetzt.«