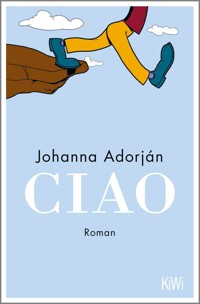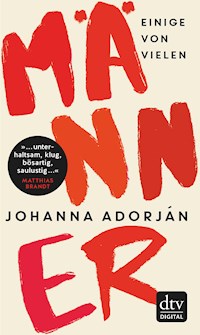Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jessica trifft Tom, der schön ist und ein bisschen geheimnisvoll. Sie kommen zusammen, doch gerade, als sie die Nähe zulässt, stößt er sie wieder ein Stück von sich. Und während sie immer mehr um ihn kreist, scheint er seine Zuwendung freigebig zu verstreuen. Spielt er ein Spiel? Ist seine Unverbindlichkeit eine Art, Macht über sie zu erlangen? Oder bietet er ihr eine Liebe, die freier ist und ehrlicher? Frau trifft Mann und verliebt sich in ihn: Es ist die älteste Geschichte der Welt, doch Johanna Adorján erzählt sie ganz direkt und nüchtern, wie zum ersten Mal. Es ist eine Geschichte darüber, wie sich Liebe und Freiheit zueinander verhalten. Und wann sich Liebe in etwas Dunkles verwandelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Eine Frau trifft einen Mann und sie verliebt sich in ihn. Es ist die älteste Geschichte der Welt, doch Johanna Adorján erzählt sie ganz direkt und nüchtern, wie zum ersten Mal. Es ist eine Geschichte darüber, wie sich Liebe und Freiheit zueinander verhalten, wenn man alles darüber weiß und es einen doch wieder erwischt. Die Geschichte einer großen Sehnsucht und einer Befreiung.
Hanser Berlin E-Book
JOHANNA ADORJÁN
Geteiltes Vergnügen
Roman
Hanser Berlin
ISBN 978-3-446-25216-5
© Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag München 2016
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Greiner & Reichel, Köln
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
TEIL EINS
ZULETZT SAH ICH ihn gestern Nacht. Er trug ein dunkles Hemd, er hielt sich aufrecht, nur wenn man genau hinsah, konnte man erkennen, dass er komplett verloren war. Für weniger aufmerksame Beobachter mag es ausgesehen haben, als sei er einfach nur sehr betrunken. Seine Augen waren wie hinter einem Schleier. Manchmal wankte er leicht oder hielt sich ein bisschen zu lange am Arm der Person fest, die gerade neben ihm stand. Und ständig waren Frauen um ihn herum und strichen ihm über den Kopf und umarmten ihn und hielten ihn kurz. Obwohl er so viel größer war als sie alle. Obwohl er nicht zu halten war.
Ohne Zigarette kann ich ihn mir gar nicht vorstellen. Irgendwo ist immer eine mit im Bild, steckt ihm brennend im Mund oder zwischen den Fingern oder, in Räumen, in denen Rauchen verboten ist, schon griffbereit hinterm Ohr.
Er ist lang und schlank, und seine typische Körperhaltung ist leicht nach vorne gebeugt oder zumindest mit eingezogenem Kopf, als wolle er niemandem mit seiner Größe auf die Nerven gehen. Seine verwaschen blonden Haare trägt er im Winter kurz und lässt sie dann wachsen, bis sie ihm über die Augen fallen und er sie sich ständig aus der Stirn streicht, was er mit einer schwungvollen und zugleich zärtlichen Bewegung tut. Er strahlt etwas Sorgloses, Verschwenderisches aus, und dazu passt, wie er sich anzieht – nach Urlaub irgendwie, helles Hemd, die Ärmel aufgekrempelt, großer Kragen.
Und dann wieder kann er unendlich verlassen aussehen. Wie einer dieser blassen jungen Männer auf einem Elizabeth-Peyton-Porträt. Eher elend als hübsch, todernst und unrettbar allein. Ich glaube, es liegt an seinen Augen. Sie sind blassblau, und manchmal scheinen sie wie aus einer weiten Ferne aufzutauchen und erst allmählich und ohne große Anteilnahme die unmittelbare Umgebung wahrzunehmen. Als ich diesen Blick die ersten Male bemerkte, fand ich ihn auf eine anziehende Weise arrogant. Doch je länger ich ihn kannte, desto erdrückender wurde die Traurigkeit, die ich darin sah.
Und gestern Nacht sah er mich noch einmal an. Für einen undeutlichen Moment ruhte sein Blick auf mir, aber es schien keine besondere Erinnerung daran geknüpft zu sein. Dann murmelte er »See you around«, drehte sich um – und war fort.
*
Sommer, vor einem Jahr. Ein warmer Abend, eine Geburtstagseinladung, ein langer Tisch auf dem Bürgersteig vor einem Restaurant. Er kam spät, und alle, die ihn kannten, schienen geradezu erleichtert, ihn zu sehen. Als könnte die Party nun endlich beginnen. Ich hatte von ihm gehört. Wir bewegten uns in denselben Kreisen, aber er bewegte sich schneller, war jedes Mal schon wieder fort, wenn ich kam. Nur sein Name hing dann noch im Raum, so oft wurde sich gegenseitig wiederholt, was er gesagt hatte oder getan. Hast du gehört, was Tom … Tom … dieser Geiger … Tom Natanson.
Sein Vater war ein bekannter Pianist, der in den späten fünfziger und den sechziger Jahren als einer von wenigen Amerikanern (wenn auch russischer Abstammung) jenseits des Eisernen Vorhangs Konzerte gab; ein Auftritt 1962 in Budapest, bei dem er Gershwin als Zugabe spielte, gilt heute noch als legendär. Dessen Vater wiederum war ein noch bekannterer Dirigent gewesen. Mir persönlich bedeutete allerdings seine Mutter mehr – die Essayistin und Drehbuchautorin Jill Bachner Natanson, deren (seltene) Texte im New Yorker ich so liebte.
Und hier war nun ihr Sohn.
Eine Weile lang unterhielt er sich im Stehen mit der Gastgeberin, und wie er sich ihr dabei zuwendete, wie er sich, wann immer sie etwas sagte, mit dem Oberkörper zu ihr neigte, als wolle er keine Silbe verpassen, schien sie auf einmal eine faszinierende Gesprächspartnerin zu sein. Es kam mir vor, als hätten alle am Tisch gerne gehabt, dass er sich neben sie setzen würde. Ein zusätzlicher Stuhl wurde organisiert, und er landete zwei Plätze von mir entfernt. Zwischen uns eine Frau, die so schön war, dass ich verstehen konnte, dass er sich nur für sie zu interessieren schien. Auch wenn ich es schade fand, das schon.
Noch etwas später kam seine Freundin nach. Sie arbeiteten zusammen. Sie waren Geiger und unterrichteten gemeinsam an der Musikhochschule. Die Freundin strahlte Ruhe und Ernst aus, und es schien ihr nichts auszumachen, dass sie einen Platz ganz am anderen Ende des Tisches bekam, wo keines der Gespräche je ankam. Sie hatte kurze dunkle Haare, ein ebenmäßiges, ungeschminktes Gesicht und war ebenso schlank wie er, vielleicht etwas drahtiger. Sie hieß wie ich: Jessica.
Nach Mitternacht wurde der Ort gewechselt, und alle, die noch nicht nach Hause gegangen waren, landeten im Hof eines Restaurants, wo wir uns auf den Stufen einer kurzen Treppe versammelten. Ich habe ein Foto davon. Ich sitze rechts – neben mir, mit einigem Abstand, die andere Jessica, aber wir scheinen keine Notiz voneinander zu nehmen. Ich schaue zur Seite, lache irgendjemanden an, von dem nur ein Hosenbein zu sehen ist. Meine Wangen sind gerötet, und ich sehe aus, als versuchte ich, sehr glücklich zu sein. Die andere Jessica betrachtet lächelnd ihr Knie. Tom steht genau hinter mir. Sein Kopf ist oben abgeschnitten, aber ich erkenne ihn an seiner Hand. Er spricht gerade mit jemandem, dem er einen Arm gestikulierend entgegenstreckt, die Finger gekrümmt, als halte er einen Bogen. Zwischen uns auf dem Boden liegt sein Geigenkasten aus Leder, dem anzusehen ist, dass er viele, viele Jahre lang herumgetragen worden ist.
Irgendwann saß er neben mir. Ich mochte ihn gleich. Er hatte eine angenehme Stimme und eine Art, rasant in Sätze hineinzustolpern und sie dann mittendrin abzubrechen, als hinge ein verlängerter Gedankenstrich in der Luft. Das gab seinem Gegenüber Gelegenheit, etwas einzuwerfen, woraufhin er seinen Satz möglicherweise anders beendete als ursprünglich vorgehabt, in der liebenswürdigen Absicht, sich letztlich einig zu sein. Es hatte etwas Spielerisches, das mir gefiel. Dann gerieten wir in andere soziale Zusammenhänge, und als ich irgendwann aufbrechen wollte und nach ihm suchte, um mich zu verabschieden, war ich enttäuscht, feststellen zu müssen, dass er schon gegangen war.
Kurze Zeit darauf war ich mit Aniko wieder im selben Restaurant. Es wurde spät, und wir wollten gerade gehen, als sie einen Anruf erhielt. Es war Tom, offenbar lose mit ihr verabredet, offenbar bereits auf dem Weg zu uns. Aniko sah aus, als wäre das eine sensationelle Nachricht. Ich war müde und wollte eigentlich ins Bett, aber da war er schon, kam durch die Tür, wieder in einem weißen Hemd. Und mit seinem Erscheinen schien sich der Energielevel im ganzen Raum zu heben, mit einem Schlag war ich überhaupt nicht mehr müde, sondern froh, noch hier, wach und am Leben zu sein.
Er hatte Kokain dabei, was ich nicht erwartet hätte (ein Klassik-Musiker?), und wir nahmen zu dritt welches, wobei ich wie immer fand, das Elektrisierende daran waren die Minuten davor. Der gemeinsame Gang zur Toilette, das verschwörerische Moment, plötzlich eine Gruppe geworden zu sein, ein kleiner Kreis Eingeweihter mit einem sehr klar umrissenen gemeinsamen Ziel. Erstaunlicherweise schien sogar die seelenlose Droge Kokain durch Toms Gegenwart eine optimistische Qualität anzunehmen.
Ich glaube, noch auf dem Klo fanden wir heraus, dass wir beide, Tom und ich, von der Seite unserer Väter her (der falschen) jüdisch waren. Seine Mutter war ebenfalls väterlicherseits jüdisch, was mich freute, weil ich das Gefühl hatte, ihr dadurch näher zu sein. Vielleicht lag es auch daran, dass Aniko nicht mitreden konnte, jedenfalls fühlte es sich fast wie Verwandtschaft an.
Ich glaube, ich war es, die an jenem Abend vorschlug, noch weiterzuziehen, als das Restaurant irgendwann schloss. Wir gingen in eine kleine Bar in der Nähe, die wir aber zu voll und zu laut fanden, weshalb wir sie direkt durch die Hintertür wieder verließen, die auf einen Hof führte, von dem aus wir über einen Zaun in den Nachbarhof stiegen, wo Tische und Bierbänke standen und Leute herumsaßen und tranken. Wir setzten uns dazu, bestellten eine Runde Drinks und dann noch eine Runde – und plötzlich schlug die Stimmung um.
Zuerst küsste sie mich. Dann küsste ich ihn. Dann küsste er sie. Und von da steuerte das Gespräch zwischen Tom und Aniko in eine Richtung, die ich seltsam fand, weil es so nüchtern ums Organisatorische ging. Ganz pragmatisch wurde besprochen, zu wem wir nun gehen würden. Toms Wohnung kam nicht in Frage, weil seine Freundin dort schlief. Anikos war zu weit weg. Blieb nur eine Möglichkeit, aber sosehr sie auch versuchten, mich zu überreden, er von links, sie von rechts, und obwohl ich mich von beiden so begehrt fühlte, dass ich tatsächlich fast nachgab – ich blieb bei meinem Nein. Nein, nicht heute, wo es schon so spät war, dass es fast wieder hell wurde. Nein, lieber nicht, nein, wirklich nein. Doch als ich kurz darauf nach Hause radelte, dachte ich: Vielleicht ein andermal, warum eigentlich nicht?
Zwei Straßenecken von der Bar entfernt holte Tom mich ein. Er war mir mit seinem Rad gefolgt und fragte, ob er noch einen Kuss haben könne. Er fragte es fast ein wenig scheu. Also küsste ich ihn, obwohl ich lieber gehabt hätte, wenn er mir nicht nachgekommen wäre, ich wollte hauptsächlich nicht unhöflich sein. »Aber du hast doch eine Freundin«, sagte ich. Ich weiß nicht mehr, was er darauf antwortete; höchstwahrscheinlich hat er gar nichts gesagt.
Ein paar Tage später, an einem Abend, der so warm war, dass man hinter jeder Straßenecke das Mittelmeer vermutete, traf ich meine Freundin Roni zum Essen. Wir hatten einen der kleinen Tische auf dem Bürgersteig, entlang der Längsseite des Restaurants. Ich merkte erst, dass Tom direkt hinter mir saß, Rücken an Rücken, als er irgendwann an unserem Tisch vorbeilief, um ins Haus zu gehen. Als er wieder rauskam, begrüßten wir uns. Ich sah mich um, neugierig, mit wem er da war. Neben ihm saß seine Freundin, Jessica, die mir freundlich zunickte. Die Frau ihnen gegenüber war so eindeutig Toms Mutter, dass er sie nicht hätte vorstellen müssen, was er nun tat. Sie hatte die gleichen vollen Haare (nur in lang), das gleiche verschmitzte Lächeln, und sie strahlte auch dieses Selbstvertrauen aus, das sich nicht spielen lässt, so eine Art grundsätzliches Einverstandensein mit der Welt. Sie sah nett aus, aber anders, als ich mir Jill Bachner Natanson vorgestellt hatte – perfekter geföhnt, amerikanischer, irgendwie teurer.
Die schönste Geschichte, die ich von ihr gelesen hatte, war ihre Erinnerung an eine Reise nach Chile, die sie als junge Reporterin unternommen hatte. Sie war damals im sechsten Monat schwanger gewesen und gegen den Rat ihres Arztes gereist. In einem schäbigen Hotelzimmer hatte sie in der ersten Nacht eine Fehlgeburt. Ganz allein brachte sie einen kleinen Jungen zur Welt, und obwohl er blau angelaufen war, als sie ihn aus sich herauszog, hatte sie nie zuvor etwas so Schönes gesehen. Ein paar Momente lang lebte er in ihrer Hand. Sie sahen sich an, verwundert und erstaunt. Dann hörte sein winziges Herz auf zu schlagen.
Ich hatte die Geschichte mehrmals gelesen und jedes Mal wieder geweint.
Ich drehte mich wieder zu Roni und flüsterte ihr zu, wer die Frau war, die da am Nebentisch saß. Aber sie las den New Yorker nicht und hatte noch nie von Jill Bachner Natanson gehört, und den restlichen Abend sprachen wir dann über meinen Exfreund, Nicolas. Dass er sich von mir getrennt hatte, fühlte sich immer noch wie ein Irrtum an. Ich trank zu viel Rosé in dieser Nacht, und ich weinte und machte ein Foto von Roni, die ein umwerfendes Lächeln hat, und sie machte eines von mir, weshalb ich noch weiß, dass ich ein rotes Kleid trug. Ich merkte nicht, dass in meinem Rücken nach der Rechnung gefragt, gezahlt und gegangen wurde. Doch als wir aufstanden, Roni und ich, waren all die anderen Tische und Stühle längst weggeräumt, und dort, wo Tom, Jessica und seine Mutter gesessen hatten, war nur noch leerer, dunkler Bürgersteig.
In den nächsten fünf Monaten sah ich Tom nie. Drei davon verbrachte ich in Paris, wo ich mir ein winziges Apartment gemietet hatte, ganz oben in einem siebten Stock, das außer einem Cinemascope-Blick über ein Meer aus graublauen Dächern nicht viel zu bieten hatte. Dafür war in der Ferne klein der Eiffelturm zu sehen. Meine Wohnung lag in derselben Gegend wie die von Nicolas, aber ich redete mir (und besorgten Freunden) ein, dass ich nicht etwa wegen, sondern trotz ihm in seiner Stadt war. Meistens war ich allein. Allein und unglücklich in Paris, das sich nirgends so sehr vermissen lässt wie in Paris. An jeder Straßenecke musste ich damit rechnen, Nicolas zu begegnen, womöglich mit seiner neuen Freundin, die zu dieser Zeit allerdings schon längst nicht mehr neu genannt werden konnte, jedenfalls nicht ernsthaft.
Tagsüber arbeitete ich an einem Roman. Er sollte, beginnend mit dem Ende, eine Trennungsgeschichte rückwärts nacherzählen, die Protagonistin hatte in jedem Kapitel eine andere Haarfarbe. Ich wollte ihn »Momente & Lügen« nennen. Mein Exposé war so überzeugend gewesen, dass ich bereits einen Verlag gefunden und die Hälfte meines Vorschusses ausbezahlt bekommen hatte. Doch seit der Vertragsunterzeichnung war ich wie gelähmt. Tagelang saß ich an einem Satz wie »Von Dienstag bis Samstag ging sie einfach nicht ans Telefon, sah niemanden, verließ das Haus nur, um Zigaretten zu holen, und lag ansonsten auf diversen Sofamöbeln herum« – nur um ihn anschließend wieder zu löschen.
Abends ging ich ins Kino. Ich trank ziemlich viel Rotwein in dieser Zeit. Irgendwann in diese Einsamkeit eine Nachricht von Tom: »You are hard to find. Can we do something about that?«
Als ich zurück in München war, wieder Wochen später, rief er mich an. Ob ich Lust hätte, mit ihm am Abend etwas trinken zu gehen? Doch ich war bereits verabredet, und wir vereinbarten, uns ein andermal zu sehen. Bald. Es war ein angenehm unkompliziertes, kurzes Gespräch, und obwohl ich ungern am Telefon Englisch spreche, fühlte ich mich nach dem Auflegen beschwingt. Wie ich gehört hatte, waren er und seine Freundin mittlerweile getrennt.
Tatsächlich hatte ich am Abend so etwas wie ein Date. Er hieß Marc. Ich hatte ihn bei einem Essen von gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Schauspieler. Eigentlich Theater, aber hauptsächlich Werbung. Er sah gut aus, fast zu gut, wie die Karikatur eines gutaussehenden Mannes: dunkelhaarig, breitschultrig, auffallend weiße Zähne. Wir hatten uns kurz nett unterhalten, ohne dass mir in Erinnerung geblieben wäre, worüber, aber sein Lachen hatte ich noch im Ohr. Es war dunkel und mit viel Zwerchfell, fast wie gesungen. Beim Abschied hatte er mich nach meiner Nummer gefragt.
Bestimmt sechs Nachrichten waren zwischen uns hin und her gegangen, bis der Ort des Treffens festgelegt war. Ein neuer Japaner im Glockenbachviertel. Es sei wahnsinnig schwierig gewesen, überhaupt noch eine Reservierung zu bekommen. Hinter diesen Satz hatte er ein Smiley gesetzt, dessen Bedeutung ich nicht verstand.
Ich wartete vor dem Eingang auf ihn. Er trug eine Wollmütze, die er den ganzen Abend nicht abnehmen sollte. »Grüß dich«, sagte er. Seine Wangen fühlten sich frisch rasiert an, und er roch nach einem Parfüm, das ein Exfreund von mir benutzt hatte, der psychisch ein wenig labil gewesen war. Ich musste an das kleine, mit viel Türkis eingerichtete Zimmer in einer Privatklinik am Bodensee denken, in der ich ihn besucht hatte, kurz nachdem wir eine »Pause« vereinbart hatten, die rückblickend das Ende gewesen war. An seine Zimmertür hatte er das berühmte National Geographic-Foto der jungen Afghanin mit den weit aufgerissenen hellgrünen Augen gehängt. Ich hatte überhaupt nichts verstanden. Nicht das Bild, nicht den Klinikaufenthalt, nicht das Parfüm.
»Es soll hervorragenden Sake hier geben«, sagte Marc auf dem Weg ins Restaurant, das sich im Erdgeschoss eines Neubaus befand, in dem es nach Zahnarztpraxis roch. »Ich hoffe, du trinkst Alkohol.« Das Entree war mit Kies ausgelegt, was das Gehen auf hohen Absätzen etwas erschwerte. Von irgendwo her war leises Rauschen zu hören, wie von einem Bach. Marc steuerte zügig auf den Empfangstresen zu, von dem uns zwei Männer in Anzügen schon geduldig entgegenlächelten. »Ich habe reserviert. Zwei Personen, 18 Uhr 45.«
Die Männer klappten ein in schwarzes Leder gebundenes Buch auf, versenkten sich kurz darin, und einer malte mit einem Bleistift ein paar Striche hinein. »Wenn Sie meinem Kollegen bitte zu Ihrem Tisch folgen mögen.« Der Raum war dunkel, die Tische nur punktuell durch Halogenstrahler beleuchtet. Wir waren die einzigen Gäste. Es war so leise, dass ich irgendwann merkte, dass ich versehentlich den Atem anhielt.
Der Kollege rückte die Stühle für uns zurecht und entfernte sich. Kaum war er verschwunden, tauchte von der anderen Seite eine sehr hübsche junge Japanerin auf. Sie trug eine schwarze Kittelschürze über ihrer weißen Bluse und platzierte freundlich zwei Speisekarten auf den Tisch. »Let me explain the concept«, sagte sie in breitem Amerikanisch, das eine Zahnspange enthüllte, und erklärte dann, dass empfohlen werde, das Menü zu bestellen. Man könne selbstverständlich auch einzelne Speisen bestellen, allerdings würde sie in diesem Fall zu mindestens drei Gerichten raten, da die Portionen nicht allzu üppig seien. Und schon war sie wieder weg, irgendwohin in der Dunkelheit verschwunden.
»Entschuldigen Sie«, rief Marc in keine bestimmte Richtung. »Excuse me, hello, sorry?« Beinahe augenblicklich tauchte wiederum von der anderen Seite eine neue japanische Bedienung auf und lächelte fragend. »I would like to order something to drink«, sagte Marc. »What kind of Sake do you … hello?«
Die Frau hatte sich, während er sprach, unter Andeutung einer Verbeugung rückwärts aus unserem Blickfeld zurückgezogen. Dafür erschien von der anderen Seite der Mann, der uns zum Tisch geführt hatte, und reichte eine Getränkekarte in unser Lichtfeld.
Marc sah mich an, als wolle er etwas sagen, sagte dann aber nichts.
Schweigend versenkten wir uns in die Karten. Es war ein ziemlich teures Restaurant.
»Bisschen wie in einer Klippklappkomödie, oder?«, sagte ich irgendwann.
»Was, warum?«
»Bisschen wie in der Komödie im Bayerischen Hof, wo dauernd jemand von einer anderen Seite kommt, oder?«
»Ich hab da auch schon mal gespielt.«
»Ja, ich meine es ja gar nicht kritisch. Nur weil dauernd jemand Neues von der Seite kommt.«
»Das ist unheimlich schwer, eine richtig gute Boulevardkomödie zu machen. Das will ich erst mal sehen, ob« – er nannte den Namen eines Schauspielers, der gerade als Hauptdarsteller in großen Shakespeare-Dramen an den Kammerspielen für ein ausverkauftes Haus sorgte – »das könnte.«
»Ich habe es ja gar nicht kritisch gemeint, eigentlich ganz neutral.«
Wir sprachen dann über etwas anderes, wir bestellten, und bis die Vorspeisen gebracht wurden, die, weil Marc nicht so großen Hunger hatte, alles war, was wir genommen hatten, unterhielt er mich mit Witzen. Von allen Dialekten, die er konnte, machte ihm Fränkisch sichtlich am meisten Spaß.
»Ist dir nicht heiß unter der Mütze?«, fragte ich, denn ihm stand etwas Schweiß auf der Stirn, aber er antwortete auf etwas anderes.
Das Essen war gut, aber nicht besonders, und als ich nach Salz fragte, brachte man mir mit feierlicher Geste eine Flasche mit einer durchsichtigen Flüssigkeit darin, die ich bitte auf meine Speise sprühen möge. »Dies verwenden wir statt Salz«, sagte der Kellner, wieder der erste, »es ist bekömmlicher.« Leider aber war es kein bisschen salzig.
Irgendwann, vielleicht ging es mit dem Anbrechen des dritten kleinen Tonkrugs Sake einher, fing Marc damit an, mir, immer wenn ich etwas sagte, was er offenbar für komisch oder bemerkenswert hielt, eine Hand hinzuhalten, damit ich sie abklatschte. »Du magst Facebook nicht? Gimme Five!« – »Du hast Angst vor dem Song ›Obladi Oblada‹? Hahaha, das ist gut.« Einmal ergriff er meine Hand nach dem Einschlagen und ließ sie dann mehrere Sätze lang nicht mehr los.
»Sag mal, und wie kommt es, dass du keinen Freund hast?«
»Keine Ahnung? Ist halt gerade so.«
»Aber wie kann denn das sein? Einer Frau wie dir müssten die Typen doch eigentlich die Tür einrennen.«
Ich erklärte ihm, dass es ja nicht immer daran liege, dass es keine Männer gebe, die sich für einen interessierten, sondern dass man doch schon einen wolle, in den man sich verlieben könne. Und dann sei es natürlich auch immer eine Frage von Zufall, ob und wann man jemanden träfe. Liebe sei schließlich immer auch eine Frage des Timings.
»Zufall gibt es nicht«, sagte er und schüttelte ernst den Kopf.
»Doch. Klar gibt es Zufall.«
»Nein.«
»Doch.«
»Nein. Wenn ich etwas weiß, dann, dass es keine Zufälle gibt. Alles, was uns geschieht, kreieren wir selbst. Alles, was wir erleben, kreieren wir durch unseren Willen.«
Ich sagte dasselbe, was ich an dieser Stelle immer sage.
»Wie, und was ist dann mit dem Holocaust?«, wiederholte er. »Was soll mit dem Holocaust sein?«
»Haben also sechs Millionen Juden es selbst kreiert, dass sie ermordet wurden?«
»Nein, das will ich natürlich nicht …«
»Das hast du aber gerade …«
»Nee, was ich gesagt habe …«
Wenig später textete ich Tom, dass ich doch noch Zeit hätte diesen Abend. Sekunden später hatte ich seine Antwort: »Meet me at the bar downstairs my house«, mitsamt Adresse.
Er stand vor der Tür. Zigarette, weißes Hemd, Drink in der Hand. Als er mich kommen sah, nahm er einen letzten, schnellen Zug, schnippte die Zigarette weg und kam auf mich zu. »Jessica.« Ich mochte, wie er meinen Namen aussprach. Mit deutschem J, aber es klang trotzdem anders als sonst. Es klang neu. »Ich habe eine sehr wichtige Frage an dich«, sagte ich und nahm mir vor, mit den Konsonanten etwas sorgfältiger umzugehen. Er sah mich ernst an. »Glaubst du an Zufälle?«
»Du meinst, generell?«
»Ja. Glaubst du, es gibt so etwas wie den Zufall, oder gestaltet jeder von uns sein Leben mit allem, was passiert, selbst.«
»Natürlich gibt es Zufälle«, sagte er, »jede Menge.«
»Dann: Hallo.«
Wir gingen rein, er besorgte mir auch einen Gin Tonic, und wir setzten uns an einen der kleinen Tische, genauer: den einzigen, der noch frei war, mit exakt zwei Stühlen daran (was wir für einen schönen Zufall hielten), und ich offenbarte ihm, dass ich ein großer Fan seiner Mutter war. Er nickte nur. »Aber kein so großer wie ich.« Wir stritten uns kurz im Spaß, wer von uns beiden seine Mutter mehr bewunderte. Er gewann. Haushoch.
»Und gab’s nie mal ne Phase, wo du rebelliert hast?«
»Es ist eher wahrscheinlich, dass sie noch gegen mich rebellieren wird, so schockierend oft, wie ich sie anrufe.«
»Wie oft?«
»Zuletzt, bevor du kamst. Und das ist dein Glück, muss man sagen, denn ich hatte bis zu diesem Anruf richtig schlechte Laune. Das passiert mir echt selten, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los war, aber irgendwie war ich schlecht drauf.«
»Und dann hast du mit deiner Mutter telefoniert …«
»Ich sollte sie eigentlich noch viel öfter anrufen. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber sie macht mir immer gute Laune.«
Er fragte mich, an was ich gerade arbeite, und interessierte sich sehr für mein Buch. Er fragte, wo ich wohne. Ob ich Geschwister habe. Was der mache. Was mein Vater von Beruf sei. Er fand Lektor einen guten Beruf.
»Und deine Mutter?«
»Die illustriert Kinderbücher. Und sie gibt Malkurse.«
»Wie schön. Ich kann überhaupt nicht malen. Du?«
Ich erzählte ihm, dass ich mit zehn Jahren einmal an einem Malwettbewerb teilgenommen und einen Preis gewonnen hatte. Die Verleihung war öffentlich gewesen. Es gab nur drei Preise, und die waren irgendwann alle an andere Kinder verliehen. Doch dann wurde feierlich verkündet, dass die Jury beschlossen habe, noch einen zusätzlichen Preis zu vergeben. Den Preis für das allerschlechteste Bild.
»Das ist grausam«, sagte er, »das tut mir sehr leid.«
»Danke, ich bin mehr oder weniger darüber hinweg.«
Ich fragte ihn nach seinen Kindheitstraumata, und er erzählte von einem Wellensittich, über dessen natürlichen Tod er so untröstlich gewesen war, dass seine Eltern ihn zum Tierpräparator gebracht hätten. Jimmy, so hieß er, habe dann noch viele Jahre lang neben seinem Bett auf dem Regal gestanden. Eigentlich genauso wie immer, nur etwas stiller vielleicht. Insofern ideal.
»Du hattest einen toten Vogel neben dem Bett?«
»So darfst du das nicht sagen. Es war immer noch Jimmy. Kennst du dieses tolle Geschäft in Paris, Deyrolle?«
Kannte ich nicht.
Er stand auf. »Komm, wir gehen kurz eine rauchen, dann erzähle ich dir davon.« Er trat hinter mich, nahm meinen Mantel von der Stuhllehne und hielt ihn mir fertig zum Hineinschlüpfen hin.
»Ja, aber meine Tasche.«
»Die lässt du hier.«
»Ja, meinst du? Einfach auf dem Tisch? Meinst du echt?«
»Ich lasse meinen Geigenkasten auch hier. Ich lasse den immer überall. Da passiert nie etwas.«
»Aber da ist alles drin.«
»Warte.« Er ging zu seinem Kasten, der neben dem Tisch auf dem Boden stand, nahm seine Geige heraus und legte sie auf meine Tasche. Er überprüfte, dass sie sicher lag. »So.« Dann hielt er mir angewinkelt seinen Arm hin, damit ich mich bei ihm unterhaken konnte.
Es war jetzt sehr kalt draußen, aber er schien in seinem Hemd nicht zu frieren. Er bot an, einen Schal für mich aus seiner Wohnung zu holen. Er sagte etwas Nettes über meine Locken. Er fand meine Meinung, ausgestopfte Tiere seien das Letzte, ein bisschen hart, aber nicht verkehrt. Und war so höflich, mich nicht auf den Widerspruch hinzuweisen, als ich hinzufügte, einen ausgestopften Flamingo hätte ich aber schon gerne im Bad. Er gab mir das Versprechen, mich niemals an seiner Zigarette ziehen zu lassen, und ließ mich etwas später wirklich nicht an seiner Zigarette ziehen. Er fragte mich, was für Filme ich mochte. Er fragte mich, wie ich zum Journalismus gekommen war. Er ließ »Zufall« als Antwort gelten.
»Schau, da wohne ich jetzt.« Er machte ein paar Schritte zur Straße hin und zeigte mit dem Finger nach oben.
»Wo? Ganz oben?«
»Eines drunter. Das große Fenster.«
Es war ein sonderbares Haus. Ein Komponist, mit dem Tom befreundet war, hatte es bauen lassen und wohnte auch darin. Von der Straße wirkte es abweisend – mehrere Stockwerke übereinandergeschichtete graue Betonplatten, deren Oberflächenstruktur aus der Nähe eine Maserung aufwies, in der sich Licht fing und spiegelte, weshalb das Grau zu funkeln schien. Die Fenster waren unterschiedlich groß und alle zur selben Seite hin von angewinkelten Betonschrägen verdeckt, die wie Haifischflossen aus dem Gebäude herausragten. Näherte man sich dem Haus von der einen Seite, wirkte es fensterlos. Von der anderen sahen die Fensterscheiben wie grimmige Schlitze aus, manche fast so klein wie Schießscharten, andere waren groß genug, dass die Spiegelung des gegenüberliegenden Gebäudes darin zu sehen war.
»Soll ich es dir zeigen?«
Es gab keine Klingel. Das Haus konnte nur von der Rückseite aus betreten werden. Man musste zunächst durch eine dunkle Einfahrt hindurch, um hinten den gläsernen Aufzug zu finden, der in einem silbernen Aluminiumkäfig geräuschlos die Rückfassade bis nach oben fuhr. In den unteren Stockwerken befanden sich Büros und die kleine Bar. Nur die oberen beiden Stockwerke waren bewohnt – von dem Komponisten, und, seit damals erst wenigen Tagen, von Tom.
Ich glaube, bei diesem ersten Mal bemerkte ich gar nicht, dass auch der Boden des Aufzugs aus Glas war. Bei Tageslicht konnte einem schwindlig werden, wenn man während der Fahrt nach unten sah. Der Komponist war nicht da, da waren nur Tom und ich, und ich folgte ihm durchs dunkle Innere. Irgendwo kamen Treppen vor, die wir hinabliefen, und wir durchquerten einen engen Nicht-Raum, in dem später sein Esstisch stehen würde, um in das Zimmer zu gelangen, in dem er schlief.
Es gab keine Tür. Die Wände waren grau. Die Decke so hoch, dass der Raum höher war als lang. Wir setzten uns auf eine schmale Couch, auf der weißer Filz lag oder ein anderer kratziger Stoff. Er erklärte mir, dass sie der ehemaligen Freundin des Komponisten gehöre, die kürzlich erst ausgezogen sei. Eine Sängerin, er nannte ihren Namen, ich hatte ihn sogar schon gehört. Ich erinnere mich, dass ich viel redete und Tom wenig und dass ich insgesamt immer negativer wurde, wie es mir seit der Trennung von Nicolas öfter passierte, wenn ich trank. Ein Künstler, den ich interviewt hatte, hatte in der Autorisierung das ganze Gespräch vergeigt; der Winter nervte mich, das Schumanns, Schauspieler, überhaupt München. Irgendwann unternahm ich einen unsinnigen Versuch, den kargen Raum wohnlicher zu gestalten. Ich arrangierte einige Bücher den Farben nach auf dem Tisch, trug eine Lampe von einer Seite auf eine andere, erklärte, alleine schon wegen der Akustik müsse hier ein Teppich rein. Er beobachtete mich, amüsiert.
»Und du und deine Freundin, ihr habt euch getrennt?«
»Ja, aber wir sind noch befreundet.«
»Wie macht ihr das?«
»Was meinst du?«
»Ich meine, wie bleibt man befreundet? Ich habe das nie hingekriegt, mit keinem meiner Exfreunde. Was ist das Geheimnis?«
»Es gibt kein Geheimnis«, sagte er. »Wir mögen uns einfach, das ist alles.«
Plötzlich war es zwei Uhr, und ich erschrak und wollte gehen. Tom begleitete mich zum Aufzug, den man nur von einem Stockwerk über oder unter seinem nehmen konnte. Seine Wohnung lag wie ein Versteck dazwischen. Ich habe nie ganz verstanden, wie viele Stockwerke es insgesamt waren, oder nahm manchmal an, ich wäre in einem, während ich in Wahrheit in einem anderen war. Es gab keine Türen zwischen ihnen, oder wenn es welche gab, standen sie immer offen. Im Inneren des Hauses war alles grau. Man konnte sich leicht verirren darin, es ist mir oft passiert.
War es in jener Nacht, dass ich nicht darauf achtete, wo ich entlanglief und diese eine große Stufe nicht bemerkte, die es in jedem Stockwerk gibt? Von ihren Proportionen her eher für lange Männerbeine gedacht als für meine. Jedenfalls stolperte ich bei einem meiner ersten Besuche über sie und verletzte mich an ihrer scharfen Kante am Schienbein. Es blutete, nur eine winzige Wunde, aber eine kleine Narbe ist bis heute zu sehen.