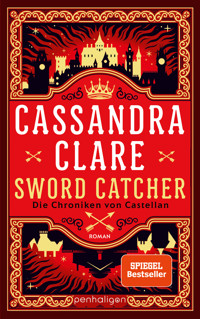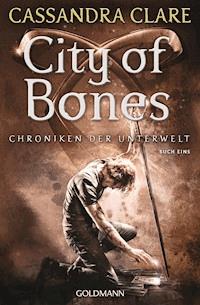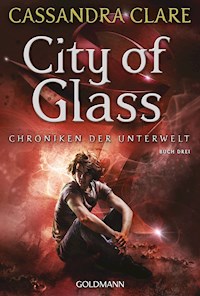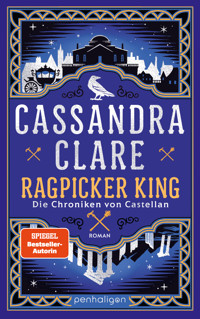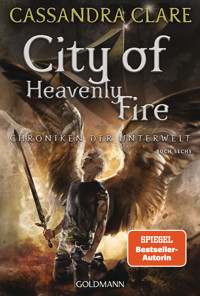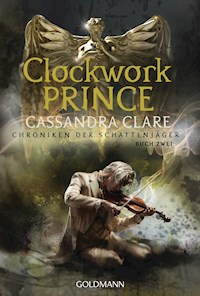
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chroniken der Schattenjäger
- Sprache: Deutsch
Tessa Gray glaubte, bei den Schattenjägern im Viktorianischen London endlich ein neues und sicheres Zuhause gefunden zu haben. Doch da stellen mysteriöse Hinweise auf ihre Herkunft plötzlich alles in Frage. Zumal sich andeutet, dass der ebenso düstere wie geheimnisvolle Magister einen Rachefeldzug gegen sie führt, der die gesamte Unterwelt zerstören könnte. Zerrissen zwischen ihren Gefühlen für den smarten Jem und den gutaussehenden Will begibt sich Tessa auf die gefährliche Suche nach der Wahrheit über sich selbst – und muss schmerzlich lernen, dass Liebe und Lügen ein hochexplosives Gemisch sind ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 886
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
In der düsteren, von magischen Wesen beherrschten Unterwelt des Viktorianischen Londons hat Tessa Gray Unterschlupf gefunden bei den Londoner Schattenjägern. Doch die vermeintliche Sicherheit trügt, denn das Misstrauen gegen Tessa und ihre Kräfte wächst auch in der Gemeinschaft der Schattenjäger. Ihre Beschützerin Charlotte, Leiterin des Londoner Instituts, droht abgesetzt zu werden – und dann wäre Tessa erneut dem skrupellosen Magister ausgeliefert, der sie in seine Gewalt bringen und ihre Fähigkeiten für seine dunklen Absichten nutzen will.
Um dem zuvorzukommen, plant Tessa mithilfe des gut aussehenden, aber selbstzerstörerischen Will und des sanften, ihr treu ergebenen Jem den wahren Plänen des Magisters auf den Grund zu gehen. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, die die Freunde von den Londoner Slums bis ins nebelverhangene Yorkshire, von einem prächtigen Herrenhaus bis zu einem verzauberten Ballsaal führt. Sie erfahren, wie zutiefst persönlich der Rachefeldzug des Magisters gegen die Schattenjäger ist und welch große Rolle Tessas eigene mysteriöse Herkunft dabei spielt. Und dass einer der Ihren die drei verraten haben muss, denn der Feind kennt jede ihrer Bewegungen …
Weitere Informationen zu Cassandra Clare
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Cassandra Clare
Clockwork Prince
Chroniken der Schattenjäger
BUCHZWEI
Roman
Deutsch von Franca Fritz und Heinrich Koop
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »The Infernal Devices. Book Two. Clockwork Prince« bei Margaret K. McElderry Books, an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York.
Erstmals auf Deutsch erschienen im Jahr 2012.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Neuausgabe November 2022
Copyright © der Originalausgabe 2011 by Cassandra Clare, LLC
Copyright © dieser Ausgabe 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Franca Fritz und
Heinrich Koop © 2012 Arena Verlag GmbH, Würzburg, www.arena-verlag.de
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Entwurfs von Russell Gordon
Umschlagmotiv: © Cliff Nielsen
Illustration Buchrücken: © 2015 by Nicolas Delort (Landschaft), Pat Kinsella (Figur)
Karte auf den Umschlaginnenseiten: Drew Willis
TH · Herstellung: ik
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-29216-4V001
www.goldmann-verlag.de
Für Elka
Chalepa ta kala
Ich wünsche, Sie mögen wissen, dass Sie der letzte Traum meiner Seele gewesen sind …
Seit ich Sie kennenlernte, quälte mich eine Reue, die mir sonst als eine Unmöglichkeit erschienen wäre, und ich hörte in mir alte flüsternde Stimmen mich aufwärts drängen, die ich für auf immer verstummt hielt. Es kamen mir längst entschwundene Gedanken von neuem Streben, einem neuen Anfang – von einem Abschütteln der Trägheit und Sinnlichkeit – von einer Wiederaufnahme des aufgegebenen Kampfes. Ein Traum, alles ein Traum, der mit nichts endet …
Charles Dickens, »Eine Geschichte aus zwei Städten«
Prolog
Die geächteten Toten
Dichter Nebel dämpfte jedes Geräusch und verhüllte die Sicht. Nur dort, wo sich die Schwaden gelegentlich lichteten, konnte Will Herondale die dunkle, allmählich ansteigende Straße erkennen; sie glänzte regennass. Und er konnte die Stimmen der Toten hören.
Nicht alle Schattenjäger vermochten das Flüstern der Geister wahrzunehmen – es sei denn, die Geister legten Wert darauf, gehört zu werden –, aber Will zählte zu den wenigen Nephilim, die diese besondere Gabe besaßen. Als er sich dem alten Friedhof näherte, schwollen die Stimmen zu einem rauen Chor an, heulend und flehend, schreiend und knurrend. Diese Begräbnisstätte war alles andere als friedvoll, was Will jedoch nicht weiter beunruhigte – er besuchte den Cross Bones Graveyard in der Nähe der London Bridge schließlich nicht zum ersten Mal. Angestrengt bemühte er sich, das gespenstische Heulen zu ignorieren: Er zog die Schultern hoch, klappte den Mantelkragen über seine Ohren und eilte mit gesenktem Kopf weiter, während der feine Sprühregen seinen schwarzen Haarschopf durchnässte.
Der Eingang zum Friedhof befand sich auf halber Strecke des Straßenzugs: ein doppelflügeliges, schmiedeeisernes Tor in einer hohen Steinmauer. Allerdings war das gesamte Areal vor den Augen irdischer Passanten sorgfältig verborgen – diese sahen nur überwuchertes Brachland, das zu einem nicht näher benannten Baugrundstück gehörte. Als Will sich dem Tor näherte, trat noch etwas aus dem Nebel hervor, das kein Irdischer hätte erkennen können: ein massiver Bronzetürklopfer in Gestalt einer Hand mit knochigen Skelettfingern. Mit spöttischer Miene nahm Will den Türklopfer, hob ihn an und ließ ihn schwer herabfallen – einmal, zweimal und ein drittes Mal, wobei jedes Mal ein hohles, metallisches Klirren durch die Nacht hallte.
Jenseits des Tors stiegen wabernde Schwaden aus dem Boden empor und verdeckten das Schimmern der herumliegenden Gebeine auf dem unwirtlichen Untergrund. Dann verdichtete sich der Dunst allmählich und begann, in einem unheimlichen Blau zu leuchten. Will legte die Hände um die Gitterstäbe des Tors; die Kälte des Metalls sickerte durch seine Handschuhe, drang ihm bis ins Mark und ließ ihn erschaudern. Bei den Frostwogen, die ihn umhüllten, handelte es sich jedoch nicht um eine herkömmliche Kälte: Aufsteigende Geister bedienten sich der Energie ihrer Umgebung, entzogen der Luft sämtliche Wärme. Will richteten sich die Nackenhaare auf, als sich der blaue Dunst langsam formte und die Gestalt einer Frau annahm – eine gebeugte Greisin in einem zerlumpten Kleid mit weißer Schürze.
»Hallo, Molly«, begrüßte Will die Alte. »Sie sehen heute Abend wieder besonders entzückend aus, wenn ich das einmal bemerken darf.«
Die gespenstische Erscheinung hob den Kopf: Die alte Molly war ein starker Geist, einer der stärksten, denen Will je begegnet war. Selbst im fahlen Mondlicht, das durch eine Lücke in der Wolkendecke fiel, erschien die Greisin kaum transparent. Ihr Körper wirkte nahezu massiv; gelblich graue Haare hingen in einem dicken Zopf über ihre Schultern, und sie hatte die rauen, geröteten Hände in die breiten Hüften gestemmt. Nur ihre Augen schienen hohl – zwei blaue Flammen flackerten in ihren Tiefen.
»William Herondale«, keckerte sie. »Schon zurück?« In einer für Geister typischen Weise glitt sie auf das Tor zu. Ihre nackten Füße starrten vor Dreck, obwohl sie den Boden nicht ein einziges Mal berührten.
Will lehnte sich gegen das Tor. »Ach, Sie wissen doch, wie sehr mir Ihr hübsches Gesicht gefehlt hat.«
Molly grinste, ihre Augen flackerten, und Will konnte den Schädel unter der durchscheinenden Haut erahnen. Die Wolkendecke über ihnen hatte sich nun geschlossen und verdeckte den Mond vollständig.
Gedankenverloren fragte Will sich, was die alte Molly wohl verbrochen haben musste, um hier bestattet zu sein, weit entfernt von geweihter Erde. Ein Großteil des Wehklagens, das um sie herum zu hören war, stammte von Prostituierten, Selbstmördern und Totgeburten – jenen geächteten Toten, die nicht in einem Kirchhof begraben werden durften. Allerdings verstand es Molly, ihre Lage auf recht lukrative Weise für sich zu nutzen, also machte es ihr vermutlich kaum etwas aus.
Die Alte lachte nun leise in sich hinein und fragte: »Was soll’s denn heute sein, mein kleiner Schattenjäger? Malphas’ Gift? Ich hätt da auch noch ’ne Klaue von Marax, sehr schön poliert, das Gift an der Spitze is’ vollkommen unsichtbar …«
»Nein«, unterbrach Will die alte Frau. »Deswegen bin ich nicht hier. Ich benötige Foraii-Dämonenpulver, und zwar fein gemahlen.«
Molly wandte den Kopf zur Seite und spuckte eine blaue Flamme auf den Boden. »Was will ein feiner junger Pinkel wie du mit so einem Zeug?«
Will seufzte innerlich: Mollys Protest war Teil des Handels. Magnus hatte ihn bereits mehrfach für Besorgungen aller Art zu der Alten geschickt: von stinkenden schwarzen Kerzen, die wie Teer an seiner Haut geklebt hatten, über Knochen eines ungeborenen Kindes bis zu einer Tüte mit Feenaugen, deren Blut ihm aufs Hemd getropft war. Im Vergleich dazu kam ihm Foraii-Dämonenpulver fast wie eine Wohltat vor.
»Du hältst mich wohl für ’ne Närrin«, fuhr Molly fort. »Das ist ’ne Falle, oder? Ihr Nephilim erwischt mich dabei, wie ich dieses Zeugs verkaufe – und dann heißt es ›Ab in den Bau mit der alten Molly‹, stimmt’s?«
»Sie sind bereits tot«, erwiderte Will bemüht ruhig. »Ich wüsste nicht, was Sie jetzt noch vom Rat zu befürchten hätten.«
»Pah!« Mollys hohle Augen flammten auf. »Im Verlies der Stillen Brüder, tief unter der Erde, können sowohl die Lebenden als auch die Toten eingekerkert werden; das weißt du genau, Schattenjäger.«
Will hielt beide Hände hoch. »Keine Tricks, großes Ehrenwort. Sie haben doch gewiss von den Gerüchten gehört, die in der Schattenwelt umgehen. Der Rat hat zurzeit andere Sorgen als die Verfolgung von Geistern, die mit Dämonenpulver und Feenblut handeln.« Er beugte sich vor und fügte mit gesenkter Stimme hinzu: »Ich zahle auch einen guten Preis.« Mit einer raschen Bewegung zog Will einen Batistbeutel aus der Tasche und wedelte damit durch die Luft, sodass der Inhalt klirrte wie aneinanderklappernde Münzen. »Sie entsprechen alle Ihrer Beschreibung, Molly.«
Ein begieriger Ausdruck huschte über Mollys totes Gesicht, und ihr Körper verdichtete sich hinreichend, dass sie den Beutel entgegennehmen konnte. Dann griff sie tief hinein und brachte eine Handvoll Ringe zum Vorschein: goldene Eheringe, jeder einzelne mit einem komplizierten Liebesknoten verziert. Wie viele Geister war auch die alte Molly ständig auf der Suche nach einem bestimmten Talisman, einem verlorenen Gegenstand aus ihrer Vergangenheit, der ihr endlich zu sterben erlauben würde – dem Anker, der sie noch in der hiesigen Welt gefangen hielt. In ihrem Fall handelte es sich um ihren Trauring.
Magnus hatte Will erzählt, dass man allgemein davon ausging, der Ring sei längst verloren, tief begraben im schlammigen Bett der Themse. Dennoch nahm Molly jeden Beutel mit gefundenen Ringen als Bezahlung entgegen – immer in der Hoffnung, dass sich ihr Ring vielleicht darunter befand.
Nun schob sie die Ringe wieder in den Beutel und ließ diesen irgendwo in den Falten ihres lumpigen Kleids verschwinden; als Gegenleistung überreichte sie Will ein gefaltetes Päckchen mit dem gewünschten Pulver.
Der junge Schattenjäger steckte das Päckchen in die Manteltasche, während die Greisin zu schimmern begann und allmählich verblasste. »Warte, Molly. Das ist noch nicht alles – ich bin aus einem weiteren Grund hier.«
Die gespenstische Erscheinung flackerte, während ihre Gier mit ihrer Ungeduld rang und sie Mühe hatte, sichtbar zu bleiben. Doch schließlich murrte sie: »Na gut. Was willste denn noch?«
Will zögerte. Hier ging es nicht um eine Besorgung, die Magnus ihm aufgetragen hatte – es handelte sich vielmehr um etwas, an dem er selbst großes Interesse besaß. »Einen Liebestrank …«
Die alte Molly brach in keckerndes Gelächter aus. »’nen Liebestrank? Für Will Herondale? Normalerweise hab ich gegen Geld nix einzuwenden, aber ein Jüngelchen, das so aussieht wie du, braucht keinen Liebestrank – so viel ist mal sicher.«
»Nein, nein, eigentlich suche ich nach dem genauen Gegenteil«, erwiderte Will, mit einem Anflug von Verzweiflung in der Stimme. »Etwas, das der Liebe ein Ende setzt.«
»’nen Hasstrank?« Molly klang noch immer amüsiert.
»Ich hatte eher gehofft, es gäbe vielleicht ein Mittel, das so etwas wie Gleichgültigkeit bewirkt? Duldsamkeit?«
Molly stieß ein verächtliches Schnauben aus, das für einen Geist erstaunlich menschlich klang. »Ich erklär dir das nur ungern, Nephilim, aber wenn du willst, dass ein Mädchen dich hasst, lässt sich das mühelos und auf mannigfache Weise bewerkstelligen. Aber dazu brauchst du meine Hilfe ganz bestimmt nicht – nich’ für dieses arme Ding.« Und damit löste sie sich endgültig auf und verschwand wieder im Nebel zwischen den Gräbern.
Will schaute ihr nach und seufzte. »Nicht für sie«, murmelte er, obwohl sich niemand in der Nähe befand, der ihn hätte hören können, »für mich …« Dann seufzte er erneut und lehnte resigniert den Kopf gegen die kalten Eisenstäbe des Friedhoftors.
1
Der Sitzungssaal
Gen Himmel strebten, reich verziert,
Gewölbe in vielerlei Bogen,
Und Engel schwebten hinauf und hinab
Mit Gaben, der Erde entzogen.
Alfred Lord Tennyson, »The Palace of Art«
»O ja. Sie sieht in der Tat so aus, wie ich sie mir vorgestellt habe«, sagte Tessa und wandte sich mit einem Lächeln dem jungen Mann an ihrer Seite zu. Er hatte ihr gerade über eine Pfütze geholfen, und seine Hand ruhte noch immer höflich auf ihrem Arm, knapp oberhalb ihres Ellbogens.
James Carstairs, in einem eleganten schwarzen Anzug, erwiderte ihr Lächeln, während der Wind sein silberhelles Haar hin und her peitschte. Seine andere Hand ruhte auf dem jadeverzierten Knauf seines Spazierstocks, und falls sich irgendjemand in der großen Menge um sie herum insgeheim über die Tatsache wunderte, dass ein derart junger Mensch eine Gehhilfe benötigte, oder über die Tönung seiner Haut und den Schnitt seiner Augen sinnierte, so hielt doch niemand inne, um ihn unverblümt anzustarren.
»Ich werte das als etwas Positives«, bemerkte Jem. »Ich habe mir allmählich schon Sorgen gemacht, dass sämtliche Attraktionen Londons in deinen Augen nichts weiter wären als eine Enttäuschung.«
Eine Enttäuschung. Tessas Bruder, Nate, hatte ihr einst das Blaue vom Himmel versprochen: London sei wundervoll, ein Neuanfang, ein fantastischer Ort zum Leben, eine Stadt mit großartigen Gebäuden und prachtvollen Parkanlagen. Stattdessen waren Tessa in der britischen Metropole jedoch fast ausschließlich Verrat und Schrecken begegnet und Gefahren jenseits ihrer Vorstellungskraft. Und dennoch …
»Nicht alles war eine Enttäuschung«, erwiderte sie und schaute lächelnd zu Jem auf.
»Das freut mich zu hören.« Sein Tonfall war ernst, nicht mokant.
Tessa wandte den Blick ab und betrachtete das imposante Bauwerk, das vor ihnen aufragte: die Westminster Abbey, deren emporstrebende gotische Formen fast den Himmel zu berühren schienen. Die Sonne hatte sich durch den Dunstschleier der dünnen Wolkendecke hindurchgekämpft und tauchte das Kirchengebäude in ein fahles Licht. »Und hier findet es also wirklich statt?«, fragte Tessa, während Jem sie in Richtung des Haupteingangs führte. »Es erscheint mir so …«
»Irdisch?«
»Ich hatte ›überfüllt‹ sagen wollen.«
Die Abbey war an diesem Tag für Touristen zugänglich, und ganze Gruppen von Besuchern strömten durch das gewaltige Portal, die meisten mit einem Baedeker-Reiseführer in der Hand. Eine Reisegruppe aus Amerika – durchgehend Frauen mittleren Alters in altmodischer Kleidung, die mit einem Akzent sprachen, der in Tessa einen Anflug von Heimweh auslöste – eilte an ihnen vorbei die Stufen hinauf, auf den Fersen eines Fremdenführers, der eine Führung durch die ehemalige Klosterkirche anbot. Jem und Tessa schlossen sich ihnen stillschweigend an.
Im Inneren des Kirchengebäudes roch es nach kaltem Stein und Metall. Tessa schaute hinauf zur Decke und dann in die Runde, betrachtete staunend die gewaltigen Dimensionen des Bauwerks.
Im Vergleich dazu wirkte das Institut beinahe wie eine Dorfkapelle.
»Die Dreiteilung des Kirchenschiffs verdient besondere Erwähnung«, leierte der Fremdenführer herunter und erläuterte dann die kleineren Seitenkapellen, die jeweils vom östlichen und westlichen Querschiff abgingen. Eine ehrfürchtige Stille hing in der Luft, obwohl in diesem Moment gar kein Gottesdienst stattfand.
Während Tessa sich von Jem zum Ostflügel der Kirche führen ließ, wurde ihr plötzlich bewusst, dass sie über Steinplatten schritt, in die Namen und Datumsangaben eingraviert waren. Sie hatte zwar gewusst, dass in Westminster Abbey berühmte Mitglieder des britischen Königshauses, Soldaten und Dichter begraben lagen, aber sie hatte nicht damit gerechnet, dass sie buchstäblich auf ihren Köpfen herumlaufen würde.
Nach einer Weile erreichten Jem und sie die südöstliche Ecke der Kirche und verlangsamten ihre Schritte. Blasses Tageslicht fiel durch das Rosettenfenster über ihnen.
»Ich weiß ja, dass wir uns eigentlich sputen sollten, um pünktlich zur Ratsversammlung zu erscheinen«, erklärte Jem, »aber ich wollte dir das hier noch zeigen.« Mit einer weit ausholenden Armbewegung deutete er um sich. »Poets’ Corner.«
Natürlich hatte Tessa von diesem Ort bereits gelesen – die Dichterecke war der Bereich der Westminster Abbey, in dem die größten Schriftsteller Englands begraben lagen. Tessas Blick fiel auf Chaucers graues Grabmal mit dem Baldachin und dann auf weitere vertraute Namen. »Edmund Spenser, oh, und Samuel Johnson«, stieß sie atemlos hervor, »und Coleridge und Robert Burns und Shakespeare …«
»Er liegt nicht wirklich hier«, warf Jem rasch ein. »Es handelt sich nur um ein Denkmal. Genau wie bei Milton.«
»Ja, ich weiß, aber …« Tessa sah ihn an und spürte, wie sie errötete. »Ich kann es nicht erklären. Es scheint mir fast so, als befände ich mich unter Freunden, hier mit all diesen Namen. Töricht, ich weiß …«
»Nein, das ist keineswegs töricht.«
Tessa schenkte ihm ein Lächeln. »Woher hast du gewusst, was ich hier vor allen Dingen sehen wollte?«
»Wie hätte ich das nicht wissen können?«, erwiderte Jem. »Wann immer ich an dich denke, sehe ich dich vor meinem inneren Auge mit einem Buch in der Hand.« Rasch wandte er das Gesicht ab, doch Tessa konnte gerade noch einen Blick auf die verräterische Röte seiner Wangenknochen erhaschen. Er war so blass, dass er nicht einmal das leichteste Erröten verbergen konnte, überlegte Tessa – und stellte überrascht fest, mit welch großer Zuneigung sie dieser Gedanke erfüllte.
Im Laufe der vergangenen zwei Wochen war Jem ihr sehr ans Herz gewachsen. Will hatte sie geflissentlich ignoriert, Charlotte und Henry waren mit Fragen des Rats und der Leitung des Instituts beschäftigt, und selbst Jessamine wirkte in letzter Zeit ständig geistesabwesend. Einzig Jem war immer für sie da. Er schien seine Rolle als persönlicher Fremdenführer sehr ernst zu nehmen und hatte ihr bereits den Hydepark und Kew Gardens gezeigt, die National Gallery, das British Museum sowie den Tower of London mit dem Traitors’ Gate. Sie hatten beim Melken der Kühe im St. James’s Park zugeschaut und die Obst- und Gemüsehändler in Covent Garden beobachtet, die lauthals ihre Waren anpriesen. Vom Themseufer aus hatten sie Boote und Schiffe betrachtet, die über den sonnenglitzernden Fluss segelten, und sie hatten eine Spezialität gekostet, die als »Türstopper« bezeichnet wurde – was in Tessas Ohren schrecklich klang, sich aber als ein Sandwich mit reichlich Butter und Zucker auf den Weißbrotscheiben entpuppte. Im Laufe der Tage hatte Tessa gespürt, wie sie ihrem stillen, unterdrückten Kummer über die Ereignisse rund um Nate und Will und dem Verlust ihres früheren Lebens langsam entwuchs – wie eine Pflanze, deren erste Triebe gefrorenen Boden durchbrachen. Einmal hatte sie sich sogar dabei ertappt, wie sie lauthals lachte. Und das alles verdankte sie Jem.
»Du bist wirklich ein guter Freund«, stieß sie nun hervor, und als er zu ihrer Überraschung schwieg, fügte sie hinzu: »Zumindest hoffe ich, dass wir gute Freunde sind. Du empfindest doch ebenso, nicht wahr, Jem?«
Der junge Schattenjäger wandte sich ihr zu, doch bevor er etwas erwidern konnte, ertönte eine düstere Grabesstimme aus den Schatten:
»Ihr Staubgebornen, bebt und seht,
Wie rasch das Fleisch allhier vergeht.
Manch ein königlich Gebein
Schläft in diesem Haufen Stein.«
Eine dunkle Gestalt trat zwischen zwei Grabdenkmälern hervor. Während Tessa überrascht blinzelte, spottete Jem in leicht resigniertem Ton: »Will. Dann hast du also doch noch beschlossen, uns mit deiner Anwesenheit zu beehren?«
»Ich habe nie behauptet, dass ich nicht zu erscheinen beabsichtige.« Als Will einen Schritt näher trat, erhellte das Licht aus dem Rosettenfenster hoch über ihnen seine Züge. Auch dieses Mal gelang es Tessa nicht, ihn zu betrachten, ohne jenes bedrückende Gefühl in der Brust zu spüren, jenes schmerzhafte Flattern ihres Herzens. Schwarze Haare, blaue Augen, elegant geschwungene Wangenknochen, dichte dunkle Wimpern und volle, sinnliche Lippen – man hätte ihn fast schon als hübsch bezeichnen können, wenn er nicht so groß und muskulös gewesen wäre. Tessa hatte ihre Hände über diese Arme wandern lassen und wusste, wie sie sich anfühlten: wie Eisen, bepackt mit dicken, harten Muskelsträngen. Und seine Hände, die ihren Kopf behutsam umfasst hatten, waren schlank und geschmeidig, mit rauen Schwielen an den Fingern …
Mit einem Ruck riss sie sich aus ihren Erinnerungen. Es tat nicht gut, zu lange in der Vergangenheit zu verweilen – nicht wenn man in der Gegenwart der Wahrheit ins Auge blicken musste: Will war wunderschön, aber er gehörte nicht ihr. Er gehörte niemandem. Irgendetwas tief in seinem Inneren war zerbrochen, und durch diesen Bruch drang eine blinde Zerstörungswut – der unerbittliche Drang, andere zu verletzen und von sich zu stoßen.
»Du bist spät«, bemerkte Jem gutmütig. Er war der einzige Mensch, den Wills maliziöse Spottlust nicht zu treffen schien.
»Ich musste noch eine Besorgung machen«, erklärte Will.
Aus der Nähe konnte Tessa erkennen, wie müde er aussah: Seine Augen waren gerötet, und die dunklen Schatten darunter schimmerten fast violett. Seine zerknitterte Kleidung erweckte den Eindruck, als hätte er darin geschlafen, und seine Haare benötigten dringend einen Friseur. Aber das geht dich überhaupt nichts an, ermahnte sie sich streng und wandte den Blick ab, fort von den weichen dunklen Locken, die sich um Ohren und Nacken kräuselten. Es spielt keine Rolle, was du von seinem Aussehen hältst oder davon, wie und wo er seine Tage und Nächte verbringt. Das hat er schließlich mehr als deutlich gemacht.
»Und ihr seid auch nicht gerade die Pünktlichkeit in Person.«
»Ich wollte Tessa noch Poets’ Corner zeigen«, räumte Jem ein. »Ich dachte, das würde ihr gefallen.« Seine Worte waren so einfach und überzeugend, dass niemand auch nur den geringsten Zweifel daran hegen konnte, Jem würde jemals etwas anderes als die Wahrheit sagen. Angesichts seiner ehrlichen Hilfsbereitschaft und Zuvorkommenheit schien nicht einmal Will zu einer bissigen Bemerkung fähig – er zuckte lediglich die Achseln und eilte ihnen voraus in Richtung East Cloister.
Dort befand sich ein quadratischer Garten, umgeben von einem Kreuzgang, in dem einige Besucher umherwandelten und sich in gedämpftem Ton unterhielten, als wären sie noch immer im Kirchengebäude. Keiner der Touristen schenkte Tessa und ihren Begleitern Beachtung, als sie sich einer doppelflügeligen Eichentür in einer der Mauern näherten.
Will schaute sich kurz um, zückte seine Stele und zog deren Spitze mit einer fließenden Bewegung über das Holz. Die Tür blitzte blau auf und schwang dann nach innen. Rasch schlüpfte Will durch den Türspalt, dicht gefolgt von Jem und Tessa.
Eine Sekunde später fiel die schwere Tür hinter Tessa dröhnend ins Schloss und hätte dabei fast einen ihrer Röcke eingeklemmt; gerade noch rechtzeitig gelang es ihr, ihn herauszuziehen. Als sie sich wieder umdrehte, erwartete sie tiefste Finsternis. »Jem?«, fragte sie leise.
Ein Licht flackerte auf: Will hatte seinen Elbenstein hervorgeholt und hob ihn in die Höhe. Sie befanden sich in einem großen Raum mit Natursteinmauern, niedrigen Gewölbedecken und einem roten Ziegelsteinboden. Am hinteren Ende des Raums stand ein Altar. »Wir sind hier in der Pyx Chamber«, erklärte Will. »Sie diente einst als Schatzkammer … an ihren Wände stapelten sich kistenweise Gold und Silber.«
»Eine Schatzkammer der Schattenjäger?«, fragte Tessa verwirrt.
»Nein, eine Schatzkammer des königlichen Schatzamts – deshalb auch die dicken Mauern und Türen«, erläuterte Jem. »Aber wir Schattenjäger hatten zu allen Zeiten Zugang.« Als er Tessas verwunderten Gesichtsausdruck sah, lächelte er. »Sämtliche Monarchien der vergangenen Jahrhunderte haben den Nephilim heimlich den Zehnt bezahlt, um ihr Königreich vor Dämonen zu schützen.«
»Aber nicht in Amerika«, entgegnete Tessa energisch. »Wir haben keine Monarchie …«
»Sei unbesorgt: Ihr habt stattdessen eine Regierungsabteilung, die mit den Nephilim zusammenarbeitet«, erwiderte Will und marschierte schnurstracks auf den Altar zu. »Früher war das Kriegsministerium dafür zuständig, doch inzwischen kümmert sich eine Unterabteilung des Justizministeriums um diese Angelegen…«
Der Rest des Satzes wurde von einem lauten Knirschen übertönt, als der Altar zur Seite schwang und den Blick auf eine dunkle, leere Öffnung im Mauerwerk freigab. In den Schatten konnte Tessa einen schwachen Lichtschein ausmachen; dann tauchte Will durch die Maueröffnung hindurch und beleuchtete den Bereich dahinter mit seinem Elbenstein.
Als Tessa ihm folgte, fand sie sich in einem langen, abschüssigen Gang wieder, dessen Boden, Decke und Mauern aus demselben glatten Stein bestanden und dadurch den Eindruck erweckten, als wäre der Weg direkt in das Felsgestein gehauen worden. Alle paar Schritte brannte ein Elbenlicht in einem Wandleuchter, geformt wie eine menschliche Hand, die aus dem Mauerwerk herausragte und eine Fackel hielt.
Hinter ihnen schwang der Altar wieder an seinen ursprünglichen Standort zurück, und sie machten sich daran, dem abschüssigen Gang zu folgen. Die Fackeln an den Wänden erzeugten einen blaugrünlichen Schein, der ein Relief im Gestein hervortreten ließ – wieder und wieder dasselbe Motiv: ein Engel, der aus einem See aufstieg und ein Schwert in der einen und einen Kelch in der anderen Hand hielt.
Schließlich erreichten die drei eine wuchtige Doppelflügeltür aus massivem Silber. Darauf war ein Symbol eingeätzt, das Tessa bereits kannte – viermal der Buchstabe C, Rücken an Rücken.
Jem deutete auf das Motiv. »Die Buchstaben stehen im englischen Sprachraum für Clave, Council, Covenant und Consul, also Rat, Kongregation, Bündnis und Konsul«, sagte er, bevor Tessa danach fragen konnte.
»Der Konsul … ist er das Oberhaupt des Rats? Wie eine Art König?«
»Ja, das könnte man sagen, allerdings ohne die in den meisten Monarchien verbreitete Inzucht. Er wird gewählt wie der Präsident oder der Premierminister«, erläuterte Will.
»Und die Kongregation?«
»Die lernst du noch früh genug kennen«, sagte Will und drückte schwungvoll die Türen auf.
Vor Erstaunen sperrte Tessa den Mund auf. Als sie ihn hastig schloss, fing sie einen belustigten Blick von Jem auf, der rechts neben ihr stand. Der Saal vor ihnen war der größte, den sie je gesehen hatte: ein gewaltiges Kuppelgewölbe mit prachtvollen Deckenmalereien, welche Himmelskörper und Sternbilder zeigten. Vom Scheitelpunkt der Kuppel hing ein gewaltiger Kronleuchter in Gestalt eines Engels herab, der hell lodernde Fackeln in den Händen hielt. Der Rest des Saals erinnerte an ein Amphitheater mit langen, leicht geschwungenen Bänken, welche bereits zu drei Vierteln besetzt waren. Will, Jem und Tessa standen an der Spitze einer Treppe, die mitten durch die Sitzreihen hinunter in den Saal führte. Am Fuß der Treppe befand sich ein erhöhtes Podium, bestückt mit einer Reihe unbequem wirkender Holzstühle mit hohen Rückenlehnen.
Auf einem dieser Stühle saß Charlotte, flankiert von Henry, der sich nervös umschaute, während seine Frau die Hände ruhig im Schoß gefaltet hielt. Nur wer Charlotte gut kannte, konnte an ihren steifen Schultern und dem fest zusammengepressten Mund ihre innere Anspannung ablesen.
Vor den beiden stand an einer Art Katheder – breiter und höher als ein normales Rednerpult – ein hochgewachsener Mann mit langen hellen Haaren und dichtem blondem Bart. Von seinen breiten Schultern hing eine lange schwarze Robe herab, auf deren Ärmeln eingewebte Runen schimmerten. Neben ihm saß ein älterer Mann in einem niedrigen Polstersessel; graue Strähnen durchzogen sein braunes Haar, und auf seinem glatt rasierten Gesicht zeichneten sich tiefe Sorgenfalten ab. Seine Robe leuchtete in einem dunklen Blau, und an seinen Fingern glitzerten mit Edelsteinen besetzte Ringe. Tessa erkannte ihn sofort wieder: Es handelte sich um den Inquisitor Whitelaw, der mit eisiger Stimme und kalten, harten Augen im Auftrag des Rats Zeugen befragt hatte.
»Mr Herondale«, bemerkte der blonde Mann mit einem Blick zu Will am oberen Ende der Treppe und rang sich ein Lächeln ab. »Wie aufmerksam von Ihnen, sich zu uns zu gesellen. Und Mr Carstairs ist ebenfalls gekommen. Und Ihre Begleiterin ist bestimmt …«
»Miss Gray«, warf Tessa ein, bevor er seinen Satz beenden konnte. »Miss Theresa Gray aus New York.«
Ein Raunen ging durch die Reihen, wie das Geräusch einer zurückschwappenden Welle. Tessa spürte, wie Will sich innerlich anspannte, und sie hörte Jem Luft holen, als wollte er etwas sagen. Einfach den Konsul zu unterbrechen … glaubte Tessa aus der Menge aufzuschnappen.
Dann ist das also Konsul Wayland, der Vorsitzende des Rats, überlegte sie. Während sie sich im Raum umschaute, erkannte sie ein paar vertraute Gesichter: Benedict Lightwood, mit den scharfen, kantigen Zügen und der steifen Körperhaltung, und sein Sohn Gabriel, der unter seinem wirren Haarschopf mit steinerner Miene geradeaus starrte; die glutäugige Lilian Highsmith, der freundlich dreinblickende George Penhallow und sogar Charlottes stimmgewaltige Tante Callida, deren graue Haare in Wellen zu einer Hochfrisur aufgetürmt waren. Die vielen anderen Gesichter kannte Tessa nicht, aber sie erinnerten sie an eine Art Bilderbuch mit allen möglichen Völkern der Welt: blonde, wikingerartige Schattenjäger, ein dunkelhäutiger Mann, der wie ein Kalif aus Tessas illustrierter Ausgabe von Tausendundeine Nacht aussah, und eine indische Nephilim in einem wunderschönen, mit silberfarbenen Runen durchwirkten Sari. Neben ihr saß eine weitere Frau, die Tessa, Will und Jem den Kopf zugewandt hatte und sie direkt ansah. Sie trug ein elegantes Seidenkleid, und ihr Gesicht erinnerte Tessa an Jem – die gleichen feinen Züge, die gleichen mandelförmigen Augen und hohen Wangenknochen, allerdings umrahmt von einer Fülle glatter dunkler Haare statt silbrig wie Jems.
»Nun denn: Herzlich willkommen, Miss Tessa Gray aus New York«, sagte der Konsul in leicht belustigtem Ton. »Wir wissen Ihre heutige Anwesenheit durchaus zu schätzen. Wie ich höre, haben Sie der Londoner Brigade bereits eine ganze Reihe von Fragen beantwortet. Und ich hoffe, Sie werden sich bereit erklären, noch ein paar weitere für uns zu erläutern.«
Tessas Augen suchten Charlottes Blick quer durch den gesamten Raum. Soll ich?
Charlotte beantwortete ihre stumme Frage mit einem kaum merklichen Kopfnicken. Bitte.
Sofort straffte Tessa die Schultern. »Selbstverständlich, wenn Sie das wünschen.«
»Dann treten Sie bitte an die Ratsbank«, forderte der Konsul Tessa auf, und sie begriff, dass er die lange, schmale Holztheke meinen musste, die sich vor dem Rednerpult befand. »Die beiden Gentlemen dürfen Sie gerne begleiten«, fügte er hinzu.
Will murmelte etwas vor sich hin, allerdings so leise, dass nicht einmal Tessa ihn verstehen konnte. Von Will und Jem flankiert, stieg sie die Stufen hinab und trat an die Ratsbank vor dem Rednerpult, wo sie unschlüssig innehielt. Aus der Nähe konnte sie erkennen, dass der Konsul freundliche blaue Augen besaß – ganz im Gegensatz zum Inquisitor, dessen steingraue Augen seltsam trostlos wirkten, wie ein regenverhangener Ozean.
»Inquisitor Whitelaw«, wandte sich der Konsul an den älteren Mann, »das Engelsschwert, wenn ich bitten darf.«
Der Inquisitor erhob sich und zog unter seiner Robe eine gewaltige Klinge hervor.
Tessa erkannte die lange, matt silbern schimmernde Waffe mit dem Heft in Gestalt ausgebreiteter Schwingen sofort wieder: das Schwert aus dem Codex, das der Erzengel Raziel bei seinem Aufstieg aus dem See in der Hand gehalten und dem ersten Nephilim überreicht hatte – Jonathan Shadowhunter. »Mellartach«, murmelte sie und nannte das Schwert damit bei seinem Namen.
Der Konsul nahm die Klinge entgegen und warf dabei Tessa erneut einen leicht amüsierten Blick zu. »Sie haben tatsächlich Ihre Hausaufgaben gemacht«, stellte er fest. »Wer von euch beiden hat sie denn unterrichtet? William? James?«
»Tessa schnappt viele Dinge ganz ohne fremde Hilfe auf, Sir.« Wills unbekümmerte Erwiderung stand im krassen Kontrast zur düsteren Stimmung im Saal. »Sie ist ausgesprochen wissbegierig.«
»Ein Grund mehr, warum sie nicht hier sein sollte.«
Tessa brauchte sich nicht umzudrehen – diese Stimme kannte sie: Benedict Lightwood.
»Dies ist der Garnisonsrat. Hierher bringen wir keine Schattenwesen.« Lightwoods Stimme klang angespannt. »Das Engelsschwert kann nicht dazu beitragen, dass sie die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagt; schließlich ist sie keine Schattenjägerin. Also, welchem Zweck sollte ihre Anwesenheit hier wohl dienlich sein?«
»Geduld, Benedict.« Konsul Wayland hielt das Schwert locker in der Hand, als ob es leicht wie eine Feder wäre. Sein Blick dagegen ruhte deutlich schwerer auf Tessa. Sie hatte das Gefühl, als würde er ihr Gesicht erkunden, die Furcht in ihren Augen lesen. »Wir werden Ihnen keinen Schaden zufügen, mein junges Hexenfräulein«, versprach er. »Das verbietet bereits das Abkommen.«
»Sie sollten mich nicht als Hexe bezeichnen«, berichtigte Tessa ihn, »denn ich trage kein Lilithmal.« Es war seltsam, diese Feststellung erneut wiederholen zu müssen, aber bisher war sie immer nur von Mitgliedern der Kongregation befragt worden und nie vom Konsul persönlich.
Konsul Wayland war ein groß gewachsener, breitschultriger Mann, der eine Aura der Macht und Autorität verströmte – genau jene Sorte von Macht und Autorität, die auch Charlotte ausstrahlte und damit Benedict Lightwood extrem gegen sich aufbrachte. »Was sind Sie denn dann?«, fragte Wayland verwundert.
»Sie weiß es nicht«, konstatierte der Inquisitor trocken. »Und auch die Brüder der Stille können diese Frage nicht beantworten.«
»Dennoch darf sie Platz nehmen und eine Aussage machen. Allerdings werden wir ihr Zeugnis nur eingeschränkt werten: Ihr Wort gilt halb so viel wie das eines Nephilim.« Damit wandte sich der Konsul dem Ehepaar Branwell zu. »In der Zwischenzeit bist du vorläufig aus dem Zeugenstand entlassen, Henry. Charlotte, bitte bleibe noch einen Moment.«
Tessa schluckte ihre Verstimmung über Waylands Worte hinunter und begab sich zur ersten Sitzreihe, begleitet von einem ziemlich mitgenommen wirkenden Henry, dessen kupferrote Haare in alle Richtungen abstanden. Dort erwartete sie bereits Jessamine, in einem Kleid aus hellbraunem Alpaka und mit einem gleichermaßen gelangweilten wie verärgerten Gesichtsausdruck. Tessa ließ sich neben ihr nieder, während die beiden jungen Schattenjäger rechts von ihr Platz nahmen. Jem saß so dicht neben ihr, dass Tessa die Wärme seines Oberarms an ihrer Schulter spüren konnte.
Die nächste halbe Stunde der Ratsversammlung verlief im Grunde wie jede andere Sitzung: Charlotte wurde gebeten, den Nephilim von jenem Abend zu berichten, an dem die Brigade de Quinceys Hochburg gestürmt und den Vampiranführer sowie die anwesenden Mitglieder seines Clans getötet hatte. Danach gab sie darüber Auskunft, wie Tessas Bruder Nate das in ihn gesetzte Vertrauen missbraucht und dem Magister, Axel Mortmain, Zutritt zum Institut verschafft hatte, wo dieser zwei der Angestellten umbringen ließ und Tessa beinahe entführt hätte.
Als man Tessa aufrief, erklärte sie genau dasselbe, was sie auch schon zuvor ausgesagt hatte: Sie wisse nicht, wo Nate sich nun aufhielte; sie hätte keinerlei Verdacht gegen ihn gehegt und auch nichts von ihren eigenen Fähigkeiten geahnt, bis zu dem Moment, in dem die Dunklen Schwestern sie ihr gezeigt hatten; und sie habe stets angenommen, dass ihre Eltern ganz normale Sterbliche gewesen waren.
»Zu Richard und Elizabeth Gray wurden umfangreiche Nachforschungen angestellt«, verkündete der Inquisitor. »Und nichts deutet daraufhin, dass sie etwas anderes als herkömmliche Menschen waren. Auch der Junge, ihr Bruder, ist rein menschlicher Natur. Zwar wäre es durchaus denkbar, dass es sich bei dem Vater des Mädchens um einen Dämon handelt, wie Mortmain ja bereits angedeutet hat, aber dann bleibt immer noch die Frage des fehlenden Lilithmals.«
»Wie überaus seltsam … im Grunde alles an Ihnen, meine Liebe, einschließlich Ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten«, bemerkte der Konsul und musterte Tessa ruhig aus seinen hellblauen Augen. »Und Sie haben keine Ahnung hinsichtlich der Grenzen oder Beschaffenheit Ihrer Kraft? Hat man Sie bereits mit einem von Mortmains Gegenständen getestet? Um herauszufinden, ob Sie vielleicht Zugang zu seinen Erinnerungen oder Gedanken erlangen können?«
»Ja, ich … wir haben es versucht. Mit einem Knopf, der von seinem Anzug abgefallen war. Eigentlich hätte es funktionieren müssen.«
»Aber?«
Tessa schüttelte den Kopf. »Es ist mir nicht gelungen. Dem Knopf fehlte jeglicher Lebensfunke. Es gab nichts, zu dem ich eine Verbindung hätte herstellen können.«
»Wie praktisch«, murmelte Benedict gerade so leise, dass Tessa ihn hören konnte und verärgert errötete.
Mit einer Handbewegung bedeutete der Konsul ihr, wieder Platz zu nehmen. Als Tessa der Aufforderung folgte, konnte sie einen kurzen Blick auf Benedict Lightwoods Gesicht werfen: Seine Lippen waren zu einem schmalen, wütend verzerrten Strich zusammengepresst. Verwundert fragte sie sich, was sie wohl gesagt haben könnte, dass er derart aufgebracht reagierte.
»Und seit Miss Grays … Auseinandersetzung mit Mortmain im Sanktuarium ist dieser spurlos verschwunden – sehe ich das richtig?«, fuhr der Konsul fort.
Der Inquisitor blätterte hastig in den Unterlagen, die vor ihm lagen. »Sämtliche seiner Häuser wurden gründlich durchsucht, doch sie waren vollkommen verlassen, regelrecht leer gefegt. Das Gleiche gilt für seine Lagerhäuser: Nirgends fand sich auch nur eine Spur von Mortmains persönlichem Besitz. Sogar unsere Freunde bei Scotland Yard haben Ermittlungen durchgeführt. Doch Mortmain hat sich anscheinend in Luft aufgelöst – im wahrsten Sinne des Wortes, wie unser junger Freund William Herondale zu berichten weiß.«
Will lächelte strahlend, als hätte der Inquisitor ihm ein Kompliment gemacht, aber Tessa sah das spöttische Funkeln in seinen Augen und musste an das Aufblitzen einer scharfen Rasiermesserklinge denken.
»Ich schlage vor, dass Charlotte und Henry Branwell eine Abmahnung erhalten«, verkündete der Konsul, »und dass während der nächsten drei Monate jegliche Amtshandlung, die sie im Auftrag des Rats durchführen, von mir persönlich gebilligt werden muss, ehe sie …«
»Euer Ehren«, meldete sich eine klare, feste Stimme aus der Menge. Sofort wirbelten mehrere Köpfe herum und starrten in die Richtung des Sprechers; Tessa hatte den Eindruck, es geschah nicht oft, dass jemand den Konsul mitten im Satz unterbrach. »Ich bitte ums Wort.«
Skeptisch zog der Konsul eine Augenbraue hoch. »Benedict Lightwood, mir scheint, vorhin während der Zeugenaussagen bestand bereits genügend Gelegenheit, uns etwas mitzuteilen.«
»Gegen die Zeugenaussagen habe ich auch gar nichts einzuwenden«, erwiderte Benedict Lightwood, dessen Profil im Elbenlicht noch schärfer und spitzer wirkte. »Aber in puncto der verhängten Strafe bin ich mit dem Hohen Gericht nicht einverstanden.«
Der Konsul beugte sich vor und stützte sich auf das Pult. Er war groß und kräftig gebaut, und seine gewaltigen Hände erweckten den Eindruck, als könnte er Benedicts Kehle mühelos mit einer Hand umspannen – was Tessa liebend gern gesehen hätte. Nach allem, was sie bisher von Benedict Lightwood mitbekommen hatte, mochte sie ihn nicht sonderlich. »Und warum nicht?«, fragte Wayland.
»Ich denke, dass Sie sich von Ihrer langjährigen Freundschaft mit der Familie Fairchild beeinflussen lassen und Charlottes Unzulänglichkeit als Leiterin des Instituts gegenüber blind sind«, sagte Benedict, und ein empörtes Raunen ging durch den Saal. »Die schweren Fehler, die in der Nacht zum sechsten Juli begangen wurden, haben nicht nur dem Ansehen des Rats geschadet und den Verlust der Pyxis zur Folge gehabt, sondern auch unsere diplomatischen Beziehungen zu Londons Schattenweltlern nachhaltig geschädigt – durch den sinnlosen Angriff auf de Quincey.«
»Es wurden bereits mehrere Beschwerden eingereicht und Anträge auf Entschädigung gestellt. Über diese wird gesetzesmäßig entschieden werden«, knurrte der Konsul. »Aber Wiedergutmachungsleistungen gehen dich nun wirklich nichts an, Benedict …«
»Und das Schlimmste ist …«, fuhr Benedict unbeirrt und mit erhobener Stimme fort, »sie hat einen gefährlichen Verbrecher entkommen lassen! Einen Verbrecher, der Pläne zur Beeinträchtigung und Vernichtung von Schattenjägern schmiedet und von dem wir nicht wissen, wo er sich in diesem Moment aufhält. Darüber hinaus bin ich der Ansicht, dass die Verantwortung zur Aufspürung dieses Kriminellen allein diejenigen tragen sollten, die sein Verschwinden verschuldet haben!«
Bei diesen Worten geriet der ganze Saal in Aufruhr; Charlotte schaute bestürzt, Henry verwirrt und Will wütend. Nur der Konsul, dessen Augen sich bei Benedicts Bemerkung über die Familie Fairchild – offenbar Charlottes Mädchenname – beunruhigend verdüstert hatten, wartete schweigend, bis sich der Lärm wieder gelegt hatte. Dann erklärte er ruhig: »Deine feindselige Gesinnung gegenüber dem Oberhaupt deiner eigenen Brigade gereicht dir nicht zur Ehre, Benedict.«
»Ich bitte um Verzeihung, Konsul, aber ich bin der Überzeugung, dass es nicht im Interesse der Schattenjägergemeinschaft ist, Charlotte Branwell weiterhin als Leiterin des Instituts einzusetzen. Schließlich wissen wir alle, dass Henry Branwells Beteiligung an der Institutsführung bestenfalls als nominell bezeichnet werden kann. Ich glaube nicht, dass eine Frau dazu fähig ist, ein Institut zu leiten: Das schwache Geschlecht denkt nicht logisch und besonnen, sondern emotional … mit dem Herzen. Zweifelsohne ist Charlotte eine gute und ehrbare Ehefrau, aber kein Mann hätte sich von einem solch offensichtlichen Spion wie Nathaniel Gray an der Nase herumführen lassen …«
»Er hat mich getäuscht!« Will war aufgesprungen, wirbelte herum und musterte Benedict Lightwood aus wütend funkelnden Augen. »Er hat uns alle getäuscht. Daher wüsste ich gern, welche Unterstellungen Sie gegenüber meiner Person und gegenüber Jem und Henry vorbringen, Mr Lightwood?«
»Du und Jem … ihr seid noch Kinder«, schnaubte Benedict. »Und Henry verbringt doch jede Minute in seinem Laboratorium.«
Will schickte sich an, über die Rückenlehne seines Stuhls zu klettern, doch Jem stieß einen unterdrückten Fluch aus und zerrte ihn zurück auf seinen Sitz.
Dagegen klatschte Jessamine begeistert in die Hände, und ihre braunen Augen begannen zu leuchten. »Na endlich geschieht hier einmal etwas Aufregendes«, jubelte sie.
Tessa warf ihr einen angewiderten Blick zu. »Hast du überhaupt zugehört? Benedict Lightwood hat gerade Charlotte zutiefst beleidigt!«, wisperte sie aufgebracht. Doch Jessamine wischte ihren Einwand mit einer abfälligen Handbewegung fort.
»Und wer sollte deiner Meinung nach stattdessen das Institut leiten?«, wandte der Konsul sich mit vor Sarkasmus triefender Stimme an Lightwood. »Du etwa?«
Mit einer bescheidenen Geste breitete Benedict die Hände aus. »Wenn Sie darauf bestehen, Konsul …«
Gleichzeitig erhoben sich drei weitere Nephilim von ihren Plätzen. Zwei von ihnen kannte Tessa vom Sehen: Mitglieder der Londoner Brigade, deren Namen sie allerdings nicht wusste. Und bei der dritten Person handelte es sich um Lilian Highsmith.
Benedict lächelte. Jetzt war ihm die Aufmerksamkeit aller Anwesenden sicher. Neben ihm saß sein jüngster Sohn Gabriel, der aus seinen grünen, unergründlichen Augen zu seinem Vater aufschaute; seine schlanken Finger umklammerten die Lehne der Stuhlreihe vor ihm. »Drei Nephilim, die meinen Anspruch unterstützen«, deklamierte Benedict. »So verlangt es das Gesetz: Hiermit fordere ich offiziell die Absetzung von Charlotte Branwell als Leiterin des Instituts.«
Charlotte schnappte nach Luft, doch sie verharrte reglos auf ihrem Stuhl … sie gönnte Lightwood nicht die Genugtuung, dass sie sich ihm gänzlich zuwandte. Jem hielt Will noch immer am Handgelenk, und Jessamine erweckte weiterhin den Eindruck, als verfolge sie eine besonders spannende Theateraufführung.
»Nein«, sagte der Konsul kühl.
»Sie können mich nicht daran hindern, eine offizielle Absetzung …«
»Benedict, du hast meine Entscheidung, Charlotte zur Institutsleiterin zu ernennen, von Anfang an infrage gestellt. Du hast dieses Amt schon immer selbst bekleiden wollen. Und nun, da die Brigade stärker denn je zusammenhalten muss, bringst du nichts als Zwist und Zwietracht in die Reihen der Nephilim.«
»Veränderungen werden nicht immer auf friedlichem Wege erreicht, aber das macht sie noch lange nicht nachteilig. Mein Antrag steht.« Benedict verschränkte die Hände.
Verstimmt trommelte der Konsul mit den Fingern auf das Rednerpult, flankiert vom Inquisitor, der mit kalten Augen zusah. Schließlich räusperte Wayland sich und meinte: »Du schlägst also vor, Benedict, dass die Verantwortung zur Aufspürung Mortmains diejenigen tragen sollten, die sein Verschwinden deines Erachtens ›verschuldet‹ haben. Dann stimmst du mir sicher zu, dass die Fahndung nach dem Gesuchten oberste Priorität besitzt?«
Benedict nickte kurz angebunden.
»Dann erlasse ich hiermit folgenden Beschluss: Charlotte und Henry Branwell leiten die Ermittlungen zu Mortmains Verbleib. Falls sie ihn am Ende einer Frist von vierzehn Tagen nicht aufgespürt haben oder zumindest überzeugende Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort vorweisen können, wird das Verfahren zur Absetzung offiziell eingeleitet.«
Charlotte fuhr von ihrem Stuhl hoch. »Mortmain ausfindig machen?«, stieß sie hervor. »Nur Henry und ich, wir zwei ganz allein – ohne die Hilfe der Brigade?«
Der Konsul bedachte sie mit einem Blick, der durchaus nicht unfreundlich, andererseits aber auch nicht nachsichtig war. »In besonderen Fällen dürft ihr die Hilfe anderer Ratsmitglieder in Anspruch nehmen, und selbstverständlich stehen euch weiterhin die Dienste der Stillen Brüder und der Eisernen Schwestern zur Verfügung«, erklärte er. »Aber was die Ermittlungen betrifft, so müsst ihr diese Aufgabe allein bewältigen.«
»Das gefällt mir nicht«, protestierte Lilian Highsmith. »Sie verwandeln die Suche nach einem Verrückten in einen Machtkampf …«
»Dann möchtest du deine Unterstützung für Benedicts Vorhaben also zurückziehen?«, fragte der Konsul. »Sein Antrag auf Absetzung wäre damit beendet, und für die Branwells bestünde nicht länger die Verpflichtung, sich zu beweisen.«
Lilian öffnete den Mund, schloss ihn aber nach einem scharfen Blick von Benedict wieder und schüttelte den Kopf.
»Wir haben gerade erst unsere Dienstboten verloren«, gab Charlotte mit gepresster Stimme zu bedenken. »Ohne sie …«
»Euch werden neue Dienstboten bereitgestellt, so wie es üblich ist«, verkündete der Konsul. »Cyril, der Bruder eures verstorbenen Dieners Thomas, ist bereits auf dem Weg von Brighton hierher, und das Institut in Dublin war so freundlich, euch seine zweite Köchin zu überlassen. Beide sind ausgebildete Kämpfer – was, wie ich anmerken muss, Charlotte, auch bei deinen früheren Angestellten der Fall hätte sein müssen.«
»Sowohl Thomas als auch Agatha waren geschult!«, widersprach Henry.
»Aber ihr habt mehrere Mitglieder in eurem Haushalt, denen es an Training mangelt«, hielt Benedict dagegen. »Nicht nur Miss Lovelace befindet sich beklagenswert im Rückstand mit ihrem Training, sondern auch euer Dienstmädchen Sophie und diese Schattenweltlerin …« Er zeigte auf Tessa. »Da ihr ja offensichtlich beabsichtigt, sie permanent in euren Haushalt aufzunehmen, dürfte es kaum schaden, wenn sie – und die Magd – wenigstens die Grundzüge der Verteidigung erlernen würden.«
Verwundert warf Tessa Jem einen Blick zu. »Meint er etwa mich?«
Jem nickte. Sein Gesicht wirkte düster.
»Das geht nicht – ich würde mir nur den eigenen Fuß abhacken!«, meinte Tessa.
»Wenn du schon irgendjemandes Fuß abhacken willst, dann nimm wenigstens den von Benedict«, murmelte Will.
»Keine Sorge, Tessa, das Training umfasst nichts, wozu du nicht in der Lage wärst …«, setzte Jem an, doch der Rest seines Satzes ging im Dröhnen von Lightwoods Stimme unter.
»Wenn ich es recht bedenke, werdet ihr alle sicherlich rund um die Uhr mit der Suche nach Mortmains Verbleib beschäftigt sein«, schwadronierte Benedict. »Daher schlage ich vor, ich stelle euch meine beiden Söhne – Gabriel und Gideon, der heute Abend aus Spanien zurückkehrt – als Fechtlehrer zur Verfügung. Beide sind hervorragende Kämpfer und könnten zusätzliche Lehrerfahrung durchaus gebrauchen.«
»Vater!«, protestierte Gabriel mit entsetzter Miene. Ganz offensichtlich hatte Benedict diesen Punkt mit seinem Sohn nicht abgesprochen.
»Wir können unsere Dienstboten selbst schulen«, fauchte Charlotte.
Doch der Konsul schüttelte tadelnd den Kopf. »Benedict Lightwood unterbreitet dir ein großzügiges Angebot. Du solltest es besser akzeptieren.«
Charlotte lief feuerrot an, und es dauerte lange, bis sie schließlich leicht den Kopf neigte und damit der Aufforderung des Konsuls nachkam.
Bei dieser Entwicklung spürte Tessa, wie ihr schwindlig wurde. Sie sollte ein Training erhalten, ein Kampftraining, das das Werfen von Messern und das Schwingen eines Schwertes umfasste? Sicherlich, Capitola aus Emma D.E.N. Southworths Werk Capitola – Die verborgene Hand hatte stets zu ihren bevorzugten Romanheldinnen gehört: eine Frau, die wie ein Mann kämpfen konnte und sich auch als solcher kleidete. Aber das bedeutete nicht, dass Tessa wie Capitola sein wollte.
»Sehr schön«, konstatierte der Konsul. »Damit ist die heutige Sitzung beendet. Die nächste Versammlung findet in zwei Wochen statt. Ich wünsche allen Anwesenden eine gute Heimreise.«
Natürlich brachen längst nicht alle Schattenjäger sofort auf. Aus den Reihen erhob sich Stimmengewirr, als die Nephilim aufstanden und sich erregt mit ihren Nachbarn unterhielten. Nur Charlotte blieb reglos sitzen, und Henry, der zu ihr gegangen war, erweckte den Eindruck, als suchte er verzweifelt nach ein paar tröstenden Worten, die ihm aber partout nicht einfallen wollten. Einen kurzen Moment lang schwebte seine Hand unsicher über der Schulter seiner Frau, während Will einen wütenden Blick quer durch den Saal zu Gabriel Lightwood warf, der kalt in ihre Richtung schaute.
Schließlich erhob sich Charlotte langsam von ihrem Stuhl; Henry hatte ihr jetzt doch eine Hand auf den Rücken gelegt und redete leise auf sie ein, während Jessamine bereits ungeduldig wartete und dabei ihren neuen Sonnenschirm aus weißer Spitze herumwirbelte – Henry hatte ihren alten Schirm ersetzt, der im Kampf gegen Mortmains Automaten zerbrochen war. Ihre Haare waren zu festen Zöpfen geflochten und über den Ohren hochgesteckt.
Auch Tessa stand nun rasch auf, und die kleine Gruppe marschierte geschlossen durch den Mittelgang. Dabei schnappte Tessa von beiden Seiten Gesprächsfetzen auf, wieder und wieder dieselben Worte: »Charlotte«, »Benedict«, »wird den Magister niemals finden«, »zwei Wochen«, »Absetzung«, »Konsul«, »Mortmain«, »Brigade«, »welch eine Demütigung«.
Charlotte eilte mit kerzengeradem Rücken voran; ihre Wangen glühten, doch sie schaute unverwandt geradeaus, als würde sie das Gerede nicht hören. Dagegen wirkte Will, als würde er sich am liebsten auf die Tratschenden stürzen und ihnen eine Tracht Prügel verpassen, doch Jem hatte ihn fest im Griff und hielt seinen Parabatai im Mantelrücken fest.
Jems Beziehung zu Will ähnelte in vielerlei Hinsicht der Beziehung eines Hundebesitzers zu seinem Rassehund, der die Gäste gern ins Bein zwickte – man musste ihn ständig am Halsband festhalten, sinnierte Tessa und schaute dann zu Jessamine, die nun wieder gelangweilt schien. Sie war offensichtlich nicht sonderlich daran interessiert, was die Brigade von ihr oder irgendeinem anderen Mitglied des Instituts dachte.
Als Charlotte die Türen des Sitzungssaals erreichte, war sie so schnell vorangestürmt, dass sie einen Moment innehalten musste, damit der Rest der Gruppe zu ihr aufschließen konnte. Die meisten Versammlungsmitglieder strebten nach links, zum Portal, durch das Tessa, Jem und Will den Saal betreten hatten, aber Charlotte wandte sich nach rechts, marschierte ein paar Meter durch den Gang, bog um eine Ecke und blieb dann abrupt stehen.
»Charlotte?« Henry, der ihr nacheilte, klang besorgt. »Alles in Ordnung, meine Liebe …?«
Ohne jede Warnung holte Charlotte mit dem Fuß aus und trat mit voller Wucht gegen die Wand, so hart sie nur konnte. Da es sich jedoch um grobes Mauerwerk handelte, hinterließ ihr Tritt keinen Schaden; allerdings stieß Charlotte einen unterdrückten Schrei aus.
»Ach du meine Güte«, murmelte Jessamine und wirbelte ihren Schirm.
»Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte …«, setzte Will an. »Etwa zwanzig Meter hinter uns, im Sitzungssaal, befindet sich Benedict Lightwood. Falls du also umkehren und ihn treten möchtest, würde ich dir empfehlen, nach oben und leicht nach links zu zielen …«
»Charlotte.« Die tiefe, raue Stimme war unverkennbar.
Sofort wirbelte Charlotte herum: Im Gang stand der Konsul. Die mit Silberfäden aufgestickten Runen auf seiner Robe schimmerten, als er sich der kleinen Institutsgruppe näherte und Charlotte dabei unverwandt ansah.
Die junge Schattenjägerin stützte sich mit einer Hand an der Wand ab, rührte sich aber nicht von der Stelle.
»Charlotte«, wiederholte Konsul Wayland, »du weißt doch, was dein Vater immer gesagt hat: ›Zügele dein Temperament.‹«
»Das hat er in der Tat gesagt. Und er hat auch gesagt, dass er gern einen Sohn gehabt hätte«, erwiderte Charlotte bitter. »Wenn ihm dieser Wunsch gewährt worden wäre, wenn ich ein Mann wäre, hätten Sie mich dann auf dieselbe Weise behandelt?«
Besänftigend legte Henry seiner Frau eine Hand auf die Schulter und murmelte ihr etwas zu, doch sie schüttelte ihn ab. Ihre großen, gekränkten braunen Augen fixierten den Konsul.
»Und auf welche Weise habe ich dich behandelt?«, fragte Wayland.
»Als ob ich ein Kind wäre, ein kleines Mädchen, das Schelte verdient hat.«
»Charlotte, ich war es doch, der dich zur Leiterin des Instituts und der Brigade ernannt hat«, konterte der Konsul, am Rande seiner Geduld angelangt. »Und das habe ich nicht nur deshalb getan, weil ich Granville Fairchild mochte und wusste, dass er seine Tochter gern als seine Amtsnachfolgerin gesehen hätte, sondern auch deshalb, weil ich der Ansicht war, dass du diese Aufgabe hervorragend meistern würdest.«
»Sie haben aber auch Henry ernannt«, hielt Charlotte dagegen. »Und damals haben Sie uns sogar den Grund dafür verraten: Die Brigade würde ein Ehepaar als Leitung akzeptieren, nicht aber eine Frau als alleinige Institutsleiterin.«
»Na, dann gratuliere ich ganz herzlich, Charlotte: Ich denke nicht, dass auch nur ein einziges Mitglied der Londoner Brigade den Eindruck hat, in irgendeiner Form von Henry geführt zu werden.«
»Das ist wohl wahr«, räumte Henry ein und schaute betreten auf seine Schuhe. »Sie wissen alle nur zu gut, dass ich vollkommen nutzlos bin. Diese vertrackte Situation ist ausschließlich meine Schuld, Konsul …«
»Nein, ist es nicht«, widersprach Wayland. »Es handelt sich vielmehr um eine Kombination aus allgemeiner Selbstgefälligkeit vonseiten des Rats, Pech, schlechtem Timing und einigen mangelhaften Entscheidungen deinerseits, Charlotte. Ja, ich mache dich dafür verantwortlich …«
»Dann pflichten Sie Benedict also bei!«, empörte sich Charlotte.
»Benedict Lightwood ist ein Lump und ein Heuchler«, erwiderte der Konsul müde. »Das ist allgemein bekannt. Aber er ist auch sehr einflussreich, und es erscheint mir besser, ihn mit diesem Schauspiel zu beschwichtigen, als ihn zu ignorieren und damit weiter aufzubringen.«
»Ein Schauspiel? So nennen Sie das also?«, schnaubte Charlotte bitter. »Sie haben mich vor eine unlösbare Aufgabe gestellt.«
»Ich habe dir die Aufgabe gestellt, den Magister ausfindig zu machen«, entgegnete Konsul Wayland. »Den Mann, der gewaltsam ins Institut eingedrungen ist, der deine Dienstboten getötet und die Pyxis gestohlen hat und der eine Armee von Klockwerk-Monstern zu errichten plant, um uns alle zu vernichten. Mit anderen Worten: ein Mann, der mit allen Mitteln gestoppt werden muss. Als Oberhaupt der Brigade ist es deine Aufgabe, ihn aufzuhalten, Charlotte. Falls du dies für unmöglich erachtest, dann solltest du dir vielleicht wirklich die Frage stellen, warum du dieses Amt überhaupt hast bekleiden wollen.«
2
Wiedergutmachung
So vergönne mir diese traurige Erholung,
Teile mir deinen Kummer mit.
Oh! Mehr als teilen, übertrag mir alle deine Leiden.
Alexander Pope, »Heloise an Abelard«
Das Elbenlicht, das die Institutsbibliothek erhellte, schien leicht zu flackern, wie eine tropfende Kerze in ihrer Wandhalterung. Doch Tessa wusste, dass es sich um eine Täuschung ihrer Fantasie handeln musste, denn im Gegensatz zu einer Flamme oder einem Gaslicht brannte das Licht der Elbensteine nicht aus – es leuchtete beständig. Allerdings ermüdeten Tessas Augen allmählich, und dem Anblick ihrer Freunde nach zu urteilen, erging es den anderen ähnlich. Sie saßen um einen der großen Bibliothekstische versammelt: Charlotte am Kopf, Henry zu Tessas Rechten und Will und Jem nebeneinander auf der anderen Seite. Nur Jessamine hatte sich ans weit entfernte Ende des Tischs zurückgezogen, abseits der anderen.
Die Oberfläche des Lesetischs war förmlich übersät mit Papieren und Dokumenten jeglicher Art – alte Zeitungsartikel, Bücher, Pergamentrollen mit feinen, krakeligen Handschriften. Dazu die Ahnentafeln verschiedener Zweige der Familie Mortmain, historische Abhandlungen über die Entwicklung der Automaten, zahlreiche Bücher mit Beschwörungszaubern und Verquickungsformeln sowie jedes Fitzelchen an Informationen, das die Brüder der Stille in ihrem Archiv über den Pandemonium Club hatten finden können.
Tessa war mit der Aufgabe betraut worden, sämtliche Zeitungsartikel durchzugehen, auf der Suche nach Berichten über Mortmain und seine Reederei, und allmählich verschwamm ihr die Sicht, und die Worte schienen auf dem Papier zu tanzen. Erleichtert atmete sie auf, als Jessamine schließlich die Stille durchbrach.
Genervt schob die junge Schattenjägerin ihre Lektüre – Über die Mechanismen der Hexerei – von sich weg und meinte düster: »Charlotte, ich denke, wir verschwenden hier nur unsere Zeit.«
Mit einem gequälten Gesichtsausdruck schaute Charlotte auf. »Jessamine, es besteht keine Veranlassung, noch länger hierzubleiben, wenn du das nicht wünschst. Ich muss ohnehin sagen, dass wohl keiner von uns mit deiner Hilfe in dieser Angelegenheit gerechnet hätte, und da du deinen Studien nie sonderlich zugetan warst, frage ich mich wirklich, ob du überhaupt weißt, wonach du suchst. Könntest du eine Verquickungsformel von einem Beschwörungszauber unterscheiden, wenn ich sie hier vor dir auf den Tisch legen würde?«
Überrascht blickte Tessa auf. Nur selten reagierte Charlotte ihnen gegenüber derartig scharf.
»Ich möchte aber helfen«, stieß Jessie schmollend hervor. »Diese mechanischen Dinger von Mortmain hätten mich fast umgebracht. Ich will, dass er geschnappt und bestraft wird.«
»Nein, willst du nicht«, bemerkte Will, der ein altes, knisterndes Pergament entrollte und die darauf abgebildeten schwarzen Symbole studierte. »Du willst, dass Tessas Bruder geschnappt und bestraft wird, weil er dich glauben machte, er sei in dich verliebt.«
Jessamine errötete. »Das will ich nicht. Ich meine, das hat er nicht. Ich meine … ach! Charlotte, Will ist wieder einmal unausstehlich.«
»Und die Erde ist eine Kugel«, sagte Jem zu niemandem im Besonderen.
»Ich will nicht, dass man mich aus dem Institut hinauswirft, wenn wir den Magister nicht finden«, fuhr Jessamine fort. »Ist das denn so schwer zu verstehen?«
»Dich wird man gewiss nicht aus dem Institut werfen. Charlotte dagegen schon. Ich bin mir sicher, dass die Lightwoods dir erlauben werden zu bleiben. Außerdem hat Benedict zwei Söhne im heiratsfähigen Alter. Du solltest eigentlich entzückt sein«, sagte Will spöttisch.
Doch Jessamine verzog das Gesicht. »Schattenjäger. Als ob ich einen von denen heiraten würde.«
»Jessamine, du bist eine von denen.«
Bevor Jessamine jedoch auf diesen Einwand reagieren konnte, wurde die Tür zur Bibliothek geöffnet, und Sophie kam herein, den Kopf mit der weißen Haube züchtig gesenkt. Leise wechselte sie ein paar Worte mit Charlotte, die sich daraufhin von ihrem Stuhl erhob.
»Bruder Enoch ist hier«, wandte Charlotte sich an die Gruppe. »Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Will, Jessamine, versucht bitte, euch nicht gegenseitig umzubringen, solange ich nicht da bin. Henry, wenn du freundlicherweise …« Sie verstummte. Henry starrte gebannt in das Buch, das vor ihm lag – al-Dschazarīs Buch über die Kunst trickreicher mechanischer Vorrichtungen –, und bekam überhaupt nicht mit, was um ihn herum vorging. Am Rande ihrer Geduld angelangt, warf Charlotte die Hände in die Höhe und eilte dann zusammen mit Sophie aus dem Raum.
In dem Moment, in dem sich die Tür hinter ihnen schloss, warf Jessamine Will einen giftigen Blick zu. »Wenn du die Ansicht vertrittst, ich besäße nicht genügend Erfahrung, um bei der Suche zu helfen, aus welchem Grund ist sie dann hier?« Jessamine zeigte auf Tessa. »Ich möchte keineswegs unhöflich erscheinen, aber glaubst du wirklich, sie könnte eine Verquickungsformel von einem Beschwörungszauber unterscheiden?« Skeptisch musterte sie Tessa. »Nun? Was sagst du? Kannst du, oder kannst du nicht? Und was dich betrifft, Will: Du hörst während des Unterrichts so wenig zu, dass ich mich frage, ob du eine Verquickungsformel von einem Soufflé-Rezept unterscheiden könntest!«
Will lehnte sich zurück und erwiderte träumerisch: »›Ich bin nur toll bei Nordnordwest; wenn der Wind südlich ist, kann ich einen Kirchturm von einem Leuchtenpfahl unterscheiden.‹«
»Jessamine, Tessa hat großzügig ihre Unterstützung angeboten, und im Moment können wir jede Hilfe gebrauchen«, sagte Jem streng. »Will, hör auf, aus Hamlet zu zitieren. Und Henry …« Er räusperte sich vernehmlich. »HENRY.«
Ruckartig hob Henry den Kopf und blinzelte. »Ja, meine Liebe?« Dann blinzelte er erneut und schaute sich verwundert um. »Wo ist Charlotte?«
»Sie spricht gerade mit einem der Stillen Brüder«, erklärte Jem, der nicht im Geringsten darüber verstimmt wirkte, dass Henry ihn gerade mit seiner Frau verwechselt hatte. »Im Übrigen muss ich einräumen … dass ich derselben Ansicht bin wie Jessamine.«
»Und die Erde ist eine Scheibe«, bemerkte Will, der Jems vorherigen Kommentar offenbar doch gehört hatte.
»Aber warum?«, drängte Tessa. »Wir können doch jetzt nicht einfach aufgeben. Das käme einer Übergabe des Instituts an diesen grässlichen Benedict Lightwood gleich.«
»Bitte versteh mich nicht falsch: Ich schlage ja gar nicht vor, dass wir nichts unternehmen. Aber wir versuchen herauszufinden, was Mortmain plant. Wir versuchen, die Zukunft vorherzusagen, statt die Vergangenheit zu verstehen.«
»Wir kennen Mortmains Vergangenheit und seine Pläne.« Will deutete mit der Hand auf die Zeitungen. »Geboren in Devon, zunächst als Schiffsarzt tätig, dann zu einem wohlhabenden Geschäftsmann aufgestiegen, in Schwarze Magie verstrickt und nun mithilfe einer gewaltigen Armee mechanischer Kreaturen auf dem Weg, die Weltherrschaft zu übernehmen. Eine nicht ganz untypische Entwicklung für einen entschlossenen jungen Mann …«
»Ich glaube nicht, dass er jemals davon gesprochen hat, die Weltherrschaft zu übernehmen«, unterbrach Tessa ihn. »Es war immer nur vom Britischen Weltreich die Rede.«
»Bewundernswert wortgetreu«, bemerkte Will. »Doch eigentlich will ich damit nur Folgendes sagen: Wir wissen, aus welchen Verhältnissen Mortmain stammt. Aber es lässt sich wohl kaum als unsere Schuld bezeichnen, dass sein Lebenslauf nicht sonderlich interessant ist.« Er verstummte, runzelte die Stirn und meinte nach einem Moment: »Ah.«
»Was Ah?«, fragte Jessamine fordernd und schaute verärgert von Will zu Jem. »Ich muss schon sagen, die Art und Weise, mit der ihr beide die Gedanken des jeweils anderen zu lesen scheint, ist mir unheimlich.«
»Ah«, wiederholte Will. »Jem dachte gerade – und ich bin geneigt, ihm beizupflichten –, dass Mortmains Lebensgeschichte, gelinde gesagt, ziemlicher Kokolores ist. Ein paar Lügen, ein paar Tatsachen, aber höchstwahrscheinlich nichts darunter, was uns irgendwie weiterhelfen würde. Bei alldem handelt es sich nur um Geschichten, die er erfunden hat, damit die Zeitungen etwas über ihn berichten konnten. Außerdem interessiert es uns doch gar nicht, wie viele Schiffe er besitzt – wir wollen vielmehr wissen, wo er in die Kunst der schwarzen Magie eingeführt wurde und von wem.«
»Und warum er Schattenjäger hasst«, fügte Tessa hinzu.
Will bedachte sie mit einem trägen Blick aus seinen blauen Augen. »Hegt er wirklich Hassgefühle?«, fragte er. »Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass es sich in seinem Falle schlicht um Machtgier handelt. Wenn wir erst einmal aus dem Weg geräumt sind, kann er mit seiner Klockwerk-Armee einfach die Herrschaft an sich reißen.«
Tessa schüttelte den Kopf. »Nein, da steckt mehr dahinter. Es lässt sich nur schwer erklären, aber … er hasst die Nephilim. Für ihn ist das Ganze eine sehr persönliche Angelegenheit. Und es hängt irgendwie mit dieser Uhr zusammen. Es … es scheint, als verlange er Sühne für ein Unrecht oder eine Kränkung, welche die Nephilim ihm zugefügt haben.«
»Wiedergutmachung«, stieß Jem plötzlich hervor und legte den Federhalter beiseite, den er in der Hand hielt.
Verwirrt musterte Will seinen Freund. »Ist das jetzt eine Art Spiel? Wir platzen einfach ungeniert mit jedem Wort heraus, das uns gerade in den Sinn kommt? In diesem Falle hätte ich ›Genuphobie‹ anzubieten. Es bezeichnet die unangemessene Angst vor Knien.«
»Und wie heißt noch mal das Wort für die vollkommen angemessene Angst vor nervigen Blödmännern?«, erkundigte Jessamine sich.
»Die Wiedergutmachungsabteilung des Archivs«, murmelte Jem und ignorierte die beiden Streithähne. »Der Konsul hat während der Sitzung davon gesprochen, und seitdem spukt mir der Begriff im Kopf herum. Dort haben wir noch nicht gesucht.«
»Wiedergutmachung?«, fragte Tessa.
»Wenn ein Schattenweltler – oder ein Irdischer – vorbringt, ein Nephilim habe im Umgang mit ihnen gegen das Gesetz verstoßen, dann legt der Schattenweltler beim Dezernat für Reparationsleistungen offiziell Beschwerde ein. Es erfolgt dann ein Gerichtsverfahren, und wenn der Schattenweltler seine Behauptungen beweisen kann, wird ihm eine Wiedergutmachung zuerkannt.«