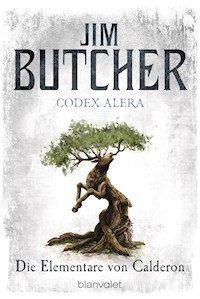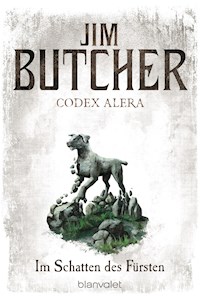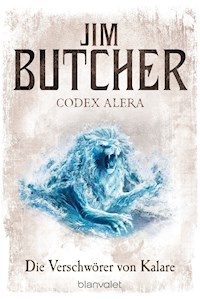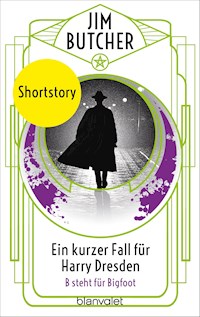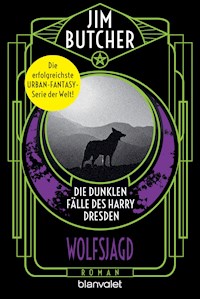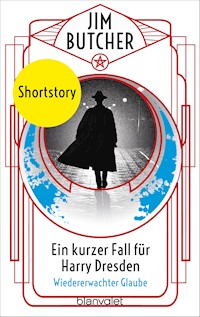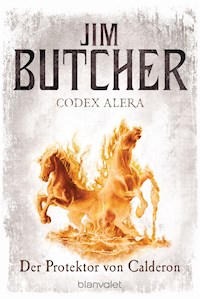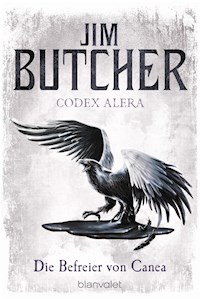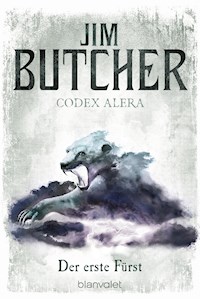
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Codex Alera
- Sprache: Deutsch
Tavi von Calderon, der so lange als magielos verachtet war, sieht sich seiner Bestimmung gegenüber. Denn seine Kräfte sind endlich erwacht, und sie sind größer als die der mächtigsten Fürsten Aleras. Und das geschah keinen Tag zu früh! Die unmenschlichen Vord fallen mit ihren Horden über Alera her. Nichts scheint sie stoppen zu können. Nur wenn Tavi sein Erbe annimmt, kann er die zerstrittenen Parteien des Reiches einen. Denn für das Überleben von Alera ist es nötig, dass die Mächtigen des Reiches ihr Knie vor ihm beugen – dem neuen Ersten Fürsten von Alera!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1051
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Jim Butcher
Der Erste Fürst
Codex Alera 06
Aus dem Englischenvon Maike Claußnitzer
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Codex Alera 06. First Lord’s Fury« bei Ace Books, the Berkley Publishing Group, Penguin Group (USA) Inc., New York.
1.Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2012
bei Blanvalet, einem Unternehmen
der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 2009 by Jim Butcher
Published by Arrangement with Longshot LLC.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012
by Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Umschlagillustration: Max Meinzold
Redaktion: Waltraud Horbas
HK · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-08034-1www.blanvalet.de
Für unsere eigenen Ritter und Legionares, die Männer und Frauen der US-Streitkräfte.Wenn ihr nicht tätet, was ihr tut, könnte ich nicht tun, was ich tue.Danke.
Prolog
Der Wehrhof lag mehrere Meilen südlich der verwüsteten Ödnis, die einst Alera Imperia gewesen war, und er war alt. Windmähnen waren hier seit über sechshundert Jahren nicht mehr gesichtet worden, und Elementarstürme hatte es sogar noch länger nicht mehr gegeben. Das Land bildete seit Jahrhunderten im Umkreis von Meilen einen Flickenteppich aus Äckern, Wehrhöfen, Dörfern und Straßen. Wilde Elementare waren so selten und schwach, dass sie als so gut wie ausgestorben galten.
Infolgedessen war der kleine Wehrhof nicht mit steinernen Umfassungsmauern errichtet worden, auch nicht mit einer soliden zentralen Halle aus Stein, die Zuflucht vor Elementarunwettern bot. Stattdessen bestand er aus einer Ansammlung von Hütten und bescheidenen Häusern, in denen einst jeweils eine Familie getrennt von den anderen in ihrem eigenen Haushalt gelebt hatte.
Aber das war gewesen, bevor die Vord gekommen waren.
Invidia Aquitania stand verborgen in den Schatten am Rande des kleinen Wehrhofs.
Schatten gab es, wenn sie es recht bedachte, in diesen Tagen reichlich.
Der neugeborene Vulkan, der als Grabmal für Gaius Sextus aufragte, des letzten Ersten Fürsten von Alera, hatte in den Tagen und Wochen nach seiner Erschaffung weiter dunkle Rauch- und Aschewolken ausgespien. Sogar jetzt war der Himmel von tiefhängenden Wolken bedeckt, die in launischen Schauern oder heftigem Platzregen für Frühlingsregen sorgten. Manchmal war der Regen gelb oder rot, zuweilen auch grün. Die Wolken selbst wurden sogar nachts von einem zornigen, scharlachroten Licht aus dem Feuerberg im Norden schwach beleuchtet – und aus jeder anderen Richtung vom gleichmäßigen, gespenstischen Schimmer des Kroatsch, der wachsartigen Wucherung, die den Boden, die Bäume, die Gebäude und alle anderen markanten Punkte des Landes bedeckte, das die Vord in Besitz genommen hatten.
Hier hatten die Vord sich besonders tiefgreifend durchgesetzt. Hier, im Herzen dessen, was einst Alera gewesen war, hatten sie sich mehr geholt als irgendwo sonst. Das Kroatsch, die lebende Gegenwart der Vord, bedeckte alles in einem Umkreis von hundert Meilen in jeder Richtung und erstickte jegliches andere Leben im Land.
Nur hier nicht.
Der kleine Wehrhof grünte und blühte. Sein Küchengarten gedieh schon gut, obwohl es noch nicht ganz Sommer war. Sein bescheidener Acker versprach bereits eine schöne Getreideernte. Der Wind rauschte in den Blättern seiner gewaltigen alten Bäume. Sein Vieh graste auf einer üppigen Weide. In der Dunkelheit wirkte er, wenn man von dem gespenstisch beleuchteten Himmel, dem grünen Schimmer des Kroatsch, das sich in alle Richtungen bis an den Horizont erstreckte, und dem gelegentlichen, fremdartigen Kreischen der Vord absah, wie ein gewöhnlicher, wohlhabender aleranischer Wehrhof.
Invidia schauderte.
Der Parasit an ihrem Oberkörper reagierte mit einem unbehaglichen Zucken auf die Bewegung. Da seine zwölf in Dornen auslaufenden Beine sie umschlangen und die scharfen Spitzen mehrere Zoll weit in ihr Fleisch gedrungen waren, verursachte das Schmerzen, aber es war nichts im Vergleich zu den Qualen, die sie litt, wenn er den Kopf verdrehte. Das augenlose Gesicht samt den verzweigten Mundwerkzeugen im Fleisch steckte zwischen zweien ihrer Rippen und grub sich in ihre Eingeweide.
Invidia verabscheute das Geschöpf, auch wenn sie wusste, dass es sie am Leben hielt. Das Gift von dem Balestrenbolzen, der sie fast getötet hätte, hatte sich in ihrem gesamten Körper ausgebreitet. Dort hatte es geschwärt und sie so schnell und heimtückisch von innen aufgezehrt, dass selbst ihre Fähigkeiten im Elementarwirken nichts dagegen hatten ausrichten können. Tagelang hatte sie dagegen angekämpft, als sie aus der Zivilisation geflohen war. Sie war kaum bei Bewusstsein und der festen Überzeugung gewesen, verfolgt zu werden, während der Kampf in ihrem Körper tobte. Sie hatte sich an einer bewaldeten Hügelflanke befunden, als ihr schließlich klar geworden war, dass dieser Kampf nur einen Ausgang nehmen konnte: Sie würde sterben.
Dann aber war die Vordkönigin zu ihr gekommen. Das Bild dieser Kreatur, die ohne einen Anflug von Mitleid oder Einfühlungsvermögen auf sie herabgestarrt hatte, hatte sich tief in ihre Erinnerung eingebrannt und verfolgte sie in ihren Träumen.
Invidia war verzweifelt gewesen. Verängstigt. Wahnsinnig vor Gift und Fieber. Ihr Körper war aufgrund des Schüttelfrosts so verkrampft gewesen, dass sie buchstäblich außerstande war, ihre Arme und Beine zu spüren. Aber sie war in der Lage gewesen, die Vordkönigin und die fremdartige Gegenwart der Kreatur in ihren Gedanken wahrzunehmen. Einen nach dem anderen war sie im Geiste durchgegangen, während ihre Gedanken im Delirium durcheinandergepurzelt waren.
Die Königin hatte Invidia angeboten, ihr das Leben zu retten und sie im Austausch gegen ihre Dienste auch künftig am Leben zu erhalten. Die einzige Alternative war der Tod gewesen.
Obwohl die peinigenden Bewegungen des Parasiten eine Welle der Qual durch ihren Körper branden ließen, ignorierte Invidia sie. In letzter Zeit gab es nicht nur reichlich Schatten, sondern auch reichlich Schmerzen.
Und eine kleine Stimme flüsterte ihr aus einem dunklen, stillen Winkel ihres Herzens zu, dass sie es nicht besser verdient hatte.
»Du kommst immer wieder hierher«, sagte eine junge Frau neben ihr.
Invidia spürte, wie sie vor Überraschung zusammenzuckte und ihr Herz plötzlich zu rasen begann, während der Parasit erschauerte und ihr neuerliche Qualen zufügte. Sie schloss die Augen, konzentrierte sich auf den Schmerz und ließ ihn ihre Sinne ausfüllen, bis in ihrem Verstand kein Hauch von Furcht mehr übrig war.
Man ließ sich vor der Vordkönigin niemals Furcht anmerken.
Invidia drehte sich zu der jungen Frau um und neigte höflich den Kopf. Die Königin sah fast wie eine Aleranerin aus. Sie war auf recht fremdartige Weise hübsch, mit Adlernase und breitem Mund. Sie trug ein schlichtes, zerlumptes Kleid aus grüner Seide, das ihre Schultern unbedeckt ließ und so glatte Muskeln und noch glattere Haut enthüllte. Ihr Haar war lang, fein und weiß und fiel ihr in sanft gewellter Bahn bis auf die Rückseite ihrer Schenkel.
Nur kleine Einzelheiten verrieten ihre wahre Herkunft. Ihre langen Fingernägel waren schwarzgrüne Krallen, die aus demselben stahlharten Vordchitin bestanden, mit dem ihre Krieger gepanzert waren. Ihre Haut wirkte seltsam starr und schien beinahe das ferne Licht des umliegenden Kroatsch widerzuspiegeln, so dass zart der Verlauf grüner Adern unter ihrer Oberfläche sichtbar wurde.
Aber es waren ihre Augen, die Invidia Angst machten, sogar noch nach Monaten in ihrer Gesellschaft. Sie waren an den Augenwinkeln leicht nach oben gezogen, wie die der Marat-Barbaren im Nordosten, und völlig schwarz. In ihnen glänzten insektenartig tausend Facettenlinsen und beobachteten die Welt mit ruhiger Ungerührtheit, ohne je zu blinzeln.
»Ja, das tue ich wohl«, antwortete Invidia ihr. »Ich habe dir ja gesagt, dass dieser Ort ein Risiko darstellt. Doch du scheinst nicht auf meinen Rat hören zu wollen. Also habe ich es auf mich genommen, ihn zu beobachten und sicherzustellen, dass er nicht irgendwelchen Eindringlingen als Versteck oder Hauptquartier dient.«
Die Königin zuckte unbesorgt mit einer Schulter. Die Bewegung war geschmeidig, aber zugleich irgendwie unbeholfen – es war eine Geste, die sie imitierte, aber eindeutig nicht verstand. »Dieser Ort wird permanent bewacht. Niemand könnte unbemerkt hier eindringen.«
»Das haben schon andere gesagt und sich geirrt«, sagte Invidia warnend. »Bedenke doch, was Gräfin Amara und Graf Bernard uns im letzten Winter angetan haben.«
»Das Gebiet war noch nicht gesichert«, antwortete die Königin ruhig. »Dieses hier ist es.« Sie richtete den Blick auf die kleinen Häuser und legte den Kopf schief. »Sie treffen sich jeden Abend zur selben Zeit, um zu essen.«
»Ja«, sagte Invidia. Die aleranischen Bauern, die auf dem kleinen Wehrhof in zusammengestückelten Haushalten wohnten, bestellten die Felder und gingen ihrem Tagewerk nach, als wären sie nicht die Einzigen ihrer Art, die im Umkreis von einem strammen Monatsmarsch lebten.
Sie hatten keine andere Wahl, als auf den Äckern zu arbeiten. Die Vordkönigin hatte ihnen gesagt, dass sie sterben würden, wenn sie es nicht taten.
Invidia seufzte und fuhr fort: »Ja, zur selben Zeit. Man nennt das ›Abendessen‹ oder ›Abendbrot‹.«
»Was von beidem?«, fragte die Königin.
»Im Allgemeinen werden die Ausdrücke austauschbar verwendet.«
Die Vordkönigin runzelte die Stirn. »Warum?«
Invidia schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass unsere Vorfahren eine ganze Anzahl unterschiedlicher Sprachen gesprochen haben und …«
Die Vordkönigin unterbrach sie. »Nein«, sagte sie. »Warum essen sie zusammen?« Sie richtete den Blick wieder auf die kleinen Häuser. »Es besteht doch die Möglichkeit, dass ein größeres und stärkeres Geschöpf den schwächeren das Essen wegnimmt. Es ist ein Gebot der Logik, dass sie allein essen sollten. Und doch tun sie es nicht.«
»Es geht um mehr als nur um bloße Nahrungsaufnahme.«
Die Königin musterte das kleine Haus. »Die Aleraner verschwenden Zeit damit, dass sie ihr Essen auf immer wieder unterschiedliche Weise zubereiten. Ich nehme an, das gemeinsame Essen verringert die Unwirtschaftlichkeit dieser Gewohnheit.«
»Es erleichtert das Kochen, und das ist einer der Gründe, warum es diesen Brauch gibt«, sagte Invidia, »aber nicht der einzige.«
Das Stirnrunzeln der Königin vertiefte sich. »Warum sollte man sonst so essen?«
»Um beieinander zu sein«, sagte Invidia, »um Zeit miteinander zu verbringen. Das ist ein Teil dessen, was eine Familie ausmacht.«
Bei den großen Elementaren, wie wahr! Sie konnte die paar Mahlzeiten, die sie gemeinsam mit ihrem Vater und ihren Brüdern eingenommen hatte, an einer Hand abzählen.
»Gefühlsmäßige Bindungen«, sagte die Vordkönigin.
»Ja«, sagte Invidia. »Und … es ist angenehm.«
Leere schwarze Augen sahen sie an. »Warum?«
Sie zuckte die Schultern. »Es verleiht einem ein Gefühl der Verlässlichkeit«, sagte sie. »Ein tägliches Ritual. Es ist tröstlich, diesen Teil des Tages zu haben und zu wissen, dass er täglich wiederkehren wird.«
»Aber das wird er nicht«, sagte die Königin. »Selbst in einem natürlichen Lebensraum sind die Umstände nicht so unveränderlich. Kinder werden erwachsen und verlassen ihr Zuhause. Gewohnheiten werden von Ereignissen durchbrochen, über die sie keine Kontrolle haben. Die Alten sterben. Die Kranken sterben. Alle sterben.«
»Das wissen sie«, sagte Invidia. Sie schloss die Augen und dachte einen Moment lang an ihre Mutter und die viel zu kurze Zeit, die es ihr vergönnt gewesen war, ihren Tisch, ihre Gesellschaft und ihre Liebe mit ihrer einzigen Tochter zu teilen. Dann öffnete sie die Augen wieder und zwang sich, die albtraumhafte Welt ringsum anzusehen. »Aber es kommt einem nicht so vor, wenn das Essen warm ist und die, die man liebt, um einen versammelt sind.«
Die Vordkönigin sah sie scharf an. »Liebe. Schon wieder.«
»Das habe ich dir doch schon erklärt. Es ist das grundlegendste Gefühl, das uns antreibt. Liebe zu anderen oder zu uns selbst.«
»Hast du so deine Mahlzeiten eingenommen?«
»Als ich noch sehr klein war«, sagte Invidia, »und nur mit meiner Mutter. Sie ist an einer Krankheit gestorben.«
»Und es war angenehm, das Abendessen einzunehmen?«
»Ja.«
»Hast du sie geliebt?«
»So, wie nur Kinder es können«, sagte Invidia.
»Hat sie dich geliebt?«
»Oh ja.«
Die Vordkönigin drehte sich um und sah Invidia geradewegs an. Sie schwieg volle zwei Minuten lang, und als sie endlich sprach, waren die Wörter zur Betonung sorgfältig voneinander getrennt, was der Frage einen seltsam zögerlichen, beinahe kindlichen Anschein verlieh. »Wie hat sich das angefühlt?«
Invidia sah die junge Frau nicht an, das junge Ungeheuer, das mittlerweile einen Großteil der Welt verwüstet hatte. Sie starrte durch das nächste Fenster das Essen an, das auf den Tisch gestellt wurde.
Ungefähr die Hälfte der Leute dort drinnen waren Placider, die gefangen genommen worden waren, als die Vord ihre Eroberung von Ceres abgeschlossen hatten und über die sanft gewellten Ebenen im Umland der Stadt weiter vorgerückt waren. Ein alter Mann und eine Frau befanden sich darunter, die tatsächlich ein Paar waren. Es war auch eine junge Mutter dabei, die außer zwei eigenen Kindern noch drei hatte, die die Vord in ihre Obhut gegeben hatten. Neben ihr saß ein Mann mittleren Alters, ein aleranischer Bauer, der nicht klug oder schnell genug gewesen war, der Gefangennahme zu entgehen, als die Vord Alera Imperia und sein Umland angegriffen hatten. Erwachsene und Kinder waren gleichermaßen müde von einem Arbeitstag auf dem Wehrhof. Sie waren hungrig, durstig und froh über das einfache Mahl, das für sie bereitet worden war. Nach dem Essen würden sie eine Weile in dem Raum mit der Feuerstelle beisammensitzen, sich ein paar Stunden lang mit vollen Mägen und angenehm erschöpften Körpern Zeit für sich selbst nehmen und dann schlafen.
Invidia starrte die kleine Familie an, die wie Treibholz von den Schicksalsschlägen der Eroberung und des Krieges zusammengewürfelt worden war und deshalb nur umso stärker zusammenhielt. Sogar jetzt, da das Ende aller Dinge gekommen war, streckten sie die Hände nacheinander aus und schenkten einander so viel Trost und Wärme, wie sie nur konnten, besonders den Kindern. Sie nickte zu dem kerzenbeschienenen Tisch hinüber, an dem die Erwachsenen tatsächlich das ein oder andere sanfte Lächeln miteinander tauschten, während die Kinder manchmal lächelten oder sogar lachten.
»So«, sagte sie. »Es fühlt sich so an.«
Die junge Königin starrte die Hütte an. Dann sagte sie: »Komm.« Anmutig und unbarmherzig wie eine hungrige Spinne schritt sie vorwärts.
Invidia knirschte mit den Zähnen und blieb, wo sie war. Sie wollte nicht noch mehr Tod sehen.
Doch als der Parasit sich in peinigendem Tadel zu winden begann, folgte Invidia der Vordkönigin.
Die Königin stieß die Tür krachend auf und machte sich nicht erst die Mühe, den Türgriff zu benutzen. Sie zerschmetterte gleich den ganzen Rahmen. Obwohl sie ihre rohe Körperkraft schon zuvor, wenn auch selten, genutzt hatte, war diese angesichts ihrer schlanken Gestalt unglaublich – sogar für Invidia, die es gewohnt war zu sehen, wie Erdwirker übermenschliche Stärke entwickelten. Die Königin marschierte über die Splitter hinweg in die Küche, wo die kleine Familie ihr Abendessen am Tisch einnahm.
Alle erstarrten. Das jüngste Kind, ein schöner kleiner Junge, der vielleicht ein Jahr alt war, stieß ein kurzes Wimmern aus, das die Mutter zum Verstummen brachte, indem sie das Kind packte und ihm mit der Hand den Mund zuhielt.
Die Königin konzentrierte sich auf Mutter und Kind. »Du«, sagte sie und richtete eine tödliche, krallenbewehrte Fingerspitze auf die junge Frau. »Ist das Kind von deinem Blut?«
Die junge Hofbewohnerin starrte die Vordkönigin mit vor Panik weit aufgerissenen Augen an. Sie nickte ein einziges Mal.
Die Vordkönigin trat vor und sagte: »Gib ihn mir.«
Die Augen der Frau füllten sich mit Tränen. Ihr Blick huschte gehetzt durchs Zimmer und versuchte, den irgendeines anderen aufzufangen, der vielleicht etwas unternehmen konnte. Keiner der anderen Hofbewohner brachte es fertig, ihr in die Augen zu sehen. Die junge Mutter schaute flehend zu Invidia auf und begann zu schluchzen. »Herrin«, flüsterte sie, »Herrin, bitte.«
Invidia zog sich der Magen zusammen, und ihr wurde übel, aber sie hatte längst gelernt, dass der Parasit, wenn sie würgte, in Krämpfe verfiel, die sie beinahe umbrachten. Sie aß in letzter Zeit nur noch selten.
»Du hast noch eine Tochter«, sagte sie in ruhigem, hartem Ton zu der jungen Mutter. »Rette sie.«
Der Mann, der neben der Mutter saß, bewegte sich. Er nahm ihr sanft den Jungen aus den Armen, beugte sich vor, um ihn auf die Haare zu küssen, und streckte ihn dann der Vordkönigin hin. Das Kind begehrte wimmernd auf und versuchte, zu seiner Mutter zurückzugelangen.
Die Vordkönigin nahm den Jungen und hielt ihn vor sich. Sie ließ ihn einen Augenblick strampeln und weinen und beobachtete ihn mit ihren fremdartigen Augen. Dann zog sie ganz ruhig den Jungen mit einem Arm eng an ihren Körper und drehte ihm den Kopf ruckartig zu einer Seite. Sein Wimmern verstummte.
Invidia spürte, dass sie nahe daran war, die Kontrolle über ihren Magen zu verlieren, aber dann sah sie, dass das Kind noch lebte. Sein Hals war so verdreht, dass er bald brechen würde, und es atmete mit flachem, mühsamem Keuchen – aber es lebte.
Die Vordkönigin starrte die weinende Mutter einen Moment lang an. Dann sagte sie: »Sie leidet Schmerzen. Ich habe ihr nichts getan, aber sie leidet Schmerzen.«
»Das ist ihr Sohn«, sagte Invidia. »Sie liebt ihn.«
Die Königin legte den Kopf schief. »Und er liebt sie seinerseits?«
»Ja.«
»Warum?«
»Weil es zum Wesen der Liebe gehört, erwidert zu werden, besonders bei Kindern.«
Die Königin legte den Kopf zur anderen Seite. Dann starrte sie auf das Kind hinab. Dann sah sie die junge Mutter an. Dann den Mann, der neben ihr saß. Sie beugte sich vor, drückte die Lippen auf das Haar des Kindes und hielt einen Moment lang inne, als ob sie darüber nachdachte, wie es sich anfühlte.
Schließlich entließ sie mit langsamen, vorsichtigen Bewegungen das Kind aus ihrem Griff und reichte es der weinenden Mutter zurück. Die junge Frau begann zitternd zu schluchzen und hielt den Jungen eng an sich gedrückt.
Die Vordkönigin drehte sich um und verließ das Haus. Invidia folgte ihr.
Die junge Königin ging einen nahen Hügel hinauf und blieb, sobald sie die Kuppe erreicht hatten und freie Sicht auf eine Vordlandschaft hatten, die sich vor ihnen erstreckte, einen Moment lang mit dem Rücken zum kleinen Wehrhof stehen. »Liebe wird unter deinesgleichen nicht immer erwidert.«
»Nein«, sagte Invidia schlicht.
»Wenn sie nicht erwidert wird«, sagte die Königin, »fügt das dem, der liebt, eine Art Schmerz zu.«
»Ja.«
»Das ist unvernünftig«, sagte die Königin – und zu Invidias Entsetzen wohnte ihren Worten unterdrückte Hitzigkeit inne. Wut. Die Vordkönigin war wütend.
Invidia spürte, wie ihr der Mund trocken wurde.
»Unvernünftig«, sagte die Königin. Ihre Finger zuckten, und die Nägel wuchsen und schrumpften abwechselnd. »Verschwenderisch. Unwirtschaftlich.«
Invidia sagte nichts.
Die Vordkönigin wirbelte jäh herum, so schnell, dass Invidia der Bewegung kaum mit Blicken folgen konnte. Sie starrte Invidia aus undurchschaubaren, fremdartigen Augen an. Invidia konnte ihr eigenes Spiegelbild tausendfach darin sehen. Es war das Bild einer bleichen, halb verhungerten Frau mit dunklem Haar, die nur einen Panzer aus Vordchitin trug, der so eng anlag wie ihre eigene Haut.
»Morgen«, sagte die Vordkönigin, und schwelender Zorn erfüllte den sonst ausdruckslosen Tonfall ihrer Stimme, »werden du und ich ein Abendessen einnehmen. Gemeinsam.«
Dann drehte sie sich um und verschwand in einem Wirbel grüner Seide in den endlosen sanften Wellen des Kroatsch.
Invidia kämpfte gegen das Entsetzen an, das sich in ihrem Magen ausbreitete. Sie starrte wieder auf die Ansammlung von Hütten hinab. Von ihrem Standort auf dem Hügel aus sah der Wehrhof wunderschön aus, mit Elementarlampen, die in den Häusern und auf dem kleinen Platz dazwischen glommen. Ein Pferd wieherte auf einer nahen Weide. Ein Hund bellte mehrfach. Die Bäume, die Hütten, alles wirkte so makellos. Wie Puppenhäuser.
Invidia bemühte sich, ein Auflachen zu unterdrücken, das durch den Wahnsinn der vergangenen Monate aufzusteigen drohte; sie hatte Angst, dass sie nicht mehr würde aufhören können, wenn sie einmal zu lachen begann.
Puppenhäuser.
Die Vordkönigin war schließlich noch keine neun Jahre alt. Vielleicht waren sie also tatsächlich nur Spielzeug für sie.
Varg, Kriegsführer des verlorenen Landes Narash, hörte den vertrauten Klang der Schritte seines Welpen auf dem Deck der Treues Blut, des Flaggschiffs der Flotte von Narash. Er zog in grimmiger Erheiterung die Lefzen zurück und entblößte seine Zähne. Konnte das überhaupt noch das Flaggschiff der Flotte von Narash sein, wenn es Narash selbst nicht mehr gab? Dem Kodex und dem Gesetz nach bildete sie das letzte Stück unabhängigen narashanischen Gebiets in ganz Carna. Aber konnte der Gesetzeskodex von Narash tatsächlich als Gesetz betrachtet werden, wenn es kein Gebiet mehr gab, in dem er galt? Wenn nicht, dann war die Treues Blut nicht mehr als Holz, Tauwerk und Segel. Es gehörte keiner Nation an und hatte keine Bedeutung mehr, sondern war einfach nur ein Fortbewegungsmittel.
Genau wie Varg selbst keine Bedeutung mehr hatte – ein Kriegsführer, der kein Gebiet mehr schützen konnte.
Bitterer Zorn loderte einen Augenblick lang wie eine Feuergarbe in ihm auf, und die weißen Wolken und das blaue Meer, die er durchs Fenster der Kajüte sehen konnte, wurden schlagartig rot. Die Vord. Die verfluchten Vord. Sie hatten seine Heimat zerstört und sein Volk ermordet. Von den Millionen von Narashanern hatten weniger als hunderttausend überlebt – und er würde die Vord für ihre Taten zur Verantwortung ziehen.
Er zügelte seinen Zorn, bevor er ihn in den Blutrausch treiben konnte, und atmete tief ein und aus, bis die normalen Farben des Tageslichts zurückkehrten. Die Vord würden bezahlen. Zur rechten Zeit und am rechten Ort würde er Rache nehmen, aber nicht hier und jetzt.
Er berührte mit einer Krallenspitze die Buchseite und blätterte vorsichtig zur nächsten um. Es war ein zartes Kunstwerk, dieses aleranische Buch, ein Geschenk von Tavar. Wie der junge aleranische Dämon war es winzig und zerbrechlich und enthielt zugleich viel mehr, als das Äußere ahnen ließ. Wenn nur die Buchstaben nicht so winzig gedruckt gewesen wären! So war das Lesen fürchterlich anstrengend für Vargs Augen. Man musste sich das Ding bei Tageslicht vornehmen. Mit einer ordentlichen mattroten Lampe konnte er überhaupt nichts erkennen.
Jemand kratzte höflich an der Tür.
»Herein«, grollte Varg, und sein Welpe, Nasaug, betrat die Kajüte. Der jüngere Cane bot respektvoll die Kehle dar, und Varg erwiderte die Geste etwas weniger betont.
Welpe, dachte Varg, während er seinen Sprössling voller Zuneigung musterte. Er ist vierhundert Jahre alt und sollte jedem vernünftigen Maßstab nach schon selbst Kriegsführer sein. Er hat zwei Jahre lang auf ihrem eigenen Grund und Boden gegen diese verfluchten aleranischen Dämonen gekämpft und ist trotz ihrer Macht entkommen. Aber ich nehme an, ein Vater vergisst nie, wie klein seine Welpen einmal waren.
»Meldung«, knurrte er.
»Meister Khral ist an Bord gekommen«, grollte Nasaug. »Er bittet um eine Audienz.«
Varg bleckte die Zähne. Er legte behutsam ein buntes Stoffstück zwischen die Seiten des Buchs und schloss es sanft. »Schon wieder.«
»Soll ich ihn zurück in sein Boot werfen?«, fragte Nasaug. Seine Stimme hatte einen leise sehnsüchtigen Unterton.
»Ich bin schwer in Versuchung«, sagte Varg. »Aber nein. Es ist dem Kodex nach sein Recht, Wiedergutmachung für Missstände zu verlangen. Bring ihn her.«
Nasaug entblößte abermals die Kehle und verließ die Kajüte. Einen Augenblick später öffnete sich die Tür erneut und Meister Khral trat ein. Er war fast so hochgewachsen wie Varg, eher neun als acht Fuß groß, wenn er sich zu voller Höhe aufrichtete, aber anders als der Canekrieger war er dünn wie eine Peitschenschnur. Sein Fell war rotbraun gefleckt und wies Streifen weißen Haars auf, die aus Narben wuchsen, die er sich in Ritualen und nicht im ehrlichen Kampf zugezogen hatte. Er trug einen Kapuzenumhang aus Dämonenhaut, obwohl Varg ihn mehrfach gebeten hatte, das Kleidungsstück nicht vor der ganzen Flotte zur Schau zu tragen; immerhin bestand es aus den Häuten jener Geschöpfe, die sie im Augenblick alle am Leben hielten. Khral trug zwei Beutel an über dem Körper gekreuzten Gürteln. Sie enthielten jeweils eine Blase mit Blut, das die Ritualisten benötigten, um ihre Zauber zu wirken. Er roch nach unsauberem Pelz und verfaultem Blut; außerdem war er offensichtlich zu töricht, um einzusehen, dass das Selbstbewusstsein, nach dem er stank, in Wirklichkeit unbegründet war.
Der oberste Ritualist starrte Varg ruhig mehrere Sekunden lang an, bevor er endlich die Kehle gerade lange genug entblößte, um Varg keinen Vorwand zu verschaffen, sie ihm herauszureißen. Varg erwiderte die Geste überhaupt nicht. »Meister Khral. Was gibt es?«
»Wie jeden Tag, Kriegsführer«, antwortete Khral, »bin ich hier, um dich im Namen der Völker von Narash und Shuar zu bitten, einen anderen Weg einzuschlagen. Deine Entscheidung, unser Volk an die Dämonen zu binden, ist gefährlich.«
»Ich habe gehört«, knurrte Varg, »dass auch die Völker von Narash und Shuar gern essen.«
Khral lächelte hämisch. »Wir sind Canim«, stieß er hervor. »Wir brauchen niemanden, der uns hilft, unsere Bestimmung zu erfüllen. Vor allem keine Dämonen.«
Varg grummelte: »Gut. Wir werden uns unserem Schicksal allein stellen. Aber Nahrung zu erhalten ist etwas ganz anderes.«
»Sie werden sich gegen uns wenden«, sagte Khral. »Sobald sie uns nicht mehr brauchen, werden sie sich gegen uns wenden und uns vernichten. Du weißt, dass das wahr ist.«
»Es ist wahr«, sagte Varg, »aber erst morgen. Ich führe heute den Befehl.«
Khrals Schwanz zuckte verärgert. »Wenn wir uns erst von den Eisschiffen getrennt haben, können wir schneller vorankommen und binnen einer Woche Land erreichen.«
»Wir können uns selbst zu Leviathanfutter machen, meinst du«, antwortete Varg. »Es gibt keine Seekarten, die das Meer so weit nördlich abbilden. Wir hätten keine Möglichkeit herauszufinden, ob wir ins Revier eines Leviathans eingedrungen sind.«
»Wir sind die Herren der Welt. Wir haben keine Angst.«
Varg knurrte tief in der Brust. »Es ist immer wieder bemerkenswert, wie oft Dilettanten Mut und Torheit miteinander verwechseln.«
Die Augen des Ritualisten verengten sich. »Wir würden vielleicht hier und da ein Schiff verlieren«, räumte Khral ein, »aber wir würden unser Leben nicht der Barmherzigkeit dieser Dämonen verdanken. Eine Woche, dann können wir uns selbstständig an den Wiederaufbau machen.«
»Die Eisschiffe zurücklassen«, sagte Varg. »Die Schiffe also, die mehr als die Hälfte der Überlebenden unseres Volkes befördern.«
»Wir müssen Opfer bringen, wenn wir uns selbst treu bleiben wollen«, verkündete Khral, »und wenn unser Geist, unser Stolz und unsere Kraft rein bleiben sollen.«
»Mir ist aufgefallen, dass Leute, die so daherreden wie du, selten bereit sind, sich selbst zu denen zu rechnen, die geopfert werden müssen.«
Ein wütendes Knurren drang aus Khrals Kehle, und eine Pfotenhand sauste zu einem der Beutel, die er an der Hüfte trug.
Varg richtete sich noch nicht einmal aus der Hocke auf. Seine Arme bewegten sich und drehten sich im Schultergelenk mit sehniger Kraft, als er das aleranische Buch nach Khral warf. Es segelte in einer verschwommenen Drehbewegung durch die Luft, und der harte Buchrücken traf den obersten Ritualisten an der Kehle. Der Aufprall schleuderte Khrals Schultern an die Kajütentür, und er prallte davon ab, landete auf dem Boden und gab würgende Laute von sich.
Varg stand auf und ging zu dem Buch hinüber. Es hatte sich geöffnet, und einige der zarten Seiten waren stark geknickt. Varg hob es behutsam auf, strich die Seiten glatt und betrachtete die aleranische Schöpfung noch einmal. Wie Tavar, so dachte er, war es offenbar gefährlicher, als es auf den ersten Blick wirkte.
Varg stand eine Weile da und sah zu, wie Khrals Keuchen Stück für Stück zu schwerem Atmen wurde. Er hatte dem Ritualisten die Luftröhre offenbar nicht ganz zerschmettert. Das war schade, denn jetzt würde er den Narren morgen wieder ertragen müssen. Nachdem er die heutige Auseinandersetzung überlebt hatte, war es unwahrscheinlich, dass Khral Varg noch einmal eine solche Gelegenheit bieten würde, sich seiner zu entledigen.
So sei es. Irgendein ehrgeiziger Handlanger hätte aus einem toten Khral vielleicht einen Märtyrer gemacht. Es war nur zu gut möglich, dass der Ritualist tot gefährlicher wäre als lebendig.
»Nasaug«, rief Varg.
Der Welpe öffnete die Tür und musterte die auf dem Boden ausgestreckte Gestalt. »Kriegsführer?«
»Meister Khral ist bereit, auf sein Boot zurückzukehren.«
Nasaug bot ihm die Kehle dar und verbarg seine Erheiterung nicht ganz. »Sofort, Kriegsführer.« Er bückte sich, packte Khral am Knöchel und schleifte ihn einfach aus der Kajüte.
Varg ließ Nasaug ein paar Minuten Zeit, Khral zurück auf sein Boot zu bringen, und schritt dann selbst aufs Deck der Treues Blut hinaus.
Das Schiff war schwarz gestrichen, wie die meisten aus Narash. Das erleichterte das heimliche Segeln bei Nacht und zog tagsüber genug Wärme an, um die klebrige Versiegelung des Rumpfs dehnbar und wasserdicht zu halten. Die Farbe verlieh den Schiffen auch etwas Bedrohliches, vor allem in den Augen der aleranischen Dämonen. Sie waren nachts fast blind und strichen ihre eigenen Schiffe weiß, so dass sie sie im Dunkeln ein wenig besser sehen konnten. Allein die Vorstellung, ein schwarzes Schiff zu haben, war ihnen fremd, und vor der Dunkelheit empfand ihre Art eine urtümliche Furcht. Die Blindheit und Angst hielt sie zwar aufgrund der Hexerei, über die sie geboten, nicht von jeglichen Angriffen ab. Doch sie verhinderten, dass Einzelne oder kleine Gruppen den Versuch unternahmen, aus welchem Grund auch immer ein narashanisches Schiff zu entern.
Die Aleraner waren vieles, aber sie waren nicht dumm. Keinem von ihnen gefiel der Gedanke, in der Dunkelheit herumzustolpern, wenn die nachtkundigen Canim es auf sie abgesehen hatten.
Varg ging zum Bug des Schiffs und starrte hinaus aufs Meer. Sie befanden sich in Gewässern, die Hunderte von Meilen nördlich von jenen lagen, die er befahren hatte, und das Meer war bewegt. Das Wetter war klar geblieben, entweder aus schierem Glück oder dank der aleranischen Zauberei, und die Flotte hatte die lange, langsame Fahrt von Canea her ohne ernste Zwischenfälle überstanden – etwas, das Varg noch vor ein paar Monaten für so gut wie unmöglich gehalten hätte.
Die Reise von Canea nach Alera dauerte unter halbwegs günstigen Windbedingungen auf einem Segelschiff etwa einen Monat. Sie hatten über drei Monate gebraucht, um bis hierherzukommen, und bei ihrer jetzigen Geschwindigkeit lagen immer noch drei Wochen auf dem Ozean vor ihnen. Varg richtete den Blick nach Süden. Dort befand sich der Grund für ihr schleichendes Tempo.
Drei unglaublich gewaltige Schiffe fuhren in der Mitte der Flotte, ragten wie Berge aus dem Meer auf und ließen sogar die Treues Blut winzig und unbedeutend erscheinen. Aber ihre Größe war noch nicht das Bemerkenswerteste an ihnen.
Sie waren aus Eis gebaut.
Die Aleraner hatten ihre Hexenkünste benutzt, um Eisberge, die ein Gletscher gekalbt hatte, in seetüchtige Fahrzeuge umzuformen, die über mehrere Decks und einen riesigen Laderaum für ihre kostbare Fracht verfügten – alles, was vom einst stolzen Canea noch übrig war. Erzeuger, Weibchen und Welpen drängten sich auf den drei Schiffen, und die narashanischen Kapitäne der Begleitfahrzeuge hatten Befehl, das Blut ihrer Mannschaften wie Wasser zu vergießen, wenn das nötig war, um die Zivilisten zu schützen.
Die Schiffe hatten riesige, flache Decks, und kein Mast konnte hoch oder breit genug sein, um genügend Segel anzubringen, die solch ein Schiff bewegten. Aber die Aleraner hatten das Problem mit ihrem typischen Einfallsreichtum gelöst. Hunderte von Pfählen mit Querbalken waren auf dem obersten Deck aufgestellt, und an ihnen blähte sich jede nur erdenkliche Art von Stoff. Das allein hätte die Eisberge noch nicht voranbewegt, aber Tavar war der zutreffenden Ansicht, dass selbst ein kleiner Beitrag auf die Dauer etwas bewirken würde. Zusätzlich waren die Winddämonen der aleranischen Flotte beauftragt worden, eine Brise aufkommen zu lassen, die den Wasserdämonen, die die gewaltigen Schiffe wirklich antrieben, die Bürde etwas erleichterte.
Da die Eisschiffe vor allem von aleranischer Zauberei angetrieben wurden, lagen sie, wie sich erwiesen hatte, ruhiger als alle anderen im Wasser. Wenn die Quartiere seiner Leute auch etwas kalt waren – allerdings weniger, als man hätte annehmen können –, so war diese Unbequemlichkeit doch ein geringer Preis für ihr Überleben. Einige Alte und Kranke waren auf Vargs Schiffe verlegt worden, um der Kälte zu entgehen, aber überwiegend hatte sich alles ohne größere Schwierigkeiten entwickelt.
Varg schaute auf und ließ dann den Blick über sein Schiff schweifen, um seinen Seeleuten bei der Arbeit zuzusehen. Seine Krieger und Matrosen waren schmerzlich abgemagert, sahen aber noch nicht wie wandelnde Leichen aus. Die Rationen hatten während der Flucht in aller Eile gesammelt werden müssen, und es galt, Tausende von hungrigen Mäulern zu stopfen. Das erste Anrecht auf Essen hatten die aleranischen Wind- und Wasserdämonen, dicht gefolgt von den Matrosen und Zivilisten. Dann kamen die Dämonenlegionen, da ihre schwache Konstitution diese Stütze nötig hatte, und als letzte Vargs Krieger. Die Reihenfolge wäre in mageren Zeiten auf einem Landfeldzug vielleicht genau umgekehrt gewesen, aber hier, auf dem offenen Meer, wurden diejenigen bevorzugt, die für das Vorankommen und den Zweck der Flotte am wichtigsten waren.
Varg sah zu, wie ein Jagdschiff von außerhalb der Formation in die Flotte hineinsegelte. Es bewegte sich schwerfällig, obwohl alle Segel gesetzt waren, aber seine Geschwindigkeit reichte aus, um die Eisschiffe einzuholen. Etwas Riesiges trieb im Wasser hinter dem Jagdschiff: Der Kadaver eines mittelgroßen Leviathans. Auch das war ein Werk der Dämonen. Leviathane verteidigten ihr Revier heftig, aber sie hassten die Kälte der abgekühlten See in der Umgebung der Eisschiffe. Jagdschiffe segelten aus dem bitterkalten Wasser heraus, um die Aufmerksamkeit eines Leviathans auf sich zu ziehen. Dann arbeiteten Luft- und Wasserdämonen zusammen, um ihn zu erlegen, manchmal, indem sie die Kreaturen mit Luft erstickten, während sie sich noch im Wasser befanden.
Es war ein gefahrvolles Unterfangen. Zwei von zehn Jagdschiffen kehrten nicht zurück, aber die, die es taten, brachten mit den erlegten Leviathanen genug Essen mit, um die ganze Flotte zwei Tage lang zu ernähren. Der Geschmack von Leviathanfleisch und -fett war unbeschreiblich abstoßend, aber es hielt den Körper am Leben.
Nasaug stellte sich neben Varg und beobachtete gemeinsam mit ihm das Jagdschiff. »Kriegsführer.«
»Ist der gute Ritualist fort?«
»Ja«, sagte Nasaug, »und verstimmt.«
Varg bleckte die Zähne zu einem Grinsen.
»Vater«, sagte Nasaug und hielt dann inne, um seine Worte sorgfältig zu wählen. Varg wandte sich ihm zu und wartete ab. Wenn Nasaug sich so verhielt, war das, was er zu sagen hatte, in aller Regel unerfreulich – und hörenswert.
»In drei Wochen erreichen wir Alera«, sagte Nasaug.
»Ja.«
»Und kämpfen an der Seite der Dämonen gegen die Vord.«
»Ja.«
Nasaug schwieg eine ganze Weile. Dann sagte er: »Khral ist ein intriganter Narr, aber ganz Unrecht hat er nicht. Die Aleraner haben keinen Grund, uns am Leben zu lassen, wenn wir den Krieg erst gewonnen haben.«
Vargs Ohren zuckten amüsiert. »Erst einmal müssen wir den Krieg gewinnen«, grollte er. »In der Zeit kann noch viel geschehen. Nur Geduld.«
Nasaug wackelte zustimmend mit den Ohren. »Khral baut sich eine Gefolgschaft auf. Hält Reden vor Versammlungen auf den Eisschiffen. Unsere Leute haben Angst, und diese Angst nutzt er aus.«
»Das tun Blutsprecher gewöhnlich«, sagte Varg.
»Er könnte eine Gefahr darstellen.«
»Das tun Narren oft.«
Nasaug widersprach ihm nicht, aber das tat er ohnehin selten. Der jüngere Cane straffte resigniert die Schultern und sah aufs Meer hinaus.
Varg legte seinem Welpen eine Hand auf die Schulter. »Ich kenne Khral. Ich kenne seinesgleichen. Wie sie denken. Wie sie handeln. Ich hatte schon mit ihnen zu tun, und du auch, als du Sarl an den Tavar verfüttert hast.«
Nasaug fletschte die Reißzähne zu einem Grinsen, als er sich daran erinnerte.
Varg nickte. »Wenn nötig, werden wir noch einmal mit ihnen fertig.«
»Es wäre vielleicht besser, dieses Problem jetzt und nicht erst später zu lösen.«
Varg knurrte: »Er hat noch nicht gegen den Kodex verstoßen. Ich werde ihn nicht grundlos töten.«
Nasaug schwieg wieder eine Weile. Dann sah er zu der winzigen, beengten Kajüte hinüber, die gleich hinter der Back angebaut war und das stinkendste und unbequemste Quartier auf dem ganzen Schiff bildete.
Dort hausten Vargs Jäger.
»Der Daseinszweck der Jäger besteht nicht darin, den Kodex zu umgehen«, knurrte Varg, »sondern darin, seinen Geist gegen seine Buchstaben zu bewahren. Natürlich könnten sie die Aufgabe erledigen. Aber das würde Khrals ehrgeizige Handlanger nur noch mehr entflammen und ihnen einen echten Grund zur Klage geben, auf den sie ihre Anhänger einschwören könnten. Vielleicht brauchen wir die Ritualisten noch, bevor alles zu Ende ist.« Er stützte die Pfotenhände auf die Reling, hielt die Nase in den Wind und schmeckte den Himmel und das Meer. »Meister Marok ist der Bruder eines meiner besten Feinde und der rangälteste Anhänger des Alten Weges. In ihm habe ich einen Unterstützer im Ritualistenlager.«
Nasaug zuckte zustimmend mit den Ohren und schien sich ein wenig zu entspannen. Er blieb eine Weile neben seinem Vater stehen, entblößte dann die Kehle und widmete sich wieder seinen Pflichten.
Varg verbrachte ungefähr eine Stunde an Deck, inspizierte alles, sprach aufmunternde Worte und knurrte über Unvollkommenes. Ansonsten war alles ruhig, was ihn misstrauisch machte. Auf dieser Überfahrt hatte es nicht annähernd genug Feindseligkeiten gegeben. Das Verhängnis bewahrte sich seinen Balestrenbolzen auf, bis es sicher sein konnte, dass er tödlich treffen würde.
Varg kehrte zu seinem Buch zurück, einer alten aleranischen Schrift, die anscheinend noch aus der Vorgeschichte des Volkes überliefert war. Tavar hatte gesagt, dass man sich nicht sicher war, wie viel von dem Material originalgetreu und wie viel hinzugefügt worden war. Wenn aber auch nur die Hälfte davon stimmte, dann war der darin beschriebene aleranische Kriegsführer fähig, wenn auch etwas arrogant gewesen. Es war leicht zu verstehen, warum seine Lebenserinnerungen die Strategie und Taktik der aleranischen Legionen beeinflusst hatten.
Allerdings, so überlegte Varg, war er nicht unbedingt überzeugt davon, dass dieser Mann, ein gewisser Julius – wer immer er auch sein mochte! –, Tavar noch viel beizubringen gehabt hätte.
Ritter Ehren ex Cursori schritt auf das Zelt im Herzen des riesigen Legionslagers vor den Mauern der alten Stadt Riva zu. Er schaute den Hügel hinauf zu der ummauerten Stadt und fühlte, wie schon zum hundertsten Mal binnen weniger Tage, ein Unbehagen in sich aufsteigen. Die Mauern von Riva waren hoch und dick – und spendeten Ehren auffallend wenig Trost, wenn er bedachte, dass er und die überlebenden Legionen unter dem Befehl des Ersten Fürsten Aquitania sich außerhalb von ihnen befanden. Traditionell war das schließlich der Ort, an dem die Feinde zusammenströmten, wenn sie eine Stadt angreifen wollten.
Oh, gewiss, die Palisaden um jedes Legionslager bildeten durchaus eine Barriere, die man verteidigen konnte, und das wusste er auch. Aber die bescheidenen Erdwälle und hölzernen Pfähle waren nicht genug, um die Vord aufzuhalten.
Allerdings hatten selbst die Mauern von Alera Imperia sie nicht aufgehalten.
Ehren schüttelte den Kopf und schob die schwermütigen Gedanken mit einem Seufzen beiseite. Es nützte nichts, über etwas nachzugrübeln, das sogar der wahre Erste Fürst von Alera, Gaius Sextus, nicht hatte aufhalten können. Aber wenigstens hatte Gaius im Sterben dem Volk von Alera die Gelegenheit verschafft, um sein Leben zu kämpfen. Der Feuerberg, der sich aufgetürmt hatte, als die Vord die Kiefer um das Herz von Alera geschlossen hatten, hatte ihre Horde so gut wie ausgelöscht, und die Legionen, die Gaius Isana unverhofft aus den weitentfernten nördlichen Städten herangeführt hatte, hatten die Überlebenden übel zugerichtet.
Gegen jeden anderen Feind, dem die Aleraner je gegenübergestanden hatten, hätte das wohl ausgereicht, wie Ehren nun dachte. Es kam ihm ziemlich ungerecht vor, dass solch ein gewaltiger Akt sinnloser Zerstörung nicht mehr als einen mäßigen Rückschlag bewirkt haben sollte, ganz gleich, wer der Feind war.
Ein ruhiger, vernünftiger Teil seines Verstands – der Teil, der sich um die Mathematik kümmerte, wenn er es mit Zahlenkolonnen zu tun hatte – sagte ihm, dass die Vord Aleras letzter Feind sein würden. Es gab keine Möglichkeit, überhaupt keine, sie mit den Streitkräften zu schlagen, die Alera noch übrig hatte. Sie vermehrten sich einfach zu schnell. In den meisten Kriegen kam es letztendlich auf die Zahl der Kämpfer an. Und die Vord waren in der Überzahl.
So einfach war das.
Ehren befahl jenem Teil seines Verstands nun allerdings mit Nachdruck, sich zu den Krähen zu scheren. Es war seine Pflicht, dem Reich zu dienen und es zu schützen, so gut er nur konnte, und er würde diese Pflicht nicht besser erfüllen können, wenn er sich solch entmutigender Schwarzmalerei hingab, ganz gleich, wie zutreffend sie historisch – und im Wortsinn – auch sein mochte.
Schließlich war selbst das in die Knie gezwungene Alera noch eine Macht, die man nicht unterschätzen durfte. Die größte Versammlung von Legionen seit tausend Jahren war in der offenen Ebene um die Stadt Riva herum zusammengeströmt, und die Mehrzahl von ihnen bestand aus Veteranen aus den ständig miteinander in Fehde liegenden Städten Antillus und Phrygia. Oh, gewiss, einige der Truppen gehörten zur Miliz, aber die Miliz der Schwesterstädte des Nordens war ohne Übertreibung so furchteinflößend wie die aktiven Legionen des Südens, und die Schmieden stellten schneller als in jeder anderen Epoche der aleranischen Geschichte Waffen und Rüstungen für die Legionen her. Wenn sie noch mehr Ausrüstungsgegenstände hätten fertigen können, hätte das Reich sogar genug Freiwillige für noch ein Dutzend Legionen aufbieten können, um die dreißig, die hier schon lagerten, zu verstärken.
Ehren schüttelte den Kopf. Dreißig Legionen. Knapp über zweihunderttausend in Stahl gehüllte Legionares, von denen jeder zu einer Legion gehörte, einer lebenden, atmenden Kriegsmaschine. Die niederen Ränge der Civitas waren auf die Legionen verteilt worden, so viele, dass jede Legion hier eine kampfbereite Ritterkohorte in doppelter Sollstärke hatte. Und darüber hinaus setzte eine ganze verdammte Legion Aeris schon monatelang dem Feind zu; in deren Reihen dienten nur fähige Ritter Aeris, geführt von den oberen Rängen der Civitas.
Und hinter dieser Truppe standen noch der Erste Fürst und die Hohen Fürsten des Reichs, von denen jeder Einzelne ein Elementarwirker von beinahe unbeschreiblicher Machtfülle war. In diesem Lager kam genug Kraft zusammen, um die Erde selbst bis auf die Knochen zu zerfetzen, den Himmel in Flammen aufgehen zu lassen, das hungrige Meer aus dem Norden herabzurufen, die Winde zu einer tödlichen Sichel zu formen, die jeden niedermähen würde, der vor ihr stand, und das alles geschützt von einem brodelnden Meer aus Stahl und Disziplin.
Und doch strömten immer mehr Menschen auf der Flucht vor der Verwüstung herbei, die sich vom Herzen des Reichs her ausbreitete. Die Stimmen der Zenturionen, die ihre Truppen drillten, hatten einen verzweifelten Unterton. Kuriere, die auf dem Wind ritten, tosten auf donnernden Säulen elementargeführter Luft in den Himmel, so viele, dass der Princeps gezwungen gewesen war, die Einflugschneisen einzuteilen, um Zusammenstöße zwischen den Fliegern zu vermeiden. Schmiede ließen die Feuer in ihren Essen Tag und Nacht brennen, widmeten sich der Herstellung, Vorbereitung und Reparatur und würden das auch weiter tun, bis sie von den Vord überrannt wurden.
Und Ehren wusste, was hinter alledem stand.
Angst. Schieres Entsetzen.
Obwohl die gesammelte Macht von ganz Alera sich meilenweit um Riva erstreckte, war die Angst ein Geruch, der der Luft anhaftete, ein Schatten, den man immer aus dem Augenwinkel lauern sah. Die Vord kamen, und ruhige, leise Stimmen flüsterten jedem denkfähigen Verstand zu, dass sogar die Macht, die hier versammelt war, nicht ausreichen würde. Obwohl Gaius Sextus wie ein in die Enge getriebener wilder Gargant gestorben war und seine Feinde im Fallen zermalmt hatte, gab es nichts an der Tatsache zu rütteln, dass er gefallen war. Ein unausgesprochener Gedanke lauerte hinter den Augen eines jeden: Wenn selbst Gaius Sextus die Vord nicht hatte überleben können, wie wahrscheinlich war es dann für jeden anderen, dass er entkommen konnte?
Ehren nickte dem Befehlshaber der zwanzig Wachen zu, die das Kommandozelt umstanden, nannte die gültige Lösung und wurde ins Zelt eingelassen, ohne auch nur seinen Schritt verlangsamen zu müssen. Ohnehin verlangsamte in diesen Tagen nicht viel Ehrens Schritte, wenn er es recht bedachte. Gaius Sextus’ Brief an den damaligen Hohen Fürsten von Aquitania hatte anscheinend unter anderem auch das bewirkt.
»Fünf Monate«, knurrte eine grollende Stimme, als Ehren das Zelt betrat. »Wir sitzen nun schon seit fünf Monaten hier. Wir hätten schon vor Wochen nach Süden gegen die Vord ziehen sollen!«
»Du bist ein brillanter Taktiker, Raucus«, antwortete eine tiefere, leisere Stimme. »Aber langfristige Planungen waren noch nie deine Stärke. Wir können nicht wissen, was für Überraschungen die Vord jetzt am Boden für uns bereithalten, nachdem sie Zeit hatten, sich vorzubereiten.«
»Es hat nie irgendetwas auf Verteidigungsstellungen hingewiesen«, gab Antillus Raucus, der Hohe Fürst Antillus, zurück, als Ehren die zweite Zeltklappe beiseiteschlug und das eigentliche Zelt betrat. Raucus sah den Princeps über einen Sandtisch von doppelter Größe hinweg an, der in der Mitte des Zelts stand und eine Karte von Alera zeigte. Raucus war ein großer, muskulöser Mann mit wettergegerbtem Gesicht, das die Winterwinde seit langem gewohnt war, und trug die Narben eines Soldaten auf den Wangen und an den Händen, Erinnerungen an Risse und Schnitte, die so zahlreich und häufig gewesen waren, dass noch nicht einmal seine beträchtlichen Fähigkeiten im Elementarwirken ausgereicht hatten, sie zu glätten. »Das hier ist die schlagkräftigste Streitmacht, die in unserer gesamten Geschichte je zusammengezogen worden ist. Wir sollten diese Armee nehmen, sie ihnen in den Rachen rammen und diese Schlampe von einer Königin töten. Jetzt. Noch heute.«
Der Erste Fürst war ein Löwe von einem Mann, hochgewachsen und schlank, mit dunkelgoldenem Haar und schwarzen, undurchdringlichen Augen unter dem schlichten, schmucklosen Stahlband seines Diadems, der traditionellen Krone eines Ersten Fürsten im Krieg. Immer noch in seine eigenen Farben Scharlachrot und Schwarz gekleidet, nahm Aquitanius Attis – wohl eigentlich Gaius Aquitanius Attis, da Sextus den Mann in seinem letzten Brief in aller Form adoptiert hatte – Raucus’ nachdrückliche Äußerung mit völligem Gleichmut auf. In der Hinsicht zumindest war er tatsächlich wie Sextus, dachte Ehren.
Der Erste Fürst schüttelte den Kopf. »Die Vord sind uns offensichtlich fremd, aber genauso offensichtlich sind sie intelligent. Wir haben Verteidigungsstellungen errichtet, weil das eine intelligente Maßnahme ist, die, wie selbst Narren begreifen, unsere Fähigkeit steigert, unser Land zu verteidigen und zu beherrschen. Wir wären unsererseits Narren, wenn wir annehmen wollten, dass die Vord nicht zu demselben Schluss gelangen können.«
»Als Gaius unsere Truppen gegen die Vord geführt hat, hast du ihm geraten anzugreifen«, hob Raucus hervor. »Nicht, sich zurückzuziehen. Das war die richtige Vorgehensweise.«
»Anscheinend nicht, wenn man bedenkt, wie viele Vord zum letzten Angriff auf Alera Imperia zusammengeströmt sind«, antwortete der Erste Fürst. »Wir hatten keine Ahnung, wie viele von ihnen da draußen waren. Wenn er auf meinen Rat gehört hätte, wären die Angreifer umzingelt und niedergemacht worden – und die Vord haben damit gerechnet, dass wir angreifen würden.«
»Wir wissen jetzt, wie viele es sind«, sagte Raucus.
»Wir glauben es zu wissen«, gab Aquitanius zurück und klang zum ersten Mal hitzig. »Das hier ist unsere letzte Hoffnung, Raucus. Wenn diese Legionen fallen, gibt es nichts mehr, was die Vord aufhalten kann. Ich werde nicht das Blut auch nur eines einzigen Legionare verschwenden, wenn ich nicht sicher bin, dass es mir gelingt, den Feind teuer dafür bezahlen zu lassen.« Er verschränkte die Hände hinter dem Rücken, atmete ein und dann wieder aus. Danach wirkte er wieder vollkommen ruhig. »Sie werden zu uns kommen, und das bald, und ihre Königin wird gezwungen sein, sie zu begleiten und ihren Angriff zu lenken.«
Raucus runzelte die zottigen Brauen. »Du glaubst, dass du sie in die Falle locken kannst.«
»Eine Abwehrschlacht«, antwortete Aquitanius nickend. »Sie zu uns locken, dem Angriff standhalten, den rechten Augenblick abwarten und dann mit allem, was wir haben, den Gegenangriff führen.«
Raucus knurrte: »Sie bedient sich jetzt des Elementarwirkens, und das so stark wie nur irgendjemand. Und sie hat immer noch eine Wache aus den Aleranern, die sie gefangen genommen hat, bevor Graf und Gräfin Calderon diesen Teil ihres Vorhabens zunichtegemacht haben.«
Wie Ehren auffiel, ging noch nicht einmal Antillus Raucus so weit, den neuen Princeps offen darauf hinzuweisen, dass seine Frau zu denen gehörte, die gezwungen worden waren, auf der Seite der Vord zu den Waffen zu greifen.
»Das ist unerfreulich«, sagte Aquitanius in hartem Ton. »Aber wir werden uns durch sie hindurchkämpfen müssen.«
Raucus musterte ihn einige Sekunden lang. »Hast du vor, es allein mit ihr aufzunehmen, Attis?«
»Mach dich nicht lächerlich«, sagte Aquitanius. »Ich bin Princeps. Das erledigen ich und du, und Fürst und Fürstin Placida und jeder andere Hohe Fürst, Fürst und Graf, der eine Waffe halten kann, und die gesamte Legion Aeris, und jede andere Legion, für deren Anwesenheit ich sorgen kann.«
Raucus zog die Augenbrauen hoch. »Für ein Vord.«
»Für das Vord«, antwortete Aquitania. »Wenn man sie tötet, sind die Übrigen kaum mehr als Tiere.«
»Verdammt gefährliche Tiere.«
»Dann bin ich mir sicher, dass Jagdkleidung sehr in Mode kommen wird«, erwiderte Aquitania. Er drehte sich um und nickte. »Ritter Ehren. Sind die Berichte eingetroffen?«
»Ja, Majestät«, antwortete Ehren.
Aquitania kehrte zu den Sandtischen zurück und machte eine einladende Handbewegung. »Zeig mir alles.«
Ehren ging ruhig zu den Tischen hinüber und hob einen Eimer mit grünem Sand hoch. Raucus zuckte zusammen, als er das tat. Der grüne Sand stand für die Ausbreitung des Kroatsch über Alera. Sie hatten schon mehrere Eimer aufgebraucht.
Ehren tauchte eine Hand in den Eimer und streute vorsichtig grünen Sand über das Modell einer ummauerten Stadt auf dem Sandtisch, das für Parcia stand. Es verschwand in einem Hügel aus smaragdgrünen Körnchen. Das schien Ehren ein unzureichender Weg zu sein, das Ende von Hunderttausenden parcianischer Leben darzustellen, der Bevölkerung der Stadt und der großen Zahl von Flüchtlingen, die sich dort in Sicherheit zu bringen versucht hatten. Aber es konnte keinen Zweifel geben. Die Kursoren und Luftspione waren sich sicher: Parcia war an die Vord gefallen.
Im Zelt herrschte Schweigen.
»Wann?«, fragte Aquitanius leise.
»Vor zwei Tagen«, sagte Ehren. »Die parcianische Flotte hat die Evakuierung bis zum Ende weitergeführt. Wenn sie in Küstennähe geblieben ist, konnte sie vielleicht auch viel kleinere Boote einsetzen und alle Schiffe sehr schwer beladen. Vielleicht sind bis zu siebzig- oder achtzigtausend Menschen ums Kap herum nach Rhodos gebracht worden.«
Aquitanius nickte. »Hat Parcia die großen Elementare unter der Stadt auf den Feind losgelassen?«
»Verdammte Krähen, Attis«, sagte Raucus leise in tadelndem Ton. »Die Hälfte aller Flüchtlinge des gesamten Südens war in Parcia.«
ENDE DER LESEPROBE