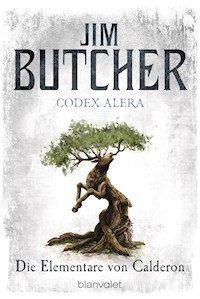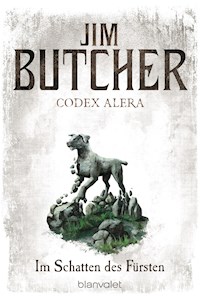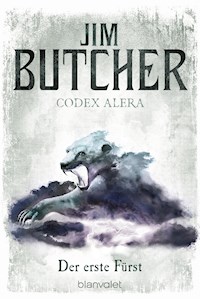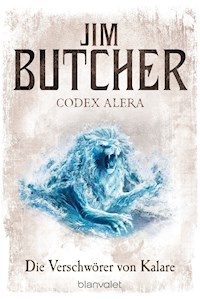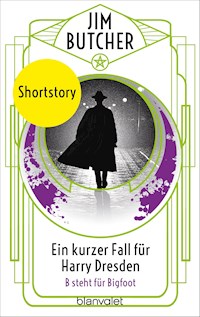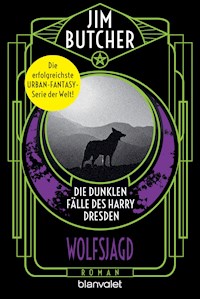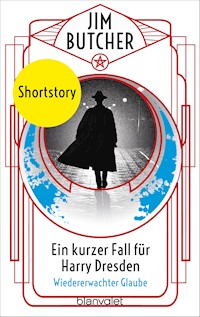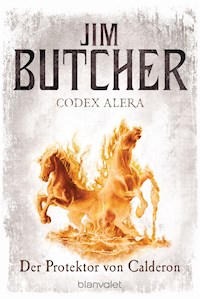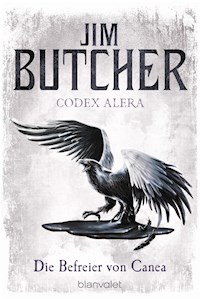9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Harry-Dresden-Serie
- Sprache: Deutsch
Die Literatur hat uns gelehrt, dass Vampire kultivierte Geschöpfe sind, doch das ist nur Fassade ... Der dritte dunkle Fall für Harry Dresden.
Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Dresden. Als Magier habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang zur übernatürlichen Gesellschaft als gewöhnliche Menschen. Und ich hatte immer vor, meine Freundin von alldem fernzuhalten. Allerdings ist Susan Reporterin und kann ganz schön stur sein, wenn es um eine Story geht. Und ein großes Fest am Roten Hof der Vampire ist eindeutig eine umwerfende Story. Die Idee, sich eine Einladung zu besorgen, war natürlich ebenso hirnrissig wie lebensgefährlich. Denn für Vampire sind Menschen nie etwas anderes als Nahrung. Doch schlussendlich blieb mir kaum eine andere Wahl, als das Fest zu besuchen. Hätte ich es doch bloß gelassen ...
Die dunklen Fälle des Harry Dresden:
1. Sturmnacht
2. Wolfsjagd
3. Grabesruhe
4. Feenzorn
5. Silberlinge
6. Bluthunger
weitere Titel in Vorbereitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Dresden. Als Magier habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang zur übernatürlichen Gesellschaft als gewöhnliche Menschen. Und ich hatte immer vor, meine Freundin von alldem fernzuhalten. Allerdings ist Susan Reporterin und kann ganz schön stur sein, wenn es um eine Story geht. Und ein großes Fest am Roten Hof der Vampire ist eindeutig eine umwerfende Story. Die Idee, sich eine Einladung zu besorgen, war natürlich ebenso hirnrissig wie lebensgefährlich. Denn für Vampire sind Menschen nie etwas anderes als Nahrung. Doch schlussendlich blieb mir kaum eine andere Wahl, als das Fest zu besuchen. Hätte ich es doch bloß gelassen …
Autor
Jim Butcher ist der Autor der Dresden Files, des Codex Alera und der Cinder-Spires-Serie. Sein Lebenslauf enthält eine lange Liste von Fähigkeiten, die vor ein paar Jahrhunderten nützlich waren – wie zum Beispiel Kampfsport –, und er spielt ziemlich schlecht Gitarre. Als begeisterter Gamer beschäftigt er sich mit Tabletop-Spielen in verschiedenen Systemen, einer Vielzahl von Videospielen auf PC und Konsole und LARPs, wann immer er Zeit dafür findet. Zurzeit lebt Jim in den Bergen außerhalb von Denver, Colorado.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlagund www.facebook.com/blanvalet.
Jim Butcher
GRABESRUHE
DIE DUNKLEN FÄLLE DES HARRY DRESDEN
Roman
Deutsch von Jürgen Langowski
Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Grave Peril (The Dresden Files 3)« bei Penguin RoC, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2001 by Jim Butcher
Published by Arrangement with IMAGINARY EMPIRE LLC
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas
Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Illustrationen: © www.buerosued.de
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-29103-7V001
www.blanvalet.de
1. Kapitel
Es gibt verschiedene Gründe, weswegen ich nicht gern schnell fahre. Zum einen beginnt mein Käfer gefährlich zu klappern und zu stöhnen, sobald ich auf mehr als neunzig Stundenkilometer beschleunige. Zweitens habe ich gewisse Schwierigkeiten mit der Technik. Alles, was nach dem Zweiten Weltkrieg hergestellt wurde, gibt unvermittelt den Geist auf, sobald ich in der Nähe bin. Daher fahre ich stets äußerst vorsichtig und aufmerksam.
Dieser Abend war allerdings eine jener Ausnahmen, die die Regel bestätigten.
Mit quietschenden Reifen lenkte ich den Käfer um eine Ecke, obwohl ein Schild das Linksabbiegen verbot. Das alte Auto heulte wild auf, als wüsste es, was auf dem Spiel stand, und ratterte, knirschte und klapperte tapfer weiter, während wir die Straße hinunterrasten.
»Können wir nicht schneller fahren?«, brummte Michael. Er wollte sich nicht beklagen, es war nur eine sachliche Frage.
»Leider nur bergab oder mit Rückenwind«, sagte ich. »Wie weit ist es noch bis zum Krankenhaus?«
Der große Mann zuckte mit den Achseln und schüttelte den Kopf. Er wirkte äußerst vertrauenerweckend mit seinem grau melierten Haar und dem dunkelbraunen, fast schwarzen Bart. Das wettergegerbte Gesicht war von Sorgen- und Lachfalten gleichermaßen gezeichnet. Er hatte die kräftigen Arbeiterhände auf die Knie gelegt, die er im engen Käfer etwas anziehen musste. »Ich bin nicht sicher«, antwortete er. »Drei Kilometer vielleicht?«
Ich spähte durchs Fenster in die Dämmerung. »Die Sonne ist schon fast untergegangen. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät.«
»Wenn Gott will, werden wir rechtzeitig dort sein«, wollte mich Michael beruhigen. »Bist du sicher, was deine …« Er schnitt eine missmutige Grimasse. »Was deine ›Quelle‹ angeht?«
»Bob ist zwar eine Nervensäge, irrt sich aber nur selten«, antwortete ich, während ich in die Eisen stieg und einem Müllwagen auswich. »Wenn er sagt, der Geist sei dort, dann ist er auch dort.«
»Herr, steh uns bei.« Michael bekreuzigte sich. Irgendetwas regte sich, eine mächtige und unerschütterliche Energie strahlte von ihm aus – die Kraft des Glaubens. »Harry, es gibt da noch etwas, das ich dich fragen möchte.«
»Bitte mich jetzt bloß nicht, wieder zur Messe zu gehen«, wehrte ich ab. »Du weißt genau, dass ich das ablehnen muss.« Ein roter Taurus schnitt uns, ich musste abrupt auf die Abbiegespur ausweichen und setzte mich wieder vor ihn. Dabei hoben sich zwei Räder des Käfers vom Boden ab. »Idiot!«, brüllte ich ihm zu.
»Ich kann dir nicht versprechen, dass ich dich nicht darum bitte«, sagte Michael. »Aber darum geht es nicht. Ich wollte mich erkundigen, wann du Miss Rodriguez heiratest.«
»Bei den Toren der Hölle!«, schimpfte ich. »Wir hetzen seit zwei Wochen kreuz und quer durch die Stadt, nehmen es mit allen möglichen Geistern und Gespenstern auf, die plötzlich aus ihren Löchern gekrochen kommen, und haben bisher noch keinen blassen Schimmer, was die Geisterwelt veranlasst hat, derart durchzudrehen, und du …«
»Das weiß ich doch«, unterbrach er mich, »aber …«
Auch ich ließ ihn nicht zu Ende reden. »Im Augenblick sind wir hinter einer hässlichen alten Hexe im Cook County her, die uns jederzeit umbringen könnte, wenn wir nicht aufpassen. Und du fragst mich nach meinem Liebesleben!«
Michael musterte mich finster. »Aber du schläfst mit ihr, oder nicht?«
»Nicht oft genug«, knurrte ich und wechselte die Spur, um einen Bus zu überholen.
Er seufzte. »Liebst du sie?«
»Michael«, antwortete ich. »Lass mich jetzt bitte damit in Ruhe. Wie kommst du darauf, mir solche Fragen zu stellen?«
»Liebst du sie?«, bohrte er.
»Ich versuche gerade, Auto zu fahren.«
»Harry«, sagte er lächelnd, »liebst du das Mädchen oder nicht? So schwierig ist das doch nicht zu beantworten.«
»Da spricht der Fachmann«, grollte ich. Dreißig Stundenkilometer schneller als erlaubt, überholte ich einen blau-weißen Wagen und bekam gerade noch mit, wie der Polizist hinterm Lenkrad verdutzt blinzelte und seinen Kaffee verschüttete, als er mich vorbeirasen sah. Ein Blick in den Rückspiegel zeigte mir, dass er das Blaulicht eingeschaltet hatte. »Verdammt, die Cops sind hinter uns her!«
»Mach dir ihretwegen keine Sorgen«, sagte Michael erneut beruhigend. »Beantworte nur meine Frage.«
Ich warf ihm einen raschen Blick zu. Er betrachtete mich mit seinem breiten, ehrlichen Gesicht, dem markanten Kinn und den strahlenden grauen Augen. Sein Haar war militärisch kurz geschnitten, und den Bart hatte er ebenfalls kurz getrimmt, sodass er mich an einen Krieger der Antike erinnerte.
»Ich denke schon«, sagte ich nach einem Moment. »Also ja.«
»Dann macht es dir doch auch nichts aus, es auszusprechen, oder?«
»Was soll ich aussprechen?«, sträubte ich mich.
»Harry«, schalt mich Michael. Er musste sich festhalten, als wir durch ein Schlagloch holperten. »Sei nicht so kindisch. Wenn du die Frau liebst, dann musst du es ihr sagen.«
»Warum denn?«
»Also hast du es ihr nicht gesagt. Du hast es ihr nie gesagt.«
Ich sah ihn böse an. »Und wenn schon. Sie weiß es doch. Was soll das Theater?«
»Harry Dresden«, sagte er, »gerade du solltest doch wissen, wie wichtig Worte sind.«
»Hör mal, sie weiß es.« Ich tippte kurz auf die Bremse und gab sofort wieder Gas. »Ich habe ihr ’ne Karte geschickt.«
»Eine Karte?«, fragte Michael.
»Von Hallmark.«
Er seufzte. »Ich will hören, wie du es sagst.«
»Was denn?«
»Sprich die Worte aus«, verlangte er. »Wenn du die Frau liebst, dann kannst du es ihr auch sagen.«
»Ich lauf nicht in der Weltgeschichte rum und sag so was zu allen möglichen Leuten. Das … ich kann so was einfach nicht, verstehst du?«
»Du liebst sie nicht«, sagte Michael. »Ich verstehe.«
»Du weißt genau, dass das nicht …«
»Dann sag es!«
»Wenn du mich dann in Ruhe lässt.« Ich trat das Gaspedal des Käfers bis zum Anschlag durch. Der Streifenwagen war zum Glück ein ganzes Stück hinter uns. »Also gut.« Ich warf Michael noch einen unwirschen Magierblick zu und knurrte: »Ich liebe sie. Ist jetzt endlich Ruhe?«
Michael strahlte. »Siehst du? Das ist das Einzige, was zwischen euch beiden steht. Es liegt dir nicht, anderen zu verraten, was du empfindest, und du gestehst dir deine Gefühle auch nur selten dir selbst gegenüber ein. Doch manchmal reicht es, in den Spiegel zu blicken, um zu erkennen, wie es in einem aussieht.«
»Ich mag keine Spiegel«, knurrte ich.
»Egal. Du musstest dir jedenfalls darüber klar werden, dass du die Frau wirklich liebst. Ich dachte schon, du würdest dich nach Elaine zu sehr zurückziehen und nie wieder …«
Ich platzte beinahe vor Wut. »Über Elaine will ich nicht reden! Niemals! Wenn dir das nicht passt, dann scher dich zum Teufel und lass mich allein arbeiten!«
Michael starrte mich entrüstet an, was aber vermutlich eher an meiner Wortwahl als an irgendetwas anderem lag. »Ich rede über Susan. Wenn du sie liebst, dann solltest du sie heiraten.«
»Ich bin ein Magier. Ich habe keine Zeit für ein Eheleben.«
»Ich bin ein Ritter«, erwiderte Michael. »Und ich habe die Zeit dazu. Es ist der Mühe wert. Du bist zu viel allein, und das merkt man dir an.«
Wieder funkelte ich ihn an. »Was meinst du damit?«
»Du bist griesgrämig. Du isolierst dich immer mehr. Du brauchst Kontakte zu anderen Menschen. Du stehst kurz davor, einen dunklen Weg einzuschlagen.«
»Michael«, fauchte ich, »ich kann jetzt keine Vorträge gebrauchen und erst recht keine Predigt, die mich bekehren soll. Ich brauche keine Vorhaltungen, dass ich den dunklen Mächten abschwören soll, ehe sie mich verschlingen. Nicht schon wieder. Gib mir lieber Rückendeckung, während ich mich um dieses Durcheinander kümmere.«
Das Cook County Hospital kam in Sicht, und ich wendete vorschriftswidrig, um den Käfer in die Einfahrt der Notaufnahme zu lenken.
Michael löste seinen Sicherheitsgurt, bevor das Auto stand, und holte sein riesiges Schwert vom Rücksitz. Es war anderthalb Meter lang und steckte in einer schwarzen Scheide. Er stieg aus und gürtete die Waffe. Dann holte er eine weiße Kutte mit einem roten Kreuz auf der linken Brust heraus und warf sie sich mit geübten Bewegungen über die Schultern. Mit einem silbernen Kreuz verschloss er die Uniform vor der Brust. Die Kutte passte nicht recht zu seinem Flanellhemd, den Jeans und den Arbeitsstiefeln mit den Stahlkappen.
»Kannst du nicht wenigstens die Kutte weglassen?«, klagte ich, während ich die Fahrertür öffnete. Ich entfaltete mich, nachdem ich auf dem Fahrersitz eingeklemmt gewesen war, streckte die langen Beine und holte auch meine Ausrüstung vom Rücksitz – meinen neuen Magierstab und den Sprengstock, beide frisch geschnitzt und an den Enden noch leicht grün.
Michael sah mich verletzt an. »Die Kutte ist ebenso ein Symbol für meine Arbeit wie das Schwert. Außerdem ist er lange nicht so lächerlich wie dein Mantel.«
Ich warf einen Blick an mir hinunter und besah mir kurz den schwarzen Ledermantel mit den großen Aufschlägen, der angenehm schwer auf meinen Schultern lag und um meine Beine wallte. Meine schwarzen Jeans und das dunkle Westernhemd waren um ein paar Jahrtausende modischer als Michaels Aufzug. »Was stimmt damit nicht?«
»So was gehört in Filme wie Eldorado«, sagte Michael. »Bist du bereit?«
Seine Frage beantwortete ich mit einem vernichtenden Blick, worauf er milde lächelte.
Nebeneinander gingen wir zur Tür. Hinter uns näherten sich die Polizeisirenen, höchstens noch einen Block entfernt. »Das wird knapp.«
»Dann sollten wir uns beeilen.« Michael zog den rechten Ärmel der Kutte hoch, legte die Hand auf das Heft des mächtigen Breitschwerts, neigte den Kopf und bekreuzigte sich. »Allmächtiger Vater«, murmelte er, »führe uns und beschütze uns im Kampf gegen die Finsternis.« Wieder strahlte eine starke Energie von ihm aus, ähnlich den Schallschwingungen von lauter Musik, die sich durch dicke Mauern fortsetzen.
Kopfschüttelnd zog ich aus der Manteltasche einen Lederbeutel, der so groß war wie meine Hand. Einen Moment musste ich mit Stab, Sprengstock und Beutel jonglieren, bis ich den Stab in der linken Hand hielt, wie es sich gehörte, während ich den Sprengstock in die rechte nahm und der Beutel an der Schnur zwischen meinen Zähnen baumelte. »Die Sonne ist untergegangen«, nuschelte ich. »Lass uns anfangen.«
Damit rannten wir los, der Ritter und der Magier, und stürzten durch die Notaufnahme ins Cook County Hospital. Natürlich erregten wir einiges Aufsehen, als wir eintraten – ich mit dem Mantel, der wie eine schwarze Wolke hinter mir wallte, Michael mit der weißen Kutte, die flatterte wie die Flügel des Racheengels, dessen Namensvetter er war. Wir platzten hinein und blieben an der ersten Kreuzung der kühlen, sterilen, belebten Gänge stehen.
Den ersten Pfleger, der mir über den Weg lief, hielt ich am Arm fest. Er blinzelte, dann musterte er mich von den Spitzen meiner Cowboystiefel bis zum dunklen Haar auf meinem Kopf. Nervös beäugte er auch meinen Stab, den Stock und den silbernen Drudenfuß, der vor meiner Brust baumelte. Er schluckte schwer. Schließlich starrte er den großen, breitschultrigen Michael an, dessen gelassene Miene überhaupt nicht zu der weißen Kutte und dem Breitschwert an der Hüfte passte.
Verunsichert wich der Pfleger einen Schritt zurück.
»K… kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
Ich setzte mein finsterstes, wildestes Lächeln auf und sagte mit zusammengebissenen Zähnen mit dem Lederbeutel dazwischen: »Hi. Könnten Sie uns bitte sagen, wo die Entbindungsstation ist?«
2. Kapitel
Wir benutzten die Feuertreppe. Michael weiß, wie technische Geräte auf mich reagieren, und wir wollten auf keinen Fall in einem kaputten Aufzug stecken bleiben, während Unschuldige umgebracht wurden.
Michael übernahm die Führung, eine Hand auf dem Geländer, die andere am Heft seines Schwerts. Unermüdlich stieg er die Stufen hinauf, schnaufend und keuchend folgte ich ihm.
Vor der Tür der Station blieb er stehen und drehte sich zu mir um, die weiße Kutte flatterte ihm um die Beine. Ich brauchte einige Sekunden, bis ich ihn eingeholt hatte.
»Bereit?«, fragte er.
»Hrrrmmpf«, machte ich und nickte. Der Lederbeutel baumelte zwischen meinen Zähnen, während ich eine weiße Kerze und eine Schachtel Streichhölzer aus der Manteltasche zog. Ich musste den Stab und den Stock ablegen, um die Kerze anzuzünden.
Michael rümpfte die Nase, als er den Rauch roch, und stieß die Tür auf.
Die Kerze in der einen, den Stock und den Stab in der anderen Hand, folgte ich ihm, blickte mich um und kontrollierte immer wieder die Kerzenflamme.
Auch hier sah es überall nach einem Krankenhaus aus – gekachelte Wände und Böden, Neonlampen. Die langen Röhren flackerten träge, als hätten sie einen Schwächeanfall, und der Flur war nur trübe beleuchtet. Ein Rollstuhl, der neben einer Tür abgestellt war, warf einen langen Schatten. An einer Gangkreuzung standen mehrere unbequeme Plastikstühle.
Der vierte Stock war ein einziger Friedhof, es herrschte Grabesstille. Kein flackerndes Fernsehgerät, kein plärrendes Radio. Keine krächzenden Sprechanlagen, keine surrende Klimaanlage. Nichts.
Wir liefen den langen Flur hinunter, unsere Schritte hallten laut, obwohl wir uns bemühten, leise zu sein. Ein Schild an der Wand, das mit einem bunten Plastikclown verziert war, wies uns in einen abzweigenden Flur:
ENTBINDUNGSSTATIONUNDGEBURTSHILFE.
Ich holte Michael ein und spähte an ihm vorbei. Der Gang endete vor einer Schwingtür. Auch dieser Flur war völlig still, Stationszimmer leer. Die Lampen hier flackerten nicht einmal mehr, sie waren ganz und gar erloschen, und es war stockfinster. Überall lauerten Schatten und gespenstische Umrisse. Als ich einen weiteren Schritt an Michael vorbei machte, schrumpfte meine Kerzenflamme zu einem kalten blauen Lichtpunkt.
Ich spie den Beutel aus und stopfte ihn wieder in die Tasche. »Michael«, sagte ich drängend und mit belegter Stimme, »hier ist es.« Ich drehte mich um, damit er die Flamme sehen konnte.
Er blickte kurz zur Kerze, schaute auf und starrte in die Finsternis. »Bleibe fest im Glauben.«
Mit seiner großen rechten Hand packte er das Heft des Schwerts und zog langsam und lautlos Amoracchius aus der Scheide, was ich eine Spur ermutigender fand als seine Worte. Flammen züngelten über die große Klinge aus poliertem Stahl, als Michael vortrat und sich neben mir aufbaute. Die Luft surrte förmlich vor Kraft – es war Michaels Glaube, tausendfach verstärkt.
»Wo sind die Schwestern?«, flüsterte er heiser.
»Vielleicht verscheucht«, antwortete ich ebenso leise. »Oder eine Art Zauber. Jedenfalls kommen sie uns nicht in die Quere.«
Ich betrachtete das Schwert, die lange, schlanke Klinge mit dem Handschutz. Vielleicht bildete ich es mir nur ein, aber ich glaubte, rote Flecken darauf zu erkennen. Sicher nur Rost, dachte ich. Klar, es musste Rost sein.
Ich stellte die Kerze auf den Boden. Die stecknadelkopfgroße Flamme verriet, dass ein spirituelles Wesen in der Nähe war. Ein mächtiges sogar. Bob hatte nicht gelogen, als er mir erzählt hatte, Agatha Hagglethorns Geist sei mehr als ein Kinderschreck.
»Halt dich bitte zurück«, sagte ich zu Michael. »Gib mir einen Augenblick Zeit.«
»Wenn dein Geist dir die Wahrheit gesagt hat, ist dieses Wesen gefährlich«, erwiderte Michael. »Lass mich vorausgehen, das ist sicherer.«
Ich warf einen Blick zum Schwert. »Glaub mir, ein Gespenst kann dein Schwert spüren, ehe du überhaupt die Tür erreichst. Lass mich zuerst sehen, was ich ausrichten kann. Wenn es mir gelingt, die Erscheinung auszuräuchern, ist der Spuk vorbei, ehe er richtig begonnen hat.«
Ohne Michaels Antwort abzuwarten, nahm ich den Sprengstock und den Magierstab in die linke Hand und zückte mit der rechten den Beutel. Der einfache Knoten, der ihn verschloss, war schnell gelöst, dann schlich ich tiefer in die Finsternis hinein.
Vorsichtig schob ich einen Flügel der Schwingtür auf, hielt eine Weile inne und lauschte.
Irgendwo sang jemand. Eine Frauenstimme, sanft und lieblich.
»Schlaf, Kindchen, schlaf. Dein Vater hüt’ die Schaf …«
Ein letzter Blick über die Schulter zu Michael, dann huschte ich durch die Tür. Sehen konnte ich nichts mehr, aber ich bin nicht umsonst Magier. Ich dachte an den Drudenfuß auf meiner Brust, das silberne Amulett, das meine Mutter mir vermacht hat. Das Schmuckstück war arg mitgenommen, zerkratzt und verbogen, nachdem ich es mehr als einmal für Zwecke eingesetzt hatte, für die es nicht gemacht war, aber der fünfzackige Stern im Kreis war das Symbol meiner Magie und für alles, woran ich glaubte. Er verkörperte die harmonische Verbindung der fünf Kräfte im Universum, die der menschlichen Kontrolle unterliegen.
Ich konzentrierte mich darauf und lenkte ein wenig Willenskraft hinein. Sofort warf das Amulett einen sanften silbrig blauen Lichtschein, der sich vor mir ausbreitete. Er zeigte mir die Umrisse eines umgestürzten Stuhls und zwei Schwestern, die hinter einer Theke auf dem Tisch zusammengesunken waren und gleichmäßig atmeten.
Die Frau sang unablässig das Kinderlied, während ich die Schwestern betrachtete. Sie waren durch Magie in Schlaf versetzt worden und würden sich vorläufig nicht rühren. Es wäre sinnlos gewesen, meine Energie auf die Auflösung des Zauberbanns zu verschwenden.
Der sanfte Gesang dauerte an, und ich ertappte mich dabei, dass ich nach dem umgestürzten Stuhl greifen wollte, um ihn aufzustellen, damit ich mich setzen und eine Weile ausruhen konnte.
Erschrocken hielt ich inne. Es wäre idiotisch, mich unter dem Einfluss des unirdischen Liedes auch nur für einen Moment hinzusetzen. Die Magie war sehr subtil und stark. Obwohl ich gewusst hatte, was mich erwartete, wäre ich beinahe ihrem Sog verfallen.
So wich ich dem Stuhl aus und ging weiter durch einen Raum voller Kleiderhaken, an denen pastellfarbene Krankenhauskittel ordentlich aufgereiht hingen. Hier war der Gesang lauter, wehte aber immer noch gespenstisch umher und schien keinen Ursprung zu haben.
Eine Wand bestand nur aus dünnem Plexiglas, dahinter befand sich ein Krankenzimmer, das seltsamerweise zugleich steril und warm wirkte.
Mehrere Reihen fahrbarer Kinderbetten standen im Raum. Die kleinen Patienten hatten winzige Krankenhaushandschuhe an den Händen und kleine Krankenhausmützen auf den kahlen Köpfen. Sie schliefen und träumten Kinderträume.
Zwischen ihnen, im Schein meines Magierlichts gut zu erkennen, wanderte die Quelle des Gesangs umher.
Agatha Hagglethorn war jung gestorben. Sie trug eine saubere, hochgeschlossene Bluse, wie es im Chicago des neunzehnten Jahrhunderts für eine Dame ihres Standes angemessen gewesen war, und einen langen, schlichten Rock. Ich konnte durch sie hindurchsehen und das Bettchen hinter ihr erkennen, aber davon abgesehen wirkte sie völlig menschlich und real. Sie hatte ein hübsches, wenngleich etwas kantiges und angespanntes Gesicht. Die rechte Hand hatte sie auf den linken Unterarm gelegt, der in einem Stumpf endete.
»Die Mutter schüttelt ’s Bäumelein, da fällt herab ein Träumelein …«
Sie hatte eine hinreißende Singstimme, trällerte das Lied vor sich hin und setzte dabei eine Energie frei, die jeden Zuhörer in seligen Tiefschlaf versetzen konnte. Wenn sie damit fortfuhr, würden Kinder und Schwestern irgendwann in eine tiefe Ohnmacht fallen, aus der sie nie wieder erwachen würden, und die Behörden würden es auf eine Kohlenmonoxidvergiftung oder irgendetwas anderes schieben, das ein wenig alltäglicher war als ein feindseliger Geist.
Ich schlich näher. Zum Glück hatte ich genügend Geisterstaub dabei, um Agatha und ein Dutzend weiterer Gespenster festzunageln. Danach konnte Michael sie rasch und ohne großes Aufhebens beseitigen – immer vorausgesetzt, ich verfehlte sie nicht.
Den kleinen Beutel locker in der rechten Hand, schlich ich in der Hocke zur Tür, die in den Raum mit den schlafenden Säuglingen führte. Das Gespenst hatte mich noch nicht bemerkt. Sie sind für gewöhnlich nicht sehr aufmerksam. Wahrscheinlich hat es nachhaltige Auswirkungen auf die Persönlichkeit, wenn man tot ist.
Sobald ich drinnen war, ergriff Agatha Hagglethorns Stimme von mir Besitz wie eine Droge. Ich blinzelte, schauderte und hatte alle Mühe, mich zu konzentrieren und an die kühle Kraft der Magie zu denken, die durch meinen Drudenfuß strömte und als Spektrallicht wieder austrat.
»Am Himmel ziehn die Schaf …«
Ich leckte mir nervös über die Lippen und beobachtete die Erscheinung, als sie sich über eines der Kinderbetten beugte. Sie lächelte mit liebevollen Augen und hauchte ihr Lied über das Kind.
Der Säugling atmete noch einmal schaudernd aus, ohne die Augen zu öffnen, und atmete nicht wieder ein.
»Schlaf, Kindchen, schlaf …«
Mir blieb keine Zeit mehr. In einer perfekten Welt hätte ich einfach den Staub über das Gespenst gekippt. Aber dies ist eine unvollkommene Welt, und die Geister müssen sich nicht an die Regeln der Realität halten. Solange sie nicht zur Kenntnis nehmen, dass man da ist, ist es schwer, sehr schwer, überhaupt irgendeinen Einfluss auf sie auszuüben. Konfrontation ist der einzige Weg. Sie drehen sich außerdem nur zu einem um, wenn man die Identität des Gespensts kennt und seinen Namen laut ausspricht. Noch schlimmer, die meisten Gespenster können viele Stimmen überhaupt nicht hören. Man braucht Magie, um im Jenseits anzurufen.
Ich richtete mich auf, hielt den Beutel fest und rief, während ich etwas Willenskraft in meine Stimme strömen ließ: »Agatha Hagglethorn!«
Das Gespenst erschrak, als es unversehens meine Stimme hörte, drehte sich zu mir um, riss die Augen auf, und das Lied brach mitten im Wort ab. »Wer sind Sie?«, fragte sie. »Was tun Sie in meiner Kinderkrippe?«
Bob hatte mir einige Einzelheiten über dieses Gespenst verraten. »Es ist nicht Ihre Kinderkrippe, Agatha Hagglethorn. Sie sind vor mehr als hundert Jahren gestorben. Sie sind nicht real, Sie sind ein Geist, und Sie sind tot.«
Das Gespenst antwortete kühl und standesgemäß mit äußerster Herablassung: »Benson hat Sie geschickt, nicht wahr? Benson tut ständig grausame und alberne Dinge, und hinterher schimpft er mich eine Verrückte. Eine Verrückte! Er will mir mein Kind wegnehmen.«
»Auch Benson Hagglethorn ist schon lange tot«, erklärte ich, während ich die rechte Hand hob. »Genau wie Ihr Kind und Sie selbst. Diese Säuglinge hier sind nicht die Ihren, und Sie dürfen ihnen nichts vorsingen oder sie mitnehmen.«
Daraufhin wollte ich den Staub werfen und holte aus. Doch das Gespenst starrte mich mit einem Ausdruck von verwirrter, tiefer Einsamkeit an. Dies war immer das Schwierigste, wenn ich es mit starken, gefährlichen Gespenstern zu tun hatte. Sie wirkten beinahe menschlich, als hätten sie Empfindungen und wären sich in gewissem Maße sogar ihrer eigenen Existenz bewusst. Dabei haben Gespenster kein Bewusstsein. Sie sind wie ein Fußabdruck im Lehm oder ein versteinertes Skelett. Äußerlich mögen sie ihren Ebenbildern gleichen, aber sie sind keine Menschen.
Allerdings sind Damen in Nöten mein wunder Punkt. Das war schon immer so. Es ist eine Charakterschwäche oder eine fatale Neigung zur Ritterlichkeit. Jedenfalls erwachte sofort mein Mitgefühl für das Gespenst, als ich Agathas Gesicht sah, das Einsamkeit zeigte und wie verletzt sie war. Ich hielt mitten im Wurf inne. Vielleicht hatte ich Glück und konnte sie auch mit guten Worten vertreiben. Gespenster sind so. Manche muss man nur mit der Realität ihrer Situation konfrontieren, dann lösen sie sich auf.
»Es tut mir leid«, sagte ich. »Aber Sie sind nicht das, was Sie selbst glauben. Sie sind ein Geist, eine Reflexion. Die echte Agatha Hagglethorn ist vor mehr als einem Jahrhundert gestorben.«
»Nein, nein«, sagte sie mit bebender Stimme, »das ist nicht wahr.«
»Doch, ist es«, beharrte ich. »Sie ist in derselben Nacht gestorben wie ihr Mann und ihr Kind.«
»Nein«, stöhnte der Geist und schloss die Augen, »ich will nichts davon hören.«
Leise und verzweifelt begann sie wieder zu singen. Doch diesmal lag kein Zauber darin, es war kein unbewusster Akt der Zerstörung. Das kleine Mädchen aber hatte immer noch nicht eingeatmet, und seine Lippen färbten sich blau.
»Hören Sie zu«, sagte ich. Dabei legte ich noch etwas mehr Willenskraft in meine Stimme und verstärkte sie mit Magie, damit das Gespenst mich auch ja verstand. »Ich weiß, wer Sie sind. Sie sind gestorben. Sie werden sich erinnern. Ihr Mann hat Sie geschlagen, und Sie hatten Angst, er könnte auch Ihre Tochter schlagen. Als sie zu weinen begann, haben Sie den Mund der Kleinen mit der Hand bedeckt.« Ich kam mir gemein vor, als ich so kalt über die Vergangenheit der Frau berichtete. Gespenst oder nicht, der schmerzliche Gesichtsausdruck war echt.
»Das habe ich nicht getan«, klagte Agatha. »Ich habe ihr nichts getan.«
Bob hatte mir alle nötigen Informationen gegeben. »Sie wollten ihr nichts tun«, wandte ich ein. »Doch er war betrunken, und Sie hatten Angst, und als Sie Ihre Tochter wieder angeschaut haben, war sie tot. Stimmt das nicht?«
Ich blickte wieder zu dem kleinen Mädchen hinüber. Wenn ich mich nicht beeilte, würde sie sterben. Es war gespenstisch, wie still sie dalag. Wie eine kleine Puppe.
Irgendwo flackerte ein Funke der Erinnerung in Agathas Augen. »Ich weiß«, zischte sie. »Das Beil. Das Beil, das Beil, das Beil!« Das Gespenst verzog das Gesicht, das sich dehnte und knochiger und schmaler wurde. »Ich habe mein Beil genommen, mein Beil, mein Beil, und habe meinen Benson zwanzigmal damit gehauen.« Der Geist wuchs und dehnte sich aus, ein gespenstischer Wind ging von ihm aus und wehte durch den Raum. Es roch nach Eisen und Blut.
»Verdammter Mist«, murmelte ich und machte Anstalten, zu dem Mädchen hinüberzurennen.
»Mein Engel ist tot!«, kreischte der Geist. »Benson ist tot! Und dann die Hand, die Hand, die sie beide getötet hat!« Sie hob den Armstumpf hoch. »Verloren, verloren, verloren!« Darauf warf sie den Kopf zurück und kreischte. Es war ein ohrenbetäubendes, unmenschliches Brüllen, das die ganze Kinderklinik erschütterte.
Ich stürzte los zu dem Säugling, der nicht mehr atmete, und in diesem Moment begannen alle Kinder ängstlich zu schreien. Sobald ich der Kleinen einen Klaps auf den Babypo versetzt hatte, schlug sie erschrocken die Augen auf und stimmte in das Gebrüll der anderen ein.
»Nein!«, kreischte Agatha. »Nein, nein, nein! Er kann dich hören, er wird es hören!« Blitzschnell stieß sie mit dem Armstumpf nach mir, und ich spürte den Hieb körperlich und in der Seele, als hätte sie mir einen Eisdorn in die Brust getrieben.
Die Kraft des Schlages warf mich wie ein Spielzeug gegen die Wand. Mein Stab und der Stock fielen klappernd zu Boden, aber wie durch ein Wunder hatte ich den Beutel mit Geisterstaub festgehalten. Allerdings vibrierte mein Kopf wie eine Glocke nach dem Schlag des Klöppels, während mir kalte Schauer in rascher Folge durch den Körper liefen.
»Michael!«, rief ich, so laut ich konnte.
Im nächsten Moment wurde die Tür aufgerissen, und schwere Arbeitsstiefel stampften in meine Richtung.
Ich rappelte mich auf und schüttelte den Kopf, um wieder zu mir zu kommen. Der Wind steigerte sich unterdessen zu Sturmstärke, die Kinderbetten rollten auf ihren kleinen Rädern im Raum herum, und mir tränten die Augen, sodass ich sie mit einer Hand schützen musste. Verdammt, bei so einem Sturm war der Staub nutzlos.
»Schlafe, mein Kindchen, schlaf ein.« Agathas Geist beugte sich wieder über das Bett des kleinen Mädchens und stieß ihm den Armstumpf in den Mund. Der transparente Arm glitt einfach durch die Haut hindurch. Das Kind zuckte zusammen und hörte zu atmen auf, versuchte aber immer noch zu schreien.
Ich rief eine wortlose Herausforderung und griff den Geist an. Da ich den Staub nicht quer durchs Zimmer nach ihr werfen konnte, musste ich ihr den Lederbeutel ins Geisterfleisch stopfen. Das war sicherlich schmerzhaft, aber auch wirkungsvoll.
Agatha schlug nach mir, als ich mich näherte, wobei sie knurrend die Hand vom Kind zurückzog. Im Sturm hatte sich ihr Haar gelöst, das nun als wilde Mähne vor ihrem Gesicht flatterte. Das passte gut zu der bösen Fratze, die den sanften Gesichtsausdruck verdrängt hatte. Sie hob die linke Hand, und auf einmal schwebte knapp über dem Stumpf ein kurzes Gespensterbeil mit schwerer Klinge in der Luft. Kreischend schlug sie damit nach mir.
Gespensterstahl klirrte auf echtem Eisen, und Amoracchius glühte strahlend weiß. Michael stellte sich auf, knirschte vor Anstrengung mit den Zähnen und hinderte die Geisterwaffe daran, mich zu berühren.
»Dresden!«, rief er. »Der Staub!«
Ich stieß Agatha die Faust in den Arm, der das Beil führte, und schüttelte etwas Geisterstaub aus dem Lederbeutel.
Beim Kontakt mit ihrem immateriellen Körper flammten die Staubkörnchen hellrot auf, und Agatha zuckte kreischend zurück, doch ihr Arm blieb, wo er war, als wäre er in Beton gegossen.
»Benson!«, schrie Agatha. »Benson! Schlafe, mein Kindchen!« Dann riss sie sich den Arm an der Schulter ab, ließ einen Teil ihres Geisterkörpers zurück und verschwand.
Arm und Beil platschten als durchsichtige, halb flüssige Gallerte auf den Boden. Die Überreste eines Geisterkörpers, nachdem der Geist verschwunden war. Ektoplasma, das rasch verdunsten würde.
Der Sturm flaute ab, aber die Lichter flackerten noch. Mein blauweißes Magierlicht und Michaels züngelndes Schwert waren die einzigen zuverlässigen Lichtquellen im Raum. Nachdem das gespenstische Gebrause so abrupt verstummt war, taten mir die Ohren weh, denn plötzlich kam mir alles ganz still vor, obwohl etwa ein Dutzend Babys in ihren Kinderbetten vor Angst schrien.
»Sind die Säuglinge unverletzt?«, fragte Michael. »Wohin ist der Geist verschwunden?«
»Ich glaube, ihnen ist nichts passiert. Die Erscheinung ist hinübergewechselt«, mutmaßte ich. »Sie hatte wohl genug.«
Michael drehte sich mit erhobenem Schwert einmal um die eigene Achse. »Dann ist sie also weg?«
Kopfschüttelnd sah ich mich um. »Nicht endgültig.«
Ich beugte mich über das Bett des Mädchens, das beinahe erstickt wäre. Der Name auf ihrem Armband lautete Alison Ann Summers. Ich streichelte ihre kleine Wange, und sie drehte sich zu meinem Finger, umschloss ihn mit ihren Babylippen und hörte zu weinen auf.
»Nimm den Finger aus ihrem Mund«, schalt mich Michael, »der ist schmutzig. Was jetzt?«
»Ich sichere den Raum ab, und dann müssen wir hier verschwinden, bevor die Polizei auftaucht und uns verhaf…«
Alison Ann zuckte zusammen und hörte wieder zu atmen auf. Die winzigen Arme und Beine wurden steif, als etwas Kaltes über sie hinwegglitt. Gleichzeitig hörte ich wieder das Kinderlied der verrückten Frau.
»Schlafe, mein Kindchen …«
»Michael«, rief ich, »sie ist noch da! Der Geist greift aus dem Niemalsland herüber!«
»Gott behüte! Wir müssen dort hin!«
»Nein«, widersprach ich, »auf keinen Fall. Das ist ein mächtiger Spuk, Michael. Ich gehe nicht nackt in ihr Reich und lasse mich in Stücke reißen.«
»Uns bleibt nichts anderes übrig«, erklärte Michael. »Sieh doch nur!«
Ich blickte mich um. Die Kinder verstummten nacheinander, ihre dünnen Stimmchen brachen eines nach dem anderen mitten im Atemzug ab.
»Schlafe, mein Kindchen …«
»Sie wird uns zerfetzen. Und wenn sie es nicht tut, dann tut es meine Patentante.«
Michael schüttelte mit finsterer Miene den Kopf. »Bei Gott, nein. Das werde ich nicht zulassen.« Sein Blick ging mir durch Mark und Bein. »Und auch du wirst es nicht zulassen. In deinem Herzen ist zu viel Gutes, um diese Kinder sterben zu lassen.«
Unsicher erwiderte ich seinen Blick. Michael hatte bei unserer ersten Begegnung darauf bestanden, dass ich ihm in die Augen sah. Wenn Ihnen ein Magier in die Augen schaut, wird es ernst. Er kann in Sie hineinblicken und erkennt all die dunklen Geheimnisse und verborgenen Ängste in Ihrer Seele – und umgekehrt sehen Sie auch sein Innerstes.
Nach dem Blick in Michaels Augen hatte ich geweint und mir gewünscht, meine Seele erschiene ihm ebenso rein wie mir die seine. Allerdings war ich mehr als sicher, dass dies nicht der Fall war.
Es wurde still, alle Babys waren verstummt.
Ich verschloss den Beutel mit dem Geisterstaub und steckte ihn in die Manteltasche. Im Niemalsland würde er mir sowieso nichts nützen.
Dann drehte ich mich zu meinem Stab und dem Stock um, die noch immer auf dem Boden lagen, streckte die Hand aus und stieß die Worte »ventas servitas« hervor. Die Luft regte sich und schleuderte Stab und Stock in meine offenen Hände.
»Na gut«, sagte ich, »ich werde uns ein Zeitfenster von fünf Minuten öffnen. Das ist hoffentlich kurz genug, damit meine Patentante mich nicht entdeckt. Wenn wir länger bleiben, sind wir tot, entweder drüben oder hier.«
»Du hast ein gutes Herz.« Michael grinste breit und beugte sich vertraulich zu mir. »Gott wird deine Entscheidung lächelnd gutheißen.«
»Ja, bitte ihn doch, in meiner Wohnung mögen nie wieder Sodom und Gomorrha Einzug halten, dann sind wir quitt.«
Michael wirkte enttäuscht, worauf ich ihn gereizt anstarrte. Er legte mir eine Hand auf die Schulter und hielt sich fest.
Dann griff ich zu, packte die Realität mit den Fingerspitzen und einer Willensanstrengung und flüsterte »aparturum«, um einen schmalen Spalt zwischen dieser und der nächsten Welt zu öffnen.
3. Kapitel
Auch Tage, die in einer gewaltigen Schlacht gegen ein durchgedrehtes Gespenst und einer Reise über die Grenze zwischen unserer Welt und dem Geisterreich gipfeln, beginnen gewöhnlich recht normal. Dieser Tag beispielsweise hatte mit Frühstück und Büroarbeit seinen Anfang genommen.
Mein Büro befindet sich im Zentrum von Chicago in einem älteren Gebäude, das nicht mehr im allerbesten Zustand ist, zumal es im letzten Jahr gewisse Probleme mit dem Aufzug gegeben hat. Es ist mir egal, was die anderen sagen, es war nicht meine Schuld. Wenn sich ein Riesenskorpion in der Größe eines irischen Wolfshundes durchs Dach der Aufzugkabine frisst, greift man eben zu den äußersten Mitteln.
Wie auch immer, mein Büro ist klein, nur ein einziger Raum, aber wenigstens ein Eckzimmer mit zwei Fenstern. Auf dem Schild an der Tür steht lediglich: HARRYDRESDEN, MAGIER. Drinnen liegen gleich neben dem Eingang auf einem Tisch verschiedene Broschüren bereit: »Magie und Sie«, »Warum Hexen nicht schneller untergehen als alle anderen«, »Eindrücke eines Magiers« und so weiter. Die meisten Texte darin habe ich selbst geschrieben. Ich halte es für wichtig, dass wir Jünger der Magie für ein gutes öffentliches Image sorgen. Unter anderem, damit sich so etwas wie die Inquisition nicht wiederholt.
Hinter dem Tisch befinden sich eine Spüle und eine Anrichte mit einer alten Kaffeemaschine. Mein Schreibtisch steht der Tür gegenüber, davor warten zwei bequeme Stühle auf Besucher. Die Klimaanlage klappert, der Deckenventilator quietscht bei jeder Umdrehung, und der Kaffeegeruch hat den Teppich und die Wände imprägniert.
Ich schlenderte also wie jeden Morgen ins Büro, setzte Kaffee auf und sah die Post durch, während er durchlief. Ein Dankesbrief von den Campbells, aus deren Haus ich ein Gespenst vertrieben hatte. Reklame. Gott sei Dank auch ein Scheck von der Stadt für meine letzten Aufträge von der Polizei. Es war ein ziemlich hässlicher Fall gewesen. Dämonenbeschwörungen, Menschenopfer, Schwarze Magie – alles, was dazugehört.
Ich holte mir einen Kaffee und beschloss, Michael anzurufen und ihm anzubieten, mein Honorar mit ihm zu teilen. Den größten Teil der Arbeit hatte ich zwar allein erledigt, aber beim Finale war er mit Amoracchius zur Stelle gewesen. Ich hatte mich um den Zauberer gekümmert, er um den Dämon, und die guten Jungs hatten die Schlacht gewonnen.
Meine Abrechnung zu fünfzig Dollar die Stunde hatte mir ansehnliche zweitausend Bucks eingebracht. Michael würde sich natürlich wie immer weigern, das Geld anzunehmen, aber ich fand es höflich, es ihm wenigstens anzubieten, zumal wir in der letzten Zeit häufig zusammen unterwegs waren, um die Ursache für all die Geistererscheinungen in der Stadt zu ergründen.
Bevor ich zum Telefon greifen und Michael anrufen konnte, schrillte der Apparat los. »Harry Dresden«, meldete ich mich.
»Hallo, Mister Dresden«, sagte eine warme Frauenstimme. »Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich?«
Ich lehnte mich bequem zurück und lächelte. »Ach, Sie sind es, Miss Rodriguez? Sind Sie nicht diese neugierige Reporterin vom Arcane? Dieses überflüssige Käseblatt, das Geschichten über Hexen, Geister und den Bigfoot veröffentlicht?«
»Und über Elvis«, bestätigte sie. »Vergessen Sie ja nicht den King. Übrigens werden meine Beiträge jetzt weltweit von anderen Publikationen mit ähnlich zweifelhaftem Ruf verbreitet.«
Ich musste lachen. »Wie geht’s dir denn?«
Susans Antwort klang ausgesprochen ironisch. »Tja, mein Freund hat mich gestern Abend versetzt, aber davon mal abgesehen …«
Ich zuckte zusammen. »Ja, ich weiß. Bitte verzeih mir. Hör mal, Bob hat mir einen Hinweis gegeben, auf den ich sofort reagieren musste und …«
»Ähm«, machte sie auf ihre höfliche, professionelle Art. »Ich rufe Sie nicht an, um mit Ihnen über mein Privatleben zu plaudern, Mister Dresden. Dies ist ein rein berufliches Telefonat.«
Jetzt lächelte ich wieder. Susan war einfach unbezahlbar, und sie konnte es tatsächlich mit mir aufnehmen. »Ich ersuche Sie noch einmal höflichst um Verzeihung, Miss Rodriguez. Bitte fahren Sie doch fort.«
»Nun, ich dachte an die Gerüchte, es habe gestern Abend schon wieder Aktivitäten von Geistern in der Stadt gegeben. Vielleicht möchten Sie dem Arcane einige Einzelheiten dazu mitteilen?«
»Hm, das wäre aber nicht sehr professionell. Meine geschäftlichen Aktivitäten sind sehr vertraulich.«
»Mister Dresden«, entgegnete sie, »ich möchte nur ungern eine Verzweiflungstat begehen.«
»Aber, aber«, gab ich grinsend zurück, »sind Sie etwa eine verzweifelte Frau?«
Ich konnte sie beinahe vor mir sehen, wie sie eine Augenbraue hochzog. »Ich will Ihnen nicht drohen, aber Sie müssen verstehen, dass ich eine gewisse junge Dame, mit der Sie befreundet sind, recht gut kenne. Ich könnte ohne weiteres dafür sorgen, dass es zwischen ihnen zu unerfreulichen Differenzen kommt.«
»Verstehe. Aber wenn ich Ihnen nun eine Story verschaffe …«
»Wenn Sie mir eine Exklusivgeschichte verschaffen, Mister Dresden.«
»Eine Exklusivgeschichte«, lenkte ich ein, »dann könnten Sie eventuelle Schwierigkeiten von mir abwenden?«
»Ich würde sogar ein gutes Wort für Sie bei ihr einlegen«, sagte Susan fröhlich, und mit tiefer, heiserer Stimme fügte sie hinzu: »Wer weiß, vielleicht haben Sie Glück.«
Das brachte mich zum Nachdenken. Das Gespenst, das Michael und ich am Vorabend erledigt hatten, war ein großes und gemeines Biest gewesen, das sich im Keller der University of Chicago herumgetrieben hatte. Ich musste ja keine Namen preisgeben. Den Universitätsoberen würde es zwar nicht gefallen, in einer Zeitschrift erwähnt zu werden, die an der Supermarktkasse neben ähnlichen Gazetten zu erwerben war, aber andererseits konnte das auch keinen großen Schaden anrichten. Außerdem dachte ich an Susans karamellfarbene Haut und an ihr dunkles, weiches Haar unter meinen Händen … hm.
»Das ist ein Angebot, dem ich kaum widerstehen kann«, gestand ich ein. »Haben Sie etwas zu schreiben?«
Sie hatte, und so erzählte ich ihr in den nächsten zehn Minuten alle Einzelheiten. Sie schrieb mit, stellte einige präzise, knappe Fragen und hatte mir in kürzerer Zeit, als ich es für möglich gehalten hätte, die ganze Geschichte entlockt. Sie ist wirklich eine gute Reporterin, dachte ich. Fast bedauerte ich, dass sie sich auf das Übernatürliche verlegt hatte, an das die Leute schon seit Jahrhunderten nicht mehr glauben wollten.
»Vielen Dank«, sagte sie, nachdem sie mich gründlich ausgequetscht hatte. »Ich hoffe, heute Abend wird zwischen Ihnen und der jungen Dame alles zu Ihrer vollen Zufriedenheit verlaufen. Bei Ihnen, um neun.«
»Vielleicht möchte die junge Dame vorher mit mir die diversen Möglichkeiten der Abendunterhaltung besprechen.«
Sie lachte kehlig. »Vielleicht würde sie das sogar gerne tun«, stimmte Susan zu. »Allerdings ist dies ein rein geschäftlicher Anruf.«
Auch ich musste lachen. »Du bist unmöglich. Du gibst einfach nie auf, was?«
»Niemals«, bekräftigte sie.
»Wärst du wirklich wütend auf mich gewesen, wenn ich dir nichts verraten hätte?«
»Harry«, sagte sie, »du hast mich gestern Abend versetzt, ohne ein Wort zu sagen. So etwas lasse ich mir von keinem Mann gefallen. Wenn du keine gute Geschichte für mich gehabt hättest, hätte ich annehmen müssen, dass du dich lieber mit deinen Freunden herumtreibst, als mich zu sehen.«
»Ja, mit diesem Michael. Ein richtiger Partylöwe.«
»Irgendwann musst du mir von ihm erzählen. Hast du inzwischen noch etwas über diese Geister rausgefunden? Hat es mit der Jahreszeit zu tun?«
Seufzend schloss ich die Augen. »Ja und nein. Ich hab nach wie vor keine Ahnung, warum die Gespenster auf einmal ausflippen, und bis jetzt konnten wir keines von ihnen lange genug festhalten, um es gründlich zu befragen und zu untersuchen. Heute Abend will ich etwas Neues ausprobieren, vielleicht kommen wir damit weiter. Bob ist jedenfalls sicher, dass es mehr als ein Halloweenschreck ist. Ich meine, im letzten Jahr hatten wir schließlich überhaupt keine Geister.«
»Nein, da hatten wir Werwölfe.«
»Das war eine völlig andere Situation«, erklärte ich. »Ich hab Bob Überstunden machen lassen, damit er rausfinden kann, ob es in der Geisterwelt verstärkte Aktivitäten gibt. Falls sich dort etwas tut, werden wir es erfahren.«
»Na gut«, sagte sie. »Ich …«
Ich wartete, doch sie schwieg. »Was denn?«
»Ich … äh … ich wollte mich einfach nur vergewissern, dass es dir gut geht.«
Es lag auf der Hand, dass sie noch etwas anderes hatte sagen wollen, aber ich drängte sie nicht. »Müde bin ich«, antwortete ich. »Ich hab ein paar Kratzer abbekommen, als ich auf Ektoplasma ausgerutscht und gegen einen Aktenschrank geprallt bin. Sonst geht’s mir gut.«
Sie lachte. »Ich versuche es mir gerade vorzustellen. Also bis heute Abend?«
»Ich freu mich drauf.«
Zum Abschied gab sie einen entzückten kleinen Laut von sich, der einen äußerst sinnlichen Unterton hatte.
Der Tag verging mit mehr oder weniger alltäglichen Dingen wie im Fluge. Ich benutzte einen Zauberspruch, um einen verlorenen Ehering wiederzufinden, und lehnte einen Klienten ab, der einen Liebestrank für seine Freundin haben wollte. In meiner Anzeige im Branchenbuch steht ausdrücklich »Keine Liebestränke«, aber aus irgendeinem Grund glauben alle Leute, ihr Fall wäre eine Ausnahme. Dann ging ich zur Bank, verwies einen Anrufer an einen mir bekannten Privatdetektiv und traf mich mit einem jugendlichen Pyromanen, um ihm nach Möglichkeit beizubringen, wie er es vermeiden konnte, versehentlich seine Katze anzuzünden.
Als ich Feierabend machen und gerade das Büro abschließen wollte, hörte ich jemanden den Aufzug verlassen und über den Flur in meine Richtung kommen. Es waren schwere Schritte wie von Stiefeln, und sie klangen eilig.
»Mister Dresden?«, fragte eine junge Frau. »Sind Sie Harry Dresden?«
»Ja«, sagte ich, während ich abschloss. »Aber ich will gerade gehen. Vielleicht können wir für morgen einen Termin vereinbaren.«
Sie blieb ein paar Meter vor mir stehen. »Bitte, ich muss mit Ihnen reden. Nur Sie können mir helfen.«
Ich seufzte, ohne sie anzusehen. Sie hatte genau die Worte gesagt, die nötig waren, um meinen Beschützerinstinkt zu wecken. Andererseits glauben viele Leute, die Magie könnte sie aus allem herausreißen, wenn sie in einer ausweglosen Situation sind. »Ich werde Ihnen gerne helfen, Ma’am. Gleich morgen früh.« Ich drehte den Schlüssel herum und wandte mich zum Gehen.
»Warten Sie.« Sie trat näher und fasste meine Hand.
Ein Kribbeln und Prickeln schoss durch mein Handgelenk bis in den Ellenbogen hinauf. Augenblicklich und instinktiv errichtete ich einen geistigen Schild gegen die Empfindung, riss meine Hand weg und wich mehrere Schritte vor der jungen Frau zurück.
Meine Haut kribbelte noch eine ganze Weile, nachdem ich die Energie ihrer Aura gespürt hatte. Sie war eine zierliche junge Frau in einem schwarzen Strickkleid und Springerstiefeln. Ihre Haare waren schwarz gefärbt und lagen flach und glänzend am Kopf an, sie hatte kreidebleiche Haut und tief eingesunkene, gehetzt blickende Augen, die mit der Wachsamkeit einer Straßenkatze funkelten.
Ich massierte mir die Finger und wich dem Blick des Mädchens vorerst aus. »Sie üben die Kunst aus«, sagte ich leise.
Sie biss sich auf die Unterlippe und wandte sich nickend ab. »Ich brauche Ihre Unterstützung. Man sagte mir, Sie könnten mir helfen.«
»Ich unterrichte auch Leute, damit sie sich durch ihre Gabe nicht versehentlich selbst verletzen. Sind Sie deshalb hier?«
»Nein«, sagte das Mädchen, »eigentlich nicht.«
»Warum kommen Sie dann zu mir? Was wollen Sie?«
»Ich brauche Ihren Schutz.« Sie hob eine zitternde Hand und nestelte an ihren dunklen Haaren herum. »Wenn ich den nicht bekomme … Ich weiß nicht, ob ich dann die Nacht überleben werde.«
4. Kapitel
Ich sperrte die Bürotür wieder auf und schaltete das Licht ein. Die Glühbirne ging kaputt. Das passiert öfter. Seufzend schloss ich hinter uns die Tür. Goldenes Herbstlicht strömte durch die Fensterläden und griff nach den Schatten auf dem Boden und an den Wänden.
Vor meinem Schreibtisch rückte ich einen Stuhl für die junge Besucherin zurecht. Sie blinzelte mich einen Moment verwirrt an. »Oh«, sagte sie schließlich und nahm Platz.
Ich ging um den Schreibtisch herum und setzte mich, ohne den Mantel auszuziehen. »Also gut«, begann ich. »Wenn Sie meinen Schutz wollen, müssen Sie mir ganz und gar vertrauen.«
Mit einer Hand strich sie ihr teerschwarzes Haar glatt und sah mich ausgesprochen berechnend an. Dann schlug sie die Beine übereinander, sodass der Schlitz ihres Kleides ihr Bein bis zum Oberschenkel entblößte. Eine kleine Bewegung des Rückens, und ihre jungen, festen Brüste traten hervor. Die Brustwarzen zeichneten sich deutlich unter dem Stoff ab. »Aber natürlich. Ich bin sicher, dass wir uns einigen können.«
Brustwarzen, die auf Kommando erigierten – kein schlechter Trick. Oh, sie war durchaus hübsch. Ein junger Mann wäre vermutlich sabbernd über sie hergefallen, aber ich hatte schon erheblich bessere Vorstellungen gesehen und verdrehte nur die Augen. »Nein, das meinte ich nicht.«
Der einladende Ausdruck in ihrer Miene verschwand. »Nein? Sie wollen nicht …« Mit gerunzelter Stirn musterte sie mich genau, um ihre Einschätzung zu überprüfen. »Ist es … sind Sie …?«
»Nein«, antwortete ich, »aber ich kaufe Ihnen nicht ab, was Sie mir anbieten. Sie haben mir nicht mal Ihren Namen genannt, sind aber bereit, die Beine für mich breit zu machen? Nein danke. Bei den Toren der Hölle, haben Sie schon mal was von Aids oder Herpes gehört?«
Sie presste die Lippen zusammen, bis auch sie weiß wurden. »Also gut«, sagte sie. »Was wollen Sie dann von mir?«
»Antworten.« Ich zielte mit dem Zeigefinger auf sie. »Und versuchen Sie ja nicht, mich anzulügen. Das würde Ihnen nicht gelingen.«
Das wiederum war eine Lüge von meiner Seite, denn auch ein Magier ist kein wandelnder Lügendetektor, und ich hatte nicht die Absicht, mich auf einen Seelenblick mit ihr einzulassen, um herauszufinden, ob sie es ehrlich meinte. Das war die Sache nicht wert.
Das Großartige am Leben eines Magiers ist, dass die Leute fast alles, was wir tun, unseren gewaltigen, unermesslichen Kräften zuschreiben. Das funktioniert natürlich nur bei denen, die klug genug sind, an Magier zu glauben, aber nicht genug wissen, um unsere Grenzen zu kennen. Die anderen, die normalen Leute, die Magie für einen Witz halten, sehen einen nur an, als müsste gleich jemand vorbeikommen und einem eine viel zu enge weiße Jacke verpassen.
Sie leckte sich über die Lippen, allerdings, weil sie nervös war, nicht, um sinnlicher zu wirken. »Na schön«, sagte sie. »Was wollen Sie wissen?«
»Zuerst einmal Ihren Namen.«
Sie stieß ein Lachen aus. »Glauben Sie wirklich, den würde ich Ihnen nennen, Magier?«
Das hatte gesessen. Ernst zu nehmende Sprüchewirker wie ich konnten mit dem Namen eines Menschen, wenn sie ihn aus dessen eigenem Mund gehört hatten, viele unangenehme Dinge anstellen. »Na gut. Wie soll ich Sie nennen?«
Sie machte sich nicht die Mühe, ihr Bein wieder zu bedecken. Es war ein recht hübsches Bein mit einer Tätowierung, die sich um ihr Fußgelenk ringelte. Ich versuchte, nicht zu offensichtlich darauf zu starren. »Lydia«, sagte sie. »Nennen Sie mich Lydia.«
»Na gut, Lydia. Sie praktizieren die Kunst. Nun erzählen Sie mir etwas darüber.«
»Das hat nichts mit dem zu tun, was ich von Ihnen will.« Sie schluckte schwer, und ihr Zorn verflog. »Bitte, ich brauche Ihre Hilfe.«
»Also gut, was für eine Art von Hilfe brauchen Sie? Falls Sie mit irgendwelchen Banden Ärger haben, würde ich Ihnen die Polizei empfehlen. Ich bin kein Leibwächter.«
Sie schauderte und schlang die Arme um sich. »Nein, das ist es nicht. Um meinen Leib mache ich mir keine Sorgen.«
Darauf runzelte ich die Stirn.
Sie atmete tief durch. »Ich brauche einen Talisman«, sagte sie. »Etwas, das mich vor einem feindseligen Geist beschützt.«
Damit hatte sie meine volle Aufmerksamkeit. Da in der Stadt sowieso schon alle möglichen Erscheinungen herumspukten, konnte ich mir lebhaft vorstellen, dass ein mit magischen Fähigkeiten gesegnetes Mädchen auf allerhand unangenehme Phänomene stieß. Geister und Gespenster fühlen sich zu Magiern hingezogen. »Was für eine Art Geist ist es?«
Sie blickte nach links und rechts, ohne mich anzusehen. »Das kann ich nicht genau sagen. Er ist mächtig und will mir wehtun. Sie … man hat mir gesagt, Sie könnten etwas unternehmen, damit mir nichts zustößt.«
Das entsprach der Wahrheit. Ich trug sogar einen Talisman am Handgelenk, der aus einem Stück Leichentuch, gesegnetem Silber und diversen weiteren, erheblich schwieriger zu beschaffenden Zutaten bestand. »Vielleicht«, stimmte ich zu. »Das hängt aber davon ab, warum Sie in Gefahr sind und warum Sie glauben, Sie bräuchten Schutz.«
»Das k-kann ich Ihnen nicht sagen«, entgegnete sie und verzog ängstlich das bleiche Gesicht. Sie machte sich große Sorgen – die Art Sorgen, mit denen man älter und hässlicher aussieht. Von ihren eigenen Armen umschlungen, wirkte sie auf einmal klein und zerbrechlich. »Bitte, ich brauche einfach nur Ihre Hilfe.«
Ich seufzte. Mein erster Impuls war, ihr eine Tasse heiße Schokolade zu geben, ihr eine Decke über die Schultern zu legen, ihr zu sagen, dass alles gut werde, und ihr meinen Talisman übers Handgelenk zu streifen. Mit viel Mühe verkniff ich mir das.
Immer mit der Ruhe, Don Quichotte. Ich wusste nichts über ihre Situation und auch nicht, wovor sie beschützt werden wollte. Ihr konnte durchaus irgendein Racheengel wegen einer bösen Untat auf den Fersen sein, die so grässlich war, dass die Mächtigen beschlossen hatten, ihr Leben auszuknipsen. Auch die simpelsten Geister haben manchmal verdammt gute Gründe, zurückzukehren und jemanden heimzusuchen.
»Hören Sie, Lydia, ich lass mich nicht gerne auf Dinge ein, ohne zu wissen, womit ich es zu tun habe.« Das hat dich doch noch nie aufgehalten, sagte ich mir selbst. »Wenn Sie mir nicht etwas mehr über Ihre Situation erzählen und mich auch nicht überzeugen, dass Sie wirklich Schutz brauchen, kann ich Ihnen nicht helfen.«
Sie ließ den Kopf hängen, das teerschwarze Haar fiel ihr ins Gesicht. Dann holte sie tief Luft und fragte: »Wissen Sie, was Kassandras Tränen sind?«
»Ein prophetischer Zustand«, antwortete ich. »Die betreffende Person leidet hin und wieder an Anfällen und hat Visionen über die Zukunft. Die Eingebungen sind aber immer in Begriffe gekleidet, die das Gesehene unglaubwürdig erscheinen lassen. Manchmal verwechseln die Ärzte den Zustand bei Kindern mit Epilepsie und verschreiben bergeweise Medikamente. Häufig sind es sogar sehr präzise Vorhersagen, die allerdings niemand glauben will. Manche Menschen nennen es auch eine Gabe.«
»So nenne ich es nicht«, flüsterte sie. »Sie wissen nicht, wie schrecklich das ist – zu sehen, dass etwas geschehen wird, und zu versuchen, es zu verhindern, aber niemand will einem glauben.«
Eine Minute lang betrachtete ich sie schweigend und lauschte der Uhr an der Wand, die tickend die Sekunden zählte. »Na gut«, sagte ich, »Sie behaupten also, diese Gabe zu besitzen. Und jetzt wollen Sie mir sagen, eine Ihrer Visionen habe Sie gewarnt, ein böser Geist werde Sie angreifen?«
»Nicht nur eine Vision«, erwiderte sie. »Drei. Es waren drei. Ich habe nur eine Vision gehabt, als sie versucht haben, den Präsidenten zu töten. Zwei hatte ich vor der Katastrophe bei der NASA und vor dem Erdbeben in Laos. Drei hatte ich noch nie. Noch nie hatte ich eine so deutliche Eingebung …«
Ich überlegte. Wieder sagte mir mein Instinkt, ich solle dem Mädchen helfen, den bösen Geist oder was es auch war, zerschmettern und als einsamer Held in den Sonnenuntergang reiten. Wenn sie wirklich unter Kassandras Tränen litt, konnte ich sogar mehr tun, als nur ihr Leben retten. Mit meinem Wissen konnte ich ihr tatsächlich helfen.
Andererseits bin ich schon öfter reingelegt worden. Das Mädchen war offenbar eine nicht unbegabte Schauspielerin. Sie war sofort in die Rolle der willigen Verführerin gewechselt, weil sie geglaubt hatte, ich könnte Sex als Bezahlung verlangen.
Es sagte einiges über sie aus, dass sie angesichts meiner recht unschuldigen Bemerkung gleich auf diese Idee gekommen war. Sie war kein Mensch, der fair und mit offenen Karten spielte. Wenn ich sie richtig einschätzte, war es für sie nicht ungewöhnlich, Sex gegen Waren und Dienstleistungen zu tauschen. Dabei war sie eigentlich noch viel zu jung, um so abgebrüht zu sein.
Die Sache mit Kassandras Tränen war ein beliebter Schwindel, den vor ihr schon andere unter den magisch Begabten angewendet haben. Man muss dafür keine Beweise vorlegen und kann nicht um eine Vorführung gebeten werden. Man braucht nur ein wenig Talent, um die richtige Aura um sich aufzubauen, und vielleicht ein wenig Kinetomantie, um den Würfel ab und zu nach seinen Wünschen fallen zu lassen. Dann denkt man sich über seine angebliche prophetische Gabe irgendeine Geschichte aus, spielt wie hier das arme kleine Mädchen und nimmt sich den nächstbesten Dorftrottel vor, in diesem Falle Harry Blackstone Copperfield Dresden.
»Ich könnte natürlich lügen«, sagte sie dann auch. »Kassandras Tränen kann man nicht analysieren oder beobachten. Ich könnte es als Vorwand benutzen, um Ihnen einen plausiblen Anlass zu bieten, einer verzweifelten Frau zu helfen.«
»Ja, Lydia, das ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen. Sie könnten eine kleine Hexe sein, die den falschen Dämon aufgescheucht hat und nach einem Ausweg sucht.«
Sie spreizte die Finger. »Ich kann Ihnen nur versichern, dass das nicht zutrifft. Ich bin überzeugt, dass etwas geschehen wird. Ich habe keine Ahnung, was es ist, und ich weiß nicht, warum oder wie. Ich weiß nur, was ich sehe.«
»Und was wäre das?«
»Feuer«, flüsterte sie. »Wind. Ich sehe dunkle Wesen und einen dunklen Krieg. Ich sehe meinen Tod, der mich aus der Geisterwelt ereilt. Und inmitten von all dem sehe ich Sie. Sie sind der Anfang und das Ende. Sie sind der Einzige, der etwas tun kann.«
»Das ist Ihre Vision? Wer’s glaubt, wird selig.«
Der übliche Kitsch. Schmeichle der Zielperson, verlocke sie, lass sie den Köder schlucken, und dann räum alles ab, was sie zu bieten hat. Verdammt, dachte ich, da will jemand auf meine Kosten absahnen. Anscheinend wurde ich allmählich berühmt.
Dennoch wollte ich nicht grob werden. »Hören Sie, Lydia, vielleicht spielen Ihnen nur die Nerven einen Streich. Können wir uns nicht in ein paar Tagen noch einmal treffen und sehen, ob Sie dann immer noch glauben, dass Sie meine Hilfe brauchen?«
Die junge Frau antwortete nicht. Sie ließ einfach nur die Schultern sinken, machte ein niedergeschlagenes Gesicht, und ich musste mit meinen bohrenden Zweifeln fertigwerden. Irgendwie gewann ich den Eindruck, dass sie mir in diesem Moment nichts vormachte.
»Na gut«, sagte sie leise. »Tut mir leid, dass ich Sie aufgehalten habe.« Sie stand auf und wandte sich zum Gehen.
Ich besann mich unterdessen, sprang auf und lief durchs Büro. Gleichzeitig erreichten wir die Tür.
»Warten Sie«, sagte ich. Rasch streifte ich den Talisman vom Arm und spürte das lautlose Knacken der Energie, als ich den Knoten löste. Dann nahm ich ihr linkes Handgelenk und drehte ihre Handfläche nach oben, um ihr den Talisman umzubinden.
Sie hatte bleiche Narben auf dem Arm, quer verlaufende Schnittwunden über den großen Adern. Die Sorte Narben, die man davonträgt, wenn man ernsthaft versucht, sich umzubringen. Sie waren alt und verblasst. Anscheinend hatte sich das Mädchen die Verletzungen zugefügt, als es … Wie alt mochte es gewesen sein? Zehn Jahre? Noch jünger?
Ich schauderte und befestigte den kleinen Ring aus staubigem Tuch und einer Silberkette an ihrem Handgelenk und gab etwas Willenskraft hinein, um den Kreis zu schließen, sobald ich den Knoten geknüpft hatte. Als ich fertig war, berührte ich sie leicht am Unterarm. Ich spürte die Kraft des Talismans, ein Kribbeln, das zwei Zentimeter über ihrer Haut einsetzte.
»Glaubensmagie wirkt am besten gegen Geister«, erklärte ich leise. »Wenn Sie sich Sorgen machen, gehen Sie in die Kirche. Geister sind kurz nach Sonnenuntergang in der Hexenstunde am stärksten und dann wieder kurz vor Sonnenaufgang. Gehen Sie zu Saint Mary of the Angels. Das ist eine Kirche an der Ecke Bloomingdale und Wood Street, unten am Wicker Park. Sie ist groß, Sie können das Gebäude nicht verfehlen. Gehen Sie zum Hintereingang, und schellen Sie. Reden Sie mit Father Forthill. Sagen Sie ihm, Michaels Freund sei der Ansicht, Sie brauchten einen sicheren Ort, an dem Sie eine Weile bleiben können.«
Lydia starrte mich nur mit offenem Mund an. Tränen stiegen ihr in die Augen. »Sie glauben mir«, sagte sie. »Sie glauben mir.«
Ich zuckte unbehaglich mit den Schultern. »Vielleicht. In den letzten Wochen sind schlimme Dinge geschehen, und ich möchte Sie nicht auf dem Gewissen haben. Beeilen Sie sich lieber, bis Sonnenuntergang ist nicht mehr viel Zeit.« Ich drückte ihr ein paar Geldscheine in die Hand. »Hier, für ein Taxi. Saint Mary of the Angels, Father Forthill. Michaels Freund hat Sie geschickt.«
»Danke«, sagte sie. »O Gott, vielen Dank, Mister Dresden.« Sie nahm meine Hand mit beiden Händen und drückte mir einen tränenfeuchten Kuss auf die Knöchel. Ihre Finger waren kalt, die Lippen zu heiß. Dann eilte sie hinaus.
Ich schloss hinter ihr die Tür und schüttelte den Kopf. Harry, du bist ein Idiot, dachte ich. Das ist der einzige vernünftige Talisman, der dich vor Geistern schützt, und du hast ihn gerade verschenkt. Wahrscheinlich ist sie ein Lockvogel. Die haben das Mädchen nur zu dir geschickt, um dir den Talisman abzunehmen, damit sie dich zum Frühstück verspeisen können, wenn du ihnen noch mal den Spaß verdirbst.
Ich betrachtete meine Hand, auf der ich noch die Wärme von Lydias Kuss und die feuchten Tränen spürte. Dann seufzte ich und ging zum Schrank, wo ich immer fünfzig oder sechzig Glühbirnen in Reserve aufbewahre, um die defekte Birne auszuwechseln.
Das Telefon klingelte. Ich stieg vom Stuhl und meldete mich missmutig. »Dresden.«
Schweigen und statisches Rauschen am anderen Ende. »Dresden«, wiederholte ich.
Das Schweigen dehnte sich, und irgendetwas daran sorgte dafür, dass sich mir alle Nackenhaare sträubten. Es hatte eine Qualität, die schwer zu beschreiben ist. Als würde etwas lauern. Schadenfreude. Das Knistern wurde lauter, bis ich glaubte, Stimmen zu hören, die sich flüsternd über grausame Dinge unterhielten.
Ich blickte zur Tür, durch die Lydia verschwunden war. »Wer ist da?«
»Bald«, flüsterte jemand. »Bald, Dresden. Wir sehen uns wieder.«
»Wer ist da?«, fragte ich noch einmal. Ich kam mir irgendwie albern vor.
Aufgelegt.
Ich starrte eine Weile den Hörer an, ehe ich ihn ebenfalls auflegte. Dann fuhr ich mir mit der Hand durchs Haar. Es lief mir kalt den Rücken hinunter, und irgendwo knapp unter meinem Magen ballte sich etwas zusammen. »Also gut«, sagte ich. Meine Stimme war ein wenig zu laut für das kleine Büro. »Gott sei Dank war das nicht allzu unheimlich oder so.«
Das alte Radio auf dem Regal neben der Kaffeemaschine erwachte zischend und knackend zum Leben. Vor Schreck hätte ich beinahe einen Herzstillstand bekommen, dann drehte ich mich wütend und mit geballten Fäusten um.
»Harry?«, sagte jemand im Radio. »He, funktioniert das Ding?«
Ich redete meinem rasenden Herzen gut zu und richtete meine Willenskraft auf den Radioapparat, damit meine Stimme auch durchdrang. »Ja, Bob. Ich bin hier.«
»Den Sternen sei Dank«, erwiderte Bob. »Du wolltest doch, dass ich etwas über Geistererscheinungen herausfinde.«
»Nun mach schon, erzähl.«
Das Radio zischte und knisterte. Es waren spirituelle, keine statischen Entladungen, und Bobs Stimme war verzerrt, aber gut zu verstehen.
»Ich konnte den Kontakt herstellen. Heute Nacht im Cook County Hospital. Irgendjemand hat Agatha Hagglethorn aufgescheucht. Das ist eine üble Sache, Harry. Sie ist eine fiese alte Schachtel.«
Bob berichtete mir von Agatha Hagglethorns grässlichem, tragischem Tod und erklärte mir, wen sie im Krankenhaus wahrscheinlich aufs Korn nehmen würde.
Ich betrachtete mein linkes Handgelenk und fühlte mich auf einmal nackt. »Gut«, sagte ich. »Ich kümmere mich darum. Danke.«
Der Radioapparat kreischte und verstummte, und ich schoss zur Tür. In weniger als zwanzig Minuten würde die Sonne untergehen, und die Rushhour hatte bereits vor einer Weile begonnen. Wenn ich nicht bei Einbruch der Dunkelheit im Cook County eintraf, konnten alle möglichen schlimmen Dinge geschehen.