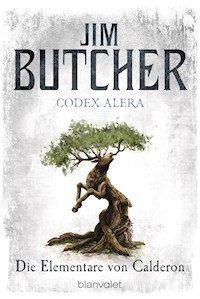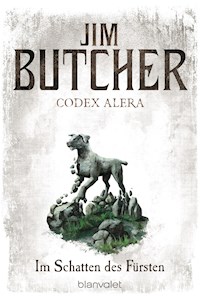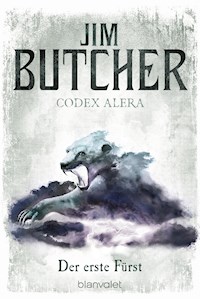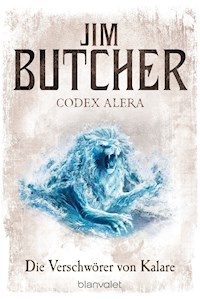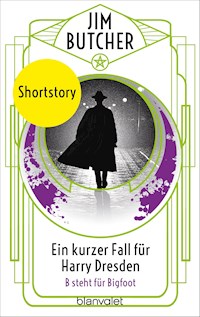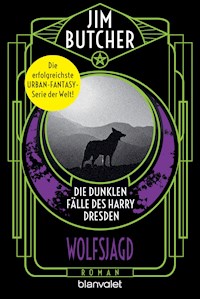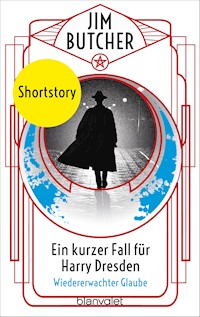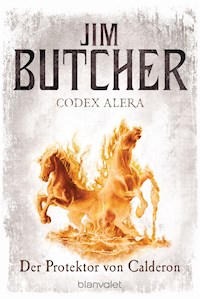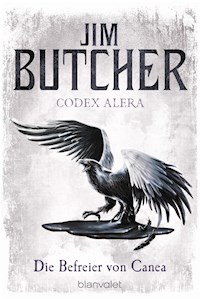9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Harry-Dresden-Serie
- Sprache: Deutsch
Um seine Tochter zu retten, stürmt Harry Dresden das Zentrum der Macht der Vampire des Roten Hofs! Der zwölfte dunkle Fall des Harry Dresden.
Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Dresden, und ich mag der mächtigste Magier Chicagos sein, aber deswegen bin ich nicht allwissend. Sie können sich meine Überraschung vorstellen, als mir meine Exfreundin Susan mitteilte, dass ich eine sieben Jahre alte Tochter namens Maggie habe. Und auch jetzt sagte Susan es mir nur, weil sie meine Hilfe benötigte. Denn die Vampire des Roten Hofes hatten Maggie entführt. Was die Blutsauger mit ihr vorhatten, wussten wir nicht. Doch eigentlich war das auch egal. Ich würde so oder so alles tun, um mein Kind zu retten. Der Rote Hof würde bereuen, sich an meiner Familie vergriffen zu haben!
Die dunklen Fälle des Harry Dresden: spannend, überraschend, mitreißend. Lassen Sie sich kein Abenteuer des besten Magiers von Chicago entgehen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 743
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Dresden, und ich mag der mächtigste Magier Chicagos sein, aber deswegen bin ich nicht allwissend. Sie können sich meine Überraschung vorstellen, als mir meine Exfreundin Susan mitteilte, dass ich eine sieben Jahre alte Tochter namens Maggie habe. Und auch jetzt sagte Susan es mir nur, weil sie meine Hilfe benötigte. Denn die Vampire des Roten Hofes hatten Maggie entführt. Was die Blutsauger mit ihr vorhatten, wussten wir nicht. Doch eigentlich war das auch egal. Ich würde so oder so alles tun, um mein Kind zu retten. Der Rote Hof würde bereuen, sich an meiner Familie vergriffen zu haben!
Autor
Jim Butcher ist der Autor der Dresden Files, des Codex Alera und der Cinder-Spires-Serie. Sein Lebenslauf enthält eine lange Liste von Fähigkeiten, die vor ein paar Jahrhunderten nützlich waren – wie zum Beispiel Kampfsport –, und er spielt ziemlich schlecht Gitarre. Als begeisterter Gamer beschäftigt er sich mit Tabletop-Spielen in verschiedenen Systemen, einer Vielzahl von Videospielen auf PC und Konsole und LARPs, wann immer er Zeit dafür findet. Zurzeit lebt Jim in den Bergen außerhalb von Denver, Colorado.
Jim Butcher
WANDEL
DIE DUNKLEN FÄLLE DES HARRY DRESDEN
Roman
Deutsch von Dorothee Danzmann
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Changes (The Dresden Files 12)« bei Penguin RoC, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2010 by Jim Butcher
Published by Arrangement with IMAGINARYEMPIRELLC
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung- und motiv: https://www.buerosued.de/
Illustrationen: © https://www.buerosued.de/
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31213-8V001
www.blanvalet.de
1. Kapitel
Ich ging ans Telefon und hörte Susan Rodriguez sagen: »Sie haben unsere Tochter entführt.«
Ich schluckte, zählte ganz langsam bis zehn. »Wie bitte?«
»Du hast mich schon richtig verstanden, Harry.« Susan sprach ganz sanft und ruhig.
»Oh!«, sagte ich. »Na dann …«
»Diese Leitung ist nicht sicher. Ich bin heute am späten Abend oder in der Nacht in der Stadt, dann können wir reden.«
»Natürlich«, sagte ich. »In Ordnung.«
»Harry? Ich bin nicht … Ich habe nie gewollt, dass …« Susan unterbrach sich mit einem ungeduldigen Seufzen. Im Hintergrund hörte ich eine Lautsprecherstimme etwas auf Spanisch sagen. »Egal, dafür ist später noch Zeit. Ich muss los, sie haben unseren Flug bereits aufgerufen. Wir sehen uns dann in ungefähr zwölf Stunden?«
»Gut«, sagte ich, »in zwölf Stunden. Ich werde … ich bin hier.«
Susan zögerte kurz, als wolle sie noch etwas sagen, legte dann aber auf.
Ich behielt den Hörer am Ohr, unfähig, mich zu rühren, bis das Telefon sein Besetztzeichen in doppelter Geschwindigkeit von sich gab.
Unsere Tochter.
Unsere Tochter, hatte sie gesagt.
Ich legte den Hörer auf. Besser gesagt, ich versuchte es. Irgendwie landete er laut klappernd auf dem Boden.
Woraufhin sich Mouse, mein großer grauer, zotteliger Hund, von seinem angestammten Schlafplatz in der Miniküchenzeile erhob, deren sich meine winzige Kellerwohnung rühmen konnte. Er kam herübergetrottet, hockte sich neben mich und starrte mich mit besorgtem Hundeblick an. Nach einer Weile gab er einen leisen Seufzer von sich, hob mit dem Maul den Telefonhörer auf und legte ihn sorgsam dorthin, wo er hingehörte, um mich danach erneut besorgt und mitfühlend zu fixieren.
»Ich …« Ich hielt inne, versuchte, das Gehörte zu verarbeiten. »Kann sein, dass ich ein Kind habe.«
Mouse ließ einen hohen, verwirrt klingenden Laut hören.
»Was glaubst du, wie ich mich fühle?« Ich starrte die Wand an. Dann stand ich auf und griff nach meinem Mantel. »Ich … ich glaube, ich brauche was zu trinken«, sagte ich und konzentrierte mich darauf, an nichts zu denken. »Jawohl. So was … ja.«
Mouse gab einen bekümmerten Laut von sich und stand auf.
»Klar darfst du mitkommen«, sagte ich. »Kannst mich ja notfalls hinterher nach Hause fahren.«
Hupkonzerte begleiteten mich auf dem Weg zum McAnally’s, doch ich schaffte die Strecke ohne Zusammenstoß. Darauf kam es im Straßenverkehr schließlich an, oder? Ich steuerte meinen geliebten und immer noch zuverlässigen, wenn auch arg ramponierten alten Käfer auf den Parkplatz neben Macs Kneipe, stieg aus und machte mich auf den Weg zur Kneipentür.
Mouse bellte leise.
Als ich mich umdrehte, stand die Wagentür noch offen. Ich hatte vergessen, sie zu schließen. Der große Hund schob sie gerade mit der Nase zu.
»Danke«, sagte ich.
Seite an Seite gingen wir in den Pub.
In Macs Kneipe stützen dreizehn unregelmäßig im Raum verteilte und reich mit Märchenmotiven aus der alten Welt verzierte Holzsäulen die Decke. Manche der dargestellten Märchenszenen sind witzig, die meisten eher nicht. An der Decke hängen, ebenfalls unregelmäßig im Raum verteilt, dreizehn sich träge drehende Ventilatoren, dreizehn Barhocker warten am bizarr gestalteten, aber stets auf Hochglanz polierten Tresen auf Gäste, und dreizehn Tische teilen sich den Platz im Raum, auch sie nach keinem erkennbaren Muster angeordnet.
»Jede Menge Dreizehnen hier drin«, murmelte ich vor mich hin.
Es war gegen halb drei am Nachmittag, und mein Hund und ich waren die einzigen Anwesenden in der Bar. Ach ja, bis auf Mac natürlich. Mac ist mittelgroß und von mittelschwerer Gestalt, ein Mann mit dicken, knochigen Handgelenken und einer glänzenden Glatze. Wie alt er ist, lässt sich unmöglich schätzen – älter als dreißig, jünger als fünfzig, irgendwo dazwischen. Auch an diesem Nachmittag trug er, wie eigentlich immer, eine blütenweiße Schürze.
Nachdem ihn Mouse einen Moment lang konzentriert gemustert hatte, setzte er sich gleich am Eingang neben die oberste Stufe der kleinen Treppe, die in die Bar führt, drehte sich einmal um sich selbst und machte es sich, das Kinn auf den Pfoten, neben der Tür bequem.
Mac warf uns einen Blick zu. »Harry.«
Ich wankte zum Tresen.
Mac hatte schon die Hand nach einer Flasche Bier ausgestreckt, aber ich schüttelte den Kopf. »Kein Bier heute. Eigentlich müsste ich jetzt einen Whiskey bestellen, aber ich weiß nicht, ob du welchen hast. Auf jeden Fall brauch ich was Stärkeres.«
Mac hob fragend die rechte Braue.
Was man bei ihm, wenn man den Mann kennt, ruhig als überraschten Ausruf verstehen darf.
Aber letztlich goss er mir ohne weiteres Nachfragen eine helle fast goldene Flüssigkeit in ein kleines Glas, die ich mir sofort hinter die Binde kippte. Es brannte abscheulich. Leise keuchend klopfte ich mit dem Zeigefinger auf den Tresen neben dem jetzt leeren Gläschen.
Stirnrunzelnd schenkte Mac nach.
Das zweite Glas kippte ich nicht mehr ganz so schnell. Auch diesmal brannte die helle Flüssigkeit auf dem Weg in meinen Magen, aber das war gut so, lieferte mir der Schmerz doch etwas, worauf ich mich konzentrieren konnte. Um ihn herum sammelten sich Gedanken und verfestigten sich, und allmählich kristallisierten sich eindeutige Formen heraus.
Susan hatte bei mir angerufen. Sie war auf dem Weg hierher.
Wir hatten ein Kind.
Von dem sie mir nie etwas gesagt hatte.
Susan hatte als Reporterin bei einem Käseblättchen gearbeitet, das auf die Welt des Übersinnlichen spezialisiert ist. Ihre ehemaligen Kollegen sind überwiegend felsenfest davon überzeugt, nichts als reine Fiktion zu verbreiten, aber Susan hatte sich ganz von selbst immer mehr der übernatürlichen Welt genähert. So waren wir einander ein paar Mal über den Weg gelaufen, was zu dem einen oder anderen verbalen Schlagabtausch geführt hatte – ehe wir schließlich zusammengekommen waren. Unsere gemeinsame Zeit hatte nicht lange gedauert, eigentlich noch nicht einmal ganze zwei Jahre, aber wir waren damals beide sehr jung und sehr glücklich miteinander gewesen.
Sicher hätte ich ahnen können, dass das nicht gut gehen konnte, denn wenn man nicht einfach nur draußen am Spielfeld steht und seine Umwelt im Großen und Ganzen ignoriert, macht man sich früher oder später Feinde. Eine meiner Feindinnen, eine Vampirin namens Bianca, hatte dann auch prompt Susan entführt und sie mit dem Blutrausch des Roten Hofes infiziert. Susan war nie ganz auf die andere Seite gewechselt, aber das würde unweigerlich geschehen, wenn sie je die Kontrolle über sich verlor. Sobald sie jemandem das Blut aussaugte, war es aus. Susan wäre dann eine Vampirin des Roten Hofes.
Sie hatte mich verlassen, weil sie fürchtete, sich nicht ewig im Griff haben zu können. Auf keinen Fall sollte ich das Opfer sein, das sie unwiderruflich zum Monster machte. So hatte sie sich ganz allein aufgemacht und war in die Welt hinausgezogen, um einen Weg zu finden, mit ihrer Situation klarzukommen.
Ich hatte mir einzureden versucht, für Susans Verhalten sprächen gute Gründe und sie habe richtig gehandelt, als sie mich verließ. Leider sprechen die Vernunft und ein gebrochenes Herz nur selten dieselbe Sprache. Ich hatte mir das, was meiner Liebsten widerfahren war, nie verziehen. Auch Schuldgefühle und Vernunft sprechen wohl nicht ganz dieselbe Sprache.
Wahrscheinlich war es gut, dass ich so schockiert war, verdammt gut sogar, denn als sich jetzt unter der Betäubung tief in mir die ersten Gefühle regten, waren die nicht von schlechten Eltern. Was sich da in mir aufbaute, ähnelte in besorgniserregender Weise einem Sturmtief, das sich weit draußen über dem Meer darauf vorbereitete, über das Land herzufallen. Noch spürte ich nur erste leise Auswirkungen, aber das reichte mir schon, um zu wissen, dass sich da in mir etwas Mächtiges zusammenbraute. Gewalttätig. Gefährlich. Tag für Tag starben überall auf der Welt Menschen, weil irgendjemand in blinder Wut zuschlug. In meinem Fall jedoch bestand die Gefahr, dass eine solche Wut weitaus schlimmere Folgen nach sich zog.
Ich bin professioneller Magier.
Und Magie und Gefühle sind untrennbar miteinander verknüpft. Ich bin schon oft in den Kampf gezogen und habe die Angst und Wut solcher angespannten Momente zu spüren bekommen, habe erlebt, wie schwer es ist, einen halbwegs klaren Kopf zu bewahren, wenn man sich in solch einer Verfassung befindet, wie hart man darum ringen muss, selbst einfache Probleme noch richtig wahrnehmen und damit umgehen zu können. Ich habe auch schon in völlig unberechenbaren Situationen meine Magie eingesetzt und ein paar Mal miterleben müssen, wie sie daraufhin wild aus dem Ruder gelaufen ist. Wenn normale Leute die Kontrolle über ihre Wut verlieren, kommt jemand zu Schaden, vielleicht stirbt sogar jemand. Wenn dasselbe einem Magier passiert, gehen Versicherungskonzerne pleite, und dann wird fleißig wieder aufgebaut.
Was sich da gerade in mir rührte, war der reinste Hurrikan. Dagegen glichen meine früheren Anfälle schwindsüchtigen kleinen Kätzchen.
»Ich muss mit jemandem reden«, hörte ich mich leise sagen. »Ich brauche jemanden, der objektiv ist, jemanden mit Durchblick. Ich muss meinen Kopf klar kriegen, ehe alles den Bach runtergeht.«
Mac stützte sich auf den Tresen und sah mich fragend an.
Ich legte wie schützend beide Hände um das kleine Schnapsglas.
»Erinnerst du dich an Susan Rodriguez?«, fragte ich leise.
Er nickte.
»Sie sagt, jemand hätte unsere Tochter entführt. Sie sagt, sie kommt später her.«
Mac atmete langsam durch. Er nahm die Flasche mit der hellen goldenen Flüssigkeit, schenkte sich selbst ein Glas ein, nippte daran.
»Ich habe sie geliebt«, sagte ich. »Und ich liebe sie vielleicht immer noch. Doch sie hat es mir nie gesagt.«
Er nickte.
»Könnte ja auch sein, dass sie lügt.«
Mac brummte etwas Unverständliches.
»Wäre schließlich nicht das erste Mal, dass ich vorgeführt werde. Ich hab nun mal eine Schwäche für Frauen.«
»Stimmt«, sagte er.
Ich warf ihm einen strengen Blick zu, woraufhin er schwach grinste.
»Sie wäre jetzt … sechs? Sieben?« Ich schüttelte den Kopf. »Ich kann ja noch nicht mal das richtig ausrechnen.«
Mac schürzte die Lippen. »Harte Nummer, das.«
Ich trank mein zweites Glas. Alles wirkte inzwischen ein bisschen weicher, der Alkohol hatte die härtesten Ecken und Kanten abgeschliffen. Mac berührte die Flasche und sah mich an, aber ich schüttelte den Kopf.
»Klar, sie könnte lügen«, fuhr ich leise fort. »Aber wenn nicht … dann …«
Mac schloss kurz die Augen und nickte.
»Dann gibt es irgendwo ein kleines Mädchen, das in Gefahr ist«, sagte ich. Ich spürte, wie ich die Zähne zusammenbiss und der Sturm in mir heftiger brodelte, an die Oberfläche zu dringen drohte. »Mein kleines Mädchen.«
Wieder nickte Mac nur.
»Ich weiß nicht, ob ich dir das je erzählt habe. Ich bin als Waisenkind aufgewachsen.«
Mein Gegenüber betrachtete mich schweigend.
»Es gab Zeiten, da … da war es schlimm. Jemand hätte kommen und mich retten müssen. Das habe ich mir so sehr gewünscht. Ich habe davon geträumt, nicht … nicht allein zu sein. Und als dann endlich, endlich wirklich jemand kam, war es das größte Monster von allen.« Ich schüttelte den Kopf. »Das wird meinem Kind nicht widerfahren, das erlaube ich nicht.«
Mac verschränkte die Arme auf dem Tresen und musterte mich eine ganze Weile lang prüfend. Als er den Mund aufmachte, ertönte ein tiefer, klangvoller Bariton: »Du musst vorsichtig sein, Harry.«
Zutiefst schockiert starrte ich ihn an. Mac hatte einen ganzen Satz gebildet, einen grammatikalisch vollständigen, korrekten Satz.
»So eine Sache stellt einen auf die Probe wie nichts anderes im Leben«, fuhr Mac fort. »Du wirst herausfinden, wer du wirklich bist. Welchen Grundsätzen du bis in den Tod hinein treu bleibst und welche Grenzen du dann doch überschreitest, wenn es hart auf hart kommt.« Er nahm mir das Glas weg und sagte: »Du bist auf dem Weg ins Ödland. Da verirrt man sich leicht.«
Wortlos sah ich total verblüfft zu, wie Mac sein Schnapsglas leerte. Dabei verzog er das Gesicht, als würde auch ihm das Getränk in der Kehle brennen, den ganzen Weg den Hals hinunter. Vielleicht hatte das viele Sprechen aber auch einfach nur seine Stimmbänder überstrapaziert.
Ich betrachtete einen Augenblick lang stumm meine Hände. »Steaksandwich und irgendwas für das Hündchen.«
Mac brummte zustimmend und machte sich umgehend an die Arbeit, ohne sich jedoch zu beeilen. Seine Barkeeper-Instinkte hatten ihm verraten, worum es mir ging: Nach Essen war mir eigentlich nicht zumute, ich wollte nur ein bisschen Zeit totschlagen und die Wirkung des Alkohols abklingen lassen.
Als das Sandwich vor mir auf dem Tresen stand, füllte Mac eine Schüssel mit Knochen und Fleisch und trug sie zusammen mit einem Wassernapf hinüber zu Mouse. Ich biss in mein Sandwich und dachte beiläufig, dass Mac nie jemandem das Essen an den Tisch brachte. Er war also auch ein Hundemensch.
Ich ließ mir Zeit beim Essen. Dann bezahlte ich.
»Danke«, sagte ich.
Er nickte. »Glück.«
Ich stand auf, verließ die Kneipe und ging zurück zum Käfer, Mouse immer dicht neben mir, den Kopf erhoben, die Augen fest auf mein Gesicht gerichtet, damit ihm auch nichts von dem, was ich vorhatte, entging.
Ich erteilte meinen Gedanken strenge Anweisungen in Bezug auf die Richtung, die sie zu nehmen hatten. Ich musste mich in Acht nehmen, immer auf der Hut sein. Das Unwetter, das sich in meinem Innern zusammenbraute, durfte auf keinen Fall losbrechen. Denn wenn ich eines ganz sicher wusste, dann das: Irgendwer, vielleicht Susan, vielleicht aber auch einer meiner Feinde, versuchte, mich zu manipulieren.
So oder so, Mac hatte recht.
Ich war auf dem Weg ins Ödland.
2. Kapitel
Susan kam gegen ein Uhr morgens.
Ich war von der Bar aus heimgefahren. Dort hatte ich mich auf direktem Weg in den Keller unter meiner Souterrainwohnung begeben, um mich der Zauberkunst zu widmen. Die hat nämlich zur Voraussetzung, dass man sich ganz und gar auf die Aufgabe konzentriert, die man sich gestellt hat. Also konzentrierte ich mich ein paar Stunden lang ganz und gar auf die Herstellung verschiedener Dinge, die mir in naher Zukunft vielleicht nützlich sein konnten. Anschließend stieg ich die Leiter zu meiner Wohnung wieder hinauf und streifte meine Kampfringe über, von denen jeder aus drei ineinander verschlungenen Reifen besteht und die ich so verzaubert habe, dass sie jedes Mal, wenn ich den Arm bewege, ein klein wenig kinetische Energie speichern. Eigentlich waren sie gut aufgeladen, aber da es nie schaden konnte, noch nachzulegen, drosch ich eine gute halbe Stunde lang heftig auf den Sandsack ein, der bei mir im Wohnzimmer in einer Ecke hängt.
Ich duschte, putzte das Bad, bereitete mir eine Mahlzeit zu und hörte generell keine Sekunde lang auf, mich zu bewegen, denn sonst wären bestimmt die Gedanken gekommen, um sich in meinem Kopf einzunisten, und ich wusste nicht, wie ich mit ihnen umgehen sollte.
An Schlaf war nicht zu denken, das konnte ich mir gleich abschminken.
Also sorgte ich wie gesagt dafür, dass ich in Bewegung blieb. Ich räumte die Küche auf und putzte sie gründlich, ich badete Mouse und kämmte sein Fell aus. Ich räumte Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad auf, wechselte das Katzenstreu im Katzenklo meines Katers Mister. Ich kehrte den Kamin aus und ordnete die Sachen, die auf dem Kaminsims standen. Ich verteilte neue Kerzen zur Beleuchtung der Wohnung.
Erst nachdem ich ein paar Stunden lang so vor mich hin gewirbelt hatte, wurde mir klar, was ich da tat: Ich wollte die Wohnung hübsch aussehen lassen, weil Susan kam. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Ich erwog gerade, auch Mister, der wie immer hoch oben auf meinem Lieblingsbücherregal thronte, noch ein Bad angedeihen zu lassen (die Überlegung allein trug mir einen starren Blick aus zusammengekniffenen Katzenaugen ein), als es höflich an der Tür klopfte.
Woraufhin mein Herz gleich höherschlug.
Als ich die Tür öffnete, stand Susan vor mir.
Sie war mittelgroß, also gut dreißig Zentimeter kleiner als ich. Sie hatte ein schmales Gesicht, das mit Ausnahme des Mundes fast kantig wirkte. Ihr Haar war dunkel und glatt, die Augen womöglich noch dunkler, und ihre Haut schimmerte tief gebräunt und kupfern, viel dunkler, als ich sie in Erinnerung hatte. Allem Anschein nach hatte sie abgenommen. Ich konnte die Sehnen und Muskeln unter der Haut an ihrem Hals erkennen, und ihre Wangenknochen traten noch deutlicher hervor als früher. Sie trug eine schwarze Lederhose, eine dazu passende Lederjacke und darunter ein schwarzes T-Shirt.
Sie schien keinen Tag älter geworden zu sein.
Unsere letzte Begegnung lag inzwischen Jahre zurück – in einem solchen Zeitraum verändert sich ein Mensch normalerweise. Vielleicht nicht immer drastisch, aber ein bisschen verändert sich jeder, oder? Ein paar Pfund mehr hier und da, ein paar Falten, das eine oder andere graue Haar. Aber Susan hatte sich nicht verändert, keinen Deut.
Das gehört dann wohl zu den netteren Nebenwirkungen, wenn man halb gewandelte Vampirin des Roten Hofes ist.
»Hallo«, begrüßte sie mich leise.
»Hallo.« Ich konnte ihr in die Augen sehen, ohne dass es einen Seelenblick ausgelöst hätte. Susan und ich hatten einander schongesehen.
Sie senkte den Blick und schob die Hände in die Taschen ihrer Lederjacke. »Kann ich reinkommen, Harry?«
Ich trat einen halben Schritt zurück. »Ich weiß nicht. Kannst du denn?«
In ihren Augen blitzte kurz heftige Wut auf. »Du glaubst, ich hätte die Grenze überschritten und mich ganz gewandelt?«
»Ich gehe ungern unnötige Risiken ein. Hat für mich irgendwie seinen Reiz verloren.«
Susan presste die Lippen zu einem dünnen Strich zusammen, nickte dann aber kommentarlos und trat über die Schwelle meiner Wohnung, jener Barriere aus magischer Energie, die jedes Heim schützte. Einem Vampir wäre das ohne meine ausdrückliche Einladung nicht möglich gewesen.
»Gut.« Ich nickte und trat ganz zurück, damit Susan in die Wohnung gehen und ich die Tür schließen konnte.
Oben auf der Treppe, die in meine Kellerwohnung führte, hatte sich ein Mann gemütlich niedergelassen. Er trug eine Leinenhose sowie eine blaue Jeansjacke und lehnte sich so zurück, dass man unter der Jacke die Konturen eines Pistolenhalfters sehen konnte. Der Mann hieß Martin und war Susans Verbündeter.
»Du«, sagte ich. »Welche Freude.«
Martins Lippen verzogen sich zu einer Grimasse, die man mit viel Wohlwollen als Andeutung eines Lächelns hätte auslegen können. »Ganz meinerseits.«
Ich knallte die Tür zu und schob zu allem Überfluss auch noch, so laut ich konnte, den Riegel vor – einfach nur so, aus purer Gemeinheit.
Susan sah mir zu, ein feines Lächeln im Gesicht, und schüttelte ein wenig den Kopf. Sie hatte gerade angefangen, sich in der Wohnung umzusehen, als aus der dunklen Miniküche ein Grollen erklang, das sie erstarren ließ. Mouse hatte sich nicht erhoben, und sein Knurren ließ sich keineswegs mit den wilden Lauten vergleichen, die ich schon von ihm gehört hatte, wenn die Lage brenzlig wurde, aber es handelte sich eindeutig um eine wenn auch noch höfliche Warnung.
Susan blieb eine Weile wie erstarrt stehen, den Blick unverwandt auf die Küche gerichtet. »Du hast dir einen Hund zugelegt?«, fragte sie schließlich.
»Umgekehrt wird ein Schuh draus: Wenn sich hier jemand jemanden zugelegt hat, dann der Hund mich.«
Susan nickte, als wäre damit alles gesagt, wobei sie den Blick durch meine kleine Wohnung schweifen ließ. »Ein bisschen umdekoriert hast du aber.«
»Zombies«, sagte ich, »und Werwölfe. Haben mir die Bude ein paar Mal auseinandergenommen.«
»Ich habe sowieso nie verstanden, warum du immer noch in diesem übelriechenden, erbärmlichen Loch haust.«
»Übelriechend? Erbärmlich? Pass auf, was du sagst, du sprichst von meinem Heim«, mahnte ich. »Kann ich dir etwas anbieten? Cola, Bier?«
»Wasser?«
»Das natürlich auch. Setz dich doch.«
Susan bewegte sich völlig lautlos zu einem der beiden Lehnsessel, die ich rechts und links vom Kamin postiert hatte, um sich mit kerzengeradem Rücken auf der Sesselkante niederzulassen. Ich goss ihr ein Glas Eiswasser ein, holte mir eine Cola aus dem Kühlschrank und trug beides zur Sitzgruppe hinüber, wo ich in dem zweiten Sessel Platz nahm, sodass wir einander, wenn auch ein bisschen schräg, gegenübersaßen. Ich riss den Verschluss von meiner Cola-Dose.
»Willst du Martin wirklich da draußen vor der Tür hocken lassen?«, fragte Susan leicht belustigt.
»Na klar.« Seelenruhig trank ich einen Schluck Cola.
Sie nickte nachdenklich, während sie ihr Glas mit den Lippen berührte. Gut möglich, dass sie auch einen winzigen Schluck Wasser trank.
Ich wartete, bis ich es nicht mehr aushielt, also vielleicht zwei oder drei Sekunden lang. Dann musste ich das aufgeladene Schweigen brechen. »Also?«, erkundigte ich mich betont beiläufig. »Was gibt es Neues?«
Susan musterte mich einen Moment lang mit schwer zu deutendem Blick, ehe sich ihre Lippen wieder in einen dünnen Strich verwandelten. »Das wird nicht leicht für uns beide, also bringen wir es hinter uns. Wir haben keine Zeit, lange um den heißen Brei herumzureden.«
»Gut. Unser Kind?«, fragte ich. »Von dir und mir?«
»Ja.«
»Woher weißt du das?«
Ihr Gesicht zeigte keine Regung. »Es hat niemand anderen gegeben, Harry. Seit jener Nacht mit dir nicht mehr und davor mehr als zwei Jahre lang nicht.«
Wenn sie log, war ihr das nicht anzumerken. Das musste ich einen Augenblick lang sacken lassen, also trank ich noch einen Schluck Cola. »Du hättest es mir sagen sollen. Meiner Meinung nach hättest du es mir sagen müssen.«
Ich sagte das in einem viel gelasseneren Tonfall, als ich es selbst für möglich gehalten hätte, allerdings wusste ich nicht, was in meinem Gesicht geschrieben stand. Susans dunkle gebräunte Haut wurde auf jeden Fall ein paar Schattierungen heller. »Ich weiß, dass du wütend bist, Harry«, sagte sie leise.
»Wenn ich wütend bin, fackel ich Sachen ab und haue Löcher in Wände«, sagte ich. »Über den Punkt bin ich schon eine ganze Weile hinaus.«
»Natürlich hast du jegliches Recht, wütend zu sein«, fuhr Susan fort, als hätte ich gar nichts gesagt. »Aber ich habe getan, was ich für sie und für dich für das Beste hielt.«
Das Unwetter tobte inzwischen weiter oben in meiner Brust, aber ich zwang mich dazu, ruhig sitzen zu bleiben und gleichmäßig zu atmen. »Ich höre.«
Sie nickte und schwieg noch einen Moment, um ihre Gedanken zu sortieren. »Du weißt nicht, wie es da unten ist«, sagte sie schließlich. »In Mittelamerika, bis runter nach Brasilien. So viele Staaten, die am Abgrund stehen, die drohen in die Anarchie abzurutschen. Dafür gibt es einen Grund.«
»Der Rote Hof!«, warf ich ein. »Das weiß ich.«
»Abstrakt magst du es wissen, ja. Aber keiner aus dem Weißen Rat hat je längere Zeit dort unten verbracht, keiner von euch hat je dort gelebt, hat gesehen, ganz hautnah miterlebt, wie es ist, wenn die Roten herrschen.« Sie zitterte und verschränkte die Arme vor der Brust. »Es ist ein Albtraum. Außer der Bruderschaft und ein paar schlecht finanzierten und noch schlechter ausgerüsteten Organisationen der Kirche gibt es niemanden, der sich ihnen in den Weg stellt.«
Bei der Bruderschaft von Saint Giles handelt es sich um ein Sammelbecken für Ausgestoßene und Verirrte aus der übernatürlichen Welt. Viele von ihnen sind Halbvampire wie Susan. Die Bruderschaft hasst den Roten Hof mit glühender Leidenschaft und tut alles in ihrer Macht Stehende, um den Vampiren bei jeder sich bietenden Gelegenheit Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Die Mitglieder sind in kleinen konspirativen Einheiten organisiert. Sie suchen sich Angriffsziele, bilden Neuzugänge aus, legen Bomben und finanzieren ihre Operationen mit zahllosen zwielichtigen geschäftlichen Aktivitäten. Im Grunde sind es Terroristen – verschlagen, geschickt und zäh. Weil sie es sein müssen.
»Im Rest der Welt ging es in den letzten Jahren auch nicht gerade zu wie in Disneyland«, sagte ich leise. »Ich habe im Krieg so einiges an Albträumen mitbekommen, und danach war es auch kein Zuckerschlecken.«
»Ich will gar nicht kleinreden, was ihr getan habt«, sagte sie. »Ich versuche nur, dir zu erklären, mit welcher Situation ich mich damals konfrontiert sah. Als Mitglied der Bruderschaft schläft man selten zweimal hintereinander im selben Bett. Wir sind immerzu unterwegs. Entweder planen wir eine Aktion, oder wir sind auf der Flucht. In diesem Leben ist kein Platz für ein Kind.«
»Wenn es da nur jemanden mit einem festen Zuhause und einem regelmäßigen Einkommen gegeben hätte, bei dem sie hätte bleiben können, was?«, sagte ich.
Susans Blick wurde härter. »Wie viele Leute sind in deiner unmittelbaren Nähe gestorben? Wie viele sind verletzt worden?« Sie fuhr sich mit allen Fingern durchs Haar. »Um Himmels willen, du selbst hast mir gerade erzählt, dass es mehrmals Angriffe auf deine Wohnung gab. Wäre das anders gelaufen, hätte es die nicht gegeben, wenn du hier drin auf ein Kleinkind hättest aufpassen müssen?«
»Das werde ich jetzt wohl nicht mehr erfahren«, sagte ich leise.
»Ich weiß es«, sagte sie, und ihre Stimme drohte plötzlich zu brechen. »Glaubst du, ich würde nicht gern an ihrem Leben teilhaben? Ich weine mich jede Nacht in den Schlaf – wenn ich überhaupt schlafen kann. Aber letztlich ging es nicht anders, letztlich konnte ich ihr nichts weiter bieten als ein Leben auf der Flucht, und du konntest ihr nichts anderes bieten als ein Leben im Belagerungszustand.«
Ich starrte sie an.
Aber ich schwieg.
»Also habe ich das Einzige getan, was ich für sie tun konnte«, sagte sie. »Ich fand einen sicheren Ort für sie. Weit weg von allen Kämpfen. Wo sie ein geregeltes Leben führen konnte. In einem liebevollen Zuhause.«
»Du hast mir nie etwas von ihr erzählt«, sagte ich.
»Hätte der Rote Hof je erfahren, dass ich ein Kind habe, hätte er das auf jeden Fall gegen mich verwendet! Sie hätten sie benutzt, um an mich ranzukommen, oder hätten sich durch sie an mir gerächt. Je weniger Menschen von ihr wussten, desto sicherer war sie. Ich habe dir nie von ihr erzählt, obwohl ich wusste, dass es falsch war. Obwohl ich wusste, wie wütend dich das machen würde. Deiner eigenen Kindheit wegen.« Sie beugte sich vor, ihre Augen glühten förmlich vor Intensität. »Ich würde jederzeit noch tausendmal Schlimmeres tun, wenn das bedeutete, sie besser zu schützen.«
Ich nippte erneut an meiner Cola. »Also hast du sie von mir ferngehalten, weil das für sie ungefährlicher ist, und sie fortgeschickt, um von Fremden erzogen zu werden, weil sie dann sicherer ist.« Der Sturm in mir drängte höher, meine Stimme klang inzwischen sehr nach seinem wütenden Heulen. »Und was bitte schön haben all deine klugen Entscheidungen letztendlich gebracht?«
Susans Augen blitzten, und auf ihrer Haut erschienen wirbelnde scharlachrote Stammesmarkierungen, wie Tätowierungen mit unsichtbarer Tinte – die Bruderschaftsversion eines Stimmungsrings. Das Muster bedeckte Susans eine Gesichtshälfte und zog sich bis auf den Hals hinunter.
»In der Bruderschaft muss es eine undichte Stelle geben«, sagte sie. »Irgendwie hat Herzogin Arianna vom Roten Hof von der Kleinen erfahren und sie entführen lassen. Du weißt, wer Arianna ist?«
»Ja.« Ich nickte. Die Erwähnung Ariannas ließ mir das Blut in den Adern gefrieren, aber ich befahl mir streng, nicht weiter darauf zu achten. »Arianna ist Herzog Ortegas Witwe. Sie hat geschworen, sich an mir zu rächen – und einmal hat sie versucht, mich über eBay zu kaufen.«
Susan starrte mich verdutzt an. »Wie geht so was … egal! Unsere Quellen am Roten Hof berichten, dass Arianna für Maggie etwas ganz Spezielles plant. Wir müssen das Kind da wegholen.«
Wieder holte ich tief Luft und schloss kurz die Augen.
»Maggie heißt sie also?«, flüsterte ich.
»Nach deiner Mutter«, flüsterte Susan. »Margaret Angelica.« Ich hörte, wie sie in ihrer Jackentasche wühlte. »Hier.«
Ich öffnete die Augen und sah ein Passfoto eines dunkeläugigen, vielleicht fünf Jahre alten Kindes. Die Kleine trug ein kirschrotes Kleidchen und lila Schleifen im Haar und strahlte mich mit breitem, total ansteckendem Lächeln an. Irgendein weit entfernter, ruhiger, vom Durcheinander in meinem Innern sorgsam abgetrennter Teil meines Verstandes prägte sich jedes Detail, jedes Merkmal im Gesicht des Kindes ein, verstaute die Infos sorgsam, für den Fall, dass ich dieses Gesicht irgendwann, irgendwo würde wiedererkennen müssen. Der Rest von mir weigerte sich schlichtweg, genauer hinzuschauen und in diesem Bild etwas anderes zu sehen als ein Stück Papier mit farbiger Tinte darauf.
»Das Bild ist zwei Jahre alt«, sagte Susan leise. »Ein neueres habe ich nicht.« Sie biss sich auf die Lippen und hielt mir das Foto hin.
»Nein, behalt es«, sagte ich ebenso leise, woraufhin Susan das Foto hastig wieder einsteckte. Die Markierungen auf ihrer Haut verblassten zusehends, verschwanden ebenso rasch, wie sie aufgetaucht waren. Müde rieb ich mir die Augen. »Lass uns für eine Weile deine Entscheidung vergessen, mich aus deinem Leben zu streichen. Es hilft momentan niemandem, darauf herumzureiten, und wenn Maggie eine Chance haben soll, müssen wir wohl zusammenarbeiten. Siehst du das auch so?«
Susan nickte.
»Aber«, fuhr ich fort, nun durch zusammengebissene Zähne hindurch, »wir werden uns später noch über dieses Thema unterhalten. Hast du verstanden?«
»Ja«, flüsterte sie. Sie sah mit großen, feucht schimmernden dunklen Augen zu mir auf. »Ich wollte dir nie wehtun. Oder ihr. Ich wollte nur …«
»Nein!«, unterbrach ich sie barsch. »Dafür ist es zu spät. Mit solchen Diskussionen verplempern wir nur Zeit, die wir nicht haben.«
Susan wandte rasch ihr Gesicht von mir ab und schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, strahlte ihr Gesicht Ruhe und Konzentration aus. Sie hatte sich wieder im Griff. »In Ordnung«, sagte sie. »Lass uns die nächsten Schritte besprechen. Da gibt es einige Möglichkeiten.«
»Die da wären?«
»Zum Beispiel Diplomatie. Ich habe einige Geschichten über dich gehört. Wahrscheinlich stimmen die meisten vorn und hinten nicht, aber ich weiß, du hast bei ein paar Leuten einen Gefallen gut. Wenn ein Großteil jener Mächte, die das Abkommen der übersinnlichen Gemeinde unterschrieben haben, die Stimme für uns erhebt, kriegen wir Maggie vielleicht ohne jeglichen Zwischenfall zurück.«
Ich schnaubte verächtlich. »Andere Möglichkeiten?«
»Mach dem Roten König ein gutes Angebot im Austausch für das Leben deines Kindes. Er hat an dieser Sache kein persönliches Interesse und steht von ihrem Rang her über Arianna. Biete ihm etwas an, das für ihn attraktiv genug ist, und Arianna wird Maggie gehen lassen müssen.«
»Gehen lassen schon«, knurrte ich. »Aber wie ich sie kenne, lässt sie Maggie mit Zementschuhen im Wasser untergehen.«
Susan sah mich an. »Was sollen wir also deiner Meinung nach tun?«
Ich spürte, wie sich meine Lippen ganz ohne mein Zutun zu etwas verzogen, was man höchstwahrscheinlich auch mit viel Wohlwollen nicht als Lächeln interpretieren konnte. Das Gewitter hatte sich inzwischen ungefähr auf Höhe meines Herzens eingenistet und schickte erste Ausläufer in Richtung Kehle, heiße Ranken der Wut. Es dauerte gut und gern zehn Sekunden, bis ich etwas sagen konnte, und selbst dann hörte sich meine Stimme an wie die von Mouse, wenn er es ernst meint.
»Ich sage dir, was wir tun werden. Die Roten haben unser Mädchen geraubt, und wir werden verdammt noch mal dafür sorgen, dass sie das teuer zu stehen kommt.«
In Susans Augen flammte glühender, schrecklicher Hunger auf – die Reaktion auf meinen blutrünstigen Tonfall.
»Wir finden Maggie«, sagte ich. »Wir holen sie zurück und töten jeden, der sich uns in den Weg stellt.«
Ein Zittern durchlief Susan, Tränen schossen ihr in die Augen. Sie senkte den Kopf und gab einen gedämpften Laut von sich, den ich nicht zu interpretieren vermochte. Dann beugte sie sich vor und berührte sanft meine linke Hand, die immer noch von vielen nur langsam verblassenden Brandnarben verunstaltet war. Sie sah meine Hand an, zuckte zusammen und machte Anstalten, die ihre zurückzuziehen.
Ehe das geschehen konnte, fing ich ihre Hand ein und drückte sie. Susan erwiderte den Händedruck. So saßen wir einen Augenblick lang einfach nur schweigend da und hielten uns bei den Händen. Keiner von uns sagte etwas.
»Danke«, flüsterte Susan schließlich. Ihre Hand, die ich immer noch fest in meiner hielt, zitterte. »Danke, Harry.«
Ich nickte. Eigentlich wollte ich dringend etwas sagen, um Susan auf Abstand zu halten, um zu verhindern, dass sie mir zu nah kam, aber da war ihre Hand, die warm in meiner lag, und aus dieser Wärme wurde plötzlich etwas, das ich nicht ignorieren konnte. Ich war so wütend auf Susan, wie man nur auf jemanden wütend sein kann, an dem einem sehr viel liegt – und der einen gerade verletzt hatte. Die Schlussfolgerung war unausweichlich: Ich machte mir immer noch etwas aus dieser Frau, sonst wäre ich nicht so unbändig wütend auf sie.
»Wir finden sie«, bekräftigte ich, »und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sie sicher zurückzubringen.«
Susan sah mich an. Tränen liefen ihr inzwischen über die Wangen. Sie nickte, hob die Hand und strich mit den Fingern sanft über die Narbe auf meiner Wange. Es war eine ganz neue Narbe, die noch bösartig rot leuchtete, und ich fand, sie ließ mich aussehen wie einen zähen, harten Burschen.
Ihre Fingerspitzen waren sanft und warm.
»Ich wusste nicht, was ich tun sollte«, erklärte sie. »Niemand war bereit, sich direkt mit ihnen anzulegen, ihnen Einhalt zu gebieten. Niemand.«
Unsere Blicke trafen einander, und plötzlich loderte die alte Hitze zwischen uns hoch, stieg zitternd aus unseren ineinander verschlungenen Händen auf, strahlte von Susans Fingerspitzen aus auf die Haut meines Gesichts. Susans Augen wurden größer, und mein Herz schlug immer schneller. Ich war stocksauer auf Susan, aber mein Körper interpretierte diese Wut anscheinend als Form der Erregung und kümmerte sich wieder einmal nicht um das Kleingedruckte. Ich schaffte es, dem Blick meiner ehemaligen Geliebten ziemlich lange standzuhalten, bis ich schließlich mit trockener Kehle sagte: »Hat es nicht damals genauso angefangen, und jetzt haben wir diesen Schlamassel am Hals?«
Sie gab einen zittrigen Laut von sich, der wohl ein Lachen hatte werden sollen, und entzog mir ihre Hände. »Tut mir leid, ich wollte wirklich nicht …« Sie räusperte sich und fügte leise hinzu: »Bei mir ist es nur schon eine ganze Weile her.«
Verdammt, ich wusste genau, was sie meinte. Aber letztlich schaffte ich es, Körper und Geist zu trennen. »Susan«, sagte ich, »was immer nach dieser Unterhaltung passieren mag: Wir beide sind fertig miteinander.« Ich sah ihr ins Gesicht. »Das ist dir auch klar. Das weißt du, seit du dich entschieden hast, mir nichts von Maggie zu erzählen.«
Sie nickte langsam, als fürchte sie, etwas könne bersten, wenn sie sich zu schnell bewegte. Sie faltete die Hände im Schoß. »Ja. Ich wusste es, als ich die Entscheidung traf.«
Das Schweigen zwischen uns drohte endlos zu werden.
»Gut!« Ich holte tief Luft, als würde das helfen. »Soweit ich verstanden habe, bist du nicht nach Chicago geflogen, um einen kleinen Plausch mit mir zu halten. Für Privatbesuche brauchst du keinen Martin.«
Susan zog anerkennend die rechte Braue hoch. »Stimmt.«
»Also? Warum Chicago?«
Sie schien sich wieder gefasst zu haben. »Hier gibt es einen Außenposten der Roten. Ich dachte, das wäre ein Anfang.«
»Gut«, sagte ich und stand auf. »Fangen wir an.«
3. Kapitel
»Ich hoffe, du nimmst mir nichts mehr übel«, sagte Martin zu mir, während er den Wagen, den Susan und er gemietet hatten, vom kleinen, kiesbestreuten Parkplatz meines Wohnhauses auf die Straße lenkte.
Aus Rücksicht auf meine Storchenbeine hatte mir Susan den Beifahrersitz überlassen. »Was sollte ich dir denn übel nehmen?«
»Die Sache, die bei unserer ersten Begegnung passiert ist.« Martin fuhr ein Auto genauso, wie er alles andere tat: mustergültig und emotionslos. Bei jedem Stoppschild kam unser Fahrzeug wie vorgeschrieben vollständig zum Stehen, und wir fuhren 8 km/h unter der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Noch wusste ich nicht, wohin wir unterwegs waren, aber eines war mir schon klar: Wir würden eine halbe Ewigkeit brauchen, um dort anzukommen.
»Meinst du, als du mich bei deinem Attentat an den alten Ortega benutzt hast?«, fragte ich. »Womit du dafür gesorgt hast, dass man das Duell wegen Verstoßes gegen den Kodex für ungültig erklärt hat? Woraufhin der Krieg des Weißen Rates gegen die Vampire munter in die nächste Runde ging?«
Martin warf erst mir, dann im Rückspiegel Susan einen Blick zu.
»Sieh mich nicht so an, ich habe es dir doch gesagt«, ließ sich Susan von hinten vernehmen. »Er ist nur etwas langsam, wenn er spontan sein muss. So nach und nach blickt er alles.«
Auch ich schaute sie im Rückspiegel an. »Im Nachhinein war dein Vorgehen gar nicht mal so schwer nachzuvollziehen«, sagte ich. »Der Krieg des Weißen Rates gegen den Roten Hof dürfte so ungefähr das Beste sein, was der Bruderschaft seit Ewigkeiten passiert ist.«
»Dazu kann ich nichts sagen«, meinte Martin, »ich bin ja erst seit gut hundert Jahren dabei. Aber der Weiße Rat ist eine der wenigen Organisationen auf dem Planeten, die es von den Ressourcen her mit den Roten aufnehmen kann, und jeder Sieg, den der Weiße Rat davontrug, jede Schlacht, bei der ihr eigentlich eine verheerende Niederlage hättet einstecken müssen und die ihr dennoch überlebt habt, führte dazu, dass sich der Rote Hof intern zerfleischte. Ein paar von denen hegen seit Jahrtausenden einen Groll gegen Rivalen in den eigenen Reihen, und entsprechend episch ist dieser Groll.«
»Nenn mich schrullig, Martin«, sagte ich, »aber meinem Empfinden nach hat dieser Krieg, für dessen Verlängerung du dich so nachdrücklich eingesetzt hast, ein paar Kinder zu viel das Leben gekostet. Was deine Frage betrifft, ob ich dir etwas übel nehme …« Ich ließ meine Zähne aufblitzen, was rein theoretisch durchaus als Lächeln hätte durchgehen müssen. »Lass dir gesagt sein, Marty: Mit meinen Gefühlen möchtest du momentan keine nähere Bekanntschaft machen.«
Martins Blick streifte mich kurz von der Seite, und eine gewisse Anspannung ergriff von seinem Körper Besitz. Seine Schultern zuckten – der Mann dachte eindeutig an seine Knarre. Er war gut im Umgang mit Schusswaffen. Am Abend meines Duells mit einem Vampir des Roten Hofes namens Ortega hatte Martin besagtem Vampir eine Ladung aus einem dieser riesigen Scharfschützengewehre in den Leib gejagt. Zugegeben – eine halbe Sekunde später, und Ortega hätte mich geext. Aber Martins Schuss hatte eine schwerwiegende Verletzung des Duellkodexes dargestellt, des Regelwerks, das bestimmte, wie persönliche Konflikte zwischen Individuen aus Nationen, die das Abkommen der übersinnlichen Gemeinde unterzeichnet hatten, ablaufen sollten.
Der Ausgang des Duells, wäre es nach den Regeln verlaufen, hätte das frühe Ende des Krieges zwischen dem Roten Hof und dem Weißen Rat der Magie bedeutet, was einer Menge Leuten das Leben gerettet hätte. Nach Martins Schuss war alles ganz anders gelaufen.
»Aber du brauchst dir keine grauen Haare wachsen zu lassen«, fuhr ich fort. »Ortega wollte selbst gegen den Duellkodex verstoßen – die Sache wäre ohnehin so ausgegangen, egal, was du in dieser Nacht getan hast; das hat nur dafür gesorgt, dass Ortega in letzter Sekunde eine Kugel zu schlucken bekam und nicht ich. Du hast mir das Leben gerettet, und das erkenne ich an.«
Das Pseudolächeln klebte mir immer noch im Gesicht, fühlte sich aber nicht mehr richtig strahlend an, weswegen ich mir Mühe gab, es aufzupolieren.
»Aber hättest du dein Ziel erreicht, indem du mir eine Kugel in den Rücken gejagt hättest statt ihm in die Brust«, setzte ich hinzu, »hättest du es, ohne mit der Wimper zu zucken, getan, auch das ist mir klar. Denk bloß nicht, wir wären dicke Kumpel.«
Wieder bedachte mich Martin mit einem kurzen Seitenblick, schien sich dann aber zu entspannen. »Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass du, der Hitzkopf des Weißen Rates, ständig den selbstgerechten Moralapostel gibst.«
»Bitte?«, fragte ich leise.
Martin sprach gleichmütig, aber hinter seinen Worten glomm ein gewisses Feuer. Es war das erste Mal, dass ich eine solche Gefühlsregung bei ihm wahrnahm. »Auch ich habe Kinder sterben sehen, hingeschlachtet wie Tiere, und zwar von einer Macht, für die sich niemand in eurem ach so weisen und mächtigen Rat auch nur die Bohne zu interessieren scheint, weil die Opfer arm sind und weit weg. Ist das nicht ein feiner Grund, sie einfach zugrunde gehen zu lassen? Ja, wenn ich dir eine Kugel in den Rücken hätte jagen müssen, um dafür zu sorgen, dass der Weiße Rat seine Truppen wieder gegen den Roten Hof ins Feld schickt, dann hätte ich das getan und noch dafür bezahlt, der Schütze sein zu dürfen.« Er hielt wieder an einem Stoppschild, sah mich direkt an und sagte: »Damit wäre das geklärt. Gut, dass wir uns mal darüber unterhalten haben. Oder möchtest du noch etwas dazu sagen?«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust und starrte in die Nacht. »Ich hab schon Leute umgelegt, die mir sympathischer waren als du, Martin. Sind wir bald da?«
Martin lenkte den Wagen an den Straßenrand vor einem Bürohaus. »Hier ist es.«
Ich besah mir das Gebäude. Nichts Außergewöhnliches für Chicago: zwölf Stockwerke, alles ein bisschen heruntergekommen. Ein ganz normales Bürogebäude. Trotzdem haute mich der Anblick um. »Die Roten können unmöglich …«, sagte ich fassungslos. »Hört mal, das kann nicht sein. Mein Büro ist in dem Haus hier!«
»Wie sich allgemein herumgesprochen haben dürfte, hat die Unternehmenssparte des Roten Hofes das Haus vor fast acht Jahren erworben.« Martin schaltete das Automatikgetriebe des Mietwagens auf Parken und zog die Handbremse an. »Ich nehme mal an, du erinnerst dich noch an die erhebliche Mieterhöhung, die sie euch damals aufgebrummt haben?«
»Ich …« Immer noch fassungslos, musste ich ein paar Mal blinzeln. »Ich hab meine Miete an den Roten Hof bezahlt?«
»Erhöhte Miete«, sagte Martin mit leichtem Nachdruck. »Herzogin Arianna hat offenbar einen schrägen Sinn für Humor. Wenn dich das tröstet: Die Leute, die hier für den Roten Hof arbeiten, ahnen nicht, wer ihr wirklicher Auftraggeber ist. Sie glauben, sie arbeiten für eine Firma, die für einen Import-Export-Konzern Konzepte zur sicheren Datenspeicherung erstellt.«
»Aber das ist … mein Haus.« Stirnrunzelnd schüttelte ich den Kopf. »Was genau soll hier abgehen? Was haben wir vor?«
Martin stieg aus und öffnete den Kofferraum. Auch Susan kletterte aus dem Auto, und ich tat es den beiden schon rein aus Prinzip nach.
»Wir …« Martins »Wir« schloss mich eindeutig nicht mit ein, »brechen in das Büro der Datensicherungsfirma ein und holen uns ein paar Dateien, die uns hoffentlich Näheres über den Aufenthaltsort und die Pläne von Arianna verraten. Du bleibst hier beim Wagen.«
»Den Teufel werde ich tun!«
»Harry.« Susan klang durch und durch wie die Mutter aller rationalen Geschäftsfrauen. »Es geht um Computer.«
Ich stöhnte auf, als hätte sie mir gerade einen spitzen Ellbogen zwischen die Rippen gerammt. Magier und Computer passen ungefähr so gut zusammen wie Flammenwerfer und Bibliotheken. Kein technisches Gerät mag einen Magier in seiner Nähe, die Dinger werden dann gern unzuverlässig und flippen aus. Je moderner die Technologie, desto empfindlicher, was unsereins betrifft, und bei Computern wird es ganz schlimm. Würde ich mit den beiden mitgehen … sagen wir’s mal so: Man nimmt ja auch nicht gerade seine Katze mit, wenn man einen Kanarienvogel kaufen geht. Nicht weil die Katze unhöflich ist, sondern einfach nur weil sie eine Katze ist.
»Dann bleibe ich wohl lieber beim Auto.«
»Die Chancen, dass man unsere Einreise bemerkt hat und uns beobachtet, stehen eins zu eins«, sagte Martin zu Susan. »Wir mussten Guatemala überstürzt verlassen, die Ausreise lief nicht so glatt, wie sie hätte laufen sollen.«
»Wir hatten ja auch nicht tagelang Zeit.« Nun klang Susan eher nach genervter Hausfrau, die ein bestimmtes Thema zum x-ten Mal mit ihrem Mann durchkauen musste. Die beiden führten diese Diskussion eindeutig nicht zum ersten Mal. Susan öffnete den Koffer, der im Kofferraum lag, und ließ verschiedene Dinge in ihre Jackentasche gleiten. »Manchmal muss man eben Zugeständnisse machen.«
Martin sah ihr einen Augenblick lang zu, ehe er ein einzelnes Werkzeug aus dem Koffer nahm und sich seinen Trekkingrucksack auf den Rücken schnallte. Da der Rucksack wahrscheinlich Computerkram enthielt, blieb ich vorsichtshalber an der Beifahrertür des Autos stehen und versuchte, keine feindseligen Gedanken zu hegen.
»Halt die Augen offen, es könnte Ärger geben«, mahnte mich Susan. »In etwa zwanzig Minuten dürften wir zurück sein.«
»Oder auch nicht«, fügte Martin hinzu. »In welchem Fall wir dann wohl hautnah miterleben dürfen, was einem so eine schlampige, übereilte Abreise einträgt.«
Susan sagte darauf nichts, gab aber einen leisen, entnervt klingenden Laut von sich.
Die beiden machten sich auf den Weg zum Haus, wo die verschlossene Eingangstür sie ungefähr drei Sekunden lang aufhielt. Dann waren sie verschwunden.
»Ich stehe hier rum wie bestellt und nicht abgeholt«, murmelte ich vor mich hin. »Dabei ist das mein Haus.« Ich schüttelte den Kopf. »Herrje, ich stehe hier rum und führe Selbstgespräche!«
Dabei wusste ich genau, warum ich Selbstgespräche führte. Sobald ich die Klappe hielt, kamen die Gedanken und drehten sich nur um eins: eine einsame kleine Person voller Angst in der Höhle der Monster. Und sobald ich über diese kleine Person nachdachte, führte das unweigerlich dazu, dass ich auch darüber nachdachte, wie man mich aus ihrem Leben ausgeschlossen hatte, und das wiederum führte mich unweigerlich zu dem Biest in meiner Brust, das mit Zähnen und Klauen versuchte freizukommen. Alles Dinge, über die ich auf keinen Fall nachdenken durfte.
Als die regionale Oberschlampe des Roten Hofes, die nunmehr glücklicherweise endgültig verstorbene Bianca, Susan in der festen Absicht, sie in eine vollwertige Vampirin des Roten Hofes zu verwandeln, entführt hatte, hatte sie mir damit meine Liebe rauben wollen. Was ihr in gewisser Weise ja auch gelungen war. Die Susan von einst, immer fröhlich und unbekümmert, immer bereit, mich zu berühren und zu küssen, die Susan, die das Leben an sich und besonders das Leben mit mir in vollen Zügen genossen hatte – diese Susan gab es nicht mehr.
Stattdessen gab es nun dieses Zwischenwesen, halb Emma Peel, halb She-Hulk. Wir hatten einander so sehr geliebt, und aus dieser Liebe war ein Kind entstanden, doch Susan hatte mir das verschwiegen, was …
Auf einmal rieselte es mir eiskalt über den Rücken.
Ich vertraue meinen Instinkten, wenn sie um zwei Uhr morgens in einer inzwischen sehr dunkel gewordenen Stadt anfangen verrücktzuspielen. Ohne groß nachzudenken, sackte ich in die Hocke, nahm die Luft, die mich umgab, und zog einen Schleier um mich.
Einen Schleier zu wirken, erfordert ausgetüftelte, nicht gerade einfache Magie, um Objekte oder Menschen weniger sichtbar zu machen, als sie eigentlich sein müssten. Schleier sind nie mein Spezialgebiet gewesen, im Gegenteil, ich pflegte früher in dieser Richtung eher herumzupfuschen, bis mein Lehrling Molly in mein Leben trat. Um Molly die Grundlagen des Schleierwirkens ordentlich lehren zu können, hatte ich mich erst einmal selbst fortbilden müssen. Molly hatte sich in dieser Sache als Naturtalent erwiesen, ich hatte sie aber gezwungen, ihre Talente immer weiter auszubauen, was nur möglich gewesen war, indem auch ich mich höllisch anstrengte und jede Menge Zeit in das entsprechende Training investierte, um dem Grashüpfer gegenüber wenigstens ein Minimum an Glaubwürdigkeit vortäuschen zu können.
Langer Rede kurzer Sinn: Schnelle, einfache Schleier sind mir inzwischen kein Ding der Unmöglichkeit mehr.
Als ich mir den nötigen Schatten borgte und das Licht verbog, wurde es in der Straße um mich herum ein bisschen dunkler. Wenn man sich unter einem Schleier befindet, büßt man ein Stück weit die Fähigkeit ein, genau zu sehen, was um einen herum vor sich geht. In diesem Fall fand ich, es sei die Sache wert, es war nämlich verdammt weit bis zur nächsten schützenden Hausecke, sollte jemand gerade mit einer Waffe auf mich zielen. Einfach zu verschwinden, nicht mehr zu sehen zu sein, schien mir vorteilhafter.
Da kauerte ich also neben dem Mietwagen, nicht direkt unsichtbar, aber doch so gut wie. Ein Schleier ist nur sinnvoll und effektiv, wenn man absolut ruhig bleibt und sich still verhält. Was sich leicht anhört, aber versuchen Sie es mal, wenn Sie ganz in Ihrer Nähe Gefahr wittern und Angst haben müssen, jemand könne gerade planen, Ihnen mittels körperlicher Gewalteinwirkung den Leib vom Verstand zu trennen. Wie auch immer, ich schaffte es, den Adrenalinschub zu unterbinden und halbwegs gleichmäßig zu atmen. Immer hübsch ruhig bleiben, Harry!, sagte ich mir.
Auf diese Weise kam ich in den Genuss eines optimalen Blicks auf ein gutes halbes Dutzend dunkler Gestalten, die mit einer lachhaften, fast schon spinnenartigen Anmut auf das Gebäude zuschossen, in dem Susan und Martin vor nicht allzu langer Zeit verschwunden waren. Die Gestalten näherten sich auf unterschiedlichen Wegen. Zwei von ihnen, dem äußeren Anschein nach vage menschenähnlich, aber mit den geschmeidigen, anmutigen Bewegungen von Raubkatzen, kamen über die Dächer. Drei weitere glitten unten am Boden von einem Schatten zum nächsten, und ich bekam von ihnen kaum mehr mit als ein Schimmern in der Luft und einen Schauder, der mir über den Rücken lief.
Die letzte Gestalt krabbelte wahrhaftig über die Fassaden der umliegenden Gebäude. Sie hüpfte von einem Haus zum anderen, klebte nach jedem Sprung wie eine riesige Spinne an der Wand und näherte sich auf diese Weise mit erschreckender Geschwindigkeit.
Eigentlich bekam ich die ganze Zeit über nicht viel mehr zu sehen als flackernde Schatten, die sich mit unheimlicher Zielstrebigkeit auf mein Bürohaus zubewegten. Aber was ich sah, reichte mir. Ich wusste, wen ich da vor mir hatte.
Vampire.
Vampire des Roten Hofes.
Sie stürzten sich auf das Haus wie Haie auf ein blutendes Stück Fleisch und verschwanden darin – in dem Haus, in dem sich mein gottverdammtes Büro befand –, und das Unwetter in meiner Brust kannte kein Halten mehr. Wie Kakerlaken kamen sie daher, die es ja auch immer schaffen, überall dort zu sein, wo sie nicht sein dürfen, an Stellen aufzutauchen, wo sie eigentlich doch gar nicht hingelangen können. Der Zorn fuhr mir aus der Brust bis hoch in die Augen, und in den umliegenden Fenstern färbten sich die Spiegelbilder der Straßenlaternen rot.
Ich ließ die Vampire das Haus betreten.
Dann sammelte ich meine Wut und meinen Schmerz, schärfte beides zu einer immateriellen Waffe und ging ihnen nach.
4. Kapitel
Mein Sprengstock, ein Eichenstab von ungefähr fünfundvierzig Zentimetern Länge und etwas dicker als mein Daumen, hing an seinem Gurt innen in meinem Mantel. Als ich ihn zog, fühlten sich die in das Holz geritzten Runen und Sigillen unter den Fingern meiner rechten Hand sehr vertraut an.
So leise es ging, näherte ich mich dem Haus und öffnete die Tür mit meinem Schlüssel. Den Schleier ließ ich erst fallen, als ich drinnen war. Jetzt half er mir nicht mehr viel, denn ein Vampir, der nahe genug an mich herankam, konnte mich riechen und meinen Herzschlag hören. Momentan wäre ein Schleier eher hinderlich gewesen, beeinträchtigte er doch mein Sehvermögen, und dem stand einiges an Strapazen bevor.
Den Fahrstuhl mochte ich nicht rufen, denn er schnaufte und ratterte so laut, dass jeder im Haus sofort mitbekommen hätte, wo ich mich befand. Ich sah mir die Infotafel unten in der Halle an. Sie klärte mich darüber auf, dass die Firma Datasafe Inc. im zehnten Stock residierte, fünf Stockwerke über meinem Büro also. Dort, also bei Datasafe, befanden sich wahrscheinlich gerade Martin und Susan, und dorthin waren bestimmt auch die Vampire unterwegs.
Da mir offenbar nur der Weg über die Treppe blieb, entschied ich mich für einen Zauber, um möglichst lange unerkannt zu bleiben. Für einen Magier meines Kalibers gehört es quasi zur Grundausrüstung, Geräusche dämpfen und dafür sorgen zu können, dass bestimmte Unterhaltungen absolute Privatsache bleiben. Meine Schritte und die Geräusche meines Atems so abzudämpfen, dass sie nur in meiner unmittelbaren Umgebung zu hören sind, ist nicht viel schwerer. Nur begab ich mich mit einem solchen Zauber in eine Art Geräuschblase, würde also auch selbst nicht hören können, was auf mich zukam. Derzeit wusste ich zwar, dass die Vampire im Haus waren, aber sie ahnten nichts von meiner Anwesenheit. Wenn es nach mir ging, sollte das auch erst einmal so bleiben, zumal es im Treppenhaus sehr eng war, und bis ich auf das Geräusch eines Vampirs reagieren konnte, den ich vorher nicht gesehen hatte, war ich so gut wie tot.
Also erklomm ich die Treppen, nachdem ich die Worte zu einem verlässlichen kleinen Stück Phonoturgie gemurmelt hatte, in perfekte Stille gehüllt. Was gut war, denn ich joggte zwar relativ regelmäßig, aber ein Dauerlauf auf dem Bürgersteig oder über einen Sandstrand lässt sich nicht mit endlosem Treppensteigen vergleichen, und als ich im zehnten Stock ankam, schnaufte ich schwer, meine Beinmuskeln standen in Flammen, meine Beine zitterten, und mein linkes Knie drohte mich umzubringen. Seit wann, bitte schön, machten mir eigentlich meine Knie Schwierigkeiten?
An der Tür, die zum Flur des zehnten Stocks führte, blieb ich stehen, öffnete sie unter dem Schutz meines Mantels aus Stille und ließ erst dann den Zauber fallen, damit ich hören konnte, was hier oben Sache war.
Als Erstes vernahm ich eine zischelnde Diskussion in einer mir unbekannten Sprache. Ich sah nicht, wer da sprach, aber weit entfernt konnten die Personen nicht sein. Wahrscheinlich standen sie gleich hinter der Ecke im Flur, die vor mir lag. Ich hielt die Luft an. Vampire verfügen zwar über übernatürliche Sinne, lassen sich aber wie Normalsterbliche auch ablenken. Wenn sie sprachen, hörten sie mich vielleicht nicht, und da sich in diesem Gebäude tagtäglich viele Menschen aufhielten, konnte es sogar angehen, dass sich mein Geruch einfach mit dem anderer Besucher vermischte und diese Killer ihn nicht gleich mitbekamen.
Denn Killer sind die Vampire des Roten Hofes ohne Ausnahme, einer wie der andere. Als Halbvampir vollzieht man die Entwicklung zum vollwertigen Mitglied des Roten Hofes erst, wenn man ein anderes menschliches Wesen getötet und sich von dessen Blut genährt hat. Zugegeben – die armen Seelen, die gegen ihren Willen mit dem Blutdurst des Roten Hofes infiziert werden, verspüren einen ihnen gänzlich unbekannten Hunger, dem man nur schwer widerstehen kann. Trotzdem wird man erst zum vollwertigen Mitglied, wenn man eigenhändig jemanden getötet hat.
Diese Vampire sind Monster, die Menschen in der Dunkelheit überfallen, die sie verschleppen und ihnen aus reinem Vergnügen Unsagbares antun. Ich weiß, wovon ich rede, mir haben sie es einst auch angetan. Ja, sie sind Monster, deren bloße Existenz für Millionen von Menschen eine Gefahr darstellt.
Monster, die mein Kind geraubt hatten, die meine Tochter in ihrer Gewalt hatten.
Der große Meister schrieb einst, man solle sich lieber nicht in die Angelegenheiten von Magiern mischen, denn diese seien schwierig und rasch erzürnt. Das hat Tolkien im Großen und Ganzen ganz richtig gesehen.
Ich trat vor, ließ die Tür zufallen und fauchte: »Ich scheiß auf schwierig!«
Das Gurgeln und Zischen hinter der Flurbiegung verstummte jäh. Was ich dann hörte, war ein Universallaut, der keiner Übersetzung bedurfte und sich ungefähr wie folgt zusammenfassen lässt: »Hä?«
Ich hob den Sprengstock, richtete ihn auf die Mauerecke vor mir und ließ meinen Zorn, meinen Willen und meine Kraft hineinfließen. »Fuego!«, stieß ich hervor.
Silberweiße Flammen ergossen sich aus dem Stab, schossen jaulend den Flur entlang, bissen sich in das Mauerwerk der nächsten Ecke und sprengten ein Loch hinein, so einfach, wie eine Kanonenkugel eine Pappwand zerfetzt hätte. Ich zog die Feuerlinie nach links, und ebenso schnell, wie sich meine Hand bewegte, brannten die Flammen eine faustgroße Öffnung durch mehrere Schichten Putz und Beton, bahnten sich einen Weg bis in den Flur, der im rechten Winkel zu dem verlief, in dem ich stand. Dorthin, wo ich die Vampire hatte sprechen hören. Der Krach war unbeschreiblich: Holz barst und explodierte, Gips löste sich in riesige Staubwolken auf, und Leitungen knackten, als mein Feuerstrahl sie so sauber durchtrennte, als würde ich mit einem Schneidbrenner arbeiten. Kabel explodierten in einem knisternden Funkenregen.
Etwas ganz und gar Unmenschliches mit übernatürlich kräftiger Lunge stieß einen schrillen, durchdringenden Schmerzensschrei aus. Er klang lauter als eine Gewehrsalve.
Ich schrie zurück, aus Trotz, vor Wut, als Herausforderung. Im Haus waren alle Lichter ausgegangen. Aber die Runen auf meinem Sprengstab glühten grell und weiß, erleuchteten mir mit ihrem silbrig weißen Licht den Weg durch den Flur, als ich losstürmte.
Als ich um die Ecke bog, traf ich als Erstes auf eine Gestalt, die sich rasend schnell auf mich zubewegte. Aber mein Schildarmband war bereit. Ich hob die linke Hand und krümmte die Finger zu einer Geste, die nichts mit Magie zu tun hatte, jedoch überall auf der Welt als beleidigend gilt. Sofort ergoss sich mein Wille in das mit zahlreichen Schildplättchen behängte Armband an meinem linken Handgelenk und breitete sich von dort aus, um vor mir als Viertelkuppel aus reiner, unsichtbarer Kraft Gestalt anzunehmen. Konzentrische Kreise aus blauem Licht und weißen Funken blühten auf, als der Vampir gegen den Schild stieß und abprallte.
Noch ehe der Vampir nach seinem Zusammenprall wieder gelandet war, ließ ich den Schild fallen, senkte mit einer knappen Drehung des rechten Handgelenks meinen Sprengstab und teilte das Monster mit einem Wort und einem Strahl aus silbernem Feuer in zwei Hälften. Beide Hälften schlugen und traten auf eine grauenhaft lächerliche Art um sich, während sie in verschiedene Richtungen davonflogen.
Mitten im Flur entdeckte ich einen weiteren zweigeteilten Vampir, den ich wahrscheinlich erwischt hatte, als ich blind auf die Wand gefeuert hatte. Auch er verabschiedete sich soeben auf eine nicht gerade geschmackvolle Art vom Leben. Sobald ich sicher sein konnte, dass sich im Flur keine weiteren unmittelbaren Gefahren befanden, richtete ich meinen Sprengstock auf einen Punkt über mir – manchmal hat es eben auch Vorteile, wenn man zu viele schlechte Horrorfilme gesehen hat. Mich haben sie gelehrt, was man beachten muss, um in Situationen wie dieser zu überleben.
Und tatsächlich, keine sechs Meter von mir entfernt klammerte sich ein Vampir an der Decke fest. Nun gibt es ja viele Menschen, die ganz genau zu wissen meinen, wie Vampire aussehen, dass sie perfekt und wunderschön sind, Göttinnen und Götter des abgründigen Sex und der Verführung. Zugegeben, Vampire des Roten Hofes können so aussehen, wenn sie sich die sogenannte Fleischmaske überstreifen, eine Art menschlicher Hülle. Diese Maske stellt in der Regel einen umwerfend schönen Menschen dar, aber darunter befindet sich etwas ganz anderes. Ein hässliches, abscheuliches Monster nämlich, das weder Reue empfindet noch je Buße tut. So ein Monster, ein Roter Vampir in seiner wahren Gestalt, starrte mich gerade von der Decke herab an.
Aufrecht stehend mochte er gut und gern einen Meter achtzig groß sein, wobei seine Arme so dünn und lang schienen, dass die Handrücken der klauenbewehrten Hände beim Gehen bestimmt über den Boden schleiften. Seine Haut wirkte elastisch und war schwarz, hier und dort mit ungesund wirkenden rosa Punkten gesprenkelt, der Bauch ein wabbeliger Wanst, wie man ihn sich grotesker kaum vorstellen kann. Das Monster hatte O-Beine und einen Buckel, und das Gesicht wirkte wie eine Kreuzung aus Vampirfledermaus und einer Halluzination von H. R. Giger.
Als der Vampir mich um die Ecke biegen sah, wurden seine großen, stieren Augen riesig. Er riss den Mund auf und stieß einen Schrei aus.
Einen Schreckensschrei.
Der Vampir schrie, weil er Angst vor mir hatte, und floh – just als mein Sprengstock den dritten Schlag freisetzte. Das Monster hüpfte wie wild den Flur entlang, von der Decke zu den Wänden und zum Boden und wieder zurück, und versuchte verzweifelt, dem tödlichen Energiestoß zu entgehen, den ich ihm nachsandte.
»So ist es recht!«, höhnte ich laut und erbost. »Renn, mein niedlicher Kleiner, sieh zu, dass du Land gewinnst!«
Das Monster verschwand um die nächste Ecke. Ich versetzte dem immer noch zuckenden Kopf eines der zweigeteilten Vampire einen boshaften Tritt mit der Stahlkappenspitze meiner Arbeitsstiefel und stürzte dem Flüchtenden nach, fluchend wie ein Bierkutscher.
Die ganze Angelegenheit hatte höchstens sechs bis sieben Sekunden gedauert.
Danach wurde es allerdings ein bisschen komplizierter.