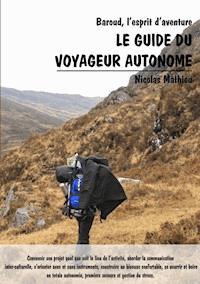Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Nach dem Bestseller „Rose Royal“ schreibt Goncourt-Preisträger Nicolas Mathieu über eine moderne Madame Bovary, die ihre Fesseln abstreift.
Hélène ist fast vierzig Jahre alt. Sie hat Karriere gemacht, geheiratet, zwei Töchter bekommen und lebt in einem Architektenhaus in der Nähe von Nancy. Sie hat sich den Traum ihrer Jugend erfüllt: abhauen, das Milieu wechseln, erfolgreich sein. Christophe hingegen hat die kleine Stadt im Osten Frankreichs, in dem er und Hélène aufgewachsen sind, nie verlassen. Er verkauft Hundefutter und führt ein unentschlossenes kleines Leben. Bis er Hélène wiedertrifft.
"Connemara" ist eine Geschichte über das tiefe Unbehagen der Klassenaufsteiger und über unsere moderne Arbeitswelt zwischen PowerPoint und Open Space. Es ist auch eine Geschichte über das Zittern in der Mitte des Lebens, und über die Sehnsucht, noch mal von vorne zu beginnen. Nur dass bei Nicolas Mathieu das Politische immer im Privaten verborgen liegt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Nach dem Bestseller »Rose Royal« schreibt Goncourt-Preisträger Nicolas Mathieu über eine moderne Madame Bovary, die ihre Fesseln abstreift.Hélène ist fast vierzig Jahre alt. Sie hat Karriere gemacht, geheiratet, zwei Töchter bekommen und lebt in einem Architektenhaus in der Nähe von Nancy. Sie hat sich den Traum ihrer Jugend erfüllt: abhauen, das Milieu wechseln, erfolgreich sein. Christophe hingegen hat die kleine Stadt im Osten Frankreichs, in dem er und Hélène aufgewachsen sind, nie verlassen. Er verkauft Hundefutter und führt ein unentschlossenes kleines Leben. Bis er Hélène wiedertrifft.»Connemara« ist eine Geschichte über das tiefe Unbehagen der Klassenaufsteiger und über unsere moderne Arbeitswelt zwischen PowerPoint und Open Space. Es ist auch eine Geschichte über das Zittern in der Mitte des Lebens, und über die Sehnsucht, noch mal von vorne zu beginnen. Nur dass bei Nicolas Mathieu das Politische immer im Privaten verborgen liegt.
Nicolas Mathieu
Connemara
Aus dem Französischen von Lena Müller und André Hansen
Roman
Hanser Berlin
Für Elsa
1
Die Wut kam gleich mit dem Aufwachen. Allein der Gedanke an die Verpflichtungen, die fehlende Zeit brachte sie in Rage.
Dabei war Hélène eine organisierte Frau. Sie erstellte Listen, plante die Wochen durch, hatte in ihrem Kopf, in ihrem ganzen Körper die Zeiten abgespeichert, die es brauchte, um Wäsche zu machen, die Kleine zu baden, Nudeln zu kochen, den Frühstückstisch zu decken, die Mädchen zur Schule zu bringen und sich die Haare zu waschen. Und was die Haare anging, hatte sie schon zigmal vorgehabt, sie abzuschneiden, um die zwei Stunden zu sparen, die ihre Pflege pro Woche beanspruchte, hatte sich aber ebenso oft dagegen entschieden, musste sie wirklich so weit gehen, selbst die Haare zu opfern, die sie seit ihrer Kindheit wie einen Schatz hegte?
Hélène war voller begrenzter Zeit, voller Alltagsstücke, die das Puzzle ihres Lebens bildeten. Manchmal dachte sie an ihre Jugend zurück, die erlaubte Faulheit mit fünfzehn, lange, träge Sonntage und später die Katerstimmung nach durchfeierten Nächten. Eine untergegangene Epoche, eine Ewigkeit, die im Nachhinein so kurz erschien. Damals schnauzte ihre Mutter sie an, weil sie stundenlang im Bett herumlag, statt draußen die Sonne zu genießen. Mittlerweile klingelte ihr Wecker wochentags um sechs, und auch am Wochenende wachte sie um sechs auf, wie ein Automat, eine präzise eingestellte Maschine.
Hélène kam es manchmal so vor, als hätte man ihr etwas genommen, als gehörte sie nicht mehr ganz sich selbst. Ihr Schlaf gehorchte äußeren Zwängen, ihr Rhythmus war der von Familie und Arbeit; ihr Takt folgte kollektiven Zielen. Ihre Mutter konnte zufrieden sein. Hélène sah nun den gesamten Lauf der Sonne, endlich nützlich, selbst Mutter, vollends eingespannt.
»Schläfst du?«, fragte sie leise.
Philippe lag auf dem Bauch, massig und nah, einen Arm unter dem Kopfkissen. Man hätte ihn für tot halten können. Hélène schaute auf die Uhr. 6:02 Uhr. Es ging los.
»Hey«, flüsterte sie lauter, »geh die Mädchen wecken. Beeil dich. Sonst sind wir wieder zu spät dran.«
Mit einem Seufzer drehte Philippe sich um, und der schwere, feuchtwarme, vertraute Geruch drang unter der Decke hervor, das Gewicht einer Nacht zu zweit. Hélène stand schon mit beiden Beinen in der beißenden Morgenkälte des Schlafzimmers und suchte ihre Brille auf dem Nachttisch.
»Verdammt, Philippe …«
Ihr Mann grummelte und wendete ihr den Rücken zu. Hélène war im Kopf schon bei den Pflichtübungen des Tages.
Sie duschte, ohne den Kiefer zu entspannen, und checkte auf dem Weg in die Küche ihre Mails. Schminken würde sie sich später im Auto. Die Mädchen brachten sie jeden Morgen ins Schwitzen, da wartete sie mit dem Make-up lieber, bis sie in der Schule waren.
Mit der Brille auf der Nasenspitze machte sie die Milch warm und schüttete Frühstücksflocken in die Schalen der Kinder. Im Radio redeten schon wieder die beiden Journalisten, deren Namen sie sich nicht merken konnte. Sie hatte noch Zeit. Die Morgensendung von France Inter lieferte ihr jeden Tag dieselben einfachen Orientierungspunkte. Jetzt lag die nächtliche Stille noch über dem Haus, und die Küche war eine Insel, auf der Hélène einen seltenen einsamen Moment genießen konnte, eine Urlauberin vor einer Tasse Kaffee. Es war 6:20 Uhr, und sie brauchte eine Zigarette.
Sie legte sich ihre Strickjacke um die Schultern und trat auf den Balkon. Dann lehnte sie rauchend an der Brüstung und sah auf die Stadt hinunter, sah das erste rote und gelbe Aufflackern des Verkehrs, den Lichtschein vereinzelter Straßenlaternen. Ein Müllauto arbeitete sich schnaufend und blinkend durch eine Nebenstraße. In einiger Entfernung stand zu ihrer Linken ein Hochhaus mit seinen hellen Rechtecken, in denen hin und wieder ein vager Umriss auftauchte. Da drüben eine Kirche. Rechts daneben der geometrische Block der Krankenhäuser. Das Zentrum von Nancy mit seinen gepflasterten Gassen, seinen reizvollen Boutiquen war fern. Die Stadt streckte sich und erwachte zu neuem Leben. Für einen Oktobermorgen war es nicht sehr kalt. Der Tabak knisterte geräuschvoll, Hélène warf einen kurzen Blick über die Schulter und schaute dann auf ihr Telefon. Ein Lächeln huschte über ihr vom Bildschirm erleuchtetes Gesicht.
Sie hatte eine neue Nachricht.
Einfache Worte, die sagten, ich kann es kaum erwarten, ich freue mich schon. Ihr Herz machte einen Satz, sie zog ein letztes Mal an ihrer Zigarette und fröstelte. Es war 6:25 Uhr, sie musste sich noch anziehen, die Mädchen zur Schule bringen und lügen.
»Hast du an alles gedacht?«
»Ja.«
»Mouche, hast du die Schwimmsachen eingepackt?«
»Nein.«
»Die darfst du nicht vergessen.«
»Ich weiß.«
»Das habe ich dir gestern gesagt, hast du nicht zugehört?«
»Doch.«
»Und warum hast du sie nicht eingepackt?«
»Das war keine Absicht.«
»Du musst aber mit Absicht daran denken.«
»Man kann nicht alles können«, erwiderte Mouche und machte mit ihrem Nesquik-Bart eine gelehrte Miene.
Die Kleine war gerade sechs geworden und wurde schneller groß, als man gucken konnte. Clara hatte auch so eine plötzliche Wachstumsphase gehabt, aber Hélène wusste schon nicht mehr, wie es sich anfühlte, wenn auf einen Schlag Leute aus ihnen wurden. Also erlebte sie den Moment noch einmal neu, in dem ein Kind die Benommenheit der ersten Jahre ablegt, die Verhaltensweisen eines gierigen Tierchens hinter sich lässt und plötzlich nachdenkt, Witze reißt und Sprüche macht, die die Stimmung bei Tisch verändern und die Erwachsenen sprachlos zurücklassen.
»Gut, ich muss los. Tschüs zusammen.«
Philippe war in der Küche aufgetaucht und richtete sich das Hemd auf eine Art, die ihr sehr vertraut war, indem er eine Hand in den Hosenbund schob und es vom Bauch bis zum Rücken glattzog.
»Willst du nicht frühstücken?«
»Ich esse im Büro.«
Flüchtig küsste der Vater seine Töchter und dann Hélène.
»Heute holst du die Mädchen ab, denkst du daran?«, sagte sie.
»Heute?«
Philippe hatte nicht mehr so viele Haare wie früher, aber er war nicht übel, herb duftend, robust und gut gebaut, in den Augen immer noch dieses Leuchten, der kleine Schlaumeier aus der Classe Prépa, der sich kein Bein ausreißt, der Schummler, der weiß, wo es langgeht. Es war nervtötend.
»Darüber reden wir seit einer Woche.«
»Kann aber sein, dass ich noch Arbeit mit nach Hause bringe.«
»Dann rufst du eben Claire an.«
»Hast du ihre Nummer?«
Hélène gab ihm die Nummer der Babysitterin und drängte ihn, sie rasch anzurufen, damit sie Bescheid wusste.
»Okay, okay«, sagte Philippe, während er die Nummer in seinem Handy speicherte. »Wird es spät bei dir?«
»Wahrscheinlich nicht«, antwortete Hélène.
Hitze stieg ihr in die Wangen, und sie hatte das Gefühl, dass ihre Bluse zwei Nummern kleiner wurde.
»Ist trotzdem ungünstig.« Philippe scrollte mit dem Daumen durch seine Mails.
»Es ist ja nicht so, dass ich ständig unterwegs wäre. Ich darf dich daran erinnern, dass du gestern erst um neun zu Hause warst und vorgestern auch.«
»Arbeit, Arbeit, Arbeit. Was soll ich sagen?«
»Und bei mir ist es ein Ehrenamt, oder was?«
Philippe schaute auf und zeigte sein seltsam horizontales Lächeln, die schmalen Lippen, den leichten Spott in seinen Augen.
Seit sie wieder in der Provinz lebten, schien Philippe zu denken, dass er das Seine getan hätte. Schließlich hatte er ihretwegen einen vielversprechenden Posten bei AXA, seine Badmintonfreunde und überhaupt eine Reihe Perspektiven aufgegeben, die mit den hiesigen nicht zu vergleichen waren. Und das bloß, weil seine Frau nicht klargekommen war. Ging es ihr jetzt etwa besser? Dieser erzwungene Umzug stand zwischen ihnen wie eine Schuld. Das war jedenfalls Hélènes Eindruck.
»Na dann bis heute Abend«, sagte er.
»Bis heute Abend.«
Hélène wandte sich an die Mädchen:
»Hopp, hopp, jetzt, Zähne putzen, anziehen, und los geht’s. Ich muss noch meine Kontaktlinsen einsetzen. Und ich sage es nicht zweimal.«
»Mama …«, traute sich Mouche.
Aber Hélène hatte schon den Raum verlassen, hastig, langbeinig, die Haare zusammengebunden, und schaute in ihre WhatsApp, während sie nach oben ging. Manuel hatte ihr noch eine Nachricht geschrieben, bis heute Abend, stand da, und sie verspürte wieder dieses angenehme Ziehen, diese Angst in der Brust, es war fast wie mit fünfzehn.
Eine halbe Stunde später waren die Mädchen in der Schule und Hélène schon fast im Büro. Mechanisch ging sie die anstehenden Termine durch. Um 10 Uhr hatte sie ein Meeting mit den Vinci-Leuten. Um 14 Uhr musste sie die Dame vom Zementwerk Porette in Dieuze zurückrufen. Dort zeichnete sich eine Entlassungswelle ab, und sie hatte eine Idee zur Umstrukturierung der Zentralen Services, mit der fünf Kündigungen vermieden werden könnten. Ihren Kalkulationen zufolge ließen sich durch ein paar Änderungen an der Organisationsstruktur sowie durch die Optimierung der Einkaufsabteilung und des Fuhrparks fast eine halbe Million Euro pro Jahr einsparen. Erwann, ihr Chef, hatte gesagt, keine Patzer, das ist extrem wichtig für uns, da können wir uns keine Patzer erlauben. Und dann um 16 Uhr ihre Präsentation im Rathaus. Vorher musste sie die Folien noch ein letztes Mal durchschauen. Lison bitten, die Unterlagen für alle Teilnehmer auszudrucken, beidseitig natürlich, damit ihr nicht irgendein kleinlicher Öko aufs Dach stieg. An das personalisierte Deckblatt denken. Sie kannte doch die Funktionsträger und Verwaltungsdirektoren, die Cliquen der Wichtigen und Nervösen, die über die städtischen Angestellten wachten. Diese Typen waren überglücklich, wenn man ihren Namen auf eine Mappe oder die erste Seite eines offiziellen Dokuments druckte. In einem bestimmten Stadium ihrer festgefahrenen Karrieren ging es nur noch darum, sich von den kleinen Angestellten zu unterscheiden und von den Kollegen abzuheben.
Und dann noch ihr Date am Abend …
Von Nancy nach Épinal brauchte man mit dem Auto mindestens eine Stunde. Sie würde vorher nicht mehr zu Hause vorbeifahren und duschen können. Aber es war ohnehin ausgeschlossen, gleich beim ersten Treffen im Bett zu landen. Wieder einmal dachte sie darüber nach, einfach abzusagen, es war keine besonders gute Idee. Aber da war schon Lison, sie lehnte an einer Mauer auf dem Parkplatz und zog gierig an ihrer E-Zigarette, ihr komisches Gesicht war hinter einer Apfel-Zimt-Qualmwolke verborgen.
»Und? Bereit?«
»Geht so … Du musst die Unterlagen für die Stadtverwaltung ausdrucken. Das Meeting ist um 16 Uhr.«
»Ist längst erledigt.«
»Beidseitig?«
»Natürlich, halten Sie mich für eine Klimaleugnerin, oder was?«
Die beiden Frauen eilten zu den Aufzügen. Auf der Fahrt in die Elexia-Büros wich Hélène dem Blick ihrer Praktikantin aus. Dabei verzichtete Lison heute auf ihren schläfrigen Ausdruck und strahlte, als hätte sie selbst ein Date am Abend. Die Tür öffnete sich in der dritten Etage, und Hélène ging vorneweg.
»Komm«, sagte sie und durchquerte den Raum mit dem beachtlichen Open Space der Consultingfirma, vorbei an der Büroinsel, dem schmalen roten Teppich, der die Ströme lenkte, und den vielen Grünpflanzen, die im Licht der Deckenfenster gediehen. Rote Sessel und graue Sofas luden hier und da zu einer geselligen Pause ein. In einer kleinen Einbauküche am Ende des Raums konnte mitgebrachtes Essen aufgewärmt und über vergammelte Lebensmittel im Kühlschrank gestritten werden. Die einzigen geschlossenen Räume befanden sich auf einer Empore, ein Meetingroom, der von allen der Cube genannt wurde, und das Chefbüro. Hélène und Lison schlossen sich in den Cube ein, um sich vor neugierigen Ohren zu schützen.
»Ich habe Mist gebaut«, sagte Hélène.
»Quatsch. Das wird super.«
»Den ganzen Tag hänge ich wie die letzte Idiotin am Handy. Ich habe Arbeit. Ich habe Kinder. Das kann nur schiefgehen. Ich kann mir das nicht erlauben. Besser lasse ich es ganz.«
»Warte!«
Manchmal duzte Lison ihre Chefin aus Versehen. Hélène ließ sich nichts anmerken. Sie sah dieser seltsamen jungen Frau alles nach. Sie war wirklich speziell mit ihren Converse, ihren Secondhandmänteln und dem Pferdegesicht, den langen Zähnen und den weit auseinanderstehenden Augen, die ihrer Schönheit keinen Abbruch taten. Sie hatte das Leben ihrer Vorgesetzten auf den Kopf gestellt. Bevor Lison aufgetaucht war, hatte Hélène sich lange Zeit wie am Rand eines Abgrunds gefühlt.
Und das, obwohl sie alles hatte, zumindest auf dem Papier, das Architektenhaus, den Job mit Personalverantwortung, eine Familie wie aus der Elle, einen passablen Lebensgefährten, einen begehbaren Kleiderschrank und sogar eine gute Gesundheit. Blieb nur dieses schwer zu fassende Etwas, das sie fertigmachte, ein ständiges Zuviel und Zuwenig. Diese Zerrissenheit, die sie unbewusst in sich trug.
Das erste Mal war ihr Leiden vor vier Jahren aufgetreten, als sie noch in Paris gelebt hatten. Eines Tages schloss sich Hélène während der Arbeit in der Toilette ein, weil sie die Mailflut in ihrem Posteingang nicht mehr ertragen konnte. Diese Art des Rückzugs wurde zur Gewohnheit. Sie versteckte sich, um einem Meeting, einem Kollegen aus dem Weg zu gehen oder nicht mehr ans Telefon zu müssen. Und so konnte sie Stunden auf dem Klo verbringen und ihren Score bei Candy Crush in die Höhe treiben, sie war wie gelähmt und spielte mit Suizidgedanken. Nach und nach waren ihr selbst die banalsten Dinge unerträglich geworden. Sie brach in Tränen aus, wenn sie den Wochenplan der Kantine studierte, weil es zum Mittag wieder Karottensalat und Kroketten gab. Sogar die Zigarettenpausen nahmen tragische Züge an. Was die Arbeit an sich betraf, sah sie einfach keinen Sinn mehr darin. Wofür sollten diese ganzen Excel-Tabellen, diese endlosen Meetings und dieser Sprech gut sein? Wenn jemand die Wörter »Workflow«, »Kick-off« oder »committen« benutzte, verspürte sie einen Ekel. Schließlich war sie nicht einmal mehr in der Lage, den Einschaltton ihres MacBook Pro zu hören, ohne loszuheulen.
Sie büßte ihren gesunden Schlaf, viele Haare und einige Kilo ein und bekam Ekzeme in den Kniekehlen. Einmal fiel sie im öffentlichen Nahverkehr in Ohnmacht, als sie den blassen Schädel eines Fahrgasts betrachtete, den eine dünne Haarsträhne spärlich bedeckte. Sie fühlte sich überall fremd. Sie wollte nirgends mehr sein. Eine große Leere machte sich in ihr breit.
Der Arzt diagnostizierte Burn-out, war sich aber nicht ganz sicher, und Philippe musste wohl oder übel dem Wegzug aus Paris zustimmen. Wenigstens bot die Provinz ein paar Vorteile, eine bessere Lebensqualität, sie konnten sich ein großes Haus mit weitläufigem Garten leisten, und nicht zuletzt schien es in dieser einladenden Gegend denkbar, einen Kitaplatz zu bekommen, ohne mit einem Verwaltungsangestellten ins Bett steigen zu müssen. Außerdem lebten Hélènes Eltern in der Nähe, die hin und wieder aushelfen konnten.
In Nancy hatte Hélène über einen Freund von Philippe Arbeit gefunden, Erwann, Geschäftsführer von Elexia, einer Firma, die Consulting und Audits verkaufte und Empfehlungen im Bereich Human Resources aussprach, es war immer dasselbe. Und für ein paar Wochen hatten der neue Rahmen und der veränderte Rhythmus genügt, um Hélènes Stimmungsschwankungen auf Distanz zu halten. Nicht für lange. Bald hatte sie sich, ohne völlig am Boden zu sein, wieder frustriert, unwohl, erschöpft, grundlos traurig und vor allem wütend gefühlt.
Philippe wusste nicht, wie er mit dieser Laune umgehen sollte. Ein- oder zweimal hatten sie versucht, darüber zu reden, aber Hélène kam es so vor, als würde Philippe ihr etwas vorspielen, wenn er sie betroffen ansah und in regelmäßigen Abständen nickte, genau dieselbe Show wie in den Videokonferenzen mit seinen Kollegen. Letztlich machte Philippe es mit ihr wie mit allem: Er managte.
Zum Glück hatte sie eines Tages im Nebel der Erschöpfung einen kuriosen Lebenslauf zugeschickt bekommen, eine Bewerbung für ein Praktikum. Normalerweise kamen solche Anfragen nicht bis zu ihr durch, oder sie löschte die Mails sofort. Aber diese hatte ihr Interesse geweckt, weil sie fast lächerlich einfach war, ohne Foto, ohne den üblichen Quatsch, Skills, Soft Skills, abenteuerliche Hobbys, Führerscheine und Co. Es war ein einfaches Word-Dokument, bloß ein Name, Lison Lagasse, eine Adresse, eine Telefonnummer, ein Vermerk über einen Master in BWL und eine Liste bunt zusammengewürfelter Berufserfahrungen. Léon de Bruxelles, Deloitte, Darty, Barclays und sogar ein schottischer Fischereibetrieb. Statt die Bewerbung an die Personalabteilung weiterzureichen, wie es der Recruiting Process vorsah, rief Hélène die Bewerberin aus Neugier an. Weil die junge Frau eine Erinnerung in ihr weckte. Sie war sofort ans Telefon gegangen, eine helle, klare Stimme, immer wieder unterbrochen von kurzen Lachern, wie Satzzeichen. Lison antwortete auf ihre Fragen mit yo, definitiv nicht, klaro und war vergnügt, verschwörerisch und wenig darum bemüht zu gefallen. Hélène hatte sie trotzdem eingeladen, nach 19 Uhr, wenn der Open Space so gut wie leer war, als dürfte es niemand erfahren. Die junge Frau war pünktlich gewesen, aufgeweckt, groß und schlaksig, mit engen Jeans, Fransenmokassins und dem obligatorischen Pony, dazu dieses längliche Gesicht, in dem auffällige, fast immer sichtbare Pferdezähne blitzten.
»Sie haben einen seltsamen Werdegang. Wie kommt man von Deloitte zu Darty?«
»Sie liegen beide an der Linie 1.«
Hélène lächelte. Eine Pariserin … Von dieser Art Frauen hatte sie sich jahrelang eingeschüchtert gefühlt, von ihrer besonderen, avancierten Eleganz, ihrer Fähigkeit, sich überall zu Hause zu fühlen, ihrer natürlichen Grazilität und ihrer gebieterischen, kompromisslosen Art; jede ihrer Bewegungen schien zu sagen: Das Beste, was dir passieren kann, ist, wie ich zu sein, Kleine. Es war seltsam, hier in Nancy einer von ihnen gegenüberzusitzen, während es draußen dämmerte. Hélène fühlte sich, als hätte sie eine Postkarte von einem Ort erhalten, an dem sie in der Vergangenheit nicht ganz ungetrübte Ferien verbracht hatte.
»Und was machen Sie hier?«
»Ach«, hatte Lison mit einer ausweichenden Handbewegung geantwortet. »Ich bin von der Kunsthochschule geflogen, und meine Mutter hat hier einen Mann gefunden.«
»Und wie finden Sie sich zurecht?«
»So mittel.«
Hélène hatte Lison sofort eingestellt und ihr die Verantwortung für die Reporting-Tools gegeben, die sie verwenden sollten, seit Erwann der Verschwendung ein Ende bereiten und die Prozesse verschlanken wollte, was darauf hinauslief, jeden zurückgelegten Kilometer zu rechtfertigen, selbst die geringsten Aufgaben in gigantische Tabellen einzutragen, in endlosen Drop-down-Menüs die kryptische Betitelung vormals belangloser Tätigkeiten aufzuspüren und jeden Tag eine Stunde damit zu vergeuden, die acht anderen zu erfassen.
Allen Erwartungen zum Trotz hatte sich Lison gut geschlagen. Schon eine Woche später kannte sie alle Angestellten und auch alle Bürogeheimnisse. Für sie war es bloß ein Spiel, wie eine Seifenblase schwebte sie durch den Open Space, effizient und gleichgültig, irritierend und überwiegend beliebt, unstressbar, als wäre ihr alles egal, den Erwartungen gewachsen, eine Art Mary Poppins des Dienstleistungssektors. Auf Hélène, die immerzu kämpfte und eine Beförderung zur Partnerin neben Erwann anstrebte, wirkte diese Leichtigkeit wie Science-Fiction.
Eines Abends, als sie im Pub nebenan ein Bier tranken, wollte sie wissen: »Und, gefällt dir jemand im Büro?«
»Nie auf der Arbeit. Das ist Sünde.«
»Auf der Arbeit lernen sich die meisten Paare kennen.«
»Ich vermisch das nicht gerne. Das ist mir zu stressig, vor allem im Open Space. Die Typen umkreisen dich den ganzen Tag wie die Geier. Und dann tratschen sie immer alles rum, die Idioten, aber sie können nichts dafür, das liegt in ihrer Natur.«
Hélène kicherte.
»Was machst du dann? Gehst du aus, tanzen?«
»Bloß nicht! Die Discos hier sind die Hölle. Ich mach’s wie alle: Ich jage im Internet.«
Hélène lächelte angestrengt. Gerade einmal eine Generation trennte sie von Lison, und schon verstand sie nichts mehr von den gängigen Liebesgebräuchen. Dating-Praktiken, Beziehungsdauer, Freundschaft Plus, serielle Monogamie, polyamoröse Verbindungen, Probezeiten, Schnupperpraktika für die Liebe: Beim Zuhören erfuhr sie von den neuen Regeln des Fickens und Fühlens.
Vor allem verwendete man jetzt Messagingdienste und Social Media. Als Hélène ihrer Praktikantin sagte, dass sie erst auf dem Lycée vom Internet erfahren hatte, sah Lison sie mit schmerzerfülltem Erstaunen an. Sie wusste, dass es auch vor dem Web eine Zivilisation gegeben hatte, aber sie verortete jene Zeit eher in sepiafarbenen Jahrzehnten, zwischen Hitler-Stalin-Pakt und Mondlandung.
»Doch, doch.« Hélène seufzte. »Meine Noten beim Baccalauréat habe ich noch auf dem 3615 EducNat oder einem ähnlichen Gerät bekommen.«
»Echt?«
Lisons Generation hingegen war quasi von Anfang an online gewesen. Auf dem Computer, den ihr die Eltern für eine erfolgreiche Schullaufbahn gekauft hatten, flirtete sie schon als Jugendliche abendelang mit Unbekannten, irgendwelchen Altersgenossen oder fünfzigjährigen Einhandtippern, mit Männern aus Singapur oder ihrem Nachbarn, neben dem sie im Bus kein Wort herausgebracht hätte. Später führte sie, just for fun, auf dem Smartphone lange Chatbeziehungen mit einer Reihe Jungs, die sie nur flüchtig kannte. Dafür freundete sie sich auf Facebook oder Insta mit einem Mitschüler ihrer Wahl an, hallo, hallo, der Rest kam von allein. In Höchstgeschwindigkeit schossen die Gespräche durch die digitale Nacht, Entfernungen schrumpften, Warten war unerträglich, Schlaf überflüssig, Exklusivität undenkbar. Sie und ihre Freundinnen hatten immer drei oder vier Chats gleichzeitig am Laufen. Erst waren sie harmlos, scherzhaft, wurden dann aber schnell intim. Man erzählte sich von seinem Weltschmerz, den nervigen Eltern, der blöden Schlampe Léa und dem Physik-Chemie-Lehrer, diesem perversen Narzissten. Nach 23 Uhr, wenn die Familie im Bett war, gingen die Peer-to-Peer-Geschäfte im Geheimen weiter. Dann kam man richtig in Schwung. Begehren äußerte sich in wenigen Worten, abgekürzt, kodifiziert, schwer zu entschlüsseln. Schließlich schickte man sich Fotos in Unterwäsche, Erektionen, andeutungsreiche, supergeheime Aufnahmen von unten.
»Besonders krass waren Pics vom eigenen Arsch, auf denen du sonst nicht zu erkennen warst. Man weiß ja nie.«
»Hattest du keine Angst, dass der Typ das an seine Kumpels weiterschickt?«
»Doch, klar. Das Risiko geht man ein.«
Diese Bilder, im Bett aufgenommene Dämmerlicht-Selfies, eine mehr oder weniger gekonnte Erotik, wurden wie eine Schmuggelwährung gehandelt, ohne Wissen der Eltern, Schwarzgeld auf einem libidinösen, lichtscheuen Markt. Denn manchmal passierte es, ein schlüpfriges Bild kam an die Öffentlichkeit, und eine fast nackte Minderjährige ging viral.
»In der zehnten Klasse musste eine Freundin von mir die Schule wechseln.«
»Furchtbar.«
»Ja. Aber es geht noch schlimmer.«
Hélène genoss diese Anekdoten, die den leicht pappigen Nachgeschmack von Chips hatten, von denen man nie genug bekam. Sie machte sich Sorgen um ihre Töchter und fragte sich, wie sie mit diesen neuartigen Bedrohungen umgehen würden. Doch tief in ihrem Bauch wurde es bei diesen Geschichten ganz warm. Sie war neidisch auf das Begehren, das nicht ihr galt. Sie fühlte sich herabgesetzt, weil sie nicht teilhaben konnte. Sie erinnerte sich an die Begierde, die früher ihre ständige Begleiterin gewesen war. Ihrem Therapeuten hatte sie gesagt: »Ich habe das Gefühl, ich bin schon alt. Das liegt alles hinter mir.«
»Wie fühlen Sie sich dabei?«, fragte der Therapeut wenig überraschend.
»Wütend. Traurig.«
Der Idiot machte darüber nicht einmal eine Notiz in seinem Moleskine.
Die Zeit war so schnell vergangen. Vom Bac bis zum vierzigsten Geburtstag war Hélènes Leben ein Schnellzug, der sie eines schönen Tages auf einem Bahnsteig rauswarf, von dem nie die Rede gewesen war, mit einem veränderten Körper, Tränensäcken unter den Augen, weniger Haaren und mehr Arsch, Kindern am Rockzipfel, einem Kerl, der behauptete, dass er sie liebte, und sich jedes Mal drückte, wenn es darum ging, die Wäsche zu machen oder sich beim Schulstreik um die Kinder zu kümmern. Auf diesem Bahnsteig drehten sich die Männer nicht mehr oft nach ihr um. Diese Blicke, über die sie sich früher beschwert hatte und die sicher nicht ihren Wert bestimmten, fehlten ihr dennoch. Mit einem Fingerschnippen war alles anders.
An einem Freitagabend im Galway rückte Hélène mit der Sprache raus.
»Deine ganzen Typen, das deprimiert mich.«
»Ich habe auch nichts gegen Frauen«, antwortete Lison mit heiterer und selbstzufriedener Miene. »Aber ich flirte meist nur. So viel Sex habe ich gar nicht.«
»Ich meine, es zieht mich runter, dass meine Zeit vorbei ist.«
»Sind Sie verrückt? Sie haben voll Potential. Auf Tinder würden die sich um Sie prügeln.«
»Ach, hör auf. Das ist doch Unsinn.«
Aber Lison blieb hartnäckig: Die Welt war voller Ausgehungerter, die sich ins Verderben gestürzt hätten, um eine Frau wie Hélène ins Bett zu kriegen.
»Das ist schmeichelhaft.« Hélène senkte den Blick.
Natürlich hatte sie von solchen Apps gehört. Auf Tech-Websites, mit denen sie sich auf dem Laufenden hielt, herrschte einhellige Verzückung über die neuen Entwicklungen: Diese Programme machten sich Millionen von Singles untertan, kaperten Dates, definierten mit ihren Algorithmen Wahlverwandtschaften und Verwirrungen der Herzen, und eigneten sich ganz nebenbei, durch Unmittelbarkeit und spielerische Oberflächen, die sexuellen Miseren und die gelegentliche Liebe auf den ersten Blick an.
Sogleich richtete Lison ihr ein Spaßprofil ein, mit Fotos aus dem Netz, zwei von hinten und ein drittes verschwommen. Was die Kurzvorstellung anging, setzte sie auf Minimalismus und ein Fünkchen Provokation: Hélène, 39. Trau dich, wenn du ein Mann bist. Das war kein Hexenwerk.
»Dann ploppt ein Typ auf, sein Gesicht, zwei, drei Fotos. Du kannst nach rechts swipen, dann hat er die Hürde genommen. Nach links, und du hörst nichts mehr von ihm.«
»Und er macht dasselbe mit meinen Fotos?«
»Genau. Wenn ihr euch gefallt, gibt es ein Match, und ihr könnt chatten.«
Am Tresen inspizierten Hélène und ihre Praktikantin, was die Region an verfügbaren Männern und unverbesserlichen Fremdgehern zu bieten hatte. Die Auswahl war eher grotesk, und schöne Männer waren Mangelware. In der Gegend fand man Möchtegernbonzen, die mit nacktem Oberkörper vor ihrem Audi posierten, Junggesellen mit randlosen Brillen, Geschiedene im Fußballtrikot, pomadisierte Immobilienmakler oder unbeholfen wirkende Feuerwehrmänner. Erbarmungslos ließ Lison mit ihrem Finger diesen illustren Haufen nach links zur Hölle fahren, fischte nur ausnahmsweise einen Typen heraus, der vage Ähnlichkeiten mit Jason Statham hatte, oder scherzeshalber einen absoluten Assi. Es kam jedes Mal zu einem Match, denn Frauen waren oft wählerisch, während Männer mit dem Treibnetz fischten, um die magere Ausbeute später ohne größere Ansprüche genauer in Augenschein zu nehmen. Jedes Mal ließ Lison einen spitzen Kommentar fallen, und Hélène, die immer betrunkener wurde, lachte.
»Warte, der ist noch nicht mal volljährig.«
»Bist du eine Wahlkabine, oder was?«
»Und der da, guck dir mal den Haarschnitt an!«
»In New York trägt man das vielleicht gerade so.«
Lison war in den tonangebenden Städten New York und London auf Tinder aktiv gewesen und hatte Geschichten von wundersamen Fängen auf Lager. Denn an diesen kostspieligen Orten befand man sich im Dauerwettbewerb und musste unentwegt arbeiten, um nicht unterzugehen, dabei blieb keine Zeit für Dinge wie Einkaufen oder Flirten. Also nutzte man Onlinedienste für Bett und Kühlschrank. Ein Match, ein kurzer Chat gegen Mittag, ein überteuerter Cocktail um sieben, und schon entkleidete man sich in einer winzigen Wohnung, um rasch zu vögeln, in Gedanken schon bei den dringenden Mails im Posteingang. So war das Leben dort, spitz wie ein Dolch, schnell und verletzend, tränen- und faltenfrei, in den sozialen Netzwerken zur Schau gestellt, die unheilvolle Illusion einer ewigen Gegenwart.
Zwischen Laxou und Vandœuvre war es natürlich nicht dasselbe.
»Zeigst du auch dein Gesicht?«, fragte Hélène. »Stört dich das nicht, dass man dich wiedererkennen könnte?«
»Das machen alle so. Wenn sich alle schämen, gibt es keine Scham mehr.«
Eine SMS von Philippe unterbrach sie und verdarb die Stimmung. Die Mädels sind im Bett. Soll ich auf dich warten? Hélène zahlte, brachte Lison nach Hause und deinstallierte die App, bevor sie das Haus betrat.
Am nächsten Tag lud sie sie wieder herunter.
In kürzester Zeit verstand sie, wie es lief, weitete ihre Jagdgründe auf einen Umkreis von achtzig Kilometern aus und versah ihr Profil mit echten Fotos, auf denen man sie aber nicht erkennen konnte. Ihre langen Beine waren zu sehen, ihr verführerischer Mund, den sie manchmal frühmorgens beim Aufstehen, oder wenn sie sich ärgerte, zu einer Schnute zog. Auf einem anderen Bild, auf dem sie am Rand eines Schwimmbeckens saß, waren ihre Hüften zu erkennen, ihr beachtlicher, aber straffer Hintern, ihre gebräunte Haut. Sie überlegte, ob sie ihre honigfarbenen Augen zeigen sollte, die im Sommer ins Mandelgrüne gingen, ließ es dann aber bleiben. Es ging hier nicht um Romantik.
Und schon flirtete sie den ganzen Tag, mit jedem Match wuchs ihr Selbstbewusstsein, jedes Kompliment hob sie auf ein höheres Podest. Doch das anonyme Begehren linderte ihre Wut nicht. Das Gefühl von Vergeblichkeit und die Bedenken blieben. Immerhin erhielt sie jetzt kleine halbautomatische Wiedergutmachungen, die Befriedigung, dass sie die Qual der Wahl hatte. Irgendwo gab es Unbekannte, die sie wollten, und die interessierte Freundlichkeit brachte Farbe in ihr Leben. Sie hatte das Gefühl, wieder lebendig zu sein, und vergaß darüber alles andere. Auch wenn sie manchmal bei einem äußerst höflichen, aber wirklich hässlichen Typen Skrupel bekam.
Nach einer Weile hatte ein Mann endgültig ihre Aufmerksamkeit geweckt. Auch er war gesichtslos, versteckte sich allerdings hinter einer Pandamaske. Und sein Profil unterschied sich von den üblichen Werbeanzeigen. Manuel, 32. Suche schöne und intelligente Frau, die mich zur Hochzeit meiner Ex begleitet. Pluspunkte, wenn du konservativ bist und das gleiche Parfüm wie meine Mutter trägst.
Amüsiert fragte Hélène, welches Parfüm seine Mutter trage.
»Nina Ricci«, antwortete er.
»Das kriegen wir hin.«
Seitdem chatteten sie regelmäßig. Erst war Hélène distanziert und halb sarkastisch. Dann fuhr Philippe auf Fortbildung nach Paris, und sie war drei Nächte allein. Die Witzeleien waren Ernsthaftigkeiten gewichen, dann folgten Andeutungen. Im dunklen Zimmer war Hélène nur mehr ein blau erleuchtetes Gesicht, und die Stunden zogen lautlos dahin. Sie hatte Hitzewallungen, schlaflose Nächte, brennende Augen und wand sich im Laken ihrer endlosen Chats. Am Morgen sah sie furchterregend aus, und als Erstes checkte sie ihre Nachrichten. Zwei neue Wörter reichten, um sie glücklich zu machen. Eine Stunde Funkstille, und sie malte sich tragische Szenarien aus. Sie landete nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen. Schließlich ließ sie sich auf ein Date ein.
Doch als es fast so weit war, bekam Hélène Zweifel. Im Cube auf der Empore fühlte sie Panik aufsteigen, eine zukünftige Reue. Lison blieb zuversichtlich.
»Alles wird gut. Sie sind es nur nicht mehr gewohnt.«
»Nein, ich sag ab. Das ist nichts für mich.«
»Wegen Ihrem Kerl?«
Hélène sah aus dem Fenster. Draußen drückte ein schwerer Himmel auf die Stadt und ihren Wust zusammengewürfelter Gebäude. Auf gegenläufigen Bahnschienen kreuzten TGVs zwischen graffitibesprühten Wänden halbleere TERs. Erwann hatte Büroräume gewollt, die über der Stadt lagen. Man musste die Dinge von oben betrachten, global denken.
»Das ist es nicht«, log Hélène. »Es ist einfach nicht der richtige Tag. Da ist dieser Termin im Rathaus. Darauf arbeite ich seit drei Monaten hin.«
»Im schlimmsten Fall können Sie Ihr Date kurzfristig absagen. Der weiß ja nicht mal, wo Sie wohnen oder so.«
Hélène musterte Lison. Diese junge Frau, der alle Möglichkeiten offenstanden … Sie wollte ihr wehtun, sich für die Zeit rächen, die Lison noch vor sich hatte.
»Nerv mich nicht mit der Geschichte, ich bin keine fünfzehn mehr.«
Lison hatte verstanden und ging. Hélène betrachtete ihr Spiegelbild in der Glasscheibe. Sie trug einen neuen Rock von Isabel Marant, eine schöne Bluse, ihre Lederjacke und hochhackige Schuhe. Sie hatte sich hübsch gemacht für Manuel, für die Trottel vom Rathaus. Sie bemerkte, wie klein ihr Haarknoten war. Sie ärgerte sich plötzlich. Hatte sie ihr ganzes Leben lang etwa dafür gekämpft?
In diesem Moment musste natürlich Erwann im Cube aufkreuzen, das Tablet in der Hand, schlecht rasiert, rothaarig, den Senatorenbauch im feinen Stoff eines blauen Twillhemdes.
»Hast du die Mail von Carole gesehen? Die nehmen uns nicht für voll. Hab ich gleich mal an den Anwalt weitergeleitet, ich kenne da nichts mehr. Sonst alles klar wegen Fusion-Meeting morgen?«
»Ja, habe ich gestern angenommen.«
»Cool, hab ich nicht gesehen. Und das Rathaus? Das läuft?«
»Ja, heute um vier.«
»Cool. Ist da alles klar?«
»Alles klar.«
»Das darf jetzt nicht schiefgehen. Wenn wir da einen Fuß in die Tür kriegen, können wir uns vor Kohle nicht retten. Ich war mit der Verwaltungsdirektorin essen. Die wollen alles umkrempeln. Wenn wir uns gut anstellen, schmeißen die uns die Aufträge hinterher.«
»Wir stellen uns gut an, keine Sorge.«
Für einen Augenblick gab Erwann die übersteigerte Ichbezogenheit auf, die sein Markenzeichen war, und richtete seine kleinen goldenen Augen auf sie. An der ESSEC Business School hatte er mit Philippe die Fachschaft geleitet. Zwanzig Jahre später prahlten sie immer noch damit, dass sie den Schatzmeister ausgetrickst hatten, um ein Wochenende in Val Thorens zu verbringen. Erwann wusste also, wo Hélène herkam, auf welcher Schule sie gewesen war, wusste von ihrem Durchhänger in Paris, von den Töchtern, die sie an spätabendlicher Arbeit hinderten, von ihren vergangenen Erfolgen, ihrem Scheitern, vielleicht sogar von noch intimeren Dingen.
»Ich vertraue dir«, sagte er.
»Wir müssen noch reden.«
»Worüber?«
Er wusste genau, was sie meinte. Hélène riss sich zusammen und ignorierte seine Nummer vom ahnungslosen Touristen.
»Du erinnerst dich. Meine Weiterentwicklung in der Firma …«
»Ach ja, ja, ja. Das müssen wir klären. Das ist ganz, ganz wichtig.«
Hélène bekam Mordfantasien. Sie nervte ihn schon seit Monaten, um von ihrer Stelle als Senior Manager (was in einem so kleinen Unternehmen so gut wie nichts bedeutete) zur Partnerin aufzusteigen, und obwohl Erwann grundsätzlich einverstanden war, geschah faktisch nichts.
»Okay«, sagte sie. »Ich habe diesen Monat mehr Tage fakturiert, als es Werktage gibt. Ich arbeite wie eine Verrückte und weiß, dass du an ein großes Unternehmen verkaufen willst. Ich warne dich, als das fünfte Rad am Wagen in einer Zweigstelle von McKinsey mach ich nicht mit.«
»Absolut!«, sagte Erwann mit seinem wankelmütigen Enthusiasmus. »Du kennst meine Meinung dazu. Talente binden hat Priorität. Kein Stress also.«
Hélène dachte, wenn er sie verarschte, wollte sie ihn Blut spucken sehen. Die Art Gedanken, die Genugtuung verschafften und zu nichts verpflichteten, zumal sie sie nicht aussprach. Mit dieser Gewaltfantasie kehrte sie in den Open Space zurück, wo die anderen Consultants saßen, jeder in seiner Ecke, ein Headset auf dem Kopf, die Augen auf den Bildschirm gerichtet. Die verdienten zwischen vierzig- und neunzigtausend Euro pro Jahr und hatten nicht mal ein eigenes Büro. Sie musste unbedingt raus aus diesem Sumpf der Stromlinienförmigen. Immer schon ging es nur um eins. Erfolg.
Das Meeting sollte im Untergeschoss des Rathauses stattfinden, in einem fensterlosen, neonbeleuchteten Raum mit Whiteboard und U-förmig aufgestellten Furniertischen. Hélène war die Erste, testete die Funktionsfähigkeit des Beamers, schloss ihren Computer an, klickte sich zur Sicherheit durch ein paar Slides, lehnte sich dann mit übergeschlagenen Beinen zurück und tippte reflexartig auf ihrem Handy. Manuel hatte drei neue Nachrichten geschickt, in denen ungefähr dasselbe stand. Ich kann’s kaum erwarten. Ich denke die ganze Zeit an dich. Wenn doch schon Abend wäre! Das war süß, aber redundant. Hoffentlich steigerte er sich nicht in etwas hinein. Sie wollte antworten, um seinen Feuereifer zu zügeln, zögerte dann aber. Sie wusste nicht recht, was sie ihm schreiben sollte. In dem Moment betraten zwei Männer den Raum, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Sofort erhob sich Hélène mit einem strahlenden Lächeln. Den ersten kannte sie flüchtig, ein junger, schon glatzköpfiger Typ, der Church’s und eine taillierte Jacke trug. Aurélien Leclerc. Er nannte sich stellvertretender PR-Manager. Dabei war er bösen Zungen zufolge lediglich der persönliche Assistent eines Referatsleiters für Öffentlichkeitsarbeit. Jedenfalls hatte er eine Grande École besucht. Für gewöhnlich dauerte es keine fünf Minuten, bis er darauf zu sprechen kam.
Der zweite, ein langer Mittfünfziger mit Spiegelglatze, weißes Hemd und Pulli mit Rundausschnitt, Freundschaftsbändchen und skeptischer Blick, streckte ihr zackig die Hand hin.
»David Schneider. Ich bin der Systemadministrator.«
»Ah!«, sagte Hélène erfreut.
Leclerc ergriff das Wort, um sachdienliche Erläuterungen loszuwerden. Das Meeting würde in kleinem Kreis stattfinden. Monsieur Politi, der das Referat Kommunikation und EDV leitete, ließ sich entschuldigen. Er hatte einen wichtigen Termin im Beisein des Präfekten. Man würde auch ohne ihn klarkommen.
Hélène lächelte wieder. Natürlich verstand sie. Immerhin hatte sie nur hundertfünfzig Stunden gebraucht, um sich einen Überblick über das schreckliche Durcheinander der IT-Dienste dieser Stadt zu verschaffen, ein Gewirr wie aus einem russischen Roman, wo in den unglaublichen Verästelungen von gleich drei übereinanderliegenden Organisationsstrukturen Geld und Energie verpulvert wurden. Während sie ihr Audit erstellte, konnte sie kaum glauben, dass dieser Turm zu Babel überhaupt noch stand. Aus allgegenwärtiger Trägheit, unklaren Hierarchien und uralten Feindschaften zwischen verschiedenen Verwaltungsfürstentümern war ein digitales Tschernobyl erwachsen. Wenn man sich vor Augen führte, dass die Stadtbevölkerung ihre Kreditkartendaten diesem quasi sowjetischen System anvertraute, um das Schulessen ihrer Kinder oder die Gebühr für ihre Aufenthaltserlaubnis zu bezahlen, konnte man nachdenklich werden.
»Wir kommen auch ohne ihn klar«, bekräftigte Schneider furchtloser denn je. »Keine Sorge.«
»Wir stehen ja ohnehin noch ganz am Anfang«, fügte Leclerc hinzu. »Wir können uns ja auf ein paar Milestones verständigen, die dann vom Direktor abgesegnet werden. So machen wir es meistens mit externen Dienstleistern.«
»Natürlich, aber eigentlich hatten wir mit Monsieur Politi etwas anderes vereinbart. Wir sind in der Planung schon ziemlich fortgeschritten.«
»Es ist, wie es ist«, beendete Schneider die Diskussion.
Hélène betrachtete die beiden, den blasierten Assistenten, den selbstbewussten Informatiker. Sie kannte sie zur Genüge, Typen wie sie, die in Meetings den Gockel spielten und ansonsten achtlos Beamten ohne Karriereaussichten managten, die kommunale Kohle für Horden von beflissenen Dienstleistern ausgaben und den ganzen Tag herumschwafelten.
»Gut«, sagte sie, »dann ist es eben so.«
Sie eröffnete ihren Vortrag klassisch mit den Stärken und Schwächen der Organisation und ging dann näher auf die Risiken ein (vier von ihnen würden empfindliche Auswirkungen auf das gesamte System haben) und endete mit den Chancen, was nicht länger als eine Minute in Anspruch nahm. Sie sprach ruhig, spielte mit dem Presenter und trat hin und wieder direkt an die Leinwand, um auf ein Detail aufmerksam zu machen. Ihr Vortrag war gespickt mit statistischen Daten, die nicht in der Präsentation aufgeführt waren und die sie auswendig gelernt hatte, eine Methode, die meist eine gewisse Wirkung entfaltete. Dann sprach sie über Best-Practice-Beispiele, ein paar Benchmarks hier, einige Brocken Organisationssoziologie da. Nach einer kurzen Konzentrationsphase schweiften Leclerc und Schneider ab und widmeten sich ihren Mails und Textnachrichten. Kurz schien es Hélène, als schaute Leclerc YouTube-Videos. Bevor sie zu ihren Empfehlungen überging, ließ sie absichtlich den Presenter auf den Boden fallen. Beim Aufprall öffnete sich das Batteriefach mit einem blechernen Scheppern. Die beiden Männer schreckten hoch. Leclerc wurde sogar rot.
»Was soll das?«, fragte Schneider.
»Wir sind ganz Ohr«, sagte Leclerc versöhnlich.
Hélène stand sehr gerade, in einigen Metern Abstand, den Kiefer angespannt. Innerlich wog sie die Vor- und Nachteile von Unterwerfung und Konfrontation gegeneinander ab. Sie dachte an den Umsatz von Elexia und an die guten Beziehungen, die diese beiden Wichtigtuer zu einer sicher nicht kleinen Anzahl von ihresgleichen in den verschiedenen Institutionen der Gegend unterhielten, in Gemeinderäten, Gesundheitsämtern, Rektoraten und anderen Verbandsgemeinden.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie, »das Ding ist mir aus der Hand gerutscht.«
Sie reparierte den Presenter und beendete ihren Vortrag in einer Atmosphäre gegenseitigen Misstrauens. Leclerc verließ noch vor ihren Schlussworten mit dem Hinweis auf eine dringende Verpflichtung den Raum. Schneider beglückwünschte sie zu ihrer Arbeit. Allerdings konnte er sich ihren Schlussfolgerungen nicht anschließen, in seinen Augen handelte es sich um Panikmache.
»Letztes Jahr hatten wir schon mal ein Audit. Die Empfehlungen waren sehr viel gemäßigter. In komplexen Systemen wie dem unseren muss es um schrittweise Verbesserungen gehen. Man kann nicht von einem Tag auf den anderen alles über den Haufen werfen.«
»Selbstverständlich«, sagte Hélène.
Das besagte Audit war intern durchgeführt worden und erinnerte in seiner Gefälligkeit und seinen spitzfindigen Ausweichmanövern an die Arbeit der Aufsichtsbehörde der Polizei, natürlich hatte sie den Bericht gelesen. Nichts als heiße Luft.
»Ich danke Ihnen«, sagte Schneider. »Ich schaue mir das mit meinen Teams an. Das ist gute Arbeit. Vor allem die Analyse des Ist-Zustands. Was die strategischen Empfehlungen angeht, können wir noch etwas nachbessern.«
»Natürlich«, sagte Hélène.
Als Schneider verkündete, dass es ein weiteres Meeting bräuchte, aber keinen neuen Termin vorschlug, wusste sie, dass die Sache gelaufen war.
Eilig verließ sie das Rathaus, lief über das neue Pflaster, den Kopf wie eine Salatschleuder. Während sie die Treppe zum Parkplatz nahm, schaute sie auf die Uhr. Es war zu spät, um noch ins Büro zu fahren. Sie dachte an die Mädchen, die Babysitterin und Philippe, sie musste Erwann anrufen, ihm die Situation erklären. Eigentlich war es schon vor dem Meeting klar gewesen. Schneider hatte sie außer Gefecht gesetzt, und dabei war dieser Saustall allein ihm zuzuschreiben. Seit Jahren spielte er sich in Meetings und Konferenzschaltungen auf, unfähig, seine Truppen anzuleiten, ein manipulativer Micromanager, der seine Vorgesetzten mit technischem Vokabular verwirrte und seine Untergebenen mit vagen Weisungen überhäufte, die ins Leere liefen und niemals umgesetzt wurden. Sicher hatte er die Sache bei einem Mittagessen mit Politi oder der Generaldirektorin der Verwaltung geregelt, hatte zwischen Wolfsbarschfilet und Frucht-Carpaccio höfliche Zweifel am Bericht von Elexia angemeldet und an der richtigen Stelle das Wort »politisch« fallengelassen, das in diesem Milieu erstaunliche Untätigkeit und jede noch so irrationale Pirouette rechtfertigte und allen guten Willen innerhalb von Sekunden ausbremste. Sogleich hatte es ausgesehen, als wäre seine Schaumfabrik das Resultat eines subtilen und notwendigen Ausbalancierens und würde bei der kleinsten Veränderung in sich zusammenfallen, was zunächst bei den Angestellten, dann in den Abläufen und schließlich bei den Nutzern zu Durcheinander und Ärger führen würde, und das könne niemand wollen, vor allem nicht jetzt, da die Presse die unrechtmäßige Förderung einiger konfessionell gebundener Vereine aufgedeckt hatte, denen eine brachliegende Kleingartensparte in der Nähe von Laxou zugesprochen worden war. Führungskräfte wie Schneider zeichneten sich dadurch aus, das von ihnen verantwortete Chaos mit für die Allgemeinheit unverständlichen Ausführungen zu kaschieren, ihre Irrtümer als Notwendigkeiten und ihre Feigheit als Diplomatie zu verkaufen. Kurz, er hatte Hélène verarscht.
Einzelne Tropfen sprenkelten den Asphalt. Hélène legte einen Schritt zu, ihr Rock und die Absätze störten, die Tasche schnitt in die Schulter, der Regenmantel rutschte vom Arm, sofort war sie schweißgebadet. Aber sie schaffte es nicht bis zum Auto. Der Schauer entlud sich über der Stadt, und sie rannte durch die plötzlich menschenleeren Straßen, schwankend, das Handy in der Hand, den Kopf gesenkt. Um sie herum war nichts als der glänzende Boden, die Heftigkeit des Regens auf den Motorhauben und Fassaden, der gesunde Geruch sauber gewaschener Luft und über ihr ein verhangener Himmel.
In ihrem Volvo angekommen, konnte sie nur noch ihren Schiffbruch begutachten. Die langen Haare hingen ihr wie die Fransen eines Wischmopps ins Gesicht, oder wie verkochte Nudeln. Ihre Klamotten waren tropfnass und lagen zu eng an. Bei jeder Bewegung spürte sie die Reibung und das Leder des Sitzes, das an ihren Schenkeln klebte. Sie nahm Taschentücher aus dem Handschuhfach und versuchte, die größten Schäden zu beseitigen. Während sie sich abmühte, beschlugen die Scheiben, und schon bald bestand die Außenwelt nur noch aus schemenhaften Umrissen. Sie war allein mit ihrer Verzweiflung und dem Rauschen des Regens. Sie konnte es nicht mehr richten. Sie begutachtete ihr ruiniertes Make-up im Rückspiegel.
»Scheiße«, presste sie heiser hervor.
Als sie versuchte, ihre Kleidung in Ordnung zu bringen, zog sie zu fest an ihrer Bluse, und zwei Knöpfe kullerten zwischen die Sitze. Eine Seidenbluse mit Blumenmuster für zweihundert Euro, der Stoff war gerissen, sie konnte sie in den Müll schmeißen. Plötzlich hatte sie Lust, alles kurz und klein zu schlagen, und packte das Lenkrad mit beiden Händen, die Lippen zusammengepresst. Der Regen trommelte weiter, ein lautes, penetrantes, gleichmäßiges Hämmern. Die Stadt ringsum war nur noch eine Abstufung unterschiedlicher Grün- und Grautöne. Sie war allein.
Sie schob ihren Rock die feuchten Schenkel hoch. Sie atmete schnell, fast schluchzend, mit nassem Rücken und heißem Nacken. Als sie die Beine spreizte, fand ihre Hand sofort die Falte ihres Geschlechts unter dem Stoff des Slips. Sie machte schnell, zwei Finger, den Hintern fest auf dem Ledersitz, eine präzise Bewegung an der Wölbung, drehend und drückend, mit sturer Entschlossenheit. Ihre Möse wurde durchlässig, und bald spürte sie dieses köstliche Prickeln im Inneren, das wie eine Blase, eine lauwarme Möglichkeit in ihrem Bauch aufstieg. Sie brauchte nur eine Minute, unbeirrbar wie ein Kind. Diese Bewegung kannte sie seit Ewigkeiten, sie hatte sie im Laufe des Lebens immer weiter verfeinert. Sie war ihr Hafen, ihr Recht. Natürlich mochte sie den Sex mit Männern. Ihre schweren Körper, ihre Behaarung, ihren opulenten Geruch. Wie sie einen umdrehten und mit ihren Armen umschlossen, sodass man sich ganz klein fühlte und unter ihrem Gewicht fast platzte vor Glück. Sie mochte das, und sogar die Enttäuschungen hatten meist noch etwas Aufregendes. Aber diese eine Sache, intim, zart und ohne Scham, den Gebrauch ihres Geschlechts, den direkten Zugang zu ihrer Lust gab sie niemals auf. Sie befriedigte sich oft, auch wenn sie verliebt war oder schwanger oder glücklich, unter der Dusche, morgens, auf der Arbeit, manchmal im Flugzeug und in ihrem Auto, wann immer sie wollte. Hin und wieder überkam die Lust sie so stark und plötzlich, dass sie versucht war, auf dem Seitenstreifen anzuhalten.
Im feuchtwarmen Auto beeilte sie sich, schloss zwischendurch die Augen, lauschte auf Passanten hinter den beschlagenen Scheiben, dachte an etwas Schönes und kam heftig, eine klare, genau zu ortende Lust, die sich ohne Umwege entlud und sie fast ruhig, etwas weniger konfus zurückließ.
Wenigstens wäre sie jetzt bei ihrem Date entspannt. Sie ordnete ihre Sachen, ließ den Motor an und fuhr los. Ihr war alles egal.
2
Cornécourt machte nicht viel her. Eine verschlafene Kleinstadt, Kirche, Friedhof, Siebziger-Jahre-Rathaus, ein Gewerbegebiet, das einen Puffer zum angrenzenden Ballungsraum bildete, Einfamilienhaussiedlungen, die im Umland aus dem Boden schossen, und mittendrin ein Platz mit den üblichen Läden: Wettbüro, Bäckerei, Metzgerei, eine Immobilienagentur mit zwei Männern in Kurzarmhemden.
Die Geburtenrate in Cornécourt war niedrig, die Bevölkerung alterte, doch der kommunale Haushalt blieb ungetrübt, vor allem wegen der üppigen Steuern, die eine norwegische Papierfabrik unaussprechlichen Namens entrichtete. Trotz dieses Wohlstands nahm der Front National in den ersten Wahlgängen stets die Spitzenposition ein, und die Einwohner beklagten sich über die Respektlosigkeit einer gewissen Klientel. Ein beschädigter Rückspiegel gab Anlass zu strafbaren Äußerungen, nächtliche Schmierereien auf dem Kulturzentrum konnten Fantasien von Strafexpeditionen wachrufen. Am Tresen des Narval, Eckbistro und Tabakladen, war Gewalt mithin nicht selten, wenn auch nur verbal. Man trank eine Orangina, ein kleines Stella oder, wenn die Tage wieder schöner wurden, einen Rosé mit Eiswürfeln auf der Terrasse. Man interessierte sich für Rubbellose und sprach über Politik, Dreierwetten und Migration. Um fünf kamen Maler in weißen Overalls, dauergestresste Unternehmer, türkische Maurer, die ihr Leben lang noch keine Lohnabrechnung gesehen hatten, junge Leute von der benachbarten Berufsschule, die die Mühen des Tages bei einem Gläschen vergessen wollten. Frauen waren rar und fast immer in Begleitung. Neben der Laufkundschaft zierten die Bar ein paar tropische Pflanzen und respekteinflößende Säufer. Fotos von Lino Ventura oder Jacques Brel hingen an den Wänden und standen für die Philosophie des Lokals.
Cornécourt verdankte seinen Namen den kleinen Seen im Norden der Stadt, die wie Münzen in der Gegend verstreut lagen und über mehrere Kilometer eine Landschaft aus Seerosen und Schilf bildeten. Die stehenden Gewässer unter dem niedrigen Himmel hatten etwas Quecksilbriges, auf dem sich Wolken, Zugvögel und Langstreckenflugzeuge spiegelten. Angler geisterten hier fast immer herum, schräge Ruten verwiesen schon von weitem auf ihre unscheinbare Präsenz. Im Frühling wimmelte es von Kids auf Mountainbikes und gut gelaunten Familien. Es war der Ort der Wahl für die erste Zigarette, heimliche Zungenküsse, jugendliche Besäufnisse am Lagerfeuer oder bloß zum Gassigehen.
Fünfzehntausend Menschen lebten in dieser mittelgroßen Stadt inmitten von Überbleibseln der Natur, einigen dahinsiechenden Höfen, schmucklosen Kreisverkehren, einem Fußballstadion, einem in die Jahre gekommenen Ärztehaus und dem Kanal, der die Stadt in zwei Hälften teilte. In diesem Kaff konnten drei Generationen derselben Familie in Rufweite leben. Die Nächte waren zwar ruhig, aber die Polizei trug kugelsichere Westen. Der Nikolausumzug und das Johannisfeuer bildeten die Höhepunkte des ereignisarmen Jahres. In der Weihnachtszeit verlieh Leuchtschmuck den Straßen eine prachtvolle, vergnügliche Stimmung. Im Sommer lösten Hitzewellen Panik in den Altenheimen aus. Alle kannten sich vom Sehen. Der Bürgermeister war parteilos.
Mit ebendiesem war Christophe Marchal verabredet. Jeden Monat lieferte er ihm die gleiche Menge Hundenahrung, Trockenfutter, mindestens drei Säcke. Den Bürgermeister kannte er schon von klein auf, und der Alte duzte ihn wie alle Kinder, die hier geboren und aufgewachsen waren. Christophe wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, das Du zu erwidern. Er parkte in einigem Sicherheitsabstand zum Range Rover des alten Müller, aus einer Art Respekt. Der Alte kam schon aus dem Haus, in Gummistiefeln, eine Kappe mit Werbelogo auf dem Kopf.
»Ah, da bist du ja!«, rief er, hob die Kopfbedeckung und kratzte sich.
Christophe lächelte zur Antwort. Die Männer gaben sich die Hand, während der Bürgermeister ihn von Kopf bis Fuß musterte.
»Willst du noch auf eine Hochzeit?«
Christophe trug ein weißes Hemd und neue Schuhe, wodurch er tatsächlich etwas Feierliches an sich hatte. Der alte Müller nahm an, dass dieser Aufzug für ein Rendezvous gedacht war, und sagte, dass er es richtig mache, man müsse das Leben genießen. Jedes Wort aus seinem Mund war in den dicken Akzent des Hochlands gehüllt, Bussang, Le Tholy, La Bresse, wo Kälte herrschte, Wiesen blühten und Vokale sich in die Länge zogen, doch man durfte seinem bäuerlichen Äußeren nicht trauen. Der Mann war reich, schlau und gefürchtet. In seinen fünf Amtszeiten hatte er mehr als einen Überflieger in Weston-Schuhen in die Schranken verwiesen. Christophe hörte ihm zu, immer noch lächelnd. Dann öffnete er den Kofferraum seines Peugeot 308 Kombi.
»Ich habe Ihnen diesen Monat einen vierten Sack mitgebracht.«
»Ach ja?«
»Geht aufs Haus.«
»Gut. Ich helfe dir mal. Lass uns das gleich zum Zwinger bringen.«
Während der alte Müller hinterm Haus eine Schubkarre suchte, ließ Christophe den Blick umherschweifen. Neben dem Haupthaus stand ein nahezu identisches zweites Gebäude, nur in klein, in dem Freunde, oft andere Jäger, übernachten konnten. Weiter hinten war der Zwinger mit seinen verputzten Mauern zu sehen, und ganz am Ende, zweihundert Meter weiter, der dunkle Waldrand, der das Grundstück begrenzte. Als der alte Müller zurückkam, luden die Männer das Futter in die Schubkarre.
»Und das Geschäft läuft?«
»Wir können nicht klagen.«
»Und wie steht’s mit dem Eishockey?«
»Wird langsam wieder.«
»Was für ein Saustall … Da gehe ich zurzeit nicht mehr hin. Solche Geschichten finde ich abartig.«
»Ja, schade.«
»Du sagst es. Die Guten sind alle weg. Wenn das so weitergeht, fragen die am Ende noch dich.«
»Gut möglich«, sagte Christophe.
Der Bürgermeister lachte, und sie setzten sich in Bewegung, Christophe hinter der Schubkarre, der alte Müller neben ihm mit seinem charakteristischen hüpfenden Gang.
Seit über fünfzig Jahren ging es mit dem Eishockeyteam der Nachbarstadt drunter und drüber. In jeder seiner wechselhaften Spielzeiten zog der Club aus Épinal, ob er das Schlusslicht der Amateurliga war oder in der Ligue Élite konkurrierte, die Aufmerksamkeit auf sich, vollbrachte seltene Heldentaten und scheiterte oft brutal, entmutigte aber mit seinen Höhen und Tiefen nie den harten Kern seiner Fans. In der Saison war die Eishalle bei jedem Spiel voll. Dort mischten sich die Stadtoberen mit den einfachen Leuten, Jugendliche aus den schicken Vierteln gingen mit zahnlosen Säufern auf Tuchfühlung, die am Imbiss literweise Picon-Bier süffelten, ganz zu schweigen von den Unternehmern in ihren Privattribünen und den Ultras, die sich in den Farben des Teams schminkten und seit drei Uhr anstanden, um sich die besten Plätze zu sichern. Die Halle war wie die Gebärmutter dieser Stadt, sie brachte eine sonst unmögliche Einigkeit zur Welt, in der Kälte, beim spröden Klang von Eisen auf Eis. Zweitausend Blicke richteten sich auf den einen schwarzen Punkt, der mit hundertfünfzig Stundenkilometern übers Feld flitzte. Ein ganzes Volk versammelte sich für zwei Stunden um das eiförmige Weiß, in der Hoffnung auf Tore, Tempo und Gewalt. Alle Herzen schlugen in einem Takt.
»Die haben dich wirklich gefragt, zurückzukommen?«, fragte der alte Müller.
»Ist im Gespräch.«
»Und meinst du, das geht noch in deinem Alter?«
»Vielleicht.«
Vor zwei Jahren musste der Club aus finanziellen Gründen absteigen, wegen einiger allzu ambitionierter Spielerkäufe, die ihn an die Tabellenspitze geführt, aber auch hoffnungslos verschuldet hatten. Ein Insolvenzverfahren später hatten sich die teuer erstandenen Tschechen, Slowaken und Kanadier in Luft aufgelöst. Das Reserveteam versuchte seither, in den unteren Gefilden der Division 2 das Schiff flott zu halten. Christophe dachte, warum nicht ich. Seiner aktiven Zeit verdankte er die besten Jahre seines Lebens.
»Könnte schwer werden für dich«, sagte der Bürgermeister von Cornécourt. »Deine Stärke war eher die Schnelligkeit.«
»Das lässt sich ausgleichen. Erfahrung zählt auch.«
»Und die Wampe?«
Der alte Müller warf ihm einen grausamen, boshaften Blick zu. Christophe hatte in letzter Zeit ordentlich zugelegt. Das Leben als Vertreter eignete sich nicht, um die Figur zu halten, mit dem ständigen Auswärtsessen, den acht Stunden pro Tag im Auto. Die großen Hände des Vierzigjährigen packten die Schubkarrengriffe etwas fester, er brachte noch immer ein Lächeln zustande.
»So ein Team braucht immer auch ein paar Kräftigere.«
Dabei musste der alte Mann an einen gemeinsamen Ausflug denken, ein Trainingslager in Kanada mit den Jungs aus dem Eishockeyteam und ihren Eltern.
»Erinnerst du dich an die Riesen da?«, fragte der alte Müller mit Bewunderung in der Stimme.
Natürlich erinnerte sich Christophe. Dort hatte jedes Team extra Schlägertypen aufgestellt, die die weniger starken, eher technischen Spieler schützten. Verteidigung war ein harter Job. Für eine ganze Reihe von Männern aus den schäbigsten Nestern war die Rolle als Enforcer der einzige Weg zum Profiniveau. Er sah den einen noch vor sich, der stammte aus dem hintersten Winkel von Ontario, ein Witz von einem Kaff, zweitausend Seelen und drei Eishallen. Mit fünfundzwanzig hatte er keinen echten Schneidezahn mehr und eine Metallschiene unter dem rechten Wangenknochen. Vor jedem Spiel kniete er in einer stillen Ecke der Umkleide zum Gebet. Doch wenn es darum ging, sich zu prügeln, zögerte er nicht, suchte die Konfrontation und drosch heftig zu. In Amerika gab es Enforcer, die waren richtige Legenden. Einschüchterung gehörte dort zum Spiel, und es war nicht zu leugnen, dass ein guter Teil des Publikums nur kam, um sich abzureagieren, um das Gefühl zu bekommen, dass es im Spiel eine Minute lang wirklich um Leben und Tod ging.
»Du hattest es jedenfalls nicht so mit Gewalt«, sagte der alte Müller. »Mit vierzig lernt man das nicht mehr …«
»Kommt drauf an.«
Jetzt lächelte er nicht mehr, aber der alte Mann lachte, ganz der joviale Grundbesitzer, der sich seiner Sache seit locker fünfzig Jahren sicher war.
Im Zwinger wurden sie von einem Gebell begrüßt, dem der alte Müller mit einem lauten Pfiff Einhalt gebot. Die Tiere beruhigten sich sofort, und es war nur noch das Geräusch der Pfoten auf dem kalten Beton zu hören, das Klirren der Ketten, das Hin und Her des feuchten, tierischen Atems. Es waren an die zwanzig Laufhunde, jeder in seinem Bereich, weiße Fliesen an den Wänden, vergitterte Fenster oben, alles ganz sauber, obwohl einem der Gestank zu Kopf stieg. Die Männer gingen nach hinten, wo der hermetisch abgeschlossene Behälter mit der zwischengelagerten Nahrung stand. Sie teilten sich die Arbeit und mussten dafür kein Wort wechseln, der alte Müller öffnete jeden Sack mit einem Cutter, während Christophe das Trockenfutter in den Trog schüttete. Als sie fertig waren, klopfte Christophe den Staub von seiner Kleidung, holte die Rechnungen und eine Quittung aus der Tasche.
»Ich bräuchte noch ein Autogramm …«
Der alte Müller überflog die Papiere und bat Christophe wie beiläufig, sich vorzubeugen. Der glaubte erst, das sei ein Scherz, aber der Alte meinte es ernst. Christophe lehnte sich also vor, die Hände auf den Knien, und wartete, bis der Bürgermeister die Unterlagen auf seinem Rücken unterzeichnet hatte. Er endete mit zwei Punkten, die ins Rückgrat stachen. Die ganze Zeit saß ein Hund neben ihm melancholisch auf seinem Hinterteil und starrte ihn mit seinen schönen feuchten Augen an.
Trotz der erniedrigenden Prozedur konnte sich Christophe noch zu ein paar freundlichen Worten durchringen. Den Tieren sei anzusehen, dass es ihnen an nichts fehle. Das sei nicht überall so.
»Ich kümmere mich eben, was soll ich sagen?«
Der alte Müller, der doch recht geschmeichelt war, hob noch einmal seine Kappe, um sich am Schädel zu kratzen, und verkündete dann: »Na komm, ich zeig dir mal was Schönes.«
Die beiden traten aus dem Schuppen und gingen auf den Wald zu. Bald konnte Christophe in der Ferne zwei Miniaturchalets erkennen, die von einem Drahtzaun umgeben waren.
»Ist das neu?«
»Ich habe mir was gegönnt.« Der Bürgermeister klopfte ihm auf die Schulter.
Sie schritten auf der Wiese voran, unter einem schiefergrauen Himmel, in dessen trägen, langen Wolken die Möglichkeit eines Schauers heranreifte. Ringsum erstreckte sich das Land, hinten das graue Band der Bäume, in der Luft der wilde Geruch der Hunde, vermischt mit dem lebendigeren Duft von Humus und Weite. Ihre Schritte raschelten angenehm im hohen Gras, fast so beruhigend wie ein Wiegenlied.
»Du wirst schon sehen«, sagte der alte Müller und öffnete den Zaun.
Die kleinen Chalets waren in Wirklichkeit nichts anderes als bessere Hundehütten, vor denen Näpfe mit Wasser und Trockenfutter standen. Sie hockten sich hin, und als sich ihre Augen ans Halbdunkel gewöhnt hatten, erkannte Christophe zwei weiche Formen, wunderschöne Welpen, die auf karierten Decken schliefen.
»Was sind das für welche?«
»Tibetdoggen.«
»Echt?«
»Ja klar, geh ruhig näher ran.«
Kniend streichelten die beiden Männer die schweren Kreaturen. Ihr Fell war unglaublich weich, und darunter war ihr schneller, eigensinniger Herzschlag zu spüren. Prachtvolle Tiere.
»Wo haben Sie die gefunden? Die sieht man hier nicht oft.«
»Ich habe da jemanden in Spanien.«
»Wie viel?«
»Zweitausend pro Exemplar. Plus Transport. Der Vater war ein Preisträger.«
Christophe stieß einen Pfiff aus. Seit einiger Zeit war diese Spezies in Mode, und beim Wiederverkauf konnte man, wenn ein guter Stammbaum vorlag, schwindelerregende Summen erwarten. Ein Tier hatte irgendwo in China sogar für über eine Million Euro den Besitzer gewechselt. Christophe schaute auf die Uhr.
»Ich kann einen für dich reservieren«, sagte der alte Müller trocken.
Derweil hatte sich ein Welpe auf die Pfoten gestellt und einmal träge gedreht, nur um sich dann wieder hinzulegen und schmachtend dreinzuschauen.
»Der da heißt Jumbo. Wenn er ausgewachsen ist, wiegt er siebzig Kilo.«
»Er ist schön«, musste Christophe zugeben.
Tiere berührten ihn wie nichts sonst. Abgesehen von seinem Jungen natürlich, der sich übrigens ähnlich unschuldig benahm, eine Art schnuppernde, erstmalige Existenz. Manchmal, wenn er ihn vor dem Fernseher beobachtete, wie er ganz erledigt auf dem Sofa lag, barfuß mit gesenktem Kopf, sagte er sich, das ist es. Sein kleiner Mann, sein kleiner Junge. Dann dachte er an die Zukunft, an die Mutter des Kindes. Das alles machte ihn so fertig, dass er den Raum verlassen musste.
»Das sind aber keine pflegeleichten Tiere«, sagte der alte Müller. »Solche Dickköpfe habe ich noch nicht gesehen. Als Wachhunde gibt’s nichts Besseres. Wenn ich mir vorstelle, dass ich die an so eine Trulla mit SUV verkaufe …«
»Ich habe irgendwo gelesen, dass ein Chinese sich so eine Dogge gekauft hat. Das Tier hat immer weiter zugenommen. Den ganzen Tag nur gefuttert. Astronomische Mengen. Eines Tages hat der Köter sich auf die Hinterbeine gestellt. Und da gab es keinen Zweifel mehr.«
Der Tierzüchter drehte sich zu Christophe und wartete mit gerunzelter Stirn auf die Pointe. Von nahem konnte man auf den Wangen und der Nase die winzigen roten und granatfarbenen Adern erkennen. Man war immer versucht, einem Pfad zu folgen, einem Weg über die lederdicke Haut.
»Sie haben sich einen Bären andrehen lassen.«
»Im Ernst?« Der Alte gluckste.
»Ich schwöre es.«
Das Gesicht des Züchters bekam mit einem Mal etwas Kindliches. Er schüttelte den Kopf und schlug sich mit der Hand auf den Oberschenkel. Dumm, diese Chinesen! Urkomisch, diese Milliarden Leute dort, weit weg, eine Nation von mickrigen, gelbgesichtigen Gestalten, die allerdings wegen ihrer Effizienz zu fürchten waren. Er stellte sie sich vor, mit ihrem Bären, und fand es köstlich. In seinem Kopf nahm die Anekdote die klaren Konturen eines Comicstrips aus Der blaue Lotus von Tim und Struppi an.
Auf dem Rückweg sah Christophe erneut auf die Uhr, dann zum grauen, düsteren Himmel. Es war jetzt drückender, und dicke Tropfen bildeten sich auf der Stirn des alten Müller, der seine leere Schubkarre schob. Zweimal bot Christophe ihm seine Hilfe an, aber der Bürgermeister von Cornécourt wollte davon nichts hören. So gingen sie also, der Junge und der Alte, über das weitläufige Grundstück, auf dem wildes Unkraut wuchs, erdrückt von der Weite des Himmels, zwei schwarze Gestalten vor dem Horizont. Auf halber Strecke legte der alte Müller dann doch eine Pause ein und wischte sich mit dem Taschentuch übers Gesicht. Der Schweiß stand ihm gut in der frischen Luft. Er war ganz rot, vollgepumpte Lungen, wache Augen, obwohl seine Pupillen bereits milchig wurden. Christophe fragte sich, wie alt er sein mochte. Er schien ihn schon immer so gekannt zu haben, den alten, kahlen, schäbig gekleideten Potentaten, reich, aber diskret, hartnäckig, bedächtig, einer jener Pfeffersäcke, die ihre Erben kleinhielten und um deren Nachfolge ein Streit ausbrach.