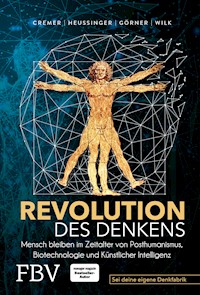12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Deutschland ist im Immobilienfieber. Doch nicht jeder kann sich eine Immobilie leisten, noch dazu zeigt der Immobilienmarkt besonders in Deutschland die ersten Überhitzungserscheinungen. Der schlaue Anleger aber weiß: Dividenden-Aktien sind die neuen Immobilien! Und funktionieren fast genauso: Wer eine Immobilie besitzt und regelmäßige Mieteinnahmen hat, den kümmert es wenig, ob der Wert der Immobilie schwankt, denn solange man sie nicht verkaufen möchte, spielt es keine Rolle. Nicht anders funktionieren Dividendenaktien; Wer eine Aktie besitzt und dafür regelmäßig – noch dazu oft jährlich steigende – Dividenden kassiert, für den spielt es keine Rolle, ob die Aktie an der Börse unterschiedlich bewertet ist – solange man sie nicht verkaufen möchte. Noch dazu fallen bei einer Aktie keine Unterhalts- oder Instandhaltungskosten an. Die Dividenden-Aktie ist also nicht nur die neue, sondern die bessere Immobilie! Anhand von zahlreichen Praxis-Beispielen aus ihrer über 20-jährigen Erfahrung als Investoren, Unternehmer und TV-Experten zeigen Christian W. Röhl und Werner H. Heussinger, warum Aktien sicherer sind als Festgeld, wie Anleger auch turbulente Börsenphasen entspannt überstehen und wie man Schritt für Schritt die besten Aktien auswählt. Also, ab auf die Couch, Dividenden kassieren und natürlich cool bleiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
6. Auflage 2019
© 2016 by FinanzBuch Verlag,
ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Die im Buch veröffentlichten Ratschläge wurden von Verfasser und Verlag sorgfältig erarbeitet und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Ebenso ist die Haftung des Verfassers beziehungsweise des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach-, und Vermögensschäden ausgeschlossen.
Redaktion: Judith Engst, Dr. Michael Eckardt
Korrektorat: Sonja Rose
Umschlaggestaltung: Melanie Melzer, München
Umschlagabbildung: Die Hoffotografen, Berlin
Satz: inpunkt[w]o, Haiger
ISBN Print: 978-3-89879-957-7
ISBN E-Book (PDF): 978-3-86248-864-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi): 978-3-86248-865-0
Dieses Buch einschließlich aller Texte, Grafiken und Tabellen ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung von Inhalten – darunter der (auch auszugsweise) Abdruck, die fotomechanische Wiedergabe und die Einspeisung in elektronische Datenspeicher – bedarf der schriftlichen Einwilligung des Verlags.
Sämtliche Inhalte wurden – auf Basis von Quellen, die die Autoren für vertrauenswürdig erachten – nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch können weder der Verlag noch die Autoren eine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Qualität der Inhalte übernehmen.
Überdies sind sämtliche Inhalte freibleibend und unverbindlich. Sämtliche Inhalte dienen nur der Information, stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Wertpapiere zu verstehen. Auch sind die Vorstellung und Kommentierung von Anlage-Strategien keinesfalls als Aufforderung oder Empfehlung zu deren Nachbildung aufzufassen, auch nicht stillschweigend.
Generell sind Investitionen in Anleihen, Aktien, Fonds/ETFs, Zertifikate und andere Finanzinstrumente mit teilweise erheblichen Markt-, Preis-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken verbunden, die unter Umständen sogar bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Vor jeder Anlageentscheidung ist deshalb – gemeinsam mit geeigneten steuerlichen, juristischen und sonstigen Beratern – zu prüfen, inwieweit eine Investition der individuellen Risikotoleranz sowie den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen und Planungen entspricht.
Dementsprechend haften weder der Verlag noch die Autoren für materielle und/oder immaterielle Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung dieses Buches oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Inhalte verursacht werden bzw. wurden.
Die Autoren sind aktive Investoren. Daher besteht die Möglichkeit, dass die Inhalte dieses Buches auf Anleihen, Aktien, Fonds/ETFs, Zertifikate oder andere Finanzinstrumente referenzieren, in denen die Autoren selbst mittelbar oder unmittelbar investiert sind.
Inhalt
GELEITWORT: Marc Tüngler
01 Opa Wilhelm und die Silvesteranleihe
02 Die große Gier nach dem kleinen Bisschen
03 Traumschiff nach Griechenland
04 Abschied von der Sicherheit
05 Das Ypsilon vom Bayer-Kreuz
06 Unterschätztes Kleinvieh
07 Treibstoff aus reifen Früchten
08 Wasser predigen und Cherry Coke saufen
09 Rossmann schlägt Maschmeyer
10 Trügerische Renditen
11 Adel verpflichtet
12 Dauerläufer und Sprinter
13 Allein die Dosis macht’s
14 Malen nach Zahlen im magischen Viereck
15 Die Hitze in der Küche
16 Scheine statt Steine
17 Jenseits des Tellerrands
18 Das böse S-Wort
19 Einheitsfraß oder Sternetempel
20 Fortsetzung folgt
Anhang A
Top Dividendenhistorie
Deutschland – Top Dividendenhistorie
Österreich – Top Dividendenhistorie
Schweiz – Top Dividendenhistorie
Eurozone ex Deutschland – Top Dividendenhistorie
Westeuropa ex Eurozone – Top Dividendenhistorie
Nordamerika – Top Dividendenhistorie
Asien/Pazifik – Top Dividendenhistorie
Anhang B
Top Dividendenqualität
Deutschland – Top Dividendenqualität
Eurozone ex Deutschland – Top Dividendenqualität
Westeuropa ex Eurozone – Top Dividendenqualität
Nordamerika – Top Dividendenqualität
Über die Autoren
GELEITWORT
Marc Tüngler, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V.
Seit fast einem Vierteljahrhundert sind die Zinsen schon im Sinkflug. Je weiter sie gefallen sind, umso mehr waren Anleger bereit, sich auch auf riskante finanzielle Abenteuer einzulassen, um überhaupt noch auskömmliche Renditen zu erzielen. Dabei ist durchaus einiges schiefgegangen; beispielhaft sei hier nur der Markt für Mittelstandsanleihen erwähnt.
Irgendwann rückte auf der Suche nach Kapitaleinkünften auch die Aktie wieder in den Fokus. Der Grund: Die im Vergleich zu den niedrigen Zinserträgen durchaus interessante Höhe der Gewinnausschüttungen. »Dividende ist der neue Zins«, lautete schnell die Parole, die in vielen Medien zu lesen war und die Anfang 2016 immer noch mehr als 2.000 direkte Google-Treffer bringt.
Aus Sicht der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), die sich nicht nur um Anlegerschutz, sondern auch um die Aktienkultur in Deutschland bemüht, wäre eine nachhaltige Hinwendung zur Aktie natürlich begrüßenswert – zu lange hat diese Anlageklasse unter dem Malus gelitten, der aus dem misslungenen Börsengang der Deutschen Telekom und den fatalen Ereignissen am Neuen Markt resultierte. Doch die Aktionärsquote ist in Deutschland im Vergleich zu anderen westlichen Industriestaaten nach wie vor ausgesprochen niedrig. Kein Wunder, dass die meisten der großen, hierzulande börsennotierten Unternehmen mehrheitlich ausländischen Aktionären gehören.
Gleichwohl ist die Schlussfolgerung »Dividende ist der neue Zins« in der Form nicht richtig, auch wenn es nur allzu verständlich ist, dass man sich an etwas Vertrautes klammert und versucht, dieses hinüberzuretten in eine andere Zeit. Doch sind Dividenden eben nicht dasselbe wie Zinsen, die man fest einplanen kann, solange der Schuldner nicht in die Insolvenz geht. Gewinnausschüttungen sind vielmehr das Ergebnis einer unternehmerischen Beteiligung. Damit ist ein spezielles Chance-Risiko-Profil verbunden, das man kennen und abschätzen sollte, um die nächste Enttäuschung zu vermeiden.
Die DSW hatte das Thema Dividende schon auf der Agenda, als es noch kein Modethema war. Bereits seit 2004 veröffentlicht sie jährlich eine Studie zu dem Thema. Seit 2010 erscheint diese Studie – die ein zuverlässiger Wegweiser für Dividendenjäger in Deutschland ist – in Kooperation mit dem von Christian W. Röhl und Werner H. Heussinger gegründeten isf Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass diese Arbeit nun in Form eines Buches ihre Fortsetzung findet.
Das große Verdienst der Autoren ist, dass sie dabei nicht einfach Kennzahlen wie Dividendenrendite oder Ausschüttungsquote »herunterbeten«, sondern das Big Picture zeichnen. Anhand zahlreicher Anekdoten und Beispiele aus ihrer über 25-jährigen Finanzmarkt-Erfahrung verdeutlichen sie die fundamentalen Unterschiede zwischen Aktien und Anleihen. Sie erklären, warum Dividenden – etwa im Gegensatz zu Aktienrückkäufen – ein echtes Qualitätsmerkmal darstellen.
Diese Informationen helfen nicht nur beim Einstieg in die Aktienanlage, sondern sind auch für erfahrene Anleger lesenswert. Gleichzeitig kommt der konkrete Nutzwert nicht zu kurz. Nach einer Analyse der gängigen Anlage-Konzepte wie Dogs of the Dow, DivDAX oder Dividend Aristocrats kann der Leser den beiden Autoren bei der sukzessiven Entwicklung individueller Dividenden-Strategien über die Schulter schauen. Hierbei profitiert er davon, dass Röhl und Heussinger vor allem Investoren sind, die ihr eigenes Vermögen anlegen und denen die Zwänge, Schwierigkeiten und Probleme, die das mit sich bringt, bestens bekannt sind. Zusammen mit den Auswahllisten in diesem Buch haben Anleger das komplette Handwerkszeug beisammen.
Gleichzeitig bringen die Autoren auch die Risiken, die gerade Anfang 2016 vielen Anlegern wieder schlagartig vor Augen geführt wurden, offen zur Sprache. Wichtiger noch als innovative Konzepte zur Risikosteuerung und Risikobegrenzung ist dabei die Perspektive: Röhl und Heussinger raten, sich vom Kursverlauf zu lösen und – dividendenstarke – Aktien eher wie vermietete Immobilien zu sehen, die einen zwar nicht sicheren, aber doch zumeist kontinuierlichen Ertrag generieren und in den meisten Fällen auf lange Sicht auch eine Wertsteigerung erfahren. Ein Ansatz, den zu verfolgen sich lohnt!
Düsseldorf, im Januar 2016 Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer DSW Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V.
Marc Tüngler, Jahrgang 1968, ist Rechtsanwalt in Düsseldorf. Für die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) ist er seit 1999 tätig. Nach einer Zwischenstation als Landesgeschäftsführer NRW wurde er 2007 zum Mitglied der DSW-Geschäftsführung ernannt und bekleidet seit 2011 die Position des Hauptgeschäftsführers. Marc Tüngler ist Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, Geschäftsführender Vorstand des Arbeitskreises deutscher Aufsichtsrat (AdAR), Mitglied des Übernahmebeirats der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie Mitglied des Börsenrates der Börse Düsseldorf und des Nominierungsausschusses der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung. Zudem hat er Aufsichtsratsmandate bei mehreren börsennotierten Unternehmen inne. Im Rahmen seiner DSW-Tätigkeit berät er die DSW-Mitglieder in allen Fragen rund um das Börsen-, Kapitalanlage- sowie Gesellschaftsrecht und ist darüber hinaus für die Bereiche »Sammelklagen« und »Investment Education« zuständig.
Die 1947 gegründete DSW ist mit rund 30.000 Mitgliedern Deutschlands führender Verband für private Anleger. Sowohl auf der politischen Ebene als auch gegenüber Aktiengesellschaften und Banken setzt sich die Schutzvereinigung für die Interessen der privaten Anleger ein. Mit über 70 Sprechern vertritt die DSW jährlich Stimmrechte auf mehr als 700 Hauptversammlungen in Deutschland und im europäischen Ausland.
01
Opa Wilhelm und die Silvesteranleihe
Es war der 1. Januar 1991 in einer grauen Kleinstadt am Ostrand des Ruhrgebiets. Wenige Stunden zuvor war das frisch wiedervereinigte Land zu den Klängen von Nenas »Wunder geschehen« ins neue Jahr geschunkelt und während draußen die Überbleibsel des ersten gesamtdeutschen Silvesterfeuerwerks vom Nieselregen aufgeweicht wurden, hockte irgendwo im Neubaugebiet ein Achtklässler vor dem Fernseher. Erstes Programm, Live-Übertragung aus Wien, das traditionelle Neujahrskonzert – nicht unbedingt der klassische Zeitvertreib für einen 14-Jährigen. Doch Claudio Abbado und seine Philharmoniker lieferten ja nur die Begleitmusik für jenen silbergrauen Altstar, der auf seiner nachweihnachtlichen Tournee durch die Familie endlich bei seinem größten Fan Station machte: Opa Wilhelm.
Nachdem er aus Hitlers wahnsinnigem Krieg schwerst verwundet heimgekehrt war, hatte er Jura studiert, mit seiner geliebten Frau Marlene drei Kinder großgezogen und eine veritable Karriere in der Finanzverwaltung hingelegt. Auch jetzt, als Regierungsdirektor im Ruhestand, sah man ihn selten ohne Krawatte, und auf seinem Schoß ruhte natürlich keine karierte Wärmedecke, sondern die Frankfurter Allgemeine. Politik, Wirtschaft, Finanzen, Sport, Feuilleton – kaum ein Artikel, den er nicht zumindest überflogen hätte und zu dem ihm nichts eingefallen wäre: Gereimtes von Heinz Erhardt hier, ein lateinischer Aphorismus dort, dazwischen ein paar Erinnerungen an die Währungsreform und das Wirtschaftswunder, dann wieder ein leidenschaftliches Lamento über diese »Sozen«, die nach dem Untergang des Kommunismus doch einfach mal ehrlich zugeben könnten, dass sie jahrzehntelang auf dem Holzweg gewesen waren.
Sein Enkel liebte diese Stunden, in denen er sein großes Vorbild ganz für sich allein hatte. Und obwohl er schon damals nicht auf den Mund gefallen war, hing er die meiste Zeit nur an Opas Lippen: Bloß nichts von dem verpassen und vergessen, was der weise alte Mann mit den fröhlichen Augen in rheinischem Singsang an Erfahrungen und Erlebnissen, Anekdoten und Sprüchen zum Besten gab. Und deshalb stutzte er auch, als Opa Wilhelm irgendwann zwischen Furioso-Polka und Radetzky-Marsch den Finanzteil beiseitelegte und dabei etwas von einer Silvesteranleihe murmelte, die er am nächsten Tag unbedingt noch zeichnen müsse. Silvester war doch schon vorbei, und der Großvater konnte prinzipiell alles – aber hatte er am Abend zuvor nicht auf ganzer Linie versagt, als er beim Activity-Spiel im Familienkreis einen Bundesadler zeichnen sollte, der dann aber eher nach einem gerupften Suppenhuhn aussah!?
Der Opa bemerkte die Fragezeichen im Gesicht seines Enkels, der dank seiner gymnasialen Bildung trefflich über die Tracheenatmung der Bienen oder die charakteristischen Merkmale von Tundra und Taiga parlieren konnte, aber keinen blassen Schimmer von Geld und Kredit hatte. Dabei war das mit der Anleihe ziemlich trivial: Statt seine Spargroschen zur Bank zu tragen, gibt man den Zaster einfach dem Staat. Natürlich nicht geschenkt, sondern gegen Zinsen. Und auch nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag, sondern nur für eine von vornherein begrenzte Zeit. Danach wird alles auf Heller und Pfennig genau zurückgezahlt – garantiert durch die Bundesrepublik Deutschland, mithin so sicher wie das Amen in der Kirche.
Und weil der Staat mehr Geld brauchte, als die fleißigen Finanzbeamten – von denen der Opa lange Jahre einige Hundertschaften befehligt hatte – dem Bürger legal abknöpfen konnten, gab es ständig neue Anleihen. Eine davon wurde traditionell zu Silvester aufgelegt, sozusagen als Rendite-Rakete für Privatanleger, die ihre Kohle nicht komplett verballert hatten. Und was das Zeichnen anging: Das war bloß der Terminus technicus dafür, dass man gleich am Ausgabetag mit von der Partie war und nicht erst abwartete, bis die Anleihe an der Börse gehandelt wurde.
Coole Sache, dachte sich der Enkel. Wieder etwas gelernt, um beizeiten den Sowi-Lehrer zu ärgern – jenen jutesackbepackten Deodorantverweigerer, der mit größter Inbrunst das Elend des Kapitalismus am Beispiel südamerikanischer Bananenbauern durchdeklinieren konnte und wohl nur deshalb ein SPD-Parteibuch besaß, weil die KPD 1956 verboten worden war. Und so hätte man sich fast schon dem Sportteil zugewandt und der existenziellen Frage, mit welchem Trainer Alemannia Aachen vielleicht doch noch dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga entrinnen könnte – wenn dem Enkel nicht noch eine Frage eingefallen wäre: Lohnte sich das überhaupt, sein Geld dem Staat anzuvertrauen?
Juristen sind ja eigentlich berüchtigt für knappe und prägnante Formulierungen, bei Opa Wilhelm hingegen lag die Würze bisweilen eher in der epischen Breite als in der knackigen Kürze. Er machte es richtig spannend, referierte über Wirtschaftszyklen, erinnerte sich wehmütig an die zweistelligen Zinssätze in den 1970er-Jahren, verwies auf die jüngsten Kommentare des Bundesbankpräsidenten in der F.A.Z. – um dann fast schon beiläufig zu erwähnen, dass die diesjährige Silvesteranleihe mit einem Kupon von neun Prozent p.a. durchaus akzeptabel ausgestattet sei, wobei man aber bedenken müsse ...
Bedenken? Hallo? Wenn diese Szene ein Comic gewesen wäre, hätte der Enkel jetzt eine leuchtende Glühbirne über dem Kopf und Dollarzeichen in den Augen gehabt. Neun Prozent! Halleluja! Auch wenn’s im Sowi-Unterricht nur für Bananenbauern reichte, wusste der Junge diese Zahl durchaus einzuordnen – wiederum dank der Großeltern, die ihm zur Kommunion sechs Jahre zuvor ein Postsparbuch geschenkt hatten. Damit war er vor nicht allzu langer Zeit stolz wie Oskar in die Postfiliale getigert, um die Zinsen eintragen zu lassen und daher wusste er ziemlich genau, was die Bank fürs Geld zahlte: Lumpige 2,75 Prozent.
Doch wahrscheinlich verhielt sich das mit diesen Anleihen ähnlich wie mit dem Prämiensparen der örtlichen Sparkasse – eine Art Lotterie, bei der man zwar kein Geld verlieren konnte, jedoch eine gehörige Portion Glück brauchte, um mehr als den gemeinen Sparbuchzins einzuheimsen. Aber nein, beschwichtigte der Opa sogleich: Bundesanleihen seien zutiefst demokratisch, alle Bürger könnten mitmachen, schon ab 100 Mark, und die neun Prozent würden für jeden gelten, der gleich zeichne. Man müsse halt die volle Laufzeit abwarten, bei der Silvesteranleihe immerhin zehn Jahre. Klar, mit einem Verkauf über die Börse käme man auch schon früher wieder ans Geld, eventuell aber nur mit Abstrichen. Und zehn Jahre, das sei schon eine lange Zeit, zu lange für die meisten Menschen und eigentlich auch zu lange für ihn mit seinen fast 69 Jahren. Andererseits wollte er ja mindestens so lange leben, bis die Alemannia wieder in der 1. Bundesliga kickte und außerdem seien gerade ein paar andere Anleihen fällig geworden und das gute Geld sollte ja nicht auf dem Konto verwesen. Kurzum, er würde morgen gleich die Bank anrufen und »e bissje wat« von der Silvesteranleihe ordern.
Als er »e bissje wat« dann noch in D-Mark übersetzte, dämmerte dem Enkel, dass der Mercedes, mit dem seine Großeltern durch die Lande reisten, wohl nicht nur mit Opas Beamtenpension bezahlt war. Der Junge war elektrisiert: Erst kurz vor den Ferien hatten sie in der Schule den Lohn eines Bananenbauern mit dem deutschen Durchschnittseinkommen verglichen und wenn er das, was Opa Wilhelm morgen in die Silvesteranleihe stecken würde, mit neun Prozent multiplizierte, kam ungefähr dasselbe heraus, was ein hiesiger Facharbeiter im Monat verdiente. Nur musste der eben jeden Tag früh aufstehen, mindestens acht Stunden schuften, vielleicht sogar seine Gesundheit aufs Spiel setzen – während der Opa ein bisschen in der F.A.Z. blätterte, kurz die Bank anrief und sein Geld für sich arbeiten ließ. Und das, dank staatlicher Garantie, auch noch ohne Risiko!
Komisch nur, warum ausgerechnet Opa Wilhelm dennoch bei jeder Gelegenheit gegen diesen Staat wetterte, der nicht mit Geld umgehen könne und nach kaufmännischen Maßstäben ohnehin schon zu Zeiten der sozialliberalen Koalition pleite gewesen sei. Aber diese Frage stellte der Junge genauso wenig wie er einen Gedanken daran verschwendete, wofür der Finanzminister die drei Milliarden Mark, die ihm durch die Silvesteranleihe zufließen sollten, wohl ausgeben würde – und woher in zehn Jahren die Mittel für die Tilgung kommen sollten. Schuldenfalle? Ja, schon mal gehört, schlimme Sache, da unten in der Dritten Welt, bei den Bananenbauern. Doch hic et nunc, wie der Opa zu sagen pflegte, zählte nur eines: Neun Prozent.
Es war dann noch ein langer Abend, der damit endete, dass am nächsten Tag ein aufgeregter Enkel, eine leicht genervte Mutter und ein routinierter Opa zur Sparkasse marschierten und erklärten, dass etwas von dem Geld, das die Eltern zur Geburt ihres Sohnes auf ein Sparkonto gepackt hatten, nun in die Silvesteranleihe des Bundes investiert werden sollte – wobei die Wertpapiere nach der Zeichnung natürlich spesen- und lastenfrei in ein kostenloses Depot bei der Bundesschuldenverwaltung zu übertragen seien. Und während der Achtklässler sich fühlte wie ein Großkapitalist, wurde der Bankbeamte so grau wie sein Anzug: Er ahnte wohl, dass dies nur der erste von vielen lästigen Zeichnungsaufträgen war, die er in den nächsten Jahren würde bearbeiten müssen.
02
Die große Gier nach dem kleinen Bisschen
Zehn Jahre später waren Opa und Enkel noch immer ein Herz und eine Seele, auch wenn der promovierte Jurist nie ganz verstehen wollte, warum der Knabe sein Studium geschmissen hatte und vorzeitig dem Ruf des Geldes gefolgt war. Schon kurz nach dem Abitur heuerte er bei einem Finanzvertrieb an und während des zweiten BWL-Semesters ergriff er dann die Chance, bei der Gründung eines neuen Börsenmagazins mitzumachen – das er bald wieder im Stich ließ, als der legendäre Bruno Kling, damals die unumstrittene Nummer eins unter den Frankfurter Börsenmaklern, ihm einen Job am Parkett angeboten hatte.
Aktienhandel, Börsengänge, Business Class nach New York, Interviews in der Telebörse des Nachrichtensenders n-tv: Es waren wilde Zeiten, ein bisschen wie bei Bud Fox, dem von Charlie Sheen verkörperten Jungbanker in Oliver Stones Hollywood-Klassiker Wall Street. Atemloses Geld, schnell verdient und noch schneller wieder verloren – abgesehen von der Silvesteranleihe. Die blieb all die Jahre brav im Depot und immer wenn der Neujahrskater verflogen war und die Zinsen gutgeschrieben wurden, erinnerte der Junge sich lächelnd, wie alles angefangen hatte mit ihm und dem Geld.
Und dann, Anfang 2001, war Schluss. Laufzeitende, Fälligkeit, Tilgung – die zehn Jahre waren um und, wie es sich für einen ordentlichen Schuldner gehört, zahlte Vater Staat das seinerzeit investierte Geld pünktlich und bis auf die zweite Nachkommastelle genau zurück. Gleichzeitig endete damit eine Ära, denn erstmals seit Jahrzehnten legte der Bund keine neue Silvesteranleihe mehr auf. Wahrscheinlich hatte Finanzminister Eichel, von Spöttern ob der leeren Kassen bisweilen auch »der blanke Hans« genannt, schlichtweg Angst, dass die einstigen Rendite-Kracher wie Blei in den Regalen liegen bleiben würden.
Denn eingangs des Jahrtausends waren Zinsen ähnlich uncool wie Stützstrümpfe oder deutsche Schlager. Wer auf der Höhe der Zeit sein wollte, kaufte Aktien. Zunächst die von einem glatzköpfigen TV-Kommissar angepriesenen »Volksaktien« der Deutschen Telekom, später dann die Hoffnungsträger vom Neuen Markt: Junge Technologiefirmen, Internet-Buden und Medienklitschen, die noch nie schwarze Zahlen geschrieben hatten, häufig nicht einmal nennenswerte Umsätze vorweisen konnten – dafür aber kühne Visionen, mit denen man seinerzeit nicht frei nach Helmut Schmidt zum Arzt, sondern eben an die Börse ging.
Neun Prozent gab’s damals nicht per annum, sondern pro Woche – wenn man sich dämlich anstellte. Oft reichten schon ein paar Stunden für zweistellige Gewinne. Endlich konnte jeder reich werden, vom Professor bis zur Putzfrau, ohne Arbeit und sogar ohne lästiges Wissen. Beispiel Biodata: Elektrisiert davon, dass die einst vom 16-jährigen Tan Siekmann gegründete Firma ja wohl gleich die beiden heißesten Megatrends des neuen Jahrtausends – nämlich Biotechnologie und Datenverarbeitung – ins Visier nahm, entwickelte sich um die am 21. Februar 2000 zu 45,00 Euro platzierten Aktien ein solcher Hype, dass der erste Börsenkurs einen Tag später bei sage und schreibe 240,00 Euro festgestellt wurde. Ein Plus von 433 Prozent, wodurch der 100-Mann-Laden, der im Jahr zuvor gerade 8,2 Mio. Euro umgesetzt hatte, mit vier Milliarden Euro bewertet wurde. Aber das war egal, genauso wie der Umstand, dass es sich bei Biodata bloß um einen schnöden Netzwerkausrüster handelte, der mit Biotechnologie ähnlich wenig am Hut hatte wie die Lufthansa oder andere Dinosaurier der mitleidig belächelten Old Economy.
Dabei war der Gipfel des Irrsinns schon vorher erreicht worden. Am 1. April 1998, als überall im Land die Angst vor einer schwammartigen Gehirnerweichung bei Rindern grassierte, medizinisch Bovine Spongiforme Enzephalopathie genannt, hatte das Düsseldorfer Maklerhaus Schnigge in seinem Handelssystem die BSE-Aktie freigeschaltet. Und obwohl keinerlei Bilanzen oder Prognosen verfügbar waren, ja nicht einmal Angaben zur Geschäftstätigkeit, stieg der Kurs binnen weniger Stunden von 150,00 auf 200,00 DM. Erst am Nachmittag, als der Ansturm zeichnungswilliger Anleger allmählich die Telefonleitungen zusammenbrechen ließ, wurde der Aprilscherz aufgedeckt und die fiktive Notierung eingestellt.
Ein Blick in die Geschichtsbücher lehrt: Solche Exzesse nehmen früher oder später ein böses Ende. Und wie die Tulpenzwiebel-Hausse im 16. Jahrhundert, die Südsee-Spekulation um 1720 oder die japanische Immobilienblase Ende der 1990er-Jahre entlud sich auch der Aktienboom der Jahrtausendwende in einem fatalen Crash. Reihenweise kollabierten die Firmen, Hunderttausende Anleger verloren einen in Summe dicken zweistelligen Milliardenbetrag und, viel schlimmer, das Vertrauen in die Börse. Zugegeben, wer am beerdigten Neuen Markt Blendern wie den Haffa-Brüdern auf den Leim gegangen war und dabei Haus und Hof verzockt hatte, war zuallererst Opfer der eigenen Gier geworden und durfte nicht unbedingt Mitleid erwarten: »Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen«, treffender als der 2011 verstorbene Filmmogul Leo Kirch, der damals mit ein paar halsbrecherischen Geschäften sein über mehr als vier Jahrzehnte aufgebautes Imperium ruinierte, kann man es kaum auf den Punkt bringen.
Anders verhält es sich indes mit den braven Bürgern, die den blumigen Sprüchen von einer rosaroten Zukunft erlegen waren und anlässlich des Telekom-Börsengangs ihre Sparbücher geplündert hatten, um zumeist das erste Mal im Leben Aktien zu kaufen – schließlich hatten neben Manfred Krug und dem smarten Vorstandschef Ron Sommer sogar die christsozialen Minister Waigel (Finanzen) und Bötsch (Post) für die T-Aktie getrommelt. Doch die vermeintlich solide, weil von Vater Staat orchestrierte Geldanlage entpuppte sich schon bald als Luftnummer. Nachdem die dritte und mit Abstand größte Telekom-Tranche im Juni 2000 zu 66,50 Euro platziert worden war, lag der Jahresschlusskurs nur noch bei 31,76 Euro. Und selbst das war gemessen an dem, was noch kommen sollte, ein Fabelwert. Bis auf 7,69 Euro ging’s runter und sogar heute, mehr als 15 Jahre nach der Telemedien-Blase, müsste der Wert sich schon vervierfachen, damit die Erstzeichner bloß ihren Einsatz wiedersehen würden.
Kein Wunder, dass die Deutschen von Aktien die Nase gestrichen voll hatten. Plötzlich lautete die Devise wieder safety first – bloß nicht noch mehr Geld verlieren. Doch dummerweise waren die guten alten Bundesanleihen zwar nach wie vor sicher, aber lange nicht mehr so lukrativ wie früher. Wo zum Jahreswechsel 1990/91 noch neun Prozent gestanden hatten, gab’s nun bloß noch die Hälfte: »Klar, dass ein so guter Schuldner wie die Bundesrepublik Deutschland nur wenig Zinsen zahlen muss. Derzeit sind es magere 5,2 Prozent für eine Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit«, klagte das Wochenblatt Euro am Sonntag.
Deutsche Bundesanleihen: Renditeentwicklung 1992 - 2004
Dabei hätten die Zinsen eigentlich steigen müssen, nachdem die Deutsche Einheit noch weitaus teurer geworden war, als von Helmut Kohl versprochen und von Oskar Lafontaine befürchtet. Aber weil die blühenden Landschaften im Osten nicht so recht gedeihen wollten, war gleichzeitig die große Inflation ausgeblieben. Das hatte die Bundesbank in die Lage versetzt, ihre Leitzinsen sukzessive herabsetzen zu können, ohne die Preisstabilität zu gefährden. Der Politik kam das natürlich zupass, denn auf diese Weise durfte man für dieselbe jährliche Zinslast doppelt so viel Geld aufnehmen wie zehn Jahre zuvor – womit sich reichlich Wohltaten finanzieren ließen. Hinzu kam die Euro-Einführung: Niedrige Zinsen signalisieren geringe Risiken, und so konnte niemand ernsthaft behaupten, der neue Währungsclub sei schon vom Start weg so eine Art paneuropäische Bananenrepublik.
Was die ehemaligen Hochzinsländer rund ums Mittelmeer genauso frohlocken ließ wie die fleißigen Häuslebauer zwischen Rhein und Oder, sorgte bei Sparern und Anlegern natürlich für Katzenjammer – vor allem weil die fünf Prozent, die zur Jahrtausendwende noch als mager gegolten hatten, im Rückspiegel schon bald wie ein Festmahl aussahen. Um der Weltwirtschaft nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und nach der Implosion der New Economy wieder auf die Beine zu helfen, wurden unter Führung des sagenumwobenen US-Notenbankchefs Alan Greenspan rund um den Globus die Zinsschrauben gelockert. Anfang 2003 war der Referenzsatz für Euro-Tagesgeld bereits auf zwei Prozent abgesackt und selbst langlaufende Bundesanleihen warfen kaum mehr ab als vier Prozent. Abzüglich Steuern und Inflation blieb da kaum noch etwas übrig, was den üblichen Sozialneid auf das arbeitsfreie Einkommen aus Kapitalvermögen gerechtfertigt hätte.
Und nun zeigte sich: Wenn die Wirtschaftspresse kritisiert, die Deutschen seien in Finanzdingen passiv, verstockt und Neuem gegenüber wenig aufgeschlossen, grenzt das fast schon an üble Nachrede. Denn solange ein halbwegs akzeptabler Zinskupon draufsteht und das Ganze so hübsch verpackt ist, dass kein Risiko mehr durchschimmert, lässt sich die Nation der Dichter und Denker auf die abenteuerlichsten, komplexesten und unsinnigsten Finanzprodukte ein.
Zum Beispiel auf offene Immobilienfonds, die im Kern ja durchaus gut gemeint sein mögen. Weil Otto Normalsparer sich vielleicht eine Wohnung oder maximal ein Mehrfamilienhaus leisten kann, bei Bürotürmen, Shoppingcentern oder Gewerbeparks jedoch meistens passen muss, zahlt jeder in einen Topf ein, für den man dann ein professionelles Management engagiert, das sich nicht nur um die Auswahl und den Kauf geeigneter Objekte kümmert, sondern auch um das, was neudeutsch Facility Management heißt – die ganze lästige Hausverwaltung, vom tropfenden Wasserhahn bis zum säumigen Mieter. Das kostet zwar Geld, ist aber bequem und unterm Strich reicht es trotzdem für jährliche Ausschüttungen von vier bis fünf Prozent, die überdies auch noch teilweise steuerfrei sind.
Damit hätte man den deutschen Michel, dessen Steuerspartrieb ja bekanntlich ausgeprägter ist als sein Sexualtrieb, eigentlich schon an der Angel – wenn Immobilien bloß nicht so illiquide wären. Ans Tagesgeld kommt man, nomen est omen, täglich heran; Spareinlagen lassen sich innerhalb bestimmter Fristen (oder gegen entsprechende Vorfälligkeitszinsen notfalls sofort) kündigen; Bundesanleihen und Aktien werden an der Börse gehandelt. Um jedoch Grund und Boden wieder zu Geld zu machen, braucht man gute Nerven und vor allem Zeit. Zwischen der Entscheidung für einen Verkauf eines Hauses und dem Glücksgefühl, wenn der Erlös endlich auf dem Konto eingegangen ist, liegen selten weniger als sechs Monate – und mehr Unwägbarkeiten, als man dem durchschnittlichen Sparer zumuten kann. Deshalb hatte die Finanzindustrie schon 1969 einen besonderen Service ersonnen, die permanente Rücknahmeverpflichtung: Wer raus wollte, konnte seine Anteile jederzeit an die Fondsgesellschaft zurückgeben, und zwar zu einem Preis, der aus einer regelmäßigen Bewertung des Immobilienbestands durch renommierte Gutachter resultierte.
Die Sicherheit von Immobilien, so flüssig wie Tagesgeld und vor allem netto weitaus renditestärker als Bundesanleihen – Anlegerträume waren wahr geworden. Wobei die Traumfabriken sich dafür fürstlich entlohnen ließen: Fünf bis sechs Prozent Ausgabeaufschlag wurden den Betongold-Sparern zumeist abgeknöpft, so dass man sich die erste Jahresrendite aus eigener Tasche zahlte. Trotzdem konnten sich die Fondsmanager vor Mittelzuflüssen kaum retten.
Die Rücknahmeverpflichtung war – wie bei jedem ordentlichen Schneeballsystem – kein Problem, da stets genügend frisches Geld hereinkam, um die paar Anleger abzufinden, die aussteigen wollten. Das änderte sich jedoch abrupt, nachdem 2008 im Zuge der Finanzkrise vor allem institutionelle Investoren Mittel abziehen mussten, um anderweitig entstandene Löcher zu stopfen. Eine Zeitlang konnten die Anteilsrücknahmen aus der gesetzlich vorgeschriebenen Liquiditätsreserve bestritten werden, dann beschaffte man sich durch Kredite ein bisschen Spielraum, aber als dann auch noch die Privatanleger begannen, ihre Einlagen zurückzufordern, ging bald nichts mehr: Gleich mehrere Fonds mussten die Anteilsrücknahme für bis zu zwölf Monate aussetzen.
Nun rächte sich der Konstruktionsfehler der offenen Immobilienfonds, nämlich dass eine per definitionem unbewegliche Anlageklasse mit dem Versprechen täglicher Verfügbarkeit ummantelt wurde. So etwas kann vielleicht gutgehen, solange nicht zu viel Geld im Spiel ist; ab einer gewissen kritischen Größe jedoch ist der Kollaps nur noch eine Frage der Zeit und dann wird’s teuer. Dies umso mehr, weil die Schieflage der Fonds spätestens durch die temporäre Schließung öffentlich bekannt war. Das schwächte die Verhandlungsposition der Manager weiter, die nun unter erheblichem Zeitdruck Objekte verkaufen mussten, um frisches Geld in die Kasse zu bekommen. Nicht nur, dass manche Perle notgedrungen regelrecht verramscht wurde: Weil die Wirtschaftsprüfer auf höheren Risikoprämien bestanden, blieb den Fondsgesellschaften nichts anderes übrig als die Wertansätze für alle Bestände nach unten zu revidieren.
Immobilienfonds in Abwicklung: Börsenpreise inkl. Ausschüttungen 2006 - 2015
Traurige Berühmtheit erlangte in diesem Zusammenhang der Degi Global Business. Der auf internationale Gewerbeimmobilien fokussierte Fonds wurde Anfang 2010 um saftige 21,6 Prozent abgewertet, während die Wettbewerber im Schnitt nur ein Zehntel Bewertungsluft ablassen mussten. Hartgesottenen Börsenzockern würde das noch nicht den Schlaf rauben, aber wo absolute Sicherheit suggeriert und verkauft wurde, sind zweistellige Verluste bereits ein Debakel. Und der Alptraum ist ja noch nicht vorbei: Zahlreiche Fonds – darunter so prominente Namen wie SEB Immoinvest, CS Euroreal oder DJE Real Estate – konnten ihren regulären Geschäftsbetrieb nicht mehr aufnehmen und werden nun liquidiert. Immer wenn wieder ein paar Objekte verkauft wurden, erhalten die Anteilseigner eine Ausschüttung; endgültig abgewickelt sein werden die einstigen Anlegerlieblinge indes wohl erst im Jahr 2017.
Allerdings waren offene Immobilienfonds beileibe nicht die einzige Dummdödelei, auf die renditehungrige Sicherheitsfanatiker sich in den vergangenen zehn Jahren eingelassen haben. Etwa genauso viel Geld ist in Garantiezertifikate geflossen, die im Bankbetrieb eine Zeitlang als das gefeiert wurden, was im Technologiesektor Killerapplikation heißt: Einerseits konnte man die Kunden plötzlich wieder mit satten Zinskupons locken; andererseits wurde das häufig chronisch margenschwache Geschäft mit nervigen Kleinsparern auf einmal zum Ertragsturbo. Denn Termingelder und Sparbriefe lohnen sich aus Bankensicht ja erst, wenn die dergestalt eingeworbenen Einlagen mit mehr oder weniger saftigen Zinsaufschlägen als Dispo-, Betriebsmittel- oder Hypothekenkredit ausgereicht werden – was mit Aufwand und Risiko verbunden ist. Bei Garantiezertifikaten hingegen musste bloß der Zeichnungsauftrag unterschrieben sein und schon hatte die Bank ihre Schäfchen im Trockenen.
»Fünf-acht-acht« hieß es damals in nicht wenigen Privatkundenabteilungen: Fünf Jahre Laufzeit, jedes Jahr acht Prozent Zinsen und acht Prozent Provision für den Verkäufer ... ähm, Berater. Und das garniert mit unbedingter Sicherheit, denn Omi macht zwar alles mit, aber nur solange sie das wohlige Gefühl genießt, dass nichts verloren gehen kann.
In Zeiten, in denen fünfjährige Bundesanleihen drei bis vier Prozent brachten und auch solide Bankschuldverschreibungen kaum mehr abwarfen, waren solche Konditionen naturgemäß nicht mit seriösen Mitteln darstellbar. Da brauchte es schon reichlich moderne Alchemie – genau das, was Warren Buffett, der wohl erfolgreichste Investor unserer Zeit, mal als »finanzielle Massenvernichtungswaffen« geißelte: Derivate. Ein bisschen mathematisches Abrakadabra und schon wird aus ganz wenig etwas, das nach richtig viel aussieht.
Man spricht dann halt nicht mehr von Zinsen, sondern von Kupon-Chance, denn genau genommen sind ja nur die acht Prozent für die Bank garantiert, während die acht Prozent für den Kunden an einem Korb aus 20 internationalen Qualitätsaktien hängen. Nein, keine Angst, diese vermaledeite Telekom ist natürlich nicht dabei, nur solide Titel wie General Motors (»Fahren Sie nicht selbst einen Opel?«), Nokia (»70 Prozent Weltmarktanteil bei Handys«) oder RWE (»Was die verdienen, sehen Sie ja an Ihrer Stromrechnung«). Und außerdem kauft man ja sowieso keine Aktien und die Kurse müssen auch nicht steigen: Die acht Prozent sind schon im Sack, wenn während der zwölf jährlichen Stichtage kein Titel mehr als 25 Prozent im Minus ist.
Sofern Omi noch immer nicht überzeugt war, wurde einfach noch mal die Garantie-Karte ausgespielt. Auch wenn die Welt zusammenfällt, also mal rein bildlich gesprochen, in fünf Jahren gäbe es ja auf jeden Fall den Emissionspreis von 100,00 Euro zurück. Selbst im worst case wäre also nichts verloren und gerechnet auf die 10.000 Euro aus dem gerade fällig gewordenen Sparbrief reichen die acht Prozent doch jedes Jahr für ein paar schöne Tage auf Mallorca! Spätestens an diesem Punkt war der Omi – die sonst den Hackenporsche durch die halbe Stadt schleift, nur weil die Milch beim Aldi fünf Cent billiger ist als bei Lidl – völlig einerlei, dass das Zertifikat nicht zu 100,00 Euro abgerechnet wurde, sondern inklusive Ausgabeaufschlag 103,00 oder gar 104,00 Euro kostete. Und dieses Geld war natürlich schon weg, genauso wie die Innenmarge. Denn von den 104,00 Euro wurden nicht einmal 100,00 Euro in die Derivate-Struktur des Zertifikats gesteckt, sondern lediglich 96,00 Euro.
Der Rest ging wiederum an die Bank – was ja durchaus zu verschmerzen und sogar zu rechtfertigen gewesen wäre, wenn Omi wirklich die acht Prozent bekommen hätte. Doch die Zinsversprechen der meisten Garantie-Zertifikate mit Aktienkorb-Bindung hatten ungefähr denselben Wert wie Opa Wilhelms augenzwinkernde Offerte, seinem Enkel zum Achtzehnten einen Mercedes zu schenken, falls auf dem Zeugnis wenigstens für ein Halbjahr eine Eins in Sport stünde: Weil der reichlich ungelenke Junge nicht einmal beim Seilspringen im heimischen Wohnzimmer nur annähernd so viele Durchgänge schaffte wie der oberschenkelamputierte Großvater, war das Risiko, dass er irgendwann zu seinem Wort stehen musste, gleich null.
So verhält es sich auch mit den vermeintlich zinsbringenden Aktien. 20 Titel und zwölf Stichtage, das heißt in planem Deutsch, dass der Zauber-Zins an sage und schreibe 240 Bedingungen hängt. Und wenn nur eine einzige Aktie an einem einzigen Stichtag 25,01 Prozent statt 24,99 Prozent im Minus liegen sollte, gibt’s keine acht Prozent, sondern eine Nullrunde – Balkonien statt Ballermann. Genau das ist auch der Normalfall, denn selbst wenn die Börsen insgesamt stabil bleiben oder sogar kräftig steigen, ist in einem Korb mit 20 Aktien eigentlich immer eine enthalten, die sich früher oder später als Lusche entpuppt und einem die ganze Tour vermasselt. General Motors, 2007 noch der weltgrößte Automobilproduzent, war 2009 bankrott; Nokia hat den Smartphone-Trend lange verschlafen und notiert mehr als 90 Prozent unter den alten Höchstständen; und RWE ist zwar halbwegs unbeschadet durch die Finanzkrise gekommen, doch seit die Bundesregierung 2011 infolge der Fukushima-Katastrophe den vorzeitigen Atomausstieg verkündet hat, ist der Kurs der einstigen »Qualitätsaktie« um drei Viertel abgeschmiert.
Solche Flops sind weder absehbar noch vermeidbar. In einem klassischen Portfolio wären sie indes durch Überflieger wie Apple oder Bayer kompensiert worden und unter dem Strich hätte man wohl trotzdem gutes Geld verdient. Aber wenn Zinskupons dergestalt an Aktienkörbe gekoppelt werden, dass kein Titel allzu sehr abrutschen darf, können die viel beschworenen Risikopuffer noch so groß sein – am Ende hebeln solche Strukturen bloß das Einzelaktienrisiko. Mit seriöser Geldanlage hat das nichts zu tun: Unter dem Deckmäntelchen der Garantie werden scheue Sparer in eine Finanzwette gelockt, die sie kaum überblicken, geschweige denn gewinnen können.
Ähnlich wie Alemannia Aachen in diesem Jahrtausend zweimal den großen FC Bayern bezwingen konnte, haben natürlich auch einige Kupon-Zertifikate ihre Fabel-Zinsen gezahlt. Eine teure Angelegenheit für die Buchmacher ... sorry, wir meinen natürlich: für die Banken, die für dieses Risiko geradestehen mussten. Zumeist jedoch lief es wie in jedem ordinären Wettbüro; die Kunden gingen leer aus oder wurden mit einem lächerlichen Minimum abgespeist. Immerhin nichts verloren, trösteten die Berater, und ließen damit nicht nur den Ausgabeaufschlag nonchalant unter den Tisch fallen, sondern auch den entgangenen Gewinn: Wer Anfang 2004 beispielsweise 10.000 Euro in eine fünfjährige Bundesanleihe gesteckt hat, durfte sich jedes Jahr über 350 Euro Zinsen freuen, in Summe also über 1.750 Euro – während bei einem mit drei Prozent Agio verkauften Kupon-Zertifikat, das dem statistischen Erwartungswert entsprechend niemals ausgeschüttet hat, unter dem Strich 300 Euro Miese stehen.
Für einige zehntausend Anleger endete das Zertifikate-Abenteuer indes mit dem Totalverlust ihres eingesetzten Kapitals. Denn als viele einheimische Häuser angesichts des absurden Wettrennens um die höchsten Vertriebsmargen kalte Füße bekamen, schlug die Stunde der angloamerikanischen Investmentbanken. Und so bekam Omi in der Sparkasse um die Ecke dann plötzlich ein ganz dolles Zertifikat aus dem Hause Lehman Brothers angedreht – einem der renommiertesten Finanzhäuser der Welt, 1850 von deutschen Einwanderern gegründet. Was die schon für Krisen überlebt haben, absolut seriös!
Tragisch nur, dass die US-Regierung ausgerechnet an der über eineinhalb Jahrhunderte alten Traditionsbank ein Exempel statuierte. Anders als zuvor den Broker Bear Stearns oder später den Versicherungsriesen AIG ließ man die Lehman-Brüder einfach pleitegehen – und weil Zertifikate als Schuldverschreibungen nun einmal nicht von der Einlagensicherung gedeckt sind, war das, was Omi über Jahre oder Jahrzehnte angespart hatte, am 15. September 2008 auf einen Schlag futsch. Insgesamt haben deutsche Kleinanleger mit Lehman-Papieren rund 750 Mio. Euro verloren. Während die juristische Aufarbeitung allmählich abgeschlossen ist, leiden Zertifikate noch immer unter einem gewissen »Bäh-bäh«-Faktor. Schade eigentlich, denn neben dem wohl unvermeidlichen Schrott hält dieses Segment gerade jetzt wieder einige durchaus brauchbare Anlage-Ideen bereit.
Obendrein sollte nicht der Eindruck entstehen, dass die Reinfälle, die Zins- und Renditejäger in den vergangenen Jahren erlitten haben, stets das sinistre Werk provisionsgeiler Bankstricher gewesen seien. So muss sich der eine oder andere Geschädigte als mündiger Bürger schon die Frage gefallen lassen, ob Eigentum nicht auch dazu verpflichtet, Geldanlagen zumindest ebenso gewissenhaft anzugehen wie den Wechsel des Handy-Tarifs oder den Kauf eines neuen Autos. Wer 25.000 Euro für einen Gebrauchtwagen ausgeben will, wühlt sich durch Testberichte, studiert Pannenstatistiken, vergleicht Preise, macht mindestens eine Probefahrt und nimmt am liebsten auch noch Onkel Erwin mit, der zwar keine Ahnung hat, aber so böse gucken kann, dass der Händler schon von sich aus ein paar Hundert Euro nachlässt. Und wenn’s um Geld geht? Da wird einfach mal gemacht, was der Berater sagt. Hört sich doch gut an, der hat Ahnung, wird schon klappen und wenn nicht, gibt’s genügend Rechtsverdreher, die mit allerlei juristischen Taschenspielertricks dafür sorgen, dass man für den eigenen Leichtsinn irgendwen haftbar machen kann.