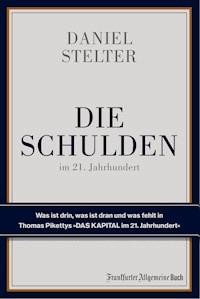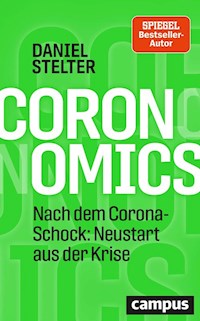
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Beginn einer neuen Wirtschafts- und Finanzordnung März 2020. Angela Merkel spricht von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens haben innerhalb kürzester Zeit zu Veränderungen geführt, die hierzulande noch völlig unmöglich erschienen als sie in China bereits Realität waren. Dann kam der Corona-Schock – der größte ökonomische Crash der Weltgeschichte. Daniel Stelter legt mit Coronomics das Fundament für die Zukunft der Wirtschaft. Seine Logik: Was zumacht, muss auch wieder aufmachen. Aber resistenter als zuvor! Stelter legt dar, wie wir uns jetzt für die Zukunft nach Corona aufstellen müssen. Das wirtschaftliche Umfeld wird ein anderes sein: Aktive Notenbanken, aktive Staaten, Abkehr von der Globalisierung. Die Rückkehr der Inflation droht. Dies verlangt andere Prioritäten: Investition statt Konsum. Echte Reformen von Staat und Gesellschaft. So kann eine alttestamentarisch anmutende Katastrophe der Schlüssel zu einer prosperierenden Zukunft für uns alle werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Stelter
CORONOMICS
Nach dem Corona-Schock: Neustart aus der Krise
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Der Beginn einer neuen Wirtschafts- und Finanzordnung März 2020. Angela Merkel spricht von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens haben innerhalb kürzester Zeit zu Veränderungen geführt, die hierzulande noch völlig unmöglich erschienen als sie in China bereits Realität waren. Dann kam der Corona-Schock – der größte ökonomische Crash der Weltgeschichte. Daniel Stelter legt mit Coronomics das Fundament für die Zukunft der Wirtschaft. Seine Logik: Was zumacht, muss auch wieder aufmachen. Aber resistenter als zuvor! Stelter legt dar, wie wir uns jetzt für die Zukunft nach Corona aufstellen müssen. Das wirtschaftliche Umfeld wird ein anderes sein: Aktive Notenbanken, aktive Staaten, Abkehr von der Globalisierung. Die Rückkehr der Inflation droht. Dies verlangt andere Prioritäten: Investition statt Konsum. Echte Reformen von Staat und Gesellschaft. So kann eine alttestamentarisch anmutende Katastrophe der Schlüssel zu einer prosperierenden Zukunft für uns alle werden.
Vita
Dr. Daniel Stelter ist Bestseller-Autor und Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Forums beyond the obvious. Er ist Experte für Wirtschafts- und Finanzkrisen und berät internationale Unternehmen und Investoren zu den Herausforderungen der sich stetig wandelnden globalen Märkte.
Inhalt
Coronomics
Das Virus, das auf eine geschwächte Wirtschaft traf
Keine Rückkehr zum Trendwachstum vor der Krise
Anhaltender Rückgang des Produktivitätswachstums
Aggressivste geldpolitische Maßnahmen
Schulden, Schulden, Schulden!
Deutlicher Anstieg der Vermögenspreise
Zunahme und Abnahme der Ungleichheit
Gedämpfte Aussichten
Anfälliges Finanzsystem
Spekulation auf Kredit
Leverage hoch drei
Die Illusion von Sicherheit
Corona beendete die Party
Das Virus als ultimativer Schock
So wirkt das Virus auf die Wirtschaft
Eine solche Rezession gab es noch nie
Wir alle haben Schulden
Operativer und finanzieller »Leverage«
Ein Beispiel zum Anfassen
Künstliches Koma für die Wirtschaft
Die Politik setzt auf Liquiditätshilfen
Ein Systemwechsel als unvermeidliche Folge?
Ein künstliches Koma wäre die Lösung gewesen
Staatliche Umsatzausfallzahlung
Ein »gedankliches Koma« ist effektiv und effizient
Wer zumacht, muss auch wieder aufmachen
Szenarien für die Wiedereröffnung
Die Logik
Kosten versus Ertrag
Mit Schwung aus dem Koma
Wer soll das bezahlen?
Spare in der Zeit …
Unzureichende Investitionen
Deutschland will wieder sparen
Was nicht sein darf …
Wachstum und Populismus vereinbaren
Doch mehr Schulden?
Risikopatient Eurozone
Italien alleine
EU und Euro gingen geschwächt in die Krise
Kurze Erinnerung: Warum der Euro nicht funktioniert
Kurze Erinnerung: Warum die EU nicht funktioniert
Eine bessere EU als Antwort
Patient Euro mit falscher Medizin
Natürlich müssen wir solidarisch sein
Ein »Weiter so« wird nicht möglich sein
Neustart der Finanzordnung
Leben auf Pump
Japanische Verhältnisse für alle
Notenbanken in der Ecke
Radikale Ideen
Das Virus macht es möglich
Was wäre die Alternative?
Damit nicht genug
Neustart mit neuen Regeln
Deutschland vor der Corona-Krise
Es rumort in Deutschland
Überforderte Politik?
Lange Liste unangenehmer Themen
Symbolpolitik statt Ursachenbekämpfung
Neues Denken ist erforderlich
Deutschland hat die guten Jahre nicht genutzt
Die Krise als Chance für gesellschaftsverändernde Projekte?
Zehn tolle Jahre
Die Fitness nimmt ab
Unternehmen investieren nicht genug
CORONOMICS für Deutschland
Mitmachen!
Solidarisch zeigen
Ein Programm zur Konjunkturförderung
Investieren
Wachstumskräfte stärken
Effizienz steigern
Vermögen bilden und sichern
Existenzielle Weichenstellung
Corona als Katalysator für Wandel
Virus statt Krieg
Der Aufstieg Asiens
Weihnachten ist es vorbei?
Anmerkungen
Das Virus, das auf eine geschwächte Wirtschaft traf
Anfälliges Finanzsystem
Das Virus als ultimativer Schock
Künstliches Koma für die Wirtschaft
Wer zumacht, muss auch wieder aufmachen
Wer soll das bezahlen?
Risikopatient Eurozone
Neustart der Finanzordnung
Deutschland vor der Corona-Krise
Deutschland hat die guten Jahre nicht genutzt
Coronomics für Deutschland
Corona als Katalysator für Wandel
Coronomics
Das Corona-Virus hat Europa und die Weltwirtschaft fest im Griff. Die Pandemie hat eine dramatische Dynamik entwickelt. Wenn Sie dieses Buch in den Händen halten, hat die durch COVID-19 ausgelöste umfassende Gesundheits- und Wirtschaftskrise bereits neue Dimensionen angenommen. Hoffentlich liegt dann der Höhepunkt der Infektionswelle hinter uns und medizinische Therapien sind in Sicht oder gar schon in Anwendung.
Selbst wenn es zu einer raschen Erholung der wirtschaftlichen Lage kommt und wir schon in einigen Monaten wieder dieselbe Wirtschaftsleistung aufweisen wie vor der Krise, wird uns die Epidemie noch lange beschäftigen. Die ökonomischen Folgen des Corona-Schocks sind gravierend und sie werden andauern.
Vor allem werden sie eine neue Ära der Wirtschaftspolitik einläuten. Ich nenne sie »Coronomics«, ein Kunstwort aus den Wörtern »Corona«, dem Namen des Virus, und »Economics«, den Wirtschaftswissenschaften. Diese neue Wirtschaftspolitik wird das Jahrzehnt prägen und zu einem ganz anderen Umfeld führen, als wir es kennen. Die Inflation dürfte zurückkehren und die Staaten werden weitaus aktiver sein als in den letzten Jahren.
Dabei lag ein Politikwechsel ohnehin in der Luft. Auch ohne Virus war absehbar, dass die Weltwirtschaft auf erhebliche Probleme zusteuert. Das Virus hat diese Probleme schließlich nur beschleunigt und vergrößert. Alle Schwachstellen sehen wir nun wie unter einem Brennglas.
Viele Leser werden bei der Lektüre geschockt sein und ausrufen, dass man diese oder jene Maßnahme unmöglich hinnehmen oder gar unterstützen dürfe. Dem halte ich entgegen: Ich beschreibe hier, was unweigerlich auf uns zukommt und wie sich Länder aufstellen sollten, um in diesem Szenario die eigenen Interessen konsequent zu vertreten. Denn nur so können wir noch größeren Schaden abwenden – von unserem Land und unserer Wirtschaft und letztlich von Europa.
Coronomics wird kommen, ob wir wollen oder nicht.
Daniel Stelter
Berlin, April 2020
Das Virus, das auf eine geschwächte Wirtschaft traf
2019 war ein gutes Jahr. Zumindest an den Börsen. Nach Daten der Deutschen Bank konnte man als Kapitalanleger faktisch keine Verluste machen. Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, egal ob in den Industrieländern oder in den Schwellenländern – alles wies Gewinne auf. Ebenso stiegen der Goldpreis und der Preis von Öl. Die Wirtschaft wuchs, aber nicht zu schnell, um zu steigenden Zinsen zu führen. Ein ideales Umfeld für die Kapitalmärkte, die von Rekord zu Rekord eilten.
Die Welt feierte den längsten Aufschwung der Nachkriegsgeschichte und die Überwindung der Finanz- und Eurokrise. Auf den ersten Blick sah alles gut aus und man schaute optimistisch auf die kommenden Jahre. Doch diese Sicht trog. Denn die Wirtschaft und die Finanzmärkte waren keineswegs gesund. Warnzeichen häuften sich, dass die Welt nicht so rosig war, wie Politiker, Notenbanken und nicht zuletzt auch die Kapitalmärkte dachten. Nicht wenige Beobachter warnten vor neuen Exzessen an den Börsen und erwarteten eine Korrektur. Nur was der Auslöser sein würde, wussten sie natürlich nicht.
Keine Rückkehr zum Trendwachstum vor der Krise
Es lohnt, sich den Zustand der Weltwirtschaft vor der Corona-Krise vor Augen zu führen. Denn dann versteht man besser, weshalb das Virus so verheerend auf die Wirtschaft wirkte und noch wirkt, wie wir aus der Krise herauskommen und vor allem, was wir nach der Überwindung der Krise alles ändern müssen, um unser Wirtschaftssystem robuster aufzustellen und zukunftsfähig zu machen.
Dies beginnt mit dem Eingeständnis, dass wir zwar seit dem Höhepunkt der Finanzkrise 2009 eine lange wirtschaftliche Erholung erlebt haben, der Aufschwung aber im Vergleich mit früheren Erfahrungen nach Rezessionen enttäuschte. Die Wachstumsraten lagen deutlich unter dem Niveau in der Zeit vor der Finanzkrise. Ökonomen vergleichen dazu das sogenannte Trendwachstum – also die Entwicklung der Wirtschaft, wenn alles so weitergegangen wäre wie vor der Krise – mit der tatsächlichen Entwicklung. Die Differenz zeigt den Wohlstandsverlust durch die Krise und deren Folgen.1 Und diese sind erheblich.
Für die USA belief sich der Verlust auf rund vier Billionen US-Dollar, was rund 20 Prozent des laufenden Bruttoinlandsprodukts (BIP) entsprach. Das ist deshalb so ungewöhnlich, weil die US-Wirtschaft sich von allen vorangegangenen Rezessionen – inklusive der auf das Platzen der Dotcom-Blase 2000 folgenden – stets vollständig erholt hatte.
In der Eurozone sah es noch schlechter aus. Auf 3,5 Billionen Euro wird der sogenannte Output-Gap geschätzt, was relativ noch mehr als in den USA ist. Wenn man den Zeitraum seit dem Jahr 2000 betrachtet, muss man sogar zu dem Schluss kommen, dass sich die Eurozone – abgesehen von der kurzen Ausnahme der Jahre 2006 und 2007 – schon seit zwei Jahrzehnten im Niedergang befindet.
Ist Deutschland die Ausnahme? Nun, das denken nur wir Deutschen, weil wir in der Tat ein paar gute Jahre erlebt haben. Dieser relative Aufschwung wurde allerdings durch Sonderfaktoren erzeugt. Neben dem Boom in China, das für einen immer größeren Anteil unserer Exporte steht, waren es vor allem die niedrigen Zinsen und der schwache Euro, die unsere Wirtschaft antrieben.2 Trotzdem lag Ende 2019 in Deutschland das BIP um rund 700 Milliarden Euro unter dem Niveau, das sich bei einer Fortschreibung des Vorkrisentrends ergeben hätte.
Weitaus schlimmer stand es um Italien und Griechenland. Nachdem in Italien schon von 2000 bis 2009 das Wachstum gering war, hatte sich das Land bis Ende 2019 noch nicht von der Finanz- und Eurokrise erholt. Das BIP lag auf dem Niveau von 2002 – und das heißt: real gesehen fast 20 Jahre lang kein Wirtschaftswachstum! Verglichen mit dem Trend fehlten beeindruckende 1 000 Milliarden Euro, bei einem Ist-BIP von 1 600 Milliarden. Griechenland war das Extrembeispiel mit einer Lücke von 150 Milliarden, etwa 70 Prozent des Ist-BIP von 195 Milliarden. 2008 lag es noch bei 252 Milliarden.
Die Eurozone schien auf dem Weg in das eigene »japanische Szenario« zu sein, gekennzeichnet durch geringes Wachstum und deflationäre Tendenzen. Allen Bemühungen von Staat und Notenbank zum Trotz hat Japan es nämlich nicht geschafft, die Stagnation der letzten Jahrzehnte zu überwinden. Seit dem Platzen der Spekulationsblase Ende der 1980er-Jahre kämpft das Land mit den Folgen und leidet unter geringem Wachstum sowie geringer Inflation. Verstärkt wird diese Entwicklung durch den Rückgang der Erwerbsbevölkerung.
Ein Bild, das nichts Gutes für Europa verheißen sollte, wurden doch die Parallelen immer offenkundiger: geringes Wachstum, beginnender Rückgang der Erwerbsbevölkerung, geringe Inflationsraten. Ökonomen sprechen hier von »säkularer Stagnation«, andere nennen es »Eiszeit«.3
Natürlich kann man nicht mit Sicherheit behaupten, dass es ohne Finanz- und Eurokrise weitergegangen wäre wie zuvor. Die Berechnungen bleiben immer nur modellhaft. So kann beispielsweise die Erwerbsbevölkerung mehr oder weniger wachsen und dementsprechend auch die Wirtschaft. Unstrittig ist jedoch, dass die letzten zehn Jahre im Hinblick auf das Wirtschaftswachstum enttäuscht haben – weltweit, aber auch und vor allem in der Eurozone.
Wachstumslokomotive der Welt war China. Lag der Anteil des Landes am weltweiten Bruttoinlandsprodukt 2008 noch bei rund acht Prozent, so stieg er innerhalb von nur zehn Jahren auf 18 Prozent. Mehr als 50 Prozent des Wachstums der letzten Jahre stammten aus China, welches entscheidend dazu beitrug, die Krise zu überwinden. Trotzdem mehrten sich im Jahr 2019 die Anzeichen, dass die Wachstumsrate auch in China abnahm. Dies lag vor allem daran, dass China die enorme Entwicklung der letzten zehn Jahre mit einem beträchtlichen Anstieg der Verschuldung erkauft hatte. Lag die Verschuldung von Unternehmen, privaten Haushalten und Staat im Jahr 2008 noch bei unter 150 Prozent des BIP, so näherte sich dieser Wert 2019 der Marke von 280 Prozent. Die Staatsführung hatte das Problem der steigenden Verschuldung erkannt und erklärte, die Abhängigkeit der Wirtschaft von immer mehr Schulden reduzieren zu wollen.
Die Weltwirtschaft stand vor einer Abkühlung und die deutsche Wirtschaft spürte das bereits. Der Industriesektor und damit das ganze Land schrammten 2019 nur knapp an einer Rezession vorbei.
Anhaltender Rückgang des Produktivitätswachstums
Ein wichtiger Grund für den Rückgang des weltweiten Wachstums war die Fortsetzung des schon länger bestehenden Trends eines immer geringeren Produktivitätswachstums. Die sogenannte Total Factor Productivity (TFP) – die Relation von gesamtwirtschaftlicher Leistung zum Einsatz von Arbeit und Kapital – wuchs von 2010 bis 2019 nur um 0,7 Prozent. Dabei ist diese unbefriedigende Produktivitätsentwicklung nicht nur ein Problem der Industrieländer, sondern vor allem auch der Schwellenländer. Im Mittleren Osten und in Lateinamerika ist die Produktivität nach Daten des US-Think-Tanks Conference Board sogar gefallen. Wir haben es also mit einem globalen Phänomen zu tun.
Der einsetzende demografische Wandel – die Stagnation oder gar das Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung – und der Rückgang der Produktivitätsfortschritte erklären rund 80 Prozent des Wachstumsrückgangs in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Japan seit 2007.4 Dabei sollten wir es nicht als Trost empfinden, dass wir mit dieser Entwicklung nicht alleine dastehen. In den 1970er-Jahren betrug der jahresdurchschnittliche Anstieg der Stundenproduktivität in Deutschland noch fast vier Prozent, in den acht Jahren seit 2011 waren es nur noch 0,9 Prozent.5 In den letzten Jahren ist das Produktivitätswachstum auf null gefallen. Nach einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) stagniert die Wirtschaftsleistung pro Arbeitnehmer hierzulande seit Jahren und ist niedriger als vor der Finanzkrise.6
Man kann die Bedeutung der Produktivität gar nicht genug betonen. Jeder Wohlstandszuwachs setzt eine steigende Produktivität voraus. Fehlt diese, so kommt es zu Verteilungskonflikten, Frustration und politischen Spannungen. Vor allem fehlt dann den Gesellschaften die Kraft, die vielen ungelösten Fragen vom Kampf gegen den Klimawandel bis zur Finanzierung des Sozialstaats zu lösen.
Aggressivste geldpolitische Maßnahmen
Die Entwicklung der Geldpolitik ist das wohl alarmierendste Zeichen dafür, dass in den zehn Jahren seit der Finanzkrise etwas nicht richtig gelaufen ist. Seit 2009 sind die Bilanzen der Notenbanken der westlichen Welt von unter vier Billionen US-Dollar auf mehr als 16 Billionen US-Dollar explodiert. Die Zinsen sind deutlich zurückgegangen. Praktisch überall lagen sie Ende 2019 unter dem Niveau von vor zehn Jahren. Zwischenzeitliche Versuche, das Zinsniveau anzuheben, scheiterten rasch. Immer wieder waren die Notenbanken gezwungen, die Zinsen zu senken und das Ausweiten der Bilanzen fortzusetzen.
Nimmt man die zehnjährigen Staatsanleihen als Maßstab, so ergibt sich in der gesamten westlichen Welt ein ähnliches Bild. Die Zinsen lagen direkt nach der Finanzkrise bereits auf einem niedrigen Niveau. Trotzdem tendierten sie noch weiter nach unten. Fast überall auf der Welt waren sie Ende 2019 auf dem niedrigsten Stand – ein Ergebnis der Geldpolitik, aber auch ein Zeichen dafür, dass die Kapitalmärkte keine Hoffnung auf ein zukünftig höheres Wachstum hatten. Insbesondere die Eurozone ragte negativ heraus. Gab es 2009 für deutsche Staatsanleihen noch 3,37 Prozent und für französische 3,41 Prozent, so erbrachten beide mit negativen Zinsen Ende 2019 weniger als japanische Anleihen. Derart geringe Nominalzinsen hatte es in den letzten 5000 Jahren noch nie gegeben.7
Offiziell ging es den Notenbanken darum, deflationäre Gefahren abzuwenden und die Inflationsraten nach oben zu treiben. Gelungen ist das nicht. Im Gegenteil – wir müssen konstatieren, dass die Wirtschaft trotz massiver geldpolitischer Stimulation nicht an Fahrt aufnahm. Man kann es sich wie ein voll beladenes Flugzeug vorstellen, das trotz maximalen Triebwerksschubs nicht in der Lage ist, richtig an Höhe zu gewinnen. Das kleinste Luftloch kann da schon zu einem Absacken führen, was ziemlich rasch gefährlich wird.
Schulden, Schulden, Schulden!
Beladen ist das Flugzeug »Weltwirtschaft« mit einer Überlast an Schulden. Seit Mitte der 1980er-Jahre wachsen in der westlichen Welt die Schulden deutlich schneller als die Wirtschaft. Zunächst haben die Politiker die privaten Haushalte ermuntert, höhere Schulden aufzunehmen, um über die Folgen stagnierender Einkommen hinwegzutäuschen. Schon bald führten die anhaltend sinkenden Zinsen zu einem allgemeinen Trend zu höherer Verschuldung. Diese Entwicklung wurde durch die Notenbanken angeheizt, die auf jede Turbulenz an den Finanzmärkten – vom Börsenkrach 1987 bis zur Finanzkrise 2009 – und jede Rezession in der Realwirtschaft immer mit einer Verbilligung des Geldes reagiert hatten, ohne nach der Intervention das Geld wieder ausreichend zu verteuern. Diese »asymmetrische Reaktion«, so die Beschreibung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), hat zwar geholfen, bestehende Schulden tragbarer zu machen, zugleich aber noch mehr Verschuldung und Risiken mit sich gebracht. Die Schuldner waren immer fester davon überzeugt, dass ihnen nichts mehr passieren könne.
2009 sah es so aus, als wäre diese Politik an ihrem Ende angelangt und es käme zur unausweichlichen Krise. Die Märkte brachen ein, denn bei immer mehr Schuldnern war es fraglich, ob sie überhaupt noch ihren Verbindlichkeiten nachkommen konnten. Nur mit nochmaligen massiven Interventionen gelang es den Notenbanken und Staaten, einen Kollaps des Finanzsystems und eine neue große Depression zu verhindern.
Dabei waren die Maßnahmen der Notenbanken seit 2009 – Aufkauf von Wertpapieren in Billionenhöhe und Senken der Zinsen bis nahe oder unter null (Japan, Eurozone) – nichts anderes als die Fortsetzung der vorangegangenen asymmetrischen Politik. Und sie hatten genau dieselben Nebenwirkungen: steigende Verschuldung und noch höhere Risiken. Nach Daten des Institute of International Finance stieg die globale Verschuldung im dritten Quartal 2019 mit 253 Billionen US-Dollar auf ein Allzeithoch von 322 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (siehe Abbildung 1).
William White, früherer Chefvolkswirt der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, der Notenbank der Notenbanken, und einer der wenigen, die die Finanzkrise frühzeitig vorhergesagt hatten, kritisiert diese Politik der Notenbanken schon lange. Aus seiner Sicht legen die Notenbanken mit ihren Maßnahmen »die Grundlage für den nächsten Zyklus aus Boom und Crash, getrieben von immer lascheren Kreditvergabestandards und immer mehr Verschuldung«. Also eine Abfolge von künstlich angeheizten Aufschwüngen an den Finanzmärkten und in der Wirtschaft, gefolgt von immer tieferen Abstürzen, die wiederum mit dem Absenken der Kreditvergabestandards und noch höherer Verschuldung bekämpft werden.8
Auf die Realwirtschaft hatte diese Politik jedoch immer weniger Wirkung. Wie gezeigt, war der Aufschwung in den USA und in Europa seit der Finanzkrise zwar einer der längsten, aber zugleich der schwächste nach dem Zweiten Weltkrieg. Überall liegt das tatsächliche Bruttoinlandsprodukt unter dem Wert, den man bei einer Fortschreibung des Vorkrisentrends erwartet hätte.
Abb. 1: Weltweite Verschuldung auf Rekordniveau
Quelle: IIF, © FT
Deutlicher Anstieg der Vermögenspreise
Die geringe Wirkung der neuen Schulden auf das Wachstum der Realwirtschaft hatte einen einfachen Grund. Das Geld wurde nicht produktiv genutzt, also beispielsweise dazu, um neue Produkte zu entwickeln und neue Anlagen zu bauen, sondern es wurde zum Kauf vorhandener Vermögenswerte wie Aktien und Immobilien eingesetzt. So hat sich das Kursniveau an der US-Börse in den zehn Jahren bis Ende 2019 mehr als verdoppelt, ebenso jenes an der japanischen Börse. China lag trotz zweier zwischenzeitlich geplatzter Blasen fast ebenso gut. In der Eurozone lagen die Börsen allerdings trotz 50 Prozent Kursanstieg immer noch unter früheren Höchstständen.
Auch die Immobilienpreise stiegen weltweit: nach Zahlen der BIZ9 seit 2010 in den Industrieländern um 33 Prozent, in den Schwellenländern um 60 Prozent. Nach Regionen: Eurozone (+15 Prozent), Japan (+15 Prozent), Dubai (+31 Prozent), Thailand (+31 Prozent), Australien (+32 Prozent), China (+35 Prozent), Brasilien (+51 Prozent), USA (+51 Prozent), Kanada (+60 Prozent). In den Wirtschaftszentren war der Preisanstieg noch deutlicher. In London, den meisten anderen europäischen Hauptstädten, New York, Boston, Los Angeles, San Francisco, Sydney, Melbourne und Vancouver wurden Immobilien besonders teuer.
Nirgendwo macht sich das billige Geld so sehr bemerkbar wie am Markt für Immobilien. Verwundern kann das nicht. Trifft doch ein fast unbeschränkt herstellbares Gut, das Geld, auf ein knappes Gut, die Immobilie. Für nichts geben Banken so gerne Kredit wie für die vermeintlich sichere Anlage in Immobilien.
Zunahme und Abnahme der Ungleichheit
So verwundert es nicht, dass die Ungleichheit in den meisten Ländern zunimmt. Global gesehen sind die Armutsraten in den letzten zehn Jahren gefallen. Der Anteil der Menschen, die in absoluter Armut leben – definiert als Einkommen von weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag –, sank von 5,4 Prozent auf 3,1 Prozent. Das dürfte der niedrigste Wert in der Geschichte der Menschheit sein und bedeutet ein besseres Leben für Hunderte Millionen Menschen. In Ostasien ging der Wert von 3,8 auf 0,5 Prozent zurück, in Lateinamerika von 2,8 auf 1,3 in Südasien von 6,6 auf 3,0 und in Afrika (südlich der Sahara) von 5,7 auf 3,1 Prozent. Nur im Mittleren Osten / Nordafrika stieg die Quote von 0,5 auf 1,0 Prozent. Das stellt in Anbetracht der Migration für Europa ein Problem dar.
In der westlichen Welt war das anders. Die Ungleichheit der Einkommen vor der Umverteilung nahm zu. Während einige Länder wie Deutschland und Frankreich durch erhebliche Umverteilung korrigierend eingreifen, erfolgt das beispielsweise in den USA und Großbritannien weniger. Damit setzte sich ein Trend fort, den wir schon seit Jahren kennen. Die Einkommen der Unter- und Mittelschicht bleiben infolge der Globalisierung unter Druck. Dadurch geht einerseits die globale Armut zurück, andererseits aber driften die Einkommen in den Industrieländern weiter auseinander.
Noch deutlicher war diese Entwicklung bei den Vermögen. Hier wirkte das billige Geld der Notenbanken besonders stark, wie wir gesehen haben. Naturgemäß profitieren von einem Anstieg der Vermögenspreise nur jene, die Vermögen haben, weshalb die Ungleichheit der Vermögensverteilung weiter zunahm. Damit setzte sich ein Trend fort, der seit Mitte der 1980er-Jahre besteht: auf der einen Seite steigende Schulden, auf der anderen steigende Vermögenspreise.
Beides steht in einem engen Zusammenhang. Schulden erlauben den Kauf vorhandener Vermögenswerte zu immer höheren Preisen, und die gestiegenen Vermögenspreise wiederum ermöglichen eine höhere Verschuldung. Da zugleich das Geld immer billiger und die Kreditvergabe immer laxer wurde – geringere Eigenkapitalanforderungen –, haben wir es mit einem sich selbst verstärkenden Prozess zu tun. Mit dem impliziten Versprechen der Notenbanken, bei Problemen rettend einzugreifen, wurden immer größere Risiken eingegangen. Vor allem Immobilienpreise gingen in die Höhe.10
Kein Wunder, dass wir vor diesem Hintergrund in den letzten zehn Jahren einen deutlichen Anstieg des Zuspruchs zu populistischen Anti-Establishment-Parteien erleben. Auswertungen zeigen, dass der Zuspruch zu diesen Kräften so groß ist wie zuletzt in den 1930er-Jahren.11 Die Wahl Donald Trumps und das Brexit-Votum werden zu einem erheblichen Teil auf diese wirtschaftlichen Umstände zurückgeführt.
Klaus Schwab, Gründer und Chairman des Weltwirtschaftsforums in Davos, sagte 2019: »Wir müssen uns jetzt um die Verlierer kümmern, um jene, die zurückgeblieben sind. Wenn wir von der nächsten Phase der Globalisierung reden, dann muss diese inklusiver und nachhaltiger sein.«12 In der Tat hat die Erholung seit der Finanzkrise die Probleme vergrößert.
Gedämpfte Aussichten
Ende 2019 blickten wir auf enttäuschende zehn Jahre zurück: geringes Wachstum, trotz massiver Interventionen der Notenbanken, weiter steigende Verschuldung, Vermögensblasen und zunehmende Ungleichheit. Zugleich mehrten sich die Anzeichen, dass die nächste Rezession nahte. China schwächelte und die Eurozone blieb auf dem Weg in die säkulare Stagnation.
Kein Wunder, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) skeptisch auf 2020 blickte: »Die Aktivität in der Industrie ist deutlich zurückgegangen, auf ein Niveau, welches wir seit der Finanzkrise nicht mehr gesehen haben. Internationale Spannungen und Handelskonflikte führen zu Unsicherheit über die Zukunft des Welthandels und die internationale Zusammenarbeit und dämpfen Zuversicht und Investitionen. Der Ausblick bleibt schlecht.«13
Ähnlich äußerte sich die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD), die für 2019 ein globales Wachstum von nur 2,9 Prozent erwartete und forderte: »(…) wir brauchen dringend koordiniertes politisches Handeln, um das Vertrauen wieder herzustellen, das Wachstum zu stärken und den Lebensstandard zu erhöhen; der Welthandel stagniert und dämpft die wirtschaftliche Aktivität in fast allen führenden Wirtschaften; politische Unsicherheit reduziert Investitionen, künftige Arbeitsplätze und Einkommen. Die Risiken für noch geringeres Wachstum sind erheblich, wie verstärkte Handelskriege, geopolitische Spannungen, die Möglichkeit eines schärfer als erwarteten Rückgangs in China und der Klimawandel.«14
Und dann kam das Corona-Virus. Es traf auf eine geschwächte Wirtschaft, die schon längst auf dem Weg in eine Rezession war.
Anfälliges Finanzsystem
Die Party an den Finanzmärkten dauerte bis in den Januar 2020. Obwohl aus dem fernen China verstörende Bilder von abgeriegelten Städten und Menschen in Schutzkleidung über die Bildschirme in aller Welt liefen, erreichten die Börsen in den USA und in einigen anderen Regionen neue Höchststände.
Die Börsianer waren davon überzeugt, dass es schon nicht so schlimm werden würde. Die chinesische Wirtschaft würde sich rasch erholen und schon im Sommer wäre alles vergessen. Ökonomen sprechen in solchen Fällen von einem »V«, also einem tiefen Einbruch, dem eine rasche Erholung folgt. So war es bei SARS, bei der Hongkong-Grippe von 1958 und selbst bei der Spanischen Grippe 1918. Warum sollte es heute anders sein?1 Und selbst wenn es etwas länger dauern würde, stünden die Notenbanken mit weiterem und noch billigerem Geld bereit, um die Wirtschaft – und natürlich vor allem die Kapitalmärkte – erneut zu retten. So wie immer in den letzten 30 Jahren. Angesichts der damit absehbaren Flut billigen Geldes gab es aus der Sicht der Börsianer nur eines: Aktien kaufen.
Spätestens als das Virus Italien fest im Griff hatte und es offensichtlich geworden war, dass es nicht bei einem regionalen chinesischen Ereignis bleiben würde, stieg die Nervosität. Die Märkte kamen ins Rutschen. Nicht mehr das »V« stand im Raum, sondern eher ein »U«, also eine längere Durststrecke. Und auch das Szenario eines »L«, eines Absturzes, von dem man sich so schnell nicht wieder erholt, war nicht mehr unwahrscheinlich. Das Ergebnis wäre in jedem Fall ein nochmaliger Rückgang des ohnehin schon enttäuschenden Wachstums.
Spekulation auf Kredit
Das Finanzsystem war keineswegs so robust, wie uns Politiker und Notenbanker nach der Finanzkrise weismachen wollten. Zwar gab es einige Reformen, um die Krisenanfälligkeit von Banken zu reduzieren, doch haben diese zum Teil eine krisenverstärkende Wirkung. Außerdem haben sie an der eklatanten Kapitalschwäche des Bankensystems – gerade in Europa – nichts geändert. Schon lange vor dem Corona-Schock bewerteten die Märkte europäische Banken an der Börse mit weniger als der Hälfte ihres Buchwertes, fast so schlecht wie im Jahr 2012 auf dem Höhepunkt der Eurokrise.2 Was nichts anderes bedeutet, als dass die Aktionäre den Zahlen der Banken nicht trauten und die Geschäftsaussichten als schlecht einschätzten.
Ein noch größeres Problem stellte die immer höhere Verschuldung des Gesamtsystems dar. Ökonomen sprechen von »Leverage«, also dem Einsatz eines »Hebels«. Dieser Hebel dient dazu, die Rendite des eingesetzten Kapitals zu erhöhen. Das folgende Beispiel soll helfen, das zu erklären:
Nehmen wir an, Sie könnten sich eine Aktie zu 100 Euro kaufen, die eine sichere Dividende von zehn Euro pro Jahr abwirft. Setzen Sie für den Kauf nur Eigenkapital ein, so erzielen Sie eine Rendite von zehn Prozent. Attraktiver wäre es, sich 100 Euro von der Bank zu leihen und gleich zwei Aktien zu kaufen. Gibt die Bank sich mit fünf Prozent Zinsen zufrieden, so gehen fünf Euro an die Bank und 15 Euro bleiben bei Ihnen. Das ergibt eine Rendite von 15 Prozent. In der Praxis dürfte die Bank noch großzügiger sein und sich mit nur 20 Prozent Eigenkapital zufriedengeben. Sie können sich also zu Ihren 100 Euro noch 400 Euro von der Bank leihen und fünf Aktien kaufen. Von den 50 Euro Dividende gehen dann 20 Euro an die Bank (fünf Prozent von 400 Euro) und Ihnen blieben 30 Euro! Eine Rendite von 30 Prozent auf das eingesetzte Eigenkapital.
Nun merken auch andere, was für ein gutes Geschäft das ist, und geben sich mit Renditen von weniger als 30 Prozent zufrieden, zahlen also mehr für die Aktie. Steigt der Kurs auf 140 Euro, so haben Sie nicht nur einen schönen Kursgewinn erzielt, sondern wieder erheblich mehr Eigenkapital. Ihre zur Beleihung zur Verfügung stehende »Margin« erhöht sich dadurch auf 300 Euro (100 Euro plus 200 Euro Kursgewinn). Zwar ist die Dividendenrendite von zehn auf sieben Prozent gefallen, doch liegt sie damit weiterhin über dem Zinssatz der Bank. Sie leihen sich weitere 840 Euro und kaufen dazu. Dann haben Sie elf Aktien im Wert von 1 540 Euro und Schulden von 1 240 Euro. Die Rendite auf Ihr Eigenkapital von 300 Euro sinkt zwar auf 16 Prozent, der Gesamtüberschuss (Dividende minus Zinsen) wächst allerdings von 30 auf 48 Euro.
Es lohnt sich, mehr Schulden aufzunehmen, solange die Dividendenrendite über dem Zinssatz der Bank liegt.
Leverage macht, wie gezeigt, sehr viel Spaß auf dem Weg nach oben. Er ist auch die treibende Kraft hinter der bereits dargestellten Zunahme der Vermögen seit 1980. Kommt noch der Eindruck hinzu, dass die Notenbanken immer intervenieren, wenn es Probleme gibt, und Geld billig zur Verfügung stellen, so geht man erst recht höhere Risiken ein. Genau dies hat in die Finanzkrise geführt und genau dies haben wir in den letzten zehn Jahren befördert.
Das Spiel funktioniert aber nur, solange der Anstieg des Preises des auf Kredit gekauften Vermögensgegenstandes – Anleihe, Aktie, Immobilie, Kunstwerk oder Ähnliches – über den Finanzierungskosten (Zins) liegt. Stockt der Preisanstieg und/oder steigen die Finanzierungskosten, so wird es gefährlich. Die Kreditgeber verlangen mehr Sicherheiten, man spricht von einem sogenannten Margin Call. Innerhalb einer – meist sehr kurzen – Frist muss der Schuldner den Eigenkapitalanteil wieder auf das vereinbarte Niveau hochhieven. Kann er das nicht, so werden die Vermögenswerte zwangsverkauft. Sobald solche Verkäufe einsetzen, fallen die Preise schneller und bringen weitere Investoren unter Druck. Der Preisverfall gewinnt an Geschwindigkeit. Es crasht.