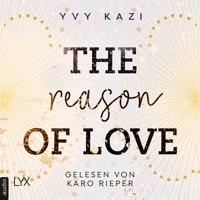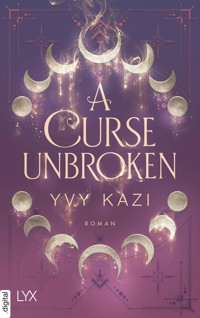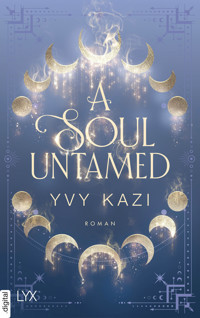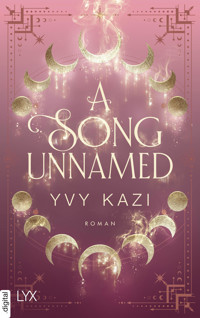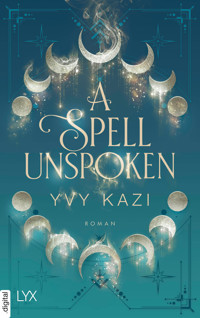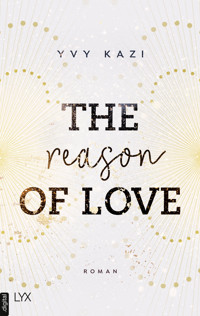3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben stellt dich ständig vor die Wahl. Welche Entscheidung triffst du? Nach ihrem bestandenen Abitur möchte Anabelle einfach nur den Hamburger Spätsommer zusammen mit ihrem Hund Smoothie genießen. Die Frage was, wann oder ob sie studieren möchte, hat für sie gerade keine Priorität. Doch Anabelles Vater hat andere Vorstellungen für seine Tochter. Ein Jahr gibt er ihr Zeit, dann will er ihr das großzügige Taschengeld streichen. Deshalb kommt der Job in einer Werbeagentur für Anabelle gerade recht. Besonders mit ihrem Teampartner Adrian versteht sie sich super und das auch außerhalb des Büros. Aber eine Beziehung zwischen Kollegen, das kann nicht gut gehen! Und als dann auch noch herauskommt, dass Adrian der Sohn des Agenturchefs ist, fangen die Probleme erst so richtig an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Crazy Kind of Love
Die Autorin
Frei nach dem Motto „Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten“ studierte Yvy Kazi Grafikdesign und Illustration. Sie liebt Spaziergänge durch grüne Wälder und an stürmischer See. Die dabei gesammelten Eindrücke bestäubt sie mit einer Prise Augenzwinkern und einer Portion Kreativität, um die Leser*innen für einen Moment aus dem Alltag zu entführen.
Das Buch
Nach ihrem bestandenen Abitur möchte Anabelle einfach nur den Hamburger Spätsommer zusammen mit ihrem Hund Smoothie genießen. Die Frage was, wann oder ob sie studieren möchte, hat für sie gerade keine Priorität. Doch Anabelles Vater hat andere Vorstellungen für seine Tochter. Ein Jahr gibt er ihr Zeit, dann will er ihr das großzügige Taschengeld streichen. Deshalb kommt der Job in einer Werbeagentur für Anabelle gerade recht. Besonders mit ihrem Teampartner Adrian versteht sie sich super und das auch außerhalb des Büros. Aber eine Beziehung zwischen Kollegen, das kann nicht gut gehen! Und als dann auch noch herauskommt, dass Adrian der Sohn des Agenturchefs ist, fangen die Probleme erst so richtig an.
Yvy Kazi
Crazy Kind of Love
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinNovember 2019 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019Umschlaggestaltung:zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © privat
E-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-95818-531-9
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
1. August / Mittwoch
29. September / Samstag
1. Oktober / Montag
2. Oktober / Dienstag
5. Oktober / Freitag
6. Oktober / Samstag
8. Oktober / Montag
9. Oktober / Dienstag
10. Oktober / Mittwoch
11. Oktober / Donnerstag
19. Oktober / Freitag
20. Oktober / Samstag
21. Oktober / Sonntag
22. Oktober / Montag
23. Oktober / Dienstag
25. Oktober / Donnerstag
26. Oktober / Freitag
27. Oktober / Samstag
29. Oktober / Montag
31. Oktober / Mittwoch
01. November / Donnerstag
02. November / Freitag
06. November / Dienstag
12. November / Montag
19. November / Montag
24. November / Samstag
21. Mai / Dienstag
Leseprobe: Pieces of my Heart
Empfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1. August / Mittwoch
Widmung
Für JEDEN,der heute ein EICHHÖRNCHENUnd ein ERDBEEREIS brauchen könnte.
1. August / Mittwoch
Einatmen. Ausatmen. Ich stehe an der großen Fensterfront, lasse den Blick zum Wasser hinausschweifen und beobachte, wie die goldenen Sonnenstrahlen über die bleifarbenen Wellen der Elbe tanzen. Ich liebe diese Aussicht. Sie lässt mich aufatmen und mein Herz schneller schlagen. Sie schreit nach Freiheit und Unendlichkeit – und trotzdem werde ich sie freiwillig durch den Anblick eines tristen Parkplatzes ersetzen.
Tausche: weitläufige Penthouse-Wohnung in der HafenCity gegen winziges WG-Zimmer an der Schanze.
Grund: vollkommen irrationaler Anfall von Hilfsbereitschaft.
Es klingt vermutlich ebenso absurd, wie es sich in diesem Moment anfühlt.
Ich zucke zusammen, als es an der Haustür klingelt. Endlich. Schnellen Schrittes gehe ich zur Wohnungstür hinüber, bestätige mit einem Fingerdruck die Anfrage der Eingangstür und gebe den Fahrstuhl frei, ehe ich die schwere Feuerschutztür öffne, die die Wohnung vom Fahrstuhl trennt. Fahrstühle, die in Wohnungen enden, sind eine nette Idee, allerdings nicht in einem Land, in dem es für alles Regeln, Gesetze und Verordnungen gibt. Sprich: Keine im Wohnzimmer endenden Fahrstühle in Deutschland. Nehmt das, ihr hippen Architekten! Brandschutzbestimmungen! So endet der Fahrstuhl in einem Vorflur, direkt vor einer ebenso undekorativen wie massiven Metalltür.
Ungeduldig warte ich auf den Wohnungsinteressenten, für den Zeit offensichtlich keine Bedeutung hat. Er kommt fast eine halbe Stunde zu spät. Als sich die Fahrstuhltüren öffnen, beschließe ich, auf meinen Vortrag über die Existenz von Armbanduhren zu verzichten. Ich bin mir sicher, dass er sinnlos wäre. Dem goldenen Wecker am Handgelenk des Fremden nach besitzt er durchaus eine Uhr und ist trotzdem nicht gewillt, pünktlich zu sein.
»Wow«, ist das erste Wort, das er hervorbringt. Da er an mir vorbeistarrt, gilt es wohl eher der Aussicht als meiner Erscheinung.
Ich deute ihm einzutreten, dabei lädt er sich ohnehin gerade selbst ein.
Er schreitet an mir vorbei und schließlich durch die offene Küche. An der Fensterfront bleibt er stehen.
»Guten Abend«, entgegne ich provokativ höflich und lasse die schwere Tür ins Schloss fallen.
Der Fremde zuckt nicht einmal zusammen, schiebt sich lässig eine Sonnenbrille in die platinblonden Haare und dreht sich halb zu mir herum. Er sieht sehr viel jünger aus, als ich erwartet hätte. Nicht einmal wie Mitte zwanzig.
Wir mustern uns einen Moment lang gegenseitig, wie zwei Hunde, die sich zum ersten Mal im Park begegnen: Auf der Lauer und noch nicht ganz sicher, ob Zähne zeigen oder mit dem Schwanz wedeln, das Signal der Wahl ist. Das Auffälligste an dem Fremden sind definitiv seine eisblauen Augen. Wenn wir zwei Hunde sind, ist er eindeutig der Typ Husky. Der Rest von ihm ist eine Mischung aus Gucci und Lacoste. Seine Schuhe sind ebenso sorgfältig poliert, wie sein Gesicht glattrasiert ist. Ohne zu fragen, legt er eine lederne Dokumentenmappe auf dem Esstisch ab, als wäre er hier bereits zuhause. Anfang zwanzig scheint mir recht jung für jemanden zu sein, der eine Wohnung mieten möchte, die pro Monat 2.400 Euro kalt kosten soll. Andererseits hat ihm gerade eine Zwanzigjährige die Tür geöffnet. Wir sind in Hamburg. Vielleicht hat er wie ich einen reichen Papi, vielleicht ist er Mitbegründer eines erfolgreichen Start-ups. Wer weiß das schon? In dieser Stadt ist alles möglich.
»Sie sind A.B.?«, fragt er und versucht sichtlich angestrengt, mir in die Augen zu sehen, statt sich von meinem kurzen Sommerkleid ablenken zu lassen. Da mein Körper keine nennenswerten Rundungen zu bieten hat, sind meine langen Beine alles, was sich zu zeigen lohnt. Davon abgesehen ist es nicht nur für hamburgische Verhältnisse recht warm heute.
»Anabelle Birnbach«, bestätige ich und mache eine ausladende Geste. »Was Sie hier sehen, ist der Eingang zu einem lichtdurchfluteten Traum auf 165 Quadratmetern mit beeindruckender Aussicht, Balkon und eigener Dachterrasse. Wie Sie vielleicht merken, ist das gesamte Gebäude klimatisiert.«
Er sieht mich einen Moment irritiert an, ehe er seine Lippen zu einem gelangweilten Lächeln verzieht. »Ganz die Tochter Ihres Vaters?«
Ich zucke mit einer Schulter. Irgendetwas muss ich ja von ihm geerbt haben, sein Charisma ist es in jedem Fall nicht. Mein Vater hat diese Fähigkeit, einen ganzen Raum mit seiner Präsenz zu erfüllen. Er kann einem Millionär einen Schuhkarton als Luxusimmobilie verkaufen, wenn er will.
»Wenn Sie mir folgen würden«, bitte ich und umrunde eine Küchenzeile, um in das offene Wohnzimmer hinüberzugehen. Meine Sandalen verursachen unangenehme Geräusche, die auf dem Steinboden wie eine Mischung aus Flipflops und Pferdehufen klingen. Flipp-Klock. Flipp-Klock. Es sind eindeutig die falschen Schuhe für eine Wohnungsführung. Hamburg hingegen zeigt sich von seiner besten Seite, schafft es tatsächlich, kurz den Vorhang aus grauen Wolken beiseitezuschieben, um der Glasfront zu ihrem Starauftritt zu verhelfen. Goldenes Sonnenlicht flutet in den Wohnraum, lässt den steinernen Boden glänzen und verleiht den modernen Möbeln einen weichen Glanz. Graue Betonwände treffen auf ein schwarzes Ledersofa in U-Form.
»Wie in der Anzeige geschrieben, wird die Wohnung möbliert vermietet«, setze ich meinen Vortrag fort und lasse den Fremden nicht aus den Augen, der sich von der Wohnung bisher wenig beeindruckt zeigt.
Er lässt den Blick durch die bodentiefen Fenster hinausschweifen, gönnt dem Balkon zwei Sekunden seiner Aufmerksamkeit, ehe er zu einer Treppe hinübersieht, die vom Wohnzimmer zu einer Galerie hinaufführt.
»Sie können von dort oben auf eine Dachterrasse hinausgehen. 60 Quadratmeter, die zu Ihrer alleinigen Verfügung stehen«, ergänze ich. Auch davon zeigt er sich nicht fasziniert, stattdessen streicht er mit einer Hand über das schwarze Leder des mitten im Raum stehenden Sofas.
»Ich nehme an, Sie gehören nicht mit zur Ausstattung?«, fragt er in einem provozierenden Tonfall, der mir einzig und allein ein Seufzen entlockt.
»Ich fürchte, Frauen müssen Sie sich anderweitig kaufen. Die sind leider nicht in der Ausstattung inbegriffen. Haustiere sind erlaubt, zumindest solange sie sich benehmen und nicht die Tapeten von den Wänden reißen.« Das war ein Witz, es gibt in dieser Wohnung keine Tapeten.
»Mein Bruder hat es nicht sonderlich mit Tieren.« Er lässt vom Sofa ab, schlendert langsam zu mir herüber und schiebt sich lässig die Hände in die Taschen seiner dunkelblauen Stoffhose. »Wir hatten mal ein Aquarium. Es endete eher unerfreulich – für alle Beteiligten.«
»Diese Wohnung ist nicht WG-geeignet«, werfe ich ein. Es gibt nur ein richtiges Schlafzimmer, der Rest der Wohnung besteht aus offenem Wohnraum und der ebenso offenen Galerie.
»Mein Bruder wird alleine einziehen«, verspricht er. Ein flüchtiges Lächeln huscht über sein Gesicht. »Es sei denn, er hat sich in Berlin einen Goldhamster zugelegt, von dem ich noch nichts weiß.«
Als er nur eine Armlänge von mir entfernt stehen bleibt, sehe ich zweifelnd zu ihm auf. Was soll das werden?
»Möchten Sie das Badezimmer sehen?«, biete ich hilfsbereit an und kann mich nur mühsam zusammenreißen nicht zurückzutreten. Er hat hier offensichtlich etwas falsch verstanden, denn statt der Wohnung begutachtet er nun mein Sommerkleid, dann meine Sandalen. Seine Nähe macht mich zunehmend nervös. Ich weiß nicht, warum.
»Ich denke, ich habe genug gesehen«, lehnt er ab, als seine Augen die Rundreise beenden. »Ich nehme sie.«
Ich ziehe zweifelnd eine Augenbraue hoch. Ist das sein Ernst? Er hat nicht einmal die Hälfte der Wohnung besichtigt. Was ist mit dem Schlafzimmer? Dem Badezimmer? Der Terrasse?
»Meinem Bruder wird gefallen, was ich sehe«, versichert er, doch statt sich umzusehen, gilt sein Blick einzig und allein den Sommersprossen auf meinem Nasenrücken. »Unser Geschmack ist ziemlich ähnlich.«
»Versuchen Sie gerade, mit mir zu flirten?«, frage ich zweifelnd und blinzele ihn sehr unelegant an. Es dauert zwei Sekunden, bis er zu lachen beginnt. Sehr laut, sehr lange und sehr falsch. Das ist seine Antwort? Er lacht mich aus? Diese Besichtigung wird sekündlich unangenehmer.
Er räuspert sich, fährt mit einer Hand durch seine Haare, streicht sich dabei seine Sonnenbrille vom Kopf und fängt sie höchst unelegant aus der Luft. Vermutlich ist das die Stelle, an der ich über ihn lachen sollte, aber ich verzichte.
»Wenn ich das nächste Mal versuche, mit dir zu flirten, werde ich es weniger subtil machen«, versichert er und zwinkert. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Er schiebt sich die Sonnenbrille wieder in die Haare und begutachtet sein Spiegelbild in der Glasscheibe einer Vitrine. »Habe ich Konkurrenz?«, fragt er und zupft seine seidigen Haare zurecht.
Was für ein Idiot.
»Wie bitte?« Ich sehe genervt zu ihm auf. Erst kommt er zu spät, dann reißt er dumme Sprüche. Meine Geduld neigt sich dem Ende entgegen.
»Die Wohnung. Gibt es weitere Interessenten?« Er lässt endlich von seinen Haaren ab, um mich mit seinen eisblauen Augen zu fixieren.
Es gibt tatsächlich weitere Interessenten, allerdings habe ich kein Bedürfnis die auch noch kennenzulernen, wenn er bereit ist die Wohnung zu nehmen – und artig seine Miete zu zahlen. Pünktlich.
Als er kurze Zeit später am Küchentisch sitzt, schwebt der silberne Kugelschreiber in seiner Hand über der Zeile für seine Unterschrift. Er blättert noch einmal durch den Mietvertrag. Es ist ein simpler Standardvertrag aus dem Internet, mit dem man angeblich nichts falsch machen kann.
»Und die Miete geht tatsächlich an eine Stiftung?«, vergewissert er sich, während er den Vertrag ein zweites Mal liest. Ist das der Grund für sein Zögern? Dass ich das Geld für die Miete nicht will, sondern es der Charming-Angel-Stiftung überlasse?
»Wenn Sie es richtig anstellen, können Sie einen Teil der Miete vielleicht als Spende ausweisen«, schlage ich vor, obwohl ich von derlei Dingen keine Ahnung habe.
Er legt den Kugelschreiber beiseite und sieht mich an. Sein Blick wandert abermals über mein Gesicht, als suche er etwas. Ich kann ihm versichern, dass es dort außer Sommersprossen nichts zu finden gibt.
»Gehört diese Wohnung deinem Vater?«, fragt er.
»Sie gehört mir«, widerspreche ich. Davor gehörte sie meinem Vater. Er besitzt mehrere Immobilien in der Stadt. Er baut sie, er verkauft sie. Manche behält er, um sie zu vermieten. Ich verstehe wenig von seinem Geschäft. Es interessiert mich nicht, so wie er sich nicht für mich interessiert. »Mein Vater wird den Vertrag weder sehen noch unterzeichnen«, fahre ich fort, beobachte wie der Interessent sich sichtlich entspannt. Ich blättere noch einmal flüchtig durch seine Unterlagen, aber mir bleibt nichts übrig, als diesen Zetteln zu vertrauen. Unter anderen Umständen hätte ich seine Papiere und Nachweise eventuell von einem Anwalt prüfen lassen, aber ich habe kein Interesse daran, dass der meinen Vater informiert. Was soll der Fremde schon tun? Meine Möbel zerlegen? Es kümmert mich nicht.
Er unterschreibt schließlich mit zwei Schnörkeln, die alles und nichts bedeuten können.
»Und du gehst ins Ausland, um zu studieren?«, vermutet er und legt den Stift beiseite.
Ich schüttele den Kopf. Ich werde nicht ins Ausland gehen. Ich werde nicht einmal diese Stadt verlassen. Ich tausche diese Zweizimmerwohnung gegen eine andere. Ich erwarte nicht, dass irgendjemand auf dieser Welt meine Entscheidung versteht. Manchmal verstehe ich mich selbst nicht. Aber ich weiß, dass es die richtige Wahl ist. Für diesen Moment ist es das Richtige, denn jemand braucht meine Hilfe. Und das ist mir wichtiger als der atemberaubende Ausblick auf die Elbe.
Mein schlechtes Gewissen meldet an, dass ich dafür gleich zweimal den Pfad der Wahrheit verlassen muss. Ich versuche, es damit zum Schweigen zu bringen, dass mein neuer Untermieter jeden Monat einen nicht allzu kleinen Betrag für wohltätige Zwecke spendet. So kann ich mir zumindest einreden, dass mein Gebilde aus Lügen etwas Gutes in sich trägt. Solange es niemand anrührt, wird dieses Kartenhaus zusammenhalten.
Nach nicht einmal einer halben Stunde trennen sich unsere Wege. Ich bekomme eine Kopie des unterschriebenen Mietvertrags, er die Schlüssel, danach versuche ich den jungen Mann zu verdrängen.
Ihn und die Tatsache, dass mein Vater vermutlich nicht allzu begeistert davon sein wird, dass ich meine Wohnung einem Wildfremden überlassen habe. Einem Wildfremden, dessen Unterlagen ich so huschig gelesen habe, dass ich mich nicht einmal an seinen Namen erinnern kann.
29. September / Samstag
Es ist wohl falsch zu schreiben, dass ich mein Leben den sozialen Medien verdanke, aber in dem Moment, in dem ich die letzten Schlagworte unter das neueste YouTube-Video setze, fühlt es sich an, als würde ein Teil davon enden. Als würde ich einen kleinen Teil meines Lebens zu Grabe tragen. Ist das absurd? Klingt das sehr dramatisch? Ich meine: Wie seltsam ist es, dass ich es tröstlich finde, dass ich mir weiterhin die Zeit für Instagram nehmen werde, als wäre es eine Art von Rettungsanker? Mein Rettungsanker. Mein Zufluchtsort. Eine Verbindung zu meinem alten Leben, für das ich in naher Zukunft kaum noch Zeit haben werde.
Ich schrecke auf, als ich Schritte auf den knarzenden Holzdielen im Flur höre, klappe rasch das MacBook zu und schiebe es beiseite, als wäre es eine Tatwaffe. Tief durchatmend lehne ich meinen Rücken gegen das Kopfteil meines Bettes. Das Klopfen an der Zimmertür lässt die französische Bulldogge an meinen Füßen kurz den Kopf heben, ehe sie ihn mit einem Schnaufen wieder auf meinen Knöcheln ablegt. Smoothie (die eben erwähnte Bulldogge) ist eher faul veranlagt. Sein silbernes Fell passt hervorragend zu dem grauen Lammfell am Fußende meines Bettes. Böse Zungen behaupten, ich hätte mir den Hund passend zur Einrichtung ausgesucht, aber das ist absurd. Wenn überhaupt, dann ist es anders herum: Ich kaufe die Einrichtung passend zu meinem Hund. Dass wir die gleiche blau-graue Augenfarbe haben, hält ohnehin niemand für einen Zufall. Würde ich für jedes Mal, wenn mich jemand oberflächlich nennt, einen Euro bekommen, könnte ich das ganze verfluchte Wohnhaus hier kaufen. In bar. Ich weiß, das sind nur Klischees und trotzdem verletzt mich, was die Leute von mir denken.
»Herein«, rufe ich halbherzig, da Sarah ohnehin bereits dabei ist die Zimmertür zu öffnen. Sie hält nicht besonders viel von Privatsphäre. Mein Blick schweift über ihr Outfit: eine Mischung aus curryfarbenen Leggings, weinrotem Kapuzenpulli und olivgrünen Kuschelsocken. In ihrer Hand hält sie einen sandfarbenen Becher, der aussieht, als hätte ihn ein Grundschüler getöpfert. Ich spare mir den Vortrag darüber, dass er mir gehört und sie eigene Becher besitzt. Wegen bereits erwähnter Missachtung von Persönlichkeitsgrenzen ist es ohnehin sinnlos. Skandinavisches Designerstück hin oder her, es interessiert sie nicht. Während Sarah sich gegen den Türrahmen lehnt, rutscht der Haarknoten auf ihrem Kopf zur Seite. Vermutlich wird das Haargummi demnächst den Geist aufgeben und vor ihrer kaum zu bändigenden Lockenpracht kapitulieren. Ihre dunkelbraunen Haare haben ohnehin nur zwei Zustände: zusammengeknotet oder Wischmopp. Genauso wie Sarah. Zuhause läuft sie meistens mit einem Buch vor der Nase herum, hat eine gefühlt drei Zentimeter dicke Dreckschicht auf der Brille und trägt Kleidung, die man nicht einmal zum Sport anziehen sollte. Vor allem nicht in diesen farblichen Kombinationen. Vielleicht sieht sie durch den Schleier ihrer verschmierten Brille auch nicht richtig? Das erklärt allerdings immer noch nicht, warum sie neulich ein Harry-Potter-Sweatshirt mit Mickey-Mouse-Leggings kombiniert hat. Es muss irgendein Trend sein, der an der restlichen Welt vorbeigegangen ist. Aber sobald Sarah das Haus verlässt, schafft sie es irgendwie, aus dem Chaos in ihrem Zimmer eine zweite Persönlichkeit hervorzuzaubern, die ich manchmal gerne um Modeberatung bitten würde.
»So«, ist alles, was sie sagt. Sie visiert mich über den Rand des Bechers hinweg an, als erwarte sie eine Antwort.
»Wie wortgewandt«, stichele ich und sehe sie auffordernd an. Was auch immer sie sagen will, sie wird es eh tun.
Sie schnaubt zur Antwort so unelegant, dass ihr ein Rinnsal des Milchkaffees am Kinn hinab läuft. Sie wischt es mit dem Handrücken ab und kommt zum Bett herübergeschwebt, um sich ungefragt auf die Bettkante zu setzen.
Smoothie zögert einen Moment, ehe er zu ihr herüberkriecht. Er wirft sich neben ihr auf den Rücken und präsentiert seinen Bauch, den sie mit einer Hand streichelt. Das Hecheln des Hundes ist das einzige Geräusch im Raum. Keine von uns sagt ein Wort. Wir starren uns schweigend an. Wer zuerst blinzelt, hat verloren.
»Du hörst mit deinem YouTube-Kanal auf?« Ihr Blick gleitet kurz zu Smoothie, ehe sie mich wieder vorwurfsvoll ansieht. Sie hat das Video also schon gesehen.
Ich zucke halbherzig mit einer Schulter, als wäre es keine große Sache. Im Grunde ist es das auch nicht. Braucht die Welt meine Beiträge über Fair Fashion und Biokosmetik? Über lokales Einkaufen, Fahrradfahren und die Vermeidung von Plastikmüll? Eher nicht. Die meisten Leute folgen mir ohnehin entweder für die lustigen Texte oder hübschen Fotos. Die lustigen Kommentare und hübschen Bilder wird es weiterhin geben – nur eben an anderer Stelle. Wie gesagt: #KeinegroßeSache.
»Ich habe keine Zeit mehr für …«, beginne ich und werde prompt unterbrochen.
»Ja«, fällt mir Sarah so vehement ins Wort, dass Smoothie erschrocken aufsieht. »Ich kann es auch nicht fassen! Es ist Samstag und du bist tatsächlich hier statt in der Agentur. Ich wollte dich gestern schon fragen, wie das Gespräch gelaufen ist, aber jemand hat unser Pizza-Date abgesagt, um … Was genau musstest du bis Mitternacht tun?«
Ich kann mir nicht helfen, aber manchmal klingt sie mehr wie meine Ehefrau als meine Mitbewohnerin, dabei kennen wir uns gerade mal zwei Monate. Seit acht Wochen leben wir nun zusammen auf knapp 60 Quadratmetern Altbau-Albtraum. Wenn Sarah nicht gerade meine Sachen in das Meer ihres Chaos entführt (Ihr Zimmer ist das Bermudadreieck für Becher. Ernsthaft!), läuft es eigentlich ganz gut. Besser als mit vielen Mitbewohnerinnen des Internats, in dem ich zur Schule gegangen bin.
Das Mitarbeitergespräch ist der Hauptgrund dafür, meine Social-Media-Präsens zu reduzieren. Mein vierwöchiges Praktikum in der Trend-Werbeagentur des Landes (Solberg Society) ist seit gestern vorüber. Man hat mir einen Job als Junior-Texterin angeboten. Eine Stelle, die ich vor allem einem eifrigen Headhunter und einigen Instagram-Followern zu verdanken habe. (Einige ist in diesem Fall eine Zahl, die der Einwohnerzahl einer deutschen Großstadt ähnelt.) Es ist nicht so, dass sich mit den richtigen Kooperationen nicht genug Geld verdienen ließe … Beziehungsweise mit Fleiß und dem Aussehen, das ich von meiner Mutter geerbt habe, und Smoothies fledermausohriger Hilfe. Wir haben neben der Schule tatsächlich einiges an Geld verdient, aber meine Schulzeit ist seit fast vier Monaten vorbei und ein Dasein als Influencerin ist nichts, was mein Vater als Arbeit durchgehen lässt. (Obwohl er mittlerweile eingesehen hat, dass es Geld einbringt und Durchhaltevermögen braucht – also zwei Sachen, die er wertschätzt.) Könnte ich noch ein paar Jahre von Fotos und Videos leben? Vielleicht. Macht es sich gut im Lebenslauf? Ungewiss. Ist es die Sache wert, mich dafür mit meinem Vater zu zerstreiten? Eher nicht. Er will, dass ich etwas aus meinem Leben mache. Ich will … Ich weiß es nicht. Es gibt diese Kinder, die schon in der Grundschule eine konkrete Zukunftsvision haben. Ihr innerer Kompass deutet in Richtung Feuerwehrmann, Tierärztin, Prinz oder Astronautin. Ich habe vermutlich den Tag verpasst, an dem man Wegweiser und Navigationssysteme ausgeteilt hat. Vielleicht habe ich nach dem Tod meiner Mutter schlicht und ergreifend versäumt, Updates zu installieren, und bin auf dem Stand einer 17-Jährigen stehen geblieben.
Ein Jahr hat mir mein Vater gegeben, bevor er »mir das Taschengeld streicht« (seine Worte). Ein Jahr lang habe ich Zeit, um meine Kreativität auszuleben und mir zu überlegen, wohin mein Lebensweg führen soll. Mein Vater ist sicherlich froh, wenn das Ortseingangsschild die Worte Jura oder Betriebswirtschaft in Kombination mit der Zauberformel Studium enthält. Noch froher, wenn ich meine Vorliebe für Schönes auf Immobilien fokussiere. Manchmal bin ich versucht nachzugeben und das zu tun, was er sich erhofft. Aber jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, höre ich die Stimme meiner Mutter. Ich sehe, wie sie vor meinem geistigen Auge den Kopf schüttelt und mit ihrem unbeirrbaren Lächeln murmelt: »Das Leben ist eine Reise. Das Ziel kennst nur du. Lass dir von niemandem einen Fahrschein geben, den du nicht willst.« Wahrscheinlich hat sie den Spruch zu oft gesagt, denn mein Vater ist nicht erst seit ihrem Tod permanent auf der Reise.
»Hast du Smoothie wenigstens danach gefragt, ob er damit einverstanden ist, sein Dasein als Star zu beenden?« Sarah streichelt weiterhin über Smoothies Bauch, bis er zufrieden seinen Hinterkopf an der Bettdecke reibt und wohlig grunzt. Dieses Mal bin ich es, die schnaubt. Ich werde versuchen bANAna-Smoothie irgendwie weiterzuführen, aber für die aufwendigen Videos habe ich keine Zeit mehr. Auch der Blog wird pausieren, bis ich weiß, wie mein neuer Alltag verläuft.
Wie gesagt: Die Solberg Society ist zurzeit die Trendagentur. Als junger, kreativer Mensch sucht man sich entweder ein hippes Start-up oder versucht bei Solberg zu landen, um den Lebenslauf ein wenig aufzuhübschen. Ich sehe es als Chance, um auszuprobieren, ob mein Hobby für mich auch als Beruf geeignet ist. Bisher weiß ich vor allem, was ich nicht will. Unter anderem Architektur, Jura oder BWL studieren.
Smoothie ist das alles mit Sicherheit herzlich egal, solange ich seinen Napf regelmäßig fülle. Im Gegensatz zu mir interessiert sich Mr. Knautschnase nämlich herzlich wenig für Ernährung. Der Anti-Gourmet würde sich auch von Schokolade ernähren, wenn er dürfte.
»Ich versteh dich nicht«, gesteht Sarah und nippt sichtlich nachdenklich an ihrem Kaffee. Sie starrt einen Moment ins Nichts, ehe sie mich wieder ansieht. Ihre hellbraunen Augen wandern über mein Gesicht, als wäre es eine ihrer Buchseiten. Als könnte sie daraus irgendeine Antwort ablesen. »Ana, tausende kleine Mädchen sehen zu dir auf, weil sie hoffen so wie du zu werden. Du hast neben der Schule eine eigene Marke aufgebaut. Seit Jahren plädierst du für einen bewussten Lebensstil. Ich habe nur deinetwegen angefangen, Mandelmilch zu trinken. Und jetzt wirfst du das hin, um für einen Laden zu arbeiten, der deine Ideale mit Füßen tritt?«
Ich werfe gar nichts hin. Und es ist schwer zu sagen, ob die Solberg Society meine Ideale mit Füßen tritt. Ich weiß nicht einmal, ob sie Ideale hat, die sie vertritt.
»Das da«, ich deute auf mein MacBook, »ist eine Scheinwelt, die vielleicht schon morgen ihre Pforten schließt. Dann stehe ich mit einer Bulldogge an der Leine auf der Straße und …«
»Vielleicht geht morgen die Welt unter«, wirft Sarah ein. In ihren Augen blitzt es herausfordernd auf. Sie hat gut reden. Sie studiert Medizin in einem Land, in dem es akuten Ärztemangel gibt – und sie liebt es. Die Menschen, das Lernen und sogar all die Geschichten, die mir schon bei ihren Erzählungen Übelkeit bereiten. Sie braucht sich über ihre berufliche Zukunft in jedem Fall keine Sorgen zu machen. Alles, was ich habe, ist ein mittelmäßiges internationales Abitur, viele Follower und permanente Ratlosigkeit darüber, wo ich mich in fünf Jahren sehe.
»Smoothie muss raus«, höre ich mich verkünden und springe aus dem Bett, als wäre ich auf der Flucht.
»Renn ruhig weg«, bestätigt Sarah meine Gedanken. »Vielleicht findest du auf dem Weg zufällig den Mut, zu dir selbst zu stehen. Lade ihn ruhig ein. Er ist ein gern gesehener Gast.«
»Du kannst mich mal!« Ich greife meinen rosafarbenen Mantel vom Hocker vor dem Schminktisch und verschwinde in den Flur, ohne meine Mitbewohnerin noch eines Blickes zu würdigen. Ich nehme Smoothies Halsband von der Flurgarderobe, schlüpfe in meine grauen Wildlederstiefel und wickle einen Schal um meinen Hals. Ein dumpfes Geräusch erklingt, als Smoothies Körper auf dem Holzboden vor dem Bett landet. Ich brauche ihn nicht zu rufen. Er folgt mir. Auch ohne Smartphone.
Im Schanzenpark ist für einen Samstagmittag erstaunlich wenig los. Nebel und ein leichter Nieselregen halten die meisten Stadtbewohner in ihren Wohnungen gefangen – oder zumindest die Studenten und Studentinnen von den Wiesen fern. Die Hunde aus den nahen Vierteln wissen es zu schätzen und nutzen den Platz zum Fangen spielen. Smoothie hingegen muss an der Leine bleiben. Seine Vorliebe für alles Essbare hat mich schon zu oft in peinliche Situationen gebracht. Manchmal reicht ihm eine Sekunde, um wie durch Zauberei zu verschwinden und am anderen Ende des Parks wieder aufzutauchen, um dort anderen Hunden oder kleinen Kindern ihren Snack zu klauen. Eigentlich ist der Sternschanzenpark keiner meiner Lieblingsorte. Angeblich ist er ein beliebter Treffpunkt für Dealer aller Art. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Bisher hat mich keiner angesprochen und dennoch verbreitet allein das Gerücht eine eigenartige Atmosphäre.
Immer noch wütend über Sarahs Worte marschiere ich über einen knirschenden Sandweg, der irgendwann in Pflastersteine übergeht. Ich halte etwas unwillig an, als Smoothie eine Bremsung einlegt, um seine platte Schnauze in ein Grasbüschel am Wegesrand zu stecken. Missmutig ziehe ich den Kragen meines grauen Rollkragenpullis höher und bemerke irgendwo am Rande meines Bewusstseins wie gut meine Stiefel und Smoothies Fell zu den grauen Steinen unter uns passen. Also ziehe ich mein iPhone aus der Manteltasche und lasse Smoothie neben meinen Füßen sitzen. Nach meiner Rückzugsankündigung kann ein Beschwichtigungsbild sicher nicht schaden. So etwas nach dem Motto: Smoothie und ich leben noch und werden auch in Zukunft aktiv sein – nur eben nicht mehr so oft. Als ich die Kamera des Handys öffne, rümpfe ich die Nase. Der Bildausschnitt stimmt nicht. Ich habe einen Streifen des Grases im Bild. Das Grün stört die Harmonie der Gesamtkomposition ungemein. Unzufrieden trete ich einen Schritt zurück – und bereue es augenblicklich.
Ich habe mich kaum bewegt und halte den Blick noch immer auf das Display des Handys gerichtet, als mich irgendetwas so unsanft zu Boden stößt, dass ich es nicht mehr schaffe, mich abzufangen. Nur geschützt durch den Mantel schlage ich mit dem Ellenbogen zuerst auf dem Boden auf. Mir rutscht das Handy aus der Hand, während ich so ruckartig an der Hundeleine ziehe, dass Smoothie erschrocken aufjault. Mein Kopf küsst den Steinboden und dankt es mir augenblicklich mit einem dumpfen Schmerz, der durch meinen Schädel dröhnt. Ich spüre, dass jemand auf mich fällt. Er stützt sich gerade noch mit den Händen neben meinem Kopf ab, bevor meine Nase Bekanntschaft mit seinem Schlüsselbein machen kann.
Mit tanzenden Sternchen vor den Augen schaue ich zu einem nach Luft ringenden, jungen Mann auf. Er ist mir so nahe, dass ich nur seine eisblauen Augen sehe. Sein Blick gleitet zwischen seinen Händen, meinem Kopf und einem Smoothie, der gerade Anstalten macht, mein Gesicht abzulecken, hin und her. Der Fremde schiebt meinen Hund unsanft beiseite und schenkt ihm ein angewidertes Naserümpfen. Etwas Nasses tropft aus seinen Haaren auf mein Gesicht. Ich hoffe sehr, dass es nur Regen ist. Für einen kurzen Augenblick sehen wir uns an. Irgendwie kommt er mir bekannt vor, ich weiß nur nicht woher. Ehe ich in meinem Gedächtnis nach einem Eintrag namens »eisblaue Augen« suchen kann, löst sich ein weiterer Tropfen aus seinen Haaren, um auf meiner Stirn zu landen. Das ist so viel widerlicher als Hundespeichel.
»Runter von mir«, fauche ich und versuche den Fremden von mir zu schieben. Als meine Hand sein feuchtes Shirt berührt, ziehe ich sie angeekelt zurück. Kein Regen.
Der Fremde erhebt sich elegant (so elegant man in Sportkleidung aussehen kann) und reicht mir eine Hand.
Sie ignorierend setze ich mich auf und schaue mich nach meinem Handy um. Es liegt nur eine Armlänge entfernt neben mir auf dem Weg.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragt der Jogger.
Mit zitternden Fingern greife ich nach meinem Handy, nur um genervt zu stöhnen. Das Display hat den Sturz nicht überlebt. Ein Spinnennetz feiner Risse zieht sich über seine gesamte Oberfläche. Was für ein Tag!
»Du hast da …«
»Mein Handy ist kaputt!« Ich halte demonstrativ das Telefon hoch, während Smoothie sich neben mich setzt und mich mit seiner breiten Schnauze anstupst. Als der Fremde nicht reagiert, wackele ich mit dem iPhone in der Luft herum, damit er sein Werk bestaunen kann.
Der junge Mann zögert einen Moment, ehe er sich neben mich kniet. Sein Blick gleitet nur flüchtig zum Handy, dann zu meinem Kopf. »Du blutest.« Er deutet auf meine Schläfe, als wäre das irgendwie hilfreich.
Ich sehe ihn überfordert an. In einer Hand halte ich mein Telefon, als wäre es ein Beweismittel, in der anderen die Hundeleine.
»Darf ich?«, fragt er und wartet erst gar nicht auf eine Antwort. Er streckt eine seiner Hände aus. Vollkommen perplex beobachte ich, wie er sich nähert, um meinen Kopf zu begutachten. Seine Finger streichen vorsichtig meine Haare hinter das Ohr, bevor sie über meine Schläfe fahren. Sein prüfender Blick gleitet zwischen meinem Ohr und meinem Haaransatz hin und her.
Die Situation ist mir unangenehm. Ich sitze in meinem rosa Mantel auf dem feuchten Weg, umklammere mein Handy, während mir ein Fremder ziemlich nahe kommt. Zu nahe für meinen Geschmack. Als er erneut meine Schläfe berührt, ziehe ich scharf die Luft ein. Autsch.
»Du solltest dein hübsches Gesicht einem Arzt zeigen. Das muss eventuell genäht werden.«
Ich ziehe eine Augenbraue hoch und bereue es augenblicklich, als ein stechender Schmerz an meiner Schläfe pocht. »Sind Sie Arzt?«, frage ich irritiert, als der Fremde noch zweimal an meinem Kopf herumdrückt, ehe er unvermittelt aufsteht.
»Nein, aber für Doktorspiele stehe ich dennoch zur Verfügung«, erwidert er mit einem seltsamen Zwinkern.
Mein Kopf ist zu durcheinander, um mit dieser Antwort etwas anfangen zu können. Ich mustere Smoothie noch einmal, aber ihm scheint es gut zu gehen. Vorsichtig rappele ich mich auf, ignoriere einen leichten Schwindel, wische mit einer Hand den dreckigen Mantel ab und lasse das Handy in der Manteltasche verschwinden.
»Braucht Fräulein Guck-auf-den-Boden eine Eskorte?«
Die Zähne zusammenbeißend sehe ich trotzig zu ihm auf. Hätte mich dieser Volltrottel nicht umgerannt, dann … »Mein Handy ist kaputt«, wiederhole ich.
Der Jogger mustert mich, fährt sich mit einer Hand durch die silberblonden Haare. Die sind sicherlich gefärbt – und genauso affektiert, wie die hochgekrempelte Jogginghose, die seine nackten Knöchel offenbart. »Handy geht vor Kopf, verstehe«, antwortet er und zögert, ehe er eine zerknickte Visitenkarte aus seiner Hosentasche hervorzieht, die er vor mein Gesicht hält. Was für ein Mensch nimmt denn Visitenkarten zum Laufen mit? »Falls du eines von beidem ersetzen lässt, schick mir die Rechnung.«
Da ich nicht reagiere, drückt er mir das Papierstück in die Hand. Er sieht mich noch ein letztes Mal abschätzend an, ehe er seine Laufrunde fortsetzt, als wäre nichts gewesen.
Ich knülle die Karte zusammen und stecke sie ein, um sie im nächsten Mülleimer zu entsorgen. Wenn ich eines sicher nicht machen werde, dann ihn kontaktieren. Vorsichtig taste ich meine Schläfe ab, die zunehmend schmerzhaft pulsiert. Ich werde Sarah nach ihrer Meinung fragen.
Wozu wohnt man mit einer Medizinstudentin zusammen?
1. Oktober / Montag
»Hat dir ein enttäuschter Fan einen Stein an den Kopf geschmissen?«, ist alles, was Sarah zu der Wunde eingefallen ist. Glücklicherweise hat sie es bei einer großzügigen Portion Desinfektionsmittel und einem Pflaster belassen. Einem Pflaster, das ich dummerweise auch noch am Montag tragen soll, während ich auf meinem weißen Fahrrad zur Arbeit radele. Smoothie sitzt in seinem Fahrradkorb am Lenker und lässt sich den Wind um seine Fledermausohren wehen. Eigentlich ist an den Landungsbrücken kaum etwas Schönes und trotzdem liebe ich es jedes Mal wieder dort vorbeizukommen. Der Wind und die Wellen erzählen Geschichten von Freiheit. Vielleicht liegt es auch an dem Museumsschiff Rickmer Rickmers, das einst tatsächlich um die Welt gesegelt ist. Sein grün-roter Rumpf ist an diesem Morgen der einzige Farbklecks im Nebel.
An der Agentur angekommen fahre ich bis in den Fahrradkeller hinab, stelle mein Rad zu all den anderen und befreie meinen Hund aus dem Korb, um mit ihm zum Fahrstuhl zu gehen. Wir könnten auch eine der Treppen ins Gebäude nehmen, aber Smoothie ist kein Fan von Treppenstufen. Und ich bin keine Freundin davon seine vierzehn Kilo bis ins Foyer hinaufzutragen, wo uns ein weißer Hirtenhund begrüßt, kaum dass wir den Fahrstuhl verlassen. Der Hund in Ponygröße wirft sich mit vollem Körpereinsatz gegen meine Beine, um gestreichelt zu werden. Smoothie ist vielleicht der berühmteste Hund in der Agentur, aber bei weitem nicht der Einzige. Solange sich die Vierbeiner benehmen, sind sie willkommen. Laut meinem Vater stammt diese »Bring deinen Hund mit zur Arbeit«-Philosophie aus Amerika. Mir ist es recht – und Smoothie sowieso. Er ist vermutlich der entspannteste Hund der Welt. Im Tempo einer fußkranken Schildkröte folgt er mir durch das Foyer bis zur Cafeteria. Durch eine Front bodentiefer Fenster kann man direkt bis zur Elbphilharmonie hinübersehen, die heute jedoch im Nebel versinkt. Vermutlich ist es Absicht, dass es an den Tischen nur unbequeme Bänke und Hocker gibt. So läuft niemand Gefahr, zu viel Zeit damit zu verbringen aus dem Fenster zu starren, statt zu arbeiten. Nur ein paar petrolfarbene Stuhlkissen bringen so etwas wie Gemütlichkeit in die recht geradlinige Einrichtung. Petrol ist ohnehin die vorherrschende Farbe in der Solberg Society – Petrol und Grün, mit dunklen Möbeln und messingfarbenen Lampen. Das Logo gleicht einem Bergmassiv, über dem die Sonne aufgeht: massiv und zukunftsweisend. (So steht es zumindest auf der Agenturwebseite.)
Die Schlange an der Essensausgabe ist zum Glück recht kurz, nur zwei Arbeitskollegen sind vor mir an der Reihe, bis ich bei der freundlichen Mitarbeiterin meinen Soja Macchiato bestellen kann. Kaffeespezialitäten, Tee, Kakao – alles wird hier frisch von Hand zubereitet, statt einen Automaten bereitzustellen. Das und kostenloses Frühstück sind zwei der Kleinigkeiten, die mir in der Agentur ganz gut gefallen. Allerdings gibt es genauso vieles, das mir nicht gefällt. Die unbezahlten Überstunden zum Beispiel. Ich weiß, dass ich jederzeit kündigen kann, aber … Was dann? Ich habe ja nicht einmal einen Plan A. Woher dann einen Plan B nehmen?
Nach dem Abholen meines Heißgetränks schlendert Smoothie alles andere als enthusiastisch mit mir zu den Fahrstühlen, um in den siebten Stock hinaufzufahren. Wenn der Fahrstuhl und Smoothie sich in einem einig sind, dann sicherlich darin, dass das Zauberwort für ein glückliches Leben Entschleunigung lautet. Der Fahrstuhl braucht gefühlte Ewigkeiten bis zu unserer Etage. Einer Etage, die so haargenau wie alle anderen aussieht, dass ich einmal versehentlich in der sechsten bis zu meinem Arbeitsplatz gelaufen bin, nur um mich zu wundern, wohin Smoothies Körbchen verschwunden ist. Es stand artig an seinem Platz – unter meinem Schreibtisch, in einem Großraumbüro ein Stockwerk höher.
Noch während ich meinen Kaffee auf dem Schreibtisch abstelle, verkriecht sich Smoothie in seinem Plüschkörbchen, wo er sich mit einem zufriedenen Schnaufen fallen lässt und seine Nase zwischen den Kissen vergräbt. Er ist bereit für sein Vormittagsnickerchen. Mein Blick gleitet durch das Büro. Ich grüße knapp ein paar Kollegen an den benachbarten Gruppentischen, aber am Montagmorgen kommt kaum mehr als unverständliches Gemurmel zurück. An den Stirnseiten des Raumes, nur durch Glaswände getrennt, befinden sich die Büros der Teamchefs. Wer es zwischen all diesen Arbeitsdrohnen zu einem eigenen Büro geschafft hat, der … hat es wohl geschafft. Das rechte Büro gehört unserem Teamleiter Oliver. Er hat zurzeit die Alleinherrschaft über alle Arbeitsdrohnen in diesem Raum, denn das linke Büro ist momentan unbesetzt.
»Ana-Banana«, grüßt mich Mira, gerade als ich mich auf meinen Stuhl setze und den iMac hochfahre, der mit einem freundlichen »Gong« in die neue Woche startet.
Ich zwinge mich zu einem Lächeln. Normalerweise habe ich nichts gegen diesen Spitznamen, aber die blonde Grafikdesignerin schafft es, ihn mit solch einer Ironie auszusprechen, dass ich spontan das Bedürfnis habe, mein Kaffeeglas über ihrem geblümten Kleid auszuleeren. Mira trägt jeden Tag ein anderes Blümchenkleid, immer mit farblich passender Strumpfhose – und absolut unpassender Strickjacke. Sie steht anscheinend auf Blumen und Stickereien in den wildesten Farbkombinationen. Es könnte vielleicht ganz niedlich aussehen, wenn sie mich nicht immer ansehen würde, als hätte sie vor, mich mit ihrem Blick zu töten. In Kombination mit ihren roten Kopfhörern schreit ihr Outfit förmlich nach klischeehafter Pseudoindividualität. Wahrscheinlich hört sie dazu irgendwelche Mainstreammusik und verkündet jedem ungefragt, dass sie die Band schon mochte, bevor sie Mainstream wurde. Als ich es in der ersten Woche gewagt habe, sie danach zu fragen, was sie gerade tut, drehte sie demonstrativ ihren Monitor weg und sah mich abfällig an. Das war ihre Art von Antwort: Keine. Und wenn sie sich doch mal dazu hinablässt, drei Worte mit mir zu reden, bereue ich es meistens.
Sie lässt ihren Lederrucksack auf den Tisch neben mir fallen.
»Hattest du ein schönes Wochenende?«, frage ich bemüht freundlich, während ich mein Passwort eintippe.
Mira sieht kurz von ihrem Rucksack auf, um zielstrebig an dem Pflaster in meinem Gesicht hängenzubleiben. »Versucht die Prinzessin, mit dem Pflaster einen Pickel abzudecken?«, antwortet sie spöttisch und schürzt ihre Oberlippe.
Sicher. Bevor ich mich mit einem Pickel in der Öffentlichkeit zeige, klebe ich mir lieber das Gesicht zu.
»Ana!«, hallt Olivers Stimme durch das Großraumbüro und erspart mir so, Mira antworten zu müssen.
Als ich fragend zu ihm aufsehe, steht er in der Tür zu seinem Büro und macht eine auffordernde Geste, die nur eines bedeuten kann: In sein Büro. Sofort.
Wundervoll.
Ich greife nach meinem Notizbuch und angele einen Stift aus dem Becher auf meinem Schreibtisch. Vermutlich geht es nur um Arbeitsaufträge, aber in das Büro des Chefs zitiert zu werden, noch bevor man sich bei der Zeiterfassung angemeldet hat, ist der falsche Weg, um in die Woche zu starten. Ich weise Smoothie an liegenzubleiben, während ich mich erhebe, um mich an den anderen Gruppentischen vorbeizuschlängeln.
»Das habe ich auch schon mal schneller gesehen«, behauptet Oliver mit dem Ansatz eines Lächelns auf dem Gesicht. Ich weiß bei ihm nie, ob er scherzt oder es ernst meint. Er hat immer so ein amüsiertes Funkeln in seinen grünbraunen Augen; er ist ohnehin schon groß, aber dieses eigenartige Lächeln – von oben herab – sorgt dafür, dass ich mich winzig fühle. Wie die namenlose Drohne, die ich in dieser Agentur bin.
Ich senke meinen Blick auf den dunkelgrauen Teppichboden, während ich vor ihm durch die Glastür in sein Büro gehe. Erst als er die Tür schließt, sehe ich überrascht auf. Wir sind nicht allein. Ein hellblonder Mann in schwarzer Lederjacke sitzt vor Olivers Schreibtisch. Statt aufzusehen, blättert er durch einige Zettel, die vor ihm auf dem Tisch liegen. Instinktiv streiche ich meine Bluse glatt.
Oliver deutet mir, mich auf den freien Stuhl zu setzen, während er um den Schreibtisch stolziert. »Ana, darf ich vorstellen? Der zweite Teil des dynamischen Duos«, mit diesen Worten lässt er sich auf seinem Stuhl nieder.
»Wie bitte?«, frage ich verwirrt und sehe zwischen Oliver und dem Fremden hin und her, der immer noch die Papiere sichtet, ohne mich zu beachten.
Dynamisches Duo? Was soll das heißen?
»Dein Grafikdesigner«, erklärt er und lehnt sich zufrieden in seinem Stuhl zurück.
Ich weiß, dass hier Texter und Designer paarweise zusammenarbeiten. Und dass sie für unser Team noch einen Junior Designer gesucht haben, aber …
»Adrian«, stellt sich der Fremde vor, greift nach einem Kugelschreiber und setzt seine Unterschrift unter einen der Zettel.
Ich komme gerade noch dazu, den Mund zu öffnen, um zu protestieren. Ich meine: Unterschreibt der gerade seinen Arbeitsvertrag? Muss der nicht erst von der Personalabteilung genehmigt …? Ich sauge scharf die Luft ein, als der Blondschopf von seinen Papieren aufsieht. Mein Herz macht einen schmerzhaften Stolperer. Das ist Mister Huskyauge. Der joggende Handyzerstörer. Kein Zweifel. Nie zuvor habe ich jemanden mit dermaßen eisblauen Augen gesehen. Sein Blick gleitet fragend über mein Gesicht, bis er an dem Pflaster auf meiner Schläfe hängenbleibt. Wie soll ich seinen besorgten Gesichtsausdruck deuten?
»Adrian und Ana, klingt hervorragend«, behauptet Oliver ungefragt. Es scheint nicht mehr viel zu fehlen, bis er sich zufrieden die Hände reibt.
»Ana«, wiederholt mein Gegenüber und verzieht seine Lippen zu einem Lächeln, das seine Augen nicht erreicht.
Ich blinzele und schließe den Mund. Wie viel Pech kann ein Mensch eigentlich haben? In dieser Stadt leben fast zwei Millionen Menschen. Und mein neuer Kollege ist ausgerechnet derjenige, der mich im Park über den Haufen gerannt hat? Das ist … schlechter als in jeder Daily Soap. Wow. Ich bin echt enttäuscht von meinem Schicksal. Einfallsloser geht es schon gar nicht mehr.
»Alles in Ordnung?« Adrian schläft das Gesicht ein.
Ist das sein Ernst? Ich habe ihm das Pflaster an meiner Schläfe zu verdanken und er fragt mich, ob alles in Ordnung ist? Wer hat sich hier den Kopf angeschlagen?
»Normalerweise ist sie weniger sprachlos«, versichert Oliver. »Wir wollten die bezaubernde Ana für unseren Influencer-Squad rekrutieren, stattdessen hat sie sich als Texterin beworben – und wie du siehst, setzen wir trotz akuten Wortmangels große Hoffnungen in sie. Genau wie in Adrian.«
Ich sehe zu Oliver hinüber. Wahrscheinlich benehme ich mich gerade wie der letzte Mensch. Wenn Adrian beschließt, so zu tun, als hätten wir kein eigenartiges Zusammentreffen im Park hinter uns: Bitte sehr.
»Adrian hat gerade sein Grafikdesignstudium beendet. Er war vor einem Jahr für ein Semester als Praktikant hier und hat für seine Bachelorarbeit zwei internationale Design-Preise gewonnen«, rattert Oliver herunter. Statt seinen Werbevortrag fortzuführen, dreht er sich zu einer Kommode hinter sich um und nimmt zwei graue Mappen von einem Stapel. Mit einer beinahe beiläufigen Bewegung schiebt er sie Adrian zu. »Ich erwarte bis heute Abend erste Ideen. Der Kunde will es jung, kreativ, wild. Fernsehen, Print, Social Media – das ganze Programm. Ihr kennt den Weg zur Cafeteria, falls ihr Zucker oder Koffein braucht. Wenn noch Fragen sind, schreibt eine Mail. Ich bin gleich außer Haus.«
Adrian überreicht Oliver die unterschriebenen Papiere und nimmt im Gegenzug die Mappen mit dem Arbeitsauftrag an sich.
»Ist noch etwas?« Oliver deutet auf seine Bürotür. Das Gespräch ist offensichtlich beendet.
Mit zusammengebissenen Zähnen stehe ich auf und marschiere zur Tür, die ich offen stehenlasse. Ich höre, wie Adrian mir folgt. Mein Augenmerk richtet sich wie von selbst auf seine Stiefel, deren schwere Schnallen bei jedem Schritt klimpern. Es ist ein Geräusch, das Smoothie aus seinem Körbchen lockt. Er tritt auf den Gang hinaus, streckt sich gähnend und sieht sich verwirrt um, als er nichts entdeckt, das seine Aufmerksamkeit verdient.
»Die Ratte hat ihr Nest verlassen«, stichelt Mira, als ich Smoothie auf seinen Platz zurückschicke.
»Er dachte, du bist ein Hund«, erkläre ich und zeige auf Adrians Stiefelschnallen. Das Geräusch der wippenden Schnallen erinnert tatsächlich ein wenig an eine klimpernde Hundeleine.
»Windhund oder Kampfhund?«, fragt er provozierend und legt breit lächelnd die Unterlagen auf meinem Schreibtisch ab.
Ich komme nicht mehr dazu, zu erklären, dass ihm der Tisch mir gegenüber gehört, als Miras Stimme die Luft zerreißt: »Adri-aaaan!«
Sie springt so hastig auf, dass Smoothie erneut den Kopf hebt, um die Umgebung zu sondieren. Verwundert beobachte ich, wie die sonst so grummelige Grafikdesignerin zu Adrian herüberläuft, um ihm um den Hals zu fallen. Als sie auf und ab hüpft, verdrehe ich die Augen. Was für ein Theater.
»Du übertreibst«, stimmt Adrian mir, ohne es zu wissen, zu. Er lacht und schiebt Mira vorsichtig von sich. »Erzähl mir nicht, dass du mich vermisst hast. Als hättest du in der Zwischenzeit keine anderen Fans gehabt.«
»Alles aufgeblasene Trottel«, stöhnt sie. Ich kann ihren Seitenblick quasi körperlich spüren. Er bohrt sich direkt durch die Stelle, an der das Pflaster klebt. »Du bist echt zurück. Ich dachte, das war ein Scherz. Du wolltest doch nach London?«
Adrian fährt sich, sichtlich verlegen, mit einer Hand durch die Haare. »Vielleicht später mal«, ist alles, was er dazu sagt. Jeder Idiot muss hören, dass ihm das Thema unangenehm ist. Offensichtlich will er immer noch nach London, aber irgendetwas ist dazwischengekommen. Da Mira allerdings in die Kategorie Vollidiot fällt, löchert sie ihn weiterhin über seine Londonpläne aus. Ich habe keine Ahnung, woher die beiden sich kennen, werde mir aber eher auf die Zunge beißen, als sie danach zu fragen.
Ich setze mich auf meinen Bürostuhl und beschließe, meinen mittlerweile so gut wie kalten Kaffee zu trinken, während Mira hinter meinem Rücken die Wiedersehensfeier des Jahrhunderts veranstaltet.
»Kaffee?«, fragt sie übertrieben fröhlich und sieht aus, als würde sie Adrian notfalls eigenhändig in die Cafeteria schleifen, wenn er nicht freiwillig mitkommt.
»Ana?« Adrian nickt in Richtung des Flures.
Wenn es die stumme Frage sein soll, ob ich die beiden nach unten begleite, verzichte ich gerne. Ich halte demonstrativ mein Glas hoch. Mit Kaffee bin ich bereits versorgt und werde einfach hier warten, bis die zwei sich fertig gefreut haben.
Dass es länger dauern kann, wird mir klar, als sich das Großraumbüro nach und nach mit den mittlerweile ausgeschlafenen Arbeitsdrohnen füllt. Jeder Zweite kann sich an Adrian erinnern. Natürlich auch Miras Arbeitspartner Matthias. Er ist ein eher unscheinbarer Typ Ende zwanzig, der meistens in engen, bunten Hosen herumläuft und ebenso wie ich gerne Fahrrad fährt. Mira und Matthias. Ana und Adrian. Wahrscheinlich macht sich Oliver einen Spaß daraus, bei der Teamzusammenstellung möglichst bescheuert klingende Namenspaare zu bilden. Als Adrian, Mira und Matthias schließlich bereit sind, sich einen Kaffee zu holen, ist mein Glas bereits leer und mein E-Mailpostfach geordnet. Seufzend öffne ich eine der Mappen mit unserem Arbeitsauftrag und stutze. Das kann nicht Olivers Ernst sein. Mein Blick gleitet zu seinem Büro hinüber, doch offensichtlich hat er sich mittlerweile klammheimlich aus der Agentur verdrückt. Ich verteile die Unterlagen auf dem Tisch und warte. Kaffee holen kann ja nicht ewig dauern.
Ewig vielleicht nicht, aber als der Rest meines Gruppentisches aus der Cafeteria zurückkommt, ist es bereits elf Uhr und die Unterlagen betteln sekündlich lauter um unsere Aufmerksamkeit.
Tag 1 – und Sir Adrian der Erste seiner Art schlendert mit einer ekelerregenden Selbstgefälligkeit in das Büro zurück, während Mira um seine Füße scharwenzelt wie ein aufgedrehter Hund. Dabei unterhält sie ihn mit Anekdoten aus dem letzten Monat und gestikuliert so euphorisch, dass ihr beinahe der Milchkaffee über den Glasrand schwappt.
Der Grafikdesigner schenkt ihr ein Lächeln, das irgendwo zwischen amüsiert und nachsichtig liegt. Als wäre sie tatsächlich so etwas wie ein niedliches Haustier.
»Und dann bin ich wieder hierhergekommen und hatte das Glück das Prinzesschen Banana und ihre widerliche Ratte kennenzulernen«, beendet sie ihre Erzählung und lässt sich auf ihren Stuhl fallen.
Instinktiv sehe ich auf Smoothie hinab. Er schläft seelenruhig. Glücklicherweise versteht er nicht, dass Mira ihn ständig beleidigt.
»Wenn du dir Mühe gibst, ist sie in spätestens vier Wochen hier weg.« Sie wirft mir ein eiskaltes Lächeln zu. Viel deutlicher kann sie wohl nicht zu verstehen geben, dass sie mich gerne los wäre.
»Schoko oder Blaubeere?«, höre ich Adrian hinter mir. Ich sehe fragend zu ihm auf. Er stellt zwei Muffins auf die Unterlagen, die ich rasch vor Fettflecken rette. »Es ist Montagmorgen und du siehst so aus, als bräuchtest du etwas Süßes.« Er geht hinter meinem Rücken lang, setzt sich auf seinen Stuhl und kommt schwungvoll zu mir herübergerollt. »Hör nicht auf Mira, niemand will, dass du gehst.«
Noch während ich ihn zweifelnd ansehe, schnaubt Mira abfällig. Matthias enthält sich jeden Kommentars – wie meistens. Ich arbeite seit vier Wochen mit ihm zusammen und weiß kaum etwas über ihn, was unter anderem daran liegt, dass er nicht viel redet und sich nach Möglichkeit aus allen Diskussionen heraushält.
»Oh Adrian, Banana isst doch nichts so Schnödes wie Süßigkeiten«, mischt sich Mira ungefragt ein.
Die Augen verdrehend greife ich nach dem Blaubeermuffin. Natürlich esse ich auch mal Süßigkeiten, aber wie gut, dass Mira mich besser kennt als ich mich selbst.
»Stalk sie auf Instagram: BananaundSmoothie.«
Während ich mit spitzen Fingern das Papier von dem Gebäck zupfe, bin ich kurz versucht, ihr den Muffin an den Kopf zu werfen, damit sie den Mund hält. »Danke für die Gratiswerbung«, säusele ich stattdessen sarkastisch.
»Die war nicht gratis. Die kostet den Schokomuffin«, behauptet sie und streckt eine Hand aus.
Tatsächlich wirft ihr Adrian, ohne zu zögern, den Muffin rüber, den sie ungeschickt aus der Luft fängt.
Ich habe die dunkle Vorahnung, dass die nächsten Wochen die Hölle werden. Auf Instagram und YouTube häufen sich mittlerweile die wütenden und enttäuschten Kommentare, hier hat mein Team endgültig beschlossen, dass ich überflüssig bin. Kann es noch unangenehmer werden? Ich weiß es nicht, aber Mira wird sich sicherlich Mühe geben, es mich herausfinden zu lassen.
»Also …« Adrian rollt mit seinem Stuhl näher heran. So nahe, dass ich instinktiv beiseite rutsche. Hat er noch nie etwas von Individualdistanz gehört? Mein Tanzbereich – dein Tanzbereich? Wenn er mir so nahekommt, dass ich sein Parfüm riechen kann, ist es zu nah. Vor allem, wenn sich der Duft meines Blaubeermuffins mit … Ich frage mich, wonach er riecht. Irgendwie nach Meer, Urlaub, frisch und … Ich rolle noch ein Stück beiseite und konzentriere mich auf meinen Muffin. Der riecht nach Blaubeere und das ist die einzige Information, die meine Nase zu verarbeiten hat.
»Was haben wir hier?«, fragt Adrian äußerst geschäftsmäßig und schiebt ein paar der Ausdrucke zurecht. Er überfliegt die Blätter.
Ich breche mit spitzen Fingern ein Stück des Muffins ab, während der Jungdesigner einen großen Schluck Kaffee trinkt. Mir fällt jetzt erst auf, dass er den Becher (der in seiner Hand wie ein graziles Tässchen wirkt) irgendwie seltsam hält. Als er meinen Blick bemerkt, wechselt er den Becher in die linke Hand und legt die rechte auf seinem Oberschenkel ab.
»Wir sollen uns ernsthaft eine Kampagne für Plastikflaschen ausdenken«, erkläre ich und versuche erst gar nicht den genervten Unterton in meiner Stimme zu unterdrücken. Plastikflaschen. Nachdem ich jahrelang für Glasflaschen und wiederverwertbare Strohhalme geworben habe.
Adrian rutscht dichter an mich heran (Anmerkung: Er passt hervorragend zu Sarah. Er schert sich offensichtlich auch nicht um Privatsphäre), stellt seinen Becher ab und schafft es innerhalb von Sekunden, alle Zettel durcheinanderzubringen. »Du meinst für Duft-Kapseln aus Kunststoff, die man auf Glasflaschen schraubt, damit sie einem vorgaukeln, dass das Leitungswasser nach etwas schmeckt«, korrigiert er.
Wie auch immer. Welchen Sinn macht es einen nach irgendetwas riechenden Verschluss auf eine Flasche zu schrauben, um mir vorzugaukeln, dass ich Zitronenwasser trinke, wenn ich genauso gut richtiges Zitronenwasser trinken kann? »Es gibt sogar Schokoladengeruch.« Er hält einen Zettel hoch, den Mira interessiert ansieht.
Ich erkenne in dem Produkt immer noch keinen Sinn. Wieso will jemand Wasser mit Schokoladengeruch trinken? Außerdem produzieren die Geruchskapseln Müll. Nach spätestens dreißig Anwendungen müssen sie ausgetauscht werden.
»Also Fräulein Influencerin: Was müsste ich dir versprechen, damit Ratte und du kalorienfreie Getränke mit Lavendelgeruch auf euren Kanälen anpreist?«, fragt Adrian und schenkt mir ein Lächeln.
Ratte? Hat er Smoothie gerade Ratte genannt? Wow. Was für ein Idiot.
Als Matthias darum bittet, unser Brainstorming in einen der Konferenzräume zu verlegen, damit der Rest des Großraumbüros in Ruhe arbeiten kann, raffe ich meine Zettel zusammen und gebe Smoothie ein Zeichen mir zu folgen. Das Geklimper seiner affigen Stiefel verrät, dass Adrian uns hinterherläuft. Ich wähle irgendeinen Raum aus und deute dem Grafiker einzutreten.
Adrian zieht seine Lederjacke aus und hängt sie über die Rückenlehne eines Stuhls. Er trägt also ein schwarzes T-Shirt unter schwarzer Jacke. Und ich hatte nach Miras Anblick schon Angst, dass es nur ein Gerücht wäre, dass Designer gerne schwarz tragen. Adrian lässt sich auf den Stuhl fallen und sieht mich auffordernd an. Es dauert einen Moment, bis ich mich daran erinnere, dass er schon einmal hier gewesen ist. Er bewegt sich mit solch einer Selbstsicherheit durch die Gänge, als wäre er nie fortgewesen.
»Ich mag übrigens Hunde«, verkündet er ungefragt, als sich Smoothie unter den Tisch legt und mit lautem Schmatzen einschläft.
»Dann hör auf, ihn Ratte zu nennen«, schlage ich vor und setze mich ihm gegenüber. »Er heißt Smoothie.«
Adrians Blick gleitet unter den Tisch. »Weil er so ruhig ist? Oder wegen des seidigen Fells?«
Ich zucke lediglich mit einer Schulter. Was geht es ihn an? »Es musste übrigens nicht genäht werden.« Ich sortiere die Zettel auf dem Tisch.
Adrian sieht mich lediglich fragend an, bis ich auf das Pflaster deute. »Das freut mich«, antwortet er irritiert.
Ich sehe genauso verwirrt zurück. Das ist alles? Das freut mich? Keine Entschuldigung? Gar nichts? Offensichtlich bin ich hier die Einzige, die unser Wiedersehen seltsam findet. Passiert es ihm öfters, dass er wildfremde Frauen umrennt, die sich kurz darauf als Arbeitskollegin herausstellen?
»In Ordnung«, unterbricht er meine Gedanken. »Ich bin offensichtlich nicht die Person, die du dir als Teampartner erhofft hast, aber wir könnten trotzdem versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Einverstanden?« Er streckt eine Hand aus und hält sie mir hin, als wäre es ein Friedensangebot.
Unsere grenzenlose Begeisterung beruht anscheinend auf Gegenseitigkeit. Aber er hat Recht: Das hier ist Arbeit. Es geht um Professionalität. Wir sollen zusammenarbeiten, nicht einander heiraten. Also nicke ich und greife nach seiner Hand. Ich bin bereit. Vorerst.
Die ersten Minuten des Brainstormings fühlen sich seltsam an. Adrians Ideen sind vollkommen wirr. Und er hat keine Angst, sie zu äußern. Er scheint tatsächlich einfach alles auszusprechen, was ihm gerade in den Sinn kommt. Mir ist absolut schleierhaft, wie uns das helfen soll. Aber da die oberste Regel des Brainstormings lautet, die Gedanken fließen zu lassen, ohne einander zu kritisieren, unterbreche ich ihn nicht. Als ich mich endlich dazu überwinden kann, mich darauf einzulassen, ist es eigentlich ganz witzig. Auch wenn Adrians Hinweis, dass ihn Lavendelduft immer an Toilettenreiniger erinnert, eher wenig hilfreich ist. Zumindest fällt mir keine sinnvolle Brücke von Erfrischungsgetränken zu Toiletten ein.
»Frisch machen bekommt so einen ganz neuen Sinn«, stöhne ich und ertappe mich fast dabei zu lächeln, als Adrian auflacht.
»Der war nicht schlecht, Banana«, behauptet er mit einem Funkeln in den Augen, das ich nicht deuten kann. Aber die Art und Weise, wie er meinen Spitznamen ausgesprochen hat, klang nett. Da war etwas Samtiges in seiner Stimme, das selbst in der Erinnerung meine Ohren streichelt. Banana.
Ich schüttele den Kopf, als könnte ich dadurch meine Gedanken ordnen. Sie sind mit einem Mal so durcheinander wie Adrians Skizzen und Notizen, die überall auf dem großen Tisch verstreut liegen. Tatsächlich fühlt es sich mit jeder Minute weniger seltsam an, mit ihm die wildesten Ideen auszutauschen. Als er mir einen Stift reicht, um meine Gedanken zu notieren, zögere ich kurz. Der Grund dafür ist ziemlich ersichtlich. Ich habe eine grauenhafte Sauklaue, die neben Adrians akkurater Handschrift noch unbeholfener aussieht.
Voran kommen wir mit unserem Geblödel nicht, aber nach den Toilettengesprächen kann es wohl kaum noch schlimmer werden.
Als Mira sich am Mittag in den Raum schiebt, um Adrian zum Mittagessen abzuholen, endet der Spaß abrupt.
»Markthalle?«, durchschneidet Miras Stimme die Luft.
Adrian nickt ohne zu zögern und schenkt ihr den Ansatz eines flüchtigen Lächelns, als hätte sie ihn soeben aus der Folterkammer befreit. Als wäre er die Jungfrau in Nöten und ich der Drache, der ihn hier festhält. Arschloch.
»Wir kommen gleich«, versichert er und skizziert schnell etwas auf einem der Blätter.
»Wir?« Ich höre Miras Naserümpfen, auch ohne mich zu ihr herumzudrehen.
»Ich muss mit Smoothie raus«, lehne ich ab. Die Mittagspause ist unsere Gassizeit. Noch nie bin ich mit den anderen essen gegangen.
Adrian sieht mich fragend an, steht auf und greift mit einer eleganten Bewegung seine Jacke von der Stuhllehne. Schon wieder schenkt er mir ein Lächeln. Wie kann ein Mensch so viel lächeln?
»Wenn ich mich richtig erinnere, sind es von hier aus zehn Minuten Fußweg zur Markthalle und weitere fünf bis zu einem kleinen Park. Der wird Smoothie gefallen.«
Ich öffne den Mund, um etwas zu antworten. Stattdessen fühle ich mich, als hätte eine Geisterhand von meinem Kopf Besitz ergriffen. Sie zwingt mich zu einem Nicken.
Wenige Minuten später gehe ich in meinen Kuschelschal und einen grauen Mantel gehüllt hinter Mira die Straße hinunter. Sie unterhält sich mit Adrian über eine Band, die ich tatsächlich nicht kenne. Vielleicht ist ihr Musikgeschmack doch nicht ganz so Mainstream. Smoothie sorgt unterdessen dafür, dass wir alle paar Meter anhalten, damit er die Duftwolken vorangegangener Hunde inhalieren kann, nur um dann seine eigene Marke darüber zu setzen. Natürlich gehen die anderen weiter, ohne auf mich zu warten. Ich frage mich jetzt schon, warum ich überhaupt mitgekommen bin. Die meiste Zeit laufe ich schweigend hinter ihnen her. Erst als Smoothie wenige Meter vor dem Eingang zur Markthalle fast von einem bellenden Rauhaardackel angefallen wird (An die alte Dame in der Tweed-Jacke: Flexileinen haben nicht umsonst einen Stoppknopf. Den kann man benutzen …), bleibt Adrian stehen und sieht mich an, als wäre ihm gerade wieder eingefallen, dass ich auch noch existiere.
»Könnt ihr zwei fünf Minuten vor der Markthalle warten oder finde ich nur einen vollgefressenen, rülpsenden Dackel, wenn ich zurückkomme?« Sein Tonfall ist für mich nicht zu deuten. Dem Funkeln seiner Augen nach hat er gerade einen Scherz gemacht. Er scheint einen etwas eigenartigen Humor zu haben. Ich sage nur: Toilettenwasser. Ich weiß noch nicht, ob er mir gefällt. (Also sein Humor.)
»Dackel fressen keine Bananen«, antwortet Mira für mich und holt mich aus meinen abschweifenden Gedanken zurück.
Ich habe keine Ahnung, was sie genau gegen mich hat, aber würde ich sie fragen, lautete die Antwort bestimmt: Nichts, was akut helfen könnte.
»Team Banana-Smoothie – warten«, ordnet Adrian an.
Ich bin kurz davor zu salutieren, als er mit den anderen in der Markthalle verschwindet.
Smoothie und ich sind schon ein paarmal an dem Gebäude vorbeispaziert, aber da Hunde darin nicht erlaubt sind, ist es auch dabei geblieben. Eine Weile betrachte ich das Gebäude, über dessen Eingang in goldenen Lettern »MARKTHALLE« steht. Roter Backstein trifft auf hohe Fenster mit schmalen, schwarzen Fensterrahmen. Smoothie und ich ziehen uns ein wenig vom Eingang zurück, um der Masse hungriger Angestellter Platz zu machen. Gelangweilt lehne ich mich gegen eine Mauer. Aus fünf Minuten werden irgendwann zehn. Dann fünfzehn. Smoothie und ich beginnen erst uns zu langweilen, dann zu frieren. Gerade als ich mich frage, ob Adrian mich veralbern will, taucht Huskyauge in der Tür auf. Mit einer Hand hält er eine raschelnde Plastiktüte hoch, die andere hat er in seiner Jackentasche vergraben. Ich stoße mich von der Mauer ab, folge ihm in Richtung einer Straße, die ich noch nicht kenne.
»Sorry«, bringt er knapp hervor, als er die Stufen zum Gehweg hinunterkommt. »Es war voller als erwartet.«
Wir gehen schweigend nebeneinanderher, aber ich spüre förmlich, dass er mich aufmerksam von der Seite mustert. Sein Blick kribbelt, als würden Ameisen über meine Haut laufen. Ich komme nicht mal dazu, ihn zu fragen, wo er Mira und Matthias gelassen hat, als er den Mund öffnet: »Also, was läuft da zwischen Mira und dir?«
Ich rümpfe die Nase und sehe zweifelnd zu ihm auf. Was soll da laufen? Nichts. Sie kann mich aus irgendeinem Grund einfach nicht leiden und ich versuche krampfhaft, mir nicht anmerken zu lassen, dass es mittlerweile auf Gegenseitigkeit beruht.