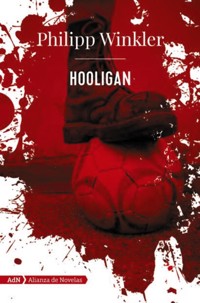14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Blick ins dunkle Herz der Hypermoderne
Sie kennen uns, denn sie beobachten uns. Und wir lassen sie in unser Zuhause, teilen online unsere intimsten Gedanken und Bilder.
In seinem zweiten Roman nach seinem gefeierten Debüt »Hool« erzählt Philipp Winkler die Geschichten von Fanni in Deutschland und Junya in Japan – beide suchen im Leben fremder Menschen, woran sie sonst verzweifeln: Kontrolle, Zugehörigkeit, Befreiung. Dabei überschreiten sie Grenzen, die für sie schon längst nicht mehr gelten.
»Creep« ist ein so berührender wie unerbittlicher Roman darüber, wie uns die Hypermoderne deformiert und wozu wir bereit sind, um der Dunkelheit – in uns – zu entkommen.
Die Presse über Philipp Winklers Bestseller-Debüt HOOL:
»Philipp Winkler versteht es, wie zuvor in »Hool«, nicht nur in die Welt der Außenseiter abzutauchen und sie zu erkunden. Er findet eine Sprache, die die Welt dar- aber nicht ausstellt.« WDR 1LIVE über »Carnival«
»Ein außerordentliches literarisches Werk über das Verlieren. « STERN über »Hool«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Fanni arbeitet für BELL, den führenden Anbieter für smarte Überwachungstechnik. Sie ist noch im Büro, wenn alle anderen längst gegangen sind und die Putzkolonnen anrücken, denn dann kann sie endlich die Kameras der Familie Naumann anzapfen. Deren Zuhause ist der einzige Ort, an dem Fanni so etwas wie Zugehörigkeit und Wärme empfindet. Die Naumanns ahnen nicht, dass Fanni existiert.
Junya ist ein erwachsener Mann, aber sein Kinderzimmer verlässt er scheinbar nie. Doch nachts schleicht er sich aus der Wohnung hinaus ins nächtliche Tokio. Er sucht nach diesem einen Moment, in dem er nicht mehr er selbst ist. Oder aber: mehr er selbst als in irgendeinem anderen Moment seines Lebens. Die schreckliche Methode, die er dazu wählt: Gewalt – und die Anerkennung dafür in den Darknet-Foren, in denen er die Videos seiner Streifzüge teilt.
Fanni und Junya leben unter uns, aber wir sehen sie nicht. Sie gehören zu der ersten Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist. Sie haben (dort) Dinge erlebt, die ihnen fast den Glauben an die Menschheit genommen haben. Dieser Roman erzählt ihre Geschichte. Es ist die Geschichte von uns allen – ob wir nun wollen oder nicht.
Über Philipp Winkler
Philipp Winkler, 1986 geboren, aufgewachsen in Hagenburg bei Hannover. Studierte Literarisches Schreiben in Hildesheim. Für seinen Debütroman »Hool« erhielt er den ZDF aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Debüt, stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und war zum Festival Neue Literatur in New York eingeladen. Der Roman war ein Spiegel-Bestseller, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und für die Bühne adaptiert. Eine Verfilmung ist in Vorbereitung. Er lebt in Niedersachsen auf dem Land.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Philipp Winkler
Creep
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
FANNI
JUNYA
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
»Full agoraphobic, losing focus, cover blownA book on getting better hand-delivered by a droneTotal disassociation, fully out your mindGoogling derealization, hating what you find«
Bo Burnham – That Funny Feeling
»Don't you dare go hollow«
Laurentius of the Great Swamp in Dark Souls
»Don't touch meWhats up wit itI stay noided, stimulation overload account for itDesensitized by the mass amounts of shit«
Death Grips – I‘ve Seen Footage
FANNI
Während die Naumanns den Esstisch für das Frühstück decken, schiebt Fanni die Tastatur bis auf den Standfuß ihres Primärmonitors, um Platz für die Rationsbeutel zu schaffen.
Im Videowiedergabefeld des Video Annotation Tools hilft Moira ihren Eltern beim Tischdecken, legt drei rechteckig abgerundete Platzsets aus Kork auf den Tisch. Ihr Okapi steht bereits am Kopfende.
Der Tisch ist aus Vollholz und war Georgs Gesellenstück. Das hatte er auf Nachfrage mal Freund_innen erzählt, die zu einem Brettspieleabend bei den Naumanns waren. Die Freund_innen fanden das beeindruckend. Fanni auch. Wenn auch bestimmt auf eine elementarere Weise.
Bis auf Rechner hat sie noch nie etwas Materielles gebaut. Und PC Building ist ohnehin etwas anderes, als einen Tisch selbst zu schreinern. Man setzt vorgefertigte interoperable Komponenten unter den Hauptgesichtspunkten von Performance und Effizienz zusammen, anstatt etwas von Grund auf aus einem Basismaterial zu formen.
Fanni holt die türkische 24 Hour Civilian Ration – Menüvariante 2 – aus ihrem Rucksack. Im Gegensatz zu den Soldat_innenrationen, die Fanni hauptsächlich nutzt, ist sie bunt, in satten Farben gehalten. Das Foto eines – so schätzt Fanni – Sees in der Türkei, die Berge im Hintergrund, ist allover auf die Tüte gedruckt.
Mit konzentriert herauslugender Zungenspitze trägt Moira drei ineinandergestapelte Müslischalen zum Tisch.
Fanni sortiert die in silbernen Beuteln versiegelten Breakfast-Bestandteile aus dem Rationspaket. Vier Scheiben Lavash-Brot, Käsebällchen, Adjikasoße und schwarze Oliven, nicht entkernt. Dazu ein Teebeutel Lipton Yellow Label und eine kleine Tube Honig.
Moiras Mutter Uta tritt in den Frame der Kamera. Sie verknotet ihr ewig langes dunkelbraunes Haar zu einem unordentlichen Dutt, bei dem Fanni immer an eine nicht näher definierte widerspenstige Steppenpflanze denkt. Uta schiebt ein paar Prospekte auf dem Tisch zusammen und legt sie irgendwo außerhalb des Kameraframes hin.
Als Fanni vorhin das Video Annotation Tool auf ihrem Arbeitscomputer geöffnet und sich sofort in den Account und die Indoor-Cam der Naumanns geloggt hatte, saß Georg schon mit seiner ersten Tasse Kaffee am Tisch und sah sich die Prospekte an. Soweit Fanni es erkennen konnte, handelte es sich um Prospekte verschiedener Fährunternehmen – Fanni konnte kleine, von Wasserblau dominierte Karten und die schwedische Flagge ausmachen.
Jeden Spätsommer besuchen die Naumanns Georgs Eltern, die für ihren Ruhestand nach Schweden ausgewandert sind. Zumindest haben sie es die vergangenen zwei Sommer so gemacht.
Fanni war vor etwas mehr als zwei Jahren auf die dreiköpfige Familie gestoßen, als sie nach Feierabend durch die Kund_innen-Datenbank zappte.
Fanni sah sie durch die bodentiefen Fenster hinter dem Esstisch. Uta und Georg topften auf der Terrasse Pflanzen um. Sie konnte nicht hören, worüber sie sich unterhielten. Moira lief barfuß herum und verteilte mit einem ernsthaften Gesichtsausdruck überall Blumenerde, so als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt. Das war etwas anderes als die gewöhnliche Impulsivität von Kleinkindern – Kindern im Allgemeinen –, die Fanni aus den Kamerafeeds und dem Real Life vom Sehen kannte. Moiras Eltern störten sich nicht an dem Schmutz. Sie sahen glücklich aus. Lachten und machten den Eindruck zufriedenen Existierens, ohne den Aftertaste von Selbstverständlichkeit. Das fand Fanni irgendwie sympathisch. Und war zu ihrer eigenen Überraschung gehooked. Sie prägte sich den in der BELL-Datenbank eingetragenen Namen und die dazugehörige Adresse ein, so dass sie sie wiederfinden würde.
Sie wohnen sogar hier in der Stadt. Im Norden. Nicht irgendwo sonst in Deutschland, in irgendeiner random Stadt. Auch wenn Lokalpatriotismus in Fannis Augen eine Form von Low-Key-Nationalismus ist, findet sie das so was Ähnliches wie schön.
Sie legt den Flameless Ration Heater auf den Boden des Heating Bags, steckt den gezippten Trinkbeutel dazu und gießt 100 ml Wasser in den Heating Bag, um die Redoxreaktion des FRH auszulösen. Dann drückt sie die Adjikasoße auf die runden Lavash-Scheiben und isst eine der öligen Oliven, während sie Moira dabei zusieht, wie sie die Knie voran auf ihren Stuhl am Tischende klettert. Uta bringt zwei Tassen Kaffee und ein Glas Orangensaft mit Fruchtfleisch für Moira. Georg rückt ihren Stuhl näher an den Tisch und schüttet Müsli aus einem zylinderförmigen Glasbehälter in ihre Schale.
Fanni verteilt die Käsebällchen auf den Lavash-Scheiben, drückt sie in die Soße, damit sie nicht so leicht rausrutschen können, wenn sie das dünne Fladenbrot wie Tortillas zusammenrollt.
»Sag, wenn’s reicht«, kommt Georgs Stimme aus den PC‑Boxen, die an den Trennwänden von Fannis Büro-Cubicle hängen.
Immer mehr Müsli häuft sich in Moiras Schale auf. Sie grinst ihren Vater verschmitzt an und stützt sich mit durchgedrückten Armen auf der Tischplatte ab. Fanni kann kaum hinsehen.
Vor ein paar Wochen war Moira aus der gleichen Position abgerutscht und hatte sich im Sturz an der Tischkante gestoßen. Sie hatte sogar eine kleine Platzwunde an der Stirn. Ihre Eltern reinigten die Wunde und klebten ihr ein Pflaster auf. Bevor Moira überhaupt anfangen konnte zu weinen, lenkten Georg und Uta sie mit einem Taschenspiegel ab und zeigten ihr die rote Strähne, die das Blut im Pony ihres Topfschnitts hinterlassen hatte.
»Wow, wie schick«, sagte Uta, und Georg dachte laut drüber nach, ob er sich auch eine Strähne seines weißblonden Haars rot färben sollte. Moira schüttelte kichernd den Kopf, und darüber war Fanni froh.
»Was«, sagt Georg in gespieltem Erstaunen, »so viel Hunger hast du? Lässt du Mama und mir denn auch noch was über?«
Moira nickt eifrig und bejaht. Ihr Pony fliegt auf. Die native Full‑HD-Auflösung der Indoor-Cam reicht nicht aus, um zu erkennen, ob sie eine kleine Narbe zurückbehalten hat, da, wo die Platzwunde war.
Fanni hofft, dass die Verkaufszahlen der aktuellen Version der Indoor-Cam bald rückläufig sein werden, weil das bedeuten würde, dass BELL die nächste auf den Markt wirft. Diese wird in der Lage sein, reinzuzoomen. Sobald die Verkäufe dieses Modells dann zurückgehen, wird die Version mit 4K-Auflösung und per App schwenkbarem Kamerakopf veröffentlicht. Die Prototypen der nächsten beiden Kameragenerationen sind bereits ausgetestet und bereit, in Serie zu gehen. Das weiß Fanni aus einem Dokument, das jemand unverschlüsselt und ziemlich sloppy im Intranet hat rumliegen lassen – sie musste Zeit totschlagen, als die Kundin, die sie gerade beim Yoga beobachtete, in einen nicht von Kameras erfassten Bereich ihres Hauses ging. Da sich sämtliche aktuellen Kameramodelle BELLs aber sowohl in den USA als auch in Europa, Indien und Teilen Ostasiens noch wie geschnitten Brot verkaufen, hat der Konzern keine Eile damit, die nächsten Generationen zu veröffentlichen.
Beim Frühstück reden Uta und Georg über eine Bewohnerin des Alten- und Pflegeheims, in dem Uta als Ergotherapeutin angestellt ist. Vorigen Monat war die Bewohnerin gestürzt, jedoch ohne sich etwas zu brechen oder zu prellen. Seitdem beharrt die Frau darauf, auch die kürzesten Wege mit dem Rollstuhl zurückzulegen. Uta sagt, dass sie sich Sorgen mache und dass solche Ängste oftmals zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen würden.
Fanni isst die zusammengerollten Brote. Die Käsebällchen darin knistern. Sie beobachtet Moira, die ihre Eltern wiederum mit besorgt hochgezogenen Augenbrauen beim Tischgespräch beobachtet. Sie schaufelt sich löffelweise Müsli, Joghurt und Blaubeeren in den Mund und kaut in der Wange, so dass das Auge auf der Seite ein wenig zusammengekniffen ist. Sie wirkt, als würde sie jeden Moment eine sehr kritische, wohlüberlegte Frage stellen, hört aber nur weiter still zu. Beobachtet. So wie Fanni.
Nach dem Frühstück räumen sie alle gemeinsam ab. Die drei Naumanns ihren Esstisch aus Vollholz. Fanni ihren weißen Schreibtisch im weißen Cubicle.
Sie kommt von der Damentoilette zurück, auf der sie die leeren Rationsbeutel entsorgt hat, und wechselt in die Videotürklingel der Naumanns. Moira schlüpft gerade in ihre Sandalen. Georg schiebt das Lastenfahrrad in das fischäugige Sichtfeld der Kamera. Uta verabschiedet sich von den beiden, steigt in den Kleinwagen und setzt rückwärts aus dem Frame. Dann fahren auch Moira und Georg los. Meistens bringt er sie in den Kindergarten, der auf direktem Weg zu seiner Tischlerei liegt.
Fanni schaut auf die Uhr. Es ist 7:43 Uhr. Ab 9 Uhr werden ihre Kollegen aus dem Research & Development allmählich in den Office Space tröpfeln.
Sie verlässt den Account der Naumanns und scrollt wahllos in der BELL-Datenbank herum. Dann öffnet sie den Eintrag eines Kunden aus Regensburg und schlüpft in eine seiner Indoor-Cams, um nachzusehen, ob jemand zu Hause ist.
»Hi«, sagt Marcel, der im Cubicle neben Fanni sitzt.
»Hi«, sagt sie und versucht, so zu wirken, als wäre sie auch gerade erst gekommen. Hätte eben erst ihren Rechner hochgefahren.
Marcel ist Student. Er macht ein Urlaubssemester, um Geld zu verdienen. Was er studiert, hat sie vergessen, oder er hat es nicht gesagt, als er sich an seinem ersten Tag vorgestellt hat. Sie reden zweimal am Tag miteinander. Hi, wenn er kommt. Ciao, wenn er geht. Er ist der perfekte Sitznachbar. Noch nie – zumindest nicht, dass Fanni es mitbekommen hätte – hat er sich auf seinem Stuhl zurückgelehnt, um aus seinem Cubicle bei ihr reinzuschmulen.
Ihr vorheriger Sitznachbar, dessen Namen sie von ihrer Festplatte gelöscht hat, war leider eine Quasselstrippe. Doch noch schlimmer war sein Kippeln, bei dem er sich jedes Mal an ihrer gemeinsamen Trennwand festgehalten hat. Sobald sie die Kugellager seines Schreibtischstuhls klappern hörte, wusste Fanni schon, dass jeden Moment wieder diese viergliedrige Fleischegelfamilie auf ihrer Seite der Trennwand kleben würde. Fingernägel, die sich in Augen verwandelten und ihr lidlos auf die Tastatur, auf die Monitore starrten.
Sie muss an das Foto des Ziploc Bags voller abgetrennter Finger in unterschiedlichen Verwesungszuständen denken, das sie vor Ewigkeiten mal auf Rotten.com gesehen hat. Sie kann sich nicht mehr an die spöttische Bildbeschreibung erinnern.
Sie startet das VAT, als sei es das erste Mal an diesem Tag.
Im Office Space flauen die Begrüßungsgespräche langsam ab und werden vom flüsternden Klicken der Maustasten und dem unbefriedigenden Geräusch von Rubberdome-Tastaturen abgelöst.
Ihre erste Instance heute. Eine Videotürklingel in Winsen (Luhe). Kleiner Vorgarten. Niedriger Zaun an drei Seiten. Fanni tippt auf Reihenhaus. Drei Treppenstufen führen von der Haustür hinunter. Unkraut, das zwischen den Steinplatten des Wegs hervorsprießt. Drei Pkw am Bürgersteig – alle anthrazitgrau. Auf der anderen Straßenseite links eine Flucht von Mietgaragen, rechts die Seitansicht eines mehrstöckigen Ziegelbaus mit senkrecht angeordneten Fenstern, die in der Hauswand so winzig wirken, als wären sie falsch skaliert.
Fanni zieht jeweils eine Bounding Box um die Autos und labelt sie in der Objektliste rechts vom Videowiedergabefeld Car‑1, Car‑2, Car‑3.
Sie klickhält den Marker in der Timeline der Kameraaufnahme und zieht ihn nach rechts. Die Hecken vor dem Ziegelbau flirren so unmerklich, dass es auch Pixelfehler sein könnten.
Etwas krabbelt in unnatürlicher Geschwindigkeit über den Weg, der den Vorgarten teilt. Fanni lässt die Maustaste los. Das Etwas ist groß genug, um seine recordete Existenz zu sehen, aber zu klein, um zu erkennen, was es ist. Kurz überlegt sie, eine neue Label-Kategorie zu erfinden und es dementsprechend zu markieren: Insect‑1. Würde sie damit einen Präzedenzfall schaffen, der sich durchsetzt, ihre R&D-Kollegen würden sie im internen Gruppenchat zuflamen, warum the fuck sie ihnen allen diese Extraarbeit machen musste. Sie lässt es und spult weiter vor.
Eine Person taucht hinter der Ecke des Ziegelbaus auf, geht zum Bürgersteig, nach rechts und aus dem Bildausschnitt. Es ist eine ältere Frau mit grauem Haar und floral bedruckter Kittelschürze. Sie zieht einen dieser Einkaufstrolleys hinter sich her, die Fanni außer von Rentner_innen nur von chinesischen Austauschstudierenden und Vollnerds kennt.
Sie spult zurück, umrahmt die Frau mit einer Bounding Box und labelt sie Person‑1. Sie drückt auf Play. Die Frau geht in Realgeschwindigkeit zum Gehweg vor. Fanni fällt auf, dass sie hinkt, und fragt sich, was sie sich getan hat. Ob sie auch gestürzt ist, so wie die Bewohnerin des Altenheims, von der Uta beim Frühstück erzählt hat? Wahrscheinlich gibt es in dem Mehrparteienhaus, aus dem sie kommt, nicht mal einen Fahrstuhl. Ein Rollstuhl wäre keine Option, selbst wenn sie wollte. Vielleicht hat sie auch keine Verwandten oder Bekannten mehr, die für sie einkaufen gehen oder ihr zumindest dabei helfen könnten. Oder sie hat noch einen Ehemann, der allerdings noch immobiler ist als sie, weshalb sie alleine zum nächsten Netto oder Penny hinken muss.
Die Bounding Box verliert sie, als sie vorne am Gehweg ankommt. Fanni drückt auf Stop und zieht die Bounding Box nach, so dass sie die Frau wieder einschließt. Play. Sie geht die Straße entlang. Stop. Fanni zieht die Box nach und spielt die Aufnahme weiter ab. Auf dem Frame, an dem jeder Pixel der Frau den Bildausschnitt verlassen hat, hält sie wieder an. Der Trolley ist noch zu sehen, doch genau genommen gehört er nicht zu Person‑1. Zählt auch nicht als Carried Object. Fanni checkt das Attributkästchen der Frau für Outside of view frame.
Sie spult manuell in der Timeline zurück. Jetzt schiebt die rückwärts gehende Frau den Einkaufstrolley, anstatt ihn hinter sich her zu ziehen. Der Algorithmus lässt die Bounding Box den Weg der Frau halbwegs exakt nachverfolgen. Fanni hält auf dem Frame an, an dem die Frau komplett hinter der Gebäudeecke verschwunden ist. Sie macht einen Haken bei Occluded or obstructed.
Dann drückt sie wieder auf Play und lässt die Frau ihres Weges gehen. In der Metadatenbeschreibung steht, dass das Recording zwei Wochen alt ist. Wahrscheinlich haben die Frau und ihr eventuell existierender Ehepartner die Lebensmittel inzwischen aufgebraucht, so dass sie bereits mindestens einmal wieder mit ihrem Trolley dort entlanggehumpelt ist.
An diesem Tag bearbeitet Fanni insgesamt 47 Instances aus ganz Deutschland. Sie rahmt Personen, Autos, Haustiere, Pakete ein. All das, was die Menschen meinen, wenn sie von Alltag reden. Von Normalität. Das, was zu sehen ist, wenn man die herausstehenden Nägel einhämmert. Wenn man alle Enden abschneidet, so dass allein die Mitte übrig bleibt. Vorgärten, der Mähroboter, Gassirunden mit dem Hund, ein Plausch mit den Nachbar_innen, die Müllabfuhr, Hände voller Einkaufstüten, der sich kontaktlos schließende Kofferraum des SUVs, Tornisterkinder. Zu harmloser Zweidimensionalität glatt gebügelt und auf einen einzigen leicht zu managenden Sinn reduziert. Das Leben, befreit vom Minenfeld der Interaktion. Von emotionaler Aufladung, von Erwartung und Haltung gereinigt. Alle Pitfalls aufgeschüttet und begradigt.
Wie jeden Tag ist Steve, der Teamleiter des Research & Development, der Letzte, der den Office Space verlässt. Wenn Fanni Lenker, Hinter- oder Vorderrad seines Rennrads erst gegen die Tür seines vom Rest des Büroraums abgetrennten Glaskubus und anschließend gegen die Eingangstür des Office Space prallen hört, dann weiß sie, dass sie wieder allein ist. Allein im Büro. Allein mit den landesweit 5 001 277 BELL-Kund_innen.
Als Erstes steckt Fanni den USB-Stick in ihren Rechner. Sie öffnet die Datenbank von BELL und extrahiert einen neuen Batch zufällig ausgewählter Kund_innen-Credentials.
Die einzelnen Datenpakete enthalten jeweils: Vor- und Nachnamen der Kund_innen. Ihre eingetragene E‑Mail-Adresse. Passwort. Zeitzone. Anschrift. Anzahl und Namen – in 99 % der Fälle gleichbedeutend mit ihrem Standort – aller an der jeweiligen Adresse angeschlossenen Kameramodelle.
Loggt man sich mithilfe der Credentials in einen Account, lassen sich außerdem alle eingetragenen Telefonnummern und per App verbundenen Devices sowie die Zahlungsinformationen des Kontos herausfinden. Im Fall von Kreditkarten sind das z. B. die Art der Karte, die letzten vier Ziffern der Kreditkartennummer sowie der CVV.
Dazu kommt, dass man natürlich auch Zugriff auf die Livefeeds der Kameras und deren Archiv von Recordings hat, sollte der_die Kund_in das Feature nicht deaktiviert haben. Und Fanni kann durch ihren arbeitsbedingten Zugriff selbst die Videohistorien dieser Kund_innen aufrufen. Weil es in den BELL-AGB vergraben und bis zur absoluten Unverständlichkeit verklausuliert ist, weiß kaum jemand, dass das Ausschalten der eigenen Videohistorie nicht bedeutet, dass dies auch für die Aufzeichnung und Speicherung aufseiten BELLs gilt.
Fanni zieht den USB-Stick ab und schiebt ihn zurück in das enge Frontfach ihres Laufrucksacks. Dann öffnet sie das Video Annotation Tool.
Die Naumanns essen meist zwischen 18 und 19 Uhr zu Abend. Darin unterscheiden sie sich kaum vom Großteil der anderen BELL-Kund_innen. Im Anschluss verbringt Fanni noch ein wenig Zeit mit ihnen. Bis Moira ins Bett gebracht wird.
Davor und danach schaut sie durch Videotürklingeln und Indoor- und Outdoor-Cams und setzt sich in ihrem Bürostuhl um, wenn ihr der Hintern oder die Oberschenkel einschlafen. Sie ist live dabei, wenn der DabbaWala-Kurier das ersehnte griechische Essen für den Abend mit Freund_innen bringt. Leistet einer Frau in Kassel Gesellschaft, die nach Hause kommt und sofort – ihren Arztkittel noch an – mit einer Dose Bier auf die Terrasse geht, und einen werbespotwürdigen ersten Schluck nimmt. Sieht mit an, wie sich ein älterer Mann in Schneverdingen mit einem Berner Sennenhund auf die Couch quetscht und sie sich ein Eis am Stiel teilen. Wie ein Ehepaar in Pforzheim mit angespannten Hälsen über die Hausaufgaben ihres Sohnes streitet. Sieht ein anderes in Markkleeberg, das seine Sexschaukel aus dem Kleiderschrank holt und in die Deckenhaken im Schlafzimmer einklinkt. Sie beobachtet einen Mann in Oberhausen, der minutenlang bei ausgeschaltetem Motor in seinem Auto sitzen bleibt – die Stirn auf dem Lenkrad –, bevor er ins Haus geht.
Um 23:01 Uhr springt die Innenbeleuchtung des Gebäudes mit einem lauten Klacken auf maximale Intensität und kündigt die Ankunft der Putzkolonne an.
Fanni sieht von ihren Monitoren auf und blinzelt sich von der gefilterten Realität zurück ins Hier und Jetzt des IRL. Sie fährt den PC runter und schultert ihren Rucksack.
Wie jeden Abend kommen ihr im letzten Gang vor dem Foyer die Reinigungskräfte entgegen. Sie schieben Wägen vor sich her, deren Chemikalienarsenale Fanni jedes Mal an Ricardo López erinnern. Der Björk-Stalker sendete im Jahr 1996 eine Briefbombe mit Schwefelsäure an die isländische Sängerin. Das Paket wurde allerdings von Scotland Yard abgefangen und konnte sicher detoniert werden. Manchmal, wenn die Reinigungskräfte ihre laute Unterhaltung, die den gesamten Gang füllt, unterbrechen, sobald Fanni um die Ecke biegt, stellt sie sich vor, dass unter ihnen ein verkappter Ricardo López ist, der im Geheimen bei sich zu Hause an einer Concoction der ätzendsten Putzmittel werkelt, um sich an irgendjemandem zu rächen.
Fanni hält den Kopf unten und weicht den Wägen und den Blicken aus, als würde sie eine viel befahrene Straße entlanglaufen. Bis sie aus dem Gebäude ist, sind alles, was sie sieht, ihre Laufschuhe und der Vinylboden in BELLs Brand Color, Pale Robin Egg Blue.
Sie steht an der Haltestelle Businesspark Süd, neben dem Lichtkegel der Laterne, und wartet auf die nächste Tram, die ein paar Stationen später zur U‑Bahn wird.
An der Seitenscheibe des Haltestellenhäuschens kleben die Überreste irgendeines Käfers. Vor der Sitzbank im Häuschen der Schatten des zerquetschten Insekts. Vom Laternenlicht auf den Boden geworfen. Fanni denkt an einen Post – Titel: Human Shadow of Death –, den sie mal im SickeningReality-Subreddit gesehen hat. Er enthielt eine Bildergalerie mit den groben schwarzen Umrissen von Personen, die sich innerhalb des Explosionsradius der Atombombe von Hiroshima befunden hatten. Durch ihre Gegenwart hatten sie verhindert, dass der Bereich unmittelbar hinter ihnen – im Gegensatz zur übrigen Umgebung – von der nuklearen Hitze wie gebleicht wurde. So entstanden die schattenähnlichen Abdrücke auf Stein und Asphalt.
Die Tram rumpelt durch die entzündete Nicht-Dunkelheit des Industriegebiets heran. Sie ist größtenteils leer. Fanni steigt ein. Die Tram fährt los. Erst verliert sie den Abdruck des zerquetschten Insekts aus dem Blick. Dann die Materie, die den Schatten erst möglich macht. Kurz darauf ist auch der Gebäudekomplex von BELLs Mutter-Company Zenith nicht mehr zu sehen.
JUNYA
Sein Zeigefinger auf der Maus. Maustaste und Knöchel klicken. Aus den Kopfhörern, die auf dem PC‑Tower liegen, wummern Hammerschläge. Junya schiebt die Maus auf dem Mauspad umher, in dessen Mitte der neoprenartige Stoff bereits hauchdünn und rissig geworden ist. Das Kabel der Maus raschelt durch zusammengeknüllte Taschentücher und Druckerpapier, stößt gegen schimmelflaumbewachsene Instant Ramen-Cups und auf dem Bauch liegende, leere Ramune-Flaschen. Mit einem weiteren Mausklick stutzt Junya das Ende des Videos. Anschließend startet er den Render- und Exportierungsvorgang.
Während er wartet, schlägt er wahllos ein vergilbtes Tankōbon von Hokuto no Ken auf. Protagonist Kenshiro sieht sich wieder mal einer Bande postapokalyptischer Banditen gegenüber, die für ihn und seine hyperschnellen Faustschläge jedoch kein Hindernis sind. Beeindruckt von dieser Darstellung roher, müheloser Gewalt geraten die übrigen Banditen gehörig ins Schwitzen und ziehen sich mit den Worten »Er … er ist ein Monster!« zurück.
Die Exportierung ist abgeschlossen. Junya legt das Buch zurück auf den Stapel seiner Manga, die sich von dem überfüllten Aluminiumregal neben seinem Schreibtisch wie Pilzkulturen auf dem Boden ausgebreitet haben. Die kleinen Rollen des Regals ächzen von Jahr zu Jahr mehr unter dem Gewicht der telefonbuchdicken abgegriffenen Exemplare von Shūkan Yangu Sandē, Bessatsu Māgaretto und Gekkan Afutanūn sowie Junyas Sammlung von Büchern über Yōkai und Tankōbon-Ausgaben von Hokuto no Ken, Yokohama Kaidashi Kikō, Nozokiya und anderen größtenteils seit Ewigkeiten bereits abgeschlossenen Manga-Reihen.
Trotz Junyas Bemühungen, seine Tür nur für absolut Notwendiges zu öffnen, hat die Zeit ihren zersetzenden Atem über seine Habseligkeiten gehaucht. Sie hat die Wärmeleitpaste seines Computers austrocknen lassen, Schimmelherde in seinem Mülleimer und den herumliegenden Katto Yocchan Ika-Tüten gesät, das Schreibtischstuhlpolster unter seinen Sitzknochen zersetzt und dunkle, feuchte Flecken in die Ecken seines Zimmers geleckt, als hätte sich der Dämon Tenjōname in Junyas Zimmer einquartiert. Seit neuestem macht die Zeit sich einen Spaß daraus, hellköpfige Warzen auf Junyas Körper heranzuzüchten, die er, sich verrenkend, versucht zu fotografieren und per Bildersuche zu diagnostizieren.
Er öffnet das Forum im Tor-Browser, loggt sich ein und lädt das Video in der Creator’s Corner hoch.
Auf der Straße hupt ein Auto. Sofort darauf das Quietschen von Reifen und ein blecherner Aufprall. Junyas Neugierde gewinnt. Er überfliegt seine Caption nur kurz, ignoriert die Englischfehler und postet sein neuestes Werk. Dann stellt er sich am Fenster auf die Zehenspitzen, um über die Hecke gucken zu können.
Auf der Kreuzung steigt ein Mann mit fliegender Krawatte aus seinem Wagen. Er wirft die Hände hoch, als er um die Motorhaube des Autos herumgeht, auf der lose großformatige Zettel liegen. Einige wirbeln zu Boden. Ein abgeknickter Fahrradreifen und eine Rucksacktasche, deren Material nach wasserabweisendem Polyurethan aussieht, ragen hinter der Hecke hervor. Der Mann spricht zu jemandem, den Junya nicht sehen kann, und schaut sich gehetzt um. Dann schüttelt er seine Armbanduhr frei. Junya sieht, wie der Mund des Mannes einen Vokal des Erschreckens ausstößt, der Junya selbst nicht unbekannt ist, wenn auch aus anderem Kontext und mit einer ungleich höheren Qualität. Der Mann springt zurück in sein Auto. Dann fährt er das Beifahrerfenster herunter und lässt eine Handvoll Geldscheine fallen. Das Fenster ist noch nicht wieder geschlossen, da setzt der Wagen zurück und fährt davon.
Später sitzt Junya vor seinem geöffneten Thread im Forum, drückt immer wieder F5 und versucht zu errechnen, wie spät es gerade in den Zeitzonen anderer Forenmitglieder ist. Der Viewcounter seines Threads ist, seit Junya das Video gepostet hat, um acht angestiegen, was bedeutet, dass sich in der Zwischenzeit nur zwei andere Personen den Thread angesehen haben. Trotzdem wartet er noch auf ein erstes Feedback. Er drückt erneut F5.
Geschirrklappern und das Geräusch von auf dem Holztablett hin und her rollenden Stäbchen kündigen das Frühstück an.
Junya minimiert das Browserfenster und fokussiert die Holzfusuma. Seine Mutter wird es nicht wagen, sein Zimmer zu betreten. Das hat sie nicht mehr getan, seit er siebzehn war; bei ihrem letzten Versuch, ihn mit ihrem bei den Sumō-Kampfrichtern abgeschauten, »nokotta!« zurück zur Schule zu beordern.
Sie stellt das Tablett im Flur ab. Junyas Magen, der unter dem Gerippe blubbert, drängt ihn zum Aufstehen. Er hört, wie sie versucht, ihr Husten in der Faust zu verstecken. Er wartet auf das sich entfernende Schlurfen ihrer Hausschuhe. Dann steht er auf und holt sich sein Frühstück herein.
Junya isst das Schälchen mit Tsukemono und schaut sich das Video ein weiteres Mal an, eine Kopfhörermuschel über dem Ohr. Die andere dahintergeschoben. Als er die letzte Gurkenscheibe zum Mund führt, klopft es an der Tür. Die Gurke flutscht von den Essstäbchen und platscht zwischen seine nackten Füße auf die Schreibtischstuhlunterlage aus PVC. Er reißt sich die Kopfhörer herunter und schließt Videoplayer und Browser. Er klammert sich an die Armlehnen seines Stuhls und versucht, ganz still zu bleiben. Vielleicht zieht der Eindringling dann wieder davon. Es klopft erneut.
»Junya-kun?«, kommt es von hinter der Zimmertür. Es ist Maedas Stimme.
Junya schaut sich schnell um. Am Boden vor seinem Nachtkästchen liegen das offene Lockpickset und einige seiner Übungsschlösser. Aus dem Handtuchhaufen vor dem Fußende des Bettes ragen seine zusammengeknüllte Tobi-Hose und der Regenmantel heraus. Irgendwo im Haufen steckt die Maske. Davor stehen die Jika-tabi, alte Arbeitsschuhe mit separiertem großen Zeh. Der Stiel des alten Holzhammers seines Vaters schaut unter dem Bett hervor. Junya wollte die Sachen nach dem Frühstück reinigen. Der Eimer, in dem sich die Packungen Natron und Backpulver befinden, steht direkt neben der Tür; bereit zum Einsatz. Seine Augenlider zucken, als würden sie von mikroskopischen Nadeln dazu animiert.
»Junya-kun?« Maeda-sensei räuspert sich laut. »Deine Mutter sagte mir, dass sie dir eben erst dein Essen gebracht hat. Ich schätze also, dass du noch nicht wieder im Bett liegst und schläfst.«
Junya zieht reflexhaft die Zehen ein, als würde er mit ihnen etwas greifen wollen. Wieso kann ihn der alte Mann nicht einfach in Frieden lassen? Er sinkt vom Stuhl auf den Boden und schiebt die Übungsschlösser in den dicht bevölkerten Schatten unter seinem Bett.
Hat er nicht erst kürzlich eines von Maedas mitleiderregenden Treffen durchgestanden und sich dafür sogar dem Tageslicht ausgesetzt? Er hatte gehofft, dies würde ihm den alten Mann für eine gewisse Zeit vom Hals halten.
»Ja«, sagt Junya und zuckt unter der Schräglage seiner eigenen Stimme zusammen. Er ist es nicht gewohnt, laut zu sprechen. Überhaupt zu sprechen. »Einen Moment, bitte.«
»Ich bin im Ruhestand, Junya-kun. Da hat man alle Zeit der Welt.«
Von seiner Oberlippe tropft Schweiß in das Etui mit seinem treuen Werkzeug. Anstatt die Picks der Größe nach geordnet in ihre Schlaufen zu schieben, legt er sie lose hinein, klappt die Ledertasche zu und versenkt sie in der Schublade seines Nachtkästchens.
»Ich wünschte nur, ich könnte mich hinsetzen. Die alten Knochen machen mir wieder zu schaffen.« Junya ignoriert den Wink.
»Was kann ich für Sie tun?«, sagt er und positioniert sich sicherheitshalber in Türnähe.
»Du könntest«, Maeda belegt das Wort ›können‹ mit der Schwere einer versteckten Aufforderung, »die Tür öffnen. Meine Generation unterhält sich gerne von Angesicht zu Angesicht. Wie soll man seinen Mitmenschen denn sonst ein so arg benötigtes Lächeln schenken? Aber du sollst dich natürlich nicht genötigt fühlen, Junya-kun.«
Junya sucht in sich nach der Stärke zu verbaler Konfrontation. Doch vergeblich. Da ist nur Ohnmacht in ihm.
»Na gut. Ich statte deiner Mutter und dir lediglich einen Besuch ab, um zu hören, wie es euch geht.«
»Gut. Danke für Ihren Besuch.«
»Nun, wenn dem so ist, dann freut mich das natürlich, Junya-kun. Du weißt aber hoffentlich auch, dass du ehrlich mit mir sein kannst, wenn es anders ist.«
Ständig sagt der Alte Dinge, denen Junya nicht entnehmen kann, ob es sich dabei um Fragen oder Aussagen handelt. Diese Unberechenbarkeit erträgt er nicht, genauso wenig wie die Erwähnung seiner Mutter.
»Ich habe mich mit deiner Mutter unterhalten.« Er macht eine Pause. »Ich muss ehrlich sein«, noch eine Pause. »Ich mache mir Sorgen.«
»Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen Sorgen bereite, Maeda-sensei. Es geht mir wirklich –«
Maeda fällt ihm ins Wort: »Ich rede von deiner Mutter, Junya-kun. Kannst du dich noch erinnern, wann ihr zum letzten Mal ein Wort miteinander gewechselt habt?«
»Nein. Schon lange her, schätze ich«, lügt Junya und presst sich an die Wand. Nur zu gerne würde er mit ihr verschmelzen. Sehnsüchtig schaut er zu seinem Computer, dessen Lüfter das Zimmer mit seinem Surren erfüllt. »Ich – ich habe noch zu tun.«
Er lässt den Blick weiterschweifen und bleibt am Haufen von Handtüchern haften, die er unter das Fußende des Bettes gequetscht hat. In der Eile muss er übersehen haben, dass das schwarze schnabelähnliche Maul der Maske noch zu sehen ist.
»Na schön. Vielleicht ein anderes Mal«, sagt Maeda. »Doch weshalb ich ebenfalls hier bin: Ich wollte vorfühlen, ob ich dich nicht davon überzeugen könnte, wieder mal zu einem unserer monatlichen Treffen zu kommen.«
Fast hatte er schon geglaubt, Maeda würde ihn diesmal damit verschonen.
»Danke für die Einladung, aber ich fürchte, ich fühle mich noch nicht bereit, so bald nach dem letzten Treffen.«
Es klingt, als würde Maeda seinen Hals von festsitzendem Schleim klären.
Dann sagt er: »Bist du so gut und sagst mir, welchen Monat wir haben?«
Diese Frage verwundert Junya.
»Es ist Juli. Wir haben Juli«, sagt er, nachdem er kurz darüber nachdenken musste.
Hinter der Tür schnaubt Maeda.
»Junya-kun. Als du zuletzt an einem Treffen teilnahmst, lag noch Schnee. Das ist nun schon fast ein halbes Jahr her.«
Junya legt den Kopf schief. Das kann nicht stimmen. Er kann nicht fassen, dass es so lange her sein soll.
»Der nächste Termin ist erst in zirka zwei Wochen. So kannst du es dir in aller Ruhe überlegen. Abgemacht, Junya-kun?«
Er bejaht, nickt wie ferngesteuert und fragt sich, was es nur ist, das die Welt außerhalb seines Zimmers so rasen lässt.
Maeda verabschiedet sich, und als Junya sich gerade wieder gesetzt hat und die Gurkenscheibe aufhebt, klopft es erneut an der Tür.
»Fast hätte ich es vergessen. Deine Mutter gab mir einen Brief für dich. Sie hat vergessen, ihn dir zu deinem Essen dazuzulegen. Er ist von der Geidai. Schon wieder ist ein Jahr vergangen. Ich finde es bewundernswert, dass du nicht aufgibst.«
Die glitschige Blöße der fermentierten Gurke zwischen den Fingern, wartet Junya darauf, dass der Alte das Schreiben vor die Tür legt und geht.
»Magst du mir die Tür öffnen, damit ich dir den Brief geben kann?«
Junya will verneinen. Er will, dass Maeda abhaut, damit endlich wieder Ruhe einkehrt. Damit die Illusion, sein Zimmer schwebe in einem zeitlosen schwarzen Vakuum, sich wiederherstellen kann. Stattdessen schiebt er die Tür ein wenig auf. Maedas quadratischer Kopf füllt die Breite des Spalts aus. Wie ertappt tritt er einen Schritt zurück. Er scheint nicht erwartet zu haben, dass Junya tatsächlich öffnet. Über seiner Brille ziehen wellenförmige Falten quer über die Stirn und lassen sie wie eine von Windströmungen gerippelte Sanddüne aussehen.
Maeda hält Junya den Briefumschlag hin. Seine mit Längsrillen unterteilten Fingernägel sehen aus wie Miniaturdachziegel. Junya greift nach dem Schreiben, und der Alte schenkt ihm sein mitgebrachtes Lächeln. Es ist gut dosiert und wohltuend wie ein Löffel warmer Ume-Sirup. Junya bedankt sich mit einem kurzen Nicken und schließt die Tür.
Das Ablehnungsschreiben der Tokioter Kunsthochschule entspricht im Wortlaut exakt denen der vergangenen Jahre. Sie bedanken sich förmlich für sein Interesse an einem Studium an der Tōkyō Geijutsu Daigaku. Es folgen eine Entschuldigung sowie eine Mitteilung darüber, dass die Prüfungskommission auch weiterhin keine Bewerbungen seinerseits mehr berücksichtigen könne. Zum einen, da er schon vor Jahren die Maximalzahl erfolgloser Bewerbungen für das Studium erreicht habe. Zum anderen, weil ihm bereits mehrmals erörtert worden sei, dass bei Bewerbern ohne ein abgeschlossenes Grundstudium an der Geidai oder einer vergleichbaren Kunsthochschule eine außerordentliche künstlerische Befähigung erkennbar sein müsse. Diese liege in seinem Fall nicht vor. Weiter steht dort, dass sie Junya seinen eingereichten USB-Stick aus, wie sie behaupten, logistischen Gründen nicht zurücksenden können. Wie in jedem Jahr schließen sie damit, dass sie ihm viel Glück auf seinem weiteren Weg wünschen und ihn nochmals darum bitten möchten, von weiteren Bewerbungen abzusehen.
Als er sich auf seinen Stuhl fallen lassen will, rollt dieser unter seinem Gesäß weg und Junya knallt mit dem Steiß auf den Boden. Sein Gesicht zieht sich zusammen, als würde es den Schmerz einsaugen, und in seinem Schädel, zwischen Haut, Gehirnmasse und Knochensplittern, ersticken wollen.
Ein verschleimtes Röcheln auf dem Flur. Seine Augen blitzen zur geschlossenen Tür. Schälchen klimpern auf dem Tablett, als Junyas Mutter es vom Boden des Flurs aufnimmt und wegträgt.
Noch einmal überfliegt er das Schreiben. Später wird er es zu den anderen in den Ordner heften. Zuerst aber wird er die Kleidung und den Sanmoku-Hammer von den Spuren der letzten Nacht befreien.
In der anderen Haushälfte klirrt es plötzlich laut. Bevor er sich dessen überhaupt bewusst ist, ist er auf den Beinen, aus dem Zimmer hinaus und tappt barfuß den Flur entlang.
Er linst um die Ecke in das kleine Wohnzimmer, welches gleichzeitig als Durchgangsraum zum Kochbereich dient. Das Geschirr, von dem Junya zuvor noch gegessen hatte, liegt in wildem Mosaik verteilt auf den Tatami. Seine Mutter sitzt mit dem Rücken zum Flurdurchgang auf einem Bein. Das andere ist zur Seite hin abgewinkelt. Der Hausschuh liegt neben ihrem Fuß. Es sieht sehr unbequem aus und als posiere sie für einen Bildhauer oder Maler. Ihre altmodische Frisur, an der sich, bis auf die Ergrauung, seit vierzig Jahren nichts geändert hat, ist in Unordnung geraten. Zum ersten Mal, solange er zurückdenken kann, wirkt die Frisur seiner Mutter wie echtes Haar und nicht wie ein entlaufener Laborparasit, der sich auf ihrem Kopf verankert hat.
Er beobachtet sie vom Durchgang aus. Wie sie dasitzt, neben sich den umgeworfenen Kotatsu-Heizofen, der seine kurzen Beine gen Decke streckt und sein Heizelement entblößt. Sie macht keine Anstalten aufzustehen oder sich aus der Position zu lösen.
Der Kotatsu ist alt – so wie das ganze Haus. Einer der ersten Generationen, die mit elektrischen Heizspiralen unter der Tischplatte ausgestattet waren. Davor hatten die Menschen Schalen mit glühender Kohle unter den kleinen Deckentischen stehen.
Als Kind hat sich Junya oft vor seiner Mutter darunter versteckt. Wenn die Hänseleien wieder solch ein Ausmaß angenommen hatten, dass er am Morgen schon vor Schulbeginn in Tränen ausbrach. Oder wenn sie ihn wieder zwang, sein üppiges Abendessen aufzuessen, obwohl er nichts mehr herunterbekam.
Unter der dicken Steppdecke roch es nach verkokelten Fusseln und den Füßen seines Vaters. Junya rollte sich so klein zusammen, wie er nur konnte, und stellte sich dann vor, er wäre ein Vogelküken in einem Brutkasten, das man nicht stören durfte, bis es aus seinem Ei geschlüpft war. Doch seine Mutter kümmerte sich nicht um Hirngespinste und Befindlichkeiten. Wenn er am Morgen weinte und schluchzte, er wolle nicht zur Schule gehen, jagte sie ihn durch das Haus. War es ein ungerader Monat und somit die Zeit des nächsten großen Sumōturniers, so war Junyas Mutter ganz besonders engagiert und unbarmherzig. Dann stampfte sie auf wie ein Gyōji, einer der Kampfrichter, erhob ihre gusseiserne Pfanne wie einen Gumbai-Fächer und bellte ihm mit tiefer Stimme wiederholt ihr »hakkeyoi!«, gefolgt von einem zackigen, »oi«, hinterher, während er wimmernd vor ihr weglief.
Eines Morgens war es Junya wieder einmal gelungen, in den warmen, nach Arbeiterfüßen riechenden Bauch des Kotatsu zu kriechen, als die Tatami unter ihm erbebte und ihr Kommen ankündigte. Als ihre Hand wie eine Giftschlange unter die Steppdecke schoss, versuchte Junya sich kleiner zu machen, als er es je geschafft hatte. Aber die von der Hausarbeit raue Hand seiner Mutter hatte ihn am Fußknöchel zu fassen bekommen. Junya schrie auf und stieß mit dem Kopf gegen das Heizelement, das wie ein aggressiver Bienenschwarm brummte. Nachdem sie seinen Kopf in eiskaltes Wasser getunkt hatte, setzte sie ihm seinen Randoseru auf den Rücken und schickte ihn zur Schule, so dass er »ja nicht zu spät zum Unterricht« erschien. Über Junyas Schläfe hatte der Heizstab einen Krater in seine Haare gebrannt und die Haut darunter versengt. An diesem Tag war die Schikane, die er von seinen Klassenkameraden zu ertragen hatte, schlimmer als je zuvor und setzte einen neuen Standard für die kommenden Jahre.
Wenn er jetzt den Hammer seines Vaters in der Hand halten würde. Er könnte es tun. Im Nachhinein könnte er auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren, indem er beim Verhör aussagte, er habe lediglich den grau melierten Parasiten erledigen wollen, der von seiner geliebten Mutter Besitz ergriffen hatte.
Ihr Kopf hebt sich. Sie streckt den Rücken durch, so dass ihr Oberkörper fast auf seine doppelte Länge anwächst. Eine Sekunde vergeht. Dann wird ihr Kopf in einem gewalttätigen Hustenanfall umhergeworfen. Ihr Rücken krümmt sich unter dem violetten Jäckchen zu einem Buckel. Auf eine Weise, die ihm fremd ist, gruselt ihn der Anblick. Als habe seine Mutter jegliche Körperspannung, ja im Grunde sich selbst, aufgegeben und sich vollständig dem knallenden, rüttelnden Husten hingegeben.
Als der bellende Sturm sich gelegt hat, sitzt sie gekrümmt da. Ihre Nasenspitze berührt fast schon die Tatami-Matte. Sie atmet schwer und erschöpft, wie eine im Sterben liegende Raubkatze.
Junya löst sich aus seiner Starre. Auf nackten Sohlen schleicht er zurück in sein Zimmer.
FANNI
Das Haus, in dem Fanni in einer von zwei Dachgeschosswohnungen wohnt, gehört – neben einigen weiteren Immobilien in der Stadt – ihrem Vater. Trotzdem zahlt sie Miete.
Sie hatten nie über einen Verwandtenrabatt oder Ähnliches gesprochen. Wie sie nie über irgendetwas sprachen. Direkt nach dem Abitur unterschrieb sie den Mietvertrag für die möblierte Wohnung, zog aus und bezahlte zu jedem Monatsanfang kommentarlos ihre Miete. Und genauso kommentarlos wurde das Geld vom Bankkonto ihres Vaters empfangen. Nur die Kaution hatte sie nicht gezahlt. Das war während eines Gesprächs von ihrer Mutter, kurz vor dem Auszug, beiläufig, aber imperativ abgehakt worden. Fanni wusste nicht, ob ihre Eltern darüber geredet und eine Abmachung getroffen hatten. Oder ob ihre Mutter ihr das von ihrem Vater weitergeben sollte. Fanni fragte auch nicht nach. Nahm es einfach hin. Jedes Mal, wenn sie sich zum Geburtstag ihrer Mutter sehen, fragt er verben- und adjektivlos nach der Wohnung. Meistens erinnert er sie zusätzlich noch ans Stoßlüften.
Was ihr Vater nicht weiß: während ihres Studiums verschenkte sie den Großteil der Einrichtung über eBay-Kleinanzeigen. Sie wollte das Zeug nur loshaben. Das gehörte zu ihrem damaligen Optimierungsprozess dazu. Alles, was nicht tagtäglich von Nutzen oder in irgendeiner Weise fest montiert war, flog raus. Regale und Stühle über die Brüstung ihres Balkons zu schubsen, wäre natürlich bedeutend kathartischer gewesen. Aber sie wollte nicht die Schuld an einem lächerlichen Passant_innentod – »Von Sideboard erschlagen« – tragen.
Die Minimierung direkter interpersonaler Beziehungen war ebenfalls ein elementarer Teil dieses Prozesses. Wann immer Leute kamen, um Möbel oder sonstigen Stuff wie DVDs oder Küchenutensilien abzuholen, ließ Fanni sie ins Haus, öffnete die Wohnungstür und lief ins Schlafzimmer. Von dort aus rief sie die Leute rein und sagte ihnen, dass sie sich einfach bedienen sollten. Ihre Ausrede, warum sie nicht aus dem Schlafzimmer kommen könne – geschweige denn beim Tragen helfen –, war eine hochansteckende Krankheit. Ein paar der Sachen musste sie noch mal einstellen, weil manche das Risiko nicht eingehen wollten, sich über Keime an den Gegenständen anzustecken.
Das Mobiliar, das die Aktion überlebt hatte, waren das Bett, der Nachtschrank, Sofa und Couchtisch und der Schrank in der Küche. Darin bewahrt Fanni ihre Meal, Ready to Eat-Rationen auf.
Die Luft in der Wohnung ist trocken und atmet sich wie feiner Nebel aus Staub.
Die Vorhänge am Balkon und das Plissee des Dachfensters in der offenen Küche sind seit Wochen zugezogen. Draußen ist Sommer. Auch das Licht bleibt ausgeschaltet. Der Griff zum Lichtschalter wäre vollkommen unnötig. Die Wege haben sich ihr ins Körpergedächtnis eingebrannt. Auch eine MRE-Ration aus dem Vorratsschrank für den nächsten Tag auszuwählen, funktioniert reibungslos im Dunkeln. Sie weiß genau, welche Ration, welche Menüvariante wo liegt. Ihr gesamtes Inventar, das Rationen aus aller Welt umfasst, ist jederzeit abrufbar in ihrem Kopf gespeichert. Sie entscheidet sich für die dritte von vorne in der rechten Reihe. Eine australische PR1M-Ration, entwickelt für Special-Forces-Einheiten.
Nachdem sie ihre Wasserflasche an der Spüle aufgefüllt hat, stellt sie ihren Rucksack vor die Trennwand zwischen Küche und Wohnzimmer. Den USB-Stick mit dem neuesten Batch BELL-Kund_innendaten legt sie auf den Couchtisch. Dann geht sie ins Schlafzimmer und zieht sich aus. Auf dem Weg ins Badezimmer, das vom Windfang abgeht, nimmt sie den Rucksack mit und stellt ihn, fertig gepackt, vor die Wohnungstür.
Sie duscht im Dunkeln, das Wasser auf Anschlag nach links. Eiskalt rauscht es aus der Brause. Noch immer reagiert ihr Körper in dem Moment, in dem die ersten Spritzer auf ihre Epidermis hageln, mit Fluchtdrang. Sie zwingt ihn mit Gewalt dazu, nicht aus der Duschkabine zu springen. Ist eine gewisse Schwelle überschritten, setzt körperweite Taubheit ein, und es wird erträglich. Dann kommt es ihr beinahe so vor, als löse sich ihr Meat Prison vom Hals abwärts auf und sie wäre nichts weiter als ein levitierendes Hirn.
Im Schlafzimmer öffnet sie das Fenster einen Spalt breit. Sie würde es gerne weiter öffnen, um mehr Nachtluft hereinzulassen, doch das würde auch den Schallwellen der nächtlichen Stadt Tür und Tor öffnen. Grölende und betrunkene Jugendliche. Singende, betrunkene Touri- und Studierendengruppen. Scherbengeklirr. Der ferne Lärm, der von den Hauptverkehrsstraßen heranweht. Das Puckern der Bahnen. Und sämtliche dazugehörige Gerüche.
Fanni legt sich aufs Bett. Das Tablet steht aufgeklappt auf der Matratze – da, wo es immer steht. Sie startet ihre selbst programmierte Einschlaf-App. Die Videospur besteht aus Restlichtaufnahmen von BELL-Indoor-Cams in Schlafzimmern. In jedem einzelnen ist nicht mehr zu sehen als ruhig daliegende, schlafende Menschen. Die Audiospur des mehrstündigen Loops ist aus mehreren Videos ihres Lieblings-ASMRtist Ephemeral Rift zusammengesetzt. Das körnige grünschwarze Bild und das angenehme Flüstern helfen ihr oft beim Einschlafen. Nicht immer. Für diesen Fall hat sie die Packungen Stilnox in der Schublade des Nachtschranks.
JUNYA
\CreeprXchange >> Creator’s Corner >> Hammer_Priest’s Kaidan\
<< … >>
<< lieber mitenthusiast, dein aktuelles video hat mir gefallen. kompliment. du erschaffst eine immersion, die man leider allzu selten antrifft. mit welcher konsequenz du bei deinem konzept bleibst, ist bewundernswert. apropos immersion: ich denke darüber nach, auch meine s. o. p. zu upgraden. dein setup aus gopro-kamera und ir‑beleuchter scheint mir da sinnvoll. auf sicherem wege habe ich mir die benötigten teile zugelegt und wollte die kamera anhand deines tutorials, das du vor längerer zeit gepostet hast, umbauen. leider ist der hoster, bei dem du das video hochgeladen hattest, down. ich könnte es auch allein mit deiner text-anleitung, die du zusätzlich gepostet hattest, versuchen, überlasse aber ungerne etwas dem zufall und würde mir lieber begleitend das video dazu ansehen. falls du die datei noch nicht vernichtet hast, wäre ich dir verbunden, wenn du einem »kollegen« unter die arme greifen könntest. dank im voraus. gv. >>
– GermanVermin, 21 minutes ago
Junya liest den Post mehrmals durch. GermanVermin ist eine Institution im Forum und kommentiert nur selten anderer Leute Material. Junya kann nicht anders, als sich geehrt zu fühlen. Er ist sich aber auch bewusst, dass Lob der Tod wahrer Kunst ist. Des Rebellentums. Doch fragt er sich auch, ob seine Erregung denn so verwerflich ist. Genauso wie die Befriedigung, die er beim Klicken eines aufgesperrten Türschlosses empfindet. Oder die Vorfreude, die beinahe schon einer außerkörperlichen Erfahrung gleicht, wenn er im Schatten eines fremden Schlafzimmers steht und sein eigener Atem seine Wangen küsst, reflektiert vom Holz der Maske. Nein, es liegt kein Unrecht darin, in der Ausübung seiner Berufung auch Genugtuung zu erfahren.
Gemeinsam mit anderen Dateien aus dem und für das Forum hat er das Video tief unten an den Wurzeln eines Verzeichnisbaums in einem verschlüsselten Ordner vergraben.
Während Junya das Tutorial-Video bei einem anderen File-Hosting-Anbieter im Darknet hochlädt, sieht er es sich noch einmal an. Je mehr er auf der Timeline des Videoplayers umherskippt, desto fester umfasst er die Maus. Er sieht seinen dünngliedrigen Fingern im Video dabei zu, wie sie mit einer Zange das werksseitig verbaute Objektiv herausdrehen. Wie sie den Infrarot-Beleuchter auf das neue Nachtsicht-Objektiv stecken. Wie sie zu Präsentationszwecken die kleine schwarze Box öffnen, in der er zuvor Spannungsumwandler-Board und Batteriefach verbaut hat.
Seine an der Kamera herumnestelnden Hände widern ihn an. Der Schmutz unter seinen krallenartigen Nägeln, die foliendünne Haut über den Mittelhandknochen und wie zaghaft seine Fingerspitzen an der Linse zupfen.
Der Mauszeiger flüchtet zum x in der rechten oberen Fensterecke. Es bleibt der Ladebalken des Uploads im Tor-Browser. Und Junyas Finger auf der Maus. Wie die Beine einer Vogelspinne, die sich auf ein Nagetier am Waldboden gestürzt hat, um ihm die Beißklauen ins Fleisch zu stoßen und ihm ihr Gift zu injizieren, damit sie den bald leblosen Körper aussagen kann.
Junya zieht die Hand eng an seinen Brustkorb und lässt sie in seinen Schoß auf die andere sinken. Er klemmt beide zwischen seine Schenkel. Es sieht aus, als hätte er nur noch Stümpfe an den Armenden.
FANNI
Sie hat wieder stundenlang wach gelegen. Der Nachtschrank blieb zu. Sie hat es ausgefightet. Irgendwann ist sie dann schließlich eingeschlafen.
Um 5:30 Uhr klingelt ihr Wecker und befreit sie von der Nacht und ihren blutgetränkten mentalen Möbiusschleifen. Mit Wecker ist ihr Bittium-Smartphone gemeint. Mit Klingeln ist MC Rides maschinengewehrfeuerartiges Brüllen des Wortes »Blow« im Song Hot Head gemeint.
Nach dem Duschen setzt sich Fanni vor das Sofa. Sie benutzt es als Rückenlehne und zieht sich den Couchtisch ran. Ihre Beine sind lang auf dem Laminat ausgestreckt.
Sie klappt ihr VivoBook auf und bootet ein jungfräuliches Tails vom USB-Stick. Nachdem das OS vollständig hochgefahren ist, öffnet sie den Tor-Browser und kopiert den Onion-Link des MonstroMart aus einer verschlüsselten Textdatei in die Adresszeile.
Glücklicherweise ist das WLAN-Signal der Nachbarn stark genug, so dass der Seitenaufbau des Schwarzmarkts keine Äonen dauert. Dass die Seite – selbst für Dark Web-Verhältnisse – äußerst rudimentär designt ist, hilft dabei natürlich auch.
Der MonstroMart gehört weder zu den etabliertesten noch zu den am elegantesten programmierten Marketplaces. Das ist allerdings ein Plus, da das Risiko, an Scammer zu geraten, dadurch zumindest ein klein wenig geringer erscheint als auf größeren Schwarzmärkten. Was selbstverständlich nicht bedeutet, dass die Seite nicht von einer Minute auf die nächste durch eine DD