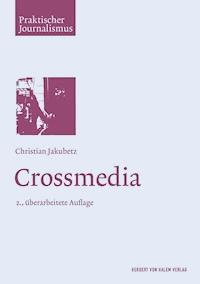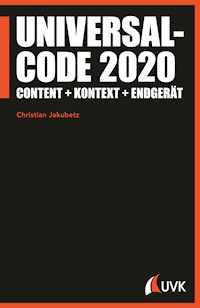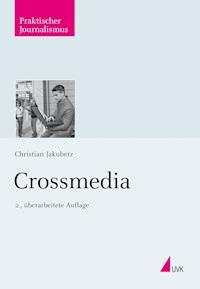
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UVK
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Praktischer Journalismus
- Sprache: Deutsch
Die Zukunft des Journalismus ist crossmedial: Reporter schreiben einen Bericht für ihre Zeitung, drehen beim Termin vor Ort ein kurzes Video für das verlagseigene Fernsehen und formulieren auch noch den Teaser für den Webauftritt. Crossmedia ist aber keine 1:1-Reproduktion von Inhalten in verschiedenen Medien – es bedeutet vielmehr, dass man sich über den richtigen Content im richtigen Kontext Gedanken machen muss. Wie dies geht, zeigt der Autor in diesem Buch systematisch und anhand von zahlreichen Beispielen aus der Praxis. Er holt die Journalisten in Zeitungen, Radio, Fernsehen oder Internet ab und vermittelt ihnen die notwendigen Kenntnisse, die sie benötigen, um über die Mediengrenzen hinweg zu publizieren und Texte, Fotos, Audios und Videos miteinander zu vernetzen. Dabei geht es nicht nur um neue Technologien, sondern darum, die angemessenen journalistischen Darstellungs- und Stilmittel für die jeweilige Zielgruppe einzuSetzen. Die zweite Auflage wurde überarbeitet und um ein Kapitel zum Thema 'Soziale Netzwerke' bzw. 'Soziale Medien' erweitert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[2]
Christian Jakubetz lebt als Autor, Dozent und Berater in Zürich. Seine journalistische Laufbahn führte von Tageszeitungen über das ZDF und N24 bis zu SevenOne Intermedia.
[3]Christian Jakubetz
Crossmedia
2., überarbeitete Auflage
UVK Verlagsgesellschaft mbH
[4]Praktischer Journalismus
Band 80
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISSN 1617-3570
ISBN 978-3-86496-017-8
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Dieses eBook ist zitierfähig. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenangaben der Druckausgabe des Titels in den Text integriert wurden. Sie finden diese in eckigen Klammern dort, wo die jeweilige Druckseite beginnt. Die Position kann in Einzelfällen inmitten eines Wortes liegen, wenn der Seitenumbruch in der gedruckten Ausgabe ebenfalls genau an dieser Stelle liegt. Es handelt sich dabei nicht um einen Fehler.
1. Auflage 2008
2. Auflage 2011
© UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2011
Einband: Susanne Fuellhaas, Konstanz
Einbandfoto: iStock International Inc.
Satz: Claudia Wild, Konstanz
UVK Verlagsgesellschaft mbH
Schützenstr. 24 · 78462 Konstanz, Deutschland
Tel.: 07531-9053-0 · Fax: 07531-9053-98
www.uvk.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
[5]Inhalt
Vorwort
1 Einführung
1.1 Warum Crossmedia?
1.2 Digitalisierung – alles wird anders
1.3 Alleskönner, die nichts richtig können?
1.4 Was ist Crossmedia überhaupt?
1.5 Welches Equipment benötigt man?
1.6 Eine Frage der Organisation
1.7 Das Storyboard
2 Texten – für wen eigentlich?
2.1 Texten fürs Lesen
2.2 Texten fürs Hören
2.3 Texten fürs Sehen und Hören
3 Video
3.1 Drehen – die ersten Schritte in der Praxis
3.2 Eine Frage der Perspektive
3.3 Der gute Ton – Sahnehäubchen oder Alleskaputtmacher
3.4 Fernsehen, Web, Mobile – Arbeitsfelder für Video-Journalisten
3.5 Der richtige Schnitt
3.6 Das nötige Video-Equipment
3.7 Videos für mobile Plattformen – Produzieren für kleine Bildschirme
3.8 Player, Formate und Encoding
3.9 Die Video-Formate
3.10 Der eigene Sender
4 Audio
4.1 Das nötige Audio-Equipment
4.2 Neue Technik, neue Darstellungs- und Anwendungsformen
4.3 Die Audio-Formate
4.4 Mischformen – alles ist möglich
[6]5 Fotos – mehr als knipsen
5.1 Wie man gute Bilder macht
5.2 Software und Equipment
5.3 Die Foto-Formate
6 Online-Journalismus
6.1 Die Charakteristika eines neuen Mediums
6.3 Neuer (Schreib-)Stil für ein neues Medium?
6.4 Usability – und immer an den User denken
6.5 Klicks und Tricks – die Bedeutung von Messgrößen
7 Mobile Medien
7.1 Trends und Entwicklungen
7.2 Audio- und Videopodcasts – welchen Inhalt wofür?
8 Digitale Workflows
8.1 Potenzielle Abläufe
8.2 Distribution – ein Inhalt, viele Kanäle
8.3 Entwicklung der Endgeräte
9 Der gute Ton – Sprechen für Audio und Video
9.1 Sprich wie du bist – Natürlichkeit vor dem Mikro
9.2 Lockern, ölen, entspannen – so hört es sich gut an
9.3 Sprechen nach Thema und Tempo
10 Web 2.0 – schöne neue Welt oder Hype?
10.1 Blogs – Kinderkram oder neues journalistisches Stilmittel?
10.2 Soziale Netzwerke
11 Ausblick – was kommt?
11.1 Die drei wichtigsten Veränderungen
11.2 Das Internet begreifen
12 Aus- und Weiterbildung
12.1 Ansprüche an eine gute Ausbildung
12.2 Journalistenschulen und Akademien
Weblogs
Index
[7]Vorwort
Es ist schon etliche Jahre her: Damals, als ich die Deutsche Journalistenschule besuchte und noch keinen Gedanken daran verschwendete, sie eines Tages zu leiten, stand ich am Ende der Ausbildung vor einer schwierigen Entscheidung: Sollte ich Zeitungsredakteur werden – oder doch lieber Radiomann? Ich hatte Angebote aus beiden Medien, beide begeisterten mich, jedes auf seine Art. Eines allerdings war klar: Zeitung und Radio zusammen, das würde nicht gehen, es musste also eine Entscheidung her.
Dieses Entweder-oder erscheint uns heute fast unvorstellbar. In Zeiten, in denen Journalisten ganz selbstverständlich sowohl Texte schreiben als auch Videos oder Audios produzieren, wirkt die frühzeitige Festlegung auf eine ganz bestimmte Mediengattung wie ein – nicht einmal sehr liebenswerter – Anachronismus. Noch dazu, da schon damals, als noch kein Mensch an Bits und Bytes, an Internet, DSL und W-LAN dachte, die Deutsche Journalistenschule nichts anderes machte als das, was heute lautstark gefordert wird: Journalisten trimedial auszubilden. Ich hätte also schon damals das nötige Handwerkszeug parat gehabt, um sowohl für eine Zeitung als auch für das Radio oder das Fernsehen zu arbeiten. Nur, dass das damals überhaupt nicht zur Debatte stand.
Bevor ein Journalist seinen endgültigen redaktionellen Bestimmungsort erreichte, musste er also bisher eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Es ging um eine Weichenstellung, die nicht immer, aber häufig die Richtung für das ganze Berufsleben vorgab: Print? Radio? Fernsehen? In was für einer Redaktion soll der Schreibtisch stehen? Ein Journalist war demnach nicht einfach einer, der Inhalte für Medien erstellt hat, sondern einer, der sich immer auch sehr stark über ein Präfix definierte: Zeitungs-Journalist. Radio-Journalist. Fernseh-Journalist.
Mit der Digitalisierung und dem Erstarken von Online-Medien hat sich dies massiv geändert. Nicht nur, dass mit »Online« ein neues Präfix für den Journalisten hinzugekommen ist. Vielmehr ändert sich gerade unser komplettes Berufsverständnis. Wir erleben, wie es immer selbstverständlicher wird, dass der Journalist erst einmal nur Journalist ist, ganz ohne einleitende Mediengattung am Wortanfang. [8]Dass seine primäre Aufgabe es ist, sich zunächst mit Inhalten zu beschäftigen und dann erst mit der Plattform, die er zu bestücken hat.
Muss man das bedauern? Es hat in jüngster Zeit immer wieder kritische Stimmen gegeben, Warnungen, die inhaltliche Qualität gehe den Bach runter, sollte aus dem gut ausgebildeten und auf ein Medium spezialisierten Journalisten plötzlich die viel bemühte eierlegende Wollmilchsau werden. Und in der Tat muss man solche Einwände sehr ernst nehmen: Wenn Unternehmen Crossmedia, multimediales Arbeiten aus einer Hand nur als Mittel zum kostensparenden Zweck wahrnehmen, dann ist absehbar, dass dies nicht gut gehen wird. Vielmehr dürften wir dann einen ziemlich unverdaulichen Mix aus Inhalten erleben, die von Journalisten erstellt werden, die vieles ein bisschen, aber nichts richtig gut können. Das kann niemand wollen – und das wäre schließlich auch eine absurde Definition des Begriffs Crossmedia. Crossmedial fit sein, so wie ich es verstehe, heißt vor allem: In verschiedenen Medien denken zu können, ihre technischen und dramaturgischen »Gesetze« zu verstehen und Themen entsprechend aufzubereiten.
Allerdings: Um die vielen neuen Dinge, die auf uns zukommen, richtig gut und nicht nur oberflächlich zu beherrschen, ist eine intensive Auseinandersetzung mit dieser Thematik nötig. Wir werden uns nicht nur Gedanken über neue Ausbildungspläne und -wege machen müssen, sondern werden auch neue Ansprüche formulieren und neue Definitionen für einen guten, gehaltvollen Multimedia-Journalismus entwickeln müssen. So spannend all die neuen Entwicklungen sind, so faszinierend ihre Möglichkeiten: Die Grundpfeiler des Journalismus dürfen nicht erschüttert werden. Egal, wie multimedial die Zeiten noch werden, gutes, solides Handwerk bleibt weiterhin die Grundlage unserer Arbeit: gründliche Recherche, das Prinzip, immer auch die andere Seite zu hören, die Mühe, sorgfältig zu bewerten und auszuwählen und die Sachverhalte verständlich darzustellen; all die Dinge eben, die uns erst die Legitimation geben, der vierte Stand im Staat zu sein.
Wenn wir über journalistische Qualität in diesen Zeiten des Umbruchs diskutieren, sollten wir uns über eines einig sein: Neue Technologien und Neue Medien sind per se weder gut noch böse, sie bieten einfach nur Möglichkeiten. Möglichkeiten, die wir als Journalisten zum Nutzen unserer Leser, Hörer und Zuschauer verantwortungsvoll einsetzen können – oder auch nicht. Ich bin sehr dafür, das Erstere zu tun.
[9]Begreifen wir also die »Medienrevolution« als eine Chance. Als eine, die Journalisten in ihrem Berufsleben nicht allzu oft bekommen. Wir können jetzt ein unglaublich vielfältiges Medium gestalten, wir können neue Ideen entwickeln und Maßstäbe setzen.
Ulrich Brenner
Leiter der Deutschen Journalistenschule, München
[10][11]1 Einführung
1.1 Warum Crossmedia?
Bevor man beginnt, viele Antworten zu suchen, sollte man möglicherweise erst einmal eine Frage stellen. Eine ganz einfache: Warum eigentlich? Warum diese ganzen Debatten über das Thema Crossmedia – und warum jetzt auch noch ein ganzes Buch darüber? Über kaum ein Thema ist im Journalismus in den letzten fünfzehn Jahren so viel diskutiert worden wie zunächst über Online-Medien und in der Folge über crossmediale Optionen und Entwicklungen sowohl für Journalisten als auch für Medienhäuser. Und mittendrin in diesen Diskussionen über Verknüpfung und Vernetzung, über den Weg vom gedruckten Text bis hin zum selbst geschnittenen Video tauchte diese Frage plötzlich auf einem der zahllosen Panels der letzten Jahre auf: Warum eigentlich? Warum sollen Journalisten, die ihr Leben lang gut damit zurechtkamen und gleichermaßen beschäftigt waren, ihre Zeitungen, Radiostationen und Fernsehsender mit Leben und Inhalt zu füllen, jetzt plötzlich auch in ihnen völlig fremden Bereichen arbeiten? Noch dazu in solchen, in denen sie sich naturgemäß wenig bis gar nicht auskennen, von denen sie, um die Sache beim Wort zu benennen, schlichtweg keine Ahnung haben. Von der »eierlegenden Wollmilchsau« hat man übrigens im halbwegs historischen Kontext schon vor 25 Jahren gesprochen, als die Zeitungsverlage sich anschickten, ihre Journalisten nicht nur zum Schreiben, sondern zudem auch noch zum digitalen Ganzseitenumbruch zu verdonnern. Man empfand das seinerzeit bereits als eine Ungeheuerlichkeit und dementsprechend verpönt war diese Idee: Wenn wir alle nur noch »Redaktroniker« seien, so die Argumentation damals, dann bleibe die journalistische Qualität zwangsläufig auf der Strecke. Die Argumentationen heute klingen nicht sehr viel anders, nur dass kein Mensch mehr auf die Idee käme, die digitalen Arbeitsabläufe in den Redaktionen wieder rückgängig zu machen.
Aber mal im Ernst: Wäre es nicht für alle Seiten vernünftiger, wenn die Schreiber einfach weiter schreiben, die Rundfunkleute Radio machen und die TV-Journalisten ihre Fernsehbeiträge betreuen? Schließlich ist die Dimension der Veränderungen, die mit der zunehmenden Digitalisierung auf uns zukommt, eine ganz [12]andere, unvergleichlich größere als die Einführung des Ganzseitenumbruchs am PC. Ebenfalls nicht zu vergessen: Mit der einigermaßen rigiden Trennung von Mediengattungen ist der Journalismus in den letzten fünfzig Jahren gut gefahren. Und wenn er es mal nicht tat, dann waren daran sicher nicht die fehlenden crossmedialen Verknüpfungen schuld. Lassen wir demnach doch alles einfach so, wie es jetzt ist. Dann wäre das ganze Gerede von Crossmedia obsolet und jeder könnte sich auf das konzentrieren, was er am besten kann. Keine Risiken mehr für die Qualität, so einfach könnte das sein.
Dafür spricht im ersten Augenblick durchaus einiges. Der Haken daran: Diese sehr strikte und rigorose Arbeitsteilung widerspricht erheblich der Entwicklung, die Medien im Zeitalter der Digitalisierung nehmen. Um es salopper und pragmatischer zu formulieren: Der »point of no return« ist längst überschritten. Insofern sind die gerade eben noch genannten Argumente dafür, es doch einfach bei dem zu belassen, wie es früher war, eine Gespensterdebatte. Und schließlich ist es ja nicht nur so, dass diese Entwicklung nur Risiken in sich bergen würde. Bei genauerer Betrachtung bietet sich eine ganze Reihe von Chancen, die Journalisten in ihrem Berufsleben nicht allzu oft geboten bekommen. Wie oft beispielsweise kann man die Gestaltung von völlig neuen Inhalten und von völlig neuen Medien aktiv mitgestalten? Wenn man, offen gesagt, eine solche Herausforderung nicht als ungemein spannend ansieht, sollte man sich eventuell grundsätzlich überlegen, ob man im richtigen Beruf gelandet ist.
Aber was eigentlich ist jetzt so neu, so spannend und so herausfordernd an dieser rasenden digitalen Entwicklung? Zwei Dinge sind entscheidend. Das eine: Wir leben in einem Zeitalter des Überangebots an Medien. Das bedingt, dass sich Konsumenten aus einem noch nie da gewesenen Berg an Inhalten das herausnehmen können, was ihnen am besten gefällt. Der Konkurrenzkampf um die wichtigste Währung für Journalisten – nämlich Aufmerksamkeit – wird sicher größer und härter. Das zweite: Die Digitalisierung macht Medien durchlässig und mobil, das Trägermedium, früher von ganz entscheidender Bedeutung, spielt heute nahezu keine Rolle mehr. Nichts und niemand ist mehr an seine frühere Plattform gefesselt, dementsprechend spielt es für uns als Journalisten auch nur noch eine untergeordnete Rolle, ob wir für eine Zeitung oder einen Fernsehsender arbeiten. Umgekehrt klammert sich auch der Konsument immer weniger an ein bestimmtes Trägermedium. Medien aller Art – gleichgültig ob Texte, Bilder, Audios oder Videos – sind inzwischen theoretisch auf so vielen Plattformen, Trägermedien und Endgeräten konsumierbar geworden, dass die Frage, für welche Art der Nutzung man sich entscheidet, viel stärker als früher von der jeweiligen Nutzungssituation, [13]den Gewohnheiten und den Vorlieben des Konsumenten abhängt. Der Konsument aber befindet sich keineswegs mehr in einer Art Abhängigkeit vom Angebot. Kein Mensch muss darauf warten, dass morgens seine Zeitung im Briefkasten liegt. Wenn sich jemand auf den neuesten Stand der Dinge bringen will, muss er nicht warten, bis das Radio Nachrichten sendet. Und schließlich: Wer das »heute-journal« des ZDF sehen will, muss dazu nicht fernsehen. Er muss nicht mal mehr einen Fernseher haben. Und wenn er es auf die Spitze treiben will, muss er es nicht einmal sehen, man kann es auch als Audio-Podcast hören (wie viel Sinn allerdings das Hören einer Fernsehsendung ergibt, sei erst einmal dahin gestellt). Eine Rolle wird künftig viel mehr als früher auch spielen, wo sich der Nutzer gerade befindet. Im analogen Zeitalter war der Konsum von Medien zwangsweise weitgehend auf zuhause beschränkt, von Zeitungen und Radios abgesehen. Um noch einmal das Beispiel »heute-journal« heranzuziehen: Man kann es inzwischen auch an jedem beliebigen Ort sehen, unabhängig von Frequenzen und Empfangsmöglichkeiten. Fernsehen ohne Fernseher und ohne Bindung an irgendein Programm oder irgendeinen Sender – man muss sich das noch einmal in aller Ruhe überlegen, um zu begreifen, was da in den vergangenen Jahren überhaupt passiert ist. Die Hülle ist tot, der Inhalt ist hingegen lebendiger denn je.
Wir müssen (ob es uns passt oder nicht), nüchtern betrachtet, nur eines: Reichweite erzielen. Wir müssen unseren Nutzer dort abholen, wo er sich befindet, wie müssen ihm das geben, was er will, wann er will, wo er will. Die Zeiten, in denen er, unser Nutzer, sehnsüchtig darauf wartet, dass morgens um 6 Uhr die Zeitung im Briefkasten liegt, wir ihm in den Mittagsnachrichten im Radio sagen, was heute in der Welt passiert ist und um 20 Uhr in der »Tagesschau« noch mal die Welt darlegen, sind Vergangenheit, den Takt der Mediennutzung geben wir nicht mehr länger vor. Übrigens auch nicht mehr die alleinige Meinungsbildung. Von Tom Buhrow stammt der schöne Satz, früher seien beispielsweise Moderatoren von Nachrichtensendungen wie der Prophet auf dem Berg Sinai erschienen und hätten im Stil einer Predigt ihre Nachrichten verkündet. Heute, so Buhrow weiter, stehe auf dem Berg eine Webcam und das Publikum würde vom Propheten erwarten, dass er mit ihnen chattet. Wir sollten uns also vermehrt nach dem richten, was andere von uns erwarten könnten. Nebenbei bemerkt: Eine solche Erwartungshaltung der Nutzer an Journalisten sollte auch unser Selbstverständnis dahin gehend verändern, dass wir unseren Beruf zunehmend auch als Kommunikation, als Dialog und als Interaktion verstehen. So ist das nun mal – erneut ganz nüchtern betrachtet –, wenn sich die Verhältnisse auf einem Markt ändern.
[14]Einhergegangen mit diesen Verschiebungen auf dem Medienmarkt sind auch dramatische Veränderungen in der Mediennutzung. Erstmals hat 2007 eine Mehrheit aus der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen angegeben, dass das Internet für sie das Leitmedium Nummer eins sei – gerade mal gut 10 Jahre, nachdem sich das Web zu einem halbwegs ernst zu nehmenden Medium entwickelt hat. Auch alle anderen Eckdaten weisen in diese Richtung: Fragt man junge Menschen, auf was sie am ehesten verzichten könnten, nennen sie zumeist eine Zeitung. Internet und Computer erscheinen einer überwältigenden Mehrheit hingegen als völlig unverzichtbar. Man muss sich das mal vor Augen halten: Wenn man es schon nicht sehr überraschend findet, dass Jugendliche auf eine Tageszeitung ziemlich schmerzfrei verzichten können, dann ist es doch erstaunlich, dass Computer und Internetzugang inzwischen sogar wichtiger sind als Fernsehen und Radio. Vor noch einem Jahrzehnt wäre eine solche Entwicklung völlig undenkbar gewesen. Es passt übrigens ins Bild, dass generell gedruckte Medien als Wissensspeicher vom Publikum immer weniger akzeptiert werden. Sogar der ehrwürdige Brockhaus verkündete Anfang 2008, nicht mehr in Buchform publizieren zu wollen. Stattdessen soll Brockhaus jetzt zu einer Marke als Wissens-Navigator im Netz werden. Nicht, weil man beim Brockhaus auf einmal die Nase voll gehabt hätte vom gedruckten Wort. Vielmehr reagierte man dort ganz einfach auf veränderte Ansprüche und letztlich verändertes Kaufverhalten bei den Kunden. Und streng genommen ist die ganze Geschichte auch völlig logisch und nachvollziehbar: Was soll man mit einem Nachschlagewerk anfangen, das zum Zeitpunkt seines Erscheinens schon wieder veraltet ist? Lernen wir also fürs Erste daraus, dass es bei der Debatte »Print oder Online« weniger um Ideologien oder Dogmen als vielmehr um Pragmatismus geht – oder zumindest gehen sollte.
Und wenn wir schon dabei sind, die Theorie zu stützen, die Nutzer dort erreichen zu müssen, wo sie sich gerade befinden: Das Handy, so man sich dazu entschließen kann, es endlich als Medium zu akzeptieren, hat inzwischen bei Jugendlichen einen Abdeckungsgrad von weit über neunzig Prozent erreicht. Einen Fernseher nennen »nur« etwas über sechzig Prozent ihr Eigen. Wobei es vermutlich ohnehin unsinnig ist, das Handy einfach nur noch als Handy zu sehen. Wenn man sich Hightech-Geräte ansieht, dann sind sie de facto Minicomputer, mit denen man nebenher auch noch telefonieren kann. Mit dem Verständnis, das wir noch Ende der 1990er Jahre von einem Handy hatten (nämlich, dass es ein mobiles Telefon mit ein paar netten anderen Gimmicks sei), haben die Geräte spätestens seit der Einführung des iPhone nichts mehr zu tun. Die nächste Generation der Handys wird noch weitergehen. In Arbeit sind Geräte mit ausrollbaren Bildschirmen, die eigentlich keine Bildschirme als vielmehr elektronische Folien sind. Sie sind [15]perfekt geeignet dafür, neben klassischen Internetseiten und Dokumenten, Fotos und Videos auch elektronische Tageszeitungen sehr komfortabel darzustellen. Die Tageszeitung der Zukunft also als verkleinerte Ausgabe auf einer Folie, die man aus dem Handy ausrollen kann? Was vor ein paar Jahren noch als eine utopische Vorstellung aus einem Science-Fiction-Film geklungen hätte, ist inzwischen aus technischer Sicht nahe an der Realität. Ob der Markt dieses Modell dann auch tatsächlich akzeptieren wird, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Die Entwicklung von E-Book-Readern hat der Debatte um die Zukunft der gedruckten Zeitung eine weitere neue Dimension gegeben. Denkbar ist inzwischen auch, Tageszeitungen in ihrem bisherigen Layout auf einem E-Book-Reader darzustellen. Vielleicht ist es sogar ein Zukunftsmodell, Lesegeräte bei Abschluss eines Abos stark zu subventionieren. Immerhin haben sich so die Mobilfunkanbieter ihren Markt erschlossen. Sie verdienen an den Verträgen, nicht an den Endgeräten. Eine Zeitung abonnieren und dafür einen stark verbilligten Reader erhalten – keine völlig abseitige Vorstellung.
Und schließlich noch zwei letzte Zahlen: Die gute alte Tageszeitung wird nicht mal mehr von jedem Zweiten der künftigen Mediennutzer (also der heute 14- bis 19-Jährigen) regelmäßig gelesen. Das Internet bringt es inzwischen in dieser Altersgruppe auf eine Marktdurchdringung von fast hundert Prozent. Das sind Zahlen von einer solchen Brachialgewalt, dass sie keinen großen Freiraum für Interpretationen mehr lassen. Man muss die Zeitung deswegen nicht gleich beerdigen. Aber selbst bei gleichermaßen wohlwollender wie realistischer Betrachtung ist klar, dass sie im künftigen durchschnittlichen Medienmix einer kommenden Mediennutzer-Generation eine zumindest quantitativ deutlich kleinere Rolle als bisher spielen wird. Allerdings: Selbst ein Überleben bei deutlich geschrumpfter Bedeutung ist noch kein Selbstläufer. Wenn sich Zeitungen nicht auch inhaltlich und strategisch neu positionieren, sieht es für ihre Zukunft alles andere als rosig aus.
Die Sache ist also recht eindeutig: Wenn wir nicht willens und in der Lage sind, uns den neuen Erfordernissen des Marktes und Wünschen des Publikums anzupassen, werden wir bald ziemlich allein da sitzen. Die Abstimmung mit den Füßen ist in vollem Gange. Machen wir uns nichts vor: Wer in der digitalen Welt nicht vernünftig vertreten ist, läutet seinen eigenen Untergang ein. In den kommenden Jahren wird die erste volldigitale Generation erwachsen – junge Menschen, die damit groß geworden sind, morgens als Erstes ihre Mails zu checken. Die sich mit Musik wie selbstverständlich aus dem Netz versorgen. Deren Tagesschau »Spiegel Online« heißt. Und die keinen Leserbrief mehr schreiben, sondern ein eigenes [16]Blog eröffnen, wenn ihnen ein Thema wichtig erscheint. Welchen Grund sollte es geben, dass diese und künftige Generationen noch einmal zu Formen der Mediennutzung zurückkehren, wie wir sie bisher gekannt haben (selbst wenn diese zu ihrer Zeit ihre Berechtigung hatte)? Hinweise darauf, dass noch nie ein neues Medium ein bestehendes Medium verdrängt oder ersetzt hat, sind zwar in der Sache nicht falsch. Aber einmal ist immer das erste Mal.
Betrachtet man die Sache nüchtern und ein wenig hype-befreit, dann ist »Crossmedia« ohnehin ein alter Hut. An der Deutschen Journalistenschule in München beispielsweise werden die angehenden Redakteure schon seit vielen Jahren konsequent für die Mediengattungen Print, Radio, TV und seit einigen Jahren auch für Online ausgebildet; auch an anderen Schulen und Akademien gehören die Einblicke in diverse Medienformen schon lange fest zum Stundenplan. Und selbst mittelgroße Regionalzeitungen lassen ihre Volontäre gerne mal bei einem verlagseigenen anderen Medium wie beispielsweise einem Lokalradio reinschnuppern. Was also soll so neu an diesem Thema sein, dass es sich nunmehr Medienmanager, Journalisten und Ausbilder gleichermaßen auf die Fahnen geschrieben haben und nicht müde werden zu betonen, dass die Bedeutung multi- und crossmedialen Arbeitens gar nicht hoch genug eingeschätzt werden könne? Wenn man heute konzediert, Journalismus über mehrere Plattformen und Mediengattungen hinweg sei schlechterdings nicht möglich und immer mit einem erheblichen Verlust an Qualität verbunden, haben dann nicht demnach auch alle diese Ausbilder verantwortungslos falsch gehandelt und hätten sich stattdessen auf eine einzige fachliche Richtung konzentrieren müssen?
Und schließlich sind auch journalistische Laufbahnen über diverse Mediengrenzen hinweg nichts Neues, im Gegenteil: Kaum eine Biografie eines Topjournalisten aus Radio oder TV, in der der Hinweis darauf fehlen würde, man habe seine ersten Schritte in der Medienwelt bei der Lokalzeitung vor Ort begonnen und erst mal das ganze Programm absolviert, von der Generalversammlung des Turnvereins bis hin zur Kritik der Aufführung des Laientheaters der Katholischen Landjugend. Umgekehrt gibt es wiederum auch Fälle, in denen altgediente Fernsehmänner plötzlich Chefredakteure von Tageszeitungen wurden. Niemand wäre Ende 2007 ernsthaft auf die Idee gekommen, den diskutierten (und schließlich abgesagten) Wechsel des ZDF-Anchorman Claus Kleber zum »Spiegel« deswegen auszuschließen, weil Kleber in erster Linie ein Fernsehmann und deswegen für ein Printmedium per se ausgeschlossen sei. Schließlich noch die letzte Feststellung zum Thema: Journalismus definiert sich in erster Linie über seine Inhalte und dann erst über die äußere Form bzw. das Trägermedium. Der Umgang [17]mit dem Trägermedium ist also zunächst einmal mehr oder minder schwieriges Handwerk und als solches erlernbar. Noch deutlicher gesagt: Das Trägermedium ist irrelevant. Wenn man das eine oder andere Medium nicht so sehr mag oder keine große Lust darauf verspürt, dann ist das so in Ordnung. Aber bitte nicht behaupten, es sei nicht möglich, eine bestimmte Art der journalistischen Darstellung zu erlernen …
Der Beruf ist und bleibt also der des Journalisten, niemand schreibt ihm vor, wo und wann und wie er diesen Beruf auszuüben hat. Zu den Schlüsselqualifikationen des Journalisten gehört es zudem schon seit jeher, entscheiden zu können, welche Darstellungsform wann und wo für welches Thema angebracht ist. Die Geschichte über den Stadtratsbeschluss, die Umgehungsstraße für die Kreisstadt jetzt lieber doch nicht zu bauen: ein Fall für den Mantelteil oder doch nur fürs Lokale? Interview mit dem Bürgermeister oder doch ein reportageartiges Hintergrundstück, in dem die Entwicklung vom ersten Antrag im Plenum über die zahlreichen kontroversen Diskussionen bis hin zur Ablehnung im Stadtparlament noch mal geschildert und nachgezeichnet wird? Oder vielleicht doch lieber eine Bildstrecke? Die Diskussion über die optimale Darstellung eines Themas ist also schon immer täglicher und fester Bestandteil jeder Redaktion. Ist es dann so ungewöhnlich und gleichermaßen zu viel verlangt, wenn man diese Diskussionen noch um ein paar Optionen mehr erweitert? Und ist es nicht vielmehr eine aufregende Chance, auf zusätzliche Mittel zurückgreifen zu können – anstatt einer nervigen Belastung? Zum journalistischen Gaukler, der mit dem Bauchladen über die publizistischen Märkte zieht und versucht, sich möglichst großem Publikum anzudienen, wie es Heribert Prantl in der »Süddeutschen Zeitung« schilderte, wird der Journalist dadurch nicht. Die Entscheidung, ob Interview oder Reportage noch mit der Antwort auf die Frage »Text, Video oder Audio?« zu verbinden, ist nicht so aberwitzig schwierig, als dass man einen normal begabten Journalisten damit überfordern würde.
Zumindest per se kann man also nicht behaupten, Journalismus werde demnächst auf eine qualitätsgeminderte Gauklerveranstaltung reduziert. Digitalisierung heißt zunächst lediglich, dass es ein paar potenzielle Darstellungsmöglichkeiten mehr gibt. Wenn sich dann Verleger oder Chefredakteure zu der Sichtweise entschließen, dass ein einzelner Redakteur jetzt die Arbeit zu verrichten habe, die vorher drei oder vier Kollegen erledigten, dann ist das der Fehler der Entscheidungsträger und letztendlich unsinnig. Die Digitalisierung selbst kann aber weniger dafür. Insofern wäre es klug, dieser Digitalisierung eine echte Chance einzuräumen und sie nicht pauschal für alles verantwortlich zu machen, was eventuell nicht so gut läuft.
[18]Wenn das alles so einfach ist – warum hat es bisher dann so gut wie niemand getan, dieses Publizieren über die Grenzen eines Trägermediums hinweg? Eine Frage, auf die es viele Antworten gibt. Die vielleicht wichtigste lautet: weil das bisher nur unter einem derart großen Aufwand möglich war, dass es sich nicht gelohnt hätte. Konkret nämlich hätte der Versuch, auch auf Audio- und Videoplattformen präsent zu sein, für einen Zeitungsverlag Folgendes bedeutet: Man müsste entsprechende Produktionsstätten, nämlich Rundfunk- und TV-Studios mit entsprechendem Sendebetrieb einrichten. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall: ganz egal, ob Print, ob Video, ob Audio, Animation oder nahezu alle anderen beliebigen Medien: Das alles lässt sich inzwischen an einem einzigen Laptop herstellen. Und eine Sendelizenz braucht man für »Fernsehsendungen« inzwischen auch nicht mehr, zumindest dann nicht, wenn man das Internet zu seinem (Fernseh- oder Radio-)Kanal macht. Konkret bedeutet das also, dass inzwischen jedes Zeitungshaus eigene fernsehähnliche Veranstaltungen aufbauen und ausstrahlen kann, ohne dafür ein aufwendiges und möglicherweise negativ beschiedenes Lizenzierungsverfahren durchstehen zu müssen. Auf einem anderen Blatt steht natürlich die Frage, ob nicht irgendwann in den kommenden Jahren medienpolitisch die Frage diskutiert wird, wie man mit solchen Entwicklungen umgeht. Grundsatzfrage: Betreibt man nicht eben doch Rundfunk, wenn man fernseh- und radioähnliche Produktionen sendet bzw. zumindest zum Abruf zur Verfügung stellt? Aber das sei zunächst einmal dahingestellt, zumal diese Debatte für Journalisten nur von zweitrangiger Relevanz ist.
Wichtigste Antwort: Weil nach bisheriger vorherrschender Lehre der Journalist nicht einfach Journalist war, sondern per definitionem Zeitungs-Journalist, Radio-Journalist oder Fernseh-Journalist. Man kann sich natürlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Trennung stellen, Fakt ist in jedem Fall, dass es bis vor wenigen Jahren völlig undenkbar gewesen wäre, einen Zeitungs-Journalisten mit der Erstellung eines Videofilms zu beauftragen. Und selbst wenn man es gemacht hätte – diese Aufgabe wäre ziemlich unsinnig gewesen, weil die Zeitung kaum eine Abspielmöglichkeit für dieses Video gehabt hätte. Beides – sowohl die technischen Hürden als auch die tradierten Berufsbilder – verschwindet gerade. Journalist ist eben doch erst einmal nur Journalist, auch wenn, zugegeben, seine potenziellen Schlüsselqualifikationen und die Anforderungen an seine Fähigkeiten gerade erheblich erweitert werden.
[19]1.2 Digitalisierung – alles wird anders
Ausschlaggebend dafür ist weniger eine plötzlich neu entstandene Denkweise als vielmehr eine neue Technologie: Digitalisierung. Mit ihr wurden auf einmal Dinge möglich, die vorher schlicht undenkbar waren. Plötzlich werden Medien hypermobil, lassen sich in wenigen Sekunden beliebig über den ganzen Erdball hinweg nutzen, publizieren, teilen. Auf einen Schlag lassen sich mit einfachsten und billigen Mitteln Dinge produzieren, deren Herstellung bis dahin komplex und kostspielig war. Plötzlich kann jeder publizieren, der will. Mediengattungen, Trägermedien und deren unterschiedliche Bedeutung spielen keine richtige Rolle mehr. Jeglicher Inhalt ist digital. Alles basiert auf IP-Technologie. Journalismus, das heißt inzwischen nicht mehr: Zeitung. Radio. Fernsehen. Stattdessen ist Journalismus erst einmal ein riesiger großer digitaler Schrank voller Inhalte, aus deren einzelnen Schubladen jeder das für sich herausnimmt, was ihm gerade passt. Und vor allem: wann und wo es ihm passt. Was nicht heißt, dass Journalismus und journalistisches Arbeiten dadurch weniger bedeutsam würden. Im Gegenteil: Journalismus wird wichtiger denn je sein. Ein großer Schrank, in den alles einfach nur reingeworfen wird, klingt zwar im ersten Moment verlockend, beim genaueren Hinsehen wird aber klar, dass ein vollgestopfter Schrank nur allein wegen seiner Größe nicht sehr nutzbringend ist. Wenn im Schrank nur unsortiertes, unpassendes, veraltetes und unansehnliches Zeugs liegt, wird der Nutzer sich sehr schnell dafür entscheiden, diesen Schrank lieber nicht mehr zu öffnen. Keine schlechte Entscheidung also, sich trotz nahezu unbegrenzter Möglichkeiten auch ein paar intensive Gedanken über die qualitativen Aspekte von möglichen Inhalten zu machen.
Was Crossmedia definitiv nicht ist, lässt sich demnach leicht feststellen. Wenn jemand Inhalte kopiert, gleich welcher Art, wenn er sie eins zu eins auf eine andere Plattform stellt, dann ist das ganz einfach Reproduktion. Auch wenn dieser Inhalt statt in einer Zeitung im Internet steht, so ist es trotzdem immer noch derselbe Inhalt. Eine Verdoppelung oder Verdreifachung von Inhalt – dadurch ist noch nichts Neues, nichts Werthaltiges, nichts Eigenes entstanden und hat insofern nichts mit Multi- oder gar Crossmedia zu tun. Reproduktion bzw. das Verschieben von Inhalten ist, ganz banal gesagt, ein Vorgang für Techniker. Mit Journalismus hat dies nichts zu tun. Man muss diese an sich banale Tatsache auch deswegen nochmals klar herausstellen, weil immer wieder von Vertretern der bisher analogen Medien darauf verwiesen wird, dass man online bereits sehr viel tue, nämlich dass (beispielsweise) die Zeitung auch im Internet nachlesbar sei. Wer so argumentiert, glaubt freilich auch noch, dass ein E-Paper etwas mit Online-Journalismus oder gar Multimedialität zu tun hat.
[20]Indes, das ist Web 0.0. Dies übrigens nicht nur, weil durch Reproduktion kein einziger neuer Inhalt, kein einziger neuer Wert sowohl in inhaltlicher als auch ökonomischer Hinsicht entsteht, sondern auch, weil die Stärken, die spezifischen Fähigkeiten des Mediums Internet nicht genutzt und bedient werden. Ein simples Beispiel: Schreibt man einen Text für eine Zeitung, wird man dabei alles Mögliche bedenken, sicher aber nicht, wie man ihn vernetzen/verlinken könnte. Vermutlich auch nicht daran, über diesen Text in irgendeiner Form abstimmen oder diskutieren zu lassen. Und wenn es um die Illustration des Textes geht, wird man sich vermutlich um Fotos kümmern, nicht aber um eine interaktive und animierte Grafik, ebenso wenig wie man sich Gedanken darum machen wird, ob es zum Thema noch ein gutes Video oder einen interessanten Audiobeitrag gibt. Deswegen wird bei einer Reproduktion, einer Verschiebung eines Mediums von A nach B (in diesem Beispielfall: von einer Zeitung ins Internet) etwas an einen Ort geschoben, wo es gar nicht hingehört, oder zumindest insofern deplatziert ist, als es zahlreiche potenzielle Möglichkeiten nicht nutzt. Zu den Kernanforderungen an crossmedial arbeitende Journalisten gehört, die jeweiligen Spezifika eines Mediums zu kennen und richtig beurteilen zu können. Im Falle von Online-Medien würde dies also bedeuten, dass man um die Bedeutung von Interaktion und Vernetzung weiß und dass man eine Ahnung davon hat, wie man diese beiden Eigenschaften am besten herstellt. Gerade bei Online-Medien hat man allerdings sehr häufig den Eindruck, dass es genau daran hapert; nämlich dieses gar nicht mehr so neue Medium auch wirklich verstanden und begriffen zu haben, insbesondere in inhaltlicher Hinsicht. Was einigermaßen erstaunlich ist: In Sachen Technik gibt es schließlich nicht so wirklich viel zu begreifen. Wer ein Redaktionssystem für ein analoges Medium beherrscht, wird auch mit einem digitalen Content-Management-System keine Schwierigkeiten haben.
Was umgekehrt natürlich die Frage aufwirft, was denn nun unter »Crossmedia« zu verstehen ist, wenn das Publizieren auf mehreren Plattformen anscheinend noch nicht ausreicht, um allen Kriterien dieses Begriffs gerecht zu werden. Natürlich ist es die erste Voraussetzung für crossmediales Publizieren, dieses mindestens auf zwei verschiedenen Plattformen zu tun. Definieren wir also erst einmal ein paar Kriterien, die gültig sein sollten, wenn wir in diesem Buch (und auch anderer Stelle) von Crossmedia sprechen:
• Crossmedia hat nichts mit Reproduktion zu tun.
• Monomedia ist nur eine Teilmenge von Multimedia.
• Crossmedia schafft neue Inhalte und Werte.
• Crossmedia ist nicht Ergänzung und Zusatz.
[21]• Crossmedia ist Strategie.
• Crossmedia rückt den Inhalt in den Mittelpunkt.
• Crossmedia sorgt für Medienhäuser.
• Crossmedia macht das Trägermedium irrelevant.
Und nachdem crossmediale Produktion und Digitalisierung insofern eng zusammenhängen, als das eine nicht ohne das andere funktionieren wird, gibt es auch noch ein paar Theorien, die für das Thema Digitalisierung die Basis bilden:
• Crossmedia und Digitalisierung hängen zusammen – eines macht das andere möglich.
• Digitalisierung macht Medien durchlässig.
• Digitalisierung macht Medienproduktion billiger.
• Digitalisierung baut Produktionshürden ab.
• Digitalisierung nimmt Medienhäusern das Mastertape.
• Digitalisierung macht den Monolog zum Dialog.
Woraus schließlich folgt, dass sich durch die Option zur crossmedialen Produktion von Medien einiges ändert – es gibt neue Chancen, neue Risiken. Und schließlich steht auch fest, dass
• Crossmedia neue Erlöse generieren kann.
• Crossmedia Bestandspublikum sichert.
• Crossmedia neues Publikum erreicht.
• Crossmedia Risiken verteilt und mindert.
• Crossmedia Geschäftsmodelle schafft.
• Crossmedia neues Denken erfordert.
Bleibt schließlich noch die Feststellung, dass Neue Medien nicht einfach nur von technischer Seite oder als neuer Distributionskanal zu sehen sind, sondern auch als etwas, was den Journalismus ergänzt und erneuert. Will man also wirklich von Cross- und Multimedia sprechen, dann ist es lohnenswert, sich Gedanken darüber zu machen, wie eine neue Form im Journalismus aussehen könnte. Dass in einem neuen Medium etwas Neues entstehen muss, liegt nachgerade auf der Hand, sodass eine Kernthese für cross- und multimedialen Journalismus so lauten sollte:
Medien im Internet verbinden und reproduzieren die Möglichkeiten aller bisherigen klassischen Medien. Sie entwickeln dabei auch eigene, neue, originäre Darstellungsformen. Sie können aber, wenn es sich um originären Web-Journalismus handelt, nicht in den klassischen Medien reproduziert werden.
[22]Das klingt erst einmal etwas komplex, ist aber im Grunde ganz einfach. Jede bisher bekannte Form der analogen journalistischen Darstellung ist im Web abzubilden. Ein Text kann in einer Zeitung stehen, genauso aber auch im Netz. Ein Foto kann analog publiziert werden, ebenso aber auch digital. Audios, Videos, alles was wir bisher im analogen und klassischen Medienbereich als Standard audiovisueller Medien kannten, lässt sich mühelos im Web publizieren. Wer daraus etwas Neues macht – und das haben wir uns per definitionem zum Ziel eines eigenständigen cross- und multimedialen Journalismus gesetzt – kann das zwar digital veröffentlichen, der Kanal zurück in die analoge Welt funktioniert aber nicht. Eine Flash-Animation geht eben nur im Internet (und dort natürlich auch nur auf Rechnern, die entsprechend ausgerüstet sind). Ein Text, der mit einem Video ergänzt wird, lässt sich im Netz prima parallel zueinander positionieren und vernetzen. Im analogen Medium allein funktioniert das nicht, zumindest nicht auf einer Plattform.
Crossmedia ist also eine eigenständige Form des Publizierens, dementsprechend eigenständig müssen also auch diejenigen aufgestellt sein, die diese neue Form prägen wollen. Denn soviel steht nach gut zehn Jahren des Massenmediums Internet auch fest: Vielfach wird im Nebel gestochert, vieles ist mit der heißen Nadel gestrickt. Und allgemeingültige Standards gibt es ebenso wenige, wie es wenige gesicherte Erkenntnisse darüber gibt, wo der crossmediale Journalismus in zehn Jahren stehen wird. Wie auch, nach gerade mal zehn Jahren, in denen sich das Web von der Nische für Technikfreaks hin zum kommenden Leitmedium entwickelt hat? Man muss also einiges noch mit Vorsicht genießen, was über cross- und multimediale Themen geschrieben wird (das gilt selbstverständlich auch für dieses Buch).
Man kann nicht über crossmediale Medienwelten sprechen, ohne sich in diesem Zusammenhang auch noch einmal über Medienkonvergenz Gedanken zu machen. Möglicherweise ist Konvergenz sogar der schönere und treffendere Ausdruck für das, was momentan passiert. Er hat nur ein Problem: Er wurde in den Zeiten der New Economy um die Jahrtausendwende zu Tode zitiert. Man konnte sich darauf verlassen: Wenn jemand schon kein Konzept und keine rechte Strategie für die kommenden Jahre vorweisen konnte, zumindest eines wollte er in Zukunft immer sein – konvergent. Was irgendwann zu der absurden Situation führte, dass man auf Panels oder Interviews schon mal gefragt wurde, was unter Konvergenz überhaupt zu verstehen sei. Man muss für eine vernünftige Antwort nicht einmal irgendwelche medienwissenschaftlichen Theorien wälzen, es reicht schon ein Blick auf die Bedeutung des Begriffs. Konvergenz bedeutet, dass sich Dinge annähern, dass Grenzen verschwimmen. Nichts anderes passiert bei der [23]crossmedialen Produktion von Medien. Medien emanzipieren sich von ihrem Trägermedium, das Trägermedium spielt nicht mehr die ausschlaggebende Rolle. Wichtig sind die Inhalte und ihre potenzielle Verknüpfung und Fortschreibung. Was strategisch gesehen sowohl für Journalisten als auch Medienunternehmen bedeutet, dass sie eines begreifen müssen: Sie verkaufen nicht (im Falle bspw. von Zeitungen) Papier, sondern Informationen. Information, Inhalt, das also ist zunächst einmal alles, was zählt in der neuen Medienwelt.
Und schließlich noch ein Letztes zur Definition der Begrifflichkeiten. Nicht selten drängt sich der Eindruck auf, dass insbesondere die Begriffe Crossmedia und Online-Journalismus ziemlich beliebig verwendet und durcheinander geworfen werden. Dabei muss man das ziemlich strikt voneinander trennen. Multimedialer Journalismus im Internet wird zwar im Regelfall für den Journalisten bedeuten, dass er in mehreren Darstellungsformen (also bspw. Text und Video) firm sein sollte. Mit Crossmedia hat dies aber noch nichts zu tun. Schließlich bewegen wir uns immer noch auf einer Plattform, in dem Falle also dem Internet. Wirklich crossmedial wäre eine Tätigkeit also erst dann, wenn sie über mindestens zwei Plattformen hinweggeht.
So weit, so schlecht. Denn was im ersten Moment ziemlich einfach klingt, birgt eine ganze Menge potenzieller Komplikationen in sich. Schließlich ist es nicht damit getan, künftig Inhalte quasi datenneutral zu produzieren und in irgendwelchen Datenbanken so lange zu lagern, bis irgendjemand kommt, sie herausnimmt und verteilt. Die Kunst besteht vielmehr darin, eine intelligente, vernetzte, kommunikative und interaktive Form der Inhalterstellung- und verwaltung zu finden. Den richtigen Content in den richtigen Kontext zu setzen: klingt plakativ, nachvollziehbar, einfach – und ist doch so schwierig, wie viele Beispiele aus den zurückliegenden Jahren gezeigt haben. Es gibt eine ganze Fülle von Beispielen, in denen neue Medien- und Darstellungsformen einfach mal ausprobiert wurden, ohne große Rücksicht darauf, ob derjenige, der sich daran gerade versucht, dieses dazu nötige Handwerk überhaupt beherrscht. Und ohne darüber nachzudenken, ob die für dieses Thema gewählte Darstellungsform überhaupt die am besten geeignete oder überhaupt dafür geeignet ist. Was merkwürdig anmuten mag, ist eigentlich eine einfache Sache: Nicht jeder – gleich ob Journalist oder Protagonist – eignet sich gleichermaßen gut für ein bestimmtes Medium. Manche Menschen können beispielsweise entzückend gut erzählen. Allerdings nur, solange keine Kamera auf sie gerichtet ist. Blicken sie in eine Linse und leuchtet womöglich noch das rote Aufnahmelämpchen, erstarren sie zur Salzsäule. Umgekehrt gibt es welche, die großartig sind vor einer Kamera, spontan, witzig, wortgewaltig, [24]schlagfertig – nur in einen geschriebenen Text können sie das alles nicht umsetzen (was allein insofern schon nicht erstaunlich ist, weil Schlagfertigkeit keine Eigenschaft ist, die einem beim Schreiben in irgendeiner Weise zugutekommen könnte).
Kurzum: Nicht jeder kann alles, nicht jeder muss