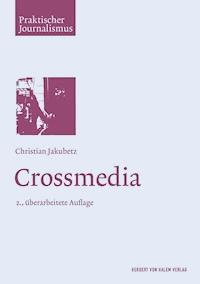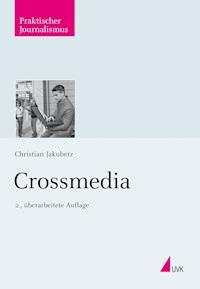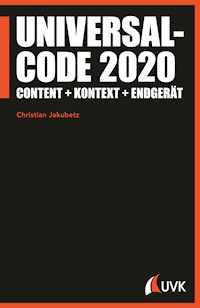
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herbert von Halem Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Praktischer Journalismus
- Sprache: Deutsch
»Von WDR-Intendant Tom Buhrow stammt der schöne Satz, früher seien Moderatoren von Nachrichtensendungen wie der Prophet auf dem Berg Sinai erschienen und hätten im Stil einer Predigt ihre Nachrichten verkündet. Heute, so Buhrow weiter, stehe auf dem Berg eine Webcam und das Publikum würde vom Propheten erwarten, dass er mit ihnen chattet…« Nichts bleibt, wie es ist: Der Wandel in Medien, Journalismus und Kommunikation geht ungebremst weiter. Aber wie damit umgehen? Was muss man wissen, was muss man können, wenn man in Medien, Journalismus und Kommunikation arbeitet? »Content + Kontext + Endgerät«: Der erfahrene Journalist und Berater Christian Jakubetz erklärt in seinem Buch »Universalcode 2020«, auf was es heute in Medien, Journalismus und Kommunikation wirklich ankommt und in welche Richtung wir Medienmacher gehen werden. Informationsdirektor Thomas Hinrichs sowie Christian Daubner und Silvia Renauer berichten, wie der Informationsbereich des Bayerischen Rundfunks trimedial aufgestellt wird und was sich für die jetzigen und künftigen Mitarbeiter dadurch verändert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Die Website zum Buch:www.universalcode2020.de
A
EINFÜHRUNG
A1
Was ist Digitaler Journalismus?
A2
Digitalisierung – Alles wird anders
A3
Alleskönner, die nichts richtig können?
A4
Was ist Digitaler Journalismus überhaupt?
A5
Welches Equipment benötigt man?
A6
Eine Frage der Organisation
A7
In Echtzeit und in Vergangenheit
A1WAS IST DIGITALER JOURNALISMUS?
Bevor man beginnt, Antworten zu suchen, sollte man erst einmal eine Frage stellen. Eine ganz einfache: Warum eigentlich? Warum diese ganzen Debatten über das Thema Digitaler Journalismus? Was soll das überhaupt sein und müsste es dann nicht umgekehrt einen „analogen“ Journalismus geben?
Warum sollen Journalisten, die ihr Leben lang gut damit zurechtkamen, ihre Zeitungen, Radiostationen und Fernsehsender mit Leben und Inhalt zu füllen, jetzt auch in völlig fremden Bereichen arbeiten? Noch dazu in Bereichen, von denen sie keine Ahnung haben? Von der „eierlegenden Wollmilchsau“ hat man übrigens schon vor 25 Jahren gesprochen, als die Zeitungsverlage sich anschickten, ihre Journalisten nicht nur zum Schreiben, sondern auch zum digitalen Ganzseitenumbruch zu verdonnern. Man empfand das seinerzeit als eine Ungeheuerlichkeit: Wenn wir alle nur noch „Redaktroniker“ seien, so die Argumentation damals, dann bleibe die journalistische Qualität auf der Strecke. Die Argumentationen heute klingen nicht sehr viel anders. Nur dass kein Mensch mehr auf die Idee käme, die digitalen Arbeitsabläufe in den Redaktionen wieder rückgängig zu machen.
Wäre es also nicht für alle Seiten vernünftiger, wenn die Schreiber einfach weiter schreiben, die Rundfunkleute Radio machen und die TV-Journalisten ihre Fernsehbeiträge betreuen? Und diejenigen, die unbedingt was mit Internet machen wollen, die sollen dann halt das tun. Schließlich ist die Dimension der Veränderungen, die mit der Digitalisierung auf uns zukommt, eine unvergleichlich größere als die Einführung des Ganzseitenumbruchs am PC.
Warum also? Zwei Punkte sind entscheidend.
Der eine: Wir leben in einem Zeitalter des Überangebots an Medien. Das bedingt, dass sich Konsumenten aus einem noch nie da gewesenen Berg an Inhalten das herausnehmen können, was ihnen am besten gefällt. Der Konkurrenzkampf um die wichtigste Währung für Journalisten – nämlich Aufmerksamkeit – wird härter.
Der Zweite: Die Digitalisierung macht Medien durchlässig und mobil, das Trägermedium, früher von ganz entscheidender Bedeutung, spielt heute nahezu keine Rolle mehr. Nichts und niemand ist mehr an seine frühere Plattform gefesselt, dementsprechend spielt es für uns als Journalisten nur noch eine untergeordnete Rolle, ob wir für eine Zeitung oder einen Fernsehsender arbeiten.
Sind wir Journalisten also demnach nicht alle digitale Journalisten, ob wir es wollen oder nicht, ganz egal, ob wir bei einem Sender, einer Zeitung oder bei Apple oder Google angestellt sind?
Über kein Thema ist im Journalismus in den letzten fünfzehn Jahren so viel diskutiert worden wie über die Digitalisierung. Dabei hat es eine ganze Reihe von Entwicklungsstufen gegeben. Wir haben zwischenzeitlich mal von „Crossmedia” gesprochen. Die Rede war auch mal von transmedialem Journalismus und von Onlinejournalismus. Mittlerweile aber haben wir zumindest in einer Hinsicht das Ende dieser Evolution erreicht: Journalismus ist inzwischen immer auch digital. Weswegen wir der Einfachheit halber gleich vom „digitalen Journalismus“ sprechen können. Das vereinfacht die ganze Angelegenheit schon alleine deswegen, weil wir uns nicht mehr lange mit der Diskussion von Begrifflichkeiten aufhalten müssen.
„Digitaler Journalismus“ bedeutet aber auch, dass wir uns über eine ganze Reihe von neuen Darstellungsformen Gedanken machen müssen, die gerade erst in der Entstehung sind. Trotzdem, so viel lässt sich festhalten: Die Zeiten, in denen wir uns vor allem mit der Frage beschäftigt haben, welche Zusatz-Inhalte wir im Netz erstellen oder wie wir Dinge miteinander vernetzen können, sind endgültig vorbei. Alles ist digital, so einfach ist das mittlerweile.
Oder so kompliziert. Die Möglichkeiten, die sich inzwischen ergeben, übersteigen unsere Vorstellungskraft und manchmal auch unsere Fähigkeiten. Schließlich gibt es inzwischen derart viele Optionen, dass man tatsächlich die Frage stellen muss: Wie will ich denn meine Geschichte überhaupt erzählen? Mit Text, Fotos? Oder als Video? Als Multimedia-Reportage oder doch als Audio? Welche Kanäle verwende ich und wie bekomme ich aus den vielen Einzelteilen ein stimmiges Ganzes?
Damit wird schon mal eine Herausforderung an digitale Journalisten klar: Sie müssen in der Lage sein, sehr viele unterschiedliche Wege zu gehen, Nutzungsverhalten, Situationen und einen Kontext in Zusammenhang bringen und die Kompetenz haben, zu entscheiden, wann welcher Inhalt wo angebracht ist.
Der Konsument jedenfalls klammert sich immer weniger an ein bestimmtes Trägermedium. Medien sind auf so vielen Plattformen und Endgeräten konsumierbar geworden, dass die Frage, für welche Art der Nutzung man sich entscheidet, viel stärker als früher von der Nutzungssituation, den Gewohnheiten und den Vorlieben des Konsumenten abhängt. Der Konsument befindet sich keineswegs mehr in einer Art Abhängigkeit vom Angebot. Kein Mensch muss darauf warten, dass morgens seine Zeitung im Briefkasten liegt. Wenn sich jemand auf den neuesten Stand der Dinge bringen will, muss er nicht warten, bis das Radio Nachrichten sendet. Und schließlich: Wer das „heute-journal“ sehen will, muss dazu nicht fernsehen. Er muss nicht mal mehr einen Fernseher haben. Und wenn er es auf die Spitze treiben will, muss er es nicht einmal sehen, man kann es auch als Audio-Podcast hören (wie viel Sinn allerdings das Hören einer Fernsehsendung ergibt, sei dahingestellt).
Eine Rolle spielt zunehmend, wo sich der Nutzer gerade befindet. Die New York Times arbeitet beispielsweise an einer Idee, die sie „Mobile Moments“ nennt. Die Idee dahinter ist, Menschen situationsbedingt auf dem Smartphone mit Informationen zu bedienen. Dabei muss es sich nicht zwingend um journalistische Infos handeln. Diese Idee des moment based bedeutet in der Konsequenz, dass man Menschen noch mehr mit Informationen versorgen kann, die für sie persönlich relevant sind. Nicht nur wegen ihrer individuellen Interessen. Sondern künftig auch wegen bestimmter Situationen oder Umfelder.
Wir müssen nüchtern betrachtet nur eines: Reichweite erzielen. Wir müssen unseren Nutzer dort abholen, wo er sich befindet, wir müssen ihm das geben, was er will, wann er will, wo er will. Die Zeiten, in denen er, unser Nutzer, sehnsüchtig darauf wartete, dass morgens um 6 Uhr die Zeitung im Briefkasten liegt, wir ihm in den Mittagsnachrichten im Radio sagen, was heute in der Welt passiert ist und um 20 Uhr in der „Tagesschau“ noch mal die Welt darlegen, sind Vergangenheit. Den Takt der Mediennutzung geben wir nicht mehr länger vor.
Von WDR-Intendant Tom Buhrow stammt der schöne Satz, früher seien Moderatoren von Nachrichtensendungen wie der Prophet auf dem Berg Sinai erschienen und hätten im Stil einer Predigt ihre Nachrichten verkündet. Heute, so Buhrow weiter, stehe auf dem Berg eine Webcam und das Publikum würde vom Propheten erwarten, dass er mit ihnen chattet. Wir sollten uns also vermehrt nach dem richten, was andere von uns erwarten könnten. Nebenbei bemerkt: Eine solche Erwartungshaltung der Nutzer an Journalisten sollte auch unser Selbstverständnis dahingehend verändern, dass wir unseren Beruf zunehmend auch als Kommunikation, als Dialog und als Interaktion verstehen.
Einhergegangen mit diesen Verschiebungen sind auch dramatische Veränderungen in der Mediennutzung. Man muss kein Prophet sein um zu prognostizieren, dass am Ende dieser Entwicklung von der bisherigen Medienwelt nicht mehr viel übrig sein wird. An Menschen, die am Tag eine Zeitung gelesen, ein bisschen ferngesehen und etwas Radio gehört haben, werden sich dann vermutlich nur die Älteren in Anflügen von Nostalgie erinnern.
Die gute alte Tageszeitung wird nicht mal mehr von jedem Zweiten der künftigen Mediennutzer (also der heute 14- bis 19-Jährigen) regelmäßig gelesen. Das Internet bringt es inzwischen in dieser Altersgruppe auf eine Marktdurchdringung von fast hundert Prozent. Das sind Zahlen, die keinen großen Freiraum für Interpretationen lassen. Den anderen Medien geht es nicht sehr viel besser, zumindest nicht im Hinblick auf die künftigen Nutzer-Generationen: Sie verlieren konstant an Bedeutung, zumindest in den bisherigen Darreichungsformen.
Die Sache ist also eindeutig: Wenn wir nicht willens sind, uns den Wünschen des Publikums anzupassen, werden wir bald alleine dasitzen. Die Abstimmung mit den Füßen ist in vollem Gange. Der Medienkonsum und das Nutzungsverhalten eines 25-Jährigen hat mit dem, was noch vor zehn Jahren als extravagant gegolten hätte, nicht mehr viel zu tun. Homepages und stationäre Computer sind schon bald wieder Relikte aus vergangener Zeit, selbst das Tablet, noch vor wenigen Jahren als Durchbruch in eine digitale Medienwelt gefeiert, steht vor einer ungewissen Zukunft. Jugendliche im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends nutzen Medien mobil auf dem Smartphone, bewegen sich wie selbstverständlich in digitalen Netzwerken und finden den Gedanken, sich Inhalte mühevoll beschaffen zu müssen, eher absonderlich. Nachvollziehbar, wenn man in einer Welt lebt, in der es sehr viel mehr Bilder, Videos, Texte, Chats und Gruppen gibt, als man je überblicken könnte.
Und wenn wir schon dabei sind, die Theorie zu stützen, dass das Smartphone das Endgerät schlechthin ist: Es hat inzwischen bei Jugendlichen einen Abdeckungsgrad von weit über neunzig Prozent. Was kein Wunder ist, weil in einem solchen Smartphone ein ganzes Leben steckt. Es ist Fernseher, Radio und Zeitung zugleich, es kann in alle Richtungen kommunizieren. Kurzum: Es ist jenes konvergente Endgerät samt Rückkanal, von dem digitale Medienpioniere schon fantasiert haben, als man noch mit knarzenden Modems und sperrigen PCs in das Web 1.0 ging.
Betrachtet man die Sache nüchtern, dann ist auch die Idee von „Crossmedia“ ein alter Hut. Inhalte über verschiedene Kanäle hinweg miteinander zu vernetzen ist zwar auch heute noch wenigstens Teil einer publizistischen Idee. Aber tatsächlich umfasst digitaler Journalismus sehr viel mehr Möglichkeiten, als einfach nur Inhalte zu vernetzen und zu ergänzen. Journalismus heißt heute, auf allen Kanälen mit individuellen und dem Kanal gerecht werdenden Inhalten vertreten zu sein. Das neue Schlagwort heißt „Digitales Narrativ“ – und die Unterschiede zu der Idee des crossmedialen Publizierens sind keineswegs nur wissenschaftlicher Natur. Stattdessen setzt sich ein neues Selbstverständnis des Journalismus durch. Und das ist etwas grundlegend anderes als einfach nur Inhalte im Netz zu reproduzieren.
Schließlich noch die letzte Feststellung zum Thema: Journalismus definiert sich in erster Linie über seine Inhalte und dann erst über die äußere Form bzw. das Trägermedium. Der Umgang mit dem Trägermedium ist zunächst einmal mehr oder minder schwieriges Handwerk und als solches erlernbar.
Der Beruf ist und bleibt der des Journalisten, niemand schreibt ihm vor, wo und wann und wie er diesen Beruf auszuüben hat. Zu den Schlüsselqualifikationen gehört es seit jeher, entscheiden zu können, welche Darstellungsform wann und wo für welches Thema angebracht ist. Die Geschichte über den Stadtratsbeschluss, die Umgehungsstraße für die Kreisstadt zu bauen: ein Fall für den Mantelteil oder doch fürs Lokale? Interview mit dem Bürgermeister oder doch ein Hintergrundstück, in dem die Entwicklung vom ersten Antrag im Plenum über die zahlreichen Diskussionen bis hin zur Abstimmung im Stadtparlament geschildert wird? Oder doch lieber eine Bildstrecke? Die Diskussion über die optimale Darstellung eines Themas ist fester Bestandteil jeder Redaktion. Ist es dann zu viel verlangt, wenn man diese Diskussionen noch um ein paar Optionen erweitert? Und ist es nicht vielmehr eine aufregende Chance, auf zusätzliche Mittel zurückgreifen zu können – statt eine nervige Belastung. Die Entscheidung, ob „Interview oder Reportage“ nun noch mit der Antwort auf die Frage „Text, Video oder Audio?“ zu verbinden, ist nicht so schwierig, als dass man einen Journalisten damit überfordern würde. Digitalisierung heißt lediglich, dass es ein paar Darstellungsmöglichkeiten mehr gibt.
Wenn das alles so einfach ist – warum hat es dann lange Zeit so gut wie niemand getan, dieses Publizieren über die Grenzen eines Trägermediums hinweg? Eine Frage, auf die es viele Antworten gibt. Die vielleicht wichtigste lautet: Weil es nur mit einem derart großen Aufwand möglich war, dass es sich nicht gelohnt hätte. Konkret nämlich hätte der Versuch, auch auf Audio- und Videoplattformen präsent zu sein, Folgendes bedeutet: Man hätte entsprechende Produktionsstätten, nämlich Rundfunk- und TV-Studios mit entsprechendem Sendebetrieb einrichten müssen. Ob Print, ob Video, ob Audio, Animation oder nahezu alle anderen beliebigen Medien: Das alles lässt sich inzwischen an einem einzigen Laptop herstellen. Konkret bedeutet das also, dass jede Redaktion alles sein kann.
Eine weitere Antwort: Weil nach bisheriger Lehre der Journalist nicht einfach Journalist war, sondern Zeitungs-Journalist, Radio-Journalist oder Fernseh-Journalist. Sowohl die technischen Hürden als auch die tradierten Berufsbilder verschwinden gerade.
JOURNALIST IST EBEN DOCH ERST EINMAL NUR JOURNALIST, AUCH WENN SEINE POTENZIELLEN SCHLÜSSELQUALIFIKATIONEN UND DIE ANFORDERUNGEN AN SEINE FÄHIGKEITEN GERADE ERHEBLICH ERWEITERT WERDEN.
CHRISTIAN JAKUBETZ
A2DIGITALISIERUNG – ALLES WIRD ANDERS
Journalismus, das heißt inzwischen nicht mehr: Zeitung. Radio. Fernsehen. Stattdessen ist Journalismus erst einmal ein riesiger großer digitaler Schrank voller Inhalte, aus dem jeder das für sich herausnimmt, was ihm gerade passt. Und vor allem: wann und wo es ihm passt. Was nicht heißt, dass Journalismus dadurch weniger bedeutsam würde. Im Gegenteil: Journalismus wird wichtiger denn je sein. Masse alleine, die das Netz unbegrenzt bietet, ist noch kein Wert an sich. Man muss diese Masse auch sortieren und einordnen können – eine Aufgabe, die der Journalismus schon immer hatte und die mit der Digitalisierung in jeder Hinsicht größer wird.
Was digitaler Journalismus definitiv nicht ist, lässt sich demnach leicht feststellen. Wenn jemand Inhalte kopiert, gleich welcher Art, wenn er sie eins zu eins auf eine andere Plattform stellt, dann ist das Reproduktion. Eine Verdoppelung oder Verdreifachung von Inhalt – dadurch ist noch nichts Neues, nichts Werthaltiges, nichts Eigenes entstanden.
Im Zeitalter des digitalen Journalismus stehen Ideen im Vordergrund, die mit dem Vernetzen von Inhalten nur eingeschränkt zu tun haben. Stattdessen setzt sich der Gedanke durch, Inhalte so zu machen, dass sie dem jeweiligen Kanal gerecht werden. Das klingt zunächst banal: Wie sollen Inhalte auch sonst sein? Tatsächlich aber geht es nicht nur um die äußeren Anforderungen, die ein Kanal an einen Inhalt stellt. Stattdessen muss man sich noch ein paar andere Gedanken machen: Wer nutzt diesen Kanal eigentlich? In welchen Situationen und auf welchen Endgeräten? Um es zusammenzufassen, lässt sich eine Formel gut verwenden:
Soll heißen: Die Bestandteile Content, Kontext und Endgerät ergeben die fertige Publikation. Das ist auch deshalb wichtig, weil es den Blick auf einen anderen Aspekt legt: Das Gießkannenprinzip ist unsinnig. Inhalte müssen nicht unbedingt in jedem Kanal stattfinden. Wenn man weiß, welcher Kanal gerade der passende ist, dann reicht das völlig aus. Die wichtigste Anforderung an Journalisten ist es deshalb, die Spezifika eines Kanals zu kennen und richtig beurteilen zu können.
Was umgekehrt die Frage aufwirft, was denn nun unter „Digitalen Narrativen“ zu verstehen ist, wenn das Publizieren auf mehreren Plattformen nicht ausreicht, um allen Kriterien dieses Begriffs gerecht zu werden. Definieren wir also ein paar Kriterien, die gültig sein sollten, wenn wir von Digitalen Narrativen sprechen:
Digitale Narrative haben nichts mit Reproduktion zu tun.
Digitale Narrative schaffen neue Inhalte und Werte.
Digitale Narrative sind nicht Ergänzung und Zusatz.
Digitale Narrative sind Strategie.
Und nachdem Inhalte-Produktion und Digitalisierung eng zusammenhängen, gibt es auch noch ein paar Theorien, die für das Thema Digitalisierung die Basis bilden:
Transmedia und Digitalisierung hängen zusammen – eines macht das andere möglich.
Digitalisierung macht Medien durchlässig.
Digitalisierung macht Medienproduktion billiger.
Digitalisierung baut Produktionshürden ab.
Digitalisierung nimmt Medienhäusern das Mastertape.
Digitalisierung macht den Monolog zum Dialog.
Woraus folgt, dass sich durch die Option zur crossmedialen Produktion von Medien einiges ändert – es gibt neue Chancen, neue Risiken. Und schließlich steht auch fest, dass
Digitaler Journalismus neue Erlöse generieren kann.
Digitaler Journalismus neues Publikum erreicht.
Digitaler Journalismus Risiken verteilt und mindert.
Digitaler Journalismus Geschäftsmodelle schafft.
Digitaler Journalismus neues Denken erfordert.
Eine Kernthese für digitalen Journalismus sollte demnach lauten:
Digitaler Journalismus verbindet und reproduziert die Möglichkeiten aller bisherigen klassischen Medien. Er entwickelt dabei auch eigene, neue Darstellungsformen. Diese können aber, im Falle von originärem Web-Journalismus, nicht in den klassischen Medien reproduziert werden.
Daneben hat digitaler Journalismus aber auch noch andere Merkmale, die ihn unverwechselbar und neuartig machen. Er ist:
interaktiv
sozial
kuratierend
in Echtzeit
Das klingt erst einmal etwas komplex, ist aber im Grunde ganz einfach. Jede bisher bekannte Form der analogen journalistischen Darstellung ist im Web abzubilden. Ein Text kann in einer Zeitung stehen, genauso aber auch im Netz. Ein Foto kann analog publiziert werden, ebenso aber auch digital. Audios, Videos – alles, was wir bisher als Standard audiovisueller Medien kannten, lässt sich mühelos im Web publizieren. Wer daraus etwas Neues macht, kann das zwar digital veröffentlichen, der Kanal zurück in die analoge Welt funktioniert aber nicht.
Beiträge zu einem Thema zu kuratieren, mit Usern in Netzwerken zu interagieren, den Tag in Echtzeit zu begleiten – das alles sind Dinge, die theoretisch schon seit Beginn des Internets möglich gewesen wären. Man hat sich allerdings lange Zeit schwergetan, sie als originären Journalismus zu begreifen. Dementsprechend eigenständig müssen also auch diejenigen aufgestellt sein, die diese neue Form des digitalen Journalismus prägen wollen. Denn so viel steht fest: Vielfach wird immer noch im Nebel gestochert, vieles ist mit der heißen Nadel gestrickt. Gesicherte Erkenntnisse darüber, wo der digitale Journalismus in zehn Jahren stehen wird? Ebenfalls Fehlanzeige. Wie auch, nach gerade mal ein paar Jahren, in denen sich das Web von der Nische für Technikfreaks hin zum Massenmedium entwickelt hat? Man sollte also einiges mit Vorsicht genießen, was über solche Themen geschrieben wird (das gilt selbstverständlich auch für dieses Buch).
Man kann nicht über digitale Medienwelten sprechen, ohne sich in diesem Zusammenhang über Medienkonvergenz Gedanken zu machen. Möglicherweise ist Konvergenz sogar der treffendere Ausdruck für das, was momentan passiert. Der Begriff Konvergenz hat nur ein Problem: Er wurde in den Zeiten der New Economy um die Jahrtausendwende zu Tode zitiert. Man konnte sich darauf verlassen: Wenn jemand schon kein Konzept und keine rechte Strategie für die kommenden Jahre vorweisen konnte, zumindest eines wollte er in Zukunft immer sein – konvergent. Was irgendwann zu der absurden Situation führte, dass man auf Panels oder Interviews schon mal gefragt wurde, was unter Konvergenz überhaupt zu verstehen sei.
Man muss für eine vernünftige Antwort nicht einmal irgendwelche medienwissenschaftlichen Theorien wälzen, es reicht schon ein Blick auf die Bedeutung des Begriffs. Konvergenz bedeutet, dass sich Dinge annähern, dass Grenzen verschwimmen. Nichts Anderes passiert bei der digitalen Produktion von Medien. Medien emanzipieren sich von ihrem Trägermedium, wichtig sind die Inhalte und deren Verknüpfung und Fortschreibung. Was strategisch gesehen sowohl für Journalisten als auch Medienunternehmen bedeutet, dass sie eines begreifen müssen: Sie verkaufen nicht (im Falle bspw. von Zeitungen) Papier, sondern Informationen. Inhalt, das ist zunächst einmal alles, was zählt in der neuen Medienwelt.
Das klingt in der Theorie so naheliegend wie einfach. Doch was im ersten Moment simpel aussieht, birgt eine Menge Komplikationen in sich. Schließlich ist es nicht damit getan, Inhalte datenneutral zu produzieren und in Datenbanken so lange zu lagern, bis jemand kommt, sie herausnimmt und verteilt. Es gibt eine ganze Fülle von Beispielen, in denen neue Medien- und Darstellungsformen ausprobiert wurden, ohne Rücksicht darauf, ob derjenige, der sich daran versucht, das nötige Handwerk beherrscht. Was merkwürdig anmuten mag, ist eine einfache Sache: Nicht jeder eignet sich für jedes Medium.
Kurzum: Nicht jeder kann alles, nicht jeder muss alles gleichermaßen beherrschen. Und nicht jeder Inhalt lässt sich zwingend in jeder Form darstellen. Man muss auch künftig nicht zu jedem 60-Zeiler, den man für eine Zeitung schreibt, gleich noch ein großartiges Video und ein knackiges Audio hinterher schieben. Wichtiger ist, künftig auch entscheiden zu können, was man besser nicht macht.
So sehr, wie wir uns als Journalisten mehr denn je mit Handwerkszeug, mit neuen Technologien und Gerätschaften auseinandersetzen müssen, so eindeutig ist, dass wir Journalisten bleiben. Dabei zählen in erster Linie all die Werte und Fähigkeiten, die in unzähligen anderen Büchern schon beschrieben und deswegen hier nicht mehr aufgezählt werden müssen. Wer anderes behauptet, bringt die Grundfesten unseres Berufs ins Wanken.
A3ALLESKÖNNER, DIE NICHTS RICHTIG KÖNNEN?
Die Frage begegnet mir bei vielen meiner Seminare: Ob es nicht eine Gefahr sei, dass man über all die technischen Details, die rasanten Weiterentwicklungen und Planungen ganz simple Dinge vergesse – nämlich all die, die mit anständigem, sauberem Journalismus zu tun haben. Und ob man nicht befürchten müsse, dass die kommende Generation der transmedial denkenden Journalisten eine sei, die alles ein bisschen, aber nichts richtig könne.
Die Antwort ist eindeutig: Nein, muss man nicht. Eine solche Argumentation ist eher ein Vorwand dafür, dass man sich mit technischen und inhaltlichen Neuerungen nicht auseinandersetzen will. Was zuversichtlich macht: Es gibt eine ganze Reihe von Journalisten, die mit solchen Dingen spielerisch und selbstverständlich umgehen. Für die sich diese Fragen erst gar nicht stellen, weil Smartphone-Videos, soziale Netzwerke und kuratierte Leselisten fester Bestandteil sowohl ihres Alltags sind. Es wäre nicht erstaunlich, wenn die Debatte über Überforderung bald beendet ist. Für Digital Natives war sie seit jeher unsinnig.
Die wichtigste Erkenntnis für Journalisten angesichts dieser Entwicklung: Den Nutzer gibt es nicht. Angesichts von unzähligen vielen Nutzungsmöglichkeiten, die digitale Technik eröffnet, bleibt gar nichts anderes übrig als auf so vielen Kanälen wie möglich präsent zu sein.
Und noch eine Plattform entwickelt sich rasant: die mobilen Endgeräte. Auch auf die Gefahr hin, dass das wie ein Werbespruch klingt: Das iPhone war im Jahr 2007 tatsächlich das Gerät, das alles verändert hat. Smartphones und Tablets waren plötzlich diese „konvergenten Endgeräte“, von denen man ein paar Jahre zuvor auf den Medien-Panels fantasiert hatte. Dazu kam eine vergleichsweise simple Bedienung. Videos anschauen oder Mails lesen konnte man auch schon mit den iPhone-Vorgängern. Aber erst als solche Dinge so einfach wie nur möglich wurden, entwickelte sich das Smartphone zum digitalen Helferlein in allen Lebenslagen. Das Smartphone ist zum selbstverständlichen Begleiter durch den Tag geworden, so dass es völlig unstrittig ist, dass auch Medien dort stattfinden müssen. Und auch hier gilt: Die Entwicklung mobiler Medien ist noch lange nicht an ihrem Ende angekommen.
Dabei ist vieles denkbar, beinahe nichts ausgeschlossen. Es wäre auch aberwitzig, irgendetwas auszuschließen, nimmt man sich nur mal die Entwicklung der ersten Milleniums-Jahre als Beispiel. Die Dinge, die wir heute als völlig selbstverständlich nehmen, galten im Jahr 2000 noch als Spinnerei einiger unverbesserlicher Digital-Optimisten. Man war ja damals schon froh, wenn man mit so einem Handy halbwegs störungsfrei telefonieren konnte. Wenn man also berücksichtigt, was in den letzten 15 bis 20 Jahren alles passiert ist, sollte man sehr vorsichtig sein mit Zukunftsprognosen, die irgendetwas ausschließen.
Ein weiterer Aspekt der Digitalisierung: Wir dürfen uns an den Gedanken gewöhnen, dass das Internet nicht nur den guten alten Computer schon lange verlassen hat und auf das Telefon oder auf Tablets und andere Lesegeräte gewandert ist. Das Netz ist jetzt und künftig so sehr Bestandteil unseres Alltags, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir „drin” sind. Spätestens mit dem „Internet der Dinge“ stellt sich also für alle nur noch die Frage: Welche Information liefern wir wem wann wohin? Der digitale Journalist einfach ein Informationsbroker? Gar nicht mal so unwahrscheinlich, dieses Szenario …
Zumindest verändert sich auch das Publikum. Die heute 14-Jährigen haben eine so hohe Web-Affinität wie noch keine Generation vor ihnen.