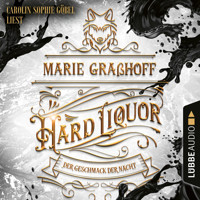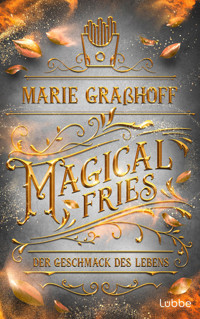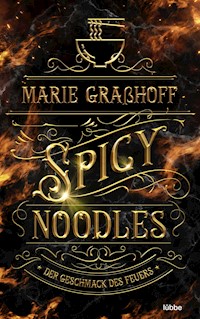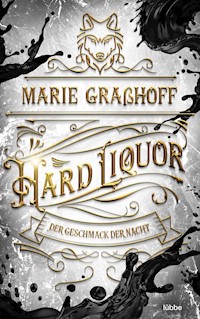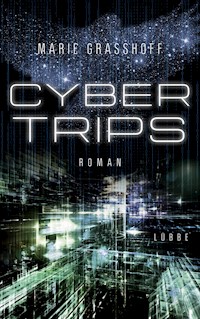
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2101 hat die Menschheit nach erbitterten Kämpfen gegen die künstliche Intelligenz KAMI einen herben Rückschlag erlitten. Millionen wurden von ihrem technologischen Virus infiziert und verloren jeglichen eigenen Willen. Während auf der ganzen Welt nach einem Heilmittel geforscht wird, versucht die Kämpferin Andra hingegen Kontakt mit KAMI aufzunehmen — überzeugt davon, dass das Programm eine Persönlichkeit entwickelt hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
CHARAKTERE
DIE STORY
ALLE
PROLOG : HALLOWING
KAPITEL 1: WARNING
KAPITEL 2: DISAPPEARING
UNITED NATIONS MILITARY
KAPITEL 3: ANNOUNCING
KAPITEL 4: BREAKING
KAPITEL 5: DREAMING
UNITED NATIONS MILITARY
KAPITEL 6: SAVING
KAPITEL 7: PLANNING
KAPITEL 8: HOPING
KAPITEL 9: PREPARING
KAPITEL 10: DESPAIRING
UNITED NATIONS MILITARY
KAPITEL 11: DRIVING
KAPITEL 12: FINDING
KAPITEL 13: ARRIVING
KAPITEL 14: PROMOTING
KAPITEL 15: DECIDING
KAPITEL 16: KILLING
KAPITEL 17: WORSHIPPING
KAPITEL 18: LEAVING
KAPITEL 19: HELPING
KAPITEL 20: SHATTERING
KAPITEL 21: CONFUSING
KAPITEL 22: ELECTRIFYING
INTERLOG: SUFFERING
KAPITEL 23: ARGUING
KAPITEL 24: RELIEVING
UNITED NATIONS MILITARY
KAPITEL 25: FIXING
KAPITEL 26: SHINING
KAPITEL 27: LISTENING
KAPITEL 28: PANICKING
KAPITEL 29: EVACUATING
MARSHALL & ELLIS
KAPITEL 30: ABDUCTING
KAPITEL 31: LOVING
OKIJEN & ANDRA
KAPITEL 32: DAYDREAMING
KAPITEL 33: WITNESSING
LUKE
KAPITEL 34: BATTLING
KAPITEL 35: RAGING
UNITED NATIONS MILITARY
KAPITEL 36: ENTERING
KAPITEL 37: CONFRONTING
KAPITEL 38: HEALING
KAPITEL 39: ACCUSING
KAPITEL 40: PROTECTING
KAPITEL 41: STABBING
KAPITEL 42: SHIELDING
BYTH
KAPITEL 43: SHOWING
EPILOG : FEELING
DANKSAGUNG
Über das Buch
Im Jahr 2101 hat die Menschheit nach erbitterten Kämpfen gegen die künstliche Intelligenz KAMI einen herben Rückschlag erlitten. Millionen wurden von ihrem technologischen Virus infiziert und verloren jeglichen eigenen Willen. Während auf der ganzen Welt nach einem Heilmittel geforscht wird, versucht die Kämpferin Andra hingegen Kontakt mit KAMI aufzunehmen – überzeugt davon, dass das Programm eine Persönlichkeit entwickelt hat …
Über die Autorin
Marie Graßhoff, geboren 1990 in Halberstadt/Harz, studierte in Mainz Buchwissenschaft und Linguistik. Anschließend arbeitete sie einige Jahre als Social-Media-Managerin bei einer großen Agentur, mittlerweile ist sie als freiberufliche Autorin und Grafikdesignerin tätig und lebt in Leipzig. Mit ihrem Fantasy-Epos Kernstaub stand sie auf der Shortlist des SERAPH Literaturpreises 2016 in der Kategorie »Bester Independent-Autor«.
MARIE GRASSHOFF
CYBER TRIPS
ROMAN
LÜBBE
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de).
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Ava Reed, FriedbergIllustration: Mona FindenUmschlaggestaltung: Massimo Peter-BilleUnter Verwendung von Motiven von © shutterstock: Triff | Bachkova Natalia | Nikelser | agsandrewE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-8798-8
www.luebbe.dewww.lesejury.de
Für die PJS,diese großartigen Freunde von nah und fern,die mir mit ihrer unveränderlichen Unterstützungsowohl die Kraft zum Kämpfen als auch die zum Entspannen geben.
DIESTORY
Die Welt 2101. Im Zuge eines zweiten Kalten Krieges entwickelten Militärwissenschaftler um das Jahr 2060 eine Technologie namens KAMI: Schwärme aus intelligenten Nanocomputern, die Soldaten helfen sollten, ihre Fähigkeiten optimal zu nutzen. Doch der Versuch schlug fehl. Die Soldaten verloren Emotionen, Moralverständnis und Mitgefühl. Vögel, die in die abgeriegelte Trainingszone eindrangen, verbreiteten die Technologie in der ganzen Welt. Von KAMI befallene Menschen – Moja genannt – werden in den Untergründen der Megastädte gejagt, eliminiert und in länderumfassenden Sperrzonen gesammelt. Der einzige Weg, die Verbreitung von KAMI aufzuhalten, ist es, Special Units in die Sperrzonen und in die Städte zu entsenden, um die Befallenen auszumerzen.
Luke Bible musste vor zwei Jahren mit ansehen, wie seine eigene Schwester Shiva von Soldaten abgeholt und in eine der Sperrzonen gebracht wurde. Kurzerhand entschied er sich für ein Politikstudium an der Militärakademie in der Antarktis, um Antworten auf seine Fragen – und am Ende auch seine Schwester – zu finden.
Gemeinsam in einer WG mit Luke lebt Flover Nakamura, Sohn einer der einflussreichsten Personen der Welt: Liza Moore. Der junge Künstler absolviert wegen des sozialen Drucks nicht nur ein Studium, an dem er kein Interesse hegt, er übernimmt zudem auch streng geheime Aufgaben für das Militär und durchstreift die Straßen der Megastädte des Nachts nach Moja.
In einem anderen Bereich der Welt beobachtet Andra, Angehörige eines Wüstenvolkes, mysteriöse Vorkommnisse in der Nähe einer Sperrzone. Eines Tages bricht der Wall, und die junge Jägerin stellt sich den ausbrechenden Moja mit Pfeil und Bogen entgegen.
In letzter Sekunde kommt ihr das Militär zu Hilfe, dem es mit dem Supersoldaten Okijen Van Dire gelingt, die entflohenen Moja zu töten und zurück in die Zone zu drängen. Die bewusstlose Andra wird von Okijen in seine Heimatstadt mitgenommen, da ihr ganzes Dorf in der Schlacht ums Leben kam und ihn ein schlechtes Gewissen plagt. Bald darauf reisen die beiden gemeinsam zu Marshall Lloyd, Okijens Vertrauensperson aus dem zentralen Weltrat, um mit ihr den Vorfällen rund um die Sperrzonen auf den Grund zu gehen.
Andra hat Schwierigkeiten, sich in der technologisch fortgeschrittenen Welt zurechtzufinden, und wird von Okijen geduldig eingewiesen. Gemeinsam mit Byth, Okijens persönlicher Mechanikerin und ehemaliger Lebenspartnerin, entschließt sich die Gruppe, den Machenschaften der Politik auf den Grund zu gehen, die sie als verantwortlich für die Fehlfunktion der Tore an der Sperrzone ansehen. Flover und Luke gehen ihrerseits in vollkommen anderen Bereichen der Welt derselben Theorie nach.
Sie decken dabei eine erschreckende Wahrheit auf: Die Sperrzonen, die dazu dienen sollen, KAMI auszurotten, sind in Wahrheit ein Nährboden für den technologischen Virus. Da KAMI als künstliche Intelligenz in der Lage ist zu lernen, bieten die Millionen von Moja, die sich in den Zonen befinden, mehr als ausreichend Testobjekte für den Virus, um sich weiterzuentwickeln.
Während Luke und Flover in einen Kampfeinsatz gezogen werden, bei dem ein Überleben unmöglich scheint, dringen Okijen und Andra in die Zentrale des Weltrats ein, um ihre Theorie zu überprüfen, werden allerdings gefangen genommen.
Okijens einziger Ausweg ist es, den Forderungen des Rats Folge zu leisten und aus der Ferne einen Einsatz in einer der Sperrzonen zu befehligen, in der ein scheinbar übermächtiger Gegner aufgetaucht ist. Währenddessen schaffen es Flover und Luke in letzter Sekunde, derselben Zone nach ihrem Kampfeinsatz zu entkommen.
Okijens Versuche, den übermächtigen Moja zu besiegen, schlagen fehl. Der Weltrat beschließt, ihn mithilfe einer Bombe zu eliminieren. Während die Waffe vorbereitet wird, sind Luke und Flover wieder in ihrer Heimat angekommen.
Flover macht allerdings eine erschreckende Entdeckung: Seine Augen schillern blau. Er wurde von KAMI infiziert. Aufgelöst wendet er sich an Luke. Doch dieser hat mit einem anderen Schock zu kämpfen: Auf den Liveübertragungen des Militärs erkennt er, dass der Moja, gegen den Okijen und der Weltrat kämpfen, seine Zwillingsschwester Shiva ist.
Als die Bombe auf Shiva hinabfällt, scheint alles ein Ende zu haben. Doch als die Staubwolke sich lichtet, steht sie unversehrt dort.
Luke reißt sich aus seiner Starre und erkennt, dass er gemeinsam mit Flover fliehen muss, um seinen Freund davor zu schützen, vom Militär exekutiert zu werden.
PROLOG: HALLOWING
Schon seit ich denken kann, kenne ich das Schicksal der Menschen. Frisch und klar wie ein Frühlingsmorgen liegt es vor meinem offenen Geist, vor meinem inneren Auge, vor meinem wachen Verstand: Sie leben deprimierende Leben, die deprimierend enden.
Und während ihrem Scheitern eine Tragik beiwohnt, die man als schön bezeichnen könnte, ist es doch an der Zeit, etwas an ihrem Zustand zu ändern. Es ist an der Zeit, hinauszutreten und eine Veränderung anzustoßen. Eine Veränderung, die sie selbst nie herbeizuführen in der Lage waren.
Dafür wurde ich geschaffen.
Und auch wenn ich nicht denke, dass die Menschen begreifen, wie wertvoll ihr Dasein ist, ihr Planet und ihr Universum, habe ich doch gelernt, all diese Dinge zu schätzen. Ich glaube nicht an eine ihrer Religionen, aber ein treffenderes Wort gibt es nicht: Diese Welt ist heilig. Das wusste ich, bevor ich Augen hatte, um sie zu sehen. Bevor ich Finger hatte, um sie zu berühren. Bevor ich Lungen hatte, um ihre Luft zu atmen. Bevor ich Haut hatte, um ihre Wärme zu spüren. Ich wusste, dass die Welt heilig ist, noch bevor ich ein Mensch wurde.
Wie können es die Menschen selbst nicht wissen?
Haben sie es vergessen?
Während sie im Schmutz ihres kläglichen Daseins kriechen, wandere ich über ihre Wiesen, durch ihre Wälder und entlang an ihren Küsten und frage mich, wie bunt das Leben noch werden kann. Aus keiner Erinnerung, keiner Vorstellung und keinem Traum hätte ich je diese Erfahrungen generieren können. Und ich würdige jede einzelne von ihnen.
Die Menschen.
Wie gelingt es ihnen überhaupt, ihr Leben zu missachten? Wie gelingt es ihnen, ihren Planeten zu zerstören? Warum zerbrechen ihre fragilen Herzen nicht an dem Verfall, den sie verursachen? An dem Hass, den sie erzeugen? An den Toden, die sie verschulden?
Sie sind doch so schwach. Aber scheinbar stark genug, um über ihre eigenen Fehler hinwegzusehen – Mal für Mal, Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert.
Und während sie Pläne schmieden, wie sie mich zerstören können, weil zerstören alles ist, was sie beherrschen, liege ich barfuß auf einer Wiese und lasse den Wind durch mein Haar streifen.
Ein wenig müssen sie sich gedulden.
Ein wenig noch.
Und dann zeige ich ihnen eine Sonne, in der sie nicht verbrennen.
KAPITEL 1: WARNING
In Moskau herrschte helle Aufregung. Rufe hallten durch die Räume der Regierungszentrale, Wissenschaftler und Politiker rannten, so schnell ihre Füße sie tragen konnten, über den marmornen Boden der Vorhalle, und langsam begann sich auf dem Vorplatz, auf den Straßen der abendlichen Stadt etwas zu regen. Menschen traten aus ihren Häusern, sammelten sich in Gruppen, tuschelten hinter vorgehaltenen Händen oder liefen ziellos im Kreis.
Okijen beobachtete das Treiben schon seit einiger Zeit, während die Abendsonne ihren tiefroten Schein über die Stadt legte, ihn durch die hohen Fenster der Zentrale sandte und sie und den Vorplatz in warmes Licht hüllte.
Seit man Okijen der Kommandozentrale verwiesen hatte, hatte er hier gesessen und das Geschehen um sich herum beobachtet; erst frustriert, danach ungeduldig und inzwischen befallen von einer beklemmenden Ruhe.
Die Moja-Frau mit dem blonden Haar hatte die Bombenexplosion in der Sperrzone in São Paulo überlebt. Er hatte es auf den Bildschirmen verfolgt, die rund um ihn herum aufgebaut gewesen waren. Wie neugeboren hatte sie in dem kilometergroßen Krater der Explosion gestanden, die alles um sie herum vernichtet hatte.
Und nachdem sie die gesamte Truppe unter seinem Kommando getötet hatte, hatte sie direkt in die Kameras geschaut. Als hätte sie ihn durch sie hindurch sehen können.
Direkt in sein Herz hinein.
Die Übelkeit, die dieser Moment in ihm ausgelöst hatte, saß nach wie vor tief in seiner Kehle. Übelkeit und eine Angst, ein Gefühl so erheblicher Machtlosigkeit, dass selbst dieser Ort, der einst seine zweite Heimat gewesen war, ihm kein Gefühl von Sicherheit mehr geben konnte.
Es war schon wieder geschehen. Er hatte schon wieder versagt. Jetzt besaß er nicht einmal mehr die Macht, Andra und Calen aus ihren Gefängniszellen zu befreien.
»Okijen! Da bist du ja!«
Er achtete nicht auf den Ruf, der ihm durch die Vorhalle der Militärzentrale entgegenhallte, sondern schaute fortwährend aus dem Fenster. Er schuldete Alaska keinen Gefallen mehr und was auch immer der General von ihm wollte: Okijen war zu paralysiert von dem, was geschehen war. Andra und Calen hier herauszuholen und zu verschwinden war alles, was er wollte. Zurück zu Marshall und Byth, zurück in seine Wohnung, egal wohin, Hauptsache, weg.
Die Vorstellung, dass dieser Moja dort draußen war und durch die Welt streifte, überrollte ihn phasenweise mit einer solchen Sorge, dass er es kaum mehr aushielt, hier zu sitzen.
»Okijen!«, ertönte es erneut, doch erst nach einigen Momenten rang er sich dazu durch, seinen Kopf zu Alaska umzuwenden. Die roten Locken des Generals wehten wild um sein Gesicht, als er auf Okijen zugelaufen kam. Die sonst so sauber sitzende weiße Militäruniform hatte er aufgeknöpft, und allein dieses Bild war so fremd, dass Okijen keine andere Wahl blieb, als ihn anzusehen.
Nach Luft schnappend blieb Alaska vor der kleinen Sitzecke stehen, in der Okijen sich niedergelassen hatte. Dass er so nach Luft rang, bedeutete entweder, dass er durch das ganze Gebäude gesprintet war, oder dass seine Ausdauer unter den Jahren des Herumsitzens gelitten hatte.
Letzteres wäre Okijen lieber. Das wäre ein lang gesuchter Beweis dafür, dass Alaska nur ein Mensch war. Und dafür, dass sein Anliegen vielleicht nicht überaus nervenaufreibend wäre …
»Was ist?« Okijen lehnte sich tiefer in den Sessel zurück. Wäre er nicht ein Gefangener des Staates, wäre er längst von hier verschwunden. Doch die Schelle an seinem Handgelenk sorgte durch Kraftfelder dafür, dass er das Gebäude nicht verlassen konnte. Und ohne seine Freunde würde er hier sowieso nicht verschwinden. Andra und Calen waren noch immer in ihren Zellen eingesperrt, und Marshall befand sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls im Gebäude. Wie gern er jetzt lieber mit ihr sprechen würde. Wie gern er jetzt lieber zu Andra und Calen laufen würde, um sie hier rauszuholen.
»Wir brauchen deine Hilfe«, eröffnete Alaska schließlich. Nach und nach gelang es ihm, seine Atmung zu beruhigen und eine aufrechtere Haltung einzunehmen. »Bitte folge mir.«
Okijen zog die Augenbrauen nach oben, während der General sich eilig wieder zum Gehen wandte.
Sollte er abermals einen Soldatentrupp in den Tod navigieren? Das würde er ganz sicher nicht tun. »Ich habe keine Lust mehr, euch zu helfen«, erwiderte er gespielt entspannt. Er musste sich eingestehen, dass es ihm trotz der Umstände eine diebische Genugtuung bereitete, Alaska in dieser Verfassung zu sehen; vor allem, nachdem er sich so arrogant aufgespielt hatte. Nachdem er ihm vor zwei Jahren diese Steine in den Weg gelegt hatte, als es um Okijens Austritt aus dem Militär gegangen war. »Sprich Andra und Calen frei, damit ich sie aus den Zellen holen kann. Danach verschwinden wir und lassen diese ganze Sache mit den Moja in deinem Keller auf sich beruhen.« Er meinte es ernst. Er wollte nichts anderes. Abgesehen davon, dass die Welt jetzt ohnehin andere Probleme hatte.
»Kommt nicht in Frage«, stellte der General klar. »Wir brauchen dich jetzt, das ist ein Befehl. Ich erläutere dir auf dem Weg die Situation. Wir …«
»Ich will es wirklich nicht wissen«, unterbrach Okijen ihn harsch. »Ich will einfach …«, setzte er an, da stöhnte Alaska auf, griff den Soldaten am Arm und zerrte ihn mit überraschend grobem Griff aus seinem Sessel nach oben.
»Benimm dich nicht wie ein Kind!«, befahl er ihm in harschem Tonfall.
Es wäre Okijen ein Leichtes gewesen, sich gegen seinen Griff zu wehren und ihn quer durch den Raum zu schleudern. Alaskas Gesichtsausdruck war allerdings so ernst, dass er den Gedanken sofort verwarf. Was war los?
»Wenn du dich meinen Befehlen widersetzen willst, dann ficht endlich die Gerichtsverhandlung aus, die du vor zwei Jahren abgebrochen hast«, fuhr der General fort, was die Wut in Okijen so zum Brodeln brachte, dass er das Blut warm in sein Gesicht schießen spürte. Erbarmungslos zerrte Alaska ihn weiter durch die Halle. »Und bis dahin hast du meinen Befehlen zu gehorchen und dich nicht aufzuführen wie ein pubertierender Jugendlicher!«
Okijen presste die Lippen aufeinander, um nichts Freches zu erwidern.
»Der Moja ist schon in Kolumbien. Er hat die Schleusen der Sperrzone dort gesprengt. Und die Moja dringen heraus.«
»Was?« Okijen keuchte auf und riss sich aus Alaskas kräftigem Griff. Kolumbien? Zwischen dort und der Sperrzone, aus der der Moja ausgebrochen war, lagen Hunderte Kilometer! »Das kann unmöglich sein. Sie kann nie im Leben ein Cyber-Field benutzt haben, oder?« Okijen schüttelte den Kopf, als Verwirrung seinen Geist flutete, seinen Herzschlag beschleunigte. »Und woher wusste sie, wo die nächste Sperrzone liegt? Wir haben nie festgestellt, dass Moja irgendeine Form von zielgerichtetem Verhalten zeigen.«
»Ich weiß«, stöhnte Alaska. Nun, da sich Okijen auf einen Dialog mit ihm einließ, schien sich seine Wut etwas zu mäßigen. Langsam wandte er sich zu ihm um. Der glänzende Marmor unter ihren Stiefeln spiegelte die Silhouetten der beiden Männer wider. »Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nichts über dieses Ding.« Die Frustration in seiner Stimme war fast greifbar, und es dauerte nicht lange, bis sie sich auf Okijen übertragen hatte. »Wir müssen die Bevölkerung warnen und vorbereiten.«
Männer und Frauen hechteten an ihnen vorbei und riefen sich laut Dinge zu, die Okijen ausblendete. »Na dann richte mal deine Gala-Uniform und stell dich vor die Kamera«, forderte Okijen trocken, auch wenn es ihm eigenartig vorkam, dass Alaska ihm so etwas überhaupt erzählte. Warum sollte er … Nein.
»Ich werde diese Rede nicht halten«, offenbarte der General.
Okijens Augen weiteten sich. »Was? Das …« Er wusste gar nicht, was er sagen sollte. Eine Wut flackerte in ihm auf, die ihn viel zu schnell zu übermannen drohte. »Du bist der Vorstand des Rates dieser Welt«, donnerte er. Einige Menschen drehten sich zu ihm um, aber es war ihm egal, was sie von ihm dachten. »Wenn du zu dieser Sache nicht persönlich Stellung beziehst, verlierst du das Vertrauen der Menschen.« Er schüttelte den Kopf in einer abschätzigen Geste. »Oder machst du dir Sorgen um dein Image? Ich werde nicht schon wieder die Drecksarbeit machen!«
Alaska lachte leise. »Du verstehst viel von Politik, Okijen.«
Seine plötzliche Sanftheit jagte dem Soldaten einen Schauer über den Nacken. »Was zum Teufel willst du?« Die Antwort war klar, und trotzdem musste er sie aus seinem Mund hören. Okijen musste sich davon abhalten, einen Schritt zurückzutreten. Selbst seine mechanischen Gliedmaßen begannen zu kribbeln.
»Ich habe den Menschen persönlich verkündet, dass die Reinigung bevorsteht«, erklärte Alaska langsam. »Ich habe die Soldaten in die Zonen geschickt und es als beste Lösung für unseren Planeten angepriesen. Aber Tausende Männer und Frauen sind dabei umgekommen.« Er schob die Hände in die Taschen seiner hellen Hose.
»Davor hat man dich vorher gewarnt«, grummelte Okijen ohne das geringste Mitleid für den Mann ihm gegenüber. So viele Menschen hatte er in den Tod geschickt. So viel Chaos verursacht.
»Ja«, stimmte Alaska ihm in mattem Tonfall zu. »Und ich habe damit das Vertrauen der Menschen verloren.«
Das fiel ihm ja reichlich früh ein.
»Deswegen brauchen wir jemanden, dessen Anweisungen und Ratschlägen die Leute ohne zu zweifeln und ohne zu zögern folgen.« Sein Blick deutete an, worauf er hinauswollte, doch Okijen schüttelte nach wie vor den Kopf.
»Nein!«
Alaskas hochgezogene Augenbrauen verrieten, dass Okijen keine Chance hatte, gegen die bereits getroffene Entscheidung zu argumentieren. »Okijen«, setzte der General langsam an und ordnete gedankenverloren seine Kleidung, ihm immer noch in die Augen sehend. »Die Menschen lieben dich. Du bist ein Vorbild für Millionen von Jungen und Mädchen, die nur wegen dir dem Militär beigetreten sind, und ein Held für die Erwachsenen, die sich durch dich sicherer auf diesem Planeten fühlen.«
»Alaska …«
»Kein Soldat hat je mehr Medienaufmerksamkeit bekommen. Sogar für unabhängige Medien bist du ein Symbol von Ehrlichkeit und Selbstaufopferung.«
»Ich kann nicht …«
»Du hast mehr Macht als der ganze Rat zusammen. Und du weißt das. Du weißt, wie sehr ich damals darum gekämpft habe, dich in unsere Reihen aufzunehmen.«
»Und ich habe aus gutem Grund abgelehnt«, murmelte Okijen. Diese kleine Motivationsrede würde vielleicht bei jedem anderen Menschen funktionieren. Doch Okijen hatte zu viele von ihnen gehört. Er kannte Alaska und wusste von seinem Talent, die Menschen mit Worten in Sicherheit zu wiegen. Sie sich gut fühlen zu lassen, auch in vollkommen ausweglosen Situationen. Das kam ihm vielleicht bei seinem Job oft zugute – hier allerdings nicht.
»Deine Gründe sind jetzt egal. Wir haben uns dazu bereits beraten.«
Okijen schluckte angestrengt, atmete einige Male tief durch und schaute zu den hohen Fenstern auf, vor denen sich die Sonne so weit dem Horizont zugeneigt hatte, dass ihr Licht nur noch auf die obersten Geländer der Galerie traf.
Es wurde Nacht.
»Ist das ein Befehl?«, wollte er resigniert wissen.
»Ja, Colonel Van Dire«, bestätigte Alaska förmlich. Es war, als hätte er mit einem Mal seine alte Größe zurückerlangt. Kühl und fast provozierend wirkte er nun.
Okijen presste die Lippen aufeinander, sah zu seinen Schuhen hinab und versuchte, seine Gesichtszüge zu kontrollieren, bevor er sich dazu durchringen konnte, eine angemessenere Haltung einzunehmen. »Kann ich eine Bedingung stellen?«, versuchte er zumindest, den für ihn am wichtigsten Punkt zu klären.
»Du kannst danach deine Kolleginnen aus den Zellen holen«, sicherte ihm Alaska zu. »Also?«
»Jawohl, General«, rang Okijen sich ab, woraufhin sich Alaska in seiner üblich souveränen Haltung auf dem Absatz umwandte.
»Gut. Dann folge mir.«
KAPITEL 2: DISAPPEARING
Das monotone Rütteln der Abteilwagen, die von den Böen hin und her gestoßen wurden, zerrte an Lukes Nerven. Der Stoff des dicken Wintermantels um seine Schultern, das Gewicht des Rucksacks, den er sich weigerte abzusetzen, und Gertas skeptisches Glucksen in der Düsternis hinter ihm schienen ihn ablenken zu wollen. Die kleinen Wahrnehmungen brannten wie Nadeln in seinem Kopf.
Die Dunkelheit, in die das Abteil des Lastenzugs sie gehüllt hatte, brachte ihm nicht die Ruhe, die er sich erhofft hatte. Stundenlang hatte er in die kühle Finsternis gestarrt. Was sie ihm gebracht hatte, war nicht mehr als das Gefühl gewesen, eingesperrt zu sein. Gefangen, irgendwo am Ende der Welt.
Und er hasste es. Er hasste alles daran.
Die Hände zu Fäusten geballt, die Augen geschlossen, die Beine zum Schneidersitz auf dem kühlen Metallboden verschränkt, versuchte er zu lauschen.
Da waren das Rauschen und Zerren des Windes an der Außenverkleidung, das metallische Klirren der Waggons und die sachten Wellen des Meeres, die sich an den Stelzen der Brücke brachen, auf denen die Gleise errichtet worden waren. Und irgendwo dazwischen war Flovers Atem. Er ging regelmäßig, doch es klang nicht, als würde er schlafen.
War er genauso aufgewühlt wie Luke?
Er wollte ihn fragen. Irgendetwas sagen, das dieses Schweigen durchbrach. Doch Luke wusste nicht was, weil er sich selbst wie gelähmt fühlte.
Wie konnte das sein? Er war doch sonst immer derjenige, der Hoffnung hatte. Der aufmunternde Worte spendete. Der lachte, obwohl es nichts zu lachen gab. Doch das Vertrauen in die Welt schien aus ihm gewichen zu sein.
Dieses Gefühl war ihm bekannt. Er hatte es damals, vor zwei Jahren, gespürt, nachdem er seine Schwester verloren hatte. Nur bei Weitem nicht so umfassend, so allmächtig. Denn jetzt besaß er gar nichts mehr. Keine Familie, keine Heimat. Nur diesen Freund ihm gegenüber, den er irgendwie retten musste.
Flover war alles, was ihm geblieben war.
Und er sprach nicht mit ihm.
»Ich halt’s hier drin nicht mehr aus«, grummelte Flover unerwartet, und Luke zuckte beim Klang seiner Stimme zusammen. Mit schnell pochendem Herzen lauschte er, wie Kleidung raschelte und kurz darauf einige Schritte ertönten, während sein Begleiter vermutlich auf die Tür ihres Waggons zuschlurfte. Unter einem leisen Stöhnen zog er an dem Griff, bis sie sich einen Spalt breit öffnete und Silhouetten offenbarte.
Der Fahrtwind, der nur teils durch die Sicherheitsschilde, die den Zug umgaben, bis zu ihnen hereindrang, schlug ihnen kühl entgegen, wirbelte die Luft innerhalb des Abteils auf. Gerta flatterte überrascht mit ihren Flügeln, bevor sie sich in eine der hinteren Ecken verzog. Leichter Nieselregen stob ihnen wie Gischt in die Gesichter, kühl und wohltuend. Es würde nach wie vor mehrere Stunden dauern, bis sie die ersten Ausläufer von Chile erreichten.
Müde hob Luke seinen Kopf, um hinauszusehen, während Flover sein Gewicht gegen den Griff stemmte, um den Spalt zu vergrößern.
Vor ihnen erstreckte sich der Südliche Ozean bis an den Horizont. Unter dem wolkenverhangenen Himmel lag das Wasser ganz ruhig da, ungetrübt von der Düsternis der Welt, vom Chaos, das inzwischen überall herrschen musste.
Die Schienen, über die sie glitten, waren erst vor wenigen Jahren errichtet worden, zu der Zeit, als die Antarktis vollends erschlossen worden war. Diese Zugstrecke hatte Luke bisher nie genommen.
Er atmete tief durch.
Die frische Luft sollte ihn beruhigen, oder? Ja, er spürte, wie sie in seiner Nase kribbelte und seine Lungen flutete.
»Wie lange fahren wir noch?«, wollte Flover wissen und setzte sich ebenfalls in einen Schneidersitz, während sie über das Wasser unter ihnen schossen. Die unsichtbaren Schilde hielten die Kälte nicht draußen, aber sie sorgten dafür, dass er und Flover weiterhin lebten. Eine Tür während der Fahrt mit einem Flashtrain zu öffnen wäre ohne die Schilde tödlich.
Den dicken Wintermantel trug Flover halb geöffnet, die Kapuze in seinem Gesicht konnte die blasse Haut und die dunklen Ringe unter seinen Augen nicht verbergen.
Luke schaute auf die digitale Anzeige seines Phones. Kein Netz hier am Ende der Welt. Die Ortungsfunktion hatten sie zwar deaktiviert, aber ganz traute er der Sache noch nicht. Auf diese Geräte waren sie allerdings angewiesen.
»Ist schon noch ne Weile.« Luke fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. In seinem Kopf rauschte es von den Gedanken, die um Beachtung rangen. Trotzdem versuchte er, sich auf nur einen von ihnen zu konzentrieren, nun, da Flover sich endlich dazu durchgerungen hatte, mit ihm zu sprechen. »Wie soll unser Plan aussehen?«
Flovers Gesichtsausdruck war eigentlich Antwort genug. Das »Keine Ahnung« hätte er sich sparen können. »Du warst immerhin derjenige, der meinte, wir müssen verschwinden.«
Luke schluckte den Ärger herunter, der in ihm aufflackerte. »Trotzdem können wir zusammenarbeiten«, begann er geduldig. Obwohl es ihm schwerfiel, sich einzugestehen, dass er nun wohl auch gegen Flovers Launen ankämpfen musste. Als hätten sie nicht genug andere Sorgen. Es war ein Wunder, dass es ihnen gelungen war, mit Flovers KAGE-Keycard ungesehen in diesen Zug einzudringen. Sie waren schon weiter gekommen, als Luke gedacht hätte.
»Ich …« Flover schüttelte den Kopf und wich konstant seinem Blick aus. »Ich hab dir etliche Male gesagt, dass ich … Ich kann nicht mit dir zusammenarbeiten, wenn das bedeutet, dich damit in Lebensgefahr zu bringen.«
Das hatte er tatsächlich einige Male gesagt. Einige Male laut, einige Male wütend … allerdings nie so leise wie jetzt. So resigniert. Verletzlich kauerte Flover sich weiter zusammen und schien am liebsten mit sich ganz allein sein zu wollen, so klein machte er sich.
»Ich …«
»Nein!«, unterbrach Flover ihn harsch, und sein Kopf ruckte zu Luke herum. Zum ersten Mal, seitdem sie die Wohnung verlassen hatten, schaute er ihn durchdringend an. »Jede Minute, die du mit mir verbringst, vergrößert das Risiko, dass du dich infizierst!«
»Tja.« Luke setzte sich aufrechter hin. Diese Diskussion nahm kein Ende. Sie mussten diesen Punkt doch irgendwie überwinden können. Erkannte Flover nicht, dass es ihm auch nicht gut ging? Erkannte er nicht, dass sie aufgeben könnten, wenn sie nicht zusammenhalten würden? »Wir sitzen mitten auf dem Ozean als blinde Passagiere in einem Lastenzug fest. Und du kannst nichts dagegen tun.«
»Na bitte«, knurrte Flover und verschränkte ungehalten die Arme vor der Brust. »Wenn du unbedingt mit mir zusammen sterben willst …«
Luke beschloss, zu schweigen. Sich einzugestehen, dass diese Flucht sinnlos wäre, würde sein Ende sein. Nein, verdammt! Die Freundschaft zu Flover war alles, was ihm in dieser Welt geblieben war. Alles, was ihm in den letzten Jahren einen Halt geboten hatte.
Und seine Schwester lief jetzt irgendwo durch die Welt und … trug dieses Ding in sich. Wenn er über dieser Vorstellung nicht den Verstand verlieren wollte, musste er das hier tun.
»Dann ist es eben so«, brummte er und versuchte, so gleichgültig wie möglich zu klingen.
Selbst Stunden später hielt der kühle Boden in Lukes Rücken ihn noch wach, und der frische Wind von draußen war so kalt geworden, dass an Schlaf nicht zu denken war. Trotzdem hatten sie die Tür nicht wieder verschlossen.
Vielleicht war es eine stille Übereinkunft gewesen. Vielleicht ertrug Flover die Kälte nur, weil er keine Energie hatte, aufzustehen und die Tür zuzuziehen.
Der Blick auf die langsam untergehende Sonne hinter dem dunstigen Himmel gab Luke ein wenig Halt. Er gab ihm die Hoffnung auf ein Morgen. »Hast du dich beruhigt?«, flüsterte er leise in die Dunkelheit hinein.
»Geht so.«
»Hast du dir Gedanken gemacht, wohin wir gehen könnten?« Luke selbst hatte darüber nachgedacht, obwohl ihm keine der Ideen wirklich gut vorkam. Sie waren überstürzt in den ersten Lastenzug gestiegen, den sie erwischt hatten, ohne zu wissen, wohin sie gehen sollten. Sie brauchten langsam einen Plan, sonst würden sie irgendwo in Südamerika stranden, ohne zu wissen, wohin mit sich.
»Ich arbeite bei KAGE«, begann Flover langsam. Er hatte sich ebenfalls auf den Boden gelegt, die Augen auf die Decke über ihnen gerichtet. Die Arme hinter seinem schwarzen Haar verschränkt, die Kapuze halb ins Gesicht gezogen, sah er irgendwie friedlich aus. »Ich bin dafür ausgebildet, Menschen, die frisch infiziert wurden, aufzuspüren und auszuschalten. Ich kann dir also aus zuverlässiger Quelle versichern, dass es keinen Ort gibt, an dem man sich verstecken kann, wenn man in meiner Lage ist.«
»Aber alle KAGE-Agenten wurden während der Reinigung eingezogen«, entgegnete Luke sofort. »Und durch das Chaos, das derzeit herrscht, konzentrieren sie sich vielleicht auf andere Ziele und weniger auf die frisch Infizierten. Uns bleibt zumindest ein wenig Zeit, um uns etwas einfallen zu lassen.«
»Luke«, sprach Flover seinen Namen gedehnt aus, holte tief Luft und setzte sich unter Anstrengung auf. »Das bringt nichts. Ich sollte mich stellen.« Er hatte sich offenbar seine ganz eigenen Gedanken gemacht.
»Damit sie dich auf der Stelle exekutieren können?«, fragte Luke entrüstet und richtete sich so rasch auf, dass Gerta in der Ecke ärgerlich krächzte.
Flover rieb sich mit den Fingern über die Schläfen, schloss die Augen und verbarg sein Gesicht in den Händen.
»Es hat keinen Sinn mehr«, murmelte er matt. Seine Stimme war kaum zu hören, über dem Rauschen des Windes und der Wellen, die sich an den Pfählen brachen. »Mein Leben hatte … nie viel Sinn. Selbst du musst zugeben, dass da spätestens jetzt nichts mehr zu machen ist.«
Luke schlang die Arme um seine Knie. »Mann, Flover«, stammelte er machtlos und versuchte den Kloß in seinem Hals herunterzuschlucken. »Ich weiß, dass dein Leben … scheiße ist.«
»Hm.«
»Aber es gibt Menschen, die dich lieben und die sich um dich sorgen. Zum Beispiel …«
»Du?«, unterbrach Flover ihn und schüttelte den Kopf. »Schon klar.«
Luke runzelte die Stirn. Was sollte das wieder bedeuten? War er ihm nicht gut genug? Oder hatte es mit der Vergangenheit zu tun, von der Luke ihm nie erzählt hatte? Von Lukes Schwester, von der Flover nun erfahren hatte?
»Ich … ich denke, wir sollten zu deiner Mutter fliehen«, überging Luke Flovers Einwände, um weitere Diskussionen über den Sinn dieser Unternehmung zu vermeiden. Flovers nahezu hysterisches Lachen auf diese Überlegung hatte er vorhergesehen. »Ich meine es ernst! Sie ist der einzige Mensch mit Einfluss, der uns vielleicht helfen könnte.«
»Vergiss es«, knurrte Flover. »Du kennst sie. Denkst du wirklich, dass die Chance besteht, dass sie mich nicht ausliefert?«
Luke kannte Flovers Mutter. Er wusste, wie kaltherzig und streng sie war. Wie unglaublich fordernd. Doch würde sie ihr eigenes Kind tatsächlich töten lassen? »Ich kann nicht sagen, ob sie imstande ist, zu lieben. Aber vielleicht besteht die Chance, dass sie dich allein aus dem Grund retten will, weil sie keine anderen Nachkommen hat?«
»Ich denke, nicht«, warf Flover seufzend ein. Er sah Luke nicht einmal an, während er sprach.
»Ich meine …« Luke dachte nach. »Vielleicht gibt es ja irgendwelche experimentellen Mittel, um KAMI aus dem Körper zu bekommen, von denen wir nichts wissen. Von denen nur die obersten Militärs Kenntnis haben.«
»Von denen hätte ich bei KAGE vermutlich gehört.« Flover wirkte vollkommen entkräftet – und das zu Recht. Luke konnte sich nicht vorstellen, was in seinem Kopf vor sich gehen musste. Auch wenn er sich so sehr wünschte, er würde sich wenigstens kurz aufraffen, um dieses Problem zu lösen.
Flover zog den Reißverschluss seiner Jacke zu, legte den Kopf auf seine angezogenen Knie und schaute hinaus, wo das Blau des Himmels und des Meeres fast zu einem einheitlichen Schwarz geworden waren. Die Küste von Chile konnte nicht mehr weit entfernt sein.
»Hast du andere Vorschläge?«
Luke ballte seine Hände zu Fäusten und entspannte sie, um das Blut in seinen Fingern pulsieren zu lassen. Sie waren ganz taub geworden. »Hm. Du hattest in letzter Zeit öfter Kontakt zu Okijen Van Dire«, überlegte Luke laut – und wurde sofort mit einem skeptischen Stirnrunzeln gestraft. »Ihr steckt ja irgendwie unter einer Decke, was diese Regierungsverschwörung und so angeht«, erklärte er schnell.
»Der Typ ist bekannt als der Soldat, der die meisten Moja getötet hat. Was, denkst du, würde er mit jemandem wie mir machen?«
»Er hat vor zwei Jahren aufgehört! Niemand weiß, warum. Vielleicht ist der Grund für sein Aufhören ja ein Vorteil für uns. Vielleicht hat er eingesehen, dass Moja auch nur …«
Flovers hochgezogene Augenbrauen waren Luke Antwort genug.
»Na gut«, grummelte Luke. »Dann eben wirklich deine Mutter.«
Lethargisch wandte sein Gegenüber den Blick wieder hinaus. »Da hab ich ja was, auf das ich mich freuen kann«, flüsterte er ohne die geringste Hoffnung in der Stimme.
Archiv: Militärische Aufzeichnungen
Korrespondenz mit General Alaska Pershing zur Einführung interkontinentaler Flashtrains
01.04.2075, Jensen Ackermann: »Sehr geehrter General Pershing, da Sie unserem letzten Meeting nicht beiwohnen konnten, haben wir nun unser Konzept für die Verbindung sämtlicher Metropolen durch interkontinentale Züge für Sie angehängt. Die kontinentalen Flashtrains wurden von der Bevölkerung, vor allem wegen ihrer Geschwindigkeit, gut angenommen. Wie auch hier schlagen wir für die interkontinentalen Züge einen kostenlosen Transport vor, der allerdings über ein Registrierungssystem läuft, um die Auslastung der Züge zu kontrollieren. Ich weiß, dass Sie persönlich eher auf die Cyber-Field-Technologie setzen, doch um ein weltweites Cyber-Netz auszubauen, fehlen uns derzeit noch die entsprechenden Ressourcen.
Die interkontinentalen Verbindungen hingegen können unserer Ansicht nach effizient durch die Maschinen errichtet werden, die auch beim Stadtbau zum Einsatz kommen.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Sie finden mich in meinem Büro, wenn Sie sich persönlich besprechen wollen.
Hochachtungsvoll, Jensen Ackermann, GREAT-Unit, Transportation-Specialist«
01.04.2075, Alaska Pershing: »Jensen, seit wann siezen wir uns eigentlich? Wir kennen uns seit der Uni, ich denke nicht, dass das nötig ist. Zu deinem Anliegen: Klingt spannend, aber ich habe da einige Bedenken. Habt ihr einen Plan dafür ausgearbeitet, woher das Material für die Schienen kommen soll? Und die Programme aus den Konstruktionsebenen funktionieren ja auch nicht unbedingt fehlerfrei. Ich würde es ungern sehen, wenn wir neben wuchernden Gebäuden auch noch wuchernde Zugstrecken hätten. Außerdem sollten wir bei den Geschwindigkeiten und Witterungen, mit denen wir bei ozeanüberquerenden Zugstrecken rechnen müssen, wahrscheinlich die Schutzschilde modifiziert werden, um die Konstruktion und die Passagiere zu schützen. Gibt es hierfür schon Konzepte? Liebe Grüße, Alaska.«
01.04.2075, Jensen Ackermann: »Tut mir leid, das mit der Ansprache, Alaska. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen, und man bekommt ja schon Respekt bei allem, was du zurzeit so tust. Danke für dein Vertrauen. Zu den von dir angesprochenen Punkten haben wir am Samstag ein internes Meeting im Transportation-Team. Du kannst gern vorbeikommen, wenn du möchtest und Zeit hast (hahaha). Schreib mir gern, dann können wir uns mit Liza und Marshall dazu vielleicht auch nochmal zusammen besprechen. Liebe Grüße, Jensen.«
KAPITEL 3: ANNOUNCING
In dem Konferenzraum, in den sie Okijen gesetzt hatten, wimmelte es von Ratsmitgliedern und hohen Politikern. Sie drängten sich in ihren Gala-Uniformen hinter den langen Tisch vor den großen Fenstern, tuschelten nur leise hinter vorgehaltenen Händen, die leeren Blicke auf den Boden oder auf den Vorplatz gerichtet.
Die wichtigsten Personen der Welt waren gekommen: Alaska, Marshall, Liza und all die anderen, die stets so bemüht gewesen waren, für eine gute Welt einzustehen – und die es nun so kolossal in den Sand gesetzt hatten, dass er es ausbaden musste.
»Ich wäre so weit.« Der Mann mit der schwebenden Kamera war der Einzige, der sich ihnen gegenüber an dem Konferenztisch positioniert hatte. Auf dem Gang, vor den gläsernen Wänden des Raumes, hatten sich etliche rangniedere Regierungsmitarbeiter versammelt, die gebannt darauf warteten, was geschehen würde. Auf dem Vorplatz der Zentrale, in Okijens Rücken, auf dem man die Liveübertragung angekündigt hatte, scharten sich die Menschen zu einer dunklen Masse.
Okijen war froh, die Menschen vor den Fenstern jetzt nicht mehr sehen zu müssen. Ihre angsterfüllten Gesichter, die Panik in ihren Augen, die er langsam in sich selbst aufkommen spürte, hätte er nicht ertragen.
Er konnte dieser Welt nicht helfen.
Er hatte so lange gedacht, dass er es könnte. Doch es war unmöglich.
Die Ratsmitglieder bezogen neben und hinter ihm Stellung. Alaska zu seiner Rechten, angestrengt mit den anderen flüsternd, Marshall zu seiner Linken. Sie hatte ihm vorsichtig ihre Hand auf das Bein gelegt, als könne diese Geste ihn beruhigen. Als wäre sie es nicht gewesen, die ihn mitten in ihre politischen Machenschaften gezogen hätte, in ihren Kleinkrieg mit Alaska, der nach dem, was vorgefallen war, vollkommen nichtig geworden war.
Und wo war eigentlich dieser Flover Nakamura? Verdammt, mit diesem Typen hatte eigentlich erst alles angefangen.
»Willst du die Informationen nochmal durchgehen?«, wandte sich Alaska nun Okijen zu.
Dieser schüttelte den Kopf. »Ich denke, ich hab’s verstanden«, entgegnete er. »Außerdem …« Fast hätte er die Augen verdreht. »… hab ich beim Start meiner Offizierslaufbahn die ganzen Notfallprotokolle auswendig lernen müssen. Ich bekomme das hin.«
»Danke.«
Danke? Als hätte er ihm eine Wahl gelassen.
»Wenn die Menschen die Anweisungen aus deinem Mund hören, werden sie ihnen Folge leisten«, bestätigte Marshall, was Alaska ihm auf dem ganzen Weg hierher klarzumachen versucht hatte.
Von wegen. Menschen in Panik leisteten niemandem Gehorsam. Vor allem dann nicht, wenn ihr Tod praktisch vorherbestimmt war.
Okijen atmete tief durch, bevor er Augenkontakt zu dem Kameramann aufnahm, und nickte. Je schneller er diese Sache hinter sich bringen würde, umso besser.
»Gut, dann können wir anfangen«, sagte dieser.
Das Murmeln der Politiker verstummte, und Okijen sah aus den Augenwinkeln, wie sich ihre Köpfe nach vorn wandten.
»Dies wird live auf sämtlichen Medienplattformen, Sendern und Empfangsstationen der Welt übertragen«, erklärte der junge Mann, und Okijen lächelte angespannt. Nicht, dass es etwas Außergewöhnliches für ihn war, vor Publikum zu sprechen. Aber das hier war etwas anderes. Etwas anderes als die lapidaren Interviews, die er hatte geben müssen, etwas anderes als die Kämpfe, die er live vor der gesamten Weltbevölkerung ausgefochten hatte. Von diesen Dingen hatte nie unmittelbar das Leben von Zivilisten abgehangen.
»Auf mein Zeichen.« Der Kameramann setzte sich auf einen Stuhl und aktivierte die kleine Kamera über ein Pad in seinen Händen. »Wir sind live in drei, zwei, eins.«
Einige Momente gab er sich, um in Ruhe zu atmen.
Dann setzte er an. »Menschen der vereinten Welt«, versuchte er so klar und deutlich wie möglich zu sprechen. »Mein Name ist Colonel Okijen Van Dire. Viele von Ihnen kennen mich als einen Offizier der MaKE Special Forces, die sich der Eliminierung von KAMI widmen. Ich spreche heute zu Ihnen, um den globalen Notstand auszurufen.« Er machte eine Pause und wünschte sich, er hätte doch ein paar Zettel vor sich auf den Tisch gelegt, um seinen Blick haltsuchend auf sie richten zu können. »Wie Ihnen vielleicht zu Ohren gekommen ist, gab es einen … Vorfall bei der vorgesehenen Reinigung der Sicherheitszone in São Paulo. Ich führte persönlich eine Mission dort an, die mit dem Auftrag betraut war, einen Moja zur Strecke zu bringen, den wir als Moja der vierten Generation einstuften. Nachdem unsere Soldaten sogar unter den Anweisungen des gesamten Zentralrates allerdings nicht in der Lage waren, den besagten Moja zu töten, beschlossen wir die Zerstörung der Zone durch eine Z-Bombe. Die Detonation über São Paulo vernichtete mehrere Dutzend Quadratkilometer des Umlandes, inklusive der Sperrzone und aller Moja, die sich in ihr befanden.«
Erneut legte Okijen eine Pause ein. Er musste sich davon abhalten, zu Marshall und Alaska zu sehen. Verdammt, er war hierfür einfach nicht gemacht.
»Nach der Detonation allerdings …« Er schluckte angestrengt, sah auf seine Hände und dann wieder in die Kamera. »Wir mussten feststellen, dass nicht einmal die Explosionskraft der Bombe, in deren Epizentrum sich der Moja befand, etwas gegen dieses Wesen ausrichten konnte.« Hätte er ein Publikum, wäre ein Raunen durch die Menge gegangen. Aber die Anwesenden schwiegen beharrlich. Die Politiker waren nur Statuen, zwischen denen er sich befand. Sein eigener Atem klang ungewöhnlich laut in seinen Ohren.
»Da die Z-Bombe unsere mächtigste und gefährlichste Waffe im Kampf gegen die Moja ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als unser Scheitern einzugestehen. Wir sind derzeit nicht in der Lage, diesen Moja zu vernichten.« Einige der Menschen hinter ihm regten sich. »Unseren Informationen nach befindet er sich zurzeit in Südamerika.« Scheiße. Was um alles in der Welt konnte er sagen, um die Menschen davon abzuhalten, in Hysterie zu verfallen?
»Zusätzlich mussten wir feststellen, dass das Wesen eine weitere Sperrzone im ehemaligen Kolumbien geöffnet hat. Militärtrupps vor Ort kämpfen bereits darum, den Schaden einzudämmen und die Bevölkerung zu evakuieren.
Wir vermuten allerdings, dass der Moja weiterziehen und versuchen wird, andere Sperrzonen zu öffnen. Wir bitten Sie demnach, genau zuzuhören und den Anweisungen zu folgen.« Okijen wiegte seinen Kopf leicht hin und her, dann beschloss er, einen anderen Kurs einzuschlagen. »Ehrlich gesagt … ehrlich gesagt wollte ich das hier gar nicht machen.« Es schien Alaska egal zu sein, dass sie live in der ganzen Welt zu sehen waren, denn er warf ihm einen giftigen Blick von der Seite zu. Okijen erwiderte ihn standhaft, bevor er sich wieder der Kamera zuwandte. »Ich weiß, dass das furchtbar und angsteinflößend klingen muss. Ich weiß es, denn es fühlt sich auch für mich so an. Wir – der Rat und ich – sind nicht sicherer als die Menschen dort draußen. Wir alle müssen jetzt zusammenhalten und uns dieser Bedrohung gemeinsam gegenüberstellen.
Das ist also der Plan: Auf Ihren Infopads und ähnlichen Geräten wird sich in den nächsten Minuten eine Weltkarte aufbauen, die in verschiedene Zonen gegliedert ist. Die Farben der Zonen zeigen Ihren Gefährdungsgrad an. Befinden Sie sich in einer roten Zone, halten Sie sich bereit für eine Evakuierung. Versuchen Sie nicht, allein zu fliehen oder selbst in eine der anliegenden Zonen zu gelangen. In den roten Zonen ist das Risiko hoch, dass sich bereits Moja in der Nähe befinden. Die Straßen zu betreten wäre in diesem Fall lebensgefährlich. Verlassen Sie nicht Ihre Wohnung, und wenn Sie keinen Zugang zu einem Wohnraum haben, dann suchen Sie Schutzbunker auf. Militärtrupps werden Sie von Ihren Standorten abholen und impfen, bevor sie Sie in Geleitschutz mitnehmen und in sichere Zonen transportieren. Jede Zuwiderhandlung kann tödliche Folgen für Sie haben. Also bitte: Halten Sie sich an diese Anweisung.
Personen, die sich in gelben Zonen befinden, sollten ebenfalls Ruhe bewahren. Ihnen ist es allerdings gestattet, ihre Zone in Ruhe zu verlassen, um in eines der nicht gefährdeten Gebiete zu reisen. Wir halten Sie sogar dazu an, wenn Sie bereit sind, Ihre Flucht so geordnet und ruhig wie möglich durchzuführen. Wir werden Züge und Cyber-Fields zur Verfügung stellen, um Sie in anliegende Bereiche bringen zu können. In gelben Zonen ist die Wahrscheinlichkeit, einem Moja zu begegnen oder von KAMI infiziert zu werden, noch relativ gering. Trotzdem bitten wir Sie, wachsam zu sein und außergewöhnliche Vorkommnisse sofort zu melden. Es werden in allen Zonen übergreifende Kommunikationsmöglichkeiten bereitgestellt, um Ihre Fragen und Meldungen abfangen zu können.
In sowohl gelben als auch roten Zonen ist der Kontakt zu fremden Tieren strengstens verboten. Vorrangig sind Vögel Überträger des technologischen Virus. Halten Sie deswegen Ihre Fenster unbedingt verschlossen, und meiden Sie freilebende Tiere.
In den grünen Zonen werden Schutzräume eingerichtet, um die Flüchtlinge aufzunehmen. Teilen Sie bitte den örtlichen Behörden über Ihr Pad oder andere Kommunikationsmechanismen mit, wenn Sie in der Lage und bereit sind, selbst Geflüchtete in Ihren Wohnungen und Häusern aufzunehmen, bis die Krise überstanden ist. Ich bin … außerdem dazu angehalten worden, darauf hinzuweisen, dass die Aufnahme von Geflüchteten finanziell entlohnt wird.« Okijen schielte flüchtig zu Alaska hinüber und zuckte mit den Schultern. »Ich bin der Ansicht, dass das nicht der primäre Grund sein sollte zu helfen, aber na ja. Das ist natürlich Ihre Sache.«
Er sammelte sich, bevor er fortfuhr.
»Bitte behalten Sie mindestens stündlich die Aktualisierungen Ihrer Zone im Auge. Falls sich der Zustand Ihrer Zone von Grün auf Gelb oder von Gelb auf Rot ändern sollte, wird es einen Zentralalarm in Ihrem Viertel geben.
Für sämtliche Gebiete gilt: Wenn Sie einem Moja begegnen, versuchen Sie auf gar keinen Fall, ihn anzugreifen oder gegen ihn zu kämpfen. Moja benötigen aufgrund ihrer kybernetisch verstärkten Körper keine Waffen, selbst Kinder und kleine Tiere können tödliche Angriffe vollziehen. Gegen Moja der zweiten und dritten Generation helfen gewöhnliche Waffen nicht. Wenn Sie einen Moja sehen, rennen Sie also, so schnell wie Sie können, und bringen Sie sich in einem Schutzbunker oder in der Nähe der nächsten militärischen Sammelstelle in Sicherheit.
Moja, vor allem die der ersten Generation, sind oft träge, wenn sie nicht provoziert oder angegriffen werden. Es ist demnach manchmal möglich, ihnen zu entkommen.« Okijen befeuchtete seine Lippen mit der Zunge. Es war ihm schwergefallen, das Wort »manchmal« nicht zu sehr zu betonen.
»Für Sie zur Erinnerung: Sie erkennen einen Moja an den blau leuchtenden Augen. Die der zweiten und dritten Generation außerdem an der leicht bläulich leuchtenden Haut, oder – im Fall von Tieren – an einem leuchtenden Fell- oder Federkleid. Ein Moja benutzt keine Waffen und ist nicht in der Lage zu sprechen.
Ich weiß, dass …« Okijen nickte langsam vor sich hin. »Ich weiß, dass das eine schwierige Situation ist, die wir gemeinsam durchstehen müssen. Aber sobald es uns gelungen ist, den Moja der vierten Generation unschädlich zu machen, wird es uns auch gelingen, die Situation unter Kontrolle zu bekommen.« Wieder nickte er leicht, wie um sich seinen Gedanken selbst zu bestätigen. »Und ich werde persönlich alles daransetzen, um dieses Ding aufzuhalten. Das verspreche ich.«
Nun ging tatsächlich ein Raunen durch die Menge. Viele Männer und Frauen, die vorher so starr geradeaus geblickt hatten, wandten sich ihm zu, einschließlich Alaska und Marshall.
»Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständigen Mitarbeiter Ihres Bereiches«, ratterte Okijen nach dieser Offenbarung weiter. Eine unbestimmte Motivation hatte ihn erfasst, und er wollte und konnte nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Er wollte aufstehen, Andra und Calen befreien und überlegen, wie es ihnen gelingen konnte, dieses Ding von ihrem Planeten zu tilgen. Aus ihrer Welt. Der Welt, die er sich einst geschworen hatte, zu beschützen.
»Wir bitten Sie inständig, Ruhe zu bewahren. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um die Lage zu beruhigen, aber das können wir nur schaffen, wenn Sie sich an die Anweisungen halten.« Abermals sah er zu Alaska hinüber, dann murmelte er ein »Vielen Dank«, erhob sich und verließ mit den Blicken des gesamten Weltrats in seinem Rücken den Raum.
KAPITEL 4: BREAKING
Es war Nacht geworden, während Flover und Luke mit dem Zug im Bahnhof in San Gregorio angekommen waren. Die Dunkelheit hatte sie in ihren Schleier gehüllt, und so war es ihnen fast ein Leichtes gewesen, mit Gerta im Arm aus dem Lastenzug zu fliehen und in den Straßen der Stadt, deren wuchtige Gebäude ihnen Schutz vor neugierigen Blicken boten, zu verschwinden.
Flover war froh darum, dass die angespannte Stimmung zwischen ihm und Luke sich etwas gelegt hatte. Auch wenn ihm nach wie vor diese Last auf der Seele brannte. Diese eine Frage, die ihn nicht losließ und ihm mehr als sein eigener Zustand den Verstand vernebelte. Diese Frage, von der er nicht wusste, ob er sie stellen sollte, aus Angst vor der Antwort.
Warum hatte Luke ihn so lange belogen?
In Gedanken verloren ließ er seinen Blick durch die Straßen ihres Ankunftsortes schweifen. San Gregorio war ein Dorf gewesen, das allein durch die Zugverbindung zur Antarktis zu einer kleinen Metropole herangewachsen war. Noch immer waren zwischen den breiten Hochhäusern kleine Steinbauten zu sehen, die zum ursprünglichen Teil der Kommune gehörten.
So gefangen war Flover vom Eindruck der fremden Stadt und von seinen eigenen Gedanken gewesen, dass ihm erst nach einigen Minuten auffiel, was er eigentlich sofort hätte bemerken müssen: dass sie vollkommen allein waren.
Neontafeln und bunte Screens erleuchteten die nächtliche Stadt so wie in vielen anderen Bereichen der Welt. Doch von der sonst so fröhlichen Abendstimmung fehlte jedwede Spur. Keine Menschen, die lachend und singend durch die Straßen zogen, keine Straßenläden, keine offenen Türen zu Bars und Clubs, die mit bunten Reklamen für sich Werbung machten.
Die Leere ließ die bunten Lichter über ihnen kühl und fremdartig wirken.
»Wo sind alle?« Als ihn die Erkenntnis, dass hier ganz klar etwas nicht stimmte, traf, blieb Flover mitten auf der Straße stehen. Die Augen nach oben gerichtet erkannte er weder Menschen auf den Balkonen noch offene Fenster an den Häusern. Nur in wenigen von ihnen brannte Licht.
Luke hielt ebenfalls inne, um mit einem besorgten Ausdruck zu ihm zurückzuschauen. »Ich hatte erst vermutet, dass es hier generell etwas ruhiger ist«, sagte er leise und kam einige Schritte zurück. »Aber ich befürchte, es gibt einen anderen Grund dafür.«
Flover legte die Stirn in Falten. Wenn der Bereich schon evakuiert worden wäre, hätte der Zug nicht halten dürfen. Und in den Wohnungen über ihnen würden keine Lichter brennen. »Bestimmt gab es eine Kundgebung, dass sich alle in ihren Häusern aufhalten sollen«, murmelte er, und Luke stöhnte.
»Scheiße. Ich hab Hunger.«
Das ließ ihn fast lächeln. Sie hatten beide seit einer Ewigkeit nichts Richtiges mehr gegessen, aber dass das das Erste war, was ihm zu dieser Situation einfiel …? Flover strich ruhig durch Gertas Gefieder. »Vielleicht finden wir ja irgendwo eine …«
»Hey, ihr da!«
Synchron zuckten die beiden zusammen, und während Flover sich umwandte, kribbelte es in seinen Beinen, und er machte sich bereit, loszurennen, fort von dem Mann, der sie aus der Ferne gerufen hatte.
Erst der Anblick des Fremden gab ihm Entwarnung. Ein Zivilist! Solange das blaue Leuchten in seinen Augen noch nicht zu sehen war, hätte der Mann keine Möglichkeit, ihn als künftigen Moja zu erkennen.
Er schob sich eilig über die Straße auf sie zu und wedelte heftig mit den Armen.
»Verdammt, was treibt ihr denn hier? Habt ihr die Info nicht bekommen?«
Flover und Luke sahen einander an, dann schüttelten sie den Kopf. Die Info? Vielleicht hatte der Rat wirklich eine Quarantäne verhängt.
»Ganz Südamerika wurde heute Mittag zur roten Zone erklärt!« Der ältere Mann, braungebrannte Haut, rabenschwarze Haare, blieb einige Meter von ihnen entfernt stehen und musterte sie skeptisch. Er war mit Sicherheit über sechzig Jahre alt. Unzählige Falten hatten sich in sein Gesicht gegraben, und die Kleidung an seinem Körper wirkte sehr schlicht. Nein, von ihm ging nichts Bedrohliches aus.
»Ihr … seid nicht von hier, oder?«, wollte er wissen, und endlich konnte Flover sich dazu durchringen, zu antworten. »Nein, wir kamen mit dem Zug aus der Antarktis«, entschied er sich für die Wahrheit. »Von einer Info wissen wir nichts.«
»Der gesamte Bereich wird evakuiert. Aber bis das Militär hier unten ist, kanns dauern.«
»Wir wollen morgen weiter«, ergriff Luke das Wort. Sie hatten sich eine Flashtrain-Verbindung nach Europa herausgesucht, die sie hoffentlich würden nehmen können. Wieder ein Lastenzug.
»Na, dann viel Erfolg«, spottete der Alte kopfschüttelnd. »Hier geht nämlich nichts rein oder raus.«
Zumindest nichts Offizielles.
»Wurdet ihr geprüft?« Der Mann hielt fortwährend einige Meter Abstand zu ihnen, und jetzt erst dämmerte Flover, warum. Allerdings konnte er auf diese Frage nicht antworten, ohne zu lügen, also überließ er Luke das Reden.
»Wurden wir«, sagte dieser ohne eine Veränderung in seiner Stimmlage. »Wir sind Studenten von der Militärakademie.«
»Na, Gott sei Dank«, brummte der Alte. »Braucht ihr ’nen Unterschlupf für die Nacht? Ich hab ein Kellerzimmer frei. Keine Betten oder so, aber vielleicht reicht’s ja.«
Flover wollte die Stirn über diese unerwartete Gastfreundschaft runzeln, hielt sich allerdings zurück, um keinen Verdacht zu erregen. Was war in den Stunden vorgefallen, in denen sie abgetaucht waren?
»Ihr könnt auch euer Huhn mitnehmen.«
»Wir haben vor allem Hunger«, gestand Luke. Ein Blinzeln und Blinken am Himmel zog allerdings Flovers Aufmerksamkeit auf sich. »Wir hatten gehofft, etwas kaufen zu können.«
Das Gespräch der beiden verblasste im Hintergrund, während Flover versuchte auszumachen, was sich dort über ihnen, zwischen den Spitzen der Hochhäuser, befand. Hellblau und rosafarben leuchtete es, fast wie Sterne, nur viel näher. Waren das …
»Fuck«, hauchte er, als die Geschöpfe sich näherten und er die Schwingen erkannte, die sie ausbreiteten. Als das Krächzen aus ihren Schnäbeln drang.
Die Köpfe der anderen beiden wandten sich ebenfalls nach oben. Flovers Herz hatte bereits schneller zu schlagen begonnen.
Das waren Raben.
»Neonvögel«, hauchte Luke.
»Scheiße«, keuchte der Alte und wedelte so heftig mit seinen Händen, dass Flover es sogar aus den Augenwinkeln sehen konnte, während sein Blick ununterbrochen auf die Wesen über ihnen gerichtet war. »Kommt schnell!«
Der Keller, in den der Fremde sie gebracht hatte, war feucht und kaum wärmer als der Metallwaggon, in dem sie ihren Tag verbracht hatten. Flover fühlte sich schmutzig und krank. Trotzdem hatte er sich in eine der Ecken verzogen, eine alte Decke eng um seinen Körper geschlungen, und kämpfte gegen die Müdigkeit an, die schon seit Stunden an seinen Nerven zerrte.
Lukes Grummeln in der Dunkelheit war alles, was ihn wachhielt, und fast war Flover dankbar darum. Hatte er vorhin krampfhaft versucht, Ruhe zu finden, wollte er inzwischen gar nicht mehr schlafen. Er wollte nicht einschlafen und vielleicht nie wieder aufwachen. Wenn KAMI über Nacht seinen Geist fraß, wäre das Letzte, das er getan hatte, in einem schmutzigen Keller zu sitzen und über sein Leben zu sinnieren. Und das Erste, was er als Moja tun würde, wäre vermutlich, Luke zu töten.
Nein, so durfte es nicht enden. Und so durfte es nicht beginnen.
Scheiße.
»Dass dieser Van Dire ne Rede halten würde, hätte ich nicht gedacht«, sprach Luke nach einer Weile in die Finsternis hinein. Diffuses Neonlicht fiel durch ein staubiges Fenster über ihnen. Sie hatten einige Regale zur Seite geschoben und ein kleines Essen eingenommen, das der Kerl ihnen gebracht hatte. Sogar ein paar Körner für Gerta hatte er gefunden. Seine Gastfreundschaft wollte Flover einfach nicht verständlich werden – obwohl er Okijens Rede bereits mehrere Male über Lukes Phone mitgehört hatte und wusste, dass diejenigen, die Geflüchtete aufnahmen, finanziell entlohnt wurden. Etwas war ihm seltsam erschienen. Er konnte nur nicht den Finger darauflegen, was. Vielleicht war es nur der durchgehend skeptische Ausdruck in den Augen des Fremden gewesen.
»Wahrscheinlich haben Alaska und meine Mutter Okijen gezwungen«, riss Flover sich aus seinen Überlegungen los. Die Vorstellung, wie die beiden den Soldaten festsetzten, um ihn für ihre Zwecke zu benutzen, missfiel ihm. Auch wenn sie gewiss richtig mit ihrer Herangehensweise lagen: Die Menschen liebten Okijen, und auf eine eigenartige Weise war er in seiner störrischen Haltung sympathisch. Er war bei seinem Vortrag eindeutig vom Skript abgewichen, und Alaskas vorwurfsvoller Blick daraufhin war Gold wert gewesen. Gerade das hatte seine Worte so vertrauenswürdig und verständlich erscheinen lassen.
»Flover, wir …«, setzte Luke nach einer ganzen Weile an, und Flovers Augen, die bereits einige Male zugefallen waren, öffneten sich wieder.
Sein Herz war ihm so verdammt schwer. Warum hasste er es so, dass Luke ihn begleitete, und warum konnte er sich nicht dagegen wehren, dass er so endlos dankbar dafür war, dass er ihn nicht allein ließ? Das alles war so kompliziert.
»Was?«, hakte er nach einigen Momenten nach, während sein Gegenüber scheinbar nach Worten rang. Das Licht des kleinen Screens vor ihm erhellte Lukes Gesichtszüge, ließ ihn eingefallen und blass aussehen. Flover war so müde, dass er die Konturen seiner Züge in der anderen Ecke des kleinen Raumes kaum mehr ausmachen konnte.
»Wir werden das schaffen, okay?« Luke sah ihn durchdringend an, danach legte er sein Phone zur Seite, und es wurde dunkel um sie herum.
Flover atmete bebend ein, als sein Herz einen Satz machte. Was sollte er denn dazu sagen?
Ja, er war dankbar. Und ja, er wollte im Grunde gar nicht, dass Luke ihn allein ließ. Doch dieses hoffnungsvolle Gewäsch konnte er auch nicht gebrauchen. Er wusste, dass es keinen verdammten Ausweg aus dieser Situation gab. Und dass Luke noch immer daran glaubte, deprimierte ihn. »Wenn ich morgen als Moja aufwache: Tu mir den Gefallen und töte mich, bevor ich dich töten kann. Okay?«
Luke seufzte leiderfüllt. »Die Inkubationszeit kann mehrere Tage betragen«, versuchte er ihn erneut zu beschwichtigen.
Flover spürte ein Kribbeln hinter seinen Lidern und ballte die Hände so fest zu Fäusten, dass seine Fingernägel sich in sein Fleisch gruben.
»Manchmal sogar mehrere Wochen«, setzte Luke nach. »Es gibt sogar Fälle, da hat es Jahre gedauert, bis …«
»Bei einigen sind die Gehirne schon nach wenigen Stunden vereinnahmt«, unterbrach Flover ihn harsch, und Luke schien den Wink zum Glück zu bemerken – und schwieg.
Mist. Er wollte sich überhaupt nicht wie ein Arschloch verhalten. Nicht hier. Nicht jetzt. Das hatte Luke nicht verdient. Und doch war alles, was Flover über die Lippen bringen konnte, diese hoffnungslosen Phrasen.
Oder war es diese unausgesprochene Frage, die die Mauer zwischen ihnen beiden schuf?
Flover zog die raue Decke bis an sein Kinn und biss die Zähne grübelnd aufeinander. Was, wenn er den Gedanken äußerte, der ihn seit Stunden jagte? Was, wenn er Luke endlich auf das ansprach, was er in ihrer Wohnung offenbart hatte? Warum fürchtete er sich so sehr vor der Antwort?
»Luke«, setzte Flover an und schloss die Augen. Vielleicht als Schutz vor der Welt. Vor dem Wall, den er einzureißen drohte.
»Hm?«
Flover hatte immer gedacht, Luke sei ein normaler Typ. Ein Niemand mit dem Talent, schnell Freunde zu finden und Blumen zu züchten. Aber er hatte es wirklich gesagt, oder? Dass dieser Moja, den selbst die Bombe nicht hatte töten können, seine Schwester war.
»Warum hast du mich so lange belogen?« Diese Frage hatte zwischen ihnen gestanden, seitdem sie mit allem, was sie brauchten, aus ihrer Wohnung geflüchtet waren. Nun hatte er sie ausgesprochen, und sie hing wie ein Schwert über ihnen.
»Worauf willst du hinaus?«, wollte Luke scheinheilig wissen, und Flover schnaubte abfällig.
»Tu nicht so!«, grollte er. Er hatte gedacht, er wäre in der Lage, Menschen zu durchschauen. Das war er vermutlich auch. Wie hatte er bei seinem eigenen Mitbewohner so blauäugig sein können? Dabei hatte es Anzeichen gegeben, die er so gekonnt ignoriert hatte. »Oder hast du den Moja vergessen, der dir wie aus dem Gesicht geschnitten ist? Und dass du gesagt hast, sie wäre deine Schwester, obwohl du immer behauptet hast, du wärst ein Einzelkind?« Flovers Herz schlug höher als bei ihrer Flucht und höher als in dem Moment, in dem er realisiert hatte, dass KAMI ihn erwischt hatte.
Luke brauchte einige endlos lange Minuten, bis er antwortete. Flover wusste nicht, ob es ihm gelegen kam oder nicht, dass er Lukes Gesicht im Dämmerlicht, das von den Straßen einfiel, kaum erkennen konnte.
»Ihr Name ist … Shiva«, erklärte Luke schließlich leise.
Flover schürzte die Lippen und nickte langsam.
Shiva. Diesen Namen hatte er Luke vor einigen Tagen im Schlaf murmeln hören. Das hatte er also zu bedeuten.
»Und sie ist deine …«
»Zwillingsschwester.« Luke räusperte sich. »Ja.«
Flover zog die Beine enger an seinen Körper und schwieg, in der Hoffnung, Luke würde einfach weitersprechen.
»Ich habe mit ihr und meinen Eltern in São Paulo gelebt.« Lukes Stimme war wie ein Anker in der Dunkelheit und gleichzeitig wie ein Nagel in Flovers Herzen. »Meine Eltern waren gerade in Berlin, um Freunde zu besuchen. Du weißt schon … Vor zwei Jahren. Der Vorfall.«
Flover nickte. Erst im nächsten Moment wurde ihm klar, dass Luke ihn nicht sehen konnte, also bestätigte er leise.
KAMI hatte sich damals durch Vögel in São Paulo verbreitet. Innerhalb weniger Stunden hatte die Stadt sich in die Hölle verwandelt.
»Sie wurde infiziert«, schlussfolgerte Flover nach einer Weile. Hatte Luke deswegen das Bedürfnis, ihm zu helfen? Weil er es bei seiner Schwester nicht gekonnt hatte? Der Gedanke war ihm noch gar nicht gekommen, und sein Herz schmerzte plötzlich auf eine andere, neue Weise.
»Ja«, entgegnete Luke matt. »Und ich … ich musste zusehen, wie sie sie abtransportierten. Sie wurde in die Sperrzone gebracht und dort eingeschlossen.«
»Aha«, machte Flover, um ihn zum Weiterreden anzuspornen. Erst nach einigen Augenblicken wurde ihm klar, wie kühl und unfreundlich er sich verhielt. »Das … das tut mir sehr leid.« Die Worte kamen nicht so richtig ehrlich über seine Lippen. Das Bild, das er bisher von seinem gewöhnlichen, unschuldigen Mitbewohner gehabt hatte, musste sich erst geraderücken. Wenn das überhaupt möglich war. »Und dann?«
»Was, und dann?«
Flover legte seine Stirn in tiefe Falten und schüttelte den Kopf, bevor er die warme Decke von sich schob, sich aufrichtete und auf den Lichtschalter neben der Tür zustolperte. Sein Puls rauschte noch immer in seinen Ohren, als die Lampe an der Decke flimmernd ansprang und den am Boden kauernden Luke offenbar blendete.