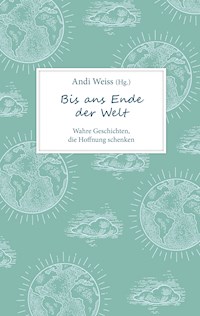Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
An manche Momente erinnert man sich ein Leben lang. Ganz besonders kostbar unter ihnen sind solche, die mit Gott zu tun haben. Andi Weiss sammelt genau diese Geschichten. Zum Glück. Denn auf diese Weise schenken die Erlebnisse auch uns Kraft und Zuversicht. Diese handverlesene Sammlung enthält neben den bewegendsten Perlen seiner bisherigen Bücher auch einige neue Erfahrungsberichte. Eine wunderbare Einladung, uns immer wieder bewusst zu machen, dass wir getragen werden - manchmal sogar, ohne dass wir es merken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Herausgeber
Andi Weiss ist auf zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen als Songpoet und Geschichtenerzähler unterwegs. Die andere Hälfte seiner Zeit arbeitet der evangelische Diakon und Logotherapeut in einer Kirchengemeinde. Auch als Buchautor hat er sich bereits einen Namen gemacht. Von der renommierten Hanns-Seidel-Stiftung wurde Andi Weiss mit dem Nachwuchspreis für Songpoeten ausgezeichnet und bekam den deutschen Musikpreis David in der Kategorie „Bester nationaler Künstler“. Außerdem engagiert er sich für die Hilfsorganisation Opportunity International (www.oid.org). Er ist verheiratet und lebt in München.
www.andi-weiss.de
Es kommt nie und nimmer darauf an, was wir vom Leben zu erwarten haben,vielmehr lediglich darauf: was das Leben von uns erwartet.
Viktor Frankl
Ein Wort zuvor …
Wer etwas bewegen will, der muss sich bewegen lassen. Und wie ginge das besser als mit Geschichten. In diesem Buch finden Sie bewegende Geschichten aus den bereits erschienenen Büchern „Ungewohnt leise“,„Es wird nicht dunkel bleiben“,„Denn Du bist bei mir“ und „Nie tiefer als in Gottes Hand“ – aber auch neue wahre und Mut machende Erlebnisse. Gelebte Geschichten. Nicht schöngeredete, gefärbte, gebleichte oder gewaschene, sondern echte Geschichten. Geprägt von Freude und Leid, von Hoffnung und Angst, von Jubel und von Tränen. Tränen, die zu Freudentränen wurden und die so von dem „TROTZDEM“ des Glaubens erzählen. Unterschiedlichste Menschen kommen mit ihrer Geschichte zu Wort. Arbeitssuchende und Erfolgreiche, Visionäre und Zweifler, Kranke und Gesundgewordene, Lebemänner und Mauerblümchen. Aber so unterschiedlich die Lebensentwürfe dieser Menschen auch sein mögen: An den einschneidenden Erlebnissen, existenziellen Weggabelungen und markanten Wegpfeilern, die uns in unserem Lebensweg vor entscheidende Fragen stellen, kommt kein Mensch vorbei. Der KZ-Überlebende und Psychotherapeut Viktor Frankl definierte einmal die „tragische Trias“, die jedes Menschenleben betrifft. Drei Tatsachen, denen jeder Mensch in seinem Leben begegnet: dem Leid, der Schuld und dem Tod. Er schreibt: „Das Leiden, die Not gehört zum Leben dazu wie das Schicksal und der Tod. Sie alle lassen sich vom Leben nicht abtrennen, ohne dessen Sinn nachgerade zu zerstören. Not und Tod, das Schicksal und das Leiden vom Leben abzulösen, hieße dem Leben die Gestalt, die Form nehmen. Erst unter den Hammerschlägen des Schicksals, in der Weißglut des Leidens an ihm, gewinnt das Leben Form und Gestalt.“1 Und so lädt Frankl ein, auch die großen Schicksalsschläge als Aufgabe und Herausforderung im Leben anzunehmen und somit Leid in Leistung, Schuld in Wiedergutmachung und die begrenzte Lebenszeit in einen verantwortlichen Lebensstil zu verwandeln.
Ich liebe die Psalmen! Wie oft weiß der Psalmdichter in der Gegenwart noch nichts von Gottes Hilfe. Wie oft scheint er im Hier und Jetzt an seiner Situation zu verzweifeln oder sogar zu zerbrechen. Aber in der Rückschau sieht er die wundervolle Begleitung, die Sinnfunken in der eigenen Biografie wie ein kunstvolles Bild, aus der Hand eines wunderbaren Künstlers, und kann dankbar sagen: „… da hast du mich getragen!“
Ich möchte den vielen Autoren danken, die bereit waren, ihre persönlichen Geschichten für dieses Buch aufzuschreiben. Geschichten, die wie ein Vogel noch in der tiefen Nacht zu singen beginnen und so trotzig hoffend in der noch traurigen Dunkelheit schon den kommenden Morgen ankündigen. Danke für alle Ehrlichkeit. Danke für alles „Teil-haben-Lassen“. Ich bin bewegt, wie viele dieser Geschichten wiederum neue Geschichten geschrieben haben. In den vergangenen Jahren haben wir auf die Geschichtenbücher unzählige dankbare Rückmeldungen bekommen. Menschen, die durch diese Geschichten heilsam erinnert werden durften: „Ich bin mit meiner Lebensgeschichte nicht allein!“
Ich wünsche Ihnen, dass jede einzelne Erzählung in diesem Buch Gottes Liebe in Ihr Herz schreibt. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Ermutigung beim Lesen der Geschichten. Ich wünsche Ihnen Mut, wieder aufzustehen, weiterzumachen, weiterzugehen, weiterzuleben, festzuhalten und weiterzuglauben.
Bleiben Sie behütet!
Ihr
Andi Weiss
1 Viktor Frankl, Ärztliche Seelsorge, S. 118
„Safah“ oder: „Der Vater ist wirklich stolz auf mich?“
Ich traf den Vater mit seinen zwei Söhnen vor ein paar Jahren in den Bergen des Nordirak. Bagdad und der Zentralirak begannen in diesen Tagen in Gewalt und Terror zu versinken. Immer mehr Menschen flohen aus dem Chaos in das wesentlich sicherere „irakische Kurdistan“, eine Region, die nicht nur von muslimischen Kurden bewohnt wird, sondern unter anderem auch Heimat der Assyrer ist. Die Assyrer sind orientalische Christen, in deren Gottesdiensten die biblischen Texte noch in Aramäisch, der Sprache Jesu, gelesen werden.
Es war kein Zufall, dass ich den Vater mit seinen zwei Söhnen traf. Der Leiter unseres irakischen Teams, mein „Bruder“ Jacob, hatte darauf bestanden, dass ich den Vater und seine zwei Kinder besuche, deren Mutter nach einem schweren Nerven- und Kreislaufzusammenbruch in der Klinik einer nahe gelegenen Stadt lag. Als Mitarbeiter der Stiftung „Wings of Hope“ versuchten der irakische Kinderarzt und ich, der deutsche Diakon, Kindern des Krieges und ihren Familien beizustehen.
„Salam aleikum, Doktor, schön, dass Sie uns wieder besuchen! Wen haben Sie denn heute mitgebracht?“, fragte der Vater, als wir an sein Zelt kommen. „Einen Gast aus Deutschland. Herr Peter ist sein Name“, stellte mich Jacob vor. – „Es freut mich sehr, Herr Peter, dass Sie den weiten Weg aus Deutschland zu mir und meinen Söhnen gefunden haben. Es ist eine Ehre für unser Zelt! Lieber würde ich Sie in unserem Haus in Bagdad begrüßen. Aber Bagdad gibt es für uns nicht mehr. Bagdad werden wir nicht mehr betreten. Doch seien Sie unbesorgt, wie Sie selbst sehen können, tragen wir die Erde für die Fundamente unseres neuen Hauses schon ab. Wenn Sie uns in einem halben Jahr besuchen, wird das neue Haus schon stehen und meine Frau wird Sie bewirten. Jetzt können wir Ihnen nur Tee anbieten. Bitte treten Sie in unser Zelt ein!“
Der starke schwarze Tee, den die Menschen hier im Irak lieben, steht schon auf dem Samowar. Er wird aus kleinen Tassen und zuckersüß getrunken. Dazu gibt es ein Glas kaltes, klares Gebirgswasser. „Besimarawa!“, sage ich, was auf Assyrisch „danke“ heißt. Mithilfe des Doktors erkundige ich mich nach dem Zustand der Frau, der Eingewöhnung in die neue Umgebung, der Schule für die Kinder, nach der neuen Nachbarschaft, und frage, ob wir helfen können.
Der Vater dankt für mein Interesse. Er entschuldigt sich nochmals für die widrigen Umstände, während der ältere Sohn ein Schälchen mit Nüssen in die Mitte stellt. Noch wird er meine Fragen nicht beantworten. Wir sind im Orient. Erst fragt er nach meiner Familie: Ob ich Söhne habe? Töchter? Wie es meiner Frau gehe? Ich muss von meiner Reise erzählen und was ich über die Situation im Irak denke.
Nachdem ich ausführlich erzählt habe, beginnt er in kurzen und abgehackten Sätzen seine Geschichte zu formulieren. Er erzählt von Bagdad und von Safah, dem älteren Sohn, der eines Tages nicht mehr von der Schule nach Hause kam. Der Doktor übersetzt. Die Atmung des Vaters geht schneller und ich kann die Halsschlagader des Mannes pochen sehen. Seine Hände sind ineinander verschränkt. Ob er betet? Die Finger umklammern einander so stark, dass die Knöchel hervortreten und eine weiße Färbung annehmen. Safah, der neben seinem Vater sitzt, ist noch bleicher geworden, als er es ohnehin schon war. Er sitzt im Schneidersitz auf dem mit Teppichen ausgelegten Zeltboden und hält sich mit den Händen an den eigenen Beinen fest. Immer mehr krümmt er sich zusammen, so wie ein Kind, das unter Bauchschmerzen oder Magenkoliken leidet.
Der jüngere Sohn versucht während der Erzählung seines Vaters mit angstvoll geweiteten Augen seine nicht mehr vorhandenen Fingernägel abzubeißen. Der Vater erzählt von einem Telefonanruf. Von den 10.000 US-Dollar, die er zahlen müsse, wenn er seinen Sohn lebendig wiedersehen wolle. Er spricht von den Verwandten und Freunden, die geholfen haben, das Geld zusammenzutragen. Von den vier Wochen des Bangens und Wartens, in denen seine Frau alt und grau geworden sei. Von der gespenstisch anmutenden Übergabe des Geldes an einen unbekannten und maskierten Mittelsmann, der auch noch bezahlt werden musste. Er berichtet von dem Moment, in dem er den Kofferraum des Autos öffnete, in den man Safah gesperrt hatte, und er seinen halb verhungerten und verdursteten, ausgemergelten, nach Kot und Urin stinkenden Sohn in die Arme nahm und weinend nach Hause trug. Und der Vater beginnt wieder zu weinen, auch Safah weint, beide lautlos, nur der kleine Bruder ist zu hören. Er maunzt wie eine kleine Katze, die alleingelassen wird.
Der Doktor sagt leise zu mir: „This is Iraq today, my Brother Peter!“ So sieht es also im Irak heute aus. Der Doktor nimmt den „kleinen Maunzer“ in den Arm und gibt mir ein Zeichen. Vorsichtig biete ich dem Vater und dem Sohn meine offenen Hände an. Der Vater legt seine Rechte in meine Linke und der Sohn seine Linke in meine Rechte. Mit den beiden anderen Händen halten sie einander fest. Der kleine Bruder beruhigt sich und seine Tränen versiegen.
„Ask Safah, I will translate – Frage Safah, ich werde übersetzen“, ermutigt mich der Doktor. Ich nicke, warte noch ein paar Sekunden und frage dann den Sohn: „Willst du mir etwas erzählen?“ Und er erzählt. Erst stockend, aber dann mit immer sicherer werdender Stimme. Er beschreibt die Angst. Den Hunger. Den Durst. Den Dreck. Da war keine Toilette, kein Waschbecken, kein Brunnen, keine Quelle, kein Fluss. Ab und zu eine Karaffe mit Wasser. Er spricht von dem dunklen Keller. Dem Verlust des Zeitgefühls. Der Brutalität des Wächters, der immer mit den Füßen nach ihm trat. Er erzählt, wie er mit diesem Wächter angefangen hat, sich zu unterhalten. Wie er versuchte, nett zu ihm zu sein, höflich und freundlich, und wie dessen Grausamkeiten dadurch allmählich aufhörten. Er schildert die Demütigungen. Er berichtet von dem Gefühl, versagt zu haben. Von der Scham, den Eltern und der Familie so viele Sorgen bereitet zu haben. Von seinen Albträumen und der Todesangst. Immer wieder blickt er mich zweifelnd und fragend an.
„Du bist ein sehr kluger, tapferer und mutiger Junge.“ Ein paarmal sage ich das zu ihm. Der Doktor übersetzt. Der Vater nickt zustimmend. „Dein Vater ist stolz auf dich!“
Der Doktor übersetzt weiter. Die Augen des Vaters blitzen ein wenig. Zaghaft, aber bewundernd blickt der kleine Bruder aus den sicheren Armen des Doktors auf den „Großen“. „Und für deinen kleinen Bruder bist du ein großes Vorbild“, sage ich. „Ich habe versucht, davonzulaufen, aber sie waren einfach schneller und stärker und zerrten mich ins Auto“, gesteht Safah. „Du hast es ihnen nicht leicht gemacht, aber als du gemerkt hast, dass es keine Chance für dich gibt, da hast du deine Kräfte für später gespart und dafür gesorgt, dass sie dich nicht noch mehr verletzten. Du hast sogar deinen Wärter besänftigt und auf diese Weise erreicht, dass du nicht getreten wirst. Du warst wirklich tapfer und klug!“, sage ich anerkennend. „Ich habe, wenn ich allein im Keller war, so lange gerechnet und mir Geschichten ausgedacht, bis ich eingeschlafen bin.“ – „Du bist ein schlauer Bursche! Du weißt, dass man schlafen muss, um seine Kräfte zu schonen und dass man das Gedächtnis trainieren muss, um fit zu bleiben! So hast du es geschafft auszuhalten, bis dein Vater das Geld zusammen hatte. Ihr seid ein gutes Team!“ – „Gott hat uns geholfen!“, sagt Safah. Der Doktor flüstert mir zu: „Bruder Peter, du solltest jetzt mit ihnen beten, sie sind gläubige Menschen!“
Ich beginne für Safah und seine Familie zu beten: „Vater im Himmel, guter Gott. Du hast Safah geholfen. Du hast ihm die Kraft gegeben. Er war mutig, stark und klug! Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Seine Hoffnung war stärker als die Unmenschlichkeit! Er glaubte an den Vater, der ihm helfen würde. Du hast seinem Vater geholfen: Er hat es geschafft, Safah zu befreien. Ihr Glaube war stärker als die Entführer. Du hast Safahs Bruder und seiner Mutter geholfen: Sie haben das Vertrauen und die Hoffnung niemals verloren und waren immer in Gedanken bei Safah. Beschütze bitte die Mutter im Krankenhaus, damit sie sich gut ausruhen kann, wieder zu Kräften kommt und bald in das neue Haus zurückkehren kann. Safah, der Vater im Himmel, der gütige Gott, der auf dich stolz ist, segne und behüte dich und deine Familie auch weiterhin. Amen.“
„Der Vater ist wirklich stolz auf mich?“, fragt Safah. „Ja, Safah, der Vater ist wirklich stolz auf dich!“
Peter Klentzan, Diakon, Leiter des TraumaHilfeZentrums der Stiftung „Wings of Hope“ am Labenbachhof in Ruhpolding, Jahrgang 1957, Röhrmoos, www.wingsofhope.de
Friederike
Meine Tochter Friederike kam 1991 unter dramatischen Umständen zur Welt. Ihr Weg ins Leben war steinig, und bald nach der Geburt stellte sich heraus, dass sie aufgrund einer cerebralen Lähmung wahrscheinlich nie laufen können würde. Diese Diagnose stellte das Leben unserer Familie komplett auf den Kopf. Ich musste plötzlich Entscheidungen treffen, auf die ich nicht vorbereitet war: Wie soll das Kind gefördert werden? Welche Therapien sind notwendig? Welche Operationen sind wann und wo durchzuführen? Was wird mit meinem Beruf? Wo wird Friederike in den Kindergarten, in die Schule gehen? Verwandte, Freunde, Bekannte, Unbekannte, Ärzte, Betreuer, Eltern anderer Kinder, Fremde redeten auf uns ein: Macht dieses, macht jenes, geht zu dem Arzt, fahrt zu der Therapie, probiert diese Medizin, ihr müsst doch …
Eines Tages fuhr mich eine Ärztin ziemlich barsch an und erklärte mir, dass Friederike für immer im Rollstuhl sitzen würde, wenn ich nicht regelmäßig eine bestimmte Therapie mit ihr mache. Falls meine Tochter nie laufen können würde, wäre das dann ganz allein meine Schuld. Da regte sich in mir Widerspruch. Ich blickte zurück auf mein bisheriges Leben und erkannte, welche Schwierigkeiten ich bereits erfolgreich gemeistert hatte. Wie durch ein Wunder hatte ich immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Und mir wurde bewusst: Es war nicht etwa Zufall oder ein harter Schicksalsschlag, der mich mit der Geburt meiner Tochter getroffen hatte. Ich war auserwählt worden, dieses besondere Kind zu begleiten. Es wurde mir anvertraut, weil ich in der Lage war, mit der Situation gut umzugehen und für meine Tochter auf die richtige Weise zu sorgen. Für mich war es kein Unglück, dass ich sie hatte, sondern ein großes Glück. Ich brauche weder Mitleid noch Anerkennung. Gott hat mir die Anerkennung bereits dadurch geschenkt, dass er mich für die richtige Person hielt, um für diesen besonderen Menschen zu sorgen. Und das Schönste ist: Friederike ist sich sehr wohl bewusst, dass sie es gut getroffen hat. Und dafür ist sie sehr dankbar.
Cornelia Beck, Verwaltungsangestellte, Jahrgang 1958, München
Walfisch
Es ist morgens 6.45 Uhr. Mein Sohn Johannes geht noch einmal kurz in den Keller, um den „Schulsprudel“ zu holen. Er kommt kreidebleich wieder hoch und ruft aufgeregt: „Mama, der Keller ist voller Wasser, in jedem Raum ist es nass!“ Das ist die erste große Katastrophe seit dem Tod meines Mannes Bernd, schießt es mir durch den Kopf. Gerade haben wir den normalen Alltag wieder einigermaßen im Griff, da kommt der nächste Härtetest. Ich rase in den Keller und sehe es mit eigenen Augen, dass Johannes wirklich keinen schlechten Witz gemacht hat (bei Kindern kann man ja nie wissen!). Tatsächlich ist es überall feucht, unsere Zisterne scheint irgendwo Wasser gelassen zu haben. Ich bin wie gelähmt. Oh Gott! Reicht es denn nicht langsam? Muss das auch noch sein? Der zweite Blick verrät mir, dass sich die ganzen Flickenteppiche, die ich überall im Keller ausgelegt habe und über die mein Mann immer gelächelt hat, mit Wasser vollgesaugt haben. Gott sei Dank, dass sich das Wasser noch nicht an die Möbel und an die Kühltruhe herangewagt hat! Diese Erkenntnis zaubert mir – im Angesicht der Überschwemmung – ein zaghaftes Lächeln aufs Gesicht. Die Teppiche, die Bernd immer für überflüssig gehalten hat, sind jetzt meine Rettung. Tja, sage ich in Gedanken zu ihm, du siehst, sie sind doch zu etwas nütze …
Ich renne zum Telefon und denke an all die Männer, die mir sonst immer helfen. Die sind jetzt auf der Arbeit – wen soll ich jetzt außer dem Notdienst anrufen? Mir fällt der Freund meiner Tochter ein, der jetzt gerade Zivildienst macht und vielleicht mit einigen Zivis eine „Noteinsatztruppe“ bilden könnte. Ich wähle schnell seine Handynummer. Markus nimmt gleich ab, und ich sprudle nur so aus mir heraus, als er mich unterbricht und flüstert: „Hey Conny, psst, wir haben gerade Andacht. (Typisch, junge Leute lassen das Handy selbst während der Andacht an, aber im Kino machen sie es brav aus!) Da höre ich plötzlich, wie im Hintergrund jemand den Satz vorliest: „… und Jona saß im Bauch des Fisches drei Tage lang“. Als ich diesen Vers hörte, musste ich wieder lächeln. Auch ich war gerade in einer glitschnassen Situation. Ich kam mir plötzlich vor wie Jonas Schwester. Mann, dachte ich, Gott hat echt Humor, dass er mir gerade jetzt diesen Satz zuwirft. Und so bin ich wieder in meinen „Walfischbauchkeller“ gestiegen und wusste plötzlich: „Er ist da! In deiner Nässe, in deinem ‚Walfischbauch‘, in deiner schwierigen Situation!“ Plötzlich fühlte ich, dass Gott mir ganz nahe war. Ich wusste: Ich bin da unten nicht allein. Ich spürte die himmlischen Heerscharen an meiner Seite. Irgendwoher bekam ich plötzlich eine Wahnsinnspower, Teppiche herauszuziehen, Möbel zu verschieben und das Wasser aufzuwischen. Ich bekam genau diese Extraportion Kraft, die diese Situation erforderte. Die bloße Verzweiflung machte der Heiterkeit Platz – dem Lächeln über Gottes Humor und seine „Sonderzuwendung“ für Witwen, die sich wie Jonas Schwestern fühlen. Die erste große Herausforderung in meinem Leben ohne Bernd war geschafft, wie durch ein Wunder. Als Markus nach der Andacht anrief, konnte ich ihm sagen: „Nottrupp absagen! Habe vieles alleine und mit himmlischer Unterstützung geschafft!“ Und da sage einer, Glaube habe nichts mit unserem ganz normalen Alltag zu tun!
Cornelia Gorenflo, Religionspädagogin, Jahrgang 1958, Bruchsal
Ein Tropfen Wasser
Ich sitze in meinem Gästezimmer, in Vellore, Südindien, und bin unglaublich müde. Nicht körperlich – die Hitze mag ich –, aber ich bin innerlich erschöpft. Mein Herz ist ohne Hoffnung und voller Bilder: der ausgetrocknete Fluss in der Stadt, das Staudamm-Projekt im Norden, das dem Süden die Dürre beschert, die Bettler, der Staub und die vielen hungrigen Kinder … In Indien leben über 20 Millionen Kinder auf der Straße. In dem Kinderheim, wo ich gerade zu Gast bin, leben zwanzig von ihnen. Resigniert denke ich: Da ist er wieder, der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.
Es klopft. Eine junge Frau steht in meiner Tür und fragt, ob sie mir etwas zu trinken bringen dürfe. Ich bitte sie herein und wir trinken beide ein Glas frisches Wasser, schweigen, sehen uns an. Ich denke wieder einmal an den berühmten Streit zwischen dem Optimisten und dem Pessimisten, die sich nicht einig sind, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Ich für meinen Teil denke, dass ein Mensch dir jedenfalls einfach ein Glas Wasser bringt, das dich erfrischt. Die junge Frau merkt wohl, dass ich geweint habe. Ich betrachte ihre langen schwarzen Haare und ihre dunkle Haut, und denke, dass wir uns trotzdem ähnlich sehen. Genau in diesem Moment sagt sie zu mir: „Ich dachte gerade: Wenn ich Europäerin wäre, würde ich so aussehen wie du; nur deine hellen Haare und deine helle Haut sind so anders.“ Ich merke, dass mir wieder die Tränen kommen. Ich trinke mein Glas aus, sie schenkt nach. Ich erzähle ihr, was ich in den letzten Tagen gesehen habe, und sage: „Ich musste den ganzen Tag an ein deutsches Sprichwort denken, in dem es heißt: Die Not ist so groß, dass dir jede Hilfe wie ein Tropfen auf einen heißen Stein vorkommt.“ Sie nickt. Ich spüre, sie versteht mich. Aber sie stimmt mir nicht zu, sondern sagt: „Ich kenne dieses Sprichwort nicht. Dennoch: Wenn ich ein Tropfen wäre, würde ich immer dahin gehen, wo kein Wasser ist.“
Sie steht auf und geht zur Tür; dreht sich noch einmal um und meint: „Und vorher würde ich noch ein paar andere Tropfen sammeln und dann würden wir gemeinsam gehen. Komm, die Kinder warten sicher schon und wollen singen!“
Ich bitte sie, schon einmal vorauszugehen. Als ich ein paar Minuten später bei den Kindern bin und nach der jungen Frau frage, weiß niemand, wen ich meine. Ich habe sie nicht nach ihrem Namen gefragt. Ich beschreibe sie, aber niemand hat sie gesehen, niemand kennt sie. Niemand glaubt mir, dass da überhaupt jemand war. Ich denke: Dann war sie vielleicht ein Engel. Sollte es ein Engel gewesen sein?
Ein Engel mit einem Tropfen Wasser. Auf einen heißen Stein? Nein, es war ein Tropfen in mein Herz. Und ich merke, ich kann mich entscheiden: Mein Herz soll kein Stein sein. Mein Herz soll sich um die Durstigen kümmern. Und vorher werde ich noch ein paar andere Tropfen sammeln.
Christina Brudereck, Evangelistin, Jahrgang 1969, Essen
Wie ein Hammerschlag
Die Nachricht, krank zu sein, hat mich getroffen wie ein Hammerschlag. Sie hat mich umgeworfen, obwohl ich geahnt hatte, dass mit mir etwas nicht in Ordnung ist. Ich habe darauf bestanden, dass die Ärzte meiner Ahnung nachgehen. Sie wollten es zunächst nicht glauben, dass ich mit meinen damals 29 Jahren an einer lebensbedrohlichen Krankheit litt. So jung, mit einer Mutter, die im Sterben liegt – das kann nur Stress bedeuten … Das Ergebnis der Untersuchung hat mir der Arzt mit großer Behutsamkeit mitgeteilt: Ich hatte ein Lymphom, eine bösartige Erkrankung des Abwehrsystems. Drei Wochen später wurden mir bei einer Operation vier Fünftel des Magens und ein Teil der Speiseröhre entfernt. Ich wehrte mich gegen die anfängliche Behutsamkeit der Ärzte. Ich wollte eine Antwort auf die Frage: „Habe ich überhaupt noch eine Chance?“ Die Außenwelt war in der Zeit, als das Wissen um meinen Zustand noch relativ neu war, völlig abgeschaltet. Ich war nur auf mich konzentriert – darauf, dass mein Leben wahrscheinlich keine Zukunft mehr hat. Auch meine Einstellung zu Gott, zum Glauben an ihn, war sehr verhalten. Ich habe wenig fromme Gedanken gehabt und gar nicht über ein hilfreiches Eingreifen Gottes nachgedacht. Einmal hatte ich das Bedürfnis, einen Klagepsalm zu lesen, weil ich die Sprache und Ausdruckskraft der Psalmen sehr schätze. Ich suchte und blätterte, war dann sehr zornig, weil ich nur Psalmen fand, die nach der Klage einen sogenannten Stimmungsumschwung enthielten. Mir war das zu viel Zuversicht und Hoffnung. Ich wollte etwas lesen, das meiner Situation mehr entsprach.
Endlich fand ich einen Psalm, in dem ich mich ernst genommen fühlte. Es ist der 88. Psalm – ein Schrei zu Gott, der von Verlassenheit und Todesnähe zeugt. In diesen Versen ist die Rede davon, wie der Psalmbeter von seinen Freunden und von der Familie entfremdet wird. Ich habe zwar nicht die Erfahrung gemacht, dass sich irgendjemand von mir abgewendet hätte, im Gegenteil: Jeder war besorgt um mich. Aber ich hatte keinen wirklichen Anteil mehr am Leben derer, die mir bis dahin vertraut waren. Ihr Beruf, ihr Erfolg, alles, was sie interessiert hat und für sie wichtig war, war für mich völlig bedeutungslos geworden. Ich habe das Leben der anderen sozusagen von außen betrachtet, als Zuschauerin, die keine Möglichkeit hat, in irgendeiner Weise daran teilzunehmen. Hin und wieder habe ich mich auch selber als Last empfunden, als jemand, der das Wohlbefinden der anderen stört.
Gerade weil ich von keinem Treffen, keiner Aktivität ausgeschlossen wurde und überall dabei sein konnte – zumindest körperlich –, habe ich mich und andere beständig daran erinnert, dass das Leben nicht so heiter und problemlos ist, wie man es gern – und auch zu Recht – in unbeschwerten Augenblicken erlebt. Ich hatte oft das Gefühl, dass durch meine Gegenwart den anderen das Lächeln im Gesicht eingefroren ist und sie nicht so sein konnten, wie sie es wohl gern gewesen wären. Im 88. Psalm ist die Rede von Schrecken und Grimm, die einen bedrängen wie Fluten. Ich habe das genauso empfunden – allerdings, ohne jemals die Frage zu stellen: Warum ich? Ich erinnere mich, dass meine Freundin nach der Diagnose verzweifelt sagte: „Vielleicht haben die ja bloß was vertauscht, und es ist jemand anderes, der so krank ist.“ Nein, das war ich, die gemeint war. Warum nicht ich?
Es ging, und so verstehe ich es immer noch, um einen Dialog, den ich mit mir selbst zu führen habe. Die Ärzte haben nach anfänglichem Zögern bis heute respektiert, dass ich nur das als das Meine annehmen kann, worüber ich etwas Bescheid weiß. Als ich nach drei Wochen Warten und weiteren Untersuchungen in die Klinik kam, war ich geradezu erleichtert. Endlich war ich nicht mehr allein in einer Welt, die mich nichts mehr anging, sondern in einer anderen, in der sich alles um das Kranksein drehte, um das für mich Eigentliche, Wesentliche. Aber bald machte ich auch hier die Erfahrung, dass ich nicht mehr dazugehörte. Mir begegneten die Schwestern mit besonderer Aufmerksamkeit, ich durfte jeden Wunsch äußern – im Gegensatz zu allen anderen, die sich den normalen Abläufen stellen mussten. Es bedeutet in einem Krankenhaus nichts Gutes, wenn einem alles erlaubt ist.
Ein paar Abende vor der Operation tappte ich im Schlafanzug um neun Uhr abends zu dem diensthabenden Arzt und ließ mir per Zeichnung die geplante Operation erklären. Er meinte, dass „vielleicht 20 Prozent das Ganze überleben – aber warum sollten Sie nicht dazugehören?“ Das muss man aushalten können, wenn man auf Wahrheitsliebe pocht, dachte ich mir in diesem Moment. Die spätere, „echte“ Prognose war noch wesentlich schlechter – sie ging gegen null. Ich akzeptierte beide Vorhersagen, denn ich wollte nicht nur wissen, woran ich bin, sondern auch, wogegen ich mit Gottes Hilfe kämpfen muss. Neben der Wahrheitsliebe habe ich bis heute von meinen Ärzten auch immer wieder viel Zärtlichkeit und Humor erfahren – bis hin zu einer regelrechten Begeisterung, wenn ich wieder „heil“ aus der Jahresuntersuchung hervorgehe.
Langsam ist eine große Ruhe und Zufriedenheit in mir eingekehrt. Nach meiner Operation, als ich einmal ganz allein in meinem Zimmer lag, hatte ich den Gedanken: „Endlich will keiner mehr etwas von mir. Endlich bin ich ganz bei mir selber.“ Ich habe gemerkt, wie sehr ich vorher, vor meiner Krankheit, untergegangen bin in Ansprüchen, Erwartungen, Forderungen. Ich habe verstanden, dass ich nicht mehr richtig vorgekommen bin in all dem, was ich an Wichtigem zu tun und zu werkeln hatte. Ich habe gelernt, dass wirklich alles im Leben seine Zeit hat. Auch das Kranksein. Ich hatte Zeit, an mich zu denken und über mich nachzudenken. Ich durfte in der Klinik ich selbst sein; konnte schlafen, wann ich wollte, reden, wann ich wollte, weinen, lachen – alles war möglich, wann immer mir danach war.
Nie zuvor habe ich jede Minute eines Tages und einer Nacht so bewusst und ausgeglichen erlebt wie in den Wochen meines Krankenhausaufenthaltes. Die Auseinandersetzung mit mir hatte ihre Zeit. Der Professor, der die Chemotherapie überwachte, trug stets neue Bücher über den Zusammenhang zwischen bösartigen Erkrankungen und Psyche herbei und wollte meine Meinung dazu hören – und mich damit bei meiner Reflexion unterstützen. Die meisten Ärzte hockten sich auf mein Bett, waren nicht mehr weit weg und sprachen mit mir über mein Befinden, über meinen Glauben und den Gott, der einen auch in den tiefsten Tiefen hält. Ich mochte es, wenn sie meine Hand streichelten, weil mir diese körperliche Nähe bei all den körperlichen und seelischen Mühen guttat.
Streng waren die Ärzte, als ich nach sechs Wochen intravenöser Ernährung einfach nicht essen wollte. Da blieb mir nichts anderes übrig als zu gehorchen, wenn ich nicht in der Klinik bleiben wollte. Gehorsam sein musste ich auch bei einer noch mühsameren Angelegenheit als dem Essen. Ich musste bougiert werden, das heißt, einen Gummischlauch schlucken, um die sich immer wieder zusammenziehende Narbe in der Speiseröhre offen zu halten. Durch einen Trick, den mir die Ärzte und Schwestern liebevoll beibrachten, lernte ich, den Schlauch eigenständig zu schlucken, und tat das dann auch ein Dreivierteljahr, bis die Gefahr vorüber war. Oft habe ich mit meinem Gott gehadert wegen dieser elenden Schinderei, habe ihn gebeten, mir die nötige Kraft für diese Tortur zu geben. Auch die Zeit der langen Chemotherapie hat mich gebeutelt, aber auch gestärkt – beides zugleich.
Ich habe zulassen können, dass mir übel war, dass ich nicht aufstehen konnte, nichts tun konnte, dass ich nicht schön war, weil ich keine Haare mehr auf dem Kopf hatte, dass ich körperlich ein Häufchen Elend war. All das war „dran“, es war in diesem Augenblick entscheidend, es war die Realität. Nichts, was vorher mein Leben ausmachte, hat mehr gezählt; ein Nachher lag sowieso außerhalb jeder Diskussion. Ich habe es auch in quälenden und schweren Stunden als Entlastung empfunden, nicht mehr an früher, an meine vergangene Vitalität zu denken, und schon gar nicht an neue Lebensmöglichkeiten. Der Augenblick war wichtig, egal, wie er ausgesehen hat. Ich habe gespürt, was es heißt, allein aus Gnade gerechtfertigt zu sein – sich bleich, glatzköpfig und ängstlich zu erleben und doch von Gott geliebt und angenommen zu wissen, ohne strahlend großartig vor ihm dazustehen.
Beinahe unmerklich hat sich für mich dann der Wandel vollzogen. Ich erlebte die Wendung einer menschlich gesehen völlig aussichtslosen Lage hin zu der Perspektive, wieder zu leben. Leben heißt nach solchen Monaten nicht einfach Rückkehr in das Gewohnte. Niemand kann so tun, als wäre nichts gewesen. Die beständigen ärztlichen Kontrollen, das Wissen, dass die Krankheit wiederkommen kann, verhindert die „Normalität“. Das Damoklesschwert hängt einem nach einer solchen Krankheit über dem Kopf, solange man lebt. Aber gerade durch diese Realität ist für mich jeder neue Tag ein Gottesgeschenk geworden. Ich freue mich, wenn ich morgens die Augen aufmachen und aufstehen darf. Ich bin froh, wenn ich mich bewegen, wenn ich denken, reden, lachen und auch immer wieder weinen kann. „Kauft die Zeit aus“, heißt es im Epheserbrief des Neuen Testamentes.
Das ist eine Aufforderung, die mein Leben prägt. Ich nehme Dinge wichtig, die nach sogenannten „normalen“ Maßstäben reine Nebensächlichkeiten oder sogar unangenehm sind. Ein nebliger Tag fasziniert mich, auch wenn das Autofahren dadurch erschwert wird. Regentropfen klingen wie Musik; Wind und Schnee können mich übermütig machen wie ein Kind. Mond und Sterne am nächtlichen Himmel bestaune ich sehr lange, auch wenn es dabei eiskalt und erkältungsverdächtig ist. Ein Hund, der ins kalte Wasser springt und sich anschließend tüchtig schüttelt, lässt mich alles andere um mich herum fast vergessen. Jede Form von Arbeit macht mich froh, weil ich sie tun kann. Wenn ich mich kräftig abgehetzt habe und kurzatmig am Ziel ankomme, dann denke ich mir, wie schön es ist, wieder eine geschäftige Miene aufsetzen und am Weltgeschehen mitwirken zu dürfen.
All das heißt nicht, dass ich nun nur noch auf der Sonnenseite des Lebens wandle. Narben und körperliche Einschränkungen, neue Krankheiten sorgen ebenso für schattige Augenblicke wie das Mit-Leiden an den Nöten anderer. Die Welt wird wegen mir nicht angehalten; die Schonzeit nach meiner Krankheit ist längst vorüber. Aber das ist gut so. Wertvoll für mich und andere ist mein Leben nicht in der sorglosen, abgeschiedenen Idylle, auch nicht im resignativen Rückzug von allem Geschehen. Kostbar wird es dadurch, dass ich meine leidvollen Erfahrungen mit hineintrage in die Beziehung zu anderen Menschen. Der Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel hat sich in seiner Vorrede zur „Phänomenologie des Geistes“ mit dem Tod auseinandergesetzt: „Nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt und in ihm sich hält, ist das Leben des Geistes. Er (der Tod, Anm. der Autorin) gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet. Diese Macht ist er nicht als das Positive, welches von dem Negativen wegsieht … sondern er ist diese Macht nur, indem er dem Negativen ins Angesicht schaut, bei ihm verweilt.“
Nur deswegen kann ich so herzhaft lachen, wie ich lache, weine ich so heftig, wie ich weine, bin ich ungezwungen fröhlich, stundenlang nachdenklich, mädchenhaft begeistert oder grenzenlos melancholisch. Die Tiefe und Intensität des Wahrnehmens, Empfindens und Erlebens ist mir erst möglich geworden durch das Leid, das ich an und in mir erfahren habe. Weil ich weiß, was Zerrissenheit und Negation bedeuten, ist mein Leben voller und lebendiger geworden. Meine Ärzte, die inzwischen meine Freunde geworden sind, sagen: „Dass du lebst, ist ein echtes Wunder!“ Ich bin Gott jeden Tag dankbar dafür.
Susanne Breit-Keßler, Regionalbischöfin, Jahrgang 1954, München, www.kirchenkreis-muenchen.de
Wohin du auch gehst …