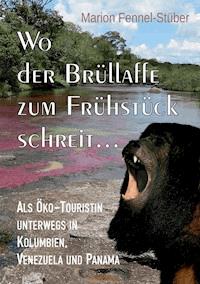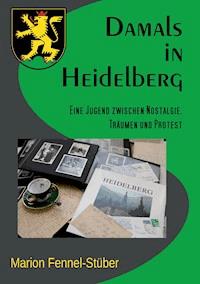
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Durch die Ausbombung in ihren Heimatstädten sind die Eltern der Autorin nach dem Zweiten Weltkrieg im unzerstörten Heidelberg gelandet. Dort lernen sie einander kennen, heiraten und gründen eine Familie. Es fehlt an allen Ecken und Enden das Geld und die wenigen Mittel werden nicht nur für die kleine Familie, sondern auch für die Sicherung der Ruine des väterlichen Elternhauses und die Unterstützung von Verwandten gebraucht. Der finanzielle Mangel wird kompensiert durch unermüdliche Arbeit, Sparsamkeit und Verzicht auf jeglichen Wohnkomfort oder technische Erleichterungen. Doch das, was aus heutiger Sicht ein Mangel wäre, wird damals nicht so empfunden. Die Familie ist glücklich, den Krieg überlebt zu haben und blickt optimistisch nach vorne in die Zukunft. Nur ganz im Verborgenen lauern bisweilen noch die unverarbeiteten Traumata. Die humorvollen, absurden, witzigen und nachdenklichen Anekdoten vermitteln einen authentischen Einblick in das Leben der Autorin als Kind, Jugendliche und junge Frau im schönen Heidelberg, und lassen den Leser zum Zeitzeugen einer bewegenden Epoche werden, die eine ganze Generation nachhaltig geprägt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Anja und Patrick
2015 erschien bei CreateSpace bereits das Buch „Damals in Heidelberg“, auf dessen Grundlage das vorliegende Werk entstanden ist. Dazu wurde es komplett überarbeitet sowie um einige Kapitel, Fotos, Anekdoten und Informationen bereichert und bekam zugleich auch ein neues Layout und den Untertitel „Eine Jugend zwischen Nostalgie, Träumen und Protest“.
Um die Persönlichkeitsrechte noch lebender Personen zu wahren, sind fast alle Personennamen in diesem Buch verändert. Original-Namen stehen nur bei Menschen, die ganz sicher nichts gegen eine positive Erwähnung haben würden, sofern sie noch am Leben wären oder sind.
Inhalt
Prolog
Kinderfragen in der Nachkriegszeit
Ruinen
Kriegsversehrte
Verfolgungsopfer
Ein Bündel Hoffnungs-Strohhalme
Lebensalltag der 60er-Jahre
Mutterpflichten, Kinderglück und viele Schrammen
Endlich auf den Hund gekommen
Sinn und Unsinn des Telefonierens im Prä-Handyzeitalter
Erinnerungen an die alten neuen Medien
Schule und Gesellschaft im Umbruch
Die Grundschulzeit mit einer Doppelrunde am Anfang
Das Gymnasium mit einer Doppelrunde am Ende
Schulwege
Erwachsenwerden zur Zeit der 68er-Bewegung
Studieren im Heidelberg der 70er-Jahre
Die Tücken des Studiums
Starke Frauen für eine emanzipierte Gesellschaft
Besondere Anlässe
Kulturelle Ereignisse bis zum Ende der 60er-Jahre
Gelebte und geliebte Gemeinsamkeit
Urlaube im Wandel der Zeiten
Kleider machen Leute oder wer erwachsen wird, kauft Kleider.
Als man Weihnachtsstress noch nicht kannte
Danksagung
Die Autorin
Nicht was wir gelebt haben, ist das Leben, sondern das, was wir erinnern und wie wir es erinnern, um davon zu erzählen.
Gabriel García Márquez (1927 - 2014)
Heidelberg:
Lange lieb’ ich dich schon, möchte dich, mir zur Lust,
Mutter nennen, und dir schenken ein kunstlos Lied,
Du, der Vaterlandsstädte
Ländlichschönste, so viel ich sah.
Friedrich Hölderlin (1770 - 1843)
Prolog
Bücher über Heidelberg gibt es ganz sicher schon genug auf der Welt, dazu hätte ich mich gar nicht erst dransetzen müssen. Über Altstadt, Schloss, Universität, die Alte Brücke, Museen, Römerfunde, Bibliotheka Palatina oder andere besonders sehens- und wissenswerte Dinge, für die Heidelberg bekannt ist, ist schon jede Menge geschrieben worden. Auch zeitgenössische Themen wie die Kriegs- und Nachkriegszeit in der von Kriegszerstörungen verschonten Stadt, die für die Ausgebombten aus anderen Städten zur neuen Heimat wurde, über die Versäumnisse bei der Aufarbeitung der Zeit des Dritten Reichs, über die nach dem Krieg folgenden Aufbaujahre, die 68er-Revolte, die Flower-Power-Zeit - kurz gesagt, über Zeiten, die in Heidelberg, der internationalen, weltoffenen Universitätsstadt, ganz spezielle Züge aufwiesen - gibt es bereits Literatur fast ohne Ende.
Wozu darüber also noch einmal etwas schreiben? Man muss schließlich das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Zudem wäre das eine Aufgabe für dazu besser Qualifizierte gewesen als mich. Ich bin nur eine Frau, die in der Nachkriegszeit in Heidelberg aufgewachsen ist. Die dort ganz bestimmte Erlebnisse gehabt und Erfahrungen gemacht hat, die sie wahrscheinlich an einem anderen Ort nicht in der gleichen Weise hätte machen können. Für die Heidelberg die Heimat war und auch noch immer ist, auch wenn ihr Wohnort inzwischen 230 Kilometer weiter südlich liegt.
Ich bin aus verschiedenen Gründen mit Heidelberg wie ein siamesischer Zwilling verwachsen - ich kann und will es nicht loslassen, da es zu mir gehört. Das hat nicht nur mit der Einzigartigkeit dieser wunderschönen Stadt zu tun. Ganz sicher liegt es auch daran, dass meine beiden Eltern sich nach dem Krieg so bewusst und aktiv dort ihre neue, gemeinsame Heimat geschaffen haben, wobei es im Fall meines Vaters zudem sogar ein Teil seines Berufes war, Heidelberg zu lieben und sein Bild in der Welt zu verbreiten. Er selbst hätte wohl eher eines der zuvor genannten Bücher über Heidelberg schreiben können. Aber zur Umsetzung solcher Pläne blieb ihm leider keine Zeit mehr, da er kurz nach Eintritt ins Rentenalter schwer erkrankte und bald darauf verstarb.
Mein Buch entstand eher durch Zufall und war ursprünglich nur so etwas wie ein Gerüst, um das sich mein eigentliches Hauptthema aufbaute - das Scheitern meiner Ehe nach fast vier gemeinsam verbrachten Jahrzehnten. Warum ich so blind und gutgläubig sein konnte und viele Dinge nicht ausreichend hinterfragt hatte - nun, wahrscheinlich waren das die ganz normalen Fragen einer sitzengelassenen Ehefrau, die die Welt erst einmal nicht mehr versteht. Aus dem Loch, in das ich damals hineinfiel, kam ich aber einfach nicht mehr heraus. Gehen andere lockerer mit solchen Tiefschlägen und Enttäuschungen um? Fangen sie sich schneller wieder? Wieso können die irgendwann einmal weitergehen, ohne sich ständig umzudrehen und immer weiter sinnlos und gegen jede Wahrscheinlichkeit zu hoffen und zu warten? Was war denn in meinem Fall so anders? Meine besondere Situation oder ich selbst? Ja, wer und was war ich denn eigentlich? Ich hatte mich jahrzehntelang nur als Hälfte eines Ganzen identifiziert. Das Ganze gab es nun nicht mehr. Die Hälfte von nichts ist… Richtig: Nichts.
Es war sehr schwer, einen Weg aus der Nicht-Existenz ins Leben zurückzufinden. Ich habe das in meinen Augen einzig Naheliegende versucht, bin einfach noch einmal auf den Ausgangspunkt gegangen. Zu der Zeit, bevor ich die Weichen selbst falsch gestellt habe. In meine Jugend und sogar noch weiter zurück bis in die Kindheit. Erinnerung war angesagt, denn von den Menschen, die damals um mich herum meine Entwicklung beeinflusst haben und die ich hätte fragen können, lebt heute keiner mehr. Also habe meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen müssen. Dazu habe ich alte Bilderalben angeschaut, Briefe gelesen, Erfahrungen und Gedanken mit Gleichaltrigen ausgetauscht, dabei sogar alte, eingeschlafene Freundschaften aktiviert, Filme gesehen, Bücher gewälzt, im Internet recherchiert, Ämter angeschrieben, Orte der Vergangenheit aufgesucht und eine ganze Menge Dinge mehr. Je mehr Erinnerungen mir dabei kamen, desto mehr wollte ich festhalten und so schrieb ich viele davon auf, um sie nicht erneut zu vergessen. Am Ende war eine ganze Sammlung daraus entstanden. Keine Geschichten über Heidelberg als Stadt, sondern meine eigene Geschichte als Heidelberger Kind der Nachkriegsgeneration. Meine ganz persönliche Geschichte, aber in vieler Hinsicht auch eine typische für Menschen und speziell Frauen meiner Generation.
Inzwischen ist mein Mann an einer kurzen, heftigen und heimtückischen Krankheit verstorben. Viele der Dinge und Fragen, die mich zum Schreiben veranlasst haben, haben sich nach seinem Tod beim Sichten seiner Unterlagen ganz einfach und sehr ernüchternd geklärt. Aber das ist eine Angelegenheit, die wohl niemanden sonst interessiert oder etwas angeht. Fest steht: Ich hätte mir nicht so viele Gedanken um meine Versäumnisse, meine Schuld und mein Versagen machen müssen. Es war alles sehr viel einfacher, ja geradezu banal.
Ich habe meine Antworten bekommen und kann jetzt hoffentlich auch meine innere Ruhe finden. Und ich habe noch immer meine Geschichten. Viele schöne, skurrile, lustige, traurige, interessante oder auch absonderliche Dinge, die ich fast vergessen hatte und die mir nun wieder lebhaft vor Augen sind, Erinnerungen, von denen eine immer zur nächsten geführt hat. Ich hatte als Lehrerin vier Jahrzehnte lang in meinem Berufsalltag immer junge Menschen um mich herum. Es fiel mir also vielleicht schon aus diesem Grund nicht schwer, in meinen Erinnerungen wieder jung zu werden. Ich konnte auch im Dialog mit den jungen Menschen viele wichtige Fragen stellen, mich selbst fragen lassen und über Antworten nachdenken. Das hat bisweilen zu ganz speziellen Kapiteln in diesem Buch geführt.
Wir haben es viel leichter, die Welt der Jungen zu verstehen als sie die unsere, der für sie Alten. Immerhin haben wir ihre Welt zumindest täglich vor Augen, um uns damit zu befassen. Zudem ist die moderne Zeit nicht von heute auf morgen über die Welt hereingebrochen, sondern wir haben an ihrer Entwicklung aktiv teilgenommen, sie auch in vieler Hinsicht sogar selbst geschaffen. Noch dazu können wir auf jahrzehntelange Lebenserfahrungen zurückblicken. Die jungen Menschen haben viel schwerere Bedingungen, wenn sie verstehen wollen, wie wir zu denen wurden, die wir heute sind, mit allen in ihren Augen positiven und vielleicht auch negativen und zumindest aus ihrer Sicht schrulligen Eigenschaften. Sie sind dabei auf unsere Mithilfe angewiesen. Gerade heute, in einer Zeit, in der in der deutschen Gesellschaft der Anteil an älteren Menschen ständig wächst, sollten alle Generationen miteinander am gleichen Strang ziehen. Jede Generation kann ihren Beitrag zum Wohle aller liefern, aber dazu bedarf es einer Atmosphäre, in der sich keine Klüfte und Gräben auftun, die in erster Linie durch Nicht-Verstehen entstehen. Meine Generation hat die Welt ihrer Eltern und Großeltern oft nicht begreifen können, weil über so vieles ein Mantel des Schweigens gelegt wurde. Diesen Fehler möchte ich nicht wiederholen. Vielleicht regen die Episoden und Gedanken andere an, sich mit ihrer eigenen Erinnerung noch einmal genauer zu beschäftigen oder die Menschen der jeweils anderen Generation mit verständigeren, nachsichtigen und offenen Augen zu sehen.
Bücher, Briefe, Postkarten und alte Zeitungsartikel als Hilfsmittel bei meiner Reise in die Vergangenheit.
Heidelberg-Lithografie meines Großvaters Friedrich Fennel (1906).
Kinderfragen in der Nachkriegszeit
Ruinen
Der Zweite Weltkrieg hinterlässt Ruinen ganz unterschiedlicher Art. Zunächst einmal die der zerbombten Häuser in den Städten, aber auch Ruinen ganz und teilweise zerstörter Lebenspläne, Hoffnungen, sozialer Verbindungen, zerrissener und verlorener Familien und zerstörten Vertrauens. Kriegsruinen treffen gleichzeitig viele Menschen. Man erkennt im Anderen seine eigenen Probleme mit der veränderten Lebenssituation und seine ruinierten Gefühle wieder. Das gemeinsame Leid macht es leichter, jemanden zu finden, der Verständnis und Toleranz besitzt, die Ruinen des Anderen - seien sie an Gebäuden, Gefühlen oder gar an beidem zur gleichen Zeit - erträglich zu machen. Wie es eben so schön heißt: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Man versteht einander, ohne viele Worte machen zu müssen. Der Kummer des Anderen, den man in ähnlicher Form ebenfalls mit sich herumträgt, ist einem nicht fremd. Man weiß, wie schlimm und ruinös die Gefühle dann wüten können, man findet ganz selbstverständlich untereinander die richtigen, tröstenden Worte oder Gesten, vielleicht sogar eine Unterstützung bei der gemeinsamen Bewältigung der neuen Situation.
Ruinen, mit denen man auch zu Friedenszeiten konfrontiert werden kann, treffen hingegen Einzelpersonen. Ihre Mitmenschen wissen zumeist nicht, wie sie sich verhalten sollen und sind dadurch verunsichert. Was können sie noch tun, was sagen, was unterlassen, was raten? Sie haben ja eventuell alles schon gemacht und gesagt, was ihnen dazu eingefallen ist. Scheinbar ohne Erfolg. Der Ruinierte bleibt dennoch am Boden zerstört. „Da kann ich ja doch nicht helfen“ oder „Alles, was ich dir rate, machst du ja doch nicht“, heißt es dann, bevor sie sich frustriert über ihr eigenes Unvermögen zurückziehen. Und das ist oft gerade dann, wenn man sie am meisten gebraucht hätte. Ich betrachte es als eine besondere Form von Egoismus, wenn man es nicht erträgt, sich im Angesicht der menschlichen Katastrophe eines anderen Menschen mit der eigenen Unzulänglichkeit konfrontiert zu sehen und man sich deshalb von einem zurückzieht, der gerade klagend und verzweifelt mitten in dem Schutthaufen seines zerbrochenen Lebens zu ertrinken droht. Dabei wäre es so einfach: Zuhören, in den Arm nehmen, einfach da sein. Das gibt die nötige Kraft, die der Trauernde braucht, bevor er daran gehen kann, sich selbst zu helfen. Es ist in Ruinen-Gefühlslagen viel wichtiger, geduldige Zuhörer und mitfühlende Tröster zu haben als Berater oder gar aktive Macher, die mir die notwendige Zeit nicht geben wollen, meine Lebensruine mit der Zeit, die ich dafür eben benötige, abzutragen und ein neues, eigenes Lebensgebäude an deren Stelle zu errichten. So etwas kann man nicht mal einfach auf die Schnelle erledigen und ein anderer Mensch kann außer durch Trost und Empathie auch nicht wirklich helfen. Meine Eltern und Großeltern haben mir oft davon berichtet, wie sich die Menschen angesichts der Kriegsruinen gegenseitig getröstet haben. Im Angesicht von Ruinen, egal welcher Art, braucht man Menschen, die wissen oder zumindest erahnen, wie man sich fühlt. Nur wer mitfühlt, kann auch echten Trost spenden.
In meiner Kindheit und Jugend ist das Thema Ruinen immer aktuell. Man sieht sie, die Erwachsenen sprechen oft darüber, und wir Kinder suchen nach Erklärungen, wie diese Ruinen denn entstanden sind und weshalb man das nicht hat verhindern können.
In Heidelberg-Handschuhsheim, wo wir bis zu meinem 17. Lebensjahr wohnen, gibt es entweder bebaute Flächen oder Felder. Für uns Kinder existieren dort also keine sichtbaren Kriegsspuren. Ganz anders ist es, wenn ich nach Mannheim komme, wohin ich mit Mami zu ihren Eltern fahre, oder mit Papi zu Dengels, den Eltern seiner verstorbenen ersten Ehefrau. Dort stehen zwischen meistens sehr hässlichen, neuen Nachkriegshäusern, die möglichst schnell und billig hochgezogen wurden, Ruinen oder teilweise zerstörte und irgendwie wieder geflickte Häuser. Jahrelange Absperrungen, die aussehen wie heutige Bauzäune, verhindern, dass Kinder in diesen baufälligen Ruinen spielen. Überall Verbotsschilder: Eltern haften für ihre Kinder. Lebensgefahr. Betreten bei Strafe verboten. Selbstschüsse. Und man sieht in luftiger Höhe Badezimmerfliesen oder Tapeten, die auf makabre Weise vom ursprünglichen Leben in diesen Häusern erzählen. Für uns Kinder, die die schrecklichen Bombennächte nur aus Erzählungen der Eltern kennen, ist Mannheim ein riesiger Abenteuerspielplatz. Und da wir das ehemals wunderschöne, alte Mannheim niemals gekannt haben, ist die Stadt in unseren Augen einfach ziemlich hässlich, was uns aber nicht weiter interessiert. Kinder können sich über architektonische Entgleisungen nicht sonderlich aufregen. Schon gar nicht dann, wenn sie nicht dort leben müssen.
Mami zeigt mir eines Tages die alten Gebäude, die in der Gegend des Wasserturms stehen und die von Bomben weitgehend verschont geblieben sind und erzählt, dass vor dem Krieg noch fast alle Gebäude Mannheims so schön ausgesehen haben sollen. Dort ganz in der Nähe treffen wir dann auch an diesem Tag zufällig ihren ersten Ehemann Hans, der Bauunternehmer ist und uns ganz spontan auf seine riesige Baustelle mitnimmt, einen Neubau mit mindestens fünf Stockwerken. Wir klettern auf Bautreppen hoch bis auf das oberste Geschoss und schauen auf die langsam wieder aus den Ruinen erwachsende Stadt, die in einem grässlichen Stilmix hochgezogen wird. Hans erzählt von dem vielen Geld, das er jetzt verdient. Für ihn ist das kaputte Mannheim der Nachkriegszeit ein einziges riesiges Geschäft. Ich wundere mich während der ganzen Zeit darüber, dass dieser freundliche Mann der böse Vater meiner Halbschwester sein soll. Zum Schluss schenkt er mir sogar noch einen Schokoladenosterhasen, den er aus wundersamen Tiefen seiner Aktentasche hervorzaubert. Mami sagt oft, dass er im Prinzip immer ein netter Mensch gewesen sei, nur als Ehemann habe er nichts getaugt, weil er sie, seine Frau, als seinen Besitz betrachtet und mit blinder Eifersucht gequält habe. Und bisweilen habe er ganz schlicht und ergreifend „eine Meise“, und dann könne man mit ihm nicht mehr reden.
An diesem Nachmittag, meinem ersten und letzten Zusammentreffen mit dem Vater meiner Halbschwester, zeigt er diese Meise nicht, er ist freundlich zu mir und zeigt mir Mannheim aus der Vogelperspektive. Und überall sieht man Lücken, wo früher Häuser waren, die zerbombt und dann abgetragen wurden. Das hat die Besitzer der Ruinen ein Vermögen gekostet zu einem Zeitpunkt, an dem auch die Geldquellen der Zeit vor dem Krieg größtenteils versiegt sind. Auch mein Vater hat zu dieser Zeit noch in Kassel zwei große, ständig einsturzgefährdete Ruinen, deren Absicherung jahrelang gewaltige Summen an Geld verschlingt. Alle ausgebombten Hausbesitzer bekommen dadurch nach dem Krieg ganz erhebliche Starterschwernisse. Sie fühlen sich mindestens doppelt bestraft: Erst wird ihr Hab und Gut in Schutt und Asche gelegt, und dann müssen sie noch fast alle ihre wenigen neuen Mittel investieren, weil sie Ruinen besitzen. Meistens in einem anderen Ort als dem, wo sie nach der Ausbombung leben, was auch noch ständiges Reisen, Telefonieren, Briefeschreiben oder hohe Ausgaben für Verwaltungsgebühren oder Baufirmen bedeutet, die mal die eine, mal die andere Mauer abtragen müssen, damit keine Menschen im Umkreis der Ruine durch herabfallende Steine gefährdet sind. Manch einer muss sich dafür sogar verschulden.
Heidelberger, die nicht ausgebombt sind1, besitzen nach dem Krieg ihre Häuser und bewegliche Habe noch und können von den Mitteln, die sie erwirtschaften, einen Grundstock für die Zukunft legen. Viele unter ihnen sind sich der Tatsache bewusst, dass sie einfach sehr viel mehr Glück gehabt haben als die Ausgebombten der anderen Städte. Sie empfangen die bei ihnen Einquartierten mit offenen Armen und helfen ihnen, so gut es eben geht. Andere unter ihnen tragen hingegen ihre Nase nach dem Krieg sehr hoch, weil sie finanziell viel besser dastehen als die Ausgebombten. Auch diejenigen, die während des Krieges anderen Familien aus dem zerbombten Mannheim Wohnraum abtreten müssen, sind nicht immer anständig ihren unfreiwilligen Gästen gegenüber. So dreht die Familie, der meine Mutter mit ihrer Tochter und beiden Eltern zunächst „zugeteilt“ worden ist, einfach bei ihnen die Heizung ab, obwohl draußen Temperaturen unter null Grad herrschen und meine Mutter den Vermieter immer wieder auf die in der Wohnung herrschende Kälte anspricht. Ihm sei das unerklärlich, meint dieser, bei ihnen sei es nicht kalt, das könne ja gar nicht sein, dass es ausgerechnet in den beiden Zimmern, in denen die einquartierte Familie lebe, kälter sei als bei ihnen, da müssten sie sich eben wärmer anziehen. Der Vater meiner Halbschwester, der bereits erwähnte Bauunternehmer, der folglich auch etwas von Heizungsanlagen versteht, wird von meiner Mutter um Hilfe und Rat gebeten, reist an und repariert mit wenigen Handgriffen den ganz offensichtlich vorgetäuschten Heizungsdefekt, der auf wundersame Weise auch nur den Wohnraum der zugeteilten Familie betroffen hat. Nach einigen weiteren Schikanen bekommt die Familie nach vielen Behördengängen meiner Mutter endlich eine neue Unterkunft in Schlierbach bei Heidelberg zugeteilt. Wenn ausgebombte Mannheimer Frauen, die fast alles verloren haben, damals auf einem Amt erscheinen, werden sie von Seiten der Heidelberger Bevölkerung sogar oft als „Bombenweiber“ abgewertet. Meiner Mutter ist das wiederholt so passiert. Behördengänge sind für sie immer etwas unendlich Erniedrigendes. Besser wird es für sie erst, als sie meinen Vater kennt. Der nimmt ihr dann solche Gänge ab oder begleitet sie dabei. Als Mann kann er sich unter dem herrschenden, patriarchalisch geprägten Zeitgeist eben leichter Gehör verschaffen als meine als höfliche Bittstellerin auftretende Mutter. Er fordert stattdessen das Recht der ausgebombten Familie ein, und man bemüht sich danach um Abhilfe. Auch die Tatsache, dass er bei der Stadt Heidelberg als Pressestellenleiter einen recht hohen Posten innehat, verleiht seinen Forderungen immer den nötigen Nachdruck. Meine Mutter, die von diesen ganzen Behördengängen völlig überfordert ist, bekommt in ihm eine echte Entlastung. Ihre Eltern haben kein Einkommen mehr, da die Brauereien, in denen mein Großvater im Vorstand war, im russischen Sektor, der späteren DDR, liegen oder zerstört wurden. Die Mannheimer Farben- und Lackfabrik des Großvaters kommt nicht mehr auf die Beine, da das Geld für eine Sanierung fehlt und weil die Hauptkunden, die eben schon erwähnten Brauereien, wegfallen, für die Ino Werner AG vor dem Krieg vor allen Dingen die von meinem Urgroßvater erfundenen Brauereiglasuren produziert hat. Auch eine Altersvorsorge besteht nicht und die alte Krankenversicherung existiert durch den Krieg nicht mehr. Um berechtigt zu sein, irgendwelche Leistungen zu beanspruchen, braucht man Dokumente. Die gibt es aber oft nicht mehr, da sie verbrannt sind und auch die ausstellende Behörde oder andere Institution mit entsprechenden Archiven oder Verzeichnissen ausgebombt ist. Woher und auf welche Art also dazu kommen? Wer sich in dieser Zeit nicht auf die Hinterbeine stellt, sich nicht bemerkbar macht und keine schier endlos erscheinenden Anträge ausfüllt, fällt durch das Netz der Hilfsleistungen, weil er erst gar nicht erfasst wird. Mein Großvater gibt einfach mit den fatalistischen Worten auf „Ich habe keine Kraft dazu, noch einmal enttäuscht zu werden“. Er weigert sich, irgendwo als Bittsteller aufzutreten und hat ohnedies nach den Jahren des Dritten Reichs in Behörden, egal welche, keinerlei Vertrauen mehr. Nach meiner heutigen Ansicht würde ich sagen, dass er damals neben seiner Verlust-Trauer an einer starken Depression gelitten haben muss. Die damit verbundene lähmende Antriebslosigkeit verbaut ihm und meiner Großmutter für die folgenden Jahre - ihm sogar bis zum Ende seines Lebens - viele Möglichkeiten, die noch hätten ausgeschöpft werden können.
Auch nach diesem endlich überstandenen menschenverachtenden und menschenvernichtenden Krieg mit allen seinen Verbrechen, Verlusten und Ungerechtigkeiten ist durch die Kapitulation nicht von heute auf morgen Ruhe, Vertrauen oder Frieden in den Herzen und Köpfen der Menschen eingekehrt. Es kommt vor allen Dingen zu einer neuen Mischung der Verhältnisse. Beispielsweise derer, die noch etwas besitzen und derer, die alles verloren haben. Derer, die einfach nicht starten können, weil sie ihre wenigen Gelder immer wieder für die Altlasten des Krieges einsetzen müssen, beispielsweise für die Sicherung ihrer Ruinen oder für die Versorgung und Unterstützung von Angehörigen - vor allen Dingen, wenn diese in der Ostzone leben, wo die Not viel größer ist als in den westlichen Besatzungszonen. Auf der anderen Seite derer, die wenig oder auch nichts verloren haben, eventuell sogar Kriegsgewinnler sind, die nicht jahrelangem Nervenkrieg in den ständig zerbombten Städten ausgesetzt waren, die keine ausländischen jüdischen oder politisch verfolgten Angehörigen hatten usw. Die also mehr Kraft und auch mehr wirtschaftliche Mittel haben, sich um ihre Zukunft zu kümmern. Hinzu kommt, dass solche Menschen, die die gravierenden Benachteiligungen des Krieges nicht persönlich zu spüren bekommen haben, auch oft noch dem alten Gedankengut anhängen, das sie zwar nun nicht mehr offen äußern, jedoch noch immer nicht abgelegt haben. Sie haben ja meistens nicht am eigenen Leib miterlebt, was der braune Terror angerichtet hat. Zu Zeiten, in denen Informationen nur zensiert über Zeitungen, bestimmte erlaubte Radiosender und bestenfalls einmal von der Propaganda freigegebenen Bildern der Wochenschau im Kino zu den Menschen kommen, kann man sich nur sehr schwer ein objektives, eigenes Bild machen. Oder, um es anders zu sagen - es fällt leichter, die Augen zu verschließen. Da kommen in der Zeit nach dem Krieg auf einmal Menschen, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben, wie Heimatvertriebene, Kriegsheimkehrer, Holocaust-Überlebende, Verfolgungsopfer und eben auch andernorts Ausgebombte. Das ist schlicht und ergreifend unbequem. Dadurch muss man sich mit Dingen auseinandersetzen, die nicht angenehm sind, eventuell sogar mit eigener Schuld, Fehleinschätzungen, politischem und menschlichem Versagen und mangelnder Zivilcourage.
Mein Großvater ist ein ganz hervorragender Violinist und traf sich schon seit vielen Jahren regelmäßig zum Musizieren mit Kollegen in Heidelberg, darunter auch Persönlichkeiten des dortigen öffentlichen Lebens. Einige davon sind im Dritten Reich noch begeisterte Anhänger der Nazis gewesen und haben dadurch auch allerlei Privilegien genossen. Nach langer kriegsbedingter Kontaktpause erinnern sie sich nach dem Krieg an meinen Großvater und bitten ihn, sie durch eine Falschaussage bei der Entnazifizierung zu entlasten. Opa weigert sich und bricht daraufhin den Kontakt ganz ab. Die Leute haben jemand anderen gefunden, der ein falsches Zeugnis abgelegt hat, wie viele andere in dieser Zeit auch. Alle Behörden, die deutschen wie die der Besatzungsmächte, sind damals gleichermaßen überfordert. Und mein Großvater bekommt für seinen Fatalismus dadurch eine weitere Begründung.
Das Heimlichtun hat nach dem Krieg einfach die Seiten gewechselt. Wer bei den Nazis heimlich dagegen war, darf jetzt offen zu seiner Meinung stehen - die anderen pflegen sie im Verborgenen noch lange weiter. 1968 kommen anlässlich der Studentenrevolte wieder die lange zurückgehaltenen alten braunen Sprüche auf, von denen der schlimmste ist: „Unter dem Führer hätte man Leute wie euch abgeholt und vergast“. Ich habe mir das bestimmt mindestens zwanzigmal von mir völlig fremden Personen anhören müssen. Mal ist es, weil ich selbst gegen die Fahrpreiserhöhung der Heidelberger Verkehrsbetriebe demonstriert habe, mal, weil ich im Bus nicht schnell genug meinen Sitzplatz für eine ältere Person geräumt habe, aber auch bisweilen einfach, weil ich einen knappen Minirock trage oder in der Heidelberger Hauptstraße eine Zigarette rauche, die mir sogar ein erboster Mann aus dem Mund schlägt, weil, so wie er es sagt, eine deutsche Frau nicht zu rauchen habe.
Bei so viel Heimlichtuerei - erst so und dann genau anders herum - weiß man in den Jahren des Neustarts nach den Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsjahren meistens nicht, wer ehrlich und wer einfach nur opportunistisch ist. Andere einzuschätzen, die in einem anderen Umfeld, einer anderen Heimat, unter ganz anderen kulturellen, sozialen und eventuell auch herrschenden politischen Bedingungen groß geworden sind und gelebt haben, fällt zu jeder Zeit schwer. Nach diesem menschenverachtenden Krieg ist es erst recht schwierig. Alle Seiten sind sehr vorsichtig mit ihren Äußerungen, aber auch beim Gewähren von Vertrauen. Ein Grund mehr, der „guten alten Zeit“ vor dem Krieg nachzutrauern, wo man solche Bedenken und Ängste noch nicht kannte. Der Krieg hinterlässt viel anhaltendes Misstrauen und jede Menge Ungerechtigkeiten, wodurch in der Nachkriegszeit das Zusammenrücken derjenigen Menschen verstärkt wird, die sich gegenseitig sicher trauen können, so auch in unserer Mini-Familie, die wie eine kleine Insel im stürmischen Meer den Wellen des Lebens weiter draußen trotzt. Daheim sagt man, was man denkt und fühlt. Wahrscheinlich hat dieses Daheim-Gefühl, dieses absolute Vertrauen und die Vertrautheit der Familienmitglieder miteinander, bei mir einen so nachhaltig prägenden Eindruck hinterlassen, dass ich es in meiner Ehe und nach der Gründung einer eigenen Familie als selbstverständlich vorausgesetzt habe. Wo, wenn nicht in der Familie unter den Menschen, die einem am nächsten stehen, kann man denn sonst noch uneingeschränktes Vertrauen schenken? Daher meine ich auch heute noch, dass darin der eigentliche Sinn von Familie besteht. Wenn sich jemand innerhalb dieses kleinen Personenkreises nicht an diese zwischenmenschliche Regel hält, stellt das nicht gleich den Sinn des gesamten Systems in Frage. Fragwürdig ist dann doch eher die Person, die sich als des in sie gesetzten Vertrauens nicht würdig erweist, das sogenannte schwarze Schaf, von denen es bekannter Weise in fast jeder Familie leider immer wieder welche gibt.
In den 50er-Jahren will jeder nur wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen, den Krieg hinter sich lassen und nach vorne gehen, ohne nach hinten zu schauen. Mehr und mehr kommen da leider auch die Ellenbogen zum Einsatz. Und Menschen, die zuvor durch gemeinschaftliche Einstellungen oder Lebenserfahrungen noch ein starkes Verbundenheitsgefühl hatten, legen dieses zunehmend ab. So wie die Not die Menschen zuvor noch zusammengeschweißt hat, trennt die Aussicht auf neuen Wohlstand die Menschen wieder. Wohl auch, weil oft für die Erinnerung an die Notzeiten vor lauter Arbeit und Zukunftsplanung kaum noch Zeit und Kraft übrig bleibt. Die Zeit des Einzelkämpfertums bricht an, die, so wie ich empfinde, heute noch anhält und in der jeder sich selbst der Nächste ist.
Auch ein Zeichen der Nachkriegszeit ist die kollektive Vergesslichkeit. Man will an die Zeit des Nationalsozialismus aus den verschiedensten Gründen möglichst nicht mehr erinnert werden. Und so findet leider auch noch sehr lange keine Aufarbeitung dieser nur nach außen hin wirklich überstandenen Zeit statt. In den Menschen selbst hinterlässt sie viele Spuren oder Narben, Erleichterungen oder Verbitterungen – je nachdem, auf welcher Seite man in der Nazizeit gestanden hat und welches Schicksal einem dadurch beschert worden ist. Oft wird bei uns zu Hause über kriegs- und nachkriegsbedingte Ungerechtigkeiten gesprochen. Nicht alles verstehe ich, aber dass meine Eltern sich ungerecht zurückgesetzt fühlen, erfasse ich klar und deutlich. Heimatvertriebene aus den verlorenen Gebieten im Osten bekommen einen Lastenausgleich, mit dem sie ein gewisses Startkapital in der neuen Heimat zur Hand haben. Leute, die hingegen ihr Hab und Gut durch Ausbombung verloren haben, gehen leer aus. Meinen Vater wurmt es, dass er durch die Ausbombung zunächst seinen Besitz und sein angehendes Erbe verloren hat und nun auch noch schier endlose Zahlungen leisten muss. Mal ist ein Zaun zu erneuern, mal ein Warnschild, dass man die Ruine nicht zu betreten habe, mal eine ganze Mauer abzutragen, da sie einzufallen droht. Bis alle diese Kosten abbezahlt sind und die Ruine endlich sehr billig wegen der nahen Zonengrenze und des damit verbundenen Verfalls der Grundstückpreise im Kasseler Raum verkauft wird, hat er viel mehr hineingesteckt als herausbekommen. Und was ihn ebenfalls hart getroffen hat, ist der Verlust so vieler ehemaliger Sozialkontakte. Die Menschen seiner Jugendzeit sind verschollen, gefallen oder nach der Ausbombung über ganz Deutschland verteilt, oft ohne in der Lage zu sein, einander wiederzufinden. In Kassel, der Heimatstadt meines Vaters, ging er 1943 während seines Heimaturlaubs mit einem Schreibblock durch die Schuttberge der Ruinen und suchte nach Hinweisen, die von den Menschen auf Brettern oder Zetteln hinterlassen oder mit Farbe direkt auf die Mauern geschrieben worden sind wie z. B. „Von Familie X sind alle tot“ oder „Familie Y ist jetzt in …„“ oder auch „Wer weiß etwas über Familie Z?“ „Lieber XX, wenn du noch lebst, suche mich in …“ So fand man damals entweder persönlich oder über andere Menschen, die entsprechende Nachrichten gefunden und gelesen hatten, bevor sie Wind und Wetter zum Opfer gefallen waren, eventuell seine Familienmitglieder, Freunde, Bekannte oder ehemalige Nachbarn. Es muss ein richtiggehendes Netzwerk zur Weitergabe dieser Informationen gegeben haben. Die gemeldeten Adressen existierten nicht mehr, ebenso wenig das Meldeamt, wo man sich hätte ummelden oder abmelden können, wenn man notgedrungen irgendwo im ländlichen Raum eine Bleibe gefunden hatte. Informationen bekam man stattdessen von Person zu Person, von Mund zu Mund und manchmal sogar nur über Dritte vom Hörensagen. Aber diese sehr effektive Informationsweitergabe hat fast denselben Zweck erfüllt wie heute ein kompliziertes soziales Netzwerk.
Mein Vater fand auf diese Weise seine Mutter in Gudensberg, wo sie nach der Ausbombung zusammen mit ihrer Schwester einquartiert worden war. Die Bewohner der wenigen noch bewohnbaren Häuser waren damals in den zerstörten Stadtvierteln wohl so etwas wie eine Anlauf- und Nachrichten-Sammelstelle für alle diejenigen, die über den Verbleib der Bewohner der zerbombten Häuser etwas wissen wollten. Das funktionierte eine Weile lang, zumindest solange nicht auch noch diese wenigen Häuser einem weiteren Bombardement zum Opfer fielen.
Sehr schlimm und auch für mich als Kind unübersehbar sind die Narben des Krieges im Mannheimer Stadtteil Lindenhof wegen der Nachbarschaft zur linksrheinischen Industriestadt Ludwigshafen, die im Krieg immer wieder Ziel von Bombenangriffen war. Die Wohnung von Onkel und Tante Dengel (den Eltern der verstorbenen ersten Ehefrau meines Vaters) hat hinter der Küche eine große Terrasse, die zur Hälfte wie eine Art Wintergarten überdacht ist. Dort befand sich früher ein Gebäudeteil, der durch die Bomben zerstört wurde. Aus der Not eine Tugend machend, hat man die hinteren Wohnungsteile der drei oberen Geschosse, die nicht mehr zu retten waren, nur abgetragen. Das Parterre konnte stehen bleiben und lieferte somit den Boden von Dengels Terrasse im damals noch „Belle Etage“ genannten ersten Stockwerk, das Dengels selbst bewohnen. Die Spuren der Brandbomben sind all die Jahre, in denen ich mit Papi Dengels besuche, immer noch an der Hausmauer zu sehen. Zum Renovieren fehlt das Geld. Nur zur Straße hin wurde neu gestrichen. Es hat genug gekostet, die halbe Ruine abzutragen. Dabei haben Dengels noch großes Glück gehabt, denn ringsum stehen fast genauso viele Ruinen wie bewohnbare Häuser. Die Nachbarn hat es oft sehr viel schlimmer getroffen. Sie haben nicht nur ihre Häuser, sondern ja auch noch die gesamte Einrichtung verloren. Aber in den ausgebombten Städten, in denen das Schicksal viele auf gleiche Art getroffen hat, halten die Menschen damals stark zusammen. Wer Glück gehabt hat und vor der Ausbombung verschont geblieben ist, der kümmert sich um die, die das Schicksal härter getroffen hat.
Auch Dengels Wohnung hat durch den Verlust eines Hausteils eine sonderbare Form bekommen. Ehemals durch eine große Schiebetüre getrennt, gab es ursprünglich ein Wohnzimmer und ein Esszimmer auf der Straßenseite. Aufgrund des Bombenschadens, der den hinteren Teil des Hauses zerstört hat, wurden Wohn- und Esszimmer vereint. Es steht ein großer, ovaler Esstisch mit sechs Stühlen in der Mitte des Zimmers, an den Wänden reihum ein Kohleofen, mehrere schwere Polstersessel, eine Wanduhr und an der Straßenseite mit zwei großen Fenstern und einem kleinen Balkon noch eine große Kredenz, auf der später auch der Fernseher seinen Platz erhält. Zur Hälfte vor der Schiebetüre, die aber immer verschlossen bleibt, steht ein großer Schreibtisch mit Stuhl. Das Zimmer ist proppenvoll mit diesen alten, dunklen und für den kleinen Raum viel zu wuchtigen Möbeln. Das ehemalige Esszimmer wurde zum Schlafzimmer umfunktioniert, da das ursprüngliche Schlafzimmer ein Raub der Bomben wurde. Aus dem gleichen Grund hört nach der großen Küche im Anschluss an den Wohn-Essbereich auf der rechten Seite die Wohnung ganz auf. Hier gibt es nur eine schnell hochgezogene fensterlose Wand, die jetzt die Außenwand des Hauses darstellt. Ein schmaler Gang führt in den ehemaligen hinteren Wohnungsteil. So schmal, weil eben die andere Hälfte des ehemals breiten Ganges und die dort noch anschließenden Zimmer durch das Bombardement verloren gingen. Auf der linken Seite des Ganges befinden sich nur noch ein recht kleines Bad, das vor der Ausbombung das Gäste-WC war, und ein Abstellzimmer.
Als ich unlängst einmal mit dem Auto durch Mannheim gefahren bin, habe ich gesehen, dass Dengels Haus in der Waldparkstraße noch immer steht. Auch bei Google Street View kann ich heute eine Zeitreise in meine Kindheit unternehmen und mir das Haus anschauen. Vielleicht wundern sich die heutigen Bewohner über die merkwürdige Raumaufteilung, ohne zu wissen, dass das Haus ursprünglich ja auch ganz anders konzipiert und gebaut war.
Für mich gehören als Kind Ruinen einfach zu Mannheim dazu. Sie haben keinen besonderen Schrecken für mich, sondern sind einfach da. Und ein Kind kann sich schwer vorstellen, wie es einmal ausgesehen haben könnte, als alle Häuser noch intakt waren, bevor sie dem Erdboden gleichgemacht worden sind. Auf dem Luftbild, das mir das Stadtarchiv Mannheim zur Verfügung gestellt hat, sieht man Mannheim im Jahr 1946. Man kann sich vorstellen, dass diese Unmengen von Ruinen und Schutt noch sehr lange das Stadtbild geprägt haben. Erst im Lauf der 60er-Jahre schließen sich die letzten Lücken.
Bei meinen Recherchen nach Fotos vom zerstörten Mannheims stieß ich auf die Online-Publikationen des Stadtarchivs Mannheim, auf denen die Luftkriegsereignisse in Mannheim zwischen 1939-1945 auf Bildern zu sehen sind und über die man dort detailliert auf vielen Seiten nachlesen kann. Jeder einzelne Luftwaffenangriff ist hier aufgeführt. Hier Angaben zu einem besonders heftigen Bombardement in der Nacht vom 5. auf den 6. September 1943: „Terrorangriff. Abwurf von 150 Minen, 2.000 Spreng-, 350.000 Stab- und 5.000 Phosphorbomben. Schwere Schäden in der Stadt. Alarm 18.34, Entwarnung 19.06, Alarm 23.22, Entwarnung 02.16.“ 2 Handelt es sich dabei um das Bombardement, bei dem Mami zusammen mit ihren Eltern und ihrer kleinen Tochter ausgebombt ist?
Luftbild von Mannheim nach einem Bombenangriff.
Ich kenne über diese Nacht noch viele Details, von denen mir berichtet wurde, aber wann sie war, konnte ich auch nicht anhand der sehr genauen Dokumentation herausfinden. Die Vielzahl der Angriffe auf Mannheimer Stadtgebiet macht es unmöglich. Ich weiß nur noch, dass die Familie nach der Ausbombung ab 1944 in Heidelberg einquartiert wurde - das genauere Datum kenne ich nicht. Wo meine Großeltern, meine Mutter und meine Halbschwester am Tag unmittelbar nach der Ausbombung untergekommen und auf welche abenteuerliche Weise sie in Heidelberg gelandet sind, entzieht sich meiner heutigen Kenntnis. Allerdings wurde mir einmal etwas von einer Bahnfahrt mit mehreren Nothalten erzählt, bei der man immer wieder aus dem Zug aussteigen und sich neben den Gleisen zu Boden werfen musste, weil Flieger im Anflug waren und weit und breit kein Bunker in erreichbarer Nähe vorhanden war. Ob es allerdings diese Reise war, weiß ich nicht.
Man stelle sich die furchtbaren Stunden während eines Bombenangriffs nur einmal vor und versetze sich in die Lage der Betroffenen, die in ihren Kellern oder in den Bunkern, oftmals sogar ganz im Dunkeln ausharren müssen! Vielleicht schon zum wiederholten Mal in dieser Nacht. Wie die Angst sich durch die Köpfe frisst, wie der Angstschweiß riecht, Kinder schreien, die Menschen beten und wie man sich immer noch, selbst in dieser absoluten und existentiellen Notlage, in der größten Angst und Verzweiflung, davor hüten muss, was man sagt, damit man nicht von anderen Menschen im gleichen Bunker bespitzelt und anschließend, sofern man dieses Bombardement überhaupt überlebt, denunziert wird. Die Angst muss unermesslich groß gewesen sein und das unglaublich viele Nächte über sechs Jahre lang. Und nicht immer kam man unbeschadet aus dem Bunker oder Keller wieder nach oben. Mein Großvater wurde einmal in einem Luftschutzkeller verschüttet und als die Helfer sich weigerten, die Mauer zu seinem Aufenthaltsort zu durchbrechen, hat meine 1,50 Meter kleine und schmächtige Oma ihn mit ihren eigenen Händen vom Nachbarkeller her freigeschaufelt und ihm damit das Leben gerettet. Erst heute, nach dem Lesen der Dokumentationen und dem Betrachten der Fotos verstehe ich die Schilderungen meiner Mutter in ihrer ganzen schrecklichen Dimension. Auch die Angst, die meine Mutter zeitlebens befiel, wenn es irgendwo knallte oder ein Probealarm geübt wurde - jedes Sirenenaufheulen rief alte Ängste, Bilder und Erinnerungen wieder wach. Wie steckt man Jahre der Angst vor jedem Bombenalarm und des ständigen Hoffens weg, es möge nicht das eigene Hab und Gut der Familie vollständig vernichtet werden und man selbst wohnsitzlos geworden, Freunde, Nachbarn und oder Familienmitglieder betroffen oder sogar getötet worden sein? Wie kann man unter diesem Dauerstress nicht verrückt werden? Mit zwei kränklichen Eltern und einem kleinen Kind im Luftschutzbunker abwarten zu müssen, zitternd vor Angst vor dem Verschüttetwerden oder dem Erstickungstod, weil die vielen Feuer ringsum den Sauerstoff aufbrauchen? Das Einschlagen der Bomben, den Krach der einstürzenden Häuser hören zu müssen, ohne zu wissen, welche Häuser es gerade wie schlimm getroffen hat und ob nicht auch das eigene Haus, die eigene Wohnung darunter ist. Und dann herauszukommen und vor dem brennenden, einsturzgefährdeten Haus zu stehen und auch ringsum gibt es nur noch Ruinen, Schutt, Krach von einstürzenden Mauern, Nebel und überall Feuer, das von niemandem gelöscht werden wird. Man muss hilflos und ohnmächtig zusehen, wie sich alles im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch auflöst.
Alle Menschen ringsum haben dann das gleiche Problem. In diesen Momenten ist jeder mit seiner Fassungslosigkeit, Angst, Ohnmacht und Verzweiflung allein, selbst wenn nach der Entwarnung die ganze Straße voller Leute steht. Da geht es bisweilen um das nackte Überleben. Darum, sich vor dem nächsten Bombenangriff in Sicherheit zu bringen und für die nächste Zeit ein Dach über dem Kopf zu organisieren. Zu verhindern, dass eventuell doch unzerstörte Besitztümer nicht auch noch aus den Schuttmassen geplündert werden. Und das noch vor dem nächsten Bombardement, von dem man weiß, dass - aber nicht wann - es erfolgen wird.
Erst heute beim Schreiben wird mir bewusst, wie sehr die Ausbombungen meiner Mutter und ihrer Eltern in Mannheim und die meines Vaters und seiner Mutter in Kassel auch mich, die ich erst nach dem Krieg geboren wurde, zeitlebens sowohl direkt als auch indirekt beeinflusst haben. Sie sorgten unter anderem dafür, dass ich bis etwa 1968 stets das Gefühl hatte, nirgends wirklich dazuzugehören. Meine Eltern waren Intellektuelle, die im sozialen Wohnungsbau untergekommen waren. Andere Intellektuelle in Heidelberg, sofern sie nicht ebenfalls von außerhalb nach der Ausbombung ihrer Heimatstädte zugezogen waren, wohnten in schönen Wohnungen, oft auch eigenen Häusern. Aussagen wie die meiner Oma „Wir sind nun niemand mehr“ oder „Als wir noch jemand waren“, trugen nicht gerade zur Festigung meines Selbstbewusstseins bei. Ich kam mir bei den Kindern meiner Schulklasse oft wie ein Voyeur vor, der von außen heimlich durch das Fenster ins warme Zimmer schaute, wo die anderen Kinder in Saus und Braus in einer Welt zu leben schienen, zu der meine Eltern und Großeltern auch einmal dazugehört hatten. Für mich selbst schien jedoch die Zugehörigkeit zu dieser Welt ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Die Kinder, deren Familien in Heidelberg nicht ausgebombt waren, lebten im Vergleich zu uns mit der, gelinde gesagt, spartanischen Wohnsituation, geradezu hochherrschaftlich. Da ich, wie mir immer wieder gesagt wurde, nicht mithalten konnte, indem auch bei mir einmal andere Kinder zum Spielen oder sogar zum Übernachten kommen konnten, blieben die Sozialkontakte zahlenmäßig sehr begrenzt. Und da mir beigebracht worden war, dass man über Geld, auch das nicht vorhandene, nicht zu reden habe, konnte ich auch nicht einfach mal sagen: „Hört mal, wir wohnen vielleicht in einer ganz popeligen Wohnung und haben nur sehr wenig Geld, aber meine Eltern haben sicher einmal mindestens so schön gelebt wie ihr heute. Sie haben eben durch die Ausbombung alles verloren“. Ich schätze, dass viele dieser Ur-Heidelberger Kinder die Bedeutung des Wortes Ausbombung auch gar nicht verstanden hätten, da es in ihrer Familie kein ständig wieder aufs Neue aktuelles Thema war. Durch mein Kinder-, Jugendlichen- und in mancher Hinsicht auch Erwachsenen-Leben zog und zieht sich das Thema hingegen wie ein roter Faden. Dass und wie ausführlich ich heute darüber schreibe, zeigt, wie sehr es mich immer noch beschäftigt.
Meine Eltern und Großeltern waren hochtraumatisiert, hatten aber für ihre Traumata keine Anlaufstelle, wo sie sich Rat, Hilfe und Trost hätten holen können, da sie ja wahrlich keine Einzelfälle waren. Heute würde man sagen, sie litten unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, von der man weiß, dass sie nur schwierig und langwierig zu therapieren ist. Damals musste man eben irgendwie allein klarkommen. Und da man als Betroffener im Normalfall kein professioneller Psychologe war, machte man dabei jede Menge Fehler und vermeintliche Erfolge waren letztlich keine Aufarbeitung oder Bewältigung, sondern im besten Fall Zweckoptimismus und Verdrängung. Ihre in Wahrheit unbewältigten, traumatischen Erfahrungen haben sie, jeder auf andere Weise, durch ihr Verhalten weitergegeben. Wir Nachkriegskinder mussten im Regelfall nicht nur mit dem Trauma einer Person, sondern mit einer Menge Traumata unseres gesamten erwachsenen Umfeldes klarkommen. So entstanden auch bei uns in gewisser Weise indirekte posttraumatische Belastungsstörungen. Wie schon die Traumata der ersten Generation ihrer Träger wurden sie nicht therapiert, meistens noch nicht einmal als solche erkannt. Auch mir selbst werden sie erst heute beim Schreiben bewusst. Die unbewältigten Traumata meiner Eltern und Großeltern hingen von klein auf an mir wie ein viel zu großer, schwerer Mantel, der mein ungehindertes seelisches Wachstum und meine freie Beweglichkeit behindert hat. So war ich als Kind und Jugendliche davon überzeugt, ich sei weniger wert als viele andere Gleichaltrige, weil meine Eltern ärmer als ihre Eltern waren, und ich sei dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass es meiner Familie eines Tages wieder gut ginge. Nicht nur finanziell, sondern insbesondere in Bezug auf ihre Trauer, die sie trotz der immer herrschenden, fröhlichen Atmosphäre wie eine Art Aura umgab. Meine Familienmitglieder haben sich stets bei mir verbal oder durch ihr Verhalten dafür entschuldigt, dass sie mir weniger bieten könnten als die Eltern meiner Schulkameradinnen ihren Kindern. In finanzieller Hinsicht, die insbesondere in der Wohnsituation ihren Ausdruck fand, in zeitlicher Hinsicht, da beide Eltern unermüdlich arbeiten mussten, da es an allen denkbaren Erleichterungen mangelte, und in Hinsicht auf ihre Körperkräfte, die nach so viel Belastung einfach nachgelassen hatten. Hinzu kam, dass beide bei meiner Geburt schon recht alt waren, zumindest für damalige Verhältnisse. Mein Vater war bereits 45, meine Mutter 38 Jahre alt - da fiel es oft schwer, dem starken Bewegungsdrang eines Kindes gerecht zu werden. Da ja auch keine Geschwister und kaum gleichaltrige Spielkameraden vorhanden waren, wie man sie heute im Kindergarten ganz selbstverständlich findet, fielen einige Beschäftigungsmöglichkeiten weg, die andere Kinder daheim ganz selbstverständlich hatten. Aber ich habe das nie als störend empfunden. Im Gegenteil - meine Eltern haben mir unendlich viel zu bieten gehabt. Ich hatte die zur gesunden, seelischen Entwicklung erforderlichen sicheren Bindungen an geliebte Menschen und ein Höchstmaß an emotionaler Zuwendung, aber zugleich ganz klar definierte Grenzen, da meine Eltern auch von mir etwas forderten und nicht einfach nachgegeben haben, um ihre Ruhe zu haben. Als Pädagogin habe ich später bisweilen auch die andere Seite kennengelernt: Wohlstandsverwahrloste Kinder, die materiell niemals etwas entbehren müssen, haben bisweilen ein seelisches Bleigewicht mit sich herumzutragen. Und vielleicht haben ihre Eltern sie gerade deshalb zu kleinen orientierungslosen Tyrannen erzogen, weil sie selbst noch in zweiter oder dritter Generation die posttraumatische Belastungsstörung ihrer Eltern oder Großeltern auf ihre eigene, falsche Art zu bewältigen suchten. Denn wenn man sein Kind liebt, versucht man automatisch, ihm das zu bieten, was einen selbst am meisten gestört hat und ihm das zu schenken, von dem man selbst immer geträumt hat.
Kriege hören nicht einfach dadurch auf, dass sie zu Ende gegangen sind. Der Zweite Weltkrieg hat meine Eltern zwar zusammengeführt und sie miteinander das neue Leben Seite an Seite beherzt schultern lassen, aber es blieben auch viele schwerwiegende, unbewältigte und irgendwie mehr oder weniger erfolgreich verdrängte Traumata zurück. Wir auf Empathie trainierten Nachkriegskinder haben das natürlich gespürt, und da wir unsere Eltern ja liebten, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ihre seelische Last zu verringern. Konkret gesagt hätte der Auftrag, den ich mir dadurch selbst gestellt habe, für mich geheißen, den Krieg und seine Zerstörungen ungeschehen zu machen - also war es eine unlösbare Aufgabe. Meine Freundin, deren Eltern auf der Flucht von Sudeten-Deutschland zwei Töchter verloren hatten, konnte auch diese Mädchen nicht ersetzten und doch hat sie immer versucht, ihre Eltern für den Verlust zu entschädigen, indem sie sich besondere Mühe gab, die perfekte Tochter zu sein. Da solche Mammutaufgaben für uns Kinder prinzipiell einfach nicht lösbar waren, haben wir auch für unser weiteres Leben häufig Versagensgefühle zurückbehalten. Wir waren eine Generation Kinder, die sich für das Glück der Familie zuständig sah, und wir haben diese Aufgabe bisweilen so verinnerlicht, dass wir sie auch als Erwachsene noch weitergeführt haben. Für Frauen, die durch die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Erziehung ohnedies immer die Glückbringer, die „Sonnenscheine“ zu sein hatten, galt diese Aufgabe sogar noch doppelt. Kein Wunder, dass Frauen meiner Generation es bis heute zumeist als ihr Versagen ansehen, wenn irgendwer in ihrer Familie eben einmal nicht glücklich ist. Ich hoffe sehr, dass moderne Frauen, die ja auch schon anders erzogen wurden, sich diesen Schuh nicht mehr anziehen. Wer in seiner Beziehung zu anderen Menschen nicht glücklich und zufrieden ist, hat selbst etwas falsch gemacht. Kein anderer Mensch, kein Partner, keine Partnerin, kein Kind kann unsere Zufriedenheit durch noch so große Bemühungen herbeiführen. Ein anderer Mensch kann mir nur eine Art Werkzeug zum Glücklich-Sein zur Verfügung stellen, mir günstige Rahmenbedingungen schaffen. Was ich daraus mache, ist mein eigenes Ding.
Ich denke heute, dass unsere Eltern eben oftmals die nötige Kraft nicht mehr hatten, mit Hilfe des Lebens- und Beziehungs-Werkzeuges selbst noch etwas Solides für ihr eigenes Glück zu bauen, da zu vieles durch die Kriegsjahre sowohl materiell als auch ideell ruiniert war. Wir Kinder mit unserer noch ungebrochenen Kraft, Spontaneität und Lebensfreude sollten sie wieder ins Leben hineinziehen. Und obwohl wir, die Kleinen, ja eigentlich gar nicht so viel Macht und Kraft hatten, auch wirklich etwas zu bewegen, haben wir das Unmögliche zum größten Teil dennoch geschafft.
Wir waren und sind eine enorm starke Generation. Schade nur, wenn wir im Laufe des Lebens vergessen haben, wie viel Stärke wir eigentlich in unserem Leben schon besessen und bewiesen haben. Wir machen es durch unseren eigenen Anspruch, auch weiterhin für das Glück der anderen verantwortlich zu sein, unnötig schwer und verlieren dabei das Wichtigste ganz aus den Augen: Unser eigenes Glück und unsere eigene Zufriedenheit, die sich nicht durch das Glück und die Zufriedenheit anderer Menschen definieren dürfen. Und wir Frauen sind da wohl die absoluten Vorreiter. Nichts erfüllt die meisten von uns mit mehr Zufriedenheit, Stolz und Glück, als wenn es uns gelungen ist, jemand anderen glücklich gemacht zu haben. Nein, liebe Frauen, ich sage euch: Das kann nicht stimmen! Zieht euch diesen viel zu großen Schuh nicht an! Glücklich machen kann man sich nur selbst.
Eines unserer beiden Häuser in Kassel . . .
. . . vor der Zerstörung
. . . und nach der Zerstörung.
Wir Nachkriegskinder haben in vieler Hinsicht für unsere Eltern eine Therapiefunktion gehabt, da ihnen damals keine andere Therapiemöglichkeit zur Verfügung stand. Ihnen ist kein Vorwurf zu machen, dass sie uns unbeabsichtigt zu anteiligen Mitträgern ihrer kriegsbedingten Seelenruinen gemacht haben. Viele der älteren Generation haben die Ängste, Konflikte, Schuld- oder Ohnmachtsgefühle der Kriegszeit, wie man es heute nennt, überkompensiert, um überhaupt im normalen Nachkriegsalltag bestehen zu können. Sie haben, zumindest nach außen hin, mit viel Kraft die alten Traumata unter Tonnen von neuen Werten, Problemen, Zukunftsvorstellungen und Hoffnungen zugeschüttet und die Erinnerungen an die Auslöser der Traumata darunter zu begraben versucht. Alles, was daran erinnert hat, wurde, so gut es nur ging, aus dem Leben verbannt. Der Blick durfte nur noch nach vorn gehen. Und so wurde geschwiegen - nicht nur, um die eigene Schuld zu vertuschen, wie die jungen Menschen 1968 ganz pauschal geurteilt und behauptet haben. Es war für viele Ältere die einzige Möglichkeit, mit ihren niemals aufgearbeiteten Traumata, ihren Seelenruinen, weiterzuleben. Das Schweigen und Verdrängen hatte Züge einer Sucht, die dazu diente, den als unangenehm empfundenen Zustand vor sich selbst zu verschleiern, sich zuzudröhnen.
Die Nachkriegsgeneration hatte sicher in vieler Hinsicht eine sehr ähnliche seelische Belastung und auch ganz ähnliche Reaktionsschemata darauf wie die Kinder von Süchtigen. Wir haben eine Form der Co-Dependenz entwickelt, indem wir alles machten, um den Eltern den Glauben an die heile Gegenwarts-Welt zu erhalten und ihre schlechten Erinnerungen durch gute Erlebnisse zu kompensieren. Dabei waren wir in ständigem Einsatz, unsere Eltern glücklich zu machen. Gerade wir Mädchen wurden ja auch noch nach der alten Tradition erzogen, dass es unsere Aufgabe sei, einmal für das Glück der später selbst zu gründenden und zu umsorgenden Familie verantwortlich zu sein. Ganz sicher hat die Generation der Nachkriegsmädchen in dieser Hinsicht allzu häufig eine Erziehung bekommen, die sie dazu prädestiniert hat, in ihrem weiteren Leben bei kleinsten Beziehungspannen das Gefühl von Unzulänglichkeit und Versagen zu entwickeln und auch das schweigende Ertragen von Missständen in einer Beziehung hat ganz sicher hier - zumindest teilweise - seinen Ursprung.
Wir haben als Kinder viel zu große Schuhe angezogen bekommen, in die wir nie hereinwachsen konnten. Wir haben genau gespürt, dass da bei den Älteren etwas war, das weit über unsere Vorstellungskraft hinausging und haben diese unsichtbare Grenze nicht zu berühren gewagt. Erst 1968 haben wir damals Jungen uns genau auf diese Schweigemauer fokussiert, die wir einzureißen versuchten, und bekamen die fast schon panikartige Reaktion der Älteren zu spüren, die wir ausschließlich als Schuldeingeständnis interpretierten. Es gab zweifellos bei einer ganz enormen Zahl von Menschen diese Schuld, die Angst vor so später Entdeckung und der Forderung nach Rechenschaft. Aber es gab eben auch die anderen. Die, die einfach nur ganz schrecklichen Belastungen ausgesetzt gewesen waren. Die ebenfalls Opfer geworden sind. Wir selbst, die wir die Kriegszeit nicht mehr persönlich erlebt haben und auch nur das Wenige darüber wussten, was uns die Älteren erzählt hatten, hielten das beharrliche Schweigen prinzipiell für ein Verleugnen, Vertuschen und Verschleiern von Schuld. Dabei waren die Gründe vielfältig. Nicht nur Schuld macht stumm.
Vielleicht war bei meinen Eltern das, was ich bei meiner Mutter immer als unbändige Lebenslust und Lebensliebe interpretiert habe, und die Rastlosigkeit, mit der mein Vater sich von Menschen, Eigenansprüchen und Terminen durch sein haupt- und freiberufliches Arbeitsleben hat treiben lassen, in Wahrheit zumindest teilweise Überkompensation, um das, was hinter ihnen lag, auch wirklich dort hinten zu lassen. Es nie mehr erleben, spüren oder sehen zu müssen.