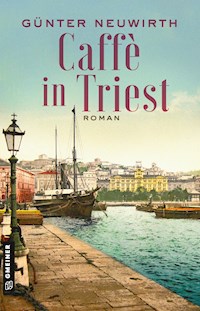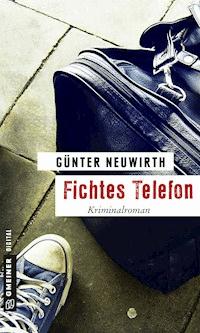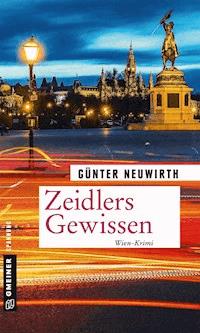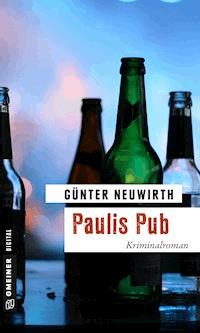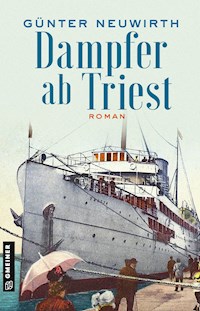
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Inspector Bruno Zabini
- Sprache: Deutsch
Inspector Bruno Zabini ist ein wahrer Triestiner, er spricht mehrere Sprachen und liebt Kaffee. Seine Heimatstadt Triest ist für die Donaumonarchie der »Hafen zur Welt«. Als Bruno den Befehl erhält, zum Schutz des Grafen Urbanau an Bord des Kreuzfahrtschiffs »Thalia« zu gehen, ist er nicht erfreut. Viel lieber hätte er ein paar schöne Tage mit seiner Geliebten verbracht. Inkognito begibt er sich auf das Schiff und mischt sich unter die illustren Fahrgäste. Denn einer unter ihnen trachtet dem Grafen nach dem Leben … Ein Roman vor der wunderbaren Kulisse der »Stadt der Winde«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Neuwirth
Dampfer ab Triest
ROMAN
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:19090108_trieste_molo_san_carlo.jpg
ISBN 978-3-8392-6704-2
Personenverzeichnis
Brunos privates Umfeld
Bruno Zabini, 37, Inspector I. Klasse, Triest
Heidemarie Zabini, geb. Bogensberger in Wien, 59, Brunos Mutter
Salvatore Zabini (1836–1899), Brunos Vater
Maria Barbieri, geb. Zabini, 32, Brunos Schwester, Triest
Fedora Cherini, 34, Hausfrau, Triest
Luise Dorothea Freifrau von Callenhoff, 27, Schriftstellerin, Sistiana und Triest
Die Triester Polizei
Johann Ernst Gellner, 52, Oberinspector
Emilio Pittoni, 40, Inspector I. Klasse
Vinzenz Jaunig, 47, Polizeiagent I. Klasse
Luigi Bosovich, 26, Polizeiagent II. Klasse
Ivana Zupan, 41, Bürokraft
Passagiere der Thalia
Maximilian Eugen Graf von Urbanau, 64, steirischer Adeliger, Oberst a. D., Attaché des Kriegsministeriums im Ruhestand
Carolina Sylvia von Urbanau, 20, Tochter des Grafen
Friedrich Grüner, 25, Schauspieler und Poet
Therese Wundrak, 33, Reiseschriftstellerin
Samuel, 54, und Vilma, 39, Teitelbaum, Ehepaar aus Lemberg
Ludmilla Kabátová, 46, Musikerin aus Prag
Ferdinand, 31, und Hermine, 26, Seefried, Ehepaar aus Wien
Winfried Mühlberger, 43, Theaterdichter aus München
Senta Oberhuber, 34, und Klara Steinhauer, 27, Schwestern aus München
Gilbert Belmais, 35, französischer Reisender
Dr. Gerold, 71, und Josefine, 64, von Eggersfeldt, Ehepaar aus Retz
Mark, 43, und Deanna, 41, Cramp, Ehepaar aus Boston
Mannschaft der Thalia
Karl von Bretfeld, 52, Kapitän
Roberto Silla, 40, Erster Offizier
Guiseppe Lorenzutti, 36, Zweiter Offizier
Mario Valenti, 42, Bootsmann
Paolo Glustich, 40, Schiffskommissär
Dr. Johannes Zechtel, 55, Schiffsarzt
Zlatko Dolinar, 35, Oberkellner
Georg Steyrer, 28, Steward und Barbier, unehelicher Sohn des Grafen Urbanau
Der Tag der Ankunft
Morgendlich kühler Wind strich über die Dächer der Stadt. Kurz hielt Bruno inne und blickte hinab zu den Segelschiffen und Dampfern im Hafen, dann stieg er weiter den Hang empor. Zügig, Schritt für Schritt.
Um Klarheit im Denken zu erlangen, waren Fußmärsche unerlässlich. Viele seiner Fälle hatte Bruno Zabini allein durch schnelles Gehen gelöst. Unterwegs klärten sich Sachverhalte, konkretisierten sich Ahnungen, ergaben sich neue Möglichkeiten und wurden Irrwege vermieden. Gehen war Denken, und Denken war Gehen. In jedem Fall in Brunos Welt.
Oberinspector Gellner, sein Vorgesetzter, bevorzugte Kutschen. Gehen war in Gellners Augen etwas für das einfache Volk, für die Tagelöhner, die Marktweiber und die Kohlenträger, ein Mann von Rang und Namen orderte eine Kutsche. Die elektrische Straßenbahn hingegen, so Gellner, sei etwas für Eilige und Nervöse. Wer setzte sich schon in ein rumpelndes Ungetüm, das nicht von braven Tieren gezogen, sondern von unsichtbaren Geistern durch die Stadt gejagt wurde? Gellner misstraute der Elektrizität im Allgemeinen, der elektrischen Straßenbahn im Besonderen. Also nutzte er die Dienste eines Kutschers. Nun, Bruno wunderte sich längst nicht mehr über die antiquierten Ansichten seines Vorgesetzten. Außerdem, so fragte sich Bruno, was hielt den Körper einfacher und sicherer gesund als beherztes Gehen? So wie jetzt, so wie eben.
Vielleicht marschierte Bruno nicht nur deswegen so forsch, um seinen Leib zu ertüchtigen und seinem Denken wohlzutun, vielleicht gab es da auch noch einen weiteren Grund? Einen, der sich nicht für medizinische Diskurse oder philosophische Reflexionen eignete.
Vor vier Wochen hatte sich Signora Cherini wieder Bücher bei Brunos Mutter ausgeliehen. Heidemarie Zabini hatte über die Jahre ein Bücherkränzchen lesefreudiger Damen um sich versammelt, die einander Bücher liehen und einmal im Monat bei Kaffee und Kuchen über ihre Lektüre debattierten. Signora Cherini war die Jüngste in diesem Kreis, seit vier Jahren nahm sie, wann immer es sich ermöglichen ließ, an den Treffen teil. Carlo Cherini bezog als Offizier der Handelsmarine zwar ein hinreichendes Einkommen, um seiner Frau und seinen beiden Söhnen ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen, aber Signora Cherini achtete sorgsam auf die Haushaltskasse, daher kaufte sie Bücher selten, sondern borgte sie von den Damen des Kränzchens oder entlieh sie aus der Bibliothek. Bruno war auf dem Weg, die Bücher abzuholen. Einen Botendienst, den er nur gerne leistete, würde er doch Fedora Cherini begegnen.
Allein in einem Raum mit dieser Tochter der Venus zu sein und dieselbe Luft zu atmen, war jeden Fußmarsch wert. Darüber hinaus war heute sein freier Tag. So war er bald nach dem Frühstück aufgebrochen und marschierte zügig bergauf und bergab durch die Straßen und kam schließlich in das Viertel Gretta, wo am Ende einer steil ansteigenden Gasse der Familienwohnsitz von Carlo Cherini lag. Während er sich dem Haus näherte, blickte er sich genau um.
Als Inspector des k.k. Polizeiagenteninstituts seiner Majestät des Kaisers verfügte er über ein scharfes Auge und einen geschulten Blick. Und so wie er es wahrnahm, wurde er in diesem Moment von keinen neugierigen Nachbarn beäugt, dennoch zog es Bruno vor, am Haus vorbeizugehen, sich noch einmal genau umzusehen und hinter der Hecke zu verschwinden. Er näherte sich im Schatten von Bäumen und Sträuchern der Rückseite des Hauses. Beim Holzzaun hielt er inne, schaute und lauschte. Nichts. Stille. Vorsichtig stieg er über den hüfthohen Zaun und huschte unter den Obstbäumen durch den Garten.
Bruno drückte sich an die Wand und horchte. Rundum war es still, nur Vogelstimmen lagen in der Luft und aus großer Ferne tönte ein Schiffshorn. Durch das halb geöffnete Fenster hörte er Schritte auf den Holzdielen. Vorsichtig beugte er sich vor und wagte einen Blick durch das Fenster.
Da war sie! Fedora Cherini.
Bruno hielt den Atem an. Sie war nur halb bekleidet, trug lediglich ein Unterkleid und war barfuß. Er erblickte ihre unbedeckten Waden, ihre nackten Oberarme. Ihr Haar floss offen über ihre Schultern. Wie schön sie war. Eine Königin!
Fedora Cherini beugte sich vornüber und kramte in der unteren Schublade des Wohnzimmerschrankes. Brunos Augen weiteten sich. Die Rundungen ihres Gesäßes prägten sich in das Unterkleid.
Ein Anblick purer Schönheit. Wollte er doch ewig weilen.
Bruno tippte vorsichtig mit dem Fingernagel an die Glasscheibe. Signora Cherini erschrak, richtete sich auf und schaute zum Fenster. Sie stemmte ihre Fäuste in die Hüften und verzog den Mund, dann trat sie zu Bruno und öffnete das Fenster zur Gänze.
»Wie lange beobachtest du mich schon?«
»Lange genug, um deiner Schönheit vollends verfallen zu sein.«
Fedora blickte aus dem Fenster. »Hat dich jemand gesehen?«
»Niemand hat mich gesehen, niemand hat mich gehört, endlich bin ich bei dir.«
»Na los, komm rein, aber mache keine Schmutzspuren an der Fassade. Es hat letzte Nacht geregnet.«
Fedora trat zur Seite, Bruno kletterte in das Haus. »Wie lange sind deine Söhne bei deiner Schwiegermutter?«
»Bis abends. Sie begleitet die Buben nach Hause.«
Bruno umfasste Fedoras Hüfte und zog sie an sich. »Das heißt, wir haben den ganzen Tag für uns.«
»Den Vormittag. Ich habe später noch zu tun.«
»Wie kann das Schicksal mir noch gnädiger sein?«
»Ich habe dich schon gestern Abend erwartet.«
Bruno verzog den Mund. »Ich hatte zu tun. Just abends haben eine Handvoll griechischer Matrosen zu viel Bier und Schnaps getrunken und sich auf eine allzu leichtfertige Rauferei eingelassen. Einer der Gesellen wurde so schwer verletzt, dass er in der Schenke seinen Verletzungen erlag. Ich konnte erst knapp vor Mitternacht los, da wollte ich dich nicht mehr stören.«
Fedora blickte Bruno mit ihren dunklen Augen an, sie schien ihn in ihren unauflöslichen Bann schlagen zu wollen. »Herr Inspector, Sie schlagen sich also bevorzugt mit betrunkenen Matrosen herum, anstatt mir Ihre Aufwartung zu machen? Ich bin bitter enttäuscht.«
Bruno grinste breit. »Signora Cherini, ich biete an, jede Schuld, die ich mir Ihnen gegenüber aufgeladen habe, mit all meinen Kräften zu begleichen.«
Fedora kicherte. »Küss mich, Herr Inspector.«
Bruno ließ sich nicht zweimal bitten.
*
»Das ist unnatürlich.«
Carolina Sylvia von Urbanau las einen Artikel im Interessanten Almanach für das treudeutsche Weib, über den sie sich nur wundern konnte. Die Haushälterin Josefa hatte das kleine Büchlein versehentlich in Carolinas Reisegepäck gesteckt, obschon sie die aktuelle Ausgabe von Roseggers Heimgarten hätte einpacken sollen. Eine ärgerliche Verwechslung, denn die mit großem Pathos vertretenen Ansichten im Almanach fand Carolina gelinde gesagt altbacken. Man schrieb das Jahr 1907. Das Mittelalter war lange vorbei. Carolina legte das Büchlein zur Seite und sah ihren Vater an.
»Was hast du gesagt, Papa?«
Graf Urbanau blickte mit verdrießlicher Miene zum Fenster des fahrenden Zuges hinaus. »Ich sagte: Das ist unnatürlich.«
Carolina folgte dem Blick ihres Vaters und sah die prächtige Landschaft der Untersteiermark. Sanfte Hügel, gedeihende Getreidefelder, in der Ferne erblickte sie einen Ochsenkarren auf einem Feldweg, die hochsteigende Sonne erhellte das Land. Was für ein schöner Ausblick! Viel besser als das moralisierende und besserwisserische Geschreibsel, mit dem sie sich die letzte Viertelstunde verdorben hatte. »Ich kann nichts Unnatürliches entdecken, lieber Papa. Unsere Heimat erscheint mir im Vorbeiziehen gerade so, wie sie sein sollte.«
Maximilian Eugen Graf von Urbanau, Besitzer großer Ländereien in der Untersteiermark, Inhaber einer Fabrik, Oberst der Infanterie außer Dienst und Attaché des Kriegsministeriums in Pension, nahm seine Tochter streng in Augenschein. »Du sagst es doch selbst! Im Vorbeiziehen. Diese Raserei! Man kommt sich vor wie in einem Tollhaus. Wie schnell fährt der Zug?«
»Ich weiß es nicht.«
»Sieh zum Fenster hinaus und versuche die Geschwindigkeit zu schätzen.«
Carolina tat wie ihr geheißen. »Vielleicht sind es sechzig Kilometer pro Stunde. Vielleicht siebzig.«
Der Graf stampfte mit seinem Gehstock auf. »Da hast du es! Siebzig Kilometer pro Stunde! Ich schätze sogar, dass es achtzig sind. Diese neuen Schnellzuglokomotiven erreichen auf geraden und ebenen Strecken leicht diese Geschwindigkeit.«
»Das ist doch gut. So kommen wir rasch voran.«
Der Graf erhob belehrend den Zeigefinger. »Wir bewegen uns mit achtzig Kilometern pro Stunde. Das nenne ich Raserei! Als ich seinerzeit mit meinem Regiment durch Böhmen marschiert bin, um bei der Schlacht bei Königgrätz den Dienst im Rock des Kaisers zu leisten, als wir also zur großen Schlacht anmarschiert sind, waren wir mit vollem Marschgepäck über zwei Wochen auf der Landstraße. Das nenne ich natürlich! Der junge Mann schnellen Schrittes über Feld und Flur entspricht der althergebrachten Natur des Menschen. Die rasende Eisenbahn ist neuzeitlicher Wahnsinn!«
Carolina kannte jede Geschichte aus der großen Zeit ihres Vaters, in welcher er als schneidiger Leutnant im Felde gestanden hatte und bei der schweren Niederlage der österreichischen Armee gegen die vermaledeiten Preußen verwundet worden war.
»Unser Coupé ist sehr komfortabel. Als wir losgefahren sind, fand ich den Kohlerauch ein bisschen störend, aber seit der Zug unterwegs ist, hat sich das gegeben. Ich genieße die Fahrt«, sagte sie.
Der Graf schüttelte den Kopf. »Der menschliche Leib ist für solche Geschwindigkeiten nicht geschaffen. Siebzig bis achtzig Kilometer pro Stunde. Kind, denk doch einmal vernünftig!«
»Nur so schaffen wir es an einem Tag von Graz nach Triest. Früher sind die Kutschen fast eine Woche unterwegs gewesen, bei schlechtem Wetter oft sogar länger.«
»Du scheinst nicht zu verstehen, was ich dir erklären will, Carolina.«
»Was willst du mir erklären, Papa?«
»Bei solchen Geschwindigkeiten und diesem irrwitzigen Geruckel und Gerüttel werden die inneren Organe des Menschen heillos durcheinandergewirbelt. Das ist auf die Dauer nicht gesund.«
»Ich finde, dass der Wagen bei siebzig oder achtzig Kilometer pro Stunde viel weniger gerüttelt wird, als eine Kutsche auf einer holprigen Straße. Außerdem fahren seit fünfzig Jahren Züge über die Südbahnstrecke von Graz nach Triest. Mir ist nicht bekannt, dass Lokführer oder Schaffner in all der Zeit an durcheinandergewirbelten Organen erkrankt sind.«
Auf die Stirn des Grafen legten sich dunkle Falten. »Was sind denn das für revolutionäre Töne, junges Fräulein?«, fragte er mit knarrender Stimme.
Carolina schlug den Blick nieder. Die Euphorie, endlich im Zug zu sitzen, hatte sie geradezu vorwitzig werden lassen. »Ganz bestimmt hast du recht, verehrter Herr Papa. Die Raserei ist augenscheinlich.« Carolina fügte schnell hinzu, um das Thema zu wechseln: »Dennoch freue ich mich sehr, endlich wieder nach Triest zu kommen. Ich habe die Stadt in so guter Erinnerung.«
Der Graf nickte zustimmend und schaute sinnierend zum Fenster hinaus. »Ja, unsere Seereise von Triest nach Ragusa. Wie lange ist das her?«
»Elf Jahre, lieber Papa, die Reise ist elf Jahre her. Ich war damals neun. Daran kann ich mich ganz genau erinnern.«
Der Graf seufzte. »Ja, unsere Dampferfahrt in den Süden. Das war schön. Deine geliebte Frau Mama, du selbst und ich, eine Familie auf großer Fahrt. Ich denke gerne daran zurück.«
Wehmut ergriff Carolina. Wenige Monate nach der für Carolina ersten und bislang einzigen Schiffsreise war ihre Mutter gestorben. »Ich auch, Papa.«
»Ich weiß gar nicht, warum ich mich habe breitschlagen lassen, wieder an Bord eines Schiffes zu gehen.«
»Wegen deiner Lungen, Papa.«
»Das weiß ich doch! Dr. Röthelstein und seine medizinischen Anordnungen. Eine Schiffsreise gegen meine Lungenschwäche. Wenn du mich fragst, sind das verrückte Ideen.«
»Ich freue mich außerordentlich auf die Schiffsreise. Das Meer! Die Sonne! Griechenland! Die große Metropole Konstantinopel. Und die klare Luft auf See wird deinen Lungen bestimmt guttun.«
Der Graf sah seine Tochter an, er sah ihre Vorfreude, ihre Erwartungen, er sah ihre Schönheit und Lebendigkeit, ihre Grazie und Eleganz. Ja, in seiner Tochter war seine geliebte Sophie lebendig geblieben. Sophie war viel zu früh und viel zu jung von ihm gegangen. Graf Urbanau griff nach der Hand seiner Tochter und drückte sie. »In Wahrheit, mein Kind, mache ich diese Reise nicht wegen meiner angeschlagenen Gesundheit, sondern allein, um dir eine Freude zu bereiten.«
Carolina lächelte freudig. »Vielen herzlichen Dank, geliebter Papa.«
»Sieh mal in den Korb, was Josefa eingepackt hat. Langsam kriege ich Hunger.«
»Trotz der durcheinandergewirbelten Organe?«
Der Graf legte die Stirn in Falten, lächelte jedoch dabei. »Du bist heute signifikant vorwitzig, Fräulein. Woher kommt denn das?«
*
Bruno saß bei Tisch und schaute zum Fenster in den schattigen Garten. Er nippte an der Kaffeetasse. Fedora verstand sich auf die Kunst, aus gemahlenen Kaffeebohnen ein Getränk zuzubereiten, das keinerlei Vergleiche mit der Arbeit des Baristas des Caffè degli Specchi zu scheuen brauchte. Die Essenz der Bohne auf den Punkt gebracht, schwarz, stark und ungesüßt. Was für ein besonderer Tag. Schon vor der Mittagsstunde hatte er ein Glück erfahren, das für viel mehr als einen Tag reichte. Fedora betrat das Wohnzimmer. Sie legte das Bücherpaket auf einen der Stühle.
»Richte deiner Frau Mama meine besten Grüße aus. Bei Gelegenheit stöbere ich wieder gerne in ihrer wohlsortierten Bibliothek.«
Bruno schmunzelte. »Du bist immer willkommen.«
»Das freut mich.«
»Verstehe ich das richtig? Du setzt mich vor die Tür?«
»Ich habe noch eine Menge zu tun, bis die Kinder zurück sind.«
Bruno leerte die Tasse in einem Zug und erhob sich. Er strich sein Hemd glatt und zog das Sakko über. Fedora kam näher, zupfte das Sakko zurecht und knöpfte es zu. Bruno umfasste ihre Taille und zog sie an sich.
»Geliebte Fedora, ich danke dir für diesen Vormittag des Glückes.«
»Ich danke dir auch, schöner Mann.«
»Was bin ich doch für ein Glückspilz, dass dein Ehemann zur See fährt und sich so Platz für mich in deinem Leben ergibt.«
»Ich finde, wir haben beide Glück gehabt.«
Bruno lächelte. Er konnte sich gut daran erinnern, wie Fedora bitter über die langen Perioden des Alleinseins klagte. Ihrer Schönheit kam nur ihr Hunger nach Liebe gleich, sie litt unter dem Schicksal, wochenlang ohne Mann ausharren zu müssen.
»Ich hoffe nur, dass dein Mann und ich einander nie in die Quere kommen.«
»Oh, das hoffe ich auch.«
»Wir müssen weiterhin vorsichtig sein.«
»Du bist doch Polizist! Du weißt doch, wie Einbrecher unbemerkt in Häuser einsteigen können. Nutze deine Kenntnisse.«
»Glaubst du, er würde mich erschießen?«
»Eher mit dem Säbel durchbohren. Oder dir den Schädel abschlagen.«
»Was für reizvolle Aussichten.«
Fedora löste sich von Bruno. »Wie gesagt, es ist besser, wenn er nichts von dir weiß.«
Bruno griff nach dem Bücherpaket. »Allerdings.«
»Kommst du am Donnerstag?«
»Wie üblich nach Einbruch der Dunkelheit?«
»Ja. Sobald die Buben schlafen.«
»Was werden wir tun, wenn sie keine Kinder mehr sind, wenn sie dereinst forsche Knaben sind und nicht mehr bei Sonnenuntergang tief und fest schlafen?«
»Das werden wir sehen, wenn es so weit ist.«
»Und wann kommt dein Mann zurück?«
»Am nächsten Samstag.«
»Also wieder der Dampfer aus Bombay?«
»Das habe ich dir doch gesagt.«
»Tut mir leid, ich komme mit der Zeit da ein wenig durcheinander. Bombay, Schanghai, Yokohama, er ist viel unterwegs. Und zu meinem Glück auf den Fernlinien.«
Fedora schreckte hoch. Auch Bruno hatte es gehört. Das Rufen eines Kindes. Noch in einiger Entfernung, aber unüberhörbar. Fedora eilte zum Vorderfenster und schaute zur Straße hin. Bruno stand hinter ihr.
»Verflixt! Meine Schwiegermutter mit den Buben.«
»Du hast gesagt, sie würden erst abends kommen.«
»Meine Schwiegermutter ist unberechenbar. Sie stattet mir immer wieder Kontrollbesuche ab und schnüffelt hinter mir her. Diese Hexe. Du musst sofort verschwinden!«
»Vielleicht nehme ich sie demnächst in polizeilichen Gewahrsam. Zweimonatige Verwahrungshaft.«
Fedora bugsierte Bruno zum hinteren Fenster. »Ciao, Bruno. Bis bald.« Fedora küsste ihn kurz, aber leidenschaftlich.
»Ciao.« Behände kletterte er aus dem Fenster, schaute sich um und verschwand im Wald hinter dem Haus. Das Bücherpaket unter dem Arm.
*
Fauchend und stampfend zog die Lokomotive die Waggons in den Triester Südbahnhof. Viele Fahrgäste hielten ihre Nasen in den Fahrtwind, um die ersten Eindrücke der Stadt aufzuschnappen. Auf dem Perron standen zahlreiche Menschen und blickten dem einfahrenden Zug entgegen. Hüte wurden geschwenkt. Auch Carolina beugte sich aus dem Fenster. Noch stand die Sonne am Himmel, dennoch war der heranziehende Abend mehr als fühlbar. Die Luft war kühl. Die Bremsen quietschten und der Zug kam zum Stillstand. Sie entdeckte Rudolf in der Menge und winkte ihm. Der Fahrer des Grafen entdeckte sie ebenfalls, winkte und eilte los. Carolina schloss das Fenster. »Rudolf kommt schon.«
»Das will ich auch hoffen.«
»Ich helfe dir mit den Koffern.«
»Lass nur, ich schaffe das schon.«
Der Graf und seine Tochter reisten mit leichtem Gepäck. Maximilian von Urbanau griff nach seinen beiden Koffern und verließ das Coupé, Carolina nahm ihren ebenfalls und den Korb. Auf dem Perron stand bereits Rudolf, der das Gepäck entgegennahm, es auf einen Handwagen hob und Carolina beim Aussteigen half. Der Fahrer des Grafen war mit dem Automobil vor zwei Tagen angekommen. Da die Thalia erst in drei Tagen ablegte, wollte der Graf diese Zeit nutzen, um das Triester Hinterland zu erkunden. Also war der Wagen auf einen offenen Güterwaggon verladen und nach Triest transportiert worden. Rudolf hatte nicht in der dritten Klasse reisen müssen, für die Bahnfahrt hatte er selbstredend eine Fahrkarte zweiter Klasse erhalten. Der Graf ließ sich niemals lumpen und seinen treuen Dienstboten fehlte es an nichts.
»Wo steht der Wagen?«
»Direkt vor dem Bahnhof, Euer Gnaden.«
»Worauf warten wir dann noch?«
Der Graf bot seiner Tochter den Arm, sie hakte sich ein. Rudolf folgte ihnen mit dem Handwagen. So bahnten sie sich den Weg durch das Gewühl. Carolina ließ ihren Blick streifen. So viele Menschen! Sie fühlte sich großartig. Endlich Triest, endlich der große Hafen der Monarchie, Österreich-Ungarns Tor zur weiten Welt. Sie freute sich auf das Schiff und das Meer. In der Menge entdeckte sie ein Augenpaar, das sie unumwunden im Blick hielt. Eine heiße Woge durchflutete sie.
»Bist du aufgeregt?«
Sie wandte sich schnell ihrem Vater zu. »Oh ja, sehr. Triest ist eine so wundervolle Stadt.«
Sie traten vor das Gebäude des Südbahnhofes. Kutschen, Fuhrwerke, Automobile, die elektrische Straßenbahn, ungezählte Menschen eilten von hier nach dort. Rudolf stellte den Handwagen ab und öffnete dem Grafen und der Komtess die Wagentür, dann verstaute er das Gepäck. Morgen früh würde er die Überseekoffer vom Bahnhof abholen, das eigentliche Reisegepäck des Grafen kam im Postwaggon des Nachtzuges. An Bord der Thalia waren zwei Luxuskabinen reserviert, sodass genug Platz für angemessene Garderobe vorhanden war. Die Direktion des Österreichischen Lloyd hatte dem Grafen auf seine briefliche Anfrage höflich mitgeteilt, dass die Mitnahme von eigenen Möbelstücken aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und wegen der bestehenden exquisiten Einrichtung der Kabinen auch gar nicht nötig war, also hatte Maximilian von Urbanau auf weiteres Gepäck verzichtet und sich auf die Garderobe, bestimmte Dokumente, Bücher und Materialien für seinen Aufenthalt auf dem Schiff beschränkt. Selbstverständlich würde er auch Waffen an Bord nehmen, seinen Revolver trug er ohnedies stets bei sich, in den Überseekoffern waren weiter ein Jagdgewehr samt der entsprechenden Munition verstaut, sowie ein Säbel und ein Knicker, sein altes Jagdmesser mit Griff aus kunstvoll bearbeitetem Hirschhorn. Als ehemaliger Offizier und Attaché des Kriegsministeriums musste er auch im Ruhestand stets für den Ernstfall vorbereitet und gerüstet sein.
Das Automobil fuhr los. Ziel war das Grand Hotel Duchi d’Aosta auf der Piazza Grande. Carolina schaute aus dem Wagen hinter sich zum Bahnhof. Wo war das Augenpaar?
*
»Signor Zabini, kommen Sie gar nicht ohne uns aus?«
Bruno schloss die Kanzleitür hinter sich und verneigte sich galant. »Werte Ivana, ein Tag ohne Sie ist ein verlorener Tag.«
»Ich glaube eher, dass Sie ohne Arbeit nicht leben können.«
»Wieder durchschaut, obwohl ich mir Mühe gegeben habe. Ich habe immer gewusst, dass Sie ein erstklassiger Inspector wären.«
Die pausbäckige Frau lachte. Ohne Ivana Zupan würde die Kanzlei des Triester k.k. Polizeiagenteninstituts in heillosem Durcheinander versinken. Die Herren Kriminalbeamten gingen ein und aus, hatten Hunderte Dinge zu tun, waren von Aufträgen, Investigationen und Fahndungen in Beschlag genommen, kratzten eifrig mit den Füllfedern und qualmenden Zigaretten im Mundwinkel auf ihre Papiere und hatten sonst wenig Zeit und Muße, um in der Kanzlei für Ordnung zu sorgen. Das war nun Frau Ivanas Domäne. Sie wusste immer, wo welche Akten lagen, welche Termine anstanden und wer zu Vernehmungen vorgeladen war. Außerdem kochte sie Kaffee für die Herren und brachte deren oft in schlampigem Triestiner Dialekt geschriebenen Notizen in orthografisch einwandfreies Hochitalienisch. Ihre Muttersprache war Slowenisch, sie sprach gut Deutsch und Triestinisch, aber da sie in jungen Jahren als gelehrige Dienstbotin eines Florentiner Professors Dienst verrichtet hatte, beherrschte sie exzellentes Toskanisch in Wort und Schrift. Das Toskanische hatte sich als Hochsprache des Italienischen durchgesetzt, so war es gerade für sie als Slowenin ein enormer Vorteil, sich in den Varianten Toskanisch und Triestinisch ausdrücken zu können. Ivana war vor über zwölf Jahren von der Polizeidirektion als Schreibkraft eingestellt worden und hatte sich in dieser Zeit als tragende Säule des Instituts bewährt. Nur wenn sie umfassende Berichte oder längere Briefe in Deutsch schreiben musste, holte sich Ivana bei Bruno Anleitungen für gute Formulierungen.
»Wollen Sie eine Tasse Kaffee?«
Bruno winkte ab. »Jetzt nicht. Ich muss nur noch einen Bericht fertigstellen, dann gehe ich wieder. Schließlich ist heute mein freier Tag, und später bin ich zum Billard mit Ingenieur Ventura verabredet.«
»Ich habe auch eine Verabredung«, sagte Ivana.
Bruno hielt im Vorbeigehen inne und schaute Ivana mit großen Augen an. »Etwa ein Rendezvous?«
Ivana zwinkerte kokett. »Allerdings.«
»Ivana, ich bin sprachlos!«
»Das hätten Sie mir nicht zugetraut, oder?«
»Was schlummerte da lange in Ihnen und kommt nun zum Vorschein?«
»Abgründe.«
»Rapportieren Sie detailliert!«, forderte Bruno.
»Also, zuerst habe ich ein Rendezvous mit dem leeren Magen meines Göttergatten, hernach mit der Schmutzwäsche meiner Kinder und final mit den Rückenschmerzen meines Vaters.«
»Was sagt Ihr werter Herr Papa zum Franzbranntwein, den Vinzenz aus Kärnten mitgebracht hat?«
»Er ist von der schmerzlindernden Wirkung begeistert. Aber der alte Teufel will mit dem Branntwein nicht nur eingerieben werden, er will ihn auch trinken.«
»Bleiben Sie standhaft, Ivana, verwahren Sie die Flaschen gut. Wer Franzbranntwein trinkt, brennt sich die Seele aus dem Leib.«
Ivana winkte ab. »Da würde nicht viel verbrennen.«
Bruno lachte, verließ Ivanas Bureau und trat auf den Gang der Kanzlei. Am Ende des Ganges stand beim offenen Fenster sein junger Kollege Luigi Bosovich und schaute rauchend und an einer Kaffeetasse nippend aus dem Fenster. Luigi hörte hinter sich die Tür und wandte sich um. Luigi blickte verwundert. »Signor Zabini, Sie, heute hier?«
Bruno schaute sich um. Die Türen der Bureaus seiner Kollegen waren geschlossen. Er trat an Luigi heran. »Ausnahmsweise, weil ich sowieso unterwegs in die Altstadt bin.«
»Zum Billard?«
»Ja. In anderthalb Stunden geht es los. Da kann ich genauso gut den Bericht über diese Wirtshausrauferei abschließen.«
»Nun denn.«
Bruno sperrte die Tür auf und drückte die Türklinke nach unten, hielt aber noch inne und musterte Luigi. »Und du, Luigi, du machst eine Pause?«
Den süffisanten Tonfall in der Stimme des höherrangigen Beamten überhörte der junge Polizist geflissentlich. Alle im Institut wussten, dass Luigi Bosovich nur dann arbeitete, wenn man ihn nicht nur anspornte, sondern richtiggehend antrieb. In der Regel schaute Luigi gerne zum Fenster hinaus, trank beispiellos langsam Kaffee oder machte Rauchpausen. Wenn er aber arbeitete, dann saß jeder Handgriff, dann vergaß er selbst winzige Kleinigkeiten nicht, dann zeigte er, dass er ein ausgezeichneter Polizist war. Oder zumindest sein könnte. Als jüngster Beamter war er im Rang des Polizeiagenten II. Klasse und in der Regel für die ungeliebte Alltagsarbeit zuständig. Die meist sehr träge vorankam.
»Ja, Herr Inspector, Rauch- und Kaffeepause.«
Bruno schmunzelte. »Weitermachen.« Damit verschwand er in seinem Bureau. Vinzenz Jaunig und Luigi Bosovich teilten sich das kleinere Bureau, im größeren standen die Schreibtische der vier weiteren Polizeiagenten. Bruno und Emilio Pittoni hatten jeweils eigene Bureaus. Die beiden waren als Inspectoren I. Klasse die ranghöchsten Kriminalbeamten im k.k. Polizeiagenteninstitut und in der Befehlskette nur dem Leiter der Dienststelle Oberinspector Gellner unterstellt.
Bruno hängte sein Sakko an den Kleiderhaken und setzte sich an seinen Schreibtisch. Wie zumeist stand die Tür zu seinem Bureau offen. Nur wenn er vertrauliche Gespräche führte oder sich bei seiner Arbeit konzentrieren musste, schloss er diese. Geschlossene Türen waren ihm immer irgendwie unangenehm, geschlossene Türen erinnerten ihn an seine Kindheit, als er auf Geheiß seines Vaters endlose Zeiten in seinem verschlossenen Zimmer hatte ausharren müssen. Seit acht Jahren war Salvatore Zabini nun schon tot, dennoch hörte Bruno nach wie vor die Stimme seines Vaters, sah seine Miene vor sich und folgte seinen strengen Anweisungen. Sein Vater hatte gewollt, dass Bruno die Laufbahn als Polizist einschlug. Nein, er hatte es nicht nur gewollt, er hatte es verfügt. Also war Bruno nach der Schule und dem Militärdienst zur Polizei gegangen. Jetzt, im Alter von siebenunddreißig Jahren, verfügte er über mannigfache Erfahrungen in seinem Beruf.
Bruno zog ein Formular aus der Schublade, blätterte sein Notizbuch auf und begann, die notierten Daten und Fakten des gestrigen Einsatzes zu protokollieren. Fünf griechische Matrosen und sieben Triestiner Hafenarbeiter waren in den Wirbel involviert gewesen. Ein Grieche war verstorben, mehrere griechische Matrosen und Triester Hafenarbeiter hatten mit erheblichen Verletzungen in das Hospital eingeliefert werden müssen, achtzehn Biergläser, fünf Teller, zwei Stühle und eine Fensterscheibe waren zu Bruch gegangen. Fein säuberlich vermerkte Bruno die erhobenen Fakten. Die Untersuchungsrichter kannten und schätzten Brunos Arbeit. Kein Polizist in Triest, so hatte es der Leiter des Oberlandesgerichts Hofrat Dr. Schremser einmal dem Statthalter seiner Majestät gegenüber formuliert, würde so taugliche, gründliche und im Gerichtsverfahren so belastbare Sachverhaltsdarstellungen erstellen wie Inspector Zabini. Nur wenige Wochen nach dieser Aussage war Bruno befördert worden.
Für Bruno selbst machte die Präzision erst den Reiz der Arbeit aus. Ganz so, wie er es von Professor Hans Gross gelernt hatte. Gerne dachte Bruno an die Zeit in Graz zurück. Zwei Semester hatte er bei Professor Gross studiert und war in das systematische Handwerk der Kriminalistik und in die wissenschaftliche Disziplin der Kriminologie eingeschult worden. Erst als er bei Professor Gross zur Lehre gegangen war, hatte er sich mit der Berufswahl seines Vaters ausgesöhnt. In jungen Jahren hatte er Ingenieur, technischer Wissenschaftler oder Konstrukteur werden wollen, seine ganze Faszination hatte der Naturwissenschaft und der sich rasend schnell entwickelnden Technik gehört. Als Jugendlicher waren seine größten Helden nicht etwa die Kriegsherren Napoleon, Prinz Eugen oder Admiral Tegetthoff gewesen, sondern der Erfinder der Schiffsschraube Josef Ressel und der Erbauer der Semmeringbahn Carl Ritter von Ghega. Die ersten Jahre als Polizist hatte er sich wie an einem falschen Ort gefühlt, geradezu wie in einem falschen Leben. Erst als er verstanden hatte, dass die Polizeiarbeit der Gegenwart immer tiefer in die Erkenntnisse der Wissenschaft tauchen musste, war er innerlich zum Polizisten geworden. Die Beförderungen waren danach wie von allein gekommen.
Salvatore Zabini wäre stolz auf die bisherige Laufbahn seines Sohnes gewesen.
*
Max von Urbanau tupfte mit der Serviette seine Lippen und atmete behaglich durch. Auch Carolina beendete das Dîner. Der Graf nickte dem diskret im Hintergrund stehenden Oberkellner zu, der sofort heraneilte.
»Haben Euer Gnaden wohl gespeist?«
»Wohl, wohl, mit besten Empfehlungen an den Küchenchef.«
»Herzlichen Dank, Euer Gnaden.« Damit servierten der Oberkellner und ein Piccolo die Teller ab. »Belieben Euer Gnaden einen Kaffee als Abschluss des Dîners zu nehmen?«
Max von Urbanau winkte ab. »Vielleicht später im Rauchsalon. Carolina, willst du eine Schale Kaffee?«
»Vielen Dank, so spät am Tag trinke ich nie Kaffee. Sonst kann ich nicht einschlafen.«
Damit zog sich der Oberkellner mit einer Verbeugung zurück.
»Meiner Seel, die Makrele war delikat. Hat dir das Dîner gemundet?«
»Oh ja, Papa, sehr gut.«
»Wenn ich schon ans Meer fahre, dann will ich auch Fisch essen.«
»Leicht und bekömmlich. Aber, Papa …«
»Ja?«
»Du sollst doch nicht rauchen.«
»Sieht mich hier irgendjemand rauchen?«
»Du hast eben vom Kaffee im Rauchsalon gesprochen.«
»Der Rauchsalon ist ein Ort für Herren. Da haben naseweise Fräuleins nichts zu suchen.«
»Aber Dr. Röthelstein hat doch …«
»Dr. Röthelstein ist ein Esel und hat mir gar nichts vorzuschreiben. Ebenso wenig wie du!«
Für ein Weilchen saßen der Graf und seine Tochter schweigend bei Tisch. Max von Urbanau bemerkte, wie Carolina wiederholt zum Fenster schaute. Er schmunzelte. »Willst du nicht ein paar Schritte am Hafen machen?«
Carolina blickte hocherfreut hoch. »Darf ich, Papa?«
»Ich habe doch längst bemerkt, dass du es hier im Speisesaal gar nicht aushältst.«
»Oh ja, ich würde so gerne rausgehen und den Hafen erkunden.«
Der Graf schaute auf seine Taschenuhr. Es war halb sieben Uhr. »Denk daran, vormittags unternehmen wir eine Autofahrt nach Duino. Ich muss der Gräfin meine Aufwartung machen, schließlich hat sie mir, als sie erfahren hat, dass ich nach Triest reise, drei Briefe geschrieben. Sie erwartet uns um zehn Uhr Vormittag. Außerdem will ich die Steilküste sehen. Also, liebe Carolina, geh los. Um acht erwarte ich dich zurück.«
»Vielen Dank, Papa.« Damit eilte sie hinaus.
Der Graf erhob sich mühsam und wurde vom Oberkellner in den Rauchsalon geleitet und mit Kaffee, einem Cognac sowie einer Zigarre versorgt. Genüsslich umgab sich der Graf mit dem Duft von erstklassigem Kaffee und der Rauchwolke einer dicken Havanna, auch der Cognac mundete vorzüglich. Ein Mann trat durch den Rauch auf den Ohrenstuhl des Grafen zu.
»Entschuldigt bitte die Inkommodität, Euer Gnaden. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Giovanni Pasqualini, ich bin Teilhaber und Geschäftsführer der Azienda Commerciale di Porto Nuovo. Die Firma ist spezialisiert auf den Seehandel mit der Levante. Hier ist meine Karte.«
Max von Urbanau warf einen musternden Blick auf den Mann mittleren Alters. Sein Anzug saß tadellos, die Schuhe waren poliert, der Bart akkurat gestutzt, sein Deutsch ganz passabel. Immerhin wurde in diesem Hotel auf angemessene Erscheinung und passende Umgangsformen Wert gelegt. Der Graf verzog seinen Mund und nahm die Karte. »Also, was will er?«
»Wenn Euer Gnaden gestatten, wäre es mir eine Ehre, mit Euch in geschäftlicher Angelegenheit zu sprechen.«
»Für geschäftliche Angelegenheiten wenden Sie sich an meine Advokaturkanzlei in Graz.«
»Leider hat ganz Triest erst heute erfahren, dass Euer Gnaden unsere Stadt mit einem Besuch beehrt, sodass sich keine Gelegenheit ergeben hat, einen Termin mit Eurem avvocato telegraphisch zu vereinbaren.«
»Ich reise privat, da muss nicht die halbe Welt wissen, wo ich bin.«
»Vielleicht erlauben Euer Gnaden dennoch, dass ich Euch mit den Möglichkeiten für gewisse geschäftliche Aktivitäten in unserer bescheidenen Stadt in allgemeinen Zügen vertraut mache?«
Der devote Tonfall und die unterwürfige Gestik des Geschäftsmannes stimmten den Grafen milde, er las den Namen von der Visitenkarte. »Herr Pasqualini, schätzen Sie Zigarren und Cognac?«
»Außerordentlich, Euer Gnaden.«
»Gut, dann setze er sich und leiste er mir Gesellschaft. Und tu er nicht halsbrecherisch tiefstapeln, Herr Pasqualini, weil wenn in der Monarchie die Geschäfte gut geölt laufen, dann bestimmt hier an der oberen Adria. Also, ich bin ganz Ohr.«
*
Der Tod war ein einträgliches Geschäft.
Wenn man sich darauf verstand.
Man musste sich als Mensch dem Tod zur Gänze verschreiben, man musste den Tod jederzeit willkommen heißen, ihn mit größtmöglicher Gastfreundschaft bewirten und immerzu bereit sein, ihm den geforderten Tribut zu zollen. Denn ein so verlässlich wiederkehrender Gast der Tod auch sein mochte, er kam nie umsonst und er forderte unausweichlich seinen Lohn. Diesen hatte man zu bezahlen. Erst dann konnte man als Mensch auch an diesem Geschäft teilhaben und einen Teil des Profits einstreichen. Der Tod musste mit dem Leben bezahlt werden, das war allen klar.
Das Töten war ein lukratives Geschäft.
Wenn man sich darauf verstand.
Die Kunst war, dem Tod nicht das eigene Leben zu überantworten, sondern ein anderes. Kunst konnte brotlos sein, praktiziert von Hungerleidern, Traumtänzern und Verrückten. Kunst konnte aber auch zu Ruhm, Anerkennung und Reichtum führen, wenn sie von Meistern, Virtuosen und Genies praktiziert wurde. Hierin sah er sein Metier.
Der Mann bewegte sich einem Schatten gleich durch die engen Gassen der Altstadt. Er verschwand hinter einer Ecke, trat durch eine versteckte Tür und huschte eine dunkle Treppe hoch. In jeder Stadt konnte man diskrete Zimmer in unscheinbaren Häusern mieten, man musste nur wissen, mit wem man zu sprechen und wie viel man für Diskretion zu bezahlen hatte.
Er hatte alles genau gehört und eine Idee gehabt. Nun galt es, aus der Idee einen Plan zu schmieden. Er war gut in solchen Dingen.
Mord war sein Geschäft.
Weil er sich darauf verstand.
*
Carolina blickte zur roten Sonne am fernen Horizont und sah über das offene Meer. Wie schön! Eine lebhafte Brise schlug ihr entgegen, Wolken zogen schnell vom Meer auf das Land zu, reflektierten das Licht der tief stehenden Sonne und tauchten den gesamten Golf von Triest in glühend rote Abendstimmung. Was für ein großartiges Naturschauspiel. Sie stand am Ende des Molo San Carlo und war fast versucht, die Arme von sich zu strecken, wie eine Möwe die Brise einzufangen und mit wenigen Flügelschlägen weit hinaus aufs offene Meer zu fliegen. Sie war in Euphorie. So schmeckte die Freiheit! Der köstlichste Geschmack der Welt.
Wo war Friedrich?
Carolina wandte sich um und suchte im Gewühl. Auf der rechten Seite des Molo lagen die kleinen Lokaldampfer für den nahen Küstenverkehr, auf der linken Seite die Dampfer des Österreichischen Lloyd, die den adriatischen Schiffsdienst bestritten. Die bedeutendste Schifffahrtsgesellschaft der österreichisch-ungarischen Monarchie bediente nicht nur die Linien in der Adria, sondern dominierte auch den Schiffsverkehr in das östliche Mittelmeer und zum Schwarzen Meer, darüber hinaus verkehrten Überseedampfer auf den Eillinien von Triest nach Indien, China und Japan.
Eben stiegen die Fahrgäste des kleinen Dampfers Metcovich aus und füllten den Molo mit Leben. Wie Carolina sah, kehrte das Schiff von seiner Fahrt aus Venedig zurück. Dienstleute versuchten, das Gepäck der Reisenden zu ergattern, eine Gruppe von Hafenarbeitern machte sich bereit, die Fracht des Dampfers auf zwei bereitstehende Pferdefuhrwerke zu verladen. Die Matrosen an Bord brachten den Kran in Stellung, um die geladenen Holzkisten auf den Molo zu hieven. Rund drei Stunden dauerte die Überfahrt von Triest nach Venedig. Mehrere kleine Dampfer pendelten täglich zwischen den beiden großen Städten der oberen Adria und sorgten für rege wirtschaftliche und kulturelle Kontakte zwischen Österreich-Ungarn und Italien.
Carolina schob sich durch das Gedränge.
Sie schaute an der hohen Eisenwand des Dampfers Gisela empor, der morgen um acht Uhr in Richtung Cattaro ablegen und auf dem Hin- und Rückweg alle großen Hafenstädte der dalmatinischen Küste anlaufen würde. An Bord brannten viele Lichter, so manche Fahrgäste hatten sich schon eingeschifft und schauten von oben herab auf das lebhafte Treiben. Zwei Kinder winkten Carolina. Sie erwiderte den Gruß.
Sie wandte sich ab und suchte wieder nach Friedrich. Da! Zwei Augen blitzten aus der Menge hervor. Sie eilte los, Friedrich griff nach ihren Händen und zog Carolina an sich.
»Da bist du ja endlich!«
»Friedrich, was für eine Freude!«
Eine ganze Weile stand das junge Paar beisammen und bemerkte nichts von all der Geschäftigkeit und dem Trubel um sie herum. Erst als ein Dienstmann seinen Gepäckkarren rumpelnd auf sie zuschob und seine Stimme lebhaft erhob, brach der kurze Zauber des Beisammenseins. Friedrich schaute sich um.
»Lass uns ein Stück gehen«, schlug er vor und bot ihr seinen Arm an.
Carolina hakte sich bei ihm ein. Sie ließen den Molo hinter sich und gingen am Kai entlang. Zahlreiche Segelschiffe waren an der Kaimauer festgemacht, kleine einmastige Brazerra und etwas größere zweimastige Trabakel, die für den küstennahen Transportdienst und den Fischfang eingesetzt wurden. Möwen kreisten in der Luft und Nebelkrähen belagerten sorgsam spähend die Kaimauer.
»Ist dein Vater im Hotel?«
»Ja. Er hat sich in den Rauchsalon zurückgezogen.«
»Wann musst du zurück sein?«
»Um acht Uhr.«
»Wir haben also mehr als eine Stunde für uns! Wie schön.«
»Hast du eine Herberge gefunden?«
»Ja. Ein kleines Haus beim Bahnhof. Das Zimmer ist sehr schlicht, aber still, das Fenster liegt auf der Hofseite. So ist es angenehm. Eine angemessene Unterkunft für ein paar Heller.«
»Du bist so bescheiden.«
»Wer so wie ich von und für die Kunst und die Liebe lebt, braucht nicht viel Geld.«
Carolina kicherte. »Du lebst also für die Liebe.«
»Natürlich! Die Liebe ist eine Schicksalsmacht und beseelt den Menschen, entflammt den Geist und lässt die Herzen pochen. Mein Herz, geliebte Carolina, gehört dir allein.«
»Du bist ein Poet!«
»Und du bist meine Muse«, rief Friedrich theatralisch und hielt an. Er nahm Carolina in den Blick. »Wann können wir endlich beisammen sein? Wann können wir heiraten? Wann können wir Mann und Frau sein, so wie Gott uns schuf und die Natur es von uns verlangt?«
»Du weißt doch, dass das nicht möglich ist.«
»Wann wirst du deinem Vater von unserer Liebe berichten?«
»Noch nicht.«
»Ich will es herausschreien, ich will es in allen Zeitungen annoncieren, ich will es auf Plakate drucken und diese auf allen Litfaßsäulen der Monarchie affichieren, dass ich, Friedrich Grüner, dich, Carolina von Urbanau, liebe und dich immer lieben werde.«
Carolina schaute sich betreten um. »Bitte nicht so laut. Lass uns weitergehen.«
Ein Weilchen gingen sie eingehakt am Kai entlang.
»Morgen früh will mein Vater mit dem Automobil nach Duino fahren. Die Gräfin erwartet unseren Besuch. Abends können wir uns wieder treffen.«
»Ich werde auf dich warten.«
»Hast du genug Geld?«
»Ich brauche nicht viel.«
»Ich kann dir welches geben.«
Friedrich kaute auf seiner Unterlippe. »Ich bin so beschämt, dass ich so arm bin. Ein bettelarmer Schauspieler und Dichter, ich besitze nichts als einen alten Gehrock und ein Paar Schuhe. Und du bist die Tochter eines unermesslich reichen Grafen. Wie kann unsere Liebe in einer verkehrten und verrückten Welt wie dieser nur Bestand haben?«
»Bist du verzweifelt?«
»Ja. Es zerreißt mir die Brust.«
»Aber wir sind doch beisammen.«
»Ich weiß nicht, wie ich es überstehen soll, fast einen Monat mit dir auf hoher See zu sein und dich immer nur aus der Ferne sehen zu können. Was hast du dir nur dabei gedacht, mich dieser Tortur auszusetzen?«
Jetzt hielt Carolina inne, sie blickte erschrocken zu Friedrich hoch. »Bitte lass mich nicht allein auf dieses Schiff steigen. Bitte! Ich brauche dich. Und wenn wir uns nur heimlich treffen und nur wenige Worte wechseln können, so ist dies doch das einzige Glück, das ich für diese Schifffahrt erhoffen kann.«
»Keine Sorge, geliebte Carolina, ich werde mit dir und doch fern von dir an Bord gehen. Ich bin bereit, das Äußerste für dich zu tun. Du hast die Schiffskarte nicht umsonst für mich gekauft.«
»Aber du hast die Karte doch selbst gekauft.«
»Mit deinem Geld.«
»Lass uns nicht vom schnöden Geld sprechen. Das deprimiert mich.«
Schlagartig hellte sich Friedrichs Miene auf. Das war es, was Carolina so an ihm liebte, er trug eine unendliche Heiterkeit in sich. Er konnte aus dem tiefsten Unglück heraus von einem Moment auf den anderen mit nur einem Lachen auf den Lippen der fröhlichste Mensch der Welt werden. Friedrich war ein Wunder. Er wies mit großer Geste um sich.
»Diese Stadt, liebe Carolina, die ich seit meiner gestrigen Ankunft kennengelernt habe, ist ein Wunder der Menschheit, ein Ort der Hoffnung und Zuversicht. Allein welche verschiedenen Sprachen ich an diesem einen Tag meiner Anwesenheit hier schon gehört habe, füllt ganze Lexika. Italienisch, Slowenisch, Deutsch, Furlanisch, Kroatisch, Griechisch, Englisch, Türkisch und Arabisch. Triest ist ein Knotenpunkt der Kulturen, eine Welt für sich und gleichermaßen ein Leuchtturm der Zukunft. Ich liebe diese Stadt. Sieh nur all die vielen Menschen!«
Carolina ließ sich von seiner Begeisterung mitreißen. Ja, auch sie war in den wenigen Stunden seit ihrer Ankunft von der Buntheit der großen Hafenstadt überwältigt. »Erzähl mir von deinen Erlebnissen.«
Die Abendsonne tauchte am Horizont in das Meer. Straßenlaternen erhellten den Kai mit Licht.
Das Automobil
Sein Zuhause war der Hof seiner Eltern. Da, wo er aufgewachsen war, inmitten der Kornfelder und Obstbäume. Egal wie viele Jahrzehnte schon ins Land gegangen waren, der Hof in der Nähe der Auwälder an der Mur würde immer seine Heimat bleiben. Sein älterer Bruder hatte den Hof übernommen. So bestimmte es die Tradition, der Ältere hatte das Vorrecht. Also war er schon in jungen Jahren von Zuhause fortgegangen, hatte in Graz eine Stelle in der Maschinenfabrik gefunden und sich lange Zeit als Arbeiter und Bettgeher durchgeschlagen. Er war aber nicht wie die anderen Burschen vom Land dem Alkohol verfallen, sondern hatte gelernt. Er war ein fähiger Schlosser geworden, einer, den seine Dienstherren gerne beschäftigt und selbst in der Krise nur ungern wieder entlassen hatten. Er hatte weiter gelernt und war in einer Autowerkstatt Mechaniker geworden. Das Instandhalten und Fahren von Automobilen war sein Lebensinhalt geworden. So hatte ihn schließlich der Graf für ein solides Gehalt als Fahrer eingestellt. Rudolf konnte sich wahrlich nicht beklagen, seit er das Automobil des Grafen wartete und fuhr, ging es ihm gut, hatte er ein bequemes Zimmer, reichlich zu essen und eine Werkstatt, über die er alleine verfügen konnte.
Am heimatlichen Hof hatte ihn stets der Hahn geweckt. Früh aufzustehen war für ihn nie ein Problem gewesen. Er hatte nie etwas anderes gekannt. Beim ersten Sonnenschein war er aus dem Bett und hatte sein Tagewerk begonnen. Heute aber weckte ihn nicht der Hahn. Rudolf wusste zuerst gar nicht, wie ihm geschah, wo er war, welches Tier so schreien konnte. Erst als er ans Fenster trat, erinnerte es sich. Er war am Meer, er war in einer Herberge nahe dem Hafen von Triest. Und das markerschütternde Geschrei stammte von einer Möwe. Rudolf öffnete das Fenster und schaute hinaus. Der große Vogel entdeckte ihn, schrie noch einmal und flog davon.
Der Morgen graute. Er musste los. Die Arbeit wartete auf ihn.
Wenig später startete er das Automobil und fuhr los. Auf den Straßen der fremden Stadt begann sich das Leben zu regen. Die ersten Händler öffneten ihre Läden, die Hafenarbeiter trotteten zielgerichtet durch die Gassen, zwei hübsche Wäscherinnen überquerten mit vollgepackten Körben die Straße und schauten bewundernd dem großen und vornehmen Automobil hinterher. Der Graf hatte einen Wagen der Wiener Automobilfabrik Gräf & Stift gekauft, der Wagen war nagelneu, Baujahr 1906, sehr luxuriös und wahrscheinlich die beste Limousine, die man in der gesamten Monarchie kaufen konnte. Das Automobil hatte ein Vermögen gekostet und war der ganze Stolz des Herrn Grafen. Deshalb hatte er den Wagen auch an die obere Adria transportieren lassen. Und Rudolf durfte den Wagen fahren.
Der Bahnhof kam in Sicht. Der Nachtzug musste schon angekommen sein. Es dauerte ein Weilchen, bis Rudolf die richtige Laderampe fand, an der die Überseekoffer des Grafen bereitstanden. Mühsam wurden die drei großen schweren Koffer verladen. Zwei Männer der Bahnverwaltung halfen Rudolf beim Aufladen der wertvollen Fracht. Fast einen Monat würden der Herr Graf und die Komtess auf See sein. Er selbst würde einen Tag nach dem Ablegen des Dampfers den Heimweg nach Graz antreten.
Rudolf fuhr los, ließ den Bahnhof hinter sich. Der Graf hatte ihm die Verantwortung über die sichere Verwahrung der Koffer anvertraut. Bis das Gepäck auf die Thalia geladen werden konnten, würden sie in einem Magazin am Hafen gelagert werden. War es verstaut, würde Rudolf das Automobil für die Fahrt nach Duino vorbereiten. Er hatte schon während der Zugfahrt die Landkarte genau studiert und sich die Route eingeprägt. Der Graf würde nicht klagen können. Es war auch für Rudolf ein Abenteuer. Noch nie war er an das Meer gekommen.
Das Automobil rollte am Kai entlang, überholte einen Zug der elektrischen Straßenbahn. Am Kai standen einige Hafenarbeiter, die den großen Wagen anstarrten, drei junge Burschen winkten mit ihren Mützen und riefen Rudolf auf Italienisch Grüße zu.
Stolz packte Rudolf. Als er sich der Gruppe näherte, betätigte er die Hupe, winkte und trat auf das Gaspedal. Der hochdrehende Motor röhrte auf, die Hafenarbeiter johlten vor Vergnügen, der Wagen sauste schnell an ihnen vorbei. Rudolf genoss die rasante Fahrt am Kai.
Ein Ochsenkarren querte die Fahrbahn. Rudolf betätigte die Hupe. Aber der Ochsenkarren war viel zu langsam und schwerfällig, um rechtzeitig die Fahrbahn freizumachen. Rudolf packte den Bremshebel und zog kräftig daran. Er hörte ein Schnalzen. Der Bremshebel kippte nutzlos nach hinten. Rudolf schrie auf.
Das Bremsseil war gerissen! Das verstand er sofort. Das Automobil raste ungebremst auf den Ochsenkarren zu. Erschrocken hoben die beiden Tiere die Köpfe, der Lenker des Karrens schrie auf.
Rudolf hatte keine Zeit nachzudenken, er handelte sofort. Er umfasste das Lenkrad fest und lenkte zur Seite. Das rechte Vorderrad kam bis auf wenige Zentimeter an den Rand der Kaimauer. Geschafft, er war nicht mit dem Ochsenkarren kollidiert. Er zog das Lenkrad nach links.
Zwei Männer direkt voraus! Sie rissen zu Tode erschrocken ihre Augen auf. Rudolf lenkte nach rechts. Der Wagen schlingerte. Das ausbrechende Heck warf die beiden Männer um. Das Automobil schwankte bedenklich. Nach Leibeskräften versuchte er, den Wagen zu stabilisieren.
Da, ein Poller vor ihm! Und dahinter gestapelte Holzkisten. Wieder riss er das Lenkrad herum. Das Automobil kippte. Der Aufprall schleuderte Rudolf vom Fahrersitz. Es ging so rasend schnell, er hatte gar keine Zeit zu schreien. Er sah die Holzkisten. Dann der Aufprall.
Dunkelheit legte sich um ihn. Völlige Finsternis.
*
Bruno wohnte nach wie vor im Haus seiner Eltern im Stadtteil Cologna, gemeinsam mit seiner Mutter. Einst hatte hier eine Bauernfamilie gelebt, die auf den Berghängen Hühner und Ziegen gehalten und einen kleinen Weingarten bewirtschaftet hatte. Für den Hausgebrauch hatten die Bauersleute Gemüsebeete bestellt. Salvatore Zabini hatte es als hochgestellter Beamter des Zollamtes zu einigem Wohlstand gebracht, und als die landwirtschaftlichen Flächen rund um Triest zusehends von den Wohnhäusern der sich ausbreitenden Stadt verbaut worden waren, hatte er seine Wohnung in der Città Vecchia veräußert und das Haus mit Garten in Cologna gekauft. Die Renovierung nahm einige Zeit in Anspruch. Bruno hatte gute Erinnerungen an die Sprache, Witze und Handgriffe der Bauarbeiter, die unter der strengen Aufsicht seines Vaters den Umbau durchgeführt hatten. Für ihn als Knaben war das eine aufregende Zeit gewesen. Die Arbeiter hatten ihn gemocht, weil er ihnen Wasser, Brot, Käse und Wurst gebracht, weil er ihnen genau zugesehen hatte und sich die Handhabe der Werkzeuge hatte beibringen lassen. Das hatte ihm viel Spaß bereitet und ihn schnell lernen lassen. Den Klang der furlanischen Sprache, der Sprache der Landbevölkerung aus dem Karst, hörte er dort zum ersten Mal, denn seine Eltern sprachen Italienisch und Deutsch.
Die ehemaligen Bauern hatten vom Verkaufserlöse ihrer Liegenschaft eine Wohnung im Borgo Giuseppino gekauft und einen Laden eröffnet, an dem Bruno immer wieder vorbeikam und Gemüse kaufte.
Das Haus verfügte über zwei Eingänge. Durch den Vordereingang betrat man die eigentlichen Wohnräume, die von Heidemarie Zabini bewohnt wurden. Der Hintereingang führte zum ehemaligen Stall, der beim Umbau zu einer kleinen Dienstbotenwohnung umgebaut worden war. Darin wohnte nun Bruno.
Der morgendliche Fußmarsch zur Polizeidirektion war Bruno ein lieb gewordenes Ritual. Mit ausgreifenden Schritten ging er vom Hang hinab in die Altstadt. Das k.k. Polizeiagenteninstitut nahm eine ganze Etage im Gebäude der Polizeidirektion ein. Wie in den anderen Ländern Cisleithaniens bildete das Polizeiagenteninstitut den nicht uniformierten Wachkörper und war unabhängig von den einzelnen Kommissariaten direkt dem Polizeidirektor unterstellt. Bruno betrat das Polizeigebäude, eilte die Treppe hoch und suchte das Wartezimmer der Kanzlei auf. Mehrere Personen saßen auf den Bänken und warteten. Die Menschen schauten allesamt hoch, als Bruno schwungvoll eintrat und grüßte. Er öffnete die Tür zu Ivanas Bureau. Diese war eben dabei, sich an ihren Arbeitsplatz zu setzen.
»Guten Morgen, Ivana.«
»Guten Morgen.«
»Gibt es Neuigkeiten von Belang?«
»Das Übliche. Kaffee?«
»Bitte ja, so wie immer.«
Er begrüßte die Polizeiagenten, die in ihrem Dienstzimmer arbeiteten. Kurz schaute er in das Bureau von Vinzenz und Luigi. Vinzenz Jaunig saß bereits an seinem Arbeitsplatz und sortierte Akten.
»Guten Morgen«, rief Bruno in Deutsch von der Tür aus.
Vinzenz hob den Blick und erwiderte den Gruß in seiner Muttersprache. Vinzenz war zehn Jahre älter als Bruno, er war vor fünfundzwanzig Jahren aus seiner Heimat Kärnten nach Triest gekommen und sprach fließend Italienisch, aber mit nach wie vor hartem Akzent. Der vierschrötige Mann war mit einer Italienerin verheiratet und Vater von vier Kindern. Sein ältester Sohn leistete eben den Militärdienst und strebte, wie sein Vater, die Laufbahn als Polizist an. Kräftige junge Männer mit einwandfreiem Leumund waren immer gesucht. Die Stadt wuchs und wuchs, da musste sich die Polizeibehörde rechtzeitig nach Blutauffrischung und Verstärkung umsehen.
Bruno zeigte auf Luigis leeren Schreibtisch. »Unser Jungspund schläft noch?«
Vinzenz zuckte mit den Schultern. »Du weißt ja, wie er ist.«
Bruno nickte und schaute zur geschlossenen Tür seines Vorgesetzten. Oberinspector Gellner erschien zumeist erst gegen halb neun in der Kanzlei, schwer vorstellbar, dass er am ersten Tag nach seinem Urlaub früher kommen würde. Auch Emilios Tür war geschlossen. Bruno sperrte die Tür zu seinem Bureau auf, trat ein und öffnete das Fenster. Das Wetter war hervorragend, sonnig, nur mäßig windig und nicht zu heiß. Ein guter Tag für die Arbeit. Er rückte den Stuhl zurecht und nahm am Schreibtisch Platz. Heute war er an der Reihe, sich die Vorträge der Bürger anzuhören. Auch diese Arbeit musste getan werden.
Ivana klopfte an die offen stehende Tür. »Ihr Kaffee.«
»Herzlichen Dank.«
Sie stellte die Tasse ab. »Soll ich die ersten schon vorlassen?«
»Ich brauche noch zehn Minuten. Ich gebe Ihnen Bescheid.«
»Ist recht, Signor Zabini.«
Damit verließ sie sein Bureau. Wohliger Kaffeeduft machte sich breit. Er nahm einen Schluck – köstlich wie immer – und hörte Schritte auf dem Gang. Die Schrittfolge, das Aufsetzen der Schuhe auf dem Parkett, Bruno erkannte daran seinen Kollegen.
Emilio Pittoni machte sich im Türstock breit. »Guten Morgen.«
»Guten Morgen«, erwiderte Bruno den Gruß.
»Du hast also den Bericht über die Rauferei schon geschrieben?«
»Ja.«
»An deinem freien Tag schreibst du Berichte?«
»Das hat sich so ergeben. Ich habe eine Stunde Zeit gehabt.«
Emilio verzog seinen Mund. »Was immer der Dienst befiehlt und die nächste Beförderung einbringt.«
Bruno regte seine Miene nicht. Es war ihm seit Langem klar, dass Emilio dem Zeitpunkt mit Argwohn entgegensah, an dem Bruno ihn in der Hierarchie überholen würde. Und es war auch klar, dass er kaum eine Gelegenheit ausließ, diesen Zeitpunkt hinauszuzögern. Sie waren Kollegen, sie waren Inspectoren I. Klasse, sie waren beide erfahrene Kriminalisten und arbeiteten gemeinsam, aber gute Kollegen oder gar Freunde waren sie nie geworden. Emilio konnte Bruno nicht ausstehen, weil er bei den Damen so beliebt war, weil er so fleißig arbeitete, weil er in Emilios Augen von Oberinspector Gellner bevorzugt wurde. Bruno hingegen misstraute Emilio, weil er seine definitiv vorhandene Intelligenz einsetzte, um mit fragwürdigen Methoden Fälle zu lösen.
»Wie du sagt, was immer der Dienst befiehlt.«
Die laute Stimme Gellners war aus Ivanas Bureau zu hören. Die beiden Inspectoren spitzten überrascht die Ohren. Sieh an, der Oberinspector war heute früher dran als sonst. Gellner lachte herzhaft. Offenbar hatte er aus dem Urlaub gute Stimmung mitgebracht. Die Beamten des k.k. Polizeiagenteninstituts hatten feine Ohren für die Stimmung des Herrn Oberinspectors entwickelt. Bei schlechter Stimmung ging man lieber nicht aus der Deckung, bei guter Stimmung konnte es in der Kanzlei mitunter fidel zugehen. Emilio warf Bruno noch einen nichtssagenden Blick zu und verschwand dann in sein Bureau. Gellner begab sich auf seine Runde, begrüßte seine Männer mit Handschlag, machte Witze und schien dem Wetter entsprechend bestens gelaunt. Gellner rief sie zu einer Besprechung in fünf Minuten zusammen. Die Bürger im Wartezimmer würden sich noch gedulden müssen.
Bruno verrichtete ein paar Handgriffe und trat kurz darauf auf den Gang. Eben huschte Luigi herein und warf Sakko und Hut auf seinen Schreibtisch. Zweifellos hatte Ivana ihn von der kurzfristig angesetzten Besprechung in Kenntnis gesetzt. Die Polizeiagenten brachten ihre Stühle aus den Dienstzimmern, betraten das geräumige Bureau des Oberinspectors und stellten die Stühle in einer Reihe vor dem wuchtigen Schreibtisch ab. Für die beiden Inspectoren standen zwei freie bereit.
Gellner verfolgte mit ernster Miene die Verrichtungen seiner Männer, holte Luft und machte eine einladende Handbewegung »Meine Herren, bitte setzen Sie sich.« Gellner wartete, bis sie saßen. Er fasste Luigi streng ins Auge. »Signor Bosovich, haben Sie es tatsächlich noch geschafft, zeitgerecht Ihren Dienst anzutreten?«
Luigi nickte kleinlaut. »Jawohl, Herr Oberinspector.«
»Ich vermisse Signor Materazzi.«
»Er ist dienstlich im Hafen unterwegs«, erklärte Vinzenz.
Gellner nickte. »Nun denn, meine Herren, ich bitte Sie, mir sorgfältig von den Geschehnissen in der Woche meiner Abwesenheit Bericht zu erstatten. Und fassen Sie die wesentlichen Inhalte Ihrer Tätigkeiten zusammen, auf dass es mir möglich ist, mir ein Bild von den Vorkommnissen zu machen.«
Gellners Sprechweise klang immer irgendwie gestelzt, ganz egal, ob er Deutsch oder das Triestiner Italienisch sprach. Vor sieben Jahren war er zum Leiter des k.k. Polizeiagenteninstituts ernannt worden. Alle im Raum wussten, dass er diese verantwortungsvolle Stelle wegen zweier Umstände erhalten hatte. Zum einen wegen seiner sehr guten Kenntnisse der italienischen Sprache, und zum anderen weil er als Deutschösterreicher ein Protegé des deutschösterreichischen Statthalters war. Gezielt hatte Prinz Hohenlohe seit seiner Ernennung durch den Kaiser Deutschösterreicher an die wichtigen Hebel der Macht und der staatlichen Sicherheit gehoben.
Doch bevor Gellner das Wort seinen Untergebenen überließ, erzählte er mit stolzgeschwellter Brust und in ausführlichen Worten von seinem Ausritt mit der Jagdgesellschaft des Baron Bruckheim in das Görzer Hinterland, von den geselligen Abenden beim Kartenspiel im Schloss des Herrn Baron, der großartigen Sammlung von historischen Büchsen des Herrn Baron und von den famosen Schusskünsten des Herrn Baron beim Taubenschießen. Die Kriminalbeamten lauschten regungslos dem Vortrag. Nichts anderes hatten sie erwartet.
Laute Stimmen vom Gang. Der Oberinspector hielt inne. Jemand klopfte an die Tür. Gellner warf seine Stirn in Falten.
»Herein!«
Ivana öffnete die Tür einen Spalt und steckte den Kopf herein. »Entschuldigen Sie die Störung, Herr Oberinspector, aber …«
»Frau Ivana, was in Herrgotts Namen ist denn so wichtig, dass Sie unsere Unterredung durch infernalisches Klopfen unterbrechen?«
Ivana öffnete die Tür zur Gänze und machte Platz. Polizeiagent Materazzi trat ein und nahm Haltung an. »Herr Oberinspector, es hat im Hafen einen schweren Unfall mit einem Automobil gegeben.«
»Einen Unfall?«
»Ja. Es gibt einen Toten.«
»Das ist sehr bedauerlich, Materazzi, und wir werden uns zu gegebener Zeit um die Sache kümmern. Aber jetzt setzen Sie sich, damit wir mit der Besprechung fortfahren können.«
»Herr Oberinspector, der Tote ist der Fahrer des Grafen Urbanau.«
Gellner hielt den Atem an. »Graf Urbanau ist in Triest?«
»Ja.«
»Ist der Graf beim Unfall verletzt worden?«
»Das nicht. Der Fahrer hat mit dem Automobil das Gepäck des Grafen transportiert.«
»Gott sei es gedankt! Ist der Graf am Hafen?«
»Nein. Der Graf logiert im Hotel Duchi d’Aosta. Wahrscheinlich weiß er noch gar nichts vom Vorfall. Ich bin vom Hafen auf direktem Weg hierher gelaufen, um Bericht zu erstatten.«
Gellner dachte kurz nach, klatschte auf den Tisch und katapultierte sich hoch. Er fasste den im Türstock stehenden Polizisten scharf ins Auge. »Materazzi, Sie haben recht gehandelt, sehr gut! Die Sache hat unmittelbare Priorität. Inspector Zabini, Inspector Pittoni, Sie beide begeben sich mit Signor Materazzi zum Hafen, inspizieren den Unfallort, sorgen für Ordnung und leiten unverzüglich die nötigen Schritte zur Klärung des Hergangs ein.«
*
»Wozu schleppst du deinen Koffer mit?«, fragte Emilio.
»Wir gehen zu einem Unfallort.«
»Eben, Unfallort, nicht Tatort.«
»Mein Koffer ist immer dabei.«
Emilio schüttelte zweifelnd den Kopf. »Wie du meinst. Schreib alles auf, miss die Zentimeter und notiere alle Gewichte.«
»Das werde ich tun.«
Emilio hatte den Sinn des Tatortkoffers noch nie verstanden. Für ihn war das unnötiger Ballast, eine Marotte, die sein Kollege Bruno von seiner Studienzeit in Graz mitgebracht hatte. Seit damals schleppte Bruno andauernd den Koffer mit sich. Für Emilio reichten ein Bleistift, ein Notizblock, ein scharfes Auge und sein exzellentes Gedächtnis.
Die Männer erreichten schnellen Schrittes die Rive. Die breite Uferstraße zwischen dem Porto Vecchio und der Città Vecchia war die Lebensader der Stadt. Eine kleine Rangierlokomotive mit vier beladenen Güterwaggons stand auf dem Gleis am Kai und kam wegen der Menschenmenge nicht voran. Die Linea delle Rive, die Rivabahn, am alten Hafen verband die beiden großen Triester Bahnhöfe, den Südbahnhof und den neuen Staatsbahnhof. Beide Lokführer und auf den Trittbrettern mitfahrende Bahnarbeiter schauten von ihrer erhöhten Position teils neugierig, teils wegen der Verzögerung entnervt zum Unfallort hinüber. Auch die Elektrische wurde an der Weiterfahrt behindert. Mehrere Pferdegespanne stauten sich. Das Leben im Hafen erwachte früh und war heute erheblich gestört worden.
»Zur Seite! Los! Tempo! Polizei! Los, zur Seite!«, riefen die drei Polizisten und bahnten sich einen Weg durch die Schaulustigen. Den beiden Inspectoren bot sich ein Bild der Verwüstung. Das stark beschädigte Automobil lag umgestürzt auf der Fahrbahn, ein Überseekoffer war aus dem Fahrzeug geschleudert worden und hatte sich geöffnet. Anzüge und Hemden des Herrn Grafen sowie dessen Säbel lagen auf dem Boden. Mehrere Polizisten mühten sich, die Gaffer zurückzudrängen.
Emilio zog seinen Revolver und hob ihn hoch, er drehte sich im Kreise und brüllte in die Menge: »Zurück jetzt, verdammt noch mal! Das ist eine polizeiliche Anordnung! Was ist das hier für ein Durcheinander? Zurück, sage ich!«
Die uniformierten Polizisten drängten vom scharfen Ton und der hochgestreckten Waffe des Herrn Inspector ermutigt die Schaulustigen zurück. Bruno schaute zu zwei auf dem Boden sitzenden Männern, die von drei Sanitätern umsorgt wurden, dann zum Arzt, der neben der Leiche kniete. Er ging auf die beiden verletzten Männer zu.
»Was ist mit ihnen?«, fragte er den ältesten Sanitäter.
»Sie wurden vom Wagen umgeworfen. Bevor er umgekippt ist.«
Bruno sah, dass einer der Hafenarbeiter mittlerweile am Kopf verbunden wurde, der zweite schien eine Verletzung am Unterarm zu haben, denn dieser war geschient und lag in einer Schlinge.
»Wie geht es euch?«, fragte Bruno die beiden.
»Mein Arm ist gebrochen.«
»Und du?«, fragte Bruno den zweiten Mann. »Bist du ansprechbar?«
»Ja, Herr Inspector. Eine Wunde am Kopf, aber nicht schlimm. Und ein paar blaue Flecken an den Armen. Wir haben Glück gehabt.«
Bruno notierte die Namen und Adressen der Männer und schickte sie mit den Sanitätern ins Hospital. Dann ging er auf den reglos am Boden liegenden Körper zu. Der Arzt erhob sich.
»Guten Morgen, Dottore.«
»Guten Morgen, Inspector.«
»Ist der Mann tot?«
Der Arzt erhob sich und stellte sich neben Bruno. »Ja. Genickbruch und schwere Kopfverletzungen. Er hat nicht lange gelitten.«
»Vielen Dank, dass Sie gleich kommen konnten, Dottore.«
»Selbstverständlich.«
Der Arzt packte seine Tasche, während Bruno seinen Koffer öffnete. Er fertigte eine Skizze der Situation an. Ein uniformierter Polizist trat neben ihn.
»Alle Zeugen sagen, dass das Automobil mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer wollte offensichtlich ein paar jungen Arbeiter imponieren, die ihm zugewinkt haben, deswegen hat er den Wagen beschleunigt.«
»Haben Sie mit den Arbeitern gesprochen?«
»Ja, und ich habe auch ihre Namen und Adressen«, sagte der Polizist und reichte Bruno einen Zettel.
»Sehr gut.«
»Das Automobil musste wegen eines Ochsenkarrens ausweichen, ist dabei ins Schleudern gekommen, hat die zwei Männer angefahren und ist dann hier umgekippt. Der Fahrer wurde mit voller Wucht vom Sitz gegen die Holzkisten geschleudert. Die Zeugen sagen, dass der Wagen nicht gebremst hat.«
»Nicht gebremst?«
»Das haben alle ausgesagt.«
Inzwischen hatte Emilio veranlasst, dass die persönlichen Gegenstände des Grafen wieder in den Koffer gepackt wurden, dass sich die Ansammlung auflöste und der Weg für die Straßenbahn freigemacht wurde. Der Güterzug musste weiterhin warten, da das Automobil quer über den Schienen lag.
Bruno trat an den Wagen heran und inspizierte ihn. Er griff nach dem Bremshebel. Er ließ sich widerstandslos hin und her bewegen.
»Die Bremse ist also kaputt«, sagte Emilio, der sich neben Bruno stellte.
»Eindeutig.«
»Was für ein Jammer! Sieh nur das Auto an. Ein Gräf & Stift, zerbeult und zerschrammt. Dieser Wagen kostet ein Vermögen. Wenn ich so viel Geld besitzen würde, um mir so ein Automobil kaufen zu können, wäre ich fein raus.«
Bruno schaute kurz seinen Kollegen an, dann blickte er zum Leichnam des Fahrers. »Ich werde mir die Bremse genauer ansehen.«