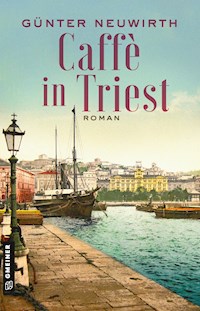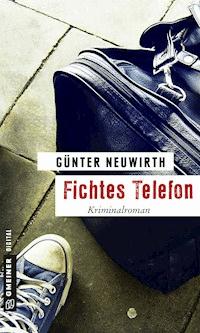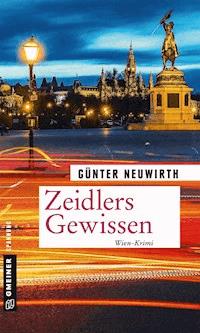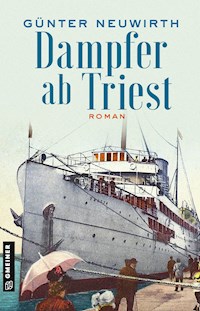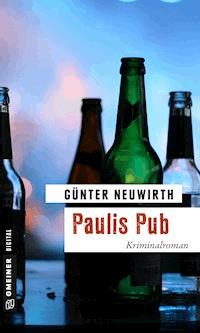Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Hoffmann
- Sprache: Deutsch
Die Wiener Drogenszene wird durch unreine Betäubungsmittel in Atem gehalten. Der Eventveranstalter Helmut Seifried und seine Partner waren zu gierig. Nach dem Fund eines Drogentoten stockt der Geldfluss der Dealer. Der vom Leben gezeichnete Inspektor Hoffmann ermittelt. Als eine weitere Tote gefunden wird, versucht er mit Unterstützung eines alten Gegners und neuen Verbündeten Seifrieds Machenschaften aufzudecken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Neuwirth
Hoffmanns Erwachen
Hoffmanns 3. Fall
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-digital.de
Gmeiner Digital
Ein Imprint der Gmeiner-Verlag GmbH
© 2016 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlagbild: © Bernd Vonau / photocase.de
Umschlaggestaltung: Simone Hölsch
ISBN 978-3-7349-9444-9
1. Szene
Der elende Vollmond.
Wolfgang Hoffmann schob die Decke zur Seite und hob sich mühsam aus dem Bett. In der Dunkelheit taumelte er zum Fenster und zog den Vorhang auf. Der Morgen war finster und kalt. Die Sonne würde sich bei diesem Novembernebel kaum zeigen. Wenn er am Vorabend eine Flasche Wein und ein paar Schnäpse getrunken hätte, wäre sein miserabler Zustand erklärbar. Hoffmann knipste das Licht an und schlurfte barfuß in die Küche. Er sah gar nicht das Durcheinander in seiner Wohnung, er blickte auch nicht auf die Uhr, er hatte nur ein Ziel. Kaffee, eine ganze Kanne voll mit heißem Kaffee. Während das heiße Wasser durch den Filter lief, zog er seinen Morgenmantel an. Der Duft des frisch aufgebrühten Kaffees erfüllte die Küche. Hoffmann blickte auf den Wandkalender. Tatsächlich lag eine Vollmondnacht hinter ihm.
Hoffmann öffnete den Kühlschrank und griff nach Milch, Butter, Käse und einem Glas Marmelade. Der Kühlschrank war gefüllt, denn gestern Abend hatte er auf dem Weg vom Büro nach Hause nicht wie häufig auf den Einkauf vergessen. Mit einem üppigen Frühstück würde er halbwegs in Schwung kommen. Kurzerhand schlug er zwei Eier in die Pfanne. Kaffee, Brot, Käse und Eier, Hoffmanns Stimmung besserte sich.
Er knipste das Radio an. Der Nachrichtensprecher sagte die Zeit durch. Fünf Uhr früh. Über Hoffmanns Gesicht huschte ein flüchtiges Lächeln. Heute könnte er seinem Bürokollegen, dem notorischen Frühaufsteher Gerhard Assmann, ohne Probleme den Rang als Erster am Arbeitsplatz ablaufen. Aber leider würde dieser Triumph ausfallen, denn heute Vormittag stand ein Termin beim Hausarzt an. Routinecheck, wie er der Ordinationsassistentin am Telefon angegeben hatte. Hoffmann lehnte sich zurück. Was sollte er an diesem Morgen anfangen? Der Termin war erst um neun Uhr, er hatte also vier Stunden Zeit. Verdammter Vollmond.
Wolfgang Hoffmann öffnete das Küchenfenster und lugte hinaus. Die Gasse lag in nächtlicher Beschaulichkeit und im Augarten, dem großen Barockpark inmitten von Wien, rührte sich auch noch nichts. Er fasste einen schnellen Entschluss. Er würde die frühe Morgenstunde nutzen, um seine Wohnung in Ordnung zu bringen. Hoffmann bekleidete sich. Wo sollte er anfangen? Der Mülleimer quoll über, und neben dem Mülleimer warteten zwei weitere Müllsäcke auf ihre Entsorgung. Also packte er die Müllsäcke, schlüpfte in seine Jacke, schnappte den Wohnungsschlüssel und trat auf den Flur. Im Stiegenhaus war es irgendwie unnatürlich ruhig. Er lauschte in die Stille. Nichts, keine Stimmen, keine über die Treppen hastenden Schritte, kein Autolärm von der Straße. Fünf Uhr früh war eine eigentümliche Zeit. Hoffmann schlich leise die Treppe hinab, bemüht, die Stille im Haus durch seine Anwesenheit nicht zu stören. Im Erdgeschoss öffnete er die Tür in den Innenhof, trat an den Müllcontainer und warf die drei Müllsäcke ein.
Wolfgang Hoffmann trat in die Mitte des kleinen Hofes und ließ den Blick kreisen. Rundum erhoben sich die Mauern der alten Häuser, in einigen wenigen Fenstern brannten schon oder noch immer Lichter, der Nebel war weniger dicht, als er zuvor gedacht hatte. Nun, der Herbst war praktisch vorbei, jetzt kam der dunkle und graue Winter in der Stadt. Nicht gerade Hoffmanns liebste Zeit im Jahr.
Er wandte sich zum Gehen. Im Vorbeistreifen entdeckte er die halb offenstehende Kellertür. Hatte wohl schon wieder jemand die Tür nicht abgeschlossen, obwohl die Hausverwaltung mehrmals Informationsblätter im Haus appliziert hatte, dass die Tür immer versperrt zu sein hatte. Angeblich wegen der Gefahr, dass sich Ratten im Kellergemäuer des alten Hauses ansiedeln könnten, aber Hoffmann wohnte lange genug in diesem Haus, um zu wissen, dass der wahre Grund die Obdachlosen waren, die hier eine Zeitlang immer wieder übernachtet hatten. Hoffmann hatte überhaupt keine Probleme damit, wenn Obdachlose im Keller schliefen, auch ihre Ausscheidungen im Hof störten ihn herzlich wenig, denn in Wahrheit war der ganze Bezirk ein großes Hundeklo, warum sich dann noch wegen ein paar Obdachloser aufregen? Dennoch zog er seine Schlüssel aus der Hosentasche und wollte die Tür schließen, schließlich musste er als Polizeibeamter mit gutem Beispiel vorangehen. Und so wie er seinen Beruf verstand, musste er dann ein gutes Beispiel sein, wenn niemand zusah.
Hoffmann öffnete die Tür und schaute in die Finsternis. Er knipste das Licht im Treppenabgang an. Da lag jemand am Fuße der Treppe. Unwillkürlich tastete er nach seiner Dienstwaffe, die er natürlich nicht dabei hatte.
»Hallo! Wer sind Sie?«
Ein Zucken durchlief die Person. Hoffmann schaute in zwei weit aufgerissene, dunkle Augen. Die junge Frau sprang hoch und drückte sich gegen die Kellerwand. Aus dem Nichts lag plötzlich Angst im Kellerabgang. Die schwarzhäutige Frau schaute hektisch nach links und rechts, sie begriff schnell, dass sie in der Falle saß, dass der einzige Fluchtweg über die Treppe nach oben führte und dass dieser Weg von einem fremden Mann in Hausschuhen versperrt war. Also verharrte sie in ihrer Position, umschlang ihre Schultern mit den Armen. Sie zitterte vor Kälte. Hoffmann war alarmiert. Wovor hatte die Frau solche Angst? Und wer hatte in dieses hübsche Gesicht geschlagen? Ihr linkes Auge war verschwollen und blutunterlaufen, der Faustschlag musste ziemlich heftig ausgefallen sein. Hoffmann musterte die junge Frau. Sie trug rosa Sportschuhe, enge Jeans und eine für diese Jahreszeit viel zu dünne Jacke mit auffälligen Glitzerstickereien. Höchst wahrscheinlich eine Prostituierte vom Praterstrich. Der Prater war zwar nicht allzu weit vom Augarten entfernt, aber normalerweise verirrten sich die afrikanischen Prostituierten kaum hierher, sondern blieben drüben beim Messegelände im Prater.
»Geht es Ihnen gut?«, fragte Hoffmann mit ruhiger, gemessener Stimme.
Allzu offensichtlich ging es der Frau nicht gut, anderenfalls hätte sie sich bestimmt nicht der Kälte und Finsternis des Kellers ausgesetzt. Hoffmann stieg eine Stufe tiefer.
»Sprechen Sie deutsch? Do you speak english?«
Sie starrte zu Boden und rührte sich nicht. Hoffmann fühlte deutlich, dass sie sehr erschöpft war, dass sie viel zu verzweifelt war, um davonzulaufen, dass sie Hilfe brauchte.
»Ist Ihnen kalt? Brauchen Sie etwas zum Anziehen? Eine Jacke? Oder einen warmen Pullover?«
Er wartete vergeblich auf eine Reaktion. Die junge Frau war völlig apathisch. Und sie schlotterte vor Kälte. Für Afrikaner war der Winter in Europa zuallererst mal ein Schock. Hoffmann setzte sich auf die kalte Treppe, er schaute sie nicht an, sondern starrte ebenfalls zu Boden.
»Wollen Sie fort? Ich halte Sie nicht auf«, sagte er nach einer ganzen Weile.
Schweigen. Hoffmann wartete. Er wusste eigentlich nicht viel über die Rotlichtszene im Prater, sein Fachgebiet war die Drogenfahndung und er arbeitete im Kommissariat West in Ottakring. Mit den Prostituierten aus der Leopoldstadt hatte er bisher nicht viel zu tun gehabt. Er wusste nur, dass es eine harte Szene war.
»Na gut, ich werde jetzt wieder gehen. Wenn Sie Hilfe brauchen, müssen Sie es sagen. Ich kann Ihnen eine Jacke geben. Oder etwas zu essen. Sind Sie hungrig?«
Hoffmann zog die Brauen hoch. Volltreffer. Erstmals eine Regung. Die dunkelhäutige Frau schaute ihn kurz an. Also war sie nicht nur durchfroren, sondern auch hungrig. Hoffmann erhob sich langsam.
»Mögen Sie Eier? Brot? Kaffee? Ein richtiges Frühstück?«
Sie trippelte auf der Stelle herum. Hoffmann sah, dass sie nur noch einen kleinen Schubs brauchte. Langsam ging er zu ihr hinunter. Sie beobachtete seine Bewegungen misstrauisch.
»Ich heiße Wolfgang«, sagte er und streckte seine Hand zum Gruß aus.
Nur zögerlich ergriff sie die dargebotene Hand. Ihr Händedruck war völlig kraftlos, klamm und kalt.
»Meine Güte, Sie sind ja völlig durchfroren. Kommen Sie, ich gebe Ihnen etwas zum Anziehen und mache ein ordentliches Frühstück. Einverstanden?«
Sie sagte nichts, bewegte sich nicht, zog auch die Hand nicht zurück, sondern verharrte verspannt und linkisch an Ort und Stelle. Ein geprügeltes Mädchen, geisterte es Hoffmann durch den Kopf. Hoffmann ließ ihre Hand los und zeigte einladend nach oben.
»Kommen Sie, wärmen Sie sich erst mal auf, dann sieht die Welt schon wieder viel freundlicher aus.«
Hoffmanns Temperament hatte ihm in ähnlichen Situationen schon mehrfach geholfen, besonnen, aufmerksam und höflich, aber doch bestimmt, hatte er im Laufe seiner Jahre als Kriminalpolizist so manche Verzweifelte, Vollgedröhnte oder Halbverrückte von irgendwelchen Dummheiten abhalten können. Aber eben nur manche, nicht alle. Ein Ruck lief durch die junge Frau. Hoffmann beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Würde sie davonlaufen? Er wusste es nicht, sie rang in jedem Fall mit dem Gedanken.
»Mögen Sie die Eier lieber gerührt oder als Spiegelei, schön gelb mit großen Dotteraugen?«
Sie blickte ihn direkt an. Ihr Blick war verstörend, denn Hoffmanns gar nicht schlechte Menschenkenntnis versagte vollständig. Er hatte keine Ahnung, was in dieser dunkelhäutigen Frau vorging. Sie nickte plötzlich. Erleichtert lächelte er sie breit an.
»Also doch lieber Spiegelei, nicht wahr?«
Ein bezauberndes Lächeln huschte verloren über ihr Gesicht. Wie hübsch sie war, wenn sich zumindest für einen flüchtigen Augenblick ein Lächeln zeigte.
»Na sehen Sie, alles gar nicht so schlimm. Jetzt kommen Sie erst mal und essen sich satt.«
Hoffmann ging voran die Treppe hoch, bewusst blickte er sich nicht mehr um. Wenn sie also doch davonlaufen wollte, würde sie es nun tun können, er würde sie nicht aufhalten. Doch sie stand noch verspannt hinter ihm, als er seine Wohnungstür öffnete. Er hielt die Tür offen und vollführte eine einladende Geste.
»Immer rein in die gute Stube.«
Sie ging mit zu Boden geschlagenem Blick an ihm vorbei in die Wohnung. Sie schaute sich nicht um, sie stand nur regungslos im Vorzimmer.
»Da links ist die Küche. Setzen Sie sich erst mal.«
Er schob sie vor sich in die Küche und rückte einen Stuhl zurecht. Als sie sich gesetzt hatte, eilte Hoffmann in das Schlafzimmer und riss den Kleiderschrank auf. Er wühlte sich durch seinen Bestand an Jacken und Pullover. Da, diese dunkelgrüne Winterjacke besaß er schon seit einigen Jahren, hatte sie aber lange nicht mehr getragen. Er entnahm die Jacke dem Schrank und schnupperte daran. Nun, ganz blütenfrisch roch sie nicht mehr, aber sie wärmte prima. Genau das Richtige für seinen unterkühlten Gast. Er eilte zurück in die Küche.
»Da, probieren Sie mal. Wird vielleicht ein bisschen groß sein, aber dafür ist die Jacke richtig warm. Schlüpfen Sie mal rein.«
Die junge Frau erhob sich und blickte ihn das erste Mal direkt an. Nun, er war zwar seit langem kein schüchterner Jüngling mehr, aber in der letzten Zeit hatte er kaum Kontakte zu Frauen gehabt. Und eine attraktive, schwarzäugige Prostituierte in seiner Küche war für ihn keine alltägliche Situation. Hoffmann war irritiert. Er sah ihr blau geschlagenes Auge erstmals aus der Nähe. Ein Hauch von Dankbarkeit lag in ihrer Miene. Sie schlüpfte in die Jacke und setzte sich wieder an den kleinen Küchentisch. Hoffmann holte eine Tasse aus dem Schrank, stellte sie vor seinem Gast auf den Tisch und schenkte den noch einigermaßen warmen Kaffee ein.
»Milch und Zucker stehen da. Bitte nach Geschmack selbst zugreifen.«
Aber sie griff nicht zu, sondern verharrte bewegungslos auf dem Stuhl. Hoffmann legte los, er schlug drei Eier in die Pfanne, schnitt Brotscheiben ab und legte Käsestücke auf einen Teller. Nach kurzer Zeit waren die Eier gebraten, Hoffmann schaufelte sie auf einen Teller und servierte das Frühstück. Noch immer rührte sie sich nicht, also setzte sich Hoffmann ihr gegenüber an den Tisch, schob den Stuhl ein Stück nach hinten und verschränkte die Arme. Er beobachtete. Warum sie überhaupt noch zögerte? Wahrscheinlich hatte sie die Erfahrung gemacht, dass weiße Männer schwarzen Frauen nichts schenkten, dass sie immer alles aus Berechnung und mit konkreten Absichten taten. Sie hob ganz kurz den Blick und musterte schüchtern ihren Gastgeber. Zweifellos gingen ihr ähnliche Gedanken wie ihm durch den Kopf. Hoffmann erwiderte nunmehr gelassen ihren Blick und wartete einfach. Endlich langte sie tüchtig zu. Hoffmann genoss es, ihr beim Essen zuzusehen. Mit jedem Bissen schien sich ihre Spannung ein wenig zu lösen, und als sie sich gesättigt zurücklehnte, lächelte sie vor sich hin.
»Na, das war ja wohl ein Festessen, nicht wahr? Wollen Sie noch etwas? Noch Brot? Noch Käse?«
Sie schüttelte verneinend den Kopf, also erhob sich Hoffmann und räumte den Tisch ab. Er schlichtete die benutzten Teller in den Geschirrspüler. Obwohl Hoffmann immer wieder mit afrikanischen Drogenhändlern zu tun hatte, wusste er, dass die meisten schwarzhäutigen Einwanderer in Österreich bitterarme Leute waren, die für einen mies bezahlten Job unendliche Strapazen und Gefahren auf sich genommen hatten und ihren Aufenthalt im gelobten Europa durch kriminelle Taten ganz und gar nicht gefährden wollten. Denn eines wurde den Afrikanern, die es bis in die Großstädte Europas geschafft hatten, bestimmt schnell klar, hier waren sie von der Mehrheit der Menschen nicht erwünscht. Was nun, wenn ausgerechnet sein frühmorgendlicher Gast zu einer Einbrechertruppe gehörte? Und sich in ihrem Schlepptau irgendwann ein paar muskelbepackte Kerle einstellten, die ihm die Wohnung ausräumen wollten? Hoffmann sinnierte vor sich hin. Afrikaner waren selten in schweren Raub verwickelt, wenn sie kriminell wurden, dann eher als simple Ladendiebe oder im Drogenbereich. Einbrüche gingen eher zu Lasten von osteuropäischen Banden. Hoffmann schloss die Klappe des Geschirrspülers und drehte sich zu seinem Gast um.
Er erschrak.
Sie stand nahe bei ihm, er hatte gar nicht gehört, wie sie aufgestanden war. Die entspannte Miene, die sie nach dem Essen gezeigt hatte, war zu einem bizarren Spottbild geworden. Ihre hübschen Gesichtszüge wirkten leblos, ihre schöne dunkle Haut schien wie aufgemalt, ihre ganze Erscheinung hatte nichts Menschliches an sich, sie schien zu einer Puppe geworden zu sein.
»Du wollen fickenblasen? Ich super fickenblasen.«
Hoffmann taumelte zwei Schritte zurück. Sie blickte zwar in seine Richtung, aber es war, als ob sie durch ihn hindurchschauen würde.
»Fünfzig Euro mit Gummi. Siebzig ohne.«
Sie öffnete die Jacke, die Hoffmann ihr gegeben und die sie während des Frühstücks nicht abgelegt hatte, griff sich zwischen die Beine und vollführte gleichermaßen bemüht anzügliche wie entwürdigende Bewegungen.
»Super fickenblasen.«
»Moment, Kindchen, nur schön langsam. So ein Theater brauchst du hier nicht aufführen. Ich habe kein Interesse.«
Sie war enttäuscht.
»Machen für vierzig Euro.«
Hoffmann war überrascht, wie schnell sie ihren Tarif nach unten regulierte. Er lachte nervös auf.
»Nein, hör auf damit.«
»Ohne Gummi vierzig Euro.«
»Schluss mit dem Scheiß!«
Die junge Frau zuckte erschrocken zusammen, sie wagte kein Wort mehr. Hoffmann fluchte in sich hinein. Und so eine Sauerei um halb sechs Uhr morgens. Hoffmann trat energisch auf sie zu, fasste sie an beiden Oberarmen und drückte sie auf den Stuhl. Sie wehrte sich nicht.
»Jetzt pass mal auf, Mädchen. Das Frühstück gibt’s bei mir für geladene Gäste gratis. Und fickenblasen ist heute nicht. Deine Show kannst du im Prater abziehen, nicht in meiner Wohnung. Außerdem bin ich von der Polizei.«
Es dauerte einen Moment, bis sie verstand. Zu Tode erschrocken katapultierte sie sich fort von Hoffmann, sie warf dabei den Stuhl um, stolperte, fiel rücklings zu Boden, raffte sich schnell auf. Hoffmann starrte in ihre panisch geweiteten Augen. Für einen Augenblick stand sie an die Wand gepresst und hechelte kurzatmig.
»Nur die Ruhe«, flüsterte Hoffmann besänftigend.
Vergebens, die junge Frau sprang los, wuchtete sich an Hoffmann vorbei und stürmte zur Wohnungstür. Hoffmann eilte ihr hinterher. Sie riss an der Türklinke, doch Hoffmann hatte die Tür versperrt. Hektisch griff sie nach dem angesteckten Schlüssel und versuchte, das Schloss zu öffnen, aber die Verzögerung ermöglichte es Hoffmann, ihren Vorsprung aufzuholen. Hoffmann war klar, dass jetzt keine beruhigenden Worte mehr wirkten, jetzt musste er härtere Bandagen anlegen. Obwohl sein letzter Selbstverteidigungskurs lange her war und seine körperliche Fitness durchaus hätte besser sein können, wusste er, wie und wo er zupacken musste. Von hinten fasste er zu, hob sie hoch und warf sie so vorsichtig wie möglich zu Boden. Er hörte, wie ihr die Luft ausging, fühlte, wie sie für einen Moment den Schock des Wurfes verdauen musste. Dann zappelte sie in seiner Umklammerung und schrie gellend auf. Hoffmann lag auf ihr und versuchte sie mit seinem Gewicht zu fixieren, was kaum gelang, denn die junge Frau war kräftig und sie war in Panik. Innerhalb eines Augenblickes war er außer Atem. Wie lange war es her, seit er einer Frau so nahe gewesen war, einen weiblichen Körper so intensiv gespürt hatte? Hoffmann war diese Rauferei zu blöd, er rollte sich einfach zur Seite, stand auf und lehnte sich schwer atmend an die Wohnungstür.
»So, du kannst aufhören herumzuschreien, die Nachbarn sind schon wach!«
Die junge Frau schluchzte und zitterte. Sie kniete vor Hoffmann auf dem Boden und faltete die Hände.
»Bitte, nicht Gefängnis, bitte, bitte, nicht Gefängnis.«
Jetzt war Hoffmann endgültig stocksauer. Der Tag war frühmorgens stimmungsmäßig schon gelaufen. Hoffmann griff in die Brusttasche seines Hemdes und zog die zerdrückte Zigarettenpackung heraus. Er steckte sich eine Zigarette an.
»Was soll der Blödsinn? Warum soll ich dich ins Gefängnis stecken?«
»Ich muss arbeiten. Muss Geld verdienen. Für Madame. Für Familie. Nicht Gefängnis.«
Schöne Familie, für die sie da ihren Körper verkaufen musste, schoss es durch Hoffmanns Kopf, dann aber erwog er, dass ihre Familie wahrscheinlich nichts von der Art ihrer Arbeit im fernen Europa wusste. Hoffmann kniete sich zu ihr hin, wischte mit der rechten Hand die Tränen von ihrer Wange. Er fasste sie ruhig und bestimmt ins Auge.
»Du kommst nicht ins Gefängnis. Kein Gefängnis. Und jetzt beruhige dich wieder. Du brauchst keine Angst zu haben, ich tu dir nichts.«
Er half ihr auf und führte sie zum Sofa. Hoffmann überlegte, wie er aus dieser Scheißsituation wieder rauskommen könnte. Er ging zu seinem Aquarium und schaute eine Weile den Fischen zu, die in ihrer kleinen, heilen Welt unbeirrbar Kreise zogen.
»Wie heißt du eigentlich?«
Er rechnete gar nicht mit einer Antwort. Hoffmann kaute hart an dieser unvermittelten, überraschenden und unbarmherzigen Konfrontation mit dem Elend der Welt. Einerseits hatte die junge Frau gute Gründe, in Panik zu geraten, wenn sie einem österreichischen Polizisten in die Hände fiel, andererseits hatte man ihr bestimmt auch furchtbare Horrorgeschichten über die Polizei eingetrichtert. Sie lebte in einem Kerker der Paranoia, dort unendliche Armut, Vertreibung und gnadenlose Menschenhändler, hier bedrohliche Polizisten, ebenso reiche wie hasserfüllte Durchschnittsbürger und bedingungslos geile Sexkäufer.
»Soll ich dich nach Hause bringen?«
Wieder wartete er vergeblich auf irgendeine Reaktion, sie saß bloß apathisch auf dem Sofa. Hoffmann ging ins Vorzimmer, schlüpfte in seine Schuhe, danach holte er aus dem Schrank seine Dienstwaffe. Zurück im Wohnzimmer stellte er sich in die Mitte des Raumes und legte bedächtig das Schulterholster an. Sie hob ihren Blick.
»Petuela. Das mein Name. Petuela.«
»Schön dich kennenzulernen, Petuela.«
»Du Polizist?«
»Ja, ich bin Polizist.«
»Ich nicht Gefängnis?«
»Kein Gefängnis.«
Er schlüpfte in seine Jacke.
»Und jetzt bringe ich dich nach Hause«
Sie erhob sich, ihre Lippen bebten.
»Ich habe was gesehen. Komm mit. Ich zeige dir.«
Hoffmann stutzte. Was war das jetzt? Er war beunruhigt. Sie ging voran zur Tür und wartete. Hoffmann schloss die Tür auf, nebeneinander gingen sie die Treppe hinab. Sie traten auf die noch immer dunkle Gasse, Hoffmann blickte auf die Anzeige seines Handys. Es war knapp nach halb sechs, die ersten Autos rollten durch die Straßen. Die junge Frau marschierte mit ausgreifenden Schritten los, Hoffmann mühte sich dranzubleiben. Sie liefen einige Blocks in Richtung Nordwestbahnhof. Hoffmann spürte aufkommendes Seitenstechen. Plötzlich blieb sie vor einem ziemlich heruntergekommenen Altbau stehen. Sie waren direkt neben dem Gelände des kleinen Frachtenbahnhofs, man hörte in der Ferne das Brummen einer Diesellokomotive. Hoffmann ließ den Blick kreisen. Der zwanzigste Bezirk war nicht der vornehmste Wiens, eine ehemalige Industrievorstadt mit weitgehend altem Hausbestand und hohem Ausländeranteil. Und diese Straße hier gehörte zu den am wenigsten vornehmen in diesem wenig vornehmen Stadtteil. Petuela schaute Hoffmann direkt in die Augen.
»Ich habe nur gesehen. Gestern Nacht. Ich sonst nichts wissen. Da.«
Sie deutete auf das Haustor, vor dem sie Halt gemacht hatten.
»Was hast du gesehen, Petuela?«
Sie stemmte sich gegen das Tor und trat in den finsteren Flur. Sie schaltete nicht das Ganglicht ein, also tat es Hoffmann auch nicht. Petuela öffnete nun die Tür zum Innenhof, trat einen Schritt in den Hof und zeigte auf einen Holzverschlag, in dem die Mülltonnen des Hauses standen. Sie sagte nichts mehr, rührte sich nicht mehr, sondern zeigte nur geradewegs auf den Holzverschlag. Hoffmann hatte einen bitteren Geschmack auf der Zunge. Was war da los? Er ließ den Blick kreisen. Ein typischer Innenhof im zwanzigsten Bezirk, nicht anders als in seinem Wohnhaus. Die Stadt war gerade dabei zu erwachen, in vielen Wohnungen brannten bereits Lichter. Hoffmann tastete unwillkürlich nach seiner Dienstwaffe und ging auf den Holzverschlag zu. Er blickte hinter die Mülltonnen.
»Das ist aber jetzt nicht wahr.«
Er kniete sich rasch neben den liegenden Mann zu Boden und tastete den Hals ab. Die Haut fühlte sich kalt an, viel zu kalt. Er spürte keinen Puls, keinen Atem. Kein Zweifel, dieser Mann war tot.
»Verdammt noch mal, was für ein Scheißtag!«, rief er aus, sprang hoch und nahm sein Telefon zur Hand.
Die junge Afrikanerin sah das Telefon, warf sich herum und lief auf und davon. Hoffmann hechtete ihr hinterher, rannte durch den Flur auf die Straße und sah, wie sie mit fliegenden Beinen verschwand. Mitsamt seiner grünen Winterjacke. Selbst wenn er gewollt hätte, er hätte sie niemals einholen können, so schnell war er seit langem nicht mehr. Hoffmann drückte das Handy an sein Ohr und steckte sich eine Zigarette an.
»Wolfgang Hoffmann hier. Brauche einen Streifenwagen, die Spurensicherung und ein Notarztteam in der Nordwestbahnstraße. Und bitte mit Tempo.«
2. Szene
Hoffmann schlurfte durch die Gänge des Kommissariats, er erwiderte kaum die Grüße der Kolleginnen und Kollegen. Er setzte wie in einem Fiebertraum einen Schritt vor den anderen, die frisch rasierten Männer und hübsch frisierten Frauen rund um ihn herum hätten genauso gut aus einer Illustrierten ausgeschnitten sein können, ihre Bewegungen erinnerten ihn an Marionetten an unsichtbaren Fäden. Was für ein mieser Tag! Hoffmann öffnete die Tür zu seinem Büro, sah seinen immer fitten, immer adretten Kollegen Assmann an seinem Schreibtisch sitzen und murmelte eine unverständliche Begrüßung. Assmann zog die Brauen hoch und wandte den Blick vom Bildschirm seines Computers ab und seinem älteren Kollegen zu.
»Na hallo, heute schaust du ja noch frischer aus als sonst«, polterte Assmann schmunzelnd los. »Das blühende Leben in Person.«
Hoffmann ignorierte Assmanns Spott, legte die Jacke ab und ließ sich auf seinen Schreibtischstuhl fallen. Ihm war richtig übel, sein Hals kratzte. Hoffmann schaute auf die Zimmeruhr. Verdammt, es war halb zehn Uhr vormittags und er hatte schon eine halbe Packung Zigaretten geraucht. Stellte sich vielleicht die erste Verkühlung in dieser Saison ein? Das Wetter würde dazu passen, nass und kalt. Er überlegte, ob er noch einen Kaffee trinken sollte. Hoffmann entschied sich dagegen, sondern startete den Computer. Assmanns Finger liefen flink über die Tastatur. Hoffmann starrte ins Leere.
»Hast du nicht heute einen Arzttermin?«, fragte Assmann, ohne von seiner Arbeit hochzublicken.
Hoffmann verzog sein Gesicht.
»Das auch noch.«
Jetzt verschränkte Assmann seine Arme und drehte sich Hoffmann zu.
»Was ist mir dir los? Du schaust richtig fertig aus.«
Diesmal war kein Spott mehr in Assmanns Stimme.
»Mir ist schlecht, hab schon wieder viel zu viel geraucht, bin seit fünf Uhr wach und war die letzten zwei Stunden beim Wallner in der Pappenheimgasse.«
»Beim Kollegen Wallner? Was war jetzt schon wieder los?«
Hoffmann blickte Assmann mit müden Augen an.
»So wie es ausschaut, haben wir einen Drogentoten mehr in der eh schon beschissenen Statistik.«
Assmanns Miene verdüsterte sich.
»Stefan Breznik, vierundzwanzig, amtsbekannter Fixer, wohnhaft in der Nordwestbahnstraße. Der Mann hat in der Volldröhnung den Weg in seine Wohnung nicht mehr geschafft und ist im Innenhof seines Hauses zusammengebrochen. Da er nur leicht bekleidet war, ist er über Nacht schlicht und einfach erfroren. Zumindest ist das die Theorie vom Wallner und mir.«
Assmann schüttelte den Kopf.
»Was hat das mit dir zu tun? Okay, du wohnst da drüben in dem Viertel, aber du bist doch gar nicht zuständig. Warum hat der Wallner dich eingeschaltet? Und das um fünf Uhr früh.«
Hoffmann tippte das Passwort zur Anmeldung am Computer ein.
»Nicht der Wallner hat mich eingeschaltet, umgekehrt. Ich habe den Toten gefunden.«
»Um fünf Uhr früh? Leidest du unter Schlaflosigkeit, die dich in die Innenhöfe deiner Nachbarschaft treibt?«
Assmanns ironische Frage löste bei Hoffmann trotz seiner miesen Stimmung ein kurzes Schmunzeln aus. Er schaute seinem jungen Kollegen in die Augen. Es hatte lange gedauert, bis Assmann seine Steifheit aus der Polizeischule abgelegt hatte, aber mittlerweile gelangen ihm immer wieder mal brauchbare, meist sehr trockene Witze.
»Das ist eine lange Geschichte.«
Assmann wandte sich seiner Arbeit zu.
»Für lange Geschichten hab ich leider gerade jetzt keine Zeit.«
Hoffmann starrte eine ganze Weile auf den Bildschirm. Immer die verfluchte linke Schulter. Er verbiss den dumpfen Schmerz. Langsam suchte er im Speicher seines Handys nach der Nummer seines Hausarztes. Er brauchte einen neuen Termin, sein Herz musste unbedingt mal gecheckt werden. Hoffmann tippte sich durch die Menüs, aber er überblätterte den gesuchten Eintrag einfach. Vor seinem Auge sah er die diensthabende Notärztin, die den anwesenden Polizisten den Tod des jungen Mannes bestätigt hatte. Er sah sich noch mit dem Kollegen Wallner vom zuständigen Kommissariat im Morgennebel stehen. Zu zweit rauchend. Die Kriminalpolizisten schwiegen sich an, weil ohnedies alles so klar war, weil ohnedies wieder nur ein nüchterner Eintrag in einer Statistik erfolgen würde, weil ohnedies wieder nur eine routinemäßig oberflächliche Obduktion gemacht werden würde. Hoffmann sah sich wieder vor dem Computer sitzen, wie er gemeinsam mit den Kollegen im Kommissariat Pappenheimgasse der kurzen Lebensgeschichte des Toten hinterher geforscht hatte. Da hatte Hoffmann einen Einfall.
»Du, Gerhard, hast du noch etwas von deinem Kräutertee da? Du weißt schon, der vorbeugend gegen Erkältungen hilft.«
»Der Lindenblütentee? Freilich. Unten im Schrank ist die Packung. Bedien dich ruhig.«
Hoffmann erhob sich und kramte im Schrank unter der Kaffeemaschine nach den Teebeuteln. Er sah nicht, dass sein Kollege ihn von hinten genau beobachtete. Assmanns Miene war beunruhigt.
3. Szene
»Hi.«
»Servus.«
»Und?«
»Eh.«
»Passt.«
Die zwei angehenden Ingenieure setzten sich in der Mittagspause auf eine der Bänke im Schulareal. Das TGM hatte in all den Jahren seines Bestandes immer als eine Kaderschmiede österreichischer Techniker gegolten. Selbst als es aus den alten Gemäuern im neunten Bezirk vor mittlerweile drei Jahrzehnten in das wuchtige Hochhaus im zwanzigsten Bezirk übersiedelt war, hatte die Schule den Ruf einer hervorragenden Ausbildungsstätte behalten. Den beiden Schülern war der Ruf ihrer Schule aber herzlich egal, ihnen war so manches egal, was vielen anderen Schülern wichtig war. Beide waren keine durchschnittlichen Jungingenieure.
»Hast du den Marian angerufen?«, fragte Gernot.
Alex zog sein Handy aus der Jackentasche und wählte eine Nummer. Der dunkelhaarige, stämmige Bursche hielt das Telefon an sein Ohr.
»Hebt nicht ab.«
Der hagere junge Mann mit dem in dieser Schule auffällig langen blonden Haar zuckte mit den Schultern.
»Wurscht. Dann halt später.«
»Pfau, jetzt noch Mathe. Bist du deppert! Nur mühsam. Und du?«
»Labor«, sagte Gernot. »Kein Problem.«
Alex stieß Gernot an die Schulter.
»Du immer kein Problem, kein Problem! Mathe ist schon ein Problem. Wie soll ich das schaffen, nicht nach fünf Sekunden zu pennen?«
Die beiden Jungs lachten.
»Heut am Abend?«
»Sowieso.«
»Rufst du den Marian an?«
»Sicher.«
Sie gingen nebeneinander in das Schulgebäude, bestiegen mit einigen anderen Schülern einen der acht Schülerlifte und fuhren hoch. Alex stieg im achten Stock aus, Gernot fuhr noch höher in den elften Stock. Zum Abschied nickten die beiden einander zu.
4. Szene
»Und, Mama, wegen der Papiere brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen, der Doktor Seiler hat das alles richtig gemacht. Du kennst ja den Doktor Seiler, der hat doch für unsere Familie immer alles richtig gemacht. Und beim Notar hast du dich ganz tapfer gehalten. Das war spitze, Mama, ganz spitze.«
Die vornehm gekleidete, ältere Frau im Rollstuhl nickte ihrem Sohn zu.
»Und tu dich nicht aufregen, du wirst sehen, in Baden sind ganz liebe Leute. Da wird für dich wirklich gut gesorgt, es ist immer ein Arzt in der Nähe und die Luft in Baden ist halt doch besser als hier in Wien. Nicht wahr, das wird schön werden?«
Wieder nickte die Frau. Helmut Seifried schaute auf seine Armbanduhr. Es war verflixt spät, er hatte noch einen Termin in der Innenstadt.
»Gell, Herr Doktor, das mit den Papieren ist doch jetzt erledigt?«
Der ältere Mann im dunklen Anzug trat in den Blickwinkel der Frau und beugte sich ein wenig zu ihr hinab.
»Ja, Frau Seifried, Ihr Sohn hat ganz recht. Ich werde mich wie schon für Ihren seligen Herrn Gemahl um die rechtlichen Angelegenheiten kümmern. Die Papiere sind in rechtlicher Hinsicht einwandfrei. Und der Doktor Radbauer ist ja ein hervorragender Notar, ich kenne ihn schon seit dem Studium. Da ist alles in bester Ordnung.«
»Und … und die Angelika?«, stammelte die Frau.
»Die Tante Angelika hat dem Vertrag zugestimmt, kannst ganz beruhigt sein«, sagte Helmut Seifried. »Sie ist ja deine Schwester und will natürlich wie wir alle das Beste für dich. Hm, bist du einverstanden?«
Die Frau nickte wieder.
»Na fein. Ich muss jetzt wieder los, habe noch einen geschäftlichen Termin.«
Seifried winkte der diskret im Hintergrund stehenden Altenpflegerin zu, die sofort loseilte und den Rollstuhl der Frau fort schob. Die beiden Männer warteten, bis die beiden Frauen den Salon verlassen hatten.
»So, Herr Doktor, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung«, sagte Seifried, und wies dem Rechtsanwalt der Familie den Weg. »Ich begleite Sie gleich hinaus, weil ich muss in einer halben Stunde am Graben sein. Na, das wird sehr knapp.«
Die beiden Männer gingen durch die Räume der Villa in Wien Döbling. Alte, prunkvolle Möbel, kostbare Gemälde und große Fenster prägten das luxuriöse Ambiente des Hauses. Die Familie Seifried wohnte schon seit mehreren Generationen in dieser Villa, nun trat Helmut das Erbe als Besitzer der Villa an, den entsprechenden Schenkungsvertrag hatte seine Mutter heute Morgen beim Notar unterzeichnet. Sie hatte die juristischen Spitzfindigkeiten des Vertragswerkes nicht verstanden, denn ihre Parkinsonkrankheit war schon weit fortgeschritten. Es war also hoch an der Zeit gewesen, dass Helmut Seifried die finanziellen Belange der Familie in die Hände bekommen hatte. Er hatte lange darum kämpfen müssen, denn wenn es ums Geld ging, war seine Verwandtschaft stets Gewehr bei Fuß. Aber er hatte es geschafft, selbst die überaus hartnäckige, geizige und clevere jüngere Schwester seiner Mutter hatte schließlich nach zähem Kampf das Feld räumen müssen. Jetzt gehörten die Kapitalien und Immobilien seiner zwar nicht reichen, aber wohlhabenden Mutter ihm. Damit würde sich seine ganz und gar prekäre finanzielle Situation stabilisieren.
Seifried überschlug seinen Besitzstand. Mit den Wertpapieren würde er seine Schulden decken können, die Sparbücher waren ein brauchbares Startkapital für die Zukunft und die wunderbare Villa mit dem großen Garten bedeutete zwar gebundenes Kapital, dafür aber würde sie ihm jetzt alleine gehören. Und sein Vater hatte knapp vor seinem Tod vor fünfzehn Jahren die Villa noch solide sanieren lassen. Jetzt konnte er das Haus endlich für seine Zwecke nutzen.
Helmut Seifried war mit seinen dreiunddreißig Jahren stolz darauf, in seinem Leben nicht einen einzigen Tag mit monotoner Arbeit vertan zu haben. Er war ein Spieler, aber kein Casinoidiot, der sinnlos Geld verbrannte, er war ein intelligenter, belesener und raffinierter Spieler, und sein Spielfeld war die reiche Oberschicht Wiens, sein Pläsier die stilvolle Dekadenz, sein System der Hedonismus. Jetzt, nach den Pleiten seiner vorigen Unternehmungen, hatte er endlich einen Plan, der ihn zweifelsfrei zu Geld und nebenbei zu erstaunlichen Sinnesfreuden verhelfen würde.
Die beiden Männer schlüpften in ihre Mäntel. Seifried fixierte den grauhaarigen Rechtsanwalt scharf. Er hatte von dem Privatdetektiv eine gepfefferte Rechnung erhalten, aber Seifried hatte anstandslos und pünktlich bezahlt. Er hatte jedes schmutzige kleine Detail über den Anwalt seiner Familie herausbekommen. Etwa, dass der seriös wirkende Herr Anfang sechzig eine Vorliebe für hübsche Knaben hatte. Doch diesen Trumpf hatte Seifried noch nicht ausspielen müssen, denn viel leichter war es gewesen, den Mann einfach zu kaufen.
»Herr Doktor, bitte richten Sie Ihrer Frau Gemahlin meine besten Empfehlungen aus.«
Sie schüttelten auf der Treppe der Villa einander die Hände.
»Und ich habe mir erlaubt«, flüsterte Seifried mit einem süffisanten Schmunzeln, »im Handschuhfach Ihres Autos eine kleine Aufmerksamkeit zu hinterlegen.«
Der Anwalt neigte dankend den Kopf.
»Meine besten Empfehlungen auch an die werte Familie.«
Damit trennten sich die Männer und stiegen in ihre Luxusautos. Seifrieds Mercedes stand hinter dem dunklen Audi des Anwaltes. Er beobachtete, wie der Anwalt sich zum Handschuhfach hinüber beugte, kurz innehielt und dann sein Auto startete. Seifried grinste vor sich hin. Geschafft, er hatte es endlich geschafft. Er war am Gipfel seiner Möglichkeiten. Und endlich war dieser ekelerregende Kadaver seiner langsam verfaulenden Mutter aus dem Haus. Wie er seine Familie hasste, diese Brut von Spießern und Kleinkrämern. Endlich hatte er mit der Villa ein wahrhaft ansprechendes Ambiente für seine Feste. Helmut Seifried liebte opulente Gelage über alles.
Sein schwarzer Mercedes rollte los, Seifried griff zum Telefon. Heute hatte er wirklich einen Grund zum Feiern.
5. Szene
In einem würde sich Major Koller nie ändern, und das war das Tempo, mit dem er durch die Gänge des Kommissariats fegte. Hoffmann hörte schon aus der Ferne das harte Knallen der genagelten Schuhe seines Vorgesetzten. Koller hegte eine Vorliebe für genagelte Schuhe. Er legte größten Wert auf einerseits korrekte, andererseits vornehme Kleidung. Und war sich ein und das andere Mal mit Hoffmann uneins über dessen mehr als legere Kleidung. Überhaupt konnten sich die beiden Männer seit Jahren in manchen Punkten nicht einigen. In der Anfangszeit ihrer Zusammenarbeit, als Koller von einem anderen Kommissariat gekommen und als Leiter der Fachgruppe für Suchtmitteldelikte Hoffmanns Vorgesetzter geworden war, hatten die beiden einen für Hoffmann zermürbenden Bürokrieg geführt. Aber Hoffmanns Langmut hatte gegen Kollers cholerisches Temperament gesiegt, denn Koller nahm mittlerweile die Meinungsverschiedenheiten nicht mehr ernst. Hoffmann konnte diesem Paradigmenwechsel in Kollers Verhalten ein genaues Datum zuordnen. Major Koller hatte seinerzeit die Leitung der Fachgruppe Suchtmitteldelikte übernommen, weil er gehofft hatte, so den angestrebten Posten im Innenministerium zu bekommen. Aber daraus war nichts geworden, ein anderer Aspirant war genommen worden. Zu Hoffmanns Überraschung war Kollers Reaktion darauf nicht Wut gegen seine Untergebenen, allen voran gegen Hoffmann, gewesen, sondern Enttäuschung und Resignation. Seither war Hoffmanns Leben im Kommissariat wesentlich entspannter.
»Guten Tag, meine Herren«, rief Koller und fegte durch die Tür herein.
»Tag«, antwortete Assmann einsilbig.
Hoffmann nickte zur Begrüßung und schenkte aus der Teekanne noch etwas von dem längst kalten Lindenblütentee in seine Tasse. Koller hatte eine Aktenmappe unter die Achsel geklemmt. Er ließ seinen Blick kreisen.
»Nun, wie ich sehe, haben die Herren sich recht gemütlich eingerichtet. Das leise Schnurren der Computer, angenehme Temperaturen, keine störenden Anrufe, eine Kanne Tee. Heute mal gar kein Kaffee, Herr Hoffmann? Eine kleine Ruhepause nach dem Mittagstisch? Als Beamter hat man doch ein feines Leben, nicht wahr?«
Hoffmann musterte Koller. Noch vor einem halben Jahr hätte Koller dieselben Sätze mit schneidender Schärfe vorgetragen, nun kamen sie mit einem ironischen Unterton daher. Für ironische Untertöne hatte Hoffmann immer eine Vorliebe gehabt.
»Wir tun, was wir können, um Recht und Sicherheit zum Erfolg zu führen«, knüpfte Hoffmann ebenfalls ironisch an.
Koller machte eine skeptische Miene und stemmte seine linke Hand in die Hüfte.
»Indem Sie in all Ihrer polizeilichen Routine den Vormittag verschlafen?«
Hoffmann lachte. Ihm war den ganzen Vormittag über alles andere als zum Lachen zumute gewesen, jetzt aber lachte er. Er wurde stutzig. Hatte er nicht gerade eben das allererste Mal über eine Äußerung seines Chefs wirklich lachen müssen?
»Na ja, Herr Major, diesmal haben Sie sogar recht. Ich komme heute nicht und nicht auf Touren.«
Tatsächlich war Hoffmanns Arbeitsleistung an diesem Vormittag ein Witz gewesen. Koller trat auf Hoffmanns Schreibtisch zu.
»Dann haben Sie hiermit das Glückslos gezogen. Habe hier zwei Meldungen aus dem Krankenhaus. Zwei Drogensüchtige sind mit Überdosis eingeliefert worden. Sie liegen mit auffälligen Vergiftungserscheinungen in der Intensivstation. Damit Sie sich heute Nachmittag nicht über zu wenig Arbeit beklagen können.«
Hoffmann nahm den Aktenumschlag und öffnete ihn. Es waren nur zwei Blätter mit den Meldungen des Krankenhauses an das Kommissariat. Hoffmann runzelte die Stirn. Opiatvergiftungen. Zuerst eine Leiche in der Nordwestbahnstraße und jetzt zwei Vergiftete in der Intensivstation. Braute sich da etwas zusammen oder war das nur eine zufällige Häufung?
»Und Sie, Herr Assmann, wie weit sind Sie mit den Berichten?«
»Eine Stunde noch.«
Major Koller ließ noch einmal den Blick durch den Raum kreisen.
»Akzeptiert. Also, weitermachen, meine Herren.«
Hoffmann brummte ein unverständliches Abschiedswort vor sich hin. Er bemerkte gar nicht mehr, dass Major Koller die Tür vergleichsweise leise hinter sich schloss. So etwas hätte es bei dem notorischen Türknaller Anton Koller noch vor Kurzem nicht gegeben.
Was machten die Junkies von Wien wieder für Probleme? Hoffmann kramte seine Siebensachen zusammen. Er erhob sich flott.
»Du, Gerhard, ich fahr gleich mal los. Die zwei Kandidaten schau ich mir aus der Nähe an.«
Gerhard Assmann nickte, ohne seinen Blick vom Bildschirm abzuwenden. Hoffmann schnappte seine Jacke und marschierte los. Vergessen war die Trägheit des Vormittages. Er war wieder da, wo er hingehörte, er war auf der Straße.
6. Szene
»Heil Hitler!«, stieß der große, blonde Mann hervor, knallte mit den Hacken und hob zackig die Hand zum Hitlergruß.
Helmut Seifrieds Miene verdüsterte sich schlagartig, er legte die Handflächen auf die kühle Platte seines Schreibtisches und schaute seinen Besucher missmutig an.
»Bei allem Respekt für deine plebejischen Vorlieben und Ansichten, werter Karlheinz, aber in diesem Bürohaus arbeiten Menschen, die dein saudummes Gebrüll vielleicht hören könnten. Ich wäre dir also sehr verbunden, wenn du deinen Nazikauderwelsch wenn schon, dann bei deinen Saufkumpanen ausposaunst, nicht aber mitten in meinem Büro!«
Karlheinz Heidinger lachte lauthals los, trat an den Schreibtisch und ließ sich auf den Stuhl davor fallen. Die beiden Männer schauten einander eine Weile an, Heidinger grinsend, Seifried verärgert.
»Na, stell dich nicht so an, sie werden dir schon nicht einen jüdischen Anwalt auf den Hals hetzen«, witzelte Heidinger.
Seifried hatte für die derben Scherze seines Kompagnons noch nie viel übrig gehabt, und auch dessen Ideologie fand er in Wahrheit trivial und spießig. Ihre Partnerschaft basierte auf den wechselseitigen Vorteilen derselben, Seifried verfügte über den Unternehmersinn und Heidinger über weitreichende Kontakte. Seifried schluckte heute seinen Ärger leicht hinunter, heute konnten ihn nicht einmal dumme Nazisprüche aufregen. Seine Miene entspannte sich, er lächelte eloquent.
»Lieber Karlheinz, das nächste Mal, wenn du hier so einen Auftritt hinlegst, rufe ich den Sicherheitsdienst und lasse dich aus dem Haus entfernen. Ich will hier wahrhaft keine üble Nachrede riskieren.«
»Schon gut, es wird nicht wieder vorkommen.«
Die Spannung zwischen den beiden Männern lockerte sich. Seifrieds Büro kostete ein Vermögen an Miete. Es bestand zwar nur aus drei Räumen, einem kleinen Vorzimmer mit Garderobe, einem Zimmer für die Sekretärin und schließlich seinem Büro, aber in einem alten Palais am Graben, im Herzen der Wiener Innenstadt, waren Mietpreise einfach astronomisch. In seinem Geschäft konnte Seifried nicht in einer schmuddeligen Besenkammer in der Vorstadt logieren, er musste repräsentieren, er musste den Kunden zeigen, dass er Stil, Einfluss und Vermögen besaß. Dazu waren nun einmal gewisse infrastrukturelle Voraussetzungen nötig. Und es war ganz und gar deplatziert in einem so noblen Palais, in dem nur renommierte Firmen ihre Büros hatten, wenn dumme Kerle Naziparolen krakeelten.
In diesem Augenblick läutete das Telefon auf Seifrieds Schreibtisch.
»Ja, Katharina? Gut, er soll gleich hereinkommen.«
Kaum hatte Seifried den Hörer aufgelegt, trat ein elegant gekleideter, dunkelhaariger Mann Anfang dreißig ein.
»Servus, Burschen«, sagte er zur Begrüßung, warf die Tür hinter sich zu und ließ sich auf den Stuhl neben dem großen, blonden Mann fallen. Wie immer wirkte Alfred Tröber etwas gehetzt. Der Mann mit der ebenmäßigen Haut, den schönen Gesichtszügen und tadellos gepflegten Zähnen hatte in jüngeren Jahren als Dressman gejobbt und eine Zeitlang vom Modeljob sehr gut leben können. Sein hoher Drogenkonsum hatte ihn aber aus der Bahn geworfen. Mittlerweile widmete er sich neuen Geschäften.
»Gut, meine Herren«, hob Seifried in seiner ganz typischen, aristokratischen, immer etwas gelangweilt wirkenden und betont kultivierten Sprechweise an, »beginnen wir also mit der Strategiesitzung. Wie ihr bestimmt erwartet habt, ist das Marketingkonzept ausgearbeitet. Wenn ihr das Papier durchblättert, werdet ihr die weiteren Aktivitäten sehen. Die Stoßrichtung weiterer Schritte ist ganz klar eine konsequente Weiterführung des erfolgreichen Expansionskurses des Unternehmens, denn …«
»Erfolgreicher Expansionskurs?«, fiel Heidinger Seifried ins Wort. »Wenn ich mir die letzte Ausschüttung ansehe, kann ich diese Einschätzung nicht teilen.«
Seifried hielt kurz den Atem an. Er liebte es ganz und gar nicht, bei seinen Ausführungen unterbrochen zu werden.
»Nun, der Wert eines Unternehmens spiegelt sich nicht immer nur in der Ausschüttung an die Teilhaber wider. Du wirst zugeben, dass die Umsätze in den letzten sechs Monaten steil bergan gegangen sind, ich habe hier praktisch im organisatorischen Alleingang eine beachtliche Markttiefe erreicht. Und wenn du nur wegen schneller Ausschüttungen in die Agentur investiert hast, hast du einen strategischen Fehler begangen. Hochriskante Wertpapiere an der Börse bringen oft in außerordentlich kurzer Zeit sehr hohe Profite. Du kannst natürlich auch alles verlieren. Eine Veranstaltungsagentur wie Gigerl & Co ist hingegen eine wertsichere Anlage mit je nach Auftragslage und strategischer Marktausrichtung …«
»Ja, schon gut«, unterbrach Heidinger erneut den Redefluss Seifrieds. »Kommen wir zu deinem Papier.«
»Hast du jetzt die Villa?«
Seifried und Heidinger starrten für einen Augenblick den dritten Mann im Bunde an. Alfred Tröbers Miene machte eindeutig klar, dass ihn die geschäftlichen Belange ihres Treffens kaum interessierten, dass er einzig und allein hier saß, um seine Neugier zu befriedigen. Für eine Weile lag Schweigen im Raum, schließlich holte Seifried mit dem Hauch eines gequälten Seufzers Luft.
»Ich weiß zwar nicht, wie das in unsere monatliche Sitzung passt, aber ich sehe schon, dass ich antworten muss. Andernfalls würdest du ja wohl doch keine Ruhe geben.«
Seifried machte eine theatralische Pause. Die beiden warteten neugierig.
»Ja, alles geht nun seinen Weg.«
»Geil!«, rief Tröber. »Und wirst du eine Party steigen lassen?«
Seifried hielt wieder inne und schaute seine Partner mit stechendem Blick an und spannte sie damit selbstverständlich auf die Folter. Inszenierungen waren nun mal sein Geschäft.
»Was mir vorschwebt, wird zweifellos in die so reichhaltige Geschichte Wiener Festivitäten eingehen.«
Tröber brach in Gelächter aus.
»Das wird eine gigantische Orgie!«
Seifried winkte ab.
»Gemach, gemach, meine Herren, ich werde dieses eine Fest bestimmt nicht schlecht vorbereitet durchführen, ich werde eine Kampagne von noch nie gesehener Klugheit und Effizienz auf die Beine stellen, ich werde einen Geniestreich vollführen. Und wir werden dabei zweifelsfrei ehrenhaft verdienen.«
7. Szene
Hoffmann steuerte sein Auto durch den dichten Nachmittagsverkehr. Es war knapp vor halb sechs Uhr abends und er hatte keine Lust mehr, ins Büro zurückzukehren, also fuhr er nach Hause. Der Aufenthalt im Krankenhaus hatte wesentlich länger gedauert als geplant. Gut, dass er hingefahren war, dass die Sache nicht irgendwo auf dem Dienstweg hängen geblieben war, dass er auch so lange gewartet hatte, bis der Arzt zu einer sicheren Aussage imstande und bereit gewesen war. Hoffmanns Miene war hart, seine Lippen waren gespannt, er drängte die heranziehende Erkältung von sich. Das neue Auto, das er seit einigen Monaten fuhr, roch kaum noch nach Kunststoff, es stank fast schon so wie sein alter Renault nach Zigarettenqualm. Hoffmann zerdrückte eben eine Zigarette im Aschenbecher und griff nach dem Headset seines Handys. Er stöpselte sich einen Lautsprecher ins Ohr und wählte die Nummer seines Chefs. Die Ampel schaltete auf Grün und die Kolonne setzte sich in Bewegung. Hoffmann beschleunigte den Wagen während er auf das gleichmäßige Signal in der Leitung hörte.
»Hoffmann, was gibt’s?«, fragte Major Koller.
»Probleme, Herr Major.«
»Will ich das jetzt wirklich hören, knapp vor Feierabend?«
»Wird sich nicht verhindern lassen.«
Hoffmann hörte Kollers Seufzen.
»Also, was für Probleme haben Sie schon wieder gemacht?«
Hoffmann war nicht nach Lachen zumute, nicht einmal nach Schmunzeln.
»Sie haben mir ja zu Mittag die zwei Meldungen vom Krankenhaus gegeben. Ich hab mir das genauer angesehen und da scheint eine Riesenscheiße auf uns zuzukommen.«
»Was ist los?«
Hoffmann hörte aus der kurzen Frage, dass Koller nun bei der Sache war, dass er gespannt lauerte.
»Mittlerweile liegen sieben Fälle von Vergiftungen vor. Alle haben Amphetamine in Tablettenform geschluckt, angeblich in relativ kleinen Mengen. Der Kollege Wallner von der Pappenheimgasse hat mir vor ein paar Minuten bestätigt, dass der Tote aus der Nordwestbahnstraße einen Cocktail intus gehabt hat. Substitol, Meth und, jetzt raten Sie mal, natürlich Amphetamine. Moment, ich parke das Auto.«
Hoffmann nahm den erstbesten Parkplatz vor einem Supermarktes.
»Wir haben also dreckige Amphetamintabletten in der Stadt.«
»Schaut schwer danach aus, Herr Major.«
»Verdammter Mist!«
»Ich habe dem Gerhard gerade alles geschildert und mit dem Kollegen Wallner habe ich auch gesprochen. Wir sind der Meinung, dass wir Alarm schlagen müssen. Deshalb mein Anruf.«
»In Ordnung, Hoffmann, ich werde mir die Sache gleich vornehmen.«
»Der Gerhard ist noch im Büro, wahrscheinlich ruft er Sie ohnedies gerade an.«
»Nein, er ist gerade zu mir ins Büro gekommen. Wo sind Sie, Hoffmann?«
»Im Auto, ich wollte nach Hause fahren.«
»Nach Hause? In so einer Situation?«, fragte Koller ungläubig.
»Ja, ich weiß, aber ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich habe für heute mein Pulver verschossen, tut mir leid, Herr Major, ich bin nicht wirklich fit.«
In der Leitung lag für einige Augenblicke Stille. Hoffmann hatte das unbestimmte Gefühl, dass Koller und Assmann miteinander wortlos kommunizierten.
»Okay, Hoffmann, der Herr Assmann und ich bleiben am Ball und Sie schauen, dass Sie morgen topfit erscheinen. Wenn Ihr Verdacht berechtigt ist, werde ich in den nächsten Tagen jeden verfügbaren Mann brauchen, Krankenstand ist da nicht drinnen.«
»Okay, Herr Major, ich bin um acht im Büro.«
»Wiederhören«, sagte Koller lapidar und trennte die Leitung.
Hoffmann schnaufte, als er den Stöpsel aus seinem Ohr zog. Sollte er sich noch etwas für das Abendessen kaufen, jetzt wo er direkt vor einem Supermarkt stand? Vielleicht auch eine Schachtel mit diesem wunderbaren Tee. Was hatte Assmann gesagt? Lindenblütentee. Warum er nicht früher zum Teetrinker geworden war? Immer nur starker Kaffee, das hatte doch keine Zukunft.
8. Szene
Marian schaltete den Subwoofer aus und fuhr den Computer runter. Gernot, Alex und er hatten ein paar mp3-Dateien gehört. Die drei erhoben sich vom Bett und schnappten ihre Jacken. Marians Zimmer war winzig, ein schmales Kabinett mit einem Bett, einem Schrank, einem Stuhl und dem auf einem Gestell stehenden Computer. An der Wand hingen verschiedene Poster. Marian benutzte sein Zimmer praktisch nur zum Übernachten. Was sollte er auch in der schäbigen Wohnung.
»Hast du den Kitt?«, fragte Gernot.
Marian klopfte auf die Innentasche seiner Jacke.
»Sicher.«
»Und was soll das für eine Party sein?«, fragte Alex.
»Keine Ahnung, irgendetwas total Krankes«, antwortete Marian.
Alex ließ allein durch seine Miene keinen Zweifel, dass er die Einladung zu dieser Party, die Marian von einem dubiosen Bekannten erhalten hatte, gar nicht besonders klasse fand.
»Scheiß dich nicht an«, stieß Gernot lächelnd hervor. »Wir schauen rein, checken die Lage, und wenn’s lulu ist, fliegen wir wieder ab.«
Alex schlüpfte in seine Jacke.
»Okay, dann los.«
Im Gänsemarsch verließen die drei das Zimmer, gingen am Wohnzimmer vorbei, wo Marians Mutter wie immer vor dem Fernseher saß und auch zu dieser Abendstunde tassenweise stark gesüßten Kaffee trank. Sie stiegen in ihre Schuhe.
»Gehst du schon wieder fort?«, hörten sie vom Wohnzimmer aus Marians Mutter.
»Bin eh gleich wieder da!«
»Morgen musst du in die Arbeit.«
»Eben deswegen«, antwortete Marian und lächelte seine ebenfalls lächelnden Freunde an.
»Was hast du gesagt?«
Gernot öffnete die Wohnungstür und wartete noch, bis Marian sein Handy eingesteckt hatte.
»Geh selber arbeiten«, murmelte Marian und verließ die Wohnung.
Marians Mutter war seit mehreren Jahren arbeitslos. Sie lebte mit ihren zwei Kindern von der Sozialhilfe und den Alimenten ihres Exmannes. Wobei sie für Marian nichts mehr bekam, denn er ging ja seit zweieinhalb Jahren in die Lehre in einer Druckerei und verdiente sein eigenes Geld. Marian war der selbständigste von den dreien und es würde wohl nicht mehr lange dauern, bis er sich eine eigene Wohnung suchen würde. Spätestens nach Abschluss der Lehre mit dem Gehalt eines Gesellen würde er sich eine Wohnung auch leisten können. Es konnte nur besser werden. Die drei verließen das alte, vor sich hin bröckelnde Haus in der Novaragasse und liefen in die Nacht des zweiten Wiener Bezirkes. Zwar hatte die neue U-Bahn das Viertel ein bisschen aufgewertet, dennoch war es eine schmucklose Vorstadt. Alte Häuser, geflickte Straßen, hoher Immigrantenanteil, das Volkertviertel beim Praterstern war immer schon eine Wohngegend für die soziale Unterschicht und die Zuwanderer in Wien gewesen. In der Monarchie waren es die Juden und Slawen aus dem Osten des Habsburger Reichs gewesen, heutzutage waren es die Immigranten aus der Türkei, dem Balkan und aus Afrika. Und die drei entstammten diesem Viertel, kannten hier jedes Gässchen, jeden Innenhof, jeden Winkel. Sie waren schon gemeinsam zur Volksschule und danach in die Hauptschule gegangen.
Mit ausgreifenden Schritten marschierten sie die Heinestraße entlang in Richtung Augarten. Sie waren schnell unterwegs, die drei waren immer schnell unterwegs, und das nicht nur, weil sie achtzehn Jahre alt waren und dem Leben hinterherliefen, sondern weil das ihre Art der Freizeitgestaltung war. Die drei waren keine alltäglichen Jugendlichen im Führerscheinalter, sie hatten so etwas wie eine Mikrokultur entwickelt, eine Dreiergruppe geformt, die mit Discobesuchen, mit Mopeds, aufgemotzten Autos und Teenagerpartys nichts am Hut hatte. Sie zogen marschierend durch die nächtliche Stadt, kifften ein paar Joints in den finsteren Parks, spielten an Regentagen meist bei Alex am Computer, diskutierten, hörten Musik, lasen Sciencefiction-Taschenbücher und hingen immer wieder mal in den Nachtvorstellungen der Programmkinos herum. Sie gingen Problemen mit der Polizei aus dem Weg, mieden Streitereien mit anderen Jugendlichen, sie waren auf ihren Touren unsichtbar wie nächtliche Phantome, sie kamen und gingen, waren immer zu Fuß unterwegs. Es gab eigentlich nur einen Fixpunkt bei ihren Wanderungen und das war der Augarten. Die Portale des großen, von einer alten, hohen Mauer umgebenen Barockparks wurden nachts versperrt. Das war ihre Chance auf Stille und Dunkelheit. Für sie war es ein Leichtes, über die meterhohen Portale oder die Mauer zu klettern, und dann hatten sie den Park für sich alleine, konnten völlig ungestört einen Joint drehen, diskutieren, herum marschieren oder einfach nur der nahen und doch so fernen Lärmkulisse der Stadt lauschen. Auch heute steuerten sie den Augarten an, doch heute waren die Portale noch nicht geschlossen, heute wollten sie den Park auch nur durchqueren, heute hatten sie ein Ziel. Eine Party. Ungewöhnlich für so lichtscheue Leute. Marian hatte den Kerl, der sie im Augarten mal angesprochen hatte, wieder getroffen und dieser hatte ihn und seine Kumpels zu dieser Party eingeladen. Die Party würde zwar erst um elf Uhr abends beginnen und jetzt war es erst sechs Uhr, aber zuerst wollten sie noch ins Kino.
Die drei betraten den Augarten, nur wenige Leute befanden sich noch darin und diese waren unterwegs zu den Ausgängen. Sie marschierten durch eine dunkle Allee.
»Reiß heraus den Jolly«, forderte Gernot.
»Nur keinen Stress«, konterte Marian, nahm aber seine Zigarettenschachtel zur Hand, worin sich der zu Hause vorgefertigte Joint befand.
9. Szene
Hoffmann hatte direkt vor seinem Haus keinen Parkplatz mehr gefunden, deshalb stellte er das Auto in der Nähe des Gaussplatzes ab. Ein paar Schritte zu Fuß würden ihm nicht schaden. Hoffmann stieg aus, öffnete den Kofferraum und nahm den Papiersack mit dem Einkauf zur Hand. Wie kühl es wieder geworden war, obwohl der Abend gerade erst angebrochen war. Hoffmann schaute zum Eingangsportal des Augartens, durch das gerade eine türkische Frau mit zwei quengelnden Kindern trat. Wann war er zuletzt im Augarten gewesen? Es musste Wochen her sein. Da lag dieser große Park direkt vor seiner Haustür, er aber kam oft monatelang nicht dazu, darin einen Spaziergang zu machen. Hoffmann stellte den Einkaufsack wieder in den Kofferraum, warf den Deckel zu und versperrte den Wagen. Kurzentschlossen marschierte er auf das Portal zu. Er hatte Feierabend, zu Hause warteten nur ein Dutzend kleiner Fische im Aquarium auf sein Erscheinen und die waren überaus geduldig. Warum sollte er also nicht genau jetzt einen Spaziergang machen? Vielleicht würde die Bewegung auch seinen Kreislauf ein wenig in Ordnung bringen.
Wie ein schützender Mantel umhüllte ihn die Dunkelheit im Park. Hoffmann klappte den Kragen seiner Jacke hoch und schlenderte durch die Alleen. Die kahlen Kastanienbäume wirkten wie verrenkte Krüppel, der jahrzehntelange Schnitt im französischen Barockstil hatte die Bäume verunstaltet. Im Sommer sahen die geometrisch geformten Bäume vielleicht ganz schick aus, ohne Laub waren die Bäume schlicht und ergreifend hässlich.
Hoffmann kniff die Augen zusammen, unwillkürlich spannten sich seine Nackenmuskeln. Er sah die drei finsteren Gestalten schon von weitem. Hoffmann wusste genau, dass die Gefahr, in Wien in einem dunklen Park überfallen zu werden, verschwindend gering war, dennoch tastete er kurz nach seiner Dienstwaffe. Er wich an die Seite der Allee aus. Hoffmann war überrascht, wie schnell die drei Gestalten näherkamen, ihre Bewegungen sahen so leicht aus, fast unbeschwert. Die drei waren zweifellos sehr sportlich. Er ging ganz langsam weiter. Da rauschten die drei schon an ihm vorbei, ihn nicht beachtend. Ein Brillenträger und zwei Langhaarige, das konnte Hoffmann in der Dunkelheit erkennen, und sie waren jung. In der Ferne ertönte die Augartensirene, die bekundete, dass in einer Viertelstunde die Portale versperrt werden würden.