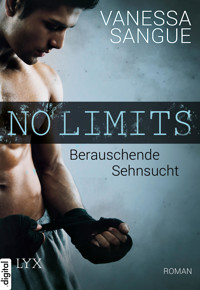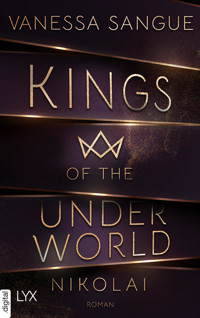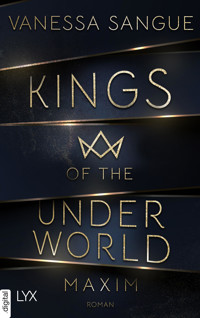6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: NOLA
- Sprache: Deutsch
Sie ist seine Sucht. Er ist ihre Erlösung.
Schon lange vor dem Wendejahr 2024 war Dimitri Morosow dem Vampirfürst Kyriakos treu ergeben. Niemand sonst spielt in seinem Leben noch eine Rolle. Denn vor vielen Jahrhunderten verlor Dimitri seine Gefährtin Amila. Seit sie in seinen Armen starb, fühlt er nur noch Einsamkeit und Schmerz. Zeit ist für ihn bedeutungslos geworden. Doch nun scheint Amila zurückgekehrt zu sein, was Dimitris Welt erneut aus den Angeln hebt. Der gequälte Vampir macht sich auf die Suche nach ihr, ohne zu ahnen, dass Zeit plötzlich das einzige ist, was er nicht mehr hat - und er es mit den Mächten der Hölle aufnehmen muss, wenn er Amila retten will. Kann Dimitri das Schicksal wenden, oder wird er sie diesmal für immer verlieren?
"Vanessa Sangue beschert ein einzigartiges Leseerlebnis mit Kopfkino!" Lesemappe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungMotto1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041EpilogDanksagungÜber die AutorinDie Romane von Vanessa Sangue bei LYX.digitalImpressumVANESSA SANGUE
Dark Hope
Gefährte der Einsamkeit
Zu diesem Buch
Schon lange vor dem Wendejahr 2024 war Dimitri Morosow dem Vampirfürst Kyriakos treu ergeben. Niemand sonst spielt in seinem Leben noch eine Rolle. Denn vor vielen Jahrhunderten verlor Dimitri seine Gefährtin Amila. Seit sie in seinen Armen starb, fühlt er nur noch Einsamkeit und Schmerz. Zeit ist für ihn bedeutungslos geworden. Doch nun scheint Amila zurückgekehrt zu sein, was Dimitris Welt erneut aus den Angeln hebt. Der gequälte Vampir macht sich auf die Suche nach ihr, ohne zu ahnen, dass Zeit plötzlich das einzige ist, was er nicht mehr hat – und er es mit den Mächten der Hölle aufnehmen muss, wenn er Amila retten will. Kann Dimitri das Schicksal wenden, oder wird er sie diesmal für immer verlieren?
Für dich, Dimitri.
Als ich das erste Mal in deine einzigartigen Augen
gesehen habe, wusste ich sofort, dass du mir das Herz
brechen würdest. Und das hast du. Mehrmals.
Aber du bist wunderbar. Vergiss das nie.
Ich liebe dich wie verrückt.
»Man muss vorsichtig sein mit gebrochenen Seelen.
An ihren scharfen Kanten kann man sich leicht verletzen.
Und im Schmerz liegt immer etwas, das süchtig macht.«
Vanessa Sangue
»Du bist das Einzige, woran ich je geglaubt habe.«
Dimitri zu Amila
1
2184 Stunden
Schmerz.
Manchmal fragte er sich, wie viel ein Wesen davon ertragen konnte. Nach einigen Jahrhunderten konnte er sagen, dass es eine ganze Menge war.
Dimitri starrte auf das feine Rinnsal aus rotem Blut, das über seinen Unterarm lief. Es bildete einen faszinierenden Kontrast zu der hellen Haut. Die Wunde schloss sich, und er stöhnte auf.
Die Qual wütete wie eine wilde Bestie, sie schien ihn innerlich zu zerfetzen. Beinahe wünschte er sich, tot zu sein. Bilder stiegen aus den dunklen Tiefen seiner Erinnerung auf. Sie. Er konnte es nicht ertragen, ihr wunderschönes Antlitz vor sich zu sehen. Jeden Tag erlebte er diese Folter von Neuem, und mit jedem Tag fiel es ihm schwerer, dem Flüstern des Todes zu widerstehen.
In Nächten wie dieser, in denen es besonders qualvoll war, blieb ihm nur die Wahl, den inneren Schmerz mit körperlichem zu bekämpfen. Die Dunkelheit, die in seinem Wohnzimmer in der Burg herrschte, umfing ihn wie eine alte Vertraute. Erneut setzte er die silberne Dolchklinge gegen seinen Unterarm, in der Hoffnung, dieser Schmerz könnte der tobenden Bestie etwas von ihrer Macht rauben. Er schnitt sich tief ins Fleisch, genoss das Brennen, den kurzen, scharfen Schmerz.
Zwei Atemzüge später war auch diese Wunde wieder verschwunden, und nur das rote Blut erinnerte an sie. Noch immer sah er sie vor sich. Sie lächelte ihn an, und es zerriss ihn.
Gerade, als er erneut das Messer ansetzen wollte, öffnete sich die Tür zu seinem Zimmer. Niemand betrat es, ohne zu klopfen, nicht einmal Kyriakos.
Niemand außer Hailey.
»Dimitri, ich habe gespürt …« Sie brach ab, als sie ihn in dem Sessel sitzen sah, und Trauer verdunkelte ihre leuchtenden blaugrünen Augen. Natürlich hatte die Empathin seine Gefühle spüren können. »Du sollst das doch nicht mehr tun.«
Sofort spürte er, wie sie begann, ihre Gabe einzusetzen, ihn mit Sanftheit und Wärme innerlich durchdrang, und Dimitri fühlte sich schuldig. Sie gab sich wirklich Mühe mit ihm, und er bereitete ihr nur Kummer. Seufzend ergab er sich ihrer Kraft und gestattete ihr, einen Teil des Schmerzes von ihm zu nehmen. Das erleichterte ihm das Atmen, konnte aber die Ursachen seiner Qual nicht beseitigen.
Er wusste, dass Hailey darunter litt, ihn so zu sehen, und da sie schon seit einigen Monaten auf der Burg lebte, fühlte er sich deswegen schlecht. Nach über sechshundert Jahren seiner Existenz war sie die erste Person, die er als Freund bezeichnet hätte. Er verehrte Kyriakos und verdankte ihm, dass er heute noch hier war, aber ein wahrer Freund war er nicht. Und auch zu den anderen Vampiren des inneren Kreises hielt er immer gewisse Distanz.
Dimitri wich Haileys Blick aus und legte den Dolch auf die Sessellehne. Er konnte sich nicht selbst verletzen, solange sie da war.
Ohne ein weiteres Wort betrat sie sein Wohnzimmer und setzte sich aufs Sofa. Erneut durchflutete ihn eine Welle ihrer empathischen Kraft.
»Es ist wieder schlimmer geworden, nicht wahr?«
Er nickte, unfähig zu sprechen.
»Es tut mir so leid, Dimitri.«
Er musste sie nicht ansehen, um zu wissen, dass sich ihr Gesichtsausdruck verdüstert hatte. Er konnte es in ihrer Stimme hören.
Aber er konnte es nicht ändern. Vor fünfhundert Jahren hatte sein Leben ein Ende gefunden. Seitdem atmete er, aber er lebte nicht. Er existierte nur. Und nichts auf dieser Welt konnte etwas daran ändern.
Es gab nur zwei Gründe, warum er seiner erbärmlichen Existenz noch kein Ende bereitet hatte. Der erste war, dass er sie Kyriakos verdankte. Dieser hatte seinen ersten Versuch, dieser Welt zu entfliehen, vereitelt und ihm eine Aufgabe gegeben. Dimitris Ehrgefühl ließ ihm keine andere Wahl, als sich der Sache zu stellen. Der zweite war, dass er sie dann nicht mehr in seiner Erinnerung sehen konnte. Er wusste nicht, was ihn auf der anderen Seite erwartete. Und obwohl die Erinnerungen an sie seine Qualen nur verschlimmerten, lechzte er nach jedem Moment, in dem er sich ihr Lachen noch einmal in Erinnerung rufen konnte und ihr Bild vor seinem inneren Auge aufstieg.
Dimitri verzog den Mund. Er fühlte sich erbärmlich.
Schweigend saß Hailey neben ihm und versuchte ihm zu helfen. Er hielt ihre Anstrengung für vergeblich, denn er spürte sehr deutlich, dass sich niemals etwas ändern würde.
»Kyriakos ist auf dem Weg hierher«, unterbrach sie schließlich die Stille, und kurz darauf waren von draußen schwere Schritte zu hören.
Er war nicht überrascht. Der andere Vampir blieb seiner Gefährtin nie lange fern. Dimitri konnte ihn verstehen. Er würde es genauso machen. Wenn er eine Gefährtin hätte, würde er sie nie wieder auch nur eine Sekunde aus den Augen lassen.
Hailey erhob sich und strich ihm mit einer Hand über die Schulter. »Bitte, verletze dich nicht wieder selbst.«
Er hob den Blick, sah sie an und nickte. Wenigstens das konnte er für sie tun. Lügen.
Nachdem die Tür hinter ihr zugefallen war, konnte Dimitri sie und Kyriakos leise auf dem Flur miteinander sprechen hören, bevor die Stille ihn erneut umfing.
Dimitri stand auf und ging hinüber ins Schlafzimmer. Alle Vampire von Kyriakos’ innerem Kreis hatten eigene Zimmer in der Burg, damit sie immer in der Nähe ihres Königs waren. Als er sich das blutverschmierte Shirt über den Kopf zog, um es gegen ein neues zu tauschen, fiel sein Blick auf sein Spiegelbild.
Das Zeichen der Verbundenheit zu seiner früheren Gefährtin, das seinen gesamten Arm überzog, war verblasst. Anstatt des einst satten Dunkelrots, das beinahe schwarz wirkte, schimmerte es jetzt nur noch in kränklichem Grau. Sein Blick folgte dem verschlungenen Muster, das sich über Brustkorb und Schulter bis hinunter auf seinen Handrücken erstreckte. Er meinte, noch zu spüren, wie sie mit den Fingern über die Linien gestrichen war. Seine Hände ballten sich zu Fäusten, und er hob den Blick, sah sich nun selbst in die Augen.
Auch das war eine Veränderung, die mit jenem grauenhaften Tag eingetreten war. Die schwarzen Splitter in seinen silbernen Augen. Hailey hatte einmal zu ihm gesagt, dass es aussah, als wären Diamanten zerbrochen, die nun von der Dunkelheit langsam verschlungen wurden. Er konnte ihr nur zustimmen. Ihn selbst verschlang die Dunkelheit. Sie quälte ihn seit fünfhundert Jahren.
Seit dem Tag, an dem seine Gefährtin ermordet worden war.
2
2160 Stunden
Amila sah von dem Stapel verstaubter alter Bücher auf und warf einen Blick auf die Uhr an ihrem Handgelenk. Feierabend. Nur widerwillig trennte sie sich von ihrem Lesestoff. Was sollte sie auch sonst tun? Die Zeit lief ab.
Bevor die Angst, die stets mit diesem Gedanken einherging, die Oberhand gewinnen konnte, atmete sie tief durch. Als sie sich erhob, knackte es in ihrem Rücken. Auch ihre Schultern und ihr Nacken waren vom langen Sitzen total verspannt. Trotzdem war der Job als Assistentin in der magischen Bibliothek von New Orleans ein Glücksgriff. Nirgends sonst war so viel Wissen über die andere Welt an einem Ort versammelt, und genau das brauchte sie. Außerdem hatte Amila in der Regel so wenig zu tun, dass sie beinahe die gesamte Arbeitszeit für ihre Recherche verwenden konnte. Die Bibliothek war nämlich der Grund, warum sie überhaupt in New Orleans war. Ihr Job dort war nicht mehr als ein Mittel zum Zweck, nichts, was sie sich vor zehn Jahren als Traumberuf ausgesucht hätte.
Nachdem sie die in Leder gebundenen Bücher an ihren Platz geräumt hatte, ging sie in den vorderen Bereich der Bibliothek zum Empfangstresen, wo eine studentische Aushilfe saß.
»Bis morgen«, sagte sie mit einem Lächeln, als sie ihre Handtasche aus der Schublade unter der Theke nahm, und ging nach draußen. Dort empfing sie Regen, aber zum Glück waren es von hier aus nur ein paar Minuten zu Fuß zu ihrer kleinen Wohnung.
Amilas Weg führte am Mississippi River entlang, und sie beobachtete eine kleine Gruppe Nixen, die im Wasser spielten. Ihre bleiche, beinahe durchscheinende Haut und die glitzernden grünlichen Augen erzeugten die Illusion, dass sie ein Teil des Wassers waren. Das Kichern der ätherischen Wesen erreichte Amila sogar über den Regen hinweg und zauberte ihr ein Lächeln auf die Lippen.
Kurz darauf erreichte sie ihre Wohnung. Stille begrüßte sie. Immer wenn sie den engen, dunklen Flur betrat, überkam sie eine depressive Stimmung. Auf einmal fühlte sie sich müde, erschöpft und traurig. Früher einmal hatte sie in einem Haus gelebt. Einem wunderbaren, gemütlichen Haus, das stets mit dem Lachen ihrer Mutter erfüllt gewesen zu sein schien. Ein weiterer Gedanke, den Amila lieber abschüttelte.
Jetzt hatte sie zwei Zimmer zur Verfügung: ein Badezimmer und einen Raum, den sie ihr Flur-Wohn-Schlaf-Küchen-Zimmer nannte.
Amila schüttelte sich den Regen aus den Haaren und versuchte, sich nicht entmutigen zu lassen. Von ihrem Gehalt konnte sie sich nichts anderes leisten, und da sie eigentlich ihre gesamte Zeit in der Bibliothek verbrachte, brauchte sie auch keine größere Wohnung.
Sieh es positiv, dachte sie. Wenn du in den nächsten drei Monaten keine Lösung findest, hat sich das Thema eh erledigt.
Die digitale Anzeige des Radioweckers verkündete, dass es bereits sechs Uhr war. Das ließ ihr noch Zeit für einen kurzen Anruf. Schnell wählte sie die Nummer, die ihr vertrauter war als ihre eigene.
»Brooks.«
»Hi Jane, hier ist Amila.«
»Amila, wie geht es dir?« Der Tonfall ihrer Freundin wechselte schlagartig von freundlich zu traurig, wie immer, wenn Amila anrief. Jane kannte eben ihr Geheimnis.
»Unverändert«, meinte sie und konnte nicht verhindern, dass es bitter klang.
Ein Seufzen hallte durch die Leitung.
»Wie lange bleibt dir noch?«
»89 Tage.«
»Und du hast noch keine Lösung gefunden?« Jane klang immer bedrückter. Amila konnte sie verstehen. Immer, wenn sie sich bewusst wurde, dass ihre Zeit ablief, fühlte sie das Gleiche.
»Nein.« Sie holte tief Luft. »Lass uns nicht mehr darüber reden. Wie geht es ihr?«
Einen Moment lang herrschte Stille, und Amila meinte ein unterdrücktes Schluchzen zu hören, aber als Jane sprach, klang ihre Stimme fest.
»Ihr geht es gut. Sie führt das ganz normale, glückliche Leben, das du ihr ermöglicht hast.«
Amila lächelte. Gut.
»Wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat sie sogar jemanden kennengelernt.«
»Wirklich?«
»Ja, er scheint ein netter Mann zu sein. Beinahe jeden Tag stehen Blumen vor ihrer Tür, und deine Mutter wirkt glücklich, wenn sie nach Hause kommt und sie entdeckt. Vielleicht ist sie endlich über ihren Ex-Ehemann hinweg.«
»Ich hoffe, dass es so ist. Mein Erzeuger verdient es nicht, dass man auch nur eine Sekunde an ihn denkt.« Purer Hass färbte Amilas Stimme.
»Da kann ich dir nur zustimmen.«
Innerlich wappnete sie sich, bevor sie ihre nächste Frage stellte. »Und …« Sie musste schlucken. »Sie erinnert sich nicht an mich?«
Jane seufzte leise. »Nein, Amila. Ich habe erst gestern mit ihr gesprochen. Es hat sich nichts verändert. Es ist, als hättest du nie existiert.«
Janes Worte brachen ihr das Herz. Aber sie riss sich zusammen. Ein Blick auf die Uhr sagte Amila, dass sie nicht länger mit ihrer Freundin telefonieren konnte.
»Ich muss los«, murmelte sie.
»Ich hab dich lieb, Amila. Du schaffst das.«
»Ich hab dich auch lieb, Jane.«
Schnell legte sie auf, bevor ihre Freundin sie noch weinen hörte. Das ging jetzt schon neun Monate lang so. Amilas Leben war geprägt von Schmerz und verlorener Hoffnung. Trotzdem würde sie nicht aufgeben. Nicht, solange ihr Herz noch schlug. Niemals.
Amila stand auf und atmete einmal tief durch, um sich auf das vorzubereiten, was als Nächstes folgen würde.
Der Radiowecker zeigte 18:17.
Ihre Hände ballten sich zu Fäusten.
Die Anzeige sprang um: 18:18.
Feuer schien ihre Haut zu versengen, und Amila sog heftig die Luft ein. Atme durch den Schmerz hindurch. Es ist gleich vorbei. Sie biss die Zähne zusammen, als das Mal auf ihrer Schulter sich erneut in sie hineinbrannte. Sie meinte, sogar den Geruch verbrannten Fleischs in der Nase zu haben. Dann war es vorbei.
Auch ohne in einen Spiegel zu sehen, wusste sie genau, was sich gerade abgespielt hatte. Auf ihrer linken Schulter prangte das Zeichen ihrer Verdammnis: eine Brandwunde in Form eines Pentagramms, die nie vernarbte und immer aussah, als wäre sie ihr gerade zugefügt worden. Vor einer Minute hatte noch 2184 in der Mitte gestanden. Jetzt war die Haut rund um das Pentagramm gerötet und die Zahl hatte sich in 2160 geändert. Die Anzahl der Stunden, die ihr noch blieben. Die Zeit, bis sie ihren Teil des Teufelspaktes erfüllen musste.
2160 Stunden, bevor sie sterben würde.
3
2136 Stunden
Er bewegte sich als Schatten zwischen den Menschen und den anderen Wesen. Trotz seiner Größe bemerkten daher nur die wenigsten, dass er in der schmalen Gasse zwischen zwei Gebäuden stand und das Geschehen in NOLA, New Orleans, beobachtete.
Heute war Dimitris Tag in der Stadt. Seit Kyriakos sich mit seiner Partnerin Hailey verbunden hatte, wollte er immer einen seiner Vampire dort wissen, um so schnell wie möglich auf drohende Gefahren reagieren zu können.
Und auch wenn Hailey diese Art der Kontrolle gar nicht mochte, erledigte Dimitri diesen Job gerne. Er führte ihn von den anderen Vampiren und der Burg weg, gab ihm Zeit zum Alleinsein. Selbst unter Vampiren, die selten die Nähe anderer suchten, galt er als Einzelgänger. Er brauchte keine Gesellschaft, fand sie meistens nur nervenaufreibend. Mit anderen reden zu müssen, die mitleidigen oder fragenden Blicke zu ertragen, das verabscheute er. Die meisten Wesen, die sich in seiner Nähe aufhielten, merkten früher oder später, dass etwas mit ihm nicht stimmte, und wenn er eins nicht wollte, dann war es, Fragen zu seiner Vergangenheit beantworten zu müssen. Da blieb er lieber für sich.
Ein Sonnenstrahl durchbrach die dünne Wolkendecke, und Dimitri trat zwischen den Häuserwänden hervor und machte sich auf den Weg durch die Innenstadt von New Orleans. Allerdings machte er einen Bogen um Haileys Büro. Als er bei seiner ersten Patrouille dort vorbeigegangen war, hatte beinahe sofort sein Handy vibriert und Hailey hatte ihm in einer SMS scherzhaft angedroht, seine Haare grün zu färben, wenn sie ihn noch einmal in der Nähe erwischte. Er grinste halbherzig bei der Erinnerung.
Schließlich kam er an der magischen Bibliothek der Stadt vorbei. Sein Körper reagierte, bevor sein Verstand die Information, die ihm der Duft vermittelte, auch nur verarbeiten konnte. Seine Muskeln spannten sich an. Sein von Natur aus sehr langsamer Herzschlag raste plötzlich. Seine Nasenlöcher weiteten sich, um den Duft tiefer in seine Lungen zu ziehen, zu analysieren. Blitzschnell suchten seine Augen die Umgebung ab. Seine Fangzähne schoben sich hervor. Ein Zischen kam über seine Lippen.
Eine junge Frau in seiner Nähe warf ihm einen angsterfüllten Blick zu und wechselte die Straßenseite. Er bemerkte es kaum.
Seine Gedanken rasten. Dimitri konnte es nicht fassen. Er kannte diesen Duft, kannte ihn besser als seinen eigenen. Dieser ganz spezielle Geruch nach Zimt und Nelken hatte sich über Jahre in sein Gedächtnis eingebrannt.
Der Geruch seiner Gefährtin.
Sein Blick fokussierte sich auf die Treppe, die zur Bibliothek hinaufführte. Dort stand sie. Keinen Tag gealtert, als hätte jemand ihr Abbild aus seiner Erinnerung geholt und in die Realität projiziert. Sie stand seitlich zu ihm und kramte in ihrer Umhängetasche. Ihr schwarzes, schulterlanges Haar fiel ihr dabei ins Gesicht. Er wusste, dass es sich samtig anfühlte.
Dimitri konnte den Moment spüren, in dem der Schalter in seinem Gehirn, der vernünftiges Denken erlaubte, umgelegt wurde. Indem er zu einer der Bestien wurde, die unzählige Schauermärchen hervorgebracht hatten.
Sein Instinkt sagte ihm, dass er sie haben, sie in Sicherheit bringen, vor der Welt beschützen musste. Er durfte sie nicht noch einmal verlieren, würde es nicht ertragen, sie aus dieser Welt gehen zu sehen. Er war verloren ohne sie.
In dem Moment, als er sich in Bewegung setzen wollte, schob sich jemand in sein Blickfeld. Er atmete ein: Dieser jemand roch nach Katze, nach Jaguar. Es war Trace.
Der vernünftige Teil seines Verstandes hätte ihm jetzt gesagt, dass er Trace kannte. Dass der Jaguar seit dem Angriff Hailey und deren schwerer Verletzung vor ein paar Monaten ein Freund des Clans war und er ihn nicht angreifen sollte. Aber Dimitris Vernunft war ausgeschaltet.
»Hey, D. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen.« Der leicht amüsierte Tonfall schmerzte in seinen Ohren. Er hatte dafür jetzt keine Zeit. Er musste zu ihr.
Aber Trace bewegte sich nicht. Stattdessen stellte er sich ihm jetzt noch energischer in den Weg.
»Dimitri?« Der Jaguar klang nun nicht mehr amüsiert. »Was ist los mit dir?« Er legte dem Vampir beide Hände auf die Schultern.
Dimitri knurrte. Der Jaguar sollte ihm besser aus dem Weg gehen. Er schob sich vorwärts. Trace hielt dagegen.
Bevor der Vampir ausholen konnte, um seinen Gegenüber das Genick zu brechen, sprach dieser bereits in ein Handy.
»Hailey? Etwas stimmt mit Dimitri nicht … Bibliothek … Und bring Kyriakos mit, ich befürchte, der Vampir dreht gleich durch.«
Dimitri blickte in die goldenen Augen seines Gegenübers. »Okay, D, wir beruhigend uns jetzt. Ich weiß zwar nicht, was mit dir los ist, Kumpel, aber du siehst aus, als würdest du gleich einen Mord begehen. Und du weißt doch, wie die Menschen auf ein Blutbad auf offener Straße reagieren. Die schreien dann immer sofort Zeter und Mordio, greifen zu Mistgabeln und Fackeln und wollen Jagd auf uns machen.«
»Lass. Mich. Los.« Dimitri knurrte die Worte, ohne den Blick von ihr abzuwenden.
»Das kann ich leider nicht tun. Und weißt du auch, wieso nicht?«
Dimitri zischte ungehalten. Es interessierte ihn nicht! Wieso verschwand der Jaguar nicht einfach?
»Weil ich nicht zulassen kann, dass du in diesem Zustand irgendwohin gehen willst. Ich müsste Gewalt anwenden, um dich davon abzuhalten. Und dann würden wir uns prügeln, und wir beide wissen, dass ich diesen Kampf gewinnen würde.«
Während Trace vor ihm immer weiterredete, konzentrierte sich Dimitri ganz auf die Frau auf der Treppe, die das gefunden zu haben schien, was sie in der Tasche gesucht hatte, und nun auf die Tür zuging. Gleich würde sie verschwunden sein. Dimitri heulte auf, weil Trace ihn nicht aus seinem Griff entweichen ließ.
Gerade als der Vampir Trace angreifen wollte, schob sich eine Frau in sein Blickfeld, die so schwer atmete, als wäre sie gerade wie der Teufel gerannt. Der Jaguar trat beiseite, und sanfte, warme Hände legten sich auf seine Wangen.
»Dimitri. Sieh mich an.« Ein Gefühl der Wärme durchflutete ihn, als er ihre Stimme vernahm. »Hey, ich bin’s – Hailey. Sieh mich an, Dimitri.«
Der Vampir schüttelte unwillig den Kopf. Hailey versuchte, in seinen Geist einzudringen. Versuchte, ihm die Emotionen und Gefühle zu nehmen, die er so lange verdrängt hatte. Doch er brauchte diese Gefühle. Brauchte sie, um sich wieder lebendig zu fühlen. Wieso wollte diese Frau ihn von der Erlösung fernhalten?
Er knurrte erneut und holte aus. Die Augen der Frau weiteten sich vor Schreck. Er griff nach ihrem Handgelenk, um sie aus dem Weg zu ziehen. Hailey schrie auf und fiel zu Boden. Wenige Augenblicke später schlangen sich die starken Arme eines anderen Vampirs von hinten um ihn. Dimitri hörte ein leises, eindringliches Knurren, das nicht von Trace stammen konnte. Spürte eine Hand an seiner Kehle. Rot-schwarze Augen, die ihn mit mörderischer Wut ansahen. Plötzlich waren da zwei weitere Vampire, die seine Arme festhielten.
»Gib mir einen Grund, warum ich dich nicht sofort töten sollte, nachdem du meine Gefährtin angegriffen hast«, hörte er Kyriakos sagen.
Aber Dimitri war außerstande, etwas zu sagen. Sie bewegte sich weiter von ihm weg. Die Tür zur Bibliothek öffnete sich. Er drehte durch.
Brüllend griff er seinen König an, ungeachtet der Hand an seiner Kehle. Er nutzte den winzigen Augenblick der Überraschung und traf Kyriakos mit der Faust im Gesicht. Dieser erholte sich beinahe sofort und drückte mit seiner Hand zu, würgte Dimitri. Gleichzeitig zogen ihn die zwei Vampire nach hinten, weg von der Frau. Dimitri bäumte sich auf, während Kyriakos ihn weiter von der Bibliothek wegschob.
Dimitri hörte Stimmen, die ihm bekannt vorkamen, durcheinanderreden, aber die Worte konnte er nicht verstehen. Er kämpfte stärker gegen die Wesen, die ihn von ihr wegbringen wollten. Da drehte sich die Frau zu ihm um. Ihre Blicke trafen sich. Dunkelbraune Augen sahen in seine, und er konnte erkennen, wie sich ihre Pupillen weiteten. Dimitri heulte auf vor Schmerzen. Ein harter Stoß traf ihn an der Schläfe. Dunkelheit senkte sich über ihn.
Amila hatte den Kopf gehoben, als sie die Geräusche bemerkte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite war ein Tumult entstanden, Menschen flohen davor. Sie blinzelte. Was war da los?
Sie konnte eine kleine Gruppe erkennen. Eine Frau stand vor einem großen Mann mit hellen Haaren, dessen Arme von einem anderen Mann hinter seinem Rücken festgehalten wurden. Plötzlich tauchten drei weitere Männer auf. Sie kannte den, der voranging: Es war Kyriakos, der Anführer der Vampire. Die anderen beiden hatte sie noch nie gesehen, aber selbst aus der Entfernung konnte sie ihre Schönheit erkennen. Sie runzelte die Stirn. Wurde sie gerade Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen den beiden stärksten Mächten in New Orleans, den Vampiren und den Wölfen? Oder verlor einer der Vampire gerade die Kontrolle über sich? Dann sollte sie besser verschwinden.
Da kreuzte ihr Blick den des Mannes, der inzwischen von vier anderen festgehalten wurde, und sie erstarrte. Ihr Herz schien für einen Moment auszusetzen, ohne dass sie sich erklären konnte, warum. Ihr linkes Handgelenk kribbelte. Der Mann schrie auf, und Amila krümmte sich beinahe bei diesem wehklagenden Ton. Schmerz lag darin, ein so abscheulicher, dass niemand ihn ertragen konnte. Sie keuchte. Unwillkürlich bewegte sie sich auf den fremden Vampir zu.
In diesem Moment sah sie den Anführer der Vampire ausholen, und schon ging der hellhaarige Mann zu Boden.
»Nein«, flüsterte sie.
Einen Moment später schüttelte sie den Kopf. Was war los mit ihr? Das ging sie gar nichts an. Irritiert checkte sie die Uhrzeit auf ihrer Armbanduhr. Ohne das schmerzhafte Ziehen in ihrem Herzen weiter zu beachten, ging sie in die Bibliothek.
Aber den Blick aus diesen schmerzerfüllten, silbern-schwarzen Augen konnte sie den restlichen Tag nicht vergessen.
Dimitri lauschte den Gesprächen um ihn herum mit geschlossenen Augen. Er war bereits vor einer kleinen Weile aufgewacht, aber er hatte sich nicht gerührt und so hatte es niemand bemerkt.
»Es war nicht seine Schuld.« Das war Hailey. Sie stand in der Nähe seines Bettes. Dimitri spürte die schweren Stahlfesseln an Hand- und Fußgelenken, die ihn dort festhielten.
»Er hat dich verletzt! Und du bist ein Mensch. Deine Wunden heilen nicht so schnell wie unsere.« Kyriakos. Etwas in ihm krampfte sich zusammen. Er hatte Hailey wehgetan? An die Ereignisse vor seiner Ohnmacht konnte er sich nur verschwommen erinnern. Er wusste, dass er gedacht hatte, seine Gefährtin zu sehen. Aber das konnte nicht sein. Amila war schon seit fünfhundert Jahren tot. Vielleicht verlor er nun endgültig den Verstand.
»Ich habe ihn noch nie so erlebt«, sagte Castigo in dem Moment. Der Ruhigere der Zwillinge, die zum Clan und zum inneren Kreis gehörten.
»Ich auch nicht«, ergänzte sein Bruder Calisto.
»Siehst du?«, sagte Hailey. »Die Zwillinge haben es auch bemerkt. Etwas stimmte mit Dimitri nicht. Er hätte mich sonst nie angegriffen.«
Kyriakos knurrte. »Und was wäre passiert, wenn ich nicht bereits auf dem Weg in die Stadt gewesen wäre? Wenn ich auch nur einen Moment später gekommen wäre? Was, wenn er dich getötet hätte?«
Dimitri hielt den Atem an. Ja, was wäre passiert, wenn Kyriakos nicht so schnell aufgetaucht wäre? Hätte er Hailey in einem Anfall von Wahnsinn getötet? Er betete zu Gottheiten, an die er nicht glaubte, dass das nie geschehen würde.
Hailey bewegte sich. Als sie sprach, war es nur ein Flüstern. »Dimitri hätte mich nicht getötet.« Sie klang überzeugt. Er wünschte, er wäre es auch.
Dimitri hatte genug. Er wollte Kyriakos’ Antwort gar nicht erst hören. Er bewegte sich und öffnete blinzelnd die Augen. Sofort war Hailey an seiner Seite. Mit einer Handbewegung schickte sie die anderen aus dem Raum, und selbst Kyriakos ging, wenn auch offensichtlich widerstrebend.
Sie setzte sich neben das Bett auf einen Stuhl. Ihr Handgelenk war verbunden. Er wandte den Blick ab und starrte an die Decke.
»Wie schlimm ist es?«, fragte er leise.
»Halb so wild …«
»Lüg mich nicht an«, unterbrach er sie.
Sie seufzte. »Die Knochen waren komplett zerstört. Ohne Kyriakos’ Blut hätte ich die Hand verloren.«
Dimitri schloss die Augen. Hätte Kyriakos nicht eingriffen, wäre sie jetzt ganz sicher tot.
»Es tut mir leid.« Das Reden fiel ihm vor lauter Scham und Selbsthass schwer. Da fand er nach Jahrhunderten einsamer Existenz ein Wesen, das er als Freund bezeichnen konnte, und tat ihr so etwas Entsetzliches an. Es schien, als wäre er zu einer Gefahr geworden. Wahnsinnig. Unberechenbar.
»Das muss es nicht. Es war nicht deine Schuld.« Sie legte ihre Hand auf seine. Er zog die Hand weg. Die Fesseln klirrten leise. So wurde nur ein Vampir gesichert, der anscheinend den Verstand verloren hatte. Entweder sie würden ihn sofort töten oder in die Burg bringen und fesseln. Da er ausgerechnet die Gefährtin des Königs angegriffen hatte, war es wahrscheinlich nur seinem Status und Hailey selbst zu verdanken, dass er überhaupt noch lebte. Fast wäre es ihm lieber gewesen, Kyriakos hätte ihn getötet.
»Was passiert jetzt?«, fragte er.
»Am besten fangen wir damit an, dass du mir erzählst, was da vorhin passiert ist.«
Er blinzelte. »Kyriakos wird mich nicht töten?«
Hailey schüttelte heftig den Kopf. »Natürlich nicht. Du gehörst zur Familie, Dimitri. Und wir töten keine Familienangehörigen.«
Er schwieg eine ganze Weile. Das Vertrauen, das diese Frau in ihn setzte, schien grenzenlos zu sein. Und so behandelte sie alle Mitglieder von Kyriakos’ innerem Kreis.
Er drehte den Kopf zu ihr und sah sie an. Seitlich die Beine auf der Sitzfläche angezogen, so saß sie auf dem Stuhl und barg das Handgelenk in ihrem Schoß.
»Wie lange dauert es, bis deine Wunde wieder verheilt ist?«, wollte er wissen.
»Mit ein bisschen blutiger Hilfe wohl circa eine Woche.«
Er musste die Knochen wirklich zermalmt haben.
»Wie kannst du hier sitzen und mich anlächeln, nachdem ich dir das angetan habe?«
»Dimitri, ich kenne dich. Ich habe in deine Seele gesehen. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, dass du mir niemals etwas zuleide tun würdest, wenn du bei Sinnen wärst.« Sie neigte den Kopf. »Also erklär mir, was geschehen ist. Gib mir etwas, was ich Kyriakos erzählen kann …«
… damit er dich nicht tötet.
Sie musste den letzten Teil des Satzes nicht aussprechen. Sie beide wussten, was geschehen würde, wenn Kyriakos von seiner Schuld überzeugt war.
Dimitri überlegte, ob er nicht einfach schweigen sollte. Dann wäre es vorbei.
Aber was, wenn du nicht verrückt geworden bist? Was, wenn sie wirklich wieder lebt?
So sehr er sich den Tod wünschte, diese Stimme konnte er nicht ignorieren. Er musste herausfinden, ob er verrückt geworden war oder ob irgendein wahnwitziger Zug des Schicksals ihm seine Hoffnung zurückgebracht hatte.
Er holte tief Luft. »Ich habe sie gesehen.«
Hailey schnappte nach Luft. »Du hast deine Gefährtin gesehen?«, flüsterte sie.
Er nickte. »Sie stand vor der Bibliothek.«
Eine ganze Weile herrschte Schweigen, als sie beide die Möglichkeiten kalkulierten. Hailey war die Erste, die wieder sprach.
»Aber … Dimitri … Amila ist …«
»Ermordet worden.« Er seufzte. »Ich weiß. Ich habe ihren vergewaltigten und sterbenden Körper auf dem Boden unserer Hütte gefunden.«
»Aber jetzt hast du sie gesehen.«
»Ja. Also habe ich entweder den Verstand verloren oder meine Gefährtin wurde wiedergeboren.«
»Was ist, wenn diese Frau ihr nur ähnlich sah?«, fragte Hailey.
»Sie war es. Sie sah genauso aus wie damals. Selbst ihr Geruch war derselbe, und du weißt, dass es den gleichen Geruch nicht zweimal auf der Welt gibt.«
Hailey erhob sich. »Ich spreche mit Kyriakos.«
»Nehmt ihm die Fesseln ab«, sagte sie zu den Zwillingen, als sie an der Tür war.
Castigo betrat den Raum, sein Bruder Calisto folgte ihm. Wie immer trugen sie exakt die gleiche Kleidung und waren auch sonst kaum zu unterscheiden. Das gleiche dunkelbraune Haar, der gleiche Körperbau, die gleiche Art zu sprechen und sich zu bewegen. Die gleiche Schönheit, die schon unzählige Frauen ins Verderben gestürzt hatte. Nur ihre Augen unterschieden die teuflischen Zwillinge. Castigos waren von einem tiefen Dunkelbraun, beinahe schwarz. Calistos hingegen leuchteten in den Farben des Sonnenuntergangs.
Die Vergangenheit der Zwillinge war ein einziges Geheimnis. Sie sprachen nie darüber, aber es musste etwas geschehen sein, das Castigo hatte anders werden lassen als sein Bruder. Er konnte zwar ein genauso draufgängerischer Unruhestifter sein wie Calisto, allerdings hatte man bei ihm immer das Gefühl, dass er sich stets zurückhielt.
Dimitri hatte das einmal gegenüber Kyriakos erwähnt. Aber er hatte nie eine Antwort erhalten.
Mit einem metallischen Klicken öffneten sich die Fesseln, und Dimitri konnte aufstehen. Die Zwillinge behielten jede seiner Bewegungen im Auge.
»Und hast du den Verstand verloren?«, fragte Calisto.
»Ich weiß es nicht.«
Calisto, der freundlicher war als sein Bruder, grinste ihn an und schlug ihm auf die Schulter. »Das wird schon.«
Castigo hingegen schwieg und bedeutete seinem Bruder mit einem Kopfnicken, dass sie gehen sollten. Kurz darauf war Dimitri mit sich alleine.
Er zog sich das Shirt über den Kopf, stellte sich vor den Spiegel und betrachtete das ergraute Gefährtenmal. So sah es aus, wenn ein Vampir seine Partnerin verlor.
Konnte es wahr sein? Konnte Amila wiedergeboren worden sein? War so etwas überhaupt möglich? Und falls es so war, erinnerte sie sich dann an ihn? Was, wenn nicht?
Was würde geschehen, wenn seine Gefährtin wieder auf dieser Welt wandelte, sich aber nicht an ihr gemeinsames Leben erinnerte? Würde ihn das endgültig zerstören?
4
2112 Stunden
Er hasste die Dunkelheit. Die Schwärze in ihm verschluckte alles, bis seine Umgebung hinter einem undurchdringlichen Schleier verschwand. Darin gab es keine Geräusche, keine Reize, keine Ablenkung. In der Dunkelheit herrschte Stille.
Und die Stille schrie ihren Namen. Alles, was er sehen konnte, war ihr Gesicht. Alles, was er riechen konnte, war ihr Duft. Alles, was er hörte, war ihre Stimme.
Dimitri saß auf dem Fußboden seines Wohnzimmers und betrachtete den aufgehenden Mond durchs Fenster. In seinem Verstand herrschte eine einzige Frage: War Amila noch am Leben?
Er wagte nicht, daran zu glauben. Die Hoffnung war schlimmer als jeder Schmerz. Er war so durcheinander, dass er keine Ahnung hatte, was er als Nächstes tun sollte. Sollte er sie suchen? Mit ihr reden? Was würde er tun, wenn die Frau vor der Bibliothek nicht Amila gewesen war? Was, wenn ihm eine Fremde gegenüberstand?
Wütend auf sich selbst und die Welt warf Dimitri das reich verzierte Glas mit dem dicken Boden quer durch den Raum gegen die Wand. Glas splitterte, Scherben sprangen über den Boden. Eine dunkle Stimme erfüllte den Raum.
»War das nicht ein Einzelstück, das du irgendeinem vor Jahrhunderten gestorbenen russischen Zaren gestohlen hast?«
»Möglich.«
Dimitri rührte keinen Muskel, als sein König sich geräuschlos neben ihn auf den Boden setzte. Was würde jetzt passieren? Würde Kyriakos ihn töten, für das, was er Hailey angetan hatte?
»Hailey hat mit mir gesprochen«, sagte Kyriakos tonlos.
Dimitri griff nach der Flasche Beluga Wodka neben sich und nahm einen großen Schluck. Wie viel er wohl noch trinken musste, bis er endlich betrunken war?
»Sie will nicht, dass ich dich umbringe. Sie sagt, man tötet die Familie nicht. Ich bin mir da noch nicht sicher.«
Dimitri atmete tief durch, schwieg jedoch.
»Ich hätte das Recht, dich zu töten. Du hast meine Gefährtin angegriffen. Aber ich habe deinen halbtoten Arsch damals nicht aus der Höhle gezogen, um dich jetzt einen Kopf kürzer zu machen.«
Dimitri trank noch einen Schluck Wodka, um seine Regung zu verbergen. Zu seiner Überraschung verspürte er Erleichterung. Das war seltsam, da er sich nie vor dem eigenen Tod gefürchtet hatte, ihn die letzten Jahrhunderte sogar herbeigesehnt hatte.
»Ich hätte es verdient.«
Kyriakos nickte. »Und solltest du noch einmal auch nur einen Finger heben, um Hailey Schaden zuzufügen, dann werde ich dich töten. Und ich werde nicht zögern.« Er legte Dimitri die Hand auf den Unterarm. »Jetzt erzähl mir von Amila. Sie lebt wieder?«
»Vielleicht.«
»Dimitri, lass mich dir einen guten Rat geben. Ich bin schon eine ganze Weile auf dieser Welt. Und das Schicksal greift nur ganz selten aktiv ins Geschehen ein. Hailey und ich? Schicksal. Du und Amila? Schicksal. Sollte dies also einer der seltenen Momente sein, in denen das Schicksal gemerkt hat, dass es einen Fehler gemacht hat, dann nutze diese Chance.«
Dimitri schwieg.
»Hast du mich verstanden? Du solltest alles daransetzen, herauszufinden, wer sie ist.«
Dimitri lehnte den Kopf gegen die Wand und starrte den Mond an. »Ja.«
Kyriakos erhob sich und verschwand genauso lautlos, wie er gekommen war. Und Dimitri blieb mit der Frage zurück, wie er herausfinden sollte, ob seine Gefährtin tatsächlich wieder lebte.
Schließlich stand er auf, schnappte sich einen herumliegenden Dolch und hatte sich bereits auf dem Weg zum Bett die ersten, tiefen Schnitte gesetzt.
Amila lag auf ihrem Schlafsofa und starrte den Mond an. Die helle Sichel beleuchtete die spärliche Einrichtung ihrer Wohnung. Heute Nacht wollte einfach kein Schlaf über sie kommen. Wie jeden Tag checkte sie alle paar Minuten die Uhrzeit. Sie war wie besessen von der Zeit.
Immer wieder erlebte sie die Szene vor der Bibliothek. Wer war dieser Mann mit den unglaublichen Augen? Und was war der Grund für den Tumult gewesen?
Und wieso interessierte sie das Ganze überhaupt? Es war ja schließlich nicht so, als hätte das etwas mit ihr zu tun gehabt. Außerdem hatte sie ganz andere Probleme, um die sie sich kümmern musste.
Wie immer, wenn sie an den Pakt dachte, den sie damals geschlossen hatte, wurde ihr schlecht. Jetzt blieben ihr keine 2133 Stunden mehr. Weniger als 88 Tage. Nicht einmal mehr drei Monate.
Verzweiflung nagte an ihr, aber Amila kämpfte dagegen an. Denn sie hatte die Befürchtung, dass sie in ein tiefes Loch fallen würde, wenn sie sich auf dieses Gefühl einließ. Vielleicht würde sie nie mehr frei sein. Und wenn sie schon bald sterben sollte, dann wollte sie die letzten Tage wenigstens auskosten und nicht alles noch schlimmer machen.
Unwillig drehte sie sich auf die Seite. Sie musste jetzt wirklich schlafen, schließlich hatte sie eine neue Liste mit Büchern erstellt, die sie morgen nach einem Ausweg durchforsten musste. Und dabei würde ihr der Mann mit den schwarz-silbernen Augen bestimmt nicht helfen.
5
2088 Stunden
Er musste vollkommen den Verstand verloren haben, wenn er es auch nur in Betracht zog, dass Amila noch lebte. Das Schicksal war nicht gnädig. Trotzdem stand er vor der Bibliothek.
Dimitri zögerte, sie zu betreten. Das war lächerlich. Er war ein Vampir. Gehörte zur Leibgarde des Königs. Er hatte Menschen und magische Wesen gefoltert und getötet. Und jetzt hatte er Angst, eine verdammte Bibliothek zu betreten.
Aber allein die Vorstellung, dass er gleich in Amilas vertraute Augen blicken könnte, ließ ihn beinahe in die Knie gehen. Ein Bild blitzte in seinem Gedächtnis auf. Blasse Haut, dunkle Augen voller Angst, weit geöffnete Lippen, überall Blut. Das letzte Mal, dass er in die Augen seiner Gefährtin gesehen hatte.
Er schob diese Erinnerung beiseite und betrat endlich die Bibliothek. Es war nicht das erste Mal, dass er dieses Bild vor sich gesehen hatte, und es war bestimmt nicht das letzte Mal gewesen.
Drinnen erwarteten ihn klimatisierte Luft und der Geruch nach Magie und alten Büchern. Blitzschnell scannte er die Umgebung. Er konnte die Frau nicht entdecken. Enttäuschung machte sich in seinem Herzen breit.
Unschlüssig, was er als Nächstes tun sollte, ging er hinüber zu den Regalen, die sich hoch in den Raum erstreckten. Die Bibliothek war in einer alten Kirche errichtet worden, und die hohe Decke vermittelte ein Gefühl von Weite. Während Dimitri zwischen den alten Holzregalen, die mit Büchern vollgestopft waren, hindurchschritt, versuchte er sich einen Plan zurechtzulegen. Eine Idee, was er tun würde, wenn er sie gefunden hatte. Er suchte nach Worten, die er zu ihr sagen konnte. Aber es schien, als hätte sich sein Verstand verabschiedet und das Chaos die Kontrolle übernommen.
Schließlich ließ er sich an einem der Tische nieder und wartete. Die Zeit verstrich, und er beobachtete, wie Menschen und magische Wesen kamen und gingen. Mit jeder Minute, die verstrich, wurde er nervöser. Und je nervöser er wurde, desto wütender wurde er auf sich selbst.
Gerade als er den Drang verspürte, aufzuspringen und den langen Holztisch vor ihm quer durch die Bibliothek zu werfen, öffnete sich die große Flügeltür am anderen Ende des Raums. Dimitri blickte auf und fletschte die Zähne.
Hailey trat ein, flankiert von Castigo und Calisto. Im ersten Moment erhob sich ein leichtes Gemurmel unter den Besuchern der Bibliothek, als die Königin der Vampire ihren Blick schweifen ließ. Ihr Handgelenk steckte noch immer in einem dicken Verband. Dimitri konnte den Anblick der Verletzung, die er verursacht hatte, kaum ertragen.
Als sie ihn entdeckte, bewegte sie sich auf ihn zu. Die Zwillinge folgten ihr wie dunkle, bösartige Schatten. Immer, wenn die Vampire des inneren Kreises die sichere Umgebung der Burg verließen, legten sie den freundlichen und fürsorglichen Teil von sich selbst ab, den sie untereinander zeigten. Draußen waren sie Raubtiere, die kämpften, um die Machtstellung ihres Königs zu untermauern, wenn dies nötig war. Und besonders, wenn sie mit Hailey unterwegs waren, waren alle Vampire angespannt und sahen sich aufmerksam nach möglichen Gefahren um. So wie die Zwillinge in diesem Moment.
Aus den Augenwinkeln bemerkte Dimitri, wie sich eine Handvoll Besucher leise von ihren Stühlen erhob und die Bibliothek verließ. Nicht jeder fühlte sich in Haileys Gegenwart wohl. Besonders nicht, wenn sie in Begleitung von Vampiren war. Da half auch ihre freundliche, empathische Ausstrahlung nicht. Jedes magische Wesen in New Orleans hatte Angst, diese Frau zu verärgern oder auch nur falsch anzusehen.
Wütend ballte Dimitri die Hände zu Fäusten. Es störte ihn nicht so sehr, dass Hailey hier aufgetaucht war, selbst wenn er diese Sache lieber allein geregelt hätte. Nein, was ihn wirklich störte, war, dass die Zwillinge sie begleiteten. Anscheinend traute auch sie ihm nicht mehr zu, sich zu beherrschen. Dabei wusste niemand, wie es wirklich in ihm aussah. Nicht einmal Hailey hatte tief genug in ihn geblickt, um das zu wissen. Seit Jahrhunderten lebte er mit einem Schmerz, der so tief war, dass er die Struktur seiner Existenz verändert hatte. Dimitri lebte eine unendliche Folter.
Als sie ihn erreichte, grinsten die Zwillinge ihn an. Hailey aber schaute ernst.
»Hältst du das für eine gute Idee?«, fragte sie.
»Ich komme auch alleine zurecht«, antwortete er.
»Hey, als wir dich das letzte Mal allein gelassen haben, bist du völlig durchgedreht, D«, warf Calisto ein. Seine Sonnenuntergangsaugen blitzten vergnügt. Es gab nichts, was die Zwillinge mehr liebten als das Chaos. Na ja, außer vielleicht Sex. Sex und Chaos waren der Lebensinhalt der teuflischen Zwillinge.
Hailey blickte über ihre Schulter. »Lasst uns alleine.«
»Bist du dir sicher?«, fragte Castigo. Er hatte das gleiche Grinsen im Gesicht wie sein Bruder, allerdings erreichte es nicht die Augen.
Hailey richtete den Blick ihrer blaugrünen Augen auf Castigo. Es dauerte einen kleinen Moment, aber dann zogen sich die Zwillinge zurück. In den paar Monaten, in denen Hailey jetzt bei ihnen war, hatte sie gelernt, sich zu behaupten.
Sie nahm Dimitri gegenüber Platz und schaute sich in der Bibliothek um, bevor sie ihm in die Augen sah.
»Ich wollte nur sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob es eine kluge Idee ist, dass du alleine hergekommen bist. Deswegen bin ich hier. Ich wollte dich unterstützen, egal, was du vorhast.«
Dimitri schwieg, und Hailey seufzte.
»Ich wollte die Zwillinge ja nicht mitnehmen, aber Kyriakos …« Sie zuckte mit den Schultern.
Was sollte er dazu sagen?
Natürlich wollte Kyriakos Hailey nicht ohne Geleitschutz in seiner Nähe wissen. Verständlich, nach dem, was Dimitri getan hatte.
»Ich war seit meiner Zeit an der Akademie nicht mehr hier«, murmelte Hailey und lächelte schief.
Dimitri blickte über die Schulter und suchte nach den Zwillingen. Er konnte sie nicht sehen, spürte aber ganz deutlich, dass sie in der Nähe geblieben waren, und das verursachte ihm Unwohlsein. Er teilte seinen Schmerz nicht gerne mit anderen.
»Ist sie denn hier?«, fragte Hailey schließlich, nachdem er immer noch nichts gesagt hatte.
»Ich habe sie noch nicht gesehen.« Dimitri zog einen der Dolche aus dem Holster an seiner Hüfte. Er ging nie nach draußen, ohne mindestens einen von ihnen bei sich zu tragen. Schließlich konnte er nie wissen, wann die psychischen Qualen so stark wurden, dass er sie mit körperlichem Schmerz überdecken musste.
Er ließ das scharfe Metall über seine Hand tanzen und genoss das leichte Brennen des Silbers.
Kurz berührte Hailey seine freie Hand und erhob sich dann. »In Ordnung. Ruf mich an, wenn du mich brauchst.« Sie wartete gar nicht erst auf eine Antwort, drehte sich um und ging. Wie aus dem Nichts tauchten die Zwillinge wieder hinter ihr auf, begleitet von bewundernden Blicken der weiblichen Anwesenden.
Dimitri blieb in der Stille der Bibliothek zurück, nachdem die Tür hinter ihnen zuschlug. Er konnte nicht gehen, weil die Versuchung, Amila wiederzusehen, einfach viel zu groß war. Allerdings konnte er auch nicht bleiben, da er Gefahr lief, bei ihrem Anblick wieder die Kontrolle zu verlieren.
Dimitri stand auf und zog sich in den hinteren Bereich der Bibliothek zurück. Hier schienen ältere Bücher gelagert zu sein. Staub flirrte in der Luft und funkelte leicht in der Sonne, die durch die Fenster hineinfiel. Er blieb vor einem der Regale stehen und besah sich ohne großes Interesse die Buchrücken. Anscheinend alles Werke, die sich mit Flüchen und deren Auflösung beschäftigten. Bitter fragte er sich, ob er hier wohl auch ein Heilmittel gegen den Fluch seiner Existenz finden würde.
Er wandte sich ab und atmete tief durch. Da roch er es. Zimt und Nelken. Einzigartig, unverwechselbar. Berauschend. Seine Hände begannen zu zittern. Verzehrende Sehnsucht mischte sich mit der Einsamkeit in seiner Seele. Ein Hauch von Hoffnung entzündete einen winzigen hellen Funken in der Dunkelheit, die ihn erfüllte. Eine Mischung, die Explosionsgefahr barg.
Vorsichtig machte Dimitri einen Schritt in die Richtung des Duftes. Er hörte, wie jemand eine Buchseite umblätterte. Seine Muskeln verkrampften sich.
Ein Seufzen. Alles in ihm kam zum Stillstand. Er kannte dieses Geräusch. Amila hatte so geklungen, wenn sie vor einer schwierigen Aufgabe stand und bereits einige ihrer Versuche gescheitert waren.
Schwarze Blitze zuckten vor seinen Augen, aber er ging trotzdem weiter. Er konnte nicht umkehren. Er war so tief in dem Strudel aus Verzweiflung und Hoffnung gefangen, dass es für ihn kein Zurück mehr gab.
Schließlich blieb er am Ende eines langen Regals stehen. Sie musste dahinter sitzen. Er konnte ihre leisen Atemzüge hören. Ihr Duft wirkte nun geradezu berauschend auf ihn. Die besondere Note überdeckte alles, holte lange verdrängte Erinnerungen aus der Dunkelheit zurück. Die Hoffnung, dass seine Gefährtin vielleicht wiedergeboren sein könnte, verschlang ihn geradezu. Wie eine unaufhaltbare Flutwelle hatte sich das Gefühl bis zu diesem Moment zusammengebraut. Jetzt konnte er nur noch versuchen, sich über Wasser zu halten.
Dimitri ließ den Dolch verschwinden und ballte stattdessen die Hände zu Fäusten. Die Fingerknöchel traten weiß hervor, als er so fest zudrückte, dass sich die Fingernägel in sein Fleisch bohrten. Erst als er den scharfen Geruch seines eigenen Bluts wahrnahm, wagte er einen Blick auf das zu werfen, was hinter dem Regal lag.
Dort saß sie.
Sehr alt aussehende Bücher türmten sich vor ihr, waren über den kleinen Tisch verstreut, an dem sie saß. Sie saß im Schneidersitz auf dem Stuhl, der leise knarrte, als sie sich in diesem Moment bewegte. Da sie gerade etwas in ein zerfleddertes Notizbuch schrieb, bemerkte sie ihn gar nicht. Ihre dunkelbraunen, beinahe schwarzen, leicht gelockten Haare hatte sie mit einem Stift zu einem Knoten im Nacken zusammengefasst. Sie saß nur etwa zwei Meter von ihm entfernt, und er konnte den ruhigen Puls an ihrem Hals sehen. Er erinnerte sich an den Geschmack ihres Blutes. Seit sie tot war, hasste er die Nahrungsaufnahme. Er verabscheute den Geschmack fremden Blutes.
Das letzte Mal, als er ihre Haut gesehen hatte, war sie bleich und weiß vom Blutverlust gewesen, jetzt hatte sie den Karamellton, den er so geliebt hatte. Auch ihr fein geschnittenes Profil war noch exakt das gleiche. Ein dezenter rosa Schimmer lag auf ihren Wangen. Sie drehte den Kopf in seine Richtung, blickte aber nicht auf. Trotzdem erkannte er ihre leicht schräg gestellten Augen wieder.
Sein Herz raste.
Sie war es.
Sein Blickfeld zog sich zusammen.
Amila lebte.
Die Erinnerung explodierte geradezu in seinem Schädel.
Er wusste, dass er sie nicht hätte verlassen sollen. Irgendetwas hatte sich in dieser Nacht falsch angefühlt. Aber sie lebten so weit von jeder Zivilisation entfernt und hatten kein Essen mehr. Er musste etwas für Amila besorgen, und als junger Vampir konnte er das nur nachts tun.
Und jetzt litt sie.
Seine Gefährtin hatte Todesangst. Er spürte es.
Und noch immer war er viel zu weit entfernt. Die Welt rauschte schemenhaft an ihm vorbei. Er spürte ihre Angst, ihre Verzweiflung, als wäre es seine eigene. Das Band der Gefährten vibrierte.
Plötzlich verspürte er einen scharfen Schmerz im Bauch und geriet ins Stolpern.
»Nein«, stöhnte er.
Er beschleunigte sein Tempo, obwohl er wusste, dass er zu spät kam.
Kurz darauf brach er durch die Tür der einfachen Holzhütte, die Amila und er ihr Zuhause nannten, und dort sah er sie. Auf dem Fußboden. In einer Lache ihres eigenen Blutes. Ihr Kleid war zerrissen, und in dem Raum roch es nach Gewalt und Sex.
Er stürzte neben ihr zu Boden und barg sie an seiner Brust. Ihre Atmung war kaum wahrnehmbar, die Haut bleich, der Herzschlag langsam. Viel zu langsam.
Der Blick ihrer einst strahlenden dunkelbraunen Augen war stumpf. Sofort biss er sich ins Handgelenk und hielt es ihr an die Lippen. Aber es war zu spät. Sie war bereits zu schwach. Er konnte es spüren, wollte jedoch nicht aufgeben, presste sein blutendes Handgelenk stärker an ihre trockenen Lippen.
Amila drehte leicht den Kopf zur Seite und sah ihn an. Diese kleine Bewegung schien sie eine Unmenge an Kraft zu kosten. Angst rauschte durch seinen Körper wie eine zerstörerische Droge.
»Amila …« Seine Stimme war nicht mehr als ein Wispern. »Das wird schon wieder. Gib nicht auf. Ich helfe dir. Du schaffst das!«
Ein trauriges Lächeln erschien auf ihren Lippen, und ihre Hand zitterte stark, als sie diese zu seinem Gesicht hob. Er nahm sie und legte sie an seine Wange. Sie fühlte sich kalt an, und er sah in ihren Augen, dass sie es wusste.
»Bitte nicht …« Ein Tropfen fiel auf Amilas Wange, und erst jetzt wurde ihm bewusst, dass er weinte. »Ich darf dich nicht verlieren.«
Amila sah ihn an. Er hörte ihr Herz schlagen. »Ich …« Es geriet ins Stocken, setzte kurz aus. »Ich liebe dich, Dimitri.« Sie seufzte seinen Namen. Ihr Herz schlug einmal.
Dann … nichts mehr.
Stille.
Dimitri blinzelte, wurde wieder gewahr, wo er sich befand. In seinem Kopf herrschte weiter die Vergangenheit. Er bemerkte, wie Amila langsam den Kopf hob. Er stockte. Dann verschwand er. Blitzschnell und ohne ein Geräusch floh er aus der Bibliothek, ohne einen Hinweis auf seinen Besuch zu hinterlassen.
Er schaffte es bis in ein leeres Haus am Rande der Stadt, bevor er zusammenbrach und schrie. Er brüllte sich den Schmerz seiner Seele aus dem Leib, bis seine Stimme brach. Im nächsten Moment sprang er auf. Er griff nach dem nächstgelegenen vergessenen Möbelstück und warf es durch den Raum. Es knallte gegen eine Wand, so heftig, dass Teile der porösen Wand herausbrachen. Mit den Fäusten bearbeitete er Wände, Möbel, alles, was er erreichen konnte.
Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als er schließlich schwer atmend auf die Knie sank. Er hatte den unteren Teil des Hauses in ein Trümmerfeld verwandelt. Blut tropfte von seinen aufgeplatzten Fingerknöcheln.
Aber alles, was er sah, alles, was er riechen, spüren und schmecken konnte, war Amila. Seine Gefährtin, die ihn ein letztes Mal ansah und sagte, dass sie ihn liebte. Die in seinen Armen starb.
Und er hatte ihr nicht einmal mehr sagen können, dass er sie auch liebte.
6
2064 Stunden
Amila hatte für eine Weile das Gefühl gehabt, beobachtet zu werden. In diesen Augenblicken hatte sich die Atmosphäre in der Bibliothek verändert. Die Ruhe, die sie sonst innerhalb dieser Mauern fand, wollte sich auch den Rest des Tages über nicht mehr einstellen. Es war ein intensiver Moment gewesen, beinahe so, als hätte jemand direkt hinter ihr gestanden. Aber als sie den Blick von ihrem Notizbuch gehoben hatte, hatte sie niemanden entdecken können.
Und zu allem Überfluss hatte sie auch heute wieder keine Lösung in den Büchern finden können. Allerdings hatte sie einen Hinweis darauf entdeckt, wen sie fragen konnte. Und es war geradezu dumm, dass sie nicht bereits selbst auf diese Idee gekommen war.
Ein Dämon. Sie musste einen Dämon beschwören und ihn fragen, wie sie den Teufelspakt lösen konnte. Allerdings waren Dämonen nicht gerade für ihre Freundlichkeit bekannt. Also musste sie etwas suchen, das sie ihm anbieten konnte. Aber alles, was ein Wesen der Hölle begehrte, hatte sie bereits verkauft.
Amila seufzte und räumte die letzten Bücher für heute zur Seite. Sie hatte Feierabend, und ihr Magen erinnerte sie laut knurrend daran, dass sie seit dem Frühstück nichts gegessen hatte. So sehr war sie in ihre Studien vertieft gewesen.
Als sie an den Empfangstresen trat, blickte die Studentin, die dort arbeitete, auf.
»Wo warst du denn den ganzen Tag?«
Amila blinzelte verwirrt. Normalerweise interessierte sich kaum jemand dafür, wo sie sich aufhielt. Und schon gar nicht die Studentin vom Empfang. »Ich war im hinteren Teil der Bibliothek. Wieso?«
»Weil die Königin der Vampire heute hier war!« Das Mädchen klang aufgeregt. »Sogar in Begleitung! Wahrscheinlich noch zwei Vampire. Ist das nicht aufregend?«
Bei der Erwähnung von Vampiren musste Amila sofort an das Erlebnis des gestrigen Tages zurückdenken. Stimmte etwas nicht mit den Vampiren von New Orleans? Oder sollte es tatsächlich etwas mit ihr zu tun haben? Aber das wäre absurd.
»Aha«, erwiderte Amila, in ihren eigenen Gedankengängen versunken. Im Gegensatz zu der Studentin war sie kein Vampirgroupie, da sie sich nie sonderlich für Vampire interessiert hatte. Schließlich kamen sie, entgegen der Meinung mancher Menschen, nicht aus der Hölle, und konnten ihr somit auch nicht helfen.
»Sie hat sich mit einem gefährlich wirkenden Mann unterhalten.« Die Studentin erschauerte. »Irgendetwas an ihm war merkwürdig. Da war dieser Hauch von … von … Tod um ihn herum.« Sie zuckte mit den Schultern, als könnte sie sich ihr Gefühl selbst nicht erklären.
Amila beachtete sie nicht weiter, sondern griff sich einfach ihre Tasche und verabschiedete sich. Sie interessierte sich nicht für die magische Gemeinde von New Orleans. Sie war nur hierher gezogen, weil sie sich von der größten magischen Bibliothek des Landes eine Lösung erhofft hatte. Außerdem hatte sie wirklich genug von Magie. Sollte sie den Fluch lösen können, würde sie ein ganz normales, langweiliges, menschliches Leben führen. Und wenn sie den Teufelspakt nicht beenden konnte … Nun, dann würde die Belange dieser Welt sie ohnehin nicht mehr betreffen.
Feuer brannte sich einen Weg von ihrer Haut bis auf den Knochen. Amila atmete tief ein und biss sich auf die Lippe, um einen Schmerzenslaut zu unterdrücken. Der Minutenzeiger der Uhr bewegte sich ein Stück, und das Brennen wurde schwächer. Sie seufzte.
Jetzt waren es noch 2064 Stunden – was sich anhörte, als wäre es viel Zeit. Aber das stimmte nicht. Es war September, und noch vor Weihnachten würde sie sterben. Und nicht nur das: Während andere Menschen ins wohltuende Nichts, in das Paradies namens Himmel entglitten oder an was auch immer sie glaubten, würde ihre eigene Seele ein neues Zuhause in der Hölle finden. Sie würde sich einen Garten mit Luzifer und seinen Dämonen teilen müssen und die Ewigkeit würde für sie Folter und Schmerz bedeuten. Wunderbare Aussichten.
Während sie ihr Schlafsofa für die Nacht vorbereitete, erinnerte sie sich an den Moment, in dem ihr klar geworden war, dass sie keine andere Wahl hatte, als den Pakt einzugehen. Sie war damals im Krankenhaus gewesen, um ihre Mutter zu besuchen.
Als Krankenschwester hatte ihre Mutter schon vielen Menschen geholfen. Sie hatte unbeirrt Gutes getan, obwohl sie selbst kein glückliches Leben führte: Ihr Mann war ein Säufer und Spieler, der ihr gemütliches Zuhause in ein Minenfeld verwandelte, wann immer er dort auftauchte. Dennoch hatte ihre Mutter unermüdlich geschuftet und alles getan, damit es ihren Patienten gut ging.
Und dann war irgendwie alles schiefgegangen. Ein neuer Patient war ins Krankenhaus gekommen, mit merkwürdigen Symptomen, die alles oder nichts bedeuten konnten. Bevor den Ärzten klar geworden war, dass er eine hochansteckende Tropenkrankheit aus dem Urlaub mitgebracht hatte, war ihre Mutter bereits infiziert gewesen. Eine Woche später war der Patient tot, und ihre Mutter lag im Sterben.
Amila war damals gerade 18 Jahre alt gewesen, mehr Kind als Erwachsene. Und als sie ihrem Vater von der Krankheit ihrer Mutter erzählt hatte, fiel diesem nichts Besseres ein, als das Konto leerzuräumen und Hals über Kopf zu verschwinden. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt hatte sie ihn nicht wieder gesehen.
Zu jener Zeit hatte die Magie die Herrschaft über die Welt übernommen, und Amila hatte nicht zulassen können, dass ihre Mutter starb. Es hätte ihr eigenes Leben zerstört. Ihre Mutter war noch zu jung, zu lebensfroh, als dass ihre Zeit schon abgelaufen sein konnte. Das war einfach nicht richtig.
Also hatte sich Amila für einen vollkommen wahnwitzigen Plan entschieden, denn die Zeit drängte und ihre Mutter wurde immer schwächer.
Sie hatte nicht einmal selbst daran geglaubt, dass es funktionieren würde, bis sie in die roten Augen des Dämons geblickt hatte. Und bevor sie wusste, was sie da gerade tat, hatte sie ihre junge Seele verkauft. Ihrer Mutter wurde ein langes und erfülltes Leben gewährt. Und alles, was sie dafür opfern musste? Sich selbst. Ihre Mutter würde sich nicht mehr an sie erinnern, und Amila hatte von da an nur noch zehn Jahre zu leben.
Von diesen zehn Jahren waren bereits neun Jahre und neun Monate vergangen. 85 320 Stunden, die vorübergezogen waren, ohne dass sie einen Ausweg hatte finden können.
Amila schüttelte den Kopf, um die Vergangenheit abzuschütteln. Es war sinnlos, die Vergangenheit zu verfluchen. Was geschehen war, war geschehen. Außerdem wusste sie, dass sie das Richtige getan hatte. Würde sie heute vor derselben Entscheidung stehen, würde sie sich wieder für diesen Weg entscheiden. Niemals könnte sie bereuen, dass sie ihr Leben gegen das ihrer Mutter eingetauscht hatte.
Am nächsten Morgen schlich Dimitri auf der Galerie herum, von der aus er einen guten Überblick über die Bibliothek hatte. Er beobachtete, wie sich Männer und Frauen zwischen den Regalen bewegten, nach Büchern suchten und sich an einen der vielen Tische setzten. Dabei hielt er nur nach einer einzigen Person Ausschau, aber sie war noch nicht da.
Als er die Burg vorhin verlassen hatte, hatte Kyriakos ihn nur unter einer Bedingung gehen lassen: Er musste die Sache in Ordnung bringen. Denn anscheinend hatte Hailey in der letzten Nacht keinen Schlaf gefunden, weil Dimitris Gefühle zu aufgewühlt gewesen waren. Es überraschte ihn manchmal immer noch, wie fein die Gefährtin seines Königs auf ihn eingestimmt war.
Seine Gedanken wurden abrupt unterbrochen, als sich die Tür zur Bibliothek öffnete und seine Amila den Raum betrat. Mit einem leichten Lächeln auf den Lippen schlenderte sie zum Empfang und legte dort ihre Tasche ab. Kurz blieb sie stehen und blickte sich um, bevor sie in Richtung der Regale ging und in den hinteren Bereich verschwand.
Als leiser Schatten stieg Dimitri von der Galerie herab und folgte ihr, beobachtete jede ihrer Bewegungen. In der letzten Nacht hatte sein Verstand ihn mit Erinnerungen an ihre gemeinsame Vergangenheit gequält, und langsam wurde ihm ein Umstand immer klarer: Amila, falls sie in dieser Zeit überhaupt so hieß, erinnerte sich nicht an ihn. Sonst hätte sie nach ihm gesucht, denn sie hätte gewusst, dass er ein Vampir war und noch leben musste. Als seine Gefährtin hätte sie es außerdem nicht aushalten können, von ihm getrennt zu sein. Es hätte sie gequält, innerlich zerfressen, bis sie wieder in seinen Armen gelegen hätte. Das gleiche Gefühl, das ihn dazu gebracht hatte, die letzte Nacht damit zu verbringen, langsam die Dolchklinge über seinen Unterarm zu ziehen, um die Bilder aus der Vergangenheit aus seinem Kopf zu verbannen.
Tief sog er ihren Duft in die Lungen und ließ sich davon durchströmen. Er scheute sich davor, sich der Tatsache zu stellen, dass Amila sich nicht an ihn erinnerte. Welche Frau, die halbwegs bei Verstand war, würde ihm glauben, wenn er zu ihr ginge und ihr sagte, dass sie seine Gefährtin war? Dass die Ewigkeit für sie bestimmt gewesen war, bevor jemand sie brutal ermordet hatte?
Das andere Szenario, das er sich ausmalte, war vielleicht noch schlimmer: Amila erinnerte sich an ihn, hatte sich jedoch dafür entschieden, nicht zu ihm zurückzukehren. Vielleicht war durch ihren Tod die Verbindung für sie gelöst worden, und in ihrem neuen Leben war er nichts weiter als eine vage Erinnerung, der Hauch einer Vergangenheit, die wie in einen tiefen Nebel gehüllt war.
Lautlos entblößte er seine Fangzähne. Dimitri wünschte sich, dass er damals mit seiner Gefährtin diese Welt verlassen hätte.
Als Amila hinter einem Regal verschwand, blieb er kurz stehen, um sich zu sammeln. Er würde sie ansprechen, und allein bei dem Gedanken verkrampfte sich sein ganzer Körper. Endlich wieder ihre sanfte Stimme hören, der Melodie ihrer Worte lauschen. Das Blut rauschte ihm in den Ohren, die Hände zitterten. Kurz vergewisserte er sich, dass die noch nicht vollständig verheilten Wunden an seinen Armen von der Lederjacke verdeckt waren, bevor er auch um das Regal herumtrat.
Dabei stieß er mit jemandem zusammen. Zimt und Nelken kitzelten seine Nase. Warme Haut berührte seine Hände. Einen Wimpernschlag lang fühlte er einen fremden, doch vertrauten, Herzschlag an seiner Brust. Hörte ein überraschtes Keuchen. Dunkelbraune Katzenaugen mit goldenen Einsprengseln darin sahen ihn an. Sein linker Arm prickelte leicht. Sein Herz setzte einen Moment lang aus. Seine Pupillen zogen sich zusammen, seine Sicht verschärfte sich.
Ihre Blicke kreuzten sich.
Ein schüchternes Lächeln auf vertrauten Lippen.
Zwei Seelen erkannten sich.
Dimitri holte tief Luft. Es war Amila. Seine Gefährtin. Sie war vor Jahrhunderten gestorben, dennoch stand sie wieder vor ihm. Er kannte alles von ihr. Jeden Zentimeter ihrer Haut, jeden Winkel ihrer Seele. Und sie erkannte ihn. Dessen war er sich sicher. Es gab gar keinen Zweifel. Für ihn war das Gefühl, dass sie seine Gefährtin war, so stark, dass es ihr gar nicht anders ergehen konnte.
Sein Körper hatte sich innerhalb dieses winzigen Momentes wieder auf sie eingestellt. Das Gefährtenmal kribbelte auf seiner Haut, rief ihm in Erinnerung, dass dies der verlorene Teil seiner selbst war. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Irgendetwas, das ihr zeigte, wie sehr er sie vermisst hatte. Dass er nicht glauben konnte, dass sie wieder bei ihm war. Dass jetzt alles gut werden würde. Dass er sich um sie kümmern und sie nie wieder gehen lassen würde. Nie wieder würde er sie im Stich lassen.
»Tut mir leid! Ich hatte Sie gar nicht gesehen.«
Dimitri blinzelte, verstand die Worte erst mit kurzer Verzögerung.