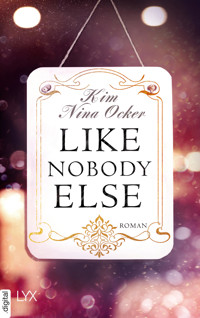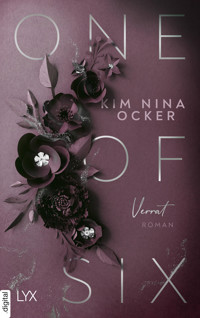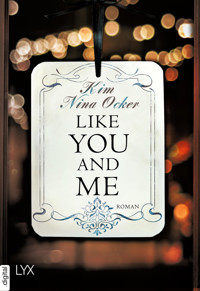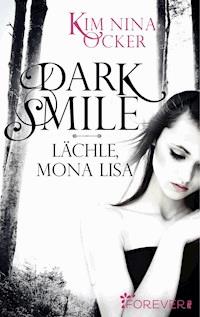
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die perfekte Mischung aus Romantasy und New Adult Mona Gray hat sich geschworen, niemandem mehr zu vertrauen, zu lange leidet sie schon unter den Schlägen ihres Vaters und der Apathie ihrer Mutter, die es nicht schafft, sich und ihre Tochter zu schützen. Als dann auch noch ihre beste Freundin Jenny bei einem tragischen Unfalls ums Leben kommt, ist Mona ganz auf sich allein gestellt. Jude Carter ist neu in Delmont. Eigentlich hat er nicht vor, sich zu verlieben – bis er an seinem ersten Schultag Mona Gray begegnet. Mit ihrer blassen Haut und ihrem schwarzen Haar sieht sie aus wie Schneewittchen, ein trauriges Schneewittchen, das irgendetwas zu verbergen scheint. Doch Jude ist gerade davon fasziniert. Kein Wunder, denn auch Jude hat ein Geheimnis, das weit über Monas Verstand hinausgeht ... "Fazit: Ich kann das Buch nur empfehlen. Super Erstlingsroman und ich hoffe es wird weitere Bücher der Autorin geben." Tamara R., amazon Von Kim Nina Ocker sind bei Forever erschienen: Dark Smila - Lächle, Mona Lisa Rise - Die Ankündigung (Band 1) Rise - Die Verstoßenen (Band 2) Eliza will Fahrrad fahren
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Die Autorin Kim Nina Ocker, aufgewachsen im beschaulichen Büren in Nordrhein-Westfalen, zeigte schon früh ein großes Interesse am Schreiben. Ihr erstes literarisches Meisterwerk bestand aus einer beinahe wortgetreuen Abschrift von Magdalena Nabbs »Zauberpferd«, bei der sie lediglich die Protagonistin in »Kim« umbenannte. Leider war die Welt noch nicht bereit für diese Sternstunde der Kreativität, und so musste der große schriftstellerische Durchbruch noch ein wenig warten. Letztendlich schaffte Cornelia Funke den Durchbruch und holte sie ganz und gar in die Welt der Buchstaben. Heute lebt sie zusammen mit ihrer Familie in Wennigsen.
Das Buch Mona Grey hat sich geschworen, niemandem mehr zu vertrauen, zu lange leidet sie schon unter den Schlägen ihres Vaters und der Apathie ihrer Mutter, die es nicht schafft, sich und ihre Tochter zu schützen. Als dann auch noch ihre beste Freundin Jenny bei einem tragischen Unfalls ums Leben kommt, ist Mona ganz auf sich allein gestellt. Jude Carter ist neu in Delmont. Eigentlich hat er nicht vor, sich zu verlieben – bis er an seinem ersten Schultag Mona Grey begegnet. Mit ihrer blassen Haut und ihrem schwarzen Haar sieht sie aus wie Schneewittchen, ein trauriges Schneewittchen, das irgendetwas zu verbergen scheint. Doch Jude ist gerade davon fasziniert. Kein Wunder, denn auch Jude hat ein Geheimnis, das weit über Monas Verstand hinausgeht …
Kim Nina Ocker
Dark Smile
Lächle, Mona Lisa
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Oktober 2014 (3) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014 Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Titelabbildung: © Finepic® Autorenfoto: © privat
ISBN 978-3-95818-018-5
Alle Rechte vorbehalten.
Mona, 15. Oktober, 17.20 Uhr
Meine Hand rutschte von dem eiskalten Stahl und ratschte über den rauen Stein. Verdammt! Ich spürte den Schmerz in den Fingerspitzen und wickelte mir meinen viel zu langen Ärmel um die Hand. Mittlerweile waren meine Klamotten bis auf die Haut durchnässt, da würden ein paar Tropfen Blut nichts mehr ausmachen. Außerdem hatte ich nicht vor, meiner Mom heute Abend die Kleider zum Waschen zu bringen.
Ein paar Sekunden hielt ich inne, lehnte meine Stirn an den glatten Stahl und schloss die Augen. Außer dem Tropfen des Regens und dem Rascheln vereinzelter Waldtiere war nichts zu hören. Nicht einmal mein Herzschlag. Auch mein Atem machte kein Geräusch. Es war still und friedlich. Vielleicht die Ruhe vor dem Sturm, mir war das jetzt egal. Ich wäre so ziemlich allem entgegengetreten, wenn ich diese Stille dadurch nur noch länger hätte festhalten können. Doch kaum hatte ich den Gedanken zu Ende gedacht, durchriss ein Hupen die Luft und ich zuckte zusammen. Autos sind meiner Meinung nach mit weniger Feingefühl ausgestattet als Motorsägen. Vorsichtig atmete ich ein, lautlos, dann umklammerten meine Hände erneut die Stange. Ich zog mich eine Stufe höher, immer höher in den Himmel. Nur nicht nach unten sehen, sagte ich mir immerzu, auch wenn mir klar war, dass der laubbedeckte Boden nur knapp zwei Meter unter meinen Füßen lag. Stufe um Stufe kämpfte ich gegen mein Gewissen an, bis ich schließlich schwer atmend den fausthohen Rand umklammerte und mich wieder auf festen Grund zog. Die Kiesel unter mir waren nass, aber das macht nichts, wenn man selbst bereits vom Regen trieft. Die Tropfen platschten mir ins Gesicht und ich kniff die Augen zusammen. Einen Moment gestattete ich mir, einfach auf dem Rücken zu liegen und mir den Schmutz der Stadt vom Gesicht waschen zu lassen. Dann rappelte ich mich wieder auf und betrachtete mein Werk.
Ich saß auf dem höchsten Punkt der Stadt, dem Wasserturm. Im Grunde hatte ich keine Ahnung, welche Funktion dieses Gebäude tatsächlich hatte – im Dorf nannten sie es alle einfach nur den Wasserturm. Unten, am Fuß des Zylinders, gab es eine Tür, die schon seit Jahren verschlossen war. Efeu und andere Kletterpflanzen hatten im Laufe der Zeit ihren Platz beansprucht, so dass sich jetzt ein grünbrauner Pflanzenteppich über den gesamten Fuß des Turmes zog. Es gab keine Fenster und auch keine anderen Türen, nur die silbern glänzende Leiter an der Nordseite. Das Dach war flach. Man konnte darauf sitzen. Vorsichtig kroch ich auf allen Vieren zum Rand, um hinunterzusehen. Ein Teil meiner regennassen schwarzen Haare klebte an meiner Stirn, der Rest hing mir in Strähnen über die Schultern. Wie Finger, die mich nach hinten zogen, um mich aufzuhalten. Aber ich war nicht hier, um zu springen. Nein, ich wollte nicht testen, ob meine Arme zu Flügeln würden, wenn ich sprang. Wahrscheinlich würde Mom genau das denken, wenn sie mich hier oben sehen könnte, und dabei ihre Liste meiner angeblichen psychischen Störungen um ein paar Punkte ergänzen.
Ich seufzte und wischte mir die Haare aus dem Gesicht. Der Boden unter mir war ein einziges matschiges Mischmasch aus Braun und Grün. Es regnete in letzter Zeit einfach zu viel, das Laub hatte gar keine Möglichkeit zu trocknen. Und das konnte man meinen Stiefeln ansehen, wie mir gerade auffiel. Als Jenny und ich sie damals gekauft hatten, waren sie noch schwarz gewesen. Jetzt waren sie braun und rochen nach Dreck.
Jenny! Der Name hallte durch meinen Kopf und meinen leeren Brustkorb wie ein unerwünschtes Echo. Ich konnte es nicht zum Verstummen bringen, egal, ob ich die Augen zusammenkniff, bis mir die Äderchen platzten, oder ob ich so laut ich konnte dagegen anschrie. Das Echo war immer lauter, heller und schneller als ich. Es knallte von innen gegen meine Schädeldecke, machte Kopfschmerzen und griff mit eiskalten Händen um mein Herz, dass mir die Luft wegblieb.
Meine Mom meinte, dass ich Zeit brauche. Dass die Zeit alle Wunden heilt. Doch das stimmte nicht. Es war nur eine neue, beschissene Lüge, die man erzählte, um die heile Welt zu retten, die seit Langem nur noch in den Köpfen meiner Eltern existierte. Vielleicht waren sie tatsächlich der Meinung, alles würde wieder gut, dass wir in einem Märchenbuch lebten und die letzte Seite mit dem Happy End jeden Moment aufgeschlagen werden konnte. Allerdings haben sie nicht gesehen, was ich gesehen habe. Nicht gehört, was ich gehört habe. Nicht verloren, was ich verloren habe. Für sie waren meine Probleme einfach ein unschöner Fleck in ihrem schillernden Leben, der schnellstmöglich entfernt werden musste. Nur ein Schritt und ich wäre weg. Nur noch eine Erinnerung, genau wie das Laub hier, das bald verfault und vergessen sein würde.
Würden meine Eltern überhaupt bemerken, wenn ich verschwinden sollte? Mit Sicherheit. Spätestens wenn sich das Geschirr in der Spüle stapelte. Oder wenn die Schule wieder anfing. Ja, sie würden es mit Sicherheit bemerken. Ich sah jedoch nicht ein, warum ich es ihnen so einfach machen sollte. Ich war ihr Fleck. Also mussten sie sich auch darum kümmern.
Ich seufzte noch einmal, tiefer diesmal, und ließ die eiskalte Luft durch meine Lunge strömen. Es tat gut, die Kälte in meinem Inneren zu spüren. Ein Beweis, dass ich doch nicht komplett hohl war.
Als ich Stunden später wieder Laub unter den Füßen spürte, hatte die Sonne sich so weit verzogen, dass alles um mich herum wie von schwarzer Tinte verschluckt wurde. Ich konnte die Hand vor Augen nicht sehen, aber ich hatte keine Angst mich zu verlaufen. Ich kannte diese Wälder besser als die Straßen der Stadt. Das Schlimmste, was mir passieren konnte, war, dass ich gegen einen Baum rannte. Und das würde ich überleben. Neben mir raschelte es. Im nächsten Moment schoss etwas Kleines vor meinen Füßen über den Trampelpfad. Wahrscheinlich ein Kaninchen oder ein Eichhörnchen. Nur manchmal begegnete mir auch eine Ratte. Noch ein Rascheln. Diesmal war es gleichmäßiger. Knack, knack. Knack, knack. Knack, knack.
Schritte! Das waren eindeutig Schritte! Ich blieb stolpernd stehen und schlug mit den Händen auf meine Jackentaschen, obwohl ich wusste, wo ich mein Pfefferspray hatte: zu Hause in der Nachttischschublade. Mit klopfendem Herzen lauschte ich in die Dunkelheit. Es war nichts mehr zu hören, außer den Geräuschen des Waldes. Verfluchte Scheiße, das hier war mein Wald! Meine Zufluchtsstätte! Ich würde nicht zulassen, dass ein zugedröhnter Junkie mir einredete, dass ich mich hier fürchten musste!
»Hey!«, rief ich zwischen die Bäume. Ich zuckte zusammen, als ich meine eigene Stimme hörte. Sie war brüchig und rau und klang nach brechendem Holz.
»Was auch immer Sie da machen, ich habe keine Angst!«
Okay, das war vielleicht nicht ganz die Wahrheit aber ich würde diesem Jemand mit Sicherheit nicht auf die Nase binden, dass mir das Herz mittlerweile in der Kehle pochte.
»Hallo?«, rief ich noch einmal. Keine Antwort. Vielleicht war der Junkie an seiner Überdosis verreckt? Sollte ich jemanden holen? Die Polizei vielleicht? Ich kramte mein Handy aus meiner Hosentasche und hielt das Display hoch, damit das spärliche Licht den Waldboden erhellte. Nichts. Links von mir waren ein paar Pflanzen zertrampelt, sonst war nichts zu sehen. Also gut, kein Junkie. Gott sei Dank!
Ich konnte mir wirklich Besseres vorstellen, als mir selbst die Cops auf den Hals zu hetzen. Ich lief zögernd weiter und verfluchte mich selbst, weil ich meinen MP3-Player zu Hause gelassen hatte. Wenn ich nichts hören konnte, hätte ich auch keine Angst vor unsichtbaren Schritten haben müssen.
Gerade einmal fünfundzwanzig Schritte schaffte ich, bis ich sie wieder hörte. Knack, knack. Erschrocken wirbelte ich herum, versuchte so viel wie möglich gleichzeitig zu sehen. Langsam wich ich auf dem schmalen Pfad zurück, bis meine Hände feuchte Blätter berührten. Ich ging in die Knie und tastete hinter mir auf dem Waldboden herum. Meine Finger fanden einen dicken Ast und umklammerten ihn. Ich richtete mich wieder auf, meinen improvisierten Knüppel an die Brust gepresst.
»Hallo?«, flüsterte ich. Meine Stimme war nur noch ein Hauch. Die Angst erstickte jeden Ton, bevor ich ihn aussprechen konnte. »Ist da jemand?« Wieder keine Antwort, kein Zeichen, kein Rufen oder neue Schritte. Wäre ich ein etwas fantasievollerer Mensch gewesen, ich hätte begonnen, an Wahnvorstellungen zu denken. Mir entfuhr ein trockenes Lachen, als ich an meine Mom dachte. Ihr würden Wahnvorstellungen gut gefallen. Die waren immerhin besser als akute Suizidgefahr. Oder Essstörungen. Ich hatte in den letzten zwei Jahren so einiges ausprobiert.
Noch immer stand ich wie erstarrt im Wald und umklammerte meinen Stock. Keine Ahnung, was ich damit vorhatte. Würde ich jemandem tatsächlich einen Knüppel überziehen können? Zusehen, wie sich das Blut allmählich in seinem Haar ausbreitet und es dunkelrot einfärbt? Wie sich Augen zuckend schließen und ein Körper nach und nach kapituliert? Wie das Leben aus einem Menschen hinaussickert, wie sein Blut aus der Kopfwunde? Mir wurde schwindelig. Ich klammerte mich an einen Baumstamm, bis die Welt aufhörte, sich nach dem Kommando des Echos zu drehen. Das war doch alles totaler Schwachsinn! Hier war niemand! Und wenn doch, dann war er offensichtlich zu feige, um mich anzugreifen. Oder es war einer dieser Perversen, die sich damit zufrieden gaben, Mädchen aus der Ferne zu beobachten. Damit kam ich schon klar.
Entschlossen warf ich meine großartige Waffe in die Büsche und rannte nach Hause. Ganz kurz dachte ich, einen Laut aus der Dunkelheit zu hören, doch ich hielt nicht an, bevor ich das Licht unserer Veranda entdeckte.
Jude, 15. Oktober, 23.17 Uhr
Es waren drei Jungen, noch Kinder, die das Mädchen – hinter Bäumen versteckt – beobachteten. Gelangweilt beobachtete ich ihr Treiben. Himmel! Diese Kerle mussten echt noch einiges dazulernen, wenn sie ihren Vätern nacheifern wollten. Sie waren viel zu laut, sollte das eine ernstzunehmende Verfolgung sein? Einer der Jungs – ein hageres, strohblondes Muttersöhnchen – verhedderte sich mit dem Fuß in einem Brombeerzweig und strauchelte eine Weile. Es knackte überall. Ich verdrehte die Augen. Diese Kerle waren nicht wert, dass ich ihnen Beachtung schenkte. Wahrscheinlich würden sie sofort in Ohnmacht fallen, sobald sie die Schwarzhaarige hatten. Das hier war eindeutig ihr erster Versuch, einen auf harte Jungs zu machen.
Das Mädchen bekam allmählich Angst. Sie begriff, dass sie nicht mehr allein im Wald war. Die Jungs waren einfach zu laut. Im Grunde sollte es mich nicht kümmern. Ich meine, wenn man nachts allein im verlassenen Wald herumrennt, dann soll man sich nicht wundern, wenn man nicht wieder heil zurückkommt, oder? Was wollte sie auch hier? Mädchen wie sie sollten um diese Zeit im Bett liegen und von Robert Pattinson oder Brad Pitt träumen.
Seufzend sprang ich von meinem Baum. Im Gegensatz zu diesen Idioten da vorne konnte ich mich vollkommen lautlos durch das tote Laub bewegen. Nicht ein Knacken, kein Knistern, nichts – und bei Nacht war ich nahezu unsichtbar. Als ich näher kam, hatte sich das Mädchen an den äußersten Rand des kümmerlichen Trampelpfades gedrängt, als könnten die Bäume hinter ihr sie schützen. Vor dem Körper umklammerte sie einen Ast, als wollte sie jeden Moment losrennen und jemanden erschlagen. Ich musste ein Lachen unterdrücken. Was hatte sie vor? Wollte sie diese armen kleinen Trottel umbringen? Das waren sie wirklich nicht wert.
Ich wandte mich von der verängstigten Schwarzhaarigen ab und suchte in der Dunkelheit nach den drei Kindern. Zusammengepfercht wie eine Herde Schafe starrten sie immer noch auf den Lichtkegel, den das Handy des Mädchens auf den Waldboden warf. Einer murmelte irgendwas, was ich nicht verstehen konnte. Da erst erkannte ich, dass der Menschenhaufen vor mir lediglich aus zweien bestand. Wo war der dritte?
Leise drehte ich mich im Kreis und entdeckte den Großen, der fast erwachsen und ein wenig bedrohlich wirkte. Er schien entschlossener zu sein als seine beiden Schoßhunde. Zielstrebig pirschte er durchs Unterholz und war dabei beinahe so geschickt wie ich. Wäre ich allein gewesen, hätte ich anerkennend durch die Zähne gepfiffen. Normalerweise verhalten sich Menschen weitaus trampeliger und rücksichtsloser, wenn es um ihre Umwelt geht. Aber mir blieb keine Zeit, mich über die Fähigkeiten meines Gegenübers zu wundern, denn in diesem Moment bewegte das Mädchen ihre Hände und das Licht des Displays wurde für Sekundenbruchteile von etwas Glänzendem reflektiert, das der Große in der Hand hielt. Der schien nichts zu merken, war immer noch unterwegs, direkt auf Schneewittchen zu – mit einem Messer in der Hand.
Gut, das ging zu weit. Wenn die drei sich ein bisschen in den Büschen verstecken und einsame Mädchen anstarren wollten, dann bitte! Aber ganz offensichtlich wollte der Große sich nicht mehr mit dem bloßen Beobachten zufrieden geben. Schnell und absolut lautlos schlängelte ich mich durch die herabhängenden Äste und pirschte auf den Kerl zu. Er war inzwischen kaum einen Meter von dem kleinen Pfad entfernt, nur noch wenige Schritte von dem Mädchen, das jetzt keuchend einen Baum umklammerte. Mein Kopf fuhr zu ihr herum. Was war passiert? Hatte der Kerl das Messer geworfen? Nein, er hielt es noch in der Hand. Und was hatte die Schwarzhaarige? Einen Moment konnte ich mich nicht entscheiden, wen ich beobachten sollte – das Mädchen oder den Brocken, der ihr auf den Fersen war. Dann entschied ich, dass der Kerl im Moment wichtiger war als ein Mädchen, das offensichtlich mehr Probleme hatte als ein paar hartnäckige Verfolger.
Bevor der Typ einen weiteren Schritt machen konnte, hatte ich einen Arm um seinen Hals geschlungen. Seine Augen wurden kugelrund. Natürlich wollte er schreien, doch meine Hand auf seinem Mund verhinderte jeden Ton. Hinter mir hörte ich die anderen Jungen nervös flüstern. Sehen konnten sie uns nicht. Der Große wehrte sich heftig gegen meinen Klammergriff. Keine Chance. Ein Zucken und ich würde ihm das Genick brechen können. Ich hatte das Gefühl, dass auch er das wusste. Nein, heute würde ich ihn nicht töten. Ich knurrte frustriert und drückte dem Schwein meinen Daumen unter den Kieferknochen. Es dauerte ein paar Herzschläge lang, bis seine massige Gestalt unter mir erschlaffte. Mit einem angewiderten Laut stieß ich ihn von mir und konnte ein Grinsen nicht verhindern, als er mit dem Gesicht genau in einem Haufen Hasenscheiße landete. Wieder hörte ich die beiden anderen hinter mir. Anscheinend wurden sie allmählich nervös. Hastig zog ich mich zurück zwischen die Büsche. Um ehrlich zu sein, war ich nicht begeistert von der Aussicht, mich jetzt auch noch um ein völlig panisches Teeniemädchen kümmern zu müssen. Als ich mich umdrehte, war der Pfad leer. Das Mädchen war verschwunden. Es hatte sich aufgelöst in der Nacht, ohne zu wissen, wer es verfolgt und wer es gerettet hatte.
Mona, 18. Oktober, 5.00 Uhr
Drei Tage später war Montag. Ich hasste Montage, nicht nur wegen der Tatsache, dass die Schule wieder losging. Montags hatte ich Sport und Geschichte, meine beiden Hassfächer. Meine Laune war bereits auf dem Nullpunkt, als ich meine Schultasche packte. Mom hatte gestern Abend das Essen anbrennen lassen und Dad war sauer geworden. Ich wollte nicht sehen, was seine Wut angerichtet hatte, nachdem ich in mein Zimmer geflohen war. Und ich wollte ihm mit Sicherheit auch nicht begegnen, denn sonst würde ich etwas zu hören bekommen. Ich hatte mich gestern Abend während des Streits in meinem Zimmer eingeschlossen – ein absolutes Kapitalverbrechen in diesem Haus. Dad versperrte man nicht einfach den Weg. Das war Respektlosigkeit in ihrer schlimmsten Form. Also stellte ich meinen Wecker eine Stunde zu früh und schlich aus dem Haus, bevor meine Eltern aufwachten. Wenn ich Glück hatte, würden sie nicht bemerken, dass ich mich aus dem Staub gemacht hatte.
Auf dem Weg zu meinem Wagen zog ich die Kapuze über den Kopf und drückte mir die Stöpsel des MP3-Players in die Ohren. Es hatte schon wieder angefangen zu regnen. Mittlerweile wurden auch die Tage immer kürzer. Es war nicht mehr zu leugnen, der Winter war auf dem Vormarsch. Hastig schloss ich die Fahrertür auf, warf meine Tasche auf den Rücksitz und hüpfte hinein. Die Heizung brauchte jedes Mal eine Ewigkeit, um warm zu werden, also beeilte ich mich, den Motor zu starten. Das Problem bei meinem ansonsten treuen Auto war, dass es selbst entschied, ob es fahren wollte oder nicht. Jeden Morgen musste ich mich fragen, ob ich wohl mit dem Wagen zur Schule käme, oder nicht. Der Bus fuhr nur ein paar Straßen weiter, aber ich hasste den Bus. Er war mir zu voll. Und solange sich meine Noten nicht besserten, kaufte Dad mir keinen neuen Wagen.
Ich kniff betend die Augen zusammen, als ich den Zündschlüssel rumdrehte. Der Motor röchelte ein paar Mal, dann sprang er mit einem wütenden Knurren an. Erleichtert grinste ich vor mich hin, als ich rückwärts aus der Einfahrt fuhr und meinen Honda Richtung Stadt lenkte.
Nach und nach füllte sich der Innenraum mit warmer Luft, und meine Muskeln entspannten sich ein wenig. Ich war viel zu früh dran, fuhr aber trotzdem sofort zur Schule. Von früheren Aktionen wie dieser wusste ich, dass der Hausmeister bereits um fünf aufschloss und man sich mit ein wenig Glück hineinschleichen konnte. Immerhin wäre es drinnen warm. Ich schob mir die Tasche wieder über die Schulter und sah mich kurz auf dem Schulparkplatz um. Einige Lehrerautos standen schon in den Parklücken, doch die Lehrer würden nur kaffeesaufend im Lehrerzimmer hocken. Keine Gefahr also.
Unsere Schule war ein farbloser rechteckiger Bunker. Wer hier nach selbstgebasteltem Fensterschmuck oder Bildern suchte, brauchte sich erst gar keine Hoffnungen zu machen. Alles in diesem Gebäude war grau, selbst das Licht der Neonröhren. Die Flure waren kalt und dunkel, genau wie die Klassenzimmer, und passten wunderbar zu meiner Stimmung.
Leise schlich ich über die Flure in den westlichen Teil der Schule. Dort waren die naturwissenschaftlichen Räume untergebracht, und der Kunstraum, auf den ich es jetzt abgesehen hatte. Seit der Sache mit Jenny war es mit meinen Noten drastisch bergab gegangen, nur in Kunst hatte sich nichts verändert. Wenn es etwas Sicheres, Eigenes, für mich auf dieser Welt gab, dann war es das Zeichnen. Niemand konnte meine Bleistiftstriche lenken, sie gehorchten allein mir. Ein kleines bisschen Kontrolle in einem Leben, das sonst von anderen bestimmt wurde.
Ein Blick auf die Uhr sagte mir, dass ich noch mehr als eine Stunde hatte, bis die anderen Schüler eintrudeln würden. Genug Zeit, um mich meinem neusten Werk zu widmen. Ich schlüpfte aus meiner Jacke und stellte die Schultasche auf einen der heruntergekommenen Stühle an der Wand. Mein Schrank war ganz hinten. Ich ging hinüber und räumte meine Sachen auf den Tisch neben der Staffelei. Mr. Winter, mein Kunstlehrer, wusste, dass ich öfters herkam, deshalb schloss er die Materialschränke nur noch selten ab. Insgeheim war ich mir sicher, dass der Mann eine Ahnung von dem hatte, was bei mir zu Hause ablief. Natürlich sprachen wir nicht darüber. Überhaupt wechselten Mr. Winter und ich kaum ein Wort, er sah sich einfach nur meine Bilder an und wenn er etwas zu sagen hatte, tat er das mit Worten, die er unter meine Bewertungen kritzelte.
Stirnrunzelnd stellte ich meine neue Leinwand auf die Staffelei und starrte sie an. Ich war noch nicht weit gekommen, konnte jedoch schon jetzt sehen, dass das nichts wurde. Ich hatte versucht, den Blick vom Wasserturm einzufangen, jedoch mit miserablem Ergebnis. Die Skizze hatte nichts von dem Gefühl der Freiheit, nichts von der unendlichen Sicht über die Baumwipfel und vor allem nichts von der Stille eingefangen, die ich so liebte. Meine Striche waren zu kurz, zu unruhig, sie wollten einfach nicht zum Leben erwachen. Sie waren einfach nur Grau auf Weiß. Keine Perspektive. Und auch die Schatten waren zu dunkel. Genervt griff ich nach meiner Federmappe und nahm den rosafarbenen Radiergummi, den mein Vater mir geschenkt hatte. Ich feuerte wütende Blicke auf ihn ab, aber es schien ihn nicht sonderlich zu stören. Nicht einmal hier konnte mein Vater mir meinen Frieden lassen. Einen Moment überlegte ich, ob ich versuchen sollte, das Bild zu retten. Dann schüttelte ich frustriert den Kopf. Ich hatte schon dutzende Male versucht, den Wasserturm zu zeichnen und nie hatte ich es hinbekommen. Es war einfach nur dämlich, dass ich es immer wieder versuchte.
Ein Rumpeln riss mich aus meinen Gedanken und hielt mich davon ab, meine Faust durch die Leinwand zu schlagen. Die Tür flog auf und knallte gegen die Wand, wo die Klinke einen dunklen Abdruck hinterließ. Ich wollte gerade den Mund aufmachen und den Hausmeister zur Sau machen – doch es war nicht der Hausmeister, der da in der Tür stand.
Es war eine Junge, perfekt gestylt und mit einer knallgelben Schultasche über der Schulter. Verwirrt schaute ich auf die Uhr. Es war immer noch viel zu früh, als dass meine lieben Mitschüler guten Gewissens zur Schule gehen konnten. Ich hatte diesen Typen noch nie gesehen. Unsere Highschool hatte etwa fünfhundert Schüler, da war es ganz selbstverständlich, dass man jeden und alle wenigstens vom Sehen kannte. Der Junge – oder war er schon ein Mann? – sah mich mindestens genauso verblüfft an wie ich ihn, sagte aber nichts.
»Kann ich dir helfen?«, fragte ich so unfreundlich wie möglich und versuchte mich unauffällig vor meine Staffelei zu schieben. Wenn der Kerl auch malte, war ich nicht wirklich scharf darauf, dass er meine Katastrophe in Schwarzweiß allzu genau betrachtete.
»Ich suche das Sekretariat«, antwortete er langsam. Seine Stimme war tief und klang ein bisschen rau, als hätte er lange nicht mehr gesprochen oder zu viel geraucht, was wohl wahrscheinlicher war. Ich betrachtete ihn genauer. Er wirkte älter als ich zuerst gedacht hatte. Er musste mindestens einen Kopf größer sein als ich und locker doppelt so breit. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich mich mit Sicherheit hinter ihm verstecken können. Seine Haare waren von einem dunklen, schmutzigen Blond. Straßenköterblond, wie meine Mom sagen würde. Ich zwang meine Augen wieder zurück auf sein Gesicht. Er musterte mich.
»Wie du siehst, bist du hier falsch«, murmelte ich und drehte mich wieder zu meiner Staffelei um. Er schien den Wink nicht zu verstehen.
»Was machst du hier? Hast du mal auf die Uhr geguckt?«
»Was interessiert es dich?«, fauchte ich über die Schulter. »Du bist doch auch hier, oder nicht?«
»Ich suche das Sekretariat«, sagte er wieder, als wäre ich schwer von Begriff. »Das hast du schon gesagt.«
Ich hörte etwas rascheln, dann einen leisen Rums, als er seine Tasche auf den Boden stellte. Er sollte gar nicht erst auf die Idee kommen, sich hier häuslich einzurichten. Wütend warf ich den Radiergummi zurück in die Federmappe.
»Und?«, fragte der Typ hinter mir. Ich fuhr herum. Er stand immer noch an derselben Stelle. Der verwirrte Gesichtsausdruck war verschwunden. Ohne die Falte auf seiner Stirn sah er zugegebenermaßen gar nicht schlecht aus.
»Und was?«, zischte ich.
»Zeigst du mir den Weg?«, fragte er.
Ich schnaubte entrüstet: »Geh den Gang zurück. Am Ende des Flurs ist ein Schild. Geh rein, wenn du Sekretariat liest. Das solltest du hinkriegen.« Es sei denn, du hast dir das Hirn kaputtgekifft.
Dann wäre er an dieser Schule wenigstens in bester Gesellschaft. Bevor er mich noch mehr vollquatschen konnte, packte ich Jacke und Tasche und stürmte an ihm vorbei in die leeren Flure. Leider hatte der Typ aus dem Kunstraum Recht gehabt, es war einfach zu früh für die Schule. Von den anderen Schülern war noch keiner da, und die Lehrer hatten sich wie Ratten in ihren Löchern verkrochen. Meine Hausaufgaben machte ich schon seit Langem nicht mehr, also war ich irgendwie arbeitslos. Ich verfluchte den unbekannten Jungen, der mich aus meinem sicheren Refugium vertrieben hatte. Vielleicht sollte ich einfach zurückgehen und mich wieder in den Kunstraum schleichen. Aber ich wollte das Risiko nicht eingehen, ihm noch einmal über den Weg zu laufen. Im Gegensatz zu unseren Mitschülern schien er nicht zu wissen, wer ich war. An der Schule war ich das sonderbare Mädchen aus dem Haus oben am Wald. Und ich hatte mir in letzter Zeit auch keine Mühe gegeben, an diesem Ruf etwas zu ändern. Mir war es nur recht, wenn die Leute mich für seltsam hielten, denn mit seltsamen Menschen redete man nicht. Das Verrücktsein bewahrte mich vor aufdringlichen Schülersprechern und Vertrauensschülern, also nahm ich es hin. Immerhin hatten die Leute irgendwann genug davon gehabt, wilde Geschichten über mich zu erfinden und ließen mich einfach in Ruhe. Ich war langweilig geworden und dafür war ich dankbar.
Das Gesicht des Jungen tauchte wieder in meinem Kopf auf. Wie eindringlich er mich gemustert hatte. Angestarrt, könnte man fast sagen. Vorsichtig hob ich die Hand und klappte die Sonnenblende herunter, damit ich mein Spiegelbild sehen konnte. Ich versuchte mich nüchtern zu betrachten. Ja, ich sah wirklich aus wie eine Verrückte. Was dachten fremde Leute wohl, wenn sie mich sahen? Was hatte der Junge gedacht?
Na ja, wahrscheinlich hatte auch er mich für bescheuert gehalten, immerhin stand ich Stunden vor Unterrichtsbeginn in einem Kunstraum und malte windschiefe Türme auf Leinwände. Wie erbärmlich. Wahrscheinlich hatte er sich innerlich gekrümmt vor Lachen, was seinen verkniffenen Gesichtsausdruck wenigstens erklären würde. Aber ich hatte schon vor einer ganzen Weile aufgehört, mir Gedanken über andere Leute zu machen.
Jude, 18. Oktober, 7.47 Uhr
Es war das Mädchen aus dem Wald. Das hatte ich erkannt, sobald ich den Kunstraum betreten hatte. Ihre Haare waren trocken und nicht mehr ganz so dunkel wie gestern Nacht, es waren ihre Augen und es war ihre Statur. Sie erkannte mich natürlich nicht. Sie hatte ja nicht einmal mitbekommen, dass sie in dieser Nacht Hilfe bekommen hatte. Eigentlich war ich nicht der Mensch für Lobeshymnen, aber ein bisschen mehr Freundlichkeit hätte ich mir schon erhofft.
Wenigstens hatte ich den Weg zum Sekretariat gefunden und mich für den Unterricht in diesem Bunker eingetragen. Das würde ein sehr deprimierendes letztes Highschooljahr werden. Welcher Architekt entwarf solche Bauten mit dem Hintergedanken, Schüler dort hinein zu schicken?
Ich hatte noch fünfzehn Minuten, bis die erste Stunde beginnen und der Startschuss für ein weiteres Jahr in der Hölle fallen würde. Der Parkplatz füllte sich allmählich mit schwatzenden und gähnenden Schülern. Fast noch Kinder, kaum älter als sechzehn, und sie alle hielten sich für die Könige der Welt. Ein Mädchen mit rotbemalten Lippen und blauem Lidschatten stöckelte an mir vorbei und ließ ihre künstlichen Wimpern klimpern. Blondie musterte mich von oben bis unten, schenkte mir noch ein strahlendes Lächeln und verschwand dann im Schulgebäude. Ich unterdrückte nur mit Mühe ein Stöhnen. Das konnte ja noch interessant werden. Als ich mich umdrehte, sah ich Schneewittchen aus ihrem Wagen klettern. Die schwarzen Haare wurden vom Wind nach vorne geweht, sodass ich ihr Gesicht nicht sehen konnte. Ich wollte ihre Augen sehen. Im Kunstraum waren sie hellblau erschienen – so hell, dass es beinahe ein bisschen gruselig ausgesehen hatte. Ich wollte wissen, ob die ungewöhnlich helle Farbe bloß Resultat des ätzenden Neonlichts gewesen war. Aber sie drehte sich nicht um, sondern zog die Kapuze ihres schwarzen Shirts über den Kopf und tauchte in der Flut der Schüler unter. Eines war sicher: Unsichtbar machen konnte sie sich ausgezeichnet.
Mona, 18. Oktober, 9.40 Uhr
Das Schrillen der Schulglocke riss mich unsanft aus einem Tagtraum über buntes Laub und körperlose Schritte. Ich holte mein Handy aus der Hosentasche und sah auf die Uhr. Zwei Stunden geschafft, nur noch sechs waren übrig. Der Tag verging quälend langsam, er zog sich wie Kaugummi. Geschichte hatte ich überstanden, der Gedanke an Sport in den letzten beiden Stunden verursachte mir Bauchschmerzen. Sport war das einzige Fach, durch das ich mich nicht mit eisernem Schweigen mogeln konnte. In Sport reichte die bloße körperliche Anwesenheit nicht aus.
Unsere Englischlehrerin betrat den Raum und zog ihren Trolley hinter sich her. Sofort verstummten die Gespräche um mich herum. Für mich war es jedes Mal wieder ein Wunder, dass ein Mensch es tatsächlich schaffte, die Leute in diesem Raum zum Schweigen zu bringen. Normalerweise gaben alle hier einen Scheißdreck auf das, was ein Lehrer sagte. Nicht so bei Mrs. Coleman. Ein Blick von ihr und man rannte heulend aus der Klasse. Mir war es gleich, ich geriet nie mit einem Lehrer aneinander, was vielleicht daran lag, dass ich niemals ein Wort sagte. Anfangs hatte sich der eine oder andere noch um mich bemüht, doch nach zwei Jahren hatten sie alle aufgegeben. Ich steckte die Hand in meine Hosentasche und stellte den MP3-Player leiser. Auch wenn ich keine Angst vor Coleman hatte, musste man sie ja nicht unbedingt noch herausfordern. Außerdem sah es so aus, als wollte sie etwas sagen. Mit einem bedeutungsvollen Blick zur Tür stellte sie sich hinter das Pult und sah uns alle erwartungsvoll an. Wir starrten zurück.
»Ladies and gentlemen«, begann sie würdevoll und ließ ihre Adleraugen über die stummen Gesichter vor sich wandern. Mich übersprang sie dabei einfach. Ich zuckte kurz mit den Schultern und schaute mir wieder die Kritzeleien auf meinem Pult an. Coleman hatte weder Tests noch eine DVD in der Hand, also würde es schon nicht so wichtig sein.
»Ich setze darauf, dass Sie alle mir keine Schande machen«, redete sie unbeirrt weiter. »Ich bin mir sicher, dass Sie Mr. Carter helfen werden, sich einzufinden.«
Mein Kopf fuhr hoch. Mr. Carter? Einfinden? Das hörte sich ja an, als ob …
»Mr. Carter, bitte suchen Sie sich einen Platz und versuchen Sie zu folgen.«
»Nein!«, stöhnte ich, als der Kunstraumjunge gelangweilt in den Raum schlenderte. Warum musste er ausgerechnet in meine Klasse kommen? An unserer Schule gab es keine Kurse, nur feste Klassenverbände, was bedeutete, dass ich diesen Kerl dauerhaft an der Backe hatte. Das Leben hatte doch echt einen grausamen Humor. Mr. Carter war jetzt im Gang zwischen den Sitzreihen angekommen und ich senkte hastig den Blick zurück auf meine Tischplatte. Natürlich war der Platz neben mir frei, niemand wollte neben der Verrückten sitzen. Aber er sollte sich ja nicht einbilden, dass das eine Einladung war! Immerhin gab es noch zwei weitere freie Plätze in diesem Raum und Chloe Dearing schien gerade das spontane Bedürfnis nach einem Sitznachbarn zu entwickeln. Ihre bemalten Augen klimperten ununterbrochen und deuteten einladend auf den freien Platz neben sich. Na bitte, da hatten wir doch das perfekte Klassenpärchen. Miss Perfect und Prinz Eisenherz. Sollten sie glücklich miteinander werden.
Leider Gottes schien Prinz Eisenherz das anders zu sehen, denn einen Augenblick später hörte ich den Stuhl neben mir quietschend über den Linoleumfußboden schaben. Ich hielt den Blick stur auf den Tisch gerichtet, während Coleman vorne hinter ihrem Pult den Unterricht begann. Vielleicht hatte ich ja Glück, und Carter würde seine Sachen herausholen und anfangen mitzuschreiben. Natürlich hatte ich kein Glück. Warum auch, Gott hasste mich.
»Ich musste gerade die komplette Schulordnung lesen. Ist dir klar, dass man Nachsitzen muss, wenn man auf die Pulte schreibt? Wenn du etwas reinritzt, wird es noch schlimmer, dann gibt es einen Anruf bei Mommy und Daddy.«
Ich sah nicht auf, auch wenn mich beim Klang seiner Stimme kleine Wutwellen durchzuckten. Da hatte ich es endlich geschafft, dass mich die Leute in Ruhe ließen und dann kam dieser Carter und spielte sich als charmanter Neuling auf.
»Coleman hat gesagt, dass du aufpassen sollst.«
»Du bist das Kunstmädchen, richtig? Deine Höflichkeit ist unverkennbar.« Ich schloss für einen Moment die Augen und zwang mich zur Ruhe. Als ich aufschaute, bemerkte ich, dass ein paar der Schüler mich verwirrt anstarrten. Vielleicht, weil sie zum ersten Mal erlebten, dass ich mit einem Mitschüler sprach. Ich konnte nur hoffen, dass ihnen klar war, dass dieses Gespräch allein von dem Neuen ausging. Seufzend wandte ich mich an Carter. Chloe feuerte währenddessen Giftpfeile aus ihren Augen auf mich ab.
»Hör mal zu, Carter«, erklärte ich, und machte mir nicht einmal die Mühe, meine Stimme zu senken, »ich bin nicht das geheimnisvolle Mädchen, dass man knacken muss und aus dem sich dann ein wunderschöner Schwan erhebt, ist das klar? Ich rede nicht mit den Leuten, weil ich keinen Bock auf sie habe und da bist du keine Ausnahme. Ich habe absolut kein Interesse an dieser pseudocharmanten Unterhaltung oder an irgendetwas anderem. Wenn du also Gesellschaft suchst oder ein Date für den Abschlussball, dann setz dich neben Chloe, die benimmt sich sowieso schon die ganze Stunde wie eine läufige Hündin.«
Er sah mich eine Weile an, und ich konnte nicht anders, als zurückzuschauen. Zum ersten Mal musterte ich sein Gesicht genauer. Mehr als nur seine blonden Haare. Nein, Prinz Eisenherz passte nicht. Sein Gesicht war zu markant, um zu einem blonden Jungen zu gehören. Er hatte hohe Wangenknochen, eine feine, weiße Narbe teilte seine Augenbraue, und seine Nase sah aus, als sei sie schon einmal gebrochen gewesen. »Was hast du für eine Augenfarbe?«, platzte es aus mir heraus, bevor ich mich selbst stoppen konnte. Das hatte ich gar nicht laut sagen wollen, aber seine Augen waren so dunkel, dass man ihre Farbe nicht erkennen konnte. Carter zog eine Braue hoch und grinste mich an. Ich wurde rot. »Schon gut, vergiss, dass ich was gesagt habe.« Er zuckte mit den Schultern und wandte das Gesicht nach vorn. Jetzt konnte ich nur noch sein Profil sehen.
Den Rest der Stunde verbrachte ich damit, meine Fingernägel anzustarren. Sie waren bis aufs Fleisch abgekaut gewesen, nun schienen sie allmählich wieder zu wachsen. Das Nägelkauen hatte ich mir nach wochenlanger Selbsttherapie abgewöhnt. Auch wenn meine Mom natürlich der Meinung war, dass das alles ihr Werk war. Sie wusste ja auch nicht, dass das Nägelkauen lediglich vom Fingerknacken abgelöst worden war. Geniale Therapeutin, Mom!
Als es endlich klingelte, war ich die erste, die vor der Tür war. Ich hatte meine Tasche gar nicht erst ausgepackt und meine Jacke schon fünf Minuten vor Schluss übergezogen. Carter hatte keine Zeit gehabt, einen weiteren Kommentar abzugeben. Eigentlich hatten wir nur zehn Minuten Pause, genug Zeit, um den Raum zu wechseln. Trotzdem rannte ich zu meinem Honda und warf mich auf den Fahrersitz. Vor mir lagen noch zwei Stunden Chemie und Sport, zusammen mit diesem fürchterlichen neuen Jungen. Hier hielt mich nichts mehr. Mit einem wütenden Blick auf den grauen Bunker drehte ich den Zündschlüssel herum. Der Motor hustete fürchterlich und erstarb. Mit einem wütenden Knurren versuchte ich es noch einmal. Ohne Erfolg. Verdammte Scheiße! Ich schlug mit der flachen Hand aufs Lenkrad. Eine der verschrammten Fingerkuppen hinterließ einen blutigen Fingerabdruck auf dem Kunstleder. Ich kümmerte mich nicht darum. Ergeben sackte ich zusammen, die Hände flach zwischen meine Oberschenkel geklemmt, die Stirn am Lenkrad. Ich schloss die Augen und begann leise zu summen. Dieser Tag war einfach nur eine Katastrophe. Meine Routine war von den Designerstiefeln eines neuen Großstadthelden unbarmherzig zertrampelt worden.. Damit kam ich nicht klar. Wenn es etwas Konstantes in meinem Leben gab, dann war es, neben dem Zeichnen, die Tatsache, dass ich acht Stunden am Tag in Ruhe gelassen wurde. In der Schule war ich ein Geist. Ein Niemand, um den man sich keine Gedanken machen brauchte. Und der sich auch keine Gedanken um andere machte. Ich vertraute auf diese Tatsache, das wurde mir erst jetzt wirklich bewusst. Carter hatte diese Tatsache zerstört. Ich wollte nicht mit ihm reden! Ich wollte keine Freunde, keine guten Bekannten oder Vertraute, warum verstand das nur niemand?
Weil alle außer dir Freunde haben dürfen! Weil niemand von ihnen seine Freunde tötet! Das Echo hallte durch meinen Körper. Ich kniff die Augen zusammen und knallte die Stirn ein paar Mal gegen das Lenkrad. Ich wollte einfach nur, dass es still ist!
Etwas schlug gegen mein Fenster. Ich schreckte hoch. Meine Stirn pochte schmerzhaft. Ich musste ein paar Mal blinzeln, doch dann erkannte ich die Gestalt vor meinem regennassen Fenster. Natürlich. Carter! Ich sah ihn an und versuchte ihn ganz einfach wegzustarren. Es war mir mittlerweile wirklich egal, was er von mir dachte. Wenn er mich jetzt für irre hielt, dann sollte mir das recht sein. Aber er ergriff weder die Flucht, noch machte er sich über mich lustig. Er erwiderte einfach nur meinen Blick und bedeutete mir mit einer Geste, das Fenster runterzulassen. Einen Moment erwog ich, ihm einfach über den Fuß zu fahren, hätte mein Auto mich nicht im Stich gelassen.
»Was ist?«, fauchte ich, sobald die Scheibe zwischen unseren Gesichtern verschwunden war. Er deutete mit einem Finger auf mich. »Du hast Blut an der Stirn.«
Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen und hielt einen verschrammten Finger vor sein Gesicht.
»Halb so schlimm.« Sollte er davon halten was er wollte.
»Du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen.«
Schnaubend zerrte ich den Schlüssel aus dem Zündschloss und sprang aus dem Wagen. Als ich die Tür aufriss, sprang Carter hastig einen Schritt zurück, um nicht getroffen zu werden. Der Gedanke ließ mich für einen Sekundenbruchteil grinsen, dann war meine Mine wieder vollkommen ausdruckslos. Ich wusste, dass man in diesem Augenblick rein gar nichts in meinem Gesicht lesen konnte, ich hatte es vor dem Spiegel geübt.
»Von dir brauche ich keine Hilfe!«, stellte ich klar. »Du solltest jetzt reingehen. Mrs. Peterson ist gnadenlos, wenn’s ums Blaumachen geht. Du fliegst am ersten Tag von der Schule!«
Ich wollte an ihm vorbeistürmen, aber er verstellte mir den Weg.
»Na, wie‘s aussieht, fliegen wir dann ja wohl beide.«
»Ich fliege nicht!«, sagte ich, und hätte mir am liebsten auf die Zunge gebissen. Warum quatschte ich eigentlich so viel? Ich sollte einfach gehen. Warum versperrte mir dieser Kerl immer noch meinen Fluchtweg?
»Wie heißt du?«, fragte er, nachdem das Blickduell mit unentschieden endete.
»Was geht es dich an?«
Er sah mich völlig ungerührt an. »Na gut, dann gehe ich und frage Blondie. Warte, wie hieß sie noch? Clary?«
»Nein!«, rief ich und griff nach seinem Arm, als er sich umdrehen wollte. Wenn dieser Kerl sich mit Chloe über mich unterhalten würde, würden die Geschichten wieder von vorne anfangen. Nicht noch einmal! Vielleicht hatte er geblufft oder vielleicht hatte er auch nur die ehrliche Panik in meinen Augen gesehen. Auf jeden Fall drehte er sich wieder zu mir um und wartete. »Mona«, flüsterte ich ergeben, »Mona Grey.«
Ohne zu fragen nahm er meine Hand und schüttelte sie. Dann ließ er mich los, als hätte er sich verbrannt.
»Jude Carter. Und bitte, nur Jude. Nenn mich nicht Carter.«
»Okay, Jude. Mach‘s gut, Jude.« Ich hatte mich wieder so weit gefasst, dass ich einen halbwegs würdevollen Abgang hingelegt hätte, hätte Jude nicht nach meinen Arm gegriffen und mich zurückgehalten.
»Lass mich los!«, fuhr ich ihn an. Hastig wich ich vor ihm zurück und sah mich um. Der Parkplatz war menschenleer.
»Schon gut«, beschwichtigte er, die Hände in der Luft, als wolle er sich ergeben. »Hey, ich wollte doch nur, dass du nicht einfach so abhaust. Ich bringe dich nach Hause.«
»Danke, ich verzichte«, sagte ich immer noch argwöhnisch. Ich wusste inzwischen, dass die wirklich gefährlichen Typen nach außen hin immer lieb und freundlich waren.
»Komm schon.« Er schien zu merken, dass ich auf der Hut war. Er hielt Abstand und kam nicht noch einmal auf mich zu.
»Dein Wagen ist offensichtlich gerade eines natürlichen Todes gestorben und ich kann auf Sport wirklich verzichten.«
Seine Bemerkung ließ mich kurz Lächeln. Wow, gleich zwei Mal an einem Tag. Ich war ja heute eine richtige Frohnatur.
»Jude, denkst du eigentlich, das vorhin in der Klasse war ein Scherz? Lass mich in Ruhe!«
»Komm schon. Steig in den Wagen.«
»Verdammt, musst du ständig über mich herfallen wie ein Schwarm Heuschrecken mit Helfersyndrom?«
»Ich will dich nur nach Hause bringen, nicht heiraten, Mona.«
Ich drehte mich zweifelnd zu meinem Honda um. Ich könnte noch einmal versuchen, ihn zu starten, aber das war meistens umsonst. Der Bus fuhr erst in einer Stunde und in den Unterricht konnte ich nicht zurück. Blieb noch die Möglichkeit zu laufen, oder mich von Jude chauffieren zu lassen.
»Du bringst mich hin und lässt mich dann in Ruhe?«
Er grinste mich an und bedeutete mir, ihm zu folgen. Wir schlängelten uns zwischen den Autos hindurch. Die meisten der Wagen waren gebraucht und wiesen ein, zwei Beulen auf. Doch dann entdeckte ich zwischen den ganzen Kombis einen blitzenden, silbernen Audi und blieb stolpernd stehen.
»Ist nicht dein Ernst, oder?«
Jude ließ sich mit Unschuldsmine auf der Motorhaube nieder. So wie der Wagen glänzte, hätte es mich nicht gewundert, wenn er einfach abgerutscht wäre.
»Was ist?«
»Hast du dir die anderen Autos mal angeguckt?«, fragte ich ihn mit einem Kopfnicken zu meinem Honda. »Ich hoffe für dich, du hast eine gute Alarmanlage.«
Er deutete auf die Beifahrertür. Ich schielte unsicher in den Innenraum. Wahrscheinlich hatte dieses Ding Panzerglas.
»Du hast einen ganz miesen Eindruck von den Menschen um dich herum, oder?«, fragte Jude. Ich hob die Schultern und ließ mich schließlich auf den Sitz fallen.
»Warum sollte ich ihnen trauen?« Verdammt, was tat ich hier eigentlich? Das hier war nicht gut. Er war zu freundlich. Ich war zu freundlich. Ich durchbrach gerade die steinkalte Mauer, die ich im Laufe der Jahre mühsam um mich herum errichtet hatte.
»Wie lange gehst du schon auf diese Schule?«, fragte er, als er den Audi vom Parkplatz fuhr.
»Warum versuchst du so krampfhaft, nett zu sein?«
»Warum versuchst du so krampfhaft, nicht nett zu sein?«, konterte er ohne mich anzusehen. »Welche Richtung?«
»Links. Hoch zum Wald«, sagte ich beiläufig. »Und ich versuche nicht bloß unfreundlich zu sein, ich bin es einfach. Warum raffst du das nicht?«
Er machte eine abwehrende Handbewegung, als bedeuteten meine Worte nicht das Geringste.
»Kein Mensch ist einfach nur unfreundlich. Irgendwo da drin versteckt sich ein Mädchen, das einmal Prinzessin werden möchte.«
»Da irrst du dich gewaltig. Die habe ich schon vor Jahren um die Ecke gebracht.«
Jude lachte. Das war das erste Mal, dass ich ihn lachen hörte. Er hatte gegrinst und gelächelt, aber noch nie gelacht. Es klang gelöst. Ehrlich. Nicht wie das gekünstelte Lachen meiner Mutter, wenn sie von ihrem Job erzählte. Nicht wie das Brüllen meines Vaters, wenn er über die Witze seines Chefs lachte.
»Lass mich raten«, sagte Jude mit einem Seitenblick zu mir, »dein Zimmer hat schwarze Wände und Poster mit dunklen Engeln, denen die Flügel herausgerissen wurden.«
Obwohl seine Bemerkung zweifellos witzig gemeint war, konnte ich nicht darüber lachen. Nein, mein Zimmer war nicht schwarz und es gab auch keine Poster. Die Wände meines Zimmers waren weiß, ohne einen einzigen Farbtupfer. Mit elf hatte ich einmal mit Bleistift einen riesigen Raben über mein Bett gemalt. Ich hatte den ganzen Samstag daran gesessen und mir die Vögel vor meinem Fenster angesehen, bis ich die richtigen Schattierungen und Lichtreflexe hinbekommen hatte. Meine Finger waren grau vom Verwischen gewesen. Dann kam Dad nach Hause und strich den Raben mit weißer Farbe über. Seitdem durfte ich nicht einmal mehr ein Bild aufhängen. Mein Vater konnte es nicht leiden, wenn man ihm ungefragt die Kontrolle entzog. Und sei es nur so etwas Banales wie die Gestaltung meines Zimmers.
»Mona?« Ich zuckte zusammen. Jude hatte etwas gesagt, anscheinend hatte ich es nicht mitbekommen. Ich sah ihn an und bemerkte, dass er auf meine Hände blickte. Unwillkürlich hatte ich angefangen, mit den Knöcheln zu knacken. Hastig schob ich mir die Hände unter die Oberschenkel, damit ich nicht wieder anfangen konnte. Ich musste mir einen unauffälligeren Tick suchen.
»Was ist?«, fragte ich und bemühte mich, zerstreut zu klingen. So sahen Menschen aus, die einfach nur aus einem Tagtraum oder einem Gedanken gerissen wurden. Völlig teilnahmslos. Er beobachtete mich noch einen Moment, dann deutete er mit einem Kopfnicken auf die Straße. Ich hatte überhaupt nicht mitbekommen, dass der Wald vor uns aufgetaucht war. Dunkel und vertraut streckten sich die stellenweise kahlen Äste in die Höhe. Vor dem grauen Himmel sahen sie aus wie die Finger eines Sterbenden, der sich an das letzte bisschen Leben klammert, das er erreichen kann.
»Nach links. Das weiße Haus mit den blauen Ziegeln.«
Schweigend folgte Jude meiner Beschreibung und hielt schließlich vor unserem Haus. Ich konnte den Wagen meines Vaters in der Einfahrt erkennen. Mir stockte für einen Moment vor Entsetzen der Atem. Er sollte jetzt noch nicht zu Hause sein! Montags war er bis spät auf dem Revier! Was machte er zu Hause?
»Wir sind da«, sagte Jude langsam. Unterschwellig nahm ich war, dass er mich schon wieder beobachtete. Doch das war mir im Moment völlig egal. Mein Plan war gewesen, mich ins Haus zu schleichen und in meinem Zimmer einzuschließen. Zu warten, bis Dad nach Hause kam und zu hoffen, dass er nicht zu mir hochkam. Aber jetzt war er hier! Er würde sehen, dass ich die Schule schwänzte und dass ich nicht den Pullover trug, den er mir rausgelegt hatte. Leise Panik machte sich in mir breit. Wie hatte ich nur so dumm sein können? Dieser Tag war von Anfang an entsetzlich gewesen.
»Ich muss jetzt los«, sagte ich tonlos. Ich griff nach meiner Tasche. Dad durfte nicht sehen, dass ich von jemandem heimgefahren wurde.
»Ist alles in Ordnung mit dir?« Jude sah mich argwöhnisch an. Sein Blick wanderte von mir zu unserem perfekten Vorstadthaus und wieder zurück. Ganz automatisch breitete sich ein maskenhaftes Lächeln auf meinem Gesicht aus. In diesem Moment wurde ich zu einem Roboter. Einem Roboter, der von anderen programmiert worden war.
»Du solltest dir eine gute Entschuldigung einfallen lassen«, bemerkte ich trocken. »Peterson ist wirklich eine Hexe. Danke fürs Fahren.« Damit drehte ich mich um und rannte über die Straße und dann unsere Auffahrt hoch.
Ich hasste es, nach Hause zu kommen. Die dunkle Eingangstür war jedes Mal wie ein gieriger Schlund, der mich nicht mehr herausließ, wenn ich einmal hindurchgetreten war. Das hier war kein Zuhause. Es war einfach nur ein Gebäude mit Zimmern, in denen ich schlief, aß, trank und duschte. Mehr nicht. Ich hatte schon öfters übers Abhauen nachgedacht. Nur, wo sollte ich hin? Meine Großeltern waren alle tot, Tanten oder Onkel hatte ich nicht und wenn ich einmal Freunde gehabt hatte, dann waren sie inzwischen geflohen. Und ich wusste genau, warum ich nicht einfach durchbrannte und mich auf der Straße durchschlug. Ich war zu feige und zu verwöhnt. Meine Klamotten waren – abgesehen von meinen Stiefeln, bei denen ich mich weigerte, sie wegzugeben – nicht älter als ein halbes Jahr, mein MP3-Player war eigentlich ein iPod und meine Haare glänzten vom Markenshampoo. Ich war der perfekte Teenager, wenn man einmal davon absah, dass ich keine High Heels und nur dezentes Make-Up trug. Aber alles andere hatte Daddy im Laufe der Jahre ganz genau nach seinen Vorstellungen geformt, bis ich einigermaßen so war, wie er es wollte.
Hinter mir hörte ich den Motor von Judes Audi. Ich drehte mich nicht um. Mit den Schlüsseln in der Hand stand ich neben Dads Dienstwagen. Was würde er tun, wenn er heraufkäme und sah, dass sein ganzes Auto verkratzt war? Wie würde sein Gesicht aussehen, wenn ich den Schlüssel langsam über Türen und Motorhaube ziehen würde? Die Faust durch die Windschutzscheite schlug, bis die Haut über meinen Knöcheln aufriss und mein Blut seine geliebten Ledersitze ruinierte?
Einen Moment spielte ich tatsächlich mit diesem Gedanken. Doch er würde wissen, dass ich es gewesen war. Und dann würde er sich eine Strafe überlegen. Natürlich nachdem er den Schaden für die Nachbarn beseitigt hatte. Im Geist konnte ich Moms Stimme hören, leise und flehend: »Er ist dein Vater. Er liebt uns. Du weißt, er tut das alles zu deinem Besten, Liebes.«
»Aber ist es auch zu deinem Besten, Mom?«, fragte ich sie dann jedes Mal. Sie hat mir nie geantwortet.
Ich holte mein Handy aus der Tasche und sah auf die Uhr. Es war immer noch zu früh, um rechtmäßig aus der Schule zu kommen. Vielleicht hätte ich mich von Jude einfach zurück in die Stadt bringen lassen sollen. Vor der Tür atmete ich ein. Einmal. Zweimal. Der Schlüssel im Türschloss machte ein beunruhigendes Geräusch, als ich ihn herumdrehte. So leise wie möglich betrat ich den Flur und wartete einen Augenblick auf der Fußmatte. Links neben mir an der Wand hing eine Gegensprechanlage, die mein Vater benutzte, um mich zu rufen, wenn er im Büro war. Falls er mich gehört hatte, würde es nicht mehr lange dauern, bis er mich zu sich bestellte. Doch die Lautsprecher blieben stumm. Ich atmete erleichtert auf. Ich wagte es nicht, meine Jacke auszuziehen oder aus den Schuhen zu treten. Auf Zehenspitzen schlich ich über den Flur, am Schlaf- und Arbeitszimmer meiner Eltern vorbei und die Treppe hinauf. Der Raum, in dem ich schlief, befand sich in der zweiten Etage. Tatsächlich war ich die einzige, die den zweiten Stock bewohnte. Außer meinem Zimmer befanden sich lediglich mein Bad, Moms Meditationsraum und das Gästezimmer hier oben. Andere Teenager hätten in dieser Wohnsituation wahrscheinlich den Himmel auf Erden gesehen. Ich nicht. Ich hatte die Lügen über den Himmel schon vor Jahren durchschaut. In meinem Zimmer war es kalt. Jemand hatte das Fenster geöffnet und die kalte Winterluft fegte mir die Haare in den Nacken. Schnell und leise schloss ich erst die Tür, dann das Fenster und zog mir schließlich mein Sweatshirt über den Kopf. Auf einer Kommode neben der Tür lagen fein säuberlich eine dunkle Jeans und ein cremefarbener Rollkragenpullover. Ich nahm mir den Pullover und schlüpfte hinein. Er war steif und roch nach Zitronenwaschmittel. Aber mein Vater schien ihn für angemessen zu halten. Heute Abend wollten Kollegen aus Moms Praxis kommen. Dad brauchte sein Vorzeigemädchen.
Vor dem Spiegel band ich mir die Haare zurück, damit ich den Zopf flechten und mir rechts über die Schulter legen konnte. Ich kannte die Frisuren, die ich zu den verschiedenen Kleidungsstücken tragen sollte. Rollkragenpullover machen mein Gesicht fett, wie Dad sagte, also musste ich mir einen Zopf machen. Ein offener Pferdeschwanz war unangemessen, weil mir beim Essen Haare in die Suppe fallen könnten. Er regte sich oft darüber auf, dass meine Haare so dunkel waren. Er selbst war blond, hellblond. Hier und da sogar schon grau. Wenn er richtig mies drauf war, warf er meiner Mom vor, dass ich nicht von ihm war. Letzten Donnerstag war sie eine dreckige Hure gewesen, Freitag die beste Ehefrau der Welt. Samstag hatte er sie aus dem Haus schmeißen wollen und abends hatte ich gehört, wie sie unten miteinander schliefen. Weil ich ein Vorzeigemädchen war, bekam ich das alles natürlich nicht mit. Für meinen Vater lebte ich in einer Art Parallelwelt, die zwar neben seiner eigenen existierte, jedoch hinter einer Art Panzerglas, durch das ich weder hören noch sehen konnte. Prüfend betrachtete ich mein Spiegelbild. Der strenge Zopf ließ mein Gesicht irgendwie merkwürdig aussehen. Kränklich. Als hätte man mich zu stark geliftet. Ich griff an meinen Hinterkopf und zog am Haarband, bis sich das Ziehen an meiner Kopfhaut ein bisschen lockerte. Perfekt.
Von unten ertönte ein erstickter Schrei, der mich zusammenfahren ließ. Für einen Augenblick stand ich wie versteinert da und starrte mein Spiegelbild an, dann schaltete sich mein Gehirn wieder ein. Mom?
Ohne über das Schwänzen nachzudenken, riss ich die Tür auf und sprang die Treppen hinunter. Der Flur war leer, nur ein schwacher Lichtstreifen fiel durch den Spalt der offenen Schlafzimmertür. Ein leises Stöhnen. Ich dachte nicht nach, sondern rannte einfach weiter und riss die Tür auf. Keuchend stolperte ich zurück. Ich knallte mit dem Rücken gegen den Türrahmen, aber das war im Moment egal. Vor mir, auf dem bügelglatten Laken meiner Mutter, räkelte sich eine wasserstoffblonde, nackte Frau. Über ihr mein Vater, der lediglich Jeans und Socken trug. Er stand mit dem Rücken zu mir. Seine harten Muskelstränge schienen bedrohlich zu pulsieren. Es dauerte einen Augenblick, bis die Frau mich bemerkte. Ihre blassblauen Augen weiteten sich entsetzt, als sie mich am Türrahmen sah. Sofort hörte sie auf sich zu räkeln und zog sich die dünne Überdecke über den Körper. Moms Überdecke!
Kaum eine Sekunde später stand Dad vor mir. Er hatte sich umgedreht, als sein Spielzeug aufgehört hatte, sich mit ihm zu beschäftigen, und war erschreckend wendig auf mich zugesprungen. Ich duckte mich im Türrahmen und wünschte mir, einfach von dem Holz verschluckt zu werden.
»Was machst du hier, Mona?«, brüllte Dad. Ich sah die Ader an seinem Hals pulsieren und schloss einen Moment erschöpft die Augen.
»Ich bin krank, Dad«, log ich glatt. »Es ging mir nicht gut. Ich bin nach Hause gekommen.«
Seine Hand zuckte an seiner Hüfte. »Ich habe dich nicht gehört.«
Mit einem Blick auf die Frau in seinem Ehebett zuckte ich die Schultern. Blitzschnell umklammerten seine Finger meinen Oberarm. Ich biss die Zähne aufeinander.
»Behandle mich nicht wie einen deiner dreckigen Freunde, junges Mädchen! Wenn ich mit dir rede, erwarte ich, dass du antwortest.«
Mein Arm begann zu kribbeln. »Es tut mir leid«, presste ich zwischen zitternden Lippen hervor. »Ich weiß nicht, warum du mich nicht gehört hast. Ich bin vorne hereingekommen.«
Dad warf einen rasenden Blick über die Schulter zu seinem Spielzeug. »Geh!«, blaffte er. Blondie ließ sich das nicht zweimal sagen. Mit einem scheuen Blick wickelte sie sich die Decke um den Körper, sammelte ein paar Klamotten vom Fußboden und huschte an uns vorbei in den Flur. Eine Sekunde später fiel die Haustür ins Schloss.
»Sie hat ihren BH vergessen«, bemerkte ich wütend. Ich wusste, dass ich nach außen hin absolut ruhig wirkte. Aber das hier war zu viel. Ich wusste seit Jahren, dass Mom und Dad sich nicht treu waren, doch ich hatte immer angenommen, dass sie wenigstens ihr Ehebett respektierten. Er hatte Mom damit ins Gesicht gespuckt! Meine Bemerkung sorgte dafür, dass Dad einen wütenden Schrei von sich gab. Seine Finger griffen inzwischen übereinander, so hart umklammerte er meinen Oberarm.
»Willst du etwa respektlos werden, Mona?«, donnerte er. Seine Stimme war jetzt ein Knurren, ein Donnern. Ich zuckte zusammen.
»Du respektierst Mom doch auch nicht!«
Plötzlich wurde er ganz ruhig. Sein Atem beruhigte sich, das Blut wich aus seinem Gesicht. Tränen brannten mir in den Augen, als ich ihm zusah.
»Ich liebe deine Mutter, Mona Lisa«, schwor er eindringlich. »Ich tue alles, um diese Familie zusammenzuhalten.«
Der Name ließ mich zusammenfahren. Mona Lisa. Sein Kosename. Seine Art und Weise, die heile Welt aufrechtzuerhalten.
»Du zerstörst diese Familie! Guck dir dieses Flittchen doch mal an! Wer ist sie, hm? Eine kleine Streifenpolizistin, die sich beim Chief hochschlafen will? Oder einfach nur eine Nutte aus der Stadt? Du bist so erbärmlich!«
Dads Gesichtszüge verhärteten sich. Langsam hob er die Hand, als wolle er mir die Haare zurückstreichen. Dann schlug er mir mitten ins Gesicht. Augenblicklich sah ich Sterne. Ich prallte nach hinten gegen den Türrahmen und sackte langsam auf den Boden. Dad hatte mich oft geschlagen, aber noch nie ins Gesicht. Einen Augenblick sah er schwer atmend auf mich herab, dann bückte er sich und lud mich auf seine Arme. Ich wehrte mich, immer noch benommen, kam gegen seine starken Arme aber einfach nicht an. Er trug mich nach oben in mein Zimmer und legte mich sanft aufs Bett. Die Finger, die gerade noch meinen Arm umklammert hatten, strichen mir eine Haarsträhne aus der Stirn, die sich aus meinem Zopf gelöst hatte.
»Du weißt, warum ich das tun musste, Schatz. Deine Mutter wäre todunglücklich, wenn sie von dem Mädchen erfahren würde. Willst du, dass sie leidet?« Seine Stimme ließ mich würgen.
»Du siehst wunderschön aus. Mr. und Mrs. Cunningham kommen um acht, bis dahin kannst du dich ausruhen. Ich werde deine Mutter mit dem Essen hochschicken.«
Ich hörte seine Schritte auf dem Laminat. Dann war er verschwunden. Sobald die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, war ich aus dem Bett. Im Spiegel überprüfte ich mein Gesicht, die komplette linke Hälfte hatte sich feuerrot verfärbt. Vorsichtig drückte ich auf die Haut. Meine Finger hinterließen weiße Abdrücke. Verdammt! Ich konnte mir kein Veilchen leisten. Meine Mom würde den Grund wissen wollen und ich wollte mit Sicherheit nicht diejenige sein, die ihr die Geschichte erzählte. In einem hatte Dad auf jeden Fall Recht: Es war besser, wenn Mom davon nichts mitbekam. Leise schlich ich ins Bad und verschloss die Tür hinter mir. Ich durfte im Moment nicht zusammenbrechen. Ich durfte nicht zulassen, dass die Gedanken an das, was passiert war, mich einholten. Heute Abend, wenn ich in meinem Bett lag, konnte ich schwach sein. Nicht jetzt. Mechanisch nahm ich einen Waschlappen aus der Schublade und hielt ihn unter den Wasserhahn. Als er sich vollgesogen hatte, wrang ich ihn aus und drückte ihn mir ins Gesicht. Das kalte Wasser tat gut, aber ich spürte, wie meine Haut unter dem Stoff pochte. Unter der Schublade mit den Waschlappen und Handtüchern befand sich mein Medikamentenlager. Verbände, Klammern, Pflaster, Tabletten, Salben – alles was das Herz begehrt. Und alles von meinem Vater gekauft, um das zu kitten, was er selbst anrichtete. Dieser Haushalt war wie eine gutgeölte Maschine.
Ich griff nach der Salbe gegen Blutergüsse und dem Eisspray und schmierte mir beides ins Gesicht. Ich hatte inzwischen meine eigenen Hausmittel gegen derlei Verletzungen. Ich langte wieder in die Schublade und holte eine kleine Flasche Apfelessig heraus. Vorsichtig schüttete ich ein wenig auf meinen Waschlappen und drückte ihn mir wieder über das Auge. Wenn Dad über Nacht nicht übernatürliche Kräfte entwickelt hatte, dann würde das reichen. Allerdings hatte ich auch keine Erfahrungen mit Hämatomen im Gesicht. Bisher war mein Vater immer bemüht gewesen, nach außen den liebenden Familienvater zu spielen. Er hatte sich nicht getraut mich ins Gesicht zu schlagen. In den Nacken, gegen den Kopf, auf den Rücken. Aber niemals ins Gesicht. Na ja, offensichtlich musste man ihn einfach nur genug reizen.
Um halb sieben klopfte es an meiner Zimmertür und die Stimme meiner Mutter drang von außen durch die Tür: »Mona, bist du wach?«
Einen Augenblick überlegte ich, ob ich mich einfach schlafend stellen sollte. Doch sie würde mich ohnehin nicht in Ruhe lassen. Wir erwarteten Gäste und da musste die ganze Familie präsent sein.
»Komm rein.«
»Dad hat gesagt, du wärst krank«, sagte sie stirnrunzelnd und kam in mein Zimmer. Wenn man meine Mutter rein objektiv betrachtete, würde man niemals denken, dass sie einen Schläger zu Hause hatte. Sie war groß, schlank, beinahe muskulös. Wir hatten dieselbe Haarfarbe, aber ihre Haare ringelten sich in tausend kleinen Locken um ihr Gesicht herum, während meine nur leichte Wellen hatten. Ich konnte mit ihr in Sachen Aussehen eindeutig nicht mithalten. Und jetzt waren ihre blauen Augen skeptisch auf mich gerichtet.
»Du siehst mir nicht sehr krank aus. Es sei denn es handelt sich um Schwänzeritis, dafür hast du die richtigen Symptome.«
Oh gut. Wenn ich nicht krank wirkte, konnte mein Gesicht nicht so schlimm aussehen. Das war im Moment die Hauptsache, dass man mir den Vorfall nicht vom Gesicht ablesen konnte.