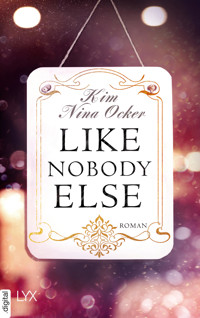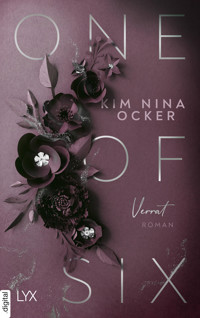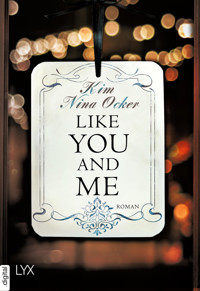9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Secret Legacy
- Sprache: Deutsch
Ich wurde getäuscht. Mit jeder kleinen Lüge, mit jedem kleinen Geheimnis.
Die Nachricht, dass ihre biologische Mutter, die sie nie kennengelernt hat, ihr ein großes Vermögen vererbt, trifft Julie Penn vollkommen unvorbereitet. Um das Erbe antreten zu können, muss sie allerdings Teil des einflussreichen Familienunternehmens ihrer Mutter werden - eine Entscheidung, die ihr ganzes Leben verändert: Julie taucht in eine Welt voller Luxus und Reichtum ein, aber auch voller Intrigen und Geheimnisse - und sie trifft auf Caleb, den Adoptivsohn ihrer Mutter, dessen intensive Blicke Julies Herz trotz seiner abweisenden Art gefährlich schnell schlagen lassen. Doch plötzlich erreichen sie beunruhigende Anrufe und mysteriöse Drohbriefe, die Julie Angst einjagen ...
"Eine moderne Cinderella-Geschichte mit spannendem Twist. Ich konnte das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen!" ANABELLE STEHL, SPIEGEL-Bestseller-Autorin
Erster Band der SECRET-LEGACY-Dilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Kim Nina Ocker bei LYX
Impressum
Kim Nina Ocker
Every Little Secret
ROMAN
Zu diesem Buch
Als Julie erfährt, dass sie von ihrer biologischen Mutter ein großes Vermögen erben soll, ist sie vollkommen überfordert – schließlich hat sie Sylvia Bonham, die einen millionenschweren Pharmakonzern aufgebaut hat, nie kennengelernt. Doch die Chance auf finanzielle Unabhängigkeit kann die junge Studentin nicht verstreichen lassen. Womit sie allerdings nicht gerechnet hat: Um das Erbe antreten zu können, muss sie für ein Jahr ein Teil von Bonham Industries werden – eine Entscheidung, die ihr ganzes Leben verändert. Julie taucht in eine vollkommen andere Welt ein, voller Luxus und Reichtum, aber auch voller Intrigen und Geheimnisse. Und sie trifft auf den attraktiven Caleb Bonham, den Adoptivsohn ihrer Mutter, der gar nicht begeistert ist, die Leitung der Firma mit Julie teilen zu müssen. Aber obwohl er sich ihr gegenüber abweisend verhält, lässt ein intensiver Blick von ihm ihr Herz doch gefährlich schnell schlagen. Und als sie plötzlich beunruhigende Anrufe und mysteriöse Drohbriefe erhält, die ihr Angst einjagen, ist Caleb an ihrer Seite. Doch kann Julie einem Mann vertrauen, der alles gewinnen würde, wenn sie auf das Erbe verzichtet?
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält Elemente, die potenziell triggern können. Diese sind:
Erwähnung von Todesfällen, Erwähnung von Erkrankungen und gefährlichen Verletzungen, Schilderungen bedrohlicher Situationen, Stalking und Einbrüchen.
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Kim und euer LYX-Verlag
Für Eileen*
* Ich denke, du weißt, warum du ENDLICH eine Buchwidmung verdient hast. Falls nicht, hier die Kurzfassung: Weil du mir die Wahrheit sagst, auch wenn ich sie nicht hören will. Und weil du der erste Mensch warst, der jemals etwas von mir gelesen hat (wofür ich mich auf diese Weise noch einmal in aller Form entschuldigen möchte). Hab dich lieb!
Prolog
Drei Tote, mehrere Millionen Sachschaden, ein zerstörtes Apartment und vier gebrochene Rippen sind ein verdammt mieses Resultat eines Sommers in New York.
Wann genau kommt man eigentlich in dieses berüchtigte Alter, in dem man es besser wissen sollte? Ich wäre jetzt bereit. Denn rückblickend betrachtet hätte ich das Ganze hier kommen sehen sollen. Rückblickend betrachtet hätte mir klar sein müssen, dass diese Sache mich einholen und mir einen gewaltigen Arschtritt verpassen wird. Ich hätte es irgendwie voraussehen, besser aufpassen und die Reißleine ziehen müssen, bevor es dermaßen eskaliert. Habe ich aber nicht. Die Kacke ist gewaltig am Dampfen, und das ist zum großen Teil meine beschissene Schuld.
Die Tür hinter mir geht auf, und ich suche den Blick des Uniformierten, der mit ernster Miene den Verhörraum betritt.
»Was hat sie gesagt?«, frage ich, ohne Zeit für eine Begrüßung zu verschwenden.
Er antwortet nicht sofort, sondern legt stattdessen bedächtig die Mappe, die er in der Hand gehalten hat, auf den Tisch und öffnet den Knopf seines Jacketts, bevor er sich mir gegenüber auf den ungemütlichen Plastikstuhl setzt.
Ich beiße die Zähne zusammen. »Was hat sie gesagt?«, wiederhole ich, langsamer dieses Mal und mit vor Wut zitternder Stimme. Er sollte dieses Spielchen nicht mit mir spielen. Ich lasse mich von ihm nicht einschüchtern, und wenn ich ihm eine direkte Frage stelle, erwarte ich, verdammt noch mal, eine klare Antwort.
Der Typ hebt eine Augenbraue. »Ich fürchte, das müssen Sie präzisieren«, sagt er in beinahe gelangweiltem Ton. »Wen genau meinen Sie?«
Meine Hand ballt sich zur Faust, aber ich versuche, Ruhe zu bewahren. So gerne ich auch ausrasten würde, so gerne ich der Wut, der Frustration und der Angst in meinem Magen auch Luft lassen würde, weiß ich, dass es mich nicht weiterbringt. Niemanden von uns. Je mehr Ärger ich hier drinnen mache, desto länger wird es dauern, bis sie mich rauslassen. Bis sie mich zu ihr und mich mit eigenen Augen sehen lassen, was ich getan habe.
»Juliette Penn«, sage ich betont ruhig. »Wo ist sie?«
Der Blick aus den Augen des Detectives ist unergründlich. Nicht unfreundlich, nicht wütend oder abschätzig. Er sieht mich an, als würde er auf etwas warten. Darauf, dass ich die Beherrschung verliere oder zusammenbreche oder …
»Brauche ich einen Anwalt?«, frage ich tonlos, als er nicht antwortet. Ich habe damit gerechnet, mich verteidigen zu müssen. Ich habe sämtliche Vorkehrungen getroffen. Trotzdem ärgert es mich. Die Ereignisse der vergangenen Stunden stecken mir immer noch in den Knochen, liegen auf meiner Haut wie ein widerlicher Film und schnüren mir die Kehle zu. Ich brauche Zeit zum Durchatmen. Eine Pause von all den Emotionen, bevor ich mit der Polizei über meine Schuld oder Unschuld diskutieren kann.
»Wurden Ihnen Ihre Rechte verlesen?« Ich nicke knapp. »Dann wissen Sie, dass Sie ein Recht auf juristischen Beistand haben. Natürlich wäre es das Beste für Sie und auch für Miss Penn, wenn Sie auf unsere Fragen so schnell wie möglich antworten würden.«
»Warum?«, frage ich und spüre, wie sich eine eisige Kälte durch meinen Körper frisst. »Warum ist es für Miss Penn wichtig, dass ich so bald wie möglich antworte?«
Sein Gesicht bleibt ungerührt. »Wir müssen wissen, was passiert ist. Das würde nicht nur uns helfen, die ganze Sache zu verstehen, sondern auch den Ärzten, die sich in diesem Moment um Miss Penn kümmern.«
Mir ist, als hätte mir jemand in den Magen geschlagen. Und ins Gesicht. Und mich gleichzeitig mit Benzin übergossen und angezündet. Ein Schauder läuft mir über den Rücken. Ich wusste, dass Julie verletzt wurde. Ich wusste, dass man sie beide ins Krankenhaus gebracht hat. Aber ich war davon ausgegangen, dass es sich bei ihren Verletzungen nur um ein paar Kratzer gehandelt hat. Eine Vorsichtsmaßnahme, absolut berechtigt, wenn man bedenkt, was passiert ist.
Einen Moment lang befürchte ich, mich übergeben zu müssen. Ich wurde gewarnt, dass mir diese Sache um die Ohren fliegen könnte. Und ich habe auch nicht erwartet, dass alles reibungslos verlaufen würde. Aber das hier … das hier droht, meine Fähigkeiten zu übersteigen. Droht, die Schutzmauern einzureißen, die ich in den letzten Jahren um mein Herz errichtet habe, um es davor zu schützen, gebrochen zu werden.
Ich setze mich ein wenig aufrechter hin und sehe den Mann vor mir an. Er hat sich mir vorgestellt, aber ich habe seinen Namen bereits wieder vergessen. Es spielt eigentlich auch keine Rolle, wie er heißt. Nichts spielt im Moment eine Rolle, nichts und niemand – nicht, solange ich nicht weiß, was genau passiert ist. Und was die Konsequenzen dessen sind.
»Was wollen Sie wissen?«, frage ich, verschränke die Arme vor der Brust und lehne mich auf dem kalten Stuhl zurück. Keine Ahnung, wie lange ich hier schon sitze. Keine Ahnung, wie lange sie mich ohne begründeten Verdacht oder Beweise festhalten können, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon bald herausfinden werde. »Und ich möchte, dass Sie Anthony Hoffman von Hoffman & Sons anrufen. Er ist mein Anwalt.«
Der Detective wendet den Kopf zur Seite und wirft einen Blick zu dem Einwegspiegel. Er nickt einmal, was vermutlich die stumme Aufforderung darstellen soll, meiner Bitte Folge zu leisten. Es wundert mich nicht, dass uns offensichtlich noch andere Leute zusehen. Hoffentlich ist noch nicht durchgesickert, dass ich mich in Polizeigewahrsam befinde. Immerhin gehöre ich zu den bekanntesten und einflussreichsten Persönlichkeiten dieser Stadt. Sobald ans Licht kommt, dass ich in einem beschissenen Verhörraum sitze und Julie im Krankenhaus liegt, werden die Reporter sich gegenseitig über den Haufen rennen, um das beste Foto zu bekommen. Es würde mich nicht mal wundern, wenn einer der Polizisten einen Platz in dem Raum hinter dem Einwegspiegel verkauft hat, um die eigene Kasse ein bisschen aufzufüllen. Vielleicht schießt genau in dieser Sekunde irgendein Reporter das wertvollste Foto seiner Karriere.
»Erzählen Sie mir, was passiert ist.«
Ich hebe kaum merklich eine Augenbraue. »Ich fürchte, Sie müssen das präzisieren.«
Er presst die Lippen zusammen. »Gut, fangen wir ganz am Anfang an. Wo waren Sie heute Morgen, als Miss Penn das Haus verlassen hat?«
»In meinem Büro in New York«, antworte ich, ohne zu zögern. »Ich arbeite sehr viel, seit ich die Firma übernommen habe.«
»Auch an den Wochenenden?«
»Wochenenden haben in meiner Welt oftmals keine Bedeutung. Wir erwarteten einen Aktieneinbruch einiger patentierter Pharmaka, weshalb ich bereits morgens in die Stadt gefahren bin. Wofür es Zeugen gibt.«
Der Blick des Detectives ist wieder aalglatt. »Und wo befand sich Miss Penn, als Sie aufgebrochen sind?«
Erneut durchfährt mich ein Schaudern, das ich mir jedoch nicht anmerken lasse. Ich erinnere mich an ihr im Schlaf entspanntes Gesicht – an das sanfte Lächeln auf ihren Lippen, ihre Stirn, ausnahmsweise einmal nicht vor Sorge gerunzelt, und an ihr Haar, das sich auf dem weißen Kopfkissen ausgebreitet hat. Sie hat friedlich ausgesehen – was vermutlich daran lag, dass ihr nicht klar war, dass ich sie beobachte.
»Hat noch geschlafen«, antworte ich knapp.
»Und Sie haben die Hamptons verlassen, ohne mit ihr zu sprechen?«
»Ja.«
»Woher wissen Sie, dass Miss Penn geschlafen hat?«
»Weil ich es gesehen habe.« Es dauert ein paar Sekunden, bis ich begreife, worauf seine Frage abgezielt hat. »Ja, ich war in ihrem Schlafzimmer«, füge ich widerstrebend hinzu, bevor er danach fragen kann. Nicht, dass diese Tatsache mir grundsätzlich peinlich ist. Aber nach allem, was in den vergangenen Monaten passiert ist, bin ich vorsichtig, was das Teilen von persönlichen Informationen angeht. Ich muss aufpassen, was ich sage. Was ich preisgebe, bevor mein Anwalt da ist.
Wieder wandern meine Gedanken zu Julie. Wie konnte das alles nur dermaßen aus dem Ruder laufen? Wie konnte ich zulassen, dass wir hier enden?
1
Drei Monate zuvor
JULIE
Dienstag, 24. Mai 2022
»Spreche ich mit Juliette Penn?«, fragt die emotionslos klingende Stimme am anderen Ende der Leitung.
Ich presse mir das Smartphone fester gegen das Ohr und weiche einer Pfütze aus, über deren Ursprung ich lieber nicht genauer nachdenken möchte. »Ja, die bin ich. Wie kann ich Ihnen helfen?« Innerlich schicke ich ein kleines Stoßgebet gen Himmel. Ich habe mich letzte Woche auf eine ausgeschriebene Stelle als Kellnerin in einer Bar im West Village beworben und, heilige Scheiße, ich brauche diesen Job.
»Miss Penn, mein Name ist Anthony Hoffman. Ich kontaktiere Sie im Namen der Anwaltskanzlei Hoffman & Sons und muss Sie in einer dringenden Erbschaftsangelegenheit sprechen.«
Ich runzle die Stirn. Ich kenne die Anwaltskanzlei, bei der er angeblich angestellt ist. Ihr Logo prangt unübersehbar an einem der Wolkenkratzer an der Lexington Avenue – einer der teuersten und nobelsten Straßen in ganz New York City. »Es tut mir leid«, sage ich ehrlich verwirrt, klemme mir das Handy zwischen Schulter und Ohr und öffne innerlich fluchend das Tor vor der Haustür meines Wohnhauses. Das verdammte Ding klemmt bereits seit Wochen. »Ich denke, Sie haben die falsche Juliette Penn. Die einzigen Verwandten, die mich in einem Testament berücksichtigen könnten, sind lebendig und wohnen nicht einmal in der Nähe.«
Und könnten sich eure Honorare nicht leisten, füge ich in Gedanken hinzu.
Der Typ schweigt, so lange, dass ich das Smartphone vom Ohr nehme, um zu schauen, ob ich aus Versehen aufgelegt habe.
»Verzeihen Sie, Miss, aber ich muss Sie bitten, persönlich bei uns vorbeizukommen. Ich würde die Angelegenheit gerne von Angesicht zu Angesicht mit Ihnen besprechen. Außerdem ist es notwendig, dass Sie sich identifizieren.«
»Wofür soll ich mich identifizieren?« Wenn das hier irgendein Scherz sein soll, verstehe ich die Pointe leider nicht. »Sie haben mit Sicherheit die falsche Nummer, Sir.«
Das Seufzen des Mannes am anderen Ende klingt nach einer kurzen Nacht, zu schwachem Kaffee und sich anbahnenden Kopfschmerzen. »Wir können Sie gerne noch einmal schriftlich kontaktieren oder die uns vorliegenden Daten mit Ihnen abgleichen, Miss Penn. Wenn Sie sich unwohl fühlen oder an unserer Integrität zweifeln, finden wir sicherlich einen Weg, Ihre Bedenken aus der Welt zu schaffen. Aber ich fürchte, es ist unvermeidbar, dass Sie sich mit uns unterhalten. Und ich halte es für das Beste, dies persönlich in unserer Kanzlei zu tun.«
Ich schließe das Tor hinter mir und lehne mich gegen die kleine Steinmauer, in die es eingebaut ist. »Passt es Ihnen morgen Nachmittag?«, kapituliere ich schließlich. Ich habe wirklich keine Lust, in den nächsten Wochen mit Briefen und Anrufen bombardiert zu werden. »Wenn Sie danach Ruhe geben, komme ich bei Ihnen vorbei, aber ich habe nicht viel Zeit.«
»Bitte planen Sie ein wenig Zeit ein, Miss. Wir haben ein paar Fragen, die ausreichend Aufmerksamkeit Ihrerseits erfordern.«
Nur mit Mühe unterdrücke ich ein Augenrollen, vereinbare mit dem Mann am Telefon einen Termin, verabschiede mich und lege dann auf. Ehrlich gesagt passt mir das alles nicht im Geringsten in den Kram. Ich muss morgen Abend arbeiten und habe neben dem College und meiner Schicht in der Kunsthochschule ohnehin schon kaum Freizeit. Diese ganze Sache ist garantiert ein Irrtum und der ganze Aufwand einfach nur unnötig. Ich schultere meinen Rucksack und schließe die Haustür auf, werfe dem kaputten Aufzug beinahe routiniert einen wütenden Blick zu und steige in den dritten Stock hinauf, wobei ich immer zwei Stufen auf einmal nehme. Mir bleibt kaum Zeit für Sport, aber das ewige Treppensteigen und Fahrradfahren zur Uni haben mir immerhin einen ganz anständigen Hintern geformt. Vor Apartment 3A halte ich kurz inne, um zu Atem zu kommen, dann schließe ich die Tür auf und betrete die WG, die ich mir seit knapp einem Jahr mit meinen Mitbewohnerinnen teile.
Ich liebe diese Wohnung: die hohen Decken, die Wände aus braunem Backstein und die alten Stahlbalken an der Decke, die dem Loft diesen authentischen und gleichzeitig modernen Industriecharme verleihen. Das Apartment besteht aus einem großen Raum mit offener Küche, von dem das Bad und die drei Schlafzimmer abgehen. Es ist nicht sehr groß, der Fahrstuhl ist schon seit Ewigkeiten kaputt und ungefähr die Hälfte der Fenster lassen sich nicht mehr öffnen, trotzdem ist es perfekt. Mitten im East Village gelegen, hat die Wohnung eine gute Anbindung an die Uni und meine Arbeitsstelle, außerdem befindet sie sich direkt neben einem Waschsalon.
Als ich das Wohnzimmer betrete, blickt Saheera von ihrem Laptop auf, den sie auf ihrem Schoß balanciert. Stirnrunzelnd sieht sie mich an. »Hey, Julie. Du bist spät dran.«
Ich werfe meinen Schlüssel auf die kleine Kommode neben der Tür. »Meine Kette ist zweimal abgesprungen, und dann hat mich so ein komischer Typ aus einer Anwaltskanzlei angerufen.«
Sie sieht mich fragend an. Während ich aus meinen Schuhen steige und die Milch, die ich unterwegs gekauft habe, in den Kühlschrank stelle, erzähle ich ihr knapp von dem lästigen Telefongespräch. »Er hat drauf bestanden, dass ich vorbeikomme. Das ist die reinste Zeitverschwendung.«
»Vielleicht ist ja was dran. Irgendein reicher Onkel, den du nie getroffen hast?«
»Meine Eltern sind Einzelkinder.« Stöhnend lasse ich mich neben sie auf die Couch fallen.
Saheera klappt den Laptop zu und zieht die Beine auf das Sitzpolster. Offensichtlich hat sie bereits Feierabend gemacht, denn sie trägt einen dunkelgrünen Schlafanzug und hat ihren Hijab abgelegt, sodass ihre Haare offen über ihren Rücken fallen. »Oder es geht um irgendwelche Forderungen.« Sie zuckt mit den Schultern, als ich fragend die Augenbrauen hebe. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch Schulden oder Ansprüche erben kann, oder nicht? Vielleicht ist jemand gestorben, dem du Geld schuldest.«
»Dann würden sie einfach eine Mahnung schicken.« Ich schüttle den Kopf. »Außerdem habe ich keine Schulden. Das ist sicher nur eine Verwechslung.«
»Was ist mit deiner Mutter? Deiner leiblichen, meine ich.«
»Die hat mich das letzte Mal gesehen, als ich ein paar Tage alt war. Sie weiß garantiert weder, wo ich wohne noch kann sie sich daran erinnern, wie ich heiße. Dad hatte keinen Kontakt zu ihr, seit sie sich getrennt haben. Sie würde mich bestimmt in keinem Testament bedenken.«
»Wie du meinst.« Sie klappt den Laptop wieder auf. »Bonnie hat geschrieben, dass sie heute erst spät nach Hause kommt. Sie hat ein Date mit dem Katzenmann von Tinder.«
Ich schnaube. Letztes Wochenende haben Bonnie, Saheera und ich Bonnies Tinder-Profil aufgemotzt und einen Abend damit verbracht, verschiedene Typen nach links oder rechts zu swipen. Je später es wurde und je mehr leere Weinflaschen sich auf dem Tisch ansammelten, desto niedriger wurden unsere Ansprüche, und schließlich fing Bonnie an, mit einem Kerl aus Brooklyn zu schreiben, der Bilder von sieben verschiedenen Katzen in Batman-Kostümen in seinem Profil hatte.
»Ich kann nicht glauben, dass sie immer noch Kontakt zu dem hat.«
»Vielleicht ist er nett«, meint Saheera und wirft mir einen strafenden Blick zu. »Sei nicht so oberflächlich. Wir haben auch zwei Katzen, und wir sind nicht komisch.«
»Sind wir nicht?«, murmele ich, stehe auf und greife auf dem Weg in mein Zimmer nach meinem Rucksack. Ich habe noch einen Haufen Arbeit für die Uni zu erledigen und ein ungutes Gefühl in meinem Magen sagt mir, dass morgen ein verdammt langer Tag wird.
Nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen habe, lehne ich mich einen Moment dagegen und atme ein paar Mal tief durch. Mein Fahrrad muss repariert werden, das muss auf meine To-do-Liste für das Wochenende. Seit einigen Wochen springt mir immer wieder die Fahrradkette ab, und ich komme nicht dahinter, wo der Fehler liegt. Morgen muss ich mich unbedingt hinsetzen und nachsehen, wie viel Geld ich erübrigen kann. Ich hoffe, dass sich das Café meldet, bei dem ich mich um die Servicestelle beworben habe. Donnerstags und jedes zweite Wochenende habe ich abends frei – an den Abenden könnte ich kellnern und neben dem Stundenlohn auch noch jede Menge Trinkgeld verdienen. Das wäre wie ein Sechser im Lotto. Allerdings habe ich keinerlei Erfahrungen in der Gastronomie und weiß, dass solche Stellen in New York City heiß begehrt sind.
Vielleicht habe ich ja doch einen reichen Onkel, von dem ich nichts weiß und der mir ein kleines Vermögen hinterlassen hat. In Filmen passiert so etwas schließlich andauernd. Das würde auf jeden Fall eine ganze Menge meiner Probleme lösen.
Ich blicke auf, als auf der Feuertreppe vor meinem Fenster ein Miauen erklingt. Eine Sekunde später schiebt sich ein schlanker, grau getigerter Kater durch den schmalen Spalt meines Fensters.
»Na, du kleiner Rumtreiber, warst du wieder unterwegs?«, frage ich leise, gehe hinüber und strecke die Hand aus, um ihn am Hals zu kraulen. Wir haben zwei Katzen, die über die Feuertreppe nach draußen gehen dürfen. Zwar machen mir der Verkehr und die Gefahren der Stadt immer wieder Sorgen, aber die beiden fühlen sich in der kleinen Wohnung einfach nicht wohl. Mr Norris ist mein Kater, Bonnies Katze Cordelia bleibt teilweise tagelang weg und kommt dann ziemlich vollgefressen nach Hause. Wir vermuten, dass sie irgendwo eine zweite Familie hat, mit der sie uns und Mr Norris betrügt.
Nachdem ich den Kater gebührend begrüßt habe, packe ich meine Unisachen aus und setze mich an den Schreibtisch, um mir die Notizen von heute anzusehen. In ein paar Wochen beginnt die Prüfungsphase und ich habe das Gefühl, in jedem verdammten Kurs hinterherzuhinken. Meine Eltern bezahlen die Gebühren für mein Grafikstudium an der NYU. Wenn ich durchfalle, würde ich das Gefühl haben, sie zu enttäuschen. Sie und ihr Bankkonto. Denn wenn ich ein Semester wiederholen muss, bedeutet das im Umkehrschluss, sie müssten auch länger zahlen, und ich weiß, dass ihnen das nicht leichtfällt.
Ein wenig sehnsüchtig werfe ich einen Blick auf das Zeichenpult, das zusammengeklappt neben meinem Bett steht. Mein Zimmer ist deutlich zu klein dafür, einen Schreibtisch und ein Zeichenpult unterzubringen, deswegen hat mein Dad mir bei meinem Einzug einen Aufsatz gebaut, den ich auf meinen Schreibtisch stellen kann. Ich studiere Grafikdesign, trotzdem liebe ich es, analog zu zeichnen und meine Entwürfe auf Papier zu skizzieren, bevor ich sie digital umsetze. Seit einer Weile arbeite ich an einer Art Freundebuch für Erwachsene – das ist meine Methode, abzuschalten und den Rest der Welt um mich herum zu vergessen. In diesem Moment sehne ich mich so sehr nach einer Auszeit, dass ich kurz überlege, den Lernstoff zu ignorieren und ein paar Entwürfe zu zeichnen. Allerdings vermute ich, dass ich mich dafür später hassen würde, also verwerfe ich den Gedanken schweren Herzens und wende mich meinen Notizen zu. Wenn ich damit fertig bin, kann ich mich dem Zeichnen viel entspannter widmen und fühle mich nicht schlecht, weil ich den Unikram auf die lange Bank schiebe. Ich kenne mich selbst gut genug, um zu wissen, dass ich Dinge am besten sofort erledige, um nicht in Stress zu geraten und den halben Abend zu prokrastinieren.
Nach einer halben Stunde stehe ich auf, um mir etwas zu trinken zu holen. Während ich darauf warte, dass die Kaffeemaschine aufheizt, checke ich gedankenverloren mein Handy und bemerke eine ungelesene SMS. Stirnrunzelnd entsperre ich das Display. Wer, zur Hölle, schreibt denn heutzutage noch SMS? Als ich auf das Symbol mit dem kleinen Umschlag tippe und der Absender erscheint, seufze ich leise. Es ist eine Terminerinnerung von Hoffman & Sons. Dort steht mein vollständiger Name, inklusive Geburtsdatum. Irgendjemand muss in dieser verdammten Kanzlei ganz schön Mist gebaut haben, oder es handelt sich um den größten Zufall aller Zeiten und es wohnt eine weitere Juliette Penn, geboren am 04. 08. 2002, im East Village, New York.
Ich tippe auf den Link in der SMS, der mich zu der Internetseite der Anwaltskanzlei führt. Laut dem Vorstellungstext auf der hochwertig gestalteten Website wird Hoffman & Sons von Mr Hoffman senior geleitet, seine vier Söhne, zu denen wohl auch mein Mr Hoffman gehört, sind Juniorpartner. Krasse Familie. Ein ungutes Gefühl breitet sich in meiner Magengegend aus, als ich die Referenzen der Kanzlei aufrufe und die Liste der Klienten durchlese, die sie offenbar erfolgreich vertreten hat. Ein paar der Namen kenne ich – darunter sind Prominente und lokale Unternehmen, deren Bürogebäude die New Yorker Skyline prägen. Es ist absolut offensichtlich, dass Hoffman und seine Söhne ausschließlich die amerikanische Oberschicht vertreten. Wozu ich nicht gehöre. Die Provisionen, die Hoffman & Sons berechnet, müssen gigantisch sein, um sich Büros an der Lexington Avenue leisten zu können. In meinem Inneren mischen sich verschiedenste Gefühle. Einerseits liegt diese Welt so dermaßen außerhalb meiner Komfortzone, dass ich mich automatisch irgendwie unwohl fühle. Ich bin in einem bodenständigen Elternhaus aufgewachsen, ich kenne mich in der Welt, in der diese Menschen leben, nicht aus. Und das will ich auch nicht. Andererseits fällt es mir ziemlich schwer, mir vorzustellen, dass diese Kanzlei überhaupt so etwas wie Fehler begehen und die falsche Person kontaktieren kann. Egal, wie sicher ich mir bin, dass es bei ihrem aktuellen Fall unmöglich um mich gehen kann.
Energisch schließe ich den Internetbrowser und öffne stattdessen Spotify, um meine dröhnenden Gedanken mit Musik zu übertönen. Dann greife ich nach meiner Tasse und nippe vorsichtig an dem heißen Kaffee. Was auch immer hinter diesem verdammten Anruf steckt, wird sich morgen herausstellen.
Zumindest hoffe ich das.
CALEB
Ich bin kein Fan von Beerdigungen. Die Musik, die Klamotten, die Stimmung, das Essen – auf all das kann ich wirklich verzichten. Meiner Meinung nach sollten Beerdigungen fröhlicher sein. Und ja, mir ist bewusst, wie widersprüchlich das klingt. Trotzdem. Sollte dieses letzte Abschiednehmen von einer geliebten Person nicht ein trostspendendes Ereignis sein? Ein Anlass, dem Leben des Verstorbenen zu gedenken, den schönen Zeiten, die man miteinander erlebt hat, und die Gelegenheit, sich gegenseitig zu unterstützen? Stattdessen wird die Trauer der Hinterbliebenen durch die ganze Stimmung ins Unermessliche gesteigert, jeder versucht verzweifelt, die Etikette zu wahren, niemand möchte sich unpassend oder gar respektlos verhalten und jeder Gast wartet nur darauf, endlich verschwinden zu dürfen und dieser niederschmetternden Stimmung zu entkommen.
So wie ich.
Wäre es nach mir gegangen, hätten wir meine Stiefmutter im kleinen Kreis beigesetzt, wären danach bei ihrem Lieblingsitaliener etwas essen gegangen und hätten einen entspannten Abend verbracht. Aber offensichtlich ging es nicht nach mir, was ein bisschen lächerlich ist, wenn man bedenkt, dass ich ihr einzig lebender Verwandter bin.
Und das auch nur auf dem Papier.
Leider haben Dinge wie Familiensinn und persönliche Präferenzen keinen Platz bei der Planung der Beerdigung einer der bekanntesten und erfolgreichsten Geschäftsfrauen des Staates New York. Sylvia Margret Bonham war Gründerin, CEO und Mehrheitsanteilseignerin eines der dreißig erfolgreichsten Pharmaunternehmen der Welt. Sie war intelligent, eine knallharte Businessfrau, schön und glamourös. Die perfekte Mischung in der Welt der Schönen und Reichen und ein fester Bestandteil der New Yorker High Society. So jemand wird nicht still und heimlich im kleinen Kreis beerdigt.
»Sieh sie dir alle an«, murmelt meine Schwester und lehnt sich zu mir rüber, damit die Leute hinter uns auf der Bank uns nicht verstehen können. »Sieh dir die Krokodilstränen an. Als ob sie sie wirklich vermissen würden.«
Ich folge ihrem Blick. Der Sarg meiner Stiefmutter ist nicht geöffnet, trotzdem gehen die Leute nach vorn, berühren mit gesenktem Kopf das polierte Mahagoniholz oder bekreuzigen sich, während sie vorgeben, ein Gebet zu sprechen. In diesem Moment treten zwei schlanke Frauen in schwarzen Kostümen vor und betupfen sich unaufhaltsam die Augen. Rahel hat recht – keine von ihnen weint wirklich um meine Stiefmutter. Gut möglich, dass sie miteinander befreundet waren, aber ich gehöre lange genug der New Yorker High Society an, um zu wissen, dass wahre Freunde in diesen Kreisen eine Seltenheit sind. Vor allem unter den Neureichen, die jeden Tag mit der Angst aufwachen, ihr Ruhm und Ansehen könnten sich durch einen kleinen Fehler, einen Einbruch der Aktienkurse oder einen schönen Skandal in Luft auflösen. Die meisten dieser Menschen scharen wohlhabende Freunde um sich, um sie im Zweifelsfall als eine Art Sicherheitsanker zu nutzen. Nicht, um das menschliche Miteinander oder die guten Gespräche zu genießen. Falls diese beiden Frauen also tatsächlich weinen, dann um die Möglichkeiten, die ihr Kontakt zu Sylvia Bonham ihnen gebracht hat.
»Dads Beerdigung war schöner«, sage ich leise. »Das hier ist bloß Theater.«
Rahel murmelt irgendeine Zustimmung und zupft ihr enges schwarzes Kleid zurecht. Mir ist klar, dass sie genauso wenig hier sein will wie ich, sogar noch weniger. Sie ist fünf Jahre älter als ich und wurde im Gegensatz zu mir nicht von Sylvia adoptiert. Die beiden konnten sich nicht sonderlich gut leiden, und ich bin mir sicher, dass meine Schwester kaum eine Träne über ihren Tod vergossen hat. Sie ist nur hier, weil ich sie darum gebeten habe. Um den Schein einer trauernden Familie zu wahren, um mich zu unterstützen. Unser Image ist wichtig, wenn das Unternehmen, das Sylvia hinterlässt, auch in Zukunft einen bedeutenden Namen in New York und der ganzen Businesswelt haben soll.
Die diskrete Hintergrundmusik wird noch leiser und verstummt schließlich vollständig, als der Priester hinter die Kanzel tritt, die Hände andächtig auf das Buch vor sich legt und den Blick über die Trauergemeinde schweifen lässt. Ein weiterer Punkt auf meiner Liste der Dinge, die mich an dieser Veranstaltung ankotzen: Sylvia war nicht katholisch, nicht einmal gläubig. Gut möglich, dass sie getauft war, aber in der gesamten Zeit, die ich sie kannte, hat sie nicht ein Mal einen Gottesdienst besucht oder die Beichte abgelegt. Trotzdem haben ihre Assistentin und der Verwalter der Hinterlassenschaften auf eine große Messe bestanden. Die Hinterbliebenen bräuchten einen Ort und die Gelegenheit zum Trauern. Bullshit. Das hier wird sich verdammt lang hinziehen, und meine Nerven liegen jetzt schon blank. Seit Sylvia vor neun Tagen an den Folgen eines Autounfalls gestorben ist, war ich quasi Tag und Nacht im Büro. Ihr Tod kam überraschend, wir konnten uns nicht darauf vorbereiten. Was eine erschreckend große Menge Arbeit bedeutet, wenn man auch in Zukunft seine beinahe dreizehntausend Mitarbeiter bezahlen können möchte.
Ich höre Rahel an meiner Seite leise seufzen, als der Priester beginnt, aus der Bibel vorzulesen. Ich kann ihr ihre Ungeduld nicht verdenken. Unauffällig werfe ich einen Blick auf den kleinen Programmzettel, den einer der Messdiener mir beim Betreten der Kirche in die Hand gedrückt hat. Mein Name springt mir sofort ins Auge und versetzt mir einen Stich in der Magengegend. Das Letzte, was ich im Moment tun will, ist, eine Rede vor all diesen Heuchlern halten zu müssen. Aber davor konnte ich mich nicht drücken. Mir ist von Anfang an klar gewesen, dass ich ein paar Worte würde sagen müssen. Ich bin zwar nur Sylvias Adoptivsohn, trotzdem bin ich das, was einem Verwandten am nächsten kommt. Sie hatte keine eigenen Kinder, mein Vater, Sylvias Ehemann, ist tot und zu ihren Eltern hatte sie seit Jahrzehnten keinen Kontakt, wenn sie überhaupt noch leben. Niemand ist übrig, abgesehen von mir. Was eigentlich ziemlich traurig ist. Bei den anderen Trauerrednern handelt es sich um Geschäftspartner, die großzügig als Freunde der Familie bezeichnet wurden.
So sollte das alles nicht laufen. Sylvia war nicht meine Mutter, geschweige denn der mütterliche Typ, aber sie war für mich da, als mein Dad vor vier Jahren gestorben ist. Sie hat versucht, für mich die beste Mutter zu sein, die sie eben sein konnte. Ich habe schöne Erinnerungen an sie und Dad, an die Zeit, in der wir unsere eigene Version einer Familie waren. Sie hätte auf jeden Fall mehr verdient als diese kalte, berechnete Farce.
»Kommst du mit zur Testamentseröffnung?«, flüstere ich Rahel zu, während der Priester vorne auf der Kanzel das nächste Gebet beginnt und alle hektisch in ihren Gebetsbüchern blättern. »Mr Hoffman meinte, es sollten bestenfalls alle Familienmitglieder anwesend sein. Also wir beide.«
Sie wirft mir einen Seitenblick zu. »Hoffman ist der Nachlassverwalter?« Als ich nicke, schnaubt sie leise. »Der wird uns in der Luft zerfetzen, Caleb. Du glaubst doch wohl nicht, dass Sylvias Schoßhund zulässt, dass ich auch nur einen Penny abbekomme? Und selbst wenn, sie hätte ihr Geld eher verbrennen lassen, als mir davon etwas zu vermachen. Oder es mit ins Grab genommen. Diese Testamentsverlesung wird ihr letzter großer Auftritt sein, die letzte Gelegenheit, mich auf meinen Platz zu verweisen, indem sie mich leer ausgehen lässt. Das tue ich mir auf keinen Fall freiwillig an!«
Ich beiße die Zähne zusammen. Rahel und Sylvia hatten Probleme, trotzdem hasse ich es, wenn meine Schwester Sylvia als absolutes Monster hinstellt. Ehrgeiz, Erfolg und ein – in den Augen der Gesellschaft – mangelnder Familiensinn lassen Frauen viel zu oft als kaltherzige Karrierefrauen erscheinen. Was absoluter Bullshit ist. Ja, ich hatte kein kuscheliges Verhältnis zu meiner Stiefmutter, dennoch habe ich sie bewundert wie keinen anderen Menschen auf dieser Welt. Sylvia stammte aus keinem wohlhabenden Elternhaus, ihr wurde nichts geschenkt. Eine erfolgreiche Firma mit beinahe dreizehntausend Angestellten und einem Hauptsitz mitten in Manhattan innerhalb weniger Jahre ohne nennenswerte Hilfe oder privates Startkapital aus dem Boden zu stampfen, ist eine beeindruckende Leistung. Mit Bonham Industries hat sie ein Imperium gegründet und den Namen Bonham vor allem in New York zu einer Marke gemacht, die einem viele Türen öffnet. Was Sylvia aus eigener Kraft geleistet und erschaffen hat, ist bewundernswert, und all das wird nach der Testamentseröffnung mir gehören. Mein halbes Leben lang habe ich darauf hingearbeitet, Sylvias Nachfolger zu werden – die logische Konsequenz, wenn man bedenkt, dass sie keine leiblichen Kinder oder andere infrage kommenden Erben hat. Aber ich wollte mir dieses Erbe verdienen, anstatt nur eine logische Konsequenz zu sein. Natürlich hatte niemand mit ihrem plötzlichen Tod und der daraus resultierenden unvorbereiteten Übernahme gerechnet. Eigentlich war ich immer davon ausgegangen, dass mich Sylvia langsam in meine neue Position einarbeiten und sich dann irgendwann zur Ruhe setzen würde. Wenn Rahel im Testament tatsächlich nicht bedacht wird, dann liegt das daran, dass sie sich niemals in ihrem Leben auch nur eine Sekunde lang für das Unternehmen interessiert hat. Nicht daran, dass Sylvia ihr eins auswischen wollte.
Eine Dreiviertelstunde später ist es so weit und der Priester bittet mich nach vorn, um ein paar Worte zu sagen. Ich habe mich akribisch auf diesen Moment vorbereitet. Nicht, weil ich Sylvia damit die letzte Ehre erweisen oder mich von ihr verabschieden will. Nein, die Hälfte der Trauergemeinde besteht aus Geschäftspartnern oder Mitarbeitern, und wenn ich mich als neuer CEO von Bonham Industries etablieren möchte, ist das hier der Anfang. Beim Betreten der Kirche habe ich Mr Freeman entdeckt, eines der kritischsten Vorstandsmitglieder von Bonham. Obwohl es mich natürlich nicht überrascht, dass er hier ist, macht mich seine Anwesenheit nervös. Nach Sylvias Tod war er einer derjenigen, die am lautesten meine Ablöse als CEO forderten. In seinen Augen bin ich zu jung, zu unerfahren, um dieses Erbe antreten zu können. Er wartet auf einen Fehltritt meinerseits, aber ich habe nicht vor, ihm diesen Gefallen zu tun. Ich zwinge mein heftig schlagendes Herz zur Ruhe und konzentriere mich auf meinen Atem, während ich aufstehe, den Knopf meines Jacketts schließe und hinauf zur Kanzel gehe. Ich spüre beinahe körperlich, dass sämtliche Blicke auf mich gerichtet sind. Einige dieser Menschen sehen mich heute zum ersten Mal, und mir ist klar, dass sie mich begutachten. Mich einschätzen und meine Schwächen erkennen wollen. Der Posten, den Sylvia Bonham hinterlassen hat, ist heiß begehrt. Ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige in dieser Kirche, der versuchen wird, ihn sich zu sichern.
Sobald ich auf der erhöhten Plattform stehe, greife ich in die Innentasche meines Jacketts und ziehe den Zettel mit den Notizen heraus, den ich sorgfältig vor mir ablege. Dann atme ich einmal tief durch, arrangiere meine Gesichtsmuskeln zu einer angemessen betroffenen Miene und lasse den Blick über die Trauergäste schweifen. Eine Sekunde vergeht, dann zwei und drei. Ich weiß, wie man vor einer Menschenmenge spricht. Ich kenne all die Skills, all die Atemtechniken. Trotzdem spüre ich, wie meine Handflächen feucht werden. Ich bin kein gläubiger Mensch, dennoch habe ich das Gefühl, Sylvia würde auch jetzt noch, aus dem Jenseits heraus, über mich urteilen. Ohne Zweifel würde sie einen überzeugenden Auftritt von mir erwarten.
»Liebe Familie, liebe Freunde«, ich straffe die Schultern und fixiere der Reihe nach einige Leute, ohne ihre Gesichter wirklich zu erkennen, »liebe Gäste. Meine Stiefmutter Sylvia wäre berührt und bewegt, Sie alle hier zu sehen und zu wissen, dass Sie gekommen sind, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Einem Menschen, dessen Abwesenheit bereits jetzt ein nicht zu füllendes Loch in unser aller Leben hinterlassen hat. Einem Menschen, dessen Güte, Großzügigkeit und Menschlichkeit kaum zu übertreffen waren. Einem Menschen, der leider viel zu früh von uns gegangen ist und so viel Trauer und Schmerz zurückgelassen hat. Uns allen ist bewusst, welch unzählige Eigenschaften Sylvia Bonham in sich vereint hat. Sie war ehrgeizig, sie war mitfühlend, einnehmend, freundlich, erfolgreich, und sie hatte exakte Vorstellungen davon, was sie von ihrem Leben erwartete und wie sie ihre Träume und Ziele verwirklichen konnte. Bereits mit vierundzwanzig Jahren gründete sie Bonham Industries, in einem schlichten Ein-Zimmer-Apartment im West Village. Heute darf sich die Firma unter den dreißig größten Pharmaherstellern weltweit listen und ist aus dem New Yorker Stadtbild kaum noch wegzudenken. Was bedeutet, dass meine Stiefmutter bereits in meinem Alter die Pläne für ihre Zukunft geschmiedet und ihre Version kurz darauf verwirklicht hat. Dafür respektierte und bewunderte ich Sylvia schon als kleiner Junge. Sie kann mit Stolz und Wohlwollen auf ihr Werk zurückblicken.« Mein Blick wandert zu Rahel, und auch wenn ihr Gesicht ausdruckslos ist, bin ich mir sicher, dass sie ein Augenrollen zu unterdrücken versucht. Ich schaue hinab auf meine Notizen, dann wieder auf die Leute vor mir. »Ich bin sehr dankbar, ein Teil von Sylvias Leben gewesen sein zu dürfen, und mein Herz ist von Trauer erfüllt angesichts der Tatsache, dass sie mich nicht länger auf meinem Weg begleiten kann. Nichtsdestotrotz blicke ich hoffnungsvoll in die Zukunft, bereit, in ihre viel zu großen Fußstapfen zu treten, und mit dem festen Willen, sie dort, wo sie jetzt ist, stolz zu machen. Wir alle trauern um einen geliebten Menschen. Einen Menschen, der gewollt hätte, dass wir ihn in positiver, fröhlicher Erinnerung behalten. Darum lasst uns gemeinsam eine Minute innehalten und an unsere persönlichen Momente mit Sylvia Bonham zurückdenken. Ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen.«
Leise Orgelmusik setzt ein, während ich die Hände vor dem Körper verschränke, den Kopf senke und die Augen schließe. Allerdings komme ich meiner eigenen Aufforderung nicht wirklich nach. Nach außen hin haben die Bonhams wie die perfekte – wenn auch kleine – Familie gewirkt. Und obwohl ich Sylvia bewundert habe, gibt es keine fröhlichen Erinnerungen an gemeinsame Spieleabende, unbeschwerte Weihnachtsfeste oder bunte Geburtstagskuchen. Stattdessen gehe ich in Gedanken meinen Terminplan für die kommenden Tage durch. Der wichtigste Punkt in meinem Kalender ist die Testamentseröffnung am Freitag. Denn auch wenn das eine reine Formsache wird, beschreibt dieser Termin einen der wichtigsten Tage in meinem Leben: den Meilenstein für meine offizielle Übernahme von Bonham Industries, einem milliardenschweren Unternehmen, und damit meinen Start in die berufliche Karriere, für die ich mir seit Jahren den Arsch aufreiße.
Als der Priester sich räuspert, öffne ich die Augen, nicke der Menge einmal respektvoll zu und gehe zurück zu meinem Platz. Als ich mich neben Rahel setze, bemerke ich ihren Blick von der Seite.
»Großer Auftritt«, murmelt sie.
Ich antworte nicht. Nicht alles in meiner Rede war gelogen, trotzdem hat Rahel recht. Das hier ist ein Spiel. Ein Spiel, das Sylvia zu ihren Lebzeiten bis zur Perfektion beherrscht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie stolz auf mich gewesen wäre.
2
JULIE
Mittwoch, 25. Mai 2022
Nervös streiche ich mir über mein Shirt, während ich das Gebäude vor mir mustere. Ich stehe mitten im Gedränge im Herzen Manhattans – und damit meilenweit entfernt von den Gegenden New Yorks, in denen ich mich normalerweise aufhalte. Die Lexington Avenue ist verdammt lang, aber das Bürogebäude von Hoffman & Sons befindet sich in dem Teil der Stadt, in dem sich ausschließlich Menschen in schicken Anzügen, Kleidern oder Kostümen namhafter Designer aufhalten. Hinter mir ragt das Chrysler Building in den wolkengrauen Himmel und einen Block weiter erstreckt sich die Park Avenue, eine der bekanntesten Straßen New Yorks.
Ich gehöre nicht hierher. Was allein schon meine Boyfriendjeans beweisen, die ich vor ein paar Wochen günstig in einem Secondhandladen gekauft habe, mein weißes No-Name-Shirt und die Lederjacke, deren Naht am Rücken kurz davor ist zu reißen. Mir ist klar, dass ich mir das nur einbilde, trotzdem habe ich das Gefühl, jeder um mich herum starrt mich an. Als ob sie wüssten, dass ich mich eigentlich besser in einem anderen Stadtteil aufhalten und nach einem Job umsehen sollte, der meine nächste Miete bezahlt.
Ich lege den Kopf in den Nacken, um an dem Gebäude hinaufzusehen, in dem sich die Anwaltskanzlei befindet. Es ist ein verspiegelter Klotz, in dessen unterem Teil sich ein Juwelier und ein Herrenausstatter befinden. Auf der einen Seite der Spiegelfassade prangt das Logo der Kanzlei: zwei ineinander verschlungene, goldene Hs. Wofür das wohl steht? Hoffman & Sons bestehen laut meiner Google-Recherche aus mindestens fünf Hoffmans. Vielleicht wären fünf Gold-Hs zu kostspielig gewesen und man hat sich deshalb auf zwei geeinigt. Was mir eigentlich aber auch ziemlich egal ist.
Ein letztes Mal überprüfe ich mein Outfit, streiche mir die Haare hinter die Ohren und steuere auf den Eingang zu, der in die Lobby der Anwaltskanzlei führt. Keine Ahnung, warum ich so aufgeregt bin. Das hier wird ein wahnsinnig schneller Besuch, und dennoch macht mich die Umgebung irgendwie nervös. Hin und wieder habe ich Probleme mit neuen Menschen und neuen Situationen und brauche ein wenig, um mich darauf einzulassen. Ich fühle mich manchmal grundlos fehl am Platz und neige dazu, ständig die Handlungen anderer zu hinterfragen. Als würden sie mich nicht mögen oder als würde ich sie nerven. Rational gesehen ist mir klar, dass das Unsinn ist und nur an meiner eigenen Unsicherheit liegt. Aber in solchen Situationen kann ich nichts dagegen tun. Und das Gebäude hier, das quasi nach Reichtum und Erfolg schreit, hat genau diese Wirkung auf mich.
Die Eingangshalle sieht genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ein großer heller Raum mit gefliestem Boden, gigantischen Deckenleuchten und einem auf Hochglanz polierten halbrunden Empfangstresen, hinter dem ein Mann und eine Frau in maßgeschneiderten Uniformen sitzen und mir höflich lächelnd entgegenblicken. Leise Loungemusik dringt aus unsichtbaren Lautsprechern. Hinter dem Empfang befinden sich drei Aufzugtüren, die vermutlich nach oben in die Büros führen, und zu meiner Rechten stehen zwei ungemütlich, aber teuer aussehende Sofas vor einer riesigen Fensterfront, die den Blick auf die Lexington Avenue freigibt.
»Mein Name ist Juliette Penn«, sage ich, sobald ich vor dem Tresen stehe und sehe abwechselnd den Mann und die Frau an. Beide erwidern meinen Blick so interessiert, dass ich keine Ahnung habe, an wen von beiden ich mich wenden soll. »Ich habe einen Termin bei Anthony Hoffman.«
Es ist schließlich der Mann, der höflich nickt, während sich die Frau mit einem zurückhaltenden Lächeln abwendet.
»Natürlich, Miss Penn«, erwidert der Mann, ohne mich auch nur eine Sekunde lang aus den Augen zu lassen. Entweder er hat das mit dem Augenkontakt wirklich perfektioniert oder er befürchtet, dass ich eine der Kristallvasen mitgehen lasse, wenn er nicht guckt. Beides nicht unvorstellbar. »Bitte nehmen Sie noch einen Augenblick Platz. Sie werden in wenigen Minuten abgeholt.«
Einen Moment lang bin ich versucht, ihn zu fragen, warum ich nicht einfach selbst mit dem Fahrstuhl nach oben fahren kann, lasse es dann aber doch bleiben. Vielleicht bekomme ich die oberen Etagen gar nicht zu Gesicht. Vielleicht hat den beiden ein Blick auf mich gereicht, um zu verstehen, dass es sich bei dieser Erbgeschichte um einen Fehler handeln muss. Bestimmt kommt gleich ein Assistent nach unten, kontrolliert meinen Ausweis und schickt mich wieder nach Hause. Was mir nur recht wäre.
Vorsichtig setze ich mich auf eines der kleinen Sofas, das sich tatsächlich als genauso steif und ungemütlich entpuppt, wie es aussieht. Vor mir auf einem kleinen Beistelltisch stehen ein Krug mit Wasser und mehrere Gläser, von denen wahrscheinlich jedes einzelne teurer ist als die gesamte Einrichtung meines WG-Zimmers. Ich frage mich, wie schockiert die Leute am Empfang wohl gucken würden, wenn ich eines der Gläser aus Versehen fallen lassen würde. Allein bei der Vorstellung bekomme ich schwitzige Hände.
Wenige Sekunden später unterbricht ein leises Ping die Pianomusik, und die Türen einer der Aufzüge öffnen sich. Heraus tritt ein schlanker Mann in einem dunkelblauen Nadelstreifenanzug inklusive Weste. Das ist mit Sicherheit kein Assistent. Ich stehe auf und verschränke die Hände vor dem Bauch, weil ich keine Ahnung habe, ob ich ihm entgegengehen soll.
»Miss Penn«, begrüßt mich der Mann freundlich, wenn auch distanziert. Seine Stimme ist tief und beruhigend, und ich erkenne sie sofort als die, mit der ich gestern Nachmittag telefoniert habe.
»Mr Hoffman.« Ich schüttle kurz seine Hand.
»Wenn Sie mich bitte nach oben begleiten würden«, sagt er und macht eine einladende Geste Richtung Fahrstuhl. »Wir sollten diese Angelegenheit in einem etwas privateren Rahmen besprechen, denke ich.«
»Mir wäre es lieber, wenn wir dieses Missverständnis schnell aus der Welt schaffen könnten.« Ich öffne meine Handtasche und ziehe das Portemonnaie heraus. »Ich bin mir sicher, dass Sie mich verwechseln.«
Als ich ihm meinen Führerschein entgegenstrecke, erkenne ich an seinem Gesichtsausdruck, dass er überhaupt nicht zufrieden ist. Gespräche mitten in der Lobby – völlig egal welcher Art – sind hier mit Sicherheit nicht üblich. Diese Kanzlei jongliert vermutlich normalerweise hinter gut verschlossenen Türen mit Millionenbeträgen, dabei braucht man bestimmt kein Publikum.
Mit seiner gepflegt manikürten Hand nimmt Mr Hoffman trotzdem meinen Führerschein entgegen und mustert ihn einen Moment lang. Dann gibt er ihn mir zurück. Seine Miene ist wieder freundlich – anscheinend hat er sich schnell von meiner kleinen Rebellion gegen die Etikette erholt.
»Ich befürchte, ich muss darauf bestehen, dass Sie mich begleiten, Miss Penn. Die Angelegenheit ist sehr wichtig.«
Das darf doch nicht wahr sein. Ich werfe einen Blick auf meine Uhr. Spätestens in eineinhalb Stunden muss ich mich auf den Weg zur Arbeit machen. Eigentlich wollte ich unterwegs noch einen Termin im Fahrradladen ausmachen und eine Kleinigkeit essen.
»Ich möchte nicht unfreundlich sein, Mr Hoffman, aber könnten wir die Sache beschleunigen? Ich habe nicht viel Zeit.«
Er antwortet nicht, sondern macht stattdessen erneut eine einladende Geste Richtung Aufzug. Ergeben nicke ich und folge ihm. Als er auf den obersten Knopf drückt, runzle ich die Stirn. Dieses Gebäude hat siebzehn Stockwerke, und irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass die obersten den besonders wichtigen Kunden vorbehalten sind.
Wenig später öffnet sich der Fahrstuhl und gibt den Blick auf einen großen Konferenzraum frei. Wow. Er ist zu drei Seiten hin verglast und gewährt eine atemberaubende Aussicht auf New York. Die Mitte des Raumes wird von einem riesigen länglichen Tisch dominiert, um den mindestens fünfzig Stühle sorgfältig in Reih und Glied stehen. Das hier ist sicher kein Büro, und ich frage mich, warum Hoffman ausgerechnet diesen Raum ausgesucht hat, um sein Anliegen zu besprechen. Es macht beinahe den Eindruck, als wolle er angeben.
»Bitte.« Auffordernd zieht er einen der Stühle zurück. Er wartet, bis ich mich gesetzt habe, dann nimmt er mir gegenüber Platz. »Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«
»Ich brauche nichts, vielen Dank«, sage ich und versuche, sein freundliches Lächeln zu erwidern, aber es fühlt sich an wie eine Grimasse.
Hoffman nickt und drückt den Knopf einer diskret in den Tisch eingelassenen Gegensprechanlage. »Robin, bitte bringen Sie uns Kaffee und etwas Wasser.« Er fängt meinen Blick auf. »Falls Sie Ihre Meinung ändern.«
Ich schlucke meine Antwort herunter: Dass ich nichts trinken möchte, weil ich das hier so schnell wie möglich über die Bühne bringen will. Stattdessen setze ich mich ein wenig aufrechter hin und verschränke die Hände, um mich selbst davon abzuhalten, nervös am Saum meines Oberteils herumzufummeln. »Also, warum möchten Sie mit mir sprechen?«
Er greift nach einer beigefarbenen Akte, die auf einem kleinen Beistelltisch gelegen hat, und blättert darin herum. »Miss Juliette Penn, geboren am 4. August 2002 in Dayton, Ohio. Tochter von Alan Penn, geboren am 17. September 1978, ebenfalls in Dayton, Ohio. Aktuell wohnhaft im East Village, 333 East 7th Street, New York, zusammen mit einer gewissen Miss Saheera Prasad und Miss Bonnie Hill. Studium des Grafikdesigns an der New York University. Sind diese Angaben korrekt?«
Mir wird gleichzeitig heiß und kalt, und einen Moment lang kann ich nichts anderes tun, als dazusitzen und diesen fremden Mann anzustarren, der geradezu beängstigend viel über mich weiß. Ich bin kein interessanter Mensch, es existiert kein Wikipedia-Artikel oder dergleichen, in dem diese detaillierten Informationen stehen könnten. Selbst wenn er all meine Social-Media-Kanäle gecheckt hätte, wüsste er nicht so viel über mich, weil ich mich in der Hinsicht eher bedeckt halte.
»Was soll das?«, frage ich nach ein paar Sekunden, in denen er mich nur geduldig ansieht.
Er dreht die geöffnete Akte um und schiebt sie über den Tisch zu mir herüber, damit ich sie lesen kann. Auf dem Dokument steht ganz oben mein Name. Danach folgen nicht nur sämtliche Informationen, die er vorgelesen hat, sondern sogar noch einige mehr. Sprachlos lese ich eine lückenlose Zusammenfassung meines Lebens, inklusive der Daten meiner Einschulung und meiner Blinddarm-OP. Als ich das Blatt anhebe, bemerke ich darunter eine Kopie meines Studierendenausweises.
Das ist verrückt.
In meiner Brust steigt ein ungläubiges Lachen auf, aber ich unterdrücke es energisch. Diese Situation ist nicht lustig, im Gegenteil. Rational gesehen ist mir bewusst, dass ein guter Anwalt all das mühelos herausfinden kann – immerhin lebe ich im 21. Jahrhundert und gebe vermutlich allein beim Onlineshopping die Hälfte dieser Daten preis. Dennoch ist es beängstigend zu sehen, wie gläsern mein Leben tatsächlich ist. Dass sich jemand die Mühe gemacht hat, mich derart in Fakten und Daten zu zerlegen, ist verdammt beklemmend.
»Was, zur Hölle, soll das alles?« Dieses Mal zittert meine Stimme kaum merklich, als ich Hoffman ansehe. Wut und Unsicherheit lassen meine Handflächen feucht werden, und ich wische sie unauffällig an meiner Hose ab.
»Ich möchte Ihnen lediglich begreiflich machen, dass es sich nicht um einen Irrtum handelt, Miss Penn. Diese Kanzlei erhebt den Anspruch, keine Fehler zu begehen. Wenn wir mit Ihnen sprechen möchten, dann haben wir vorher ausreichend geprüft, ob wir mit der richtigen Person in Kontakt treten.«
Das macht die Sache nicht wirklich besser. Im Gegenteil, es macht sie nur deutlich komplizierter.
»Sie behaupten also, dass mir tatsächlich irgendjemand, den ich offensichtlich nicht kenne, etwas vererbt hat?«
Hoffman nickt geschäftsmäßig. Er steht kurz auf, beugt sich über den Tisch und zieht die Akte wieder zu sich herüber. Dann verschränkt er seine Hände darauf. »Ich bin mit der Nachlassverwaltung von Sylvia Bonham betreut. Meine Kanzlei vertritt die Familie bereits seit Jahren und ist nach dem Ableben Mrs Bonhams nun für die Vollstreckung des Testaments zuständig. Und Sie werden darin berücksichtigt, Miss Penn.«
Verständnislos starre ich ihn an. »Ich habe noch nie von dieser Frau gehört, Mr Hoffman. Dass Sie meinen gesamten Lebenslauf in Ihrer Akte haben, ändert an dieser Tatsache leider nichts, fürchte ich.«
»Nun, ich fürchte, es gibt keinen einfachen Weg, Ihnen das Folgende mitzuteilen, Miss Penn«, beginnt er, und ganz kurz blitzt eine neue Gefühlsregung in seinen bisher so distanzierten Augen auf. Genauso schnell, wie sie gekommen ist, ist sie auch wieder verschwunden, aber der kurze Moment hat gereicht, um es zu erkennen: Mitleid. »Deswegen sage ich es einfach geradeheraus. Sind Sie damit einverstanden?«
Was habe ich schon für eine Wahl? »Schießen Sie los!«
»Mrs Sylvia Bonham war Ihre leibliche Mutter, Miss Penn. Sämtliche Dokumente, die mir zur Verfügung stehen, bestätigen Ihr Verwandtschaftsverhältnis. Ein Zweifel ist daher ausgeschlossen.«
»Wie bitte?« Ich verschlucke mich beinahe an dem nervösen Kichern, das sich seinen Weg durch meine Kehle bahnt. Wenn mich Gefühle überwältigen, muss ich entweder lachen oder heulen. Dazwischen gibt es nichts. Und genau jetzt, in dieser Sekunde, kann ich mich wirklich nicht entscheiden, wonach mir eher zumute ist. »Der Name meiner leiblichen Mutter lautet nicht Sylvia Bonham, sondern Margret Spader. Warum behauptet diese Frau, meine Mutter zu sein?«
»Sie behauptete es nicht nur, sie konnte auch die entsprechenden Dokumente vorweisen. Wie gesagt, es besteht keinerlei Zweifel.«
Ich lasse mich tief in den Stuhl zurücksinken. Ich würde gerne behaupten, dass das ausgeschlossen ist. Allerdings habe ich meine leibliche Mutter niemals kennengelernt. Sie und mein Dad haben direkt nach meiner Geburt einen Deal geschlossen: Sie wollte eigentlich keine Kinder, mein Dad wollte mich unbedingt. Er erhielt das alleinige Sorgerecht für mich, sie verschwand aus meinem Leben und gab jegliche Verantwortung ab. Jeder bekam das, was er sich wünschte. Durchaus möglich, dass sie gestorben ist, ohne dass ich oder mein Vater etwas davon mitbekommen haben. Von ihm weiß ich, dass meine Mutter Margret Spader heißt, aber gut möglich, dass sie geheiratet und einen anderen Namen angenommen hat.
»Das ergibt überhaupt keinen Sinn.« Ich reibe mir über die Stirn. »Selbst wenn diese Frau meine Mutter war, verstehe ich nicht, warum sie mir etwas vererben sollte. Ich bin ihr nie begegnet.«
»Nun, so einfach ist diese Angelegenheit nicht. Selbst wenn Mrs Bonham Sie im Testament nicht berücksichtigt hätte, stünde Ihnen als einziges leibliches Kind ein Pflichtanteil des hinterlassenen Vermögens zu. Allerdings sind Sie im Testament durchaus explizit als Erbin aufgeführt, Miss Penn.«
Mir schwirrt der Kopf. Nicht, weil Hoffmans Aussagen so kompliziert sind, sondern weil mich die ganze Situation maßlos überfordert. Meine leibliche Mutter war nie ein Teil meines Lebens. Ich habe sie nicht vermisst, ich habe nie nach ihr gesucht.
»Ich bin nicht die Alleinerbin, richtig?«, frage ich verwirrt.
Da öffnet sich die Tür und ein hochgewachsener Mann kommt herein, ein mit Kaffee und Wasser beladenes Tablett in den Händen. Er nickt mir höflich zu, stellt die Getränke ab und verlässt dann wortlos den Raum. Als Hoffman mir erneut etwas zu trinken anbietet, lehne ich ungeduldig ab.
»Sie haben gesagt, ich sei berücksichtigt. Das heißt, es gibt noch weitere Erben.«
»Es gibt eine Erbengemeinschaft, ja.«
Ich lehne mich vor. »Dann möchte ich das Erbe nicht annehmen. Das geht doch, oder nicht?«
»Hören Sie, Miss Penn. Wir sprechen hier nicht über ein paar Silberlöffel oder liebgewonnene Familienerbstücke. Vor der Testamentseröffnung darf ich Ihnen gegenüber leider noch keine genauen Aussagen treffen, aber allein Mrs Bonhams Privatvermögen liegt aktuell im achtstelligen Bereich. Wenn Sie einen gut gemeinten Rat von mir annehmen möchten, dann sollten Sie mit weitreichenden Entscheidungen bis nach der …«
»Achtstellig?«, unterbreche ich ihn fassungslos. »Sie wollen mir also sagen, dass meine … Mutter mehrere Millionen besitzt?«
»Besessen hat«, korrigiert Hoffman nachsichtig. »Aber ja, das möchte ich damit ausdrücken. Das Firmenvermögen und andere Posten wie Immobilienwerte sind in dieser Schätzung noch nicht berücksichtigt.«
Mir wird schwindelig. Mehrere Gefühle streiten sich in meinem Inneren und ringen um die Oberhand. Nicht nur, dass meine Mutter aus der Versenkung aufgetaucht ist, nein, sie ist auch noch tot. Plus der Tatsache, dass sie offensichtlich steinreich war und ich es auch werden könnte.
Heilige Scheiße.
Allerdings weiß ich, dass Erbrecht eine verdammt komplizierte Angelegenheit ist. Es gibt noch andere Erben, und ich wage zu bezweifeln, dass Hoffman mir einfach einen Koffer mit Bargeld in die Hand drücken und mir ein schönes Leben wünschen wird.
»Ich will das nicht«, sage ich nachdrücklich. »Ich will damit nichts zu tun haben. Nichts für ungut, aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich einfach aus den Unterlagen streichen und nicht mehr kontaktieren würden.«
Es ist völlig offensichtlich, dass Hoffman dazu einiges zu sagen hätte, doch er reißt sich zusammen. Nach einem Räuspern erhebt er sich abermals, zückt eine Visitenkarte aus der Innentasche seines Jacketts und reicht sie mir. »Nach der Testamentseröffnung können Sie entscheiden, wie Sie mit dem Erbe verfahren wollen. Allerdings rate ich Ihnen dringend, sich rechtlichen Beistand zu suchen. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie mich gerne jederzeit an. Mein Büro würde Sie und Ihre Ansprüche gerne vertreten, wenn Sie es zulassen.«
Beinahe hätte ich gelacht. Deswegen also der imposante Raum. Er wittert Geld. Was bei einem derartigen Erbe vermutlich auch keine Überraschung ist. Trotzdem bekommt Hoffmans aufgesetzte Freundlichkeit auf einmal einen faden Beigeschmack.
»Ich muss also zu der Testamentseröffnung erscheinen?«, hake ich nach, nehme die Karte entgegen und lege sie demonstrativ vor mich auf den Tisch, anstatt sie einzustecken. »Erst danach komme ich aus der Sache raus?«
Sein Blick verweilt kurz auf der Karte, dann sieht er mich wieder an. »Ja, Miss. Die Eröffnung erfolgt bereits kommenden Freitag. Ich lasse Ihnen eine entsprechende Terminerinnerung schicken. Melden Sie sich bitte, wenn Sie Fragen haben.«
Er macht Anstalten, noch etwas hinzuzufügen, doch bevor er es tun kann, stehe ich auf. Mir ist klar, dass es noch einiges zu besprechen gibt, selbst wenn ich das Erbe ablehne. Aber nicht heute. Ich muss zur Arbeit und ich muss … keine Ahnung. Nachdenken vielleicht. Und meinen Dad anrufen. Meine Gedanken sortieren.
Ich bedanke und verabschiede mich knapp von Hoffman, der mir mehrfach anbietet, mich nach unten zu begleiten. Was ich aber entschieden ablehne. Ich muss raus aus diesem Büro, raus aus diesem Gebäude, in dem ich mich so fehl am Platz fühle, das aber offensichtlich ganz hervorragend in die Welt meiner Mutter gepasst hat.
Meine Mutter.
Es ist verrückt.
Als ich es durch das Foyer geschafft habe und hinaus auf den Gehweg trete, atme ich ein paar Mal tief durch. Die Luft in New York City kann man vermutlich nicht unbedingt als frisch bezeichnen, trotzdem ist sie mir um einiges lieber als der dezente Duft nach Lufterfrischer, der da drinnen in den Räumen hing. Der Lärm der hupenden Taxis klingt wie Musik in meinen Ohren im Vergleich zu der nervtötend eleganten Pianomusik.
Ein paar Minuten lang stehe ich einfach da, ohne genau zu wissen, was ich als Nächstes tun soll. Mehrere Passanten fluchen demonstrativ, während sie mich umrunden, aber auch das ist mir egal. Ich habe schlicht keinen blassen Schimmer, was genau ich fühlen soll. Freude darüber, dass ich meine Mutter gefunden habe und ich nur noch eine Google-Suche davon entfernt bin, ihr Bild zu sehen? Oder doch lieber Trauer, weil sie tot ist und ich keine Chance mehr habe, sie kennenzulernen? Nicht, dass ich das vorgehabt hätte. Aber jetzt, da mir die Möglichkeit dazu für immer genommen wurde, fühle ich mich merkwürdig schwer.
Das alles ist vollkommen surreal. Ich muss dringend meinen Dad anrufen und ihm davon erzählen. Er hatte nie ein Problem damit, mit mir über meine Mutter zu sprechen. Nach allem, was ich weiß, sind die beiden trotz allem im Guten auseinandergegangen. Ich war nicht geplant, und meine Mutter hat von Anfang an klargemacht, dass es für sie nicht der richtige Zeitpunkt für ein Kind war. Also nahm mein Vater mich, und die beiden gingen getrennte Wege. Klar, ich war ihre Tochter, und ein Teil von mir hätte sich gewünscht, dass sie mich gewollt und die Verantwortung für mich übernommen hätte. Aber ich habe nie etwas vermisst. Trotz allem hatte ich eine tolle Kindheit, einen wunderbaren Dad und später eine liebevolle Stiefmutter. Margret oder Sylvia – oder wie auch immer sie sich nannte – hat die richtige Entscheidung getroffen, und deswegen konnte ich ihr nie wirklich böse sein.
Seufzend ziehe ich mein Handy aus der Handtasche und checke meine Nachrichten. Saheera und Bonnie haben in unsere WG-Gruppe geschrieben und gefragt, wie der Termin lief. Ich will sie nicht warten lassen, aber die Geschichte ist eindeutig zu kompliziert, um sie in einer WhatsApp-Nachricht zu beantworten. Also schreibe ich ihnen nur schnell, dass ich mich später melde und mache mich auf den Weg zur U-Bahn. Ich muss arbeiten, ich muss etwas essen.
Meine leibliche Mutter war niemals ein Teil meines Lebens. Ihr Tod und irgendein Testament werden daran nichts ändern. So einfach ist das.
3
JULIE
Als ich abends nach Hause komme, fühle ich mich, als hätte mich ein Taxi überrollt. Oder ein Preisboxer verprügelt. Mein Kopf pocht schmerzhaft, meine Arme und Beine tun weh und mein Herz … mein Herz fühlt sich überfordert an. Überfordert von all den Emotionen, die im Laufe des Tages auf mich eingeprasselt sind.
Bisher hatte ich noch keine Gelegenheit, mit meinem Dad zu telefonieren. Er lebt zusammen mit meiner Stiefmutter in Ohio, sodass ein persönliches Gespräch im Moment nicht möglich ist, obwohl mir das weitaus lieber gewesen wäre. Nach meinem Termin in der Kanzlei bin ich direkt zu der Kunstakademie gefahren, in der ich als Modell jobbe, habe danach noch ein paar Sachen eingekauft und bin gerade erst zur Tür hereingekommen. Doch inzwischen ist es beinahe halb zehn, und da ich schwer davon ausgehe, dass das Gespräch mit Dad mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als ein paar Minuten, verschiebe ich den Anruf auf morgen.
Ich öffne den Kühlschrank und verstaue meine Einkäufe darin, als ich hinter mir eine Tür aufgehen höre. Müde drehe ich mich um und entdecke Bonnie, die aus ihrem Zimmer schlendert und sich mit der Hüfte an den Küchentresen lehnt. Abwesend beginnt sie Mr Norris über den Kopf zu streicheln, der sich, von mir unbemerkt, wieder einmal auf der Arbeitsfläche breit gemacht hat. Ich versuche seit Monaten, den Katzen abzugewöhnen, auf den Tresen zu springen, aber weder Bonnie noch Saheera sind in dem Punkt sonderlich hilfreich. Mit einem demonstrativen Blick in Bonnies Richtung greife ich nach Mr Norris und setze ihn auf den Boden.
»Und?«, fragt Bonnie, ohne Zeit für eine Begrüßung zu verschwenden.
Mit der Hand reibe ich mir über die Stirn, in der Hoffnung, dass die Schmerzen endlich nachlassen. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, meine Mitbewohnerinnen wären ausgegangen oder würden bereits schlafen. »Ist Saheera auch da? Ich will die ganze Geschichte nicht zweimal erzählen.«
Sie dreht sich um und ruft nach Saheera, dann mustert sie mich. Die Sorge steht ihr ins Gesicht geschrieben. Ich kann es ihr nicht verdenken. Als ich auf dem Heimweg mein verschwommenes Spiegelbild in der Scheibe der U-Bahn gesehen habe, hätte ich mich beinahe selbst nicht erkannt. Der Tag ist mir deutlich anzusehen und nach den kryptischen Ausflüchten, die ich ihnen über WhatsApp geschickt habe, kann ich verstehen, dass sie neugierig sind.
Als Saheera um die Ecke kommt, schnappe ich mir eine Flasche Wasser und gehe hinüber in unser Wohnzimmer, wo ich mich auf das größere der beiden Sofas fallen lasse. Sofort hüpft Mr Norris auf meinen Schoß und rollt sich zu einer schnurrenden Kugel auf meinen Oberschenkeln zusammen.
»Also«, beginnt Saheera, die sich auf eine der Lehnen gesetzt hat und mich prüfend mustert. Sie hebt die Hände und beginnt die Spangen zu lösen, mit denen sie ihren Hijab an ihrem Haar befestigt. Anscheinend ist sie auch gerade erst nach Hause gekommen. »Es war wohl keine Verwechslung, oder?«
Ich schnaube. »Nein, war es nicht.«