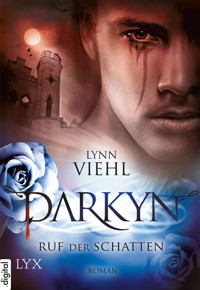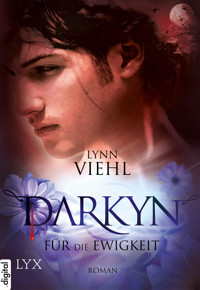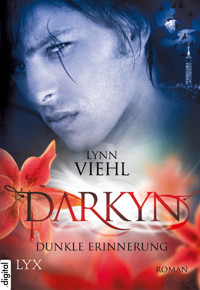
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Darkyn-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Mordkommissarin Samantha Brown ist eine toughe und erfolgreiche Polizistin. Sie verfolgt einen psychisch gestörten Mörder, und der einzige Hinweis auf seine Identität ist ein mittelalterliches Kreuz, in das der Name "Lucan" eingraviert ist. Genau so heißt der Besitzer eines neu eröffneten Nachtclubs, der sich in der Nähe des Tatorts befindet. Doch als Samantha gegen Lucan zu ermitteln beginnt, muss sie feststellen, dass sein düsterer Charme ein tiefes Verlangen in ihr weckt. Was Samantha nicht ahnt: Lucan ist ein Vampir. Und er erkennt in der hübschen Kommissarin die Reinkarnation seiner ersten großen Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Titel
Widmung
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Impressum
LYNNVIEHL
DUNKLE ERINNERUNG
Roman
Ins Deutsche übertragen von Katharina Kramp
Für Edward,mein Licht in der Dunkelheit
Musst du nehmen mit eiserner FaustWas der zarteste Griff zu holen schafft?Musst du aussehen so gar fürchterlich,so dunkel, so grausam schlimm.Wenn die müde Seel’ nicht entsetzet sich,rufst du sie leis’, ganz ohne Grimmsich zu ergeben deiner schrecklichen Kraft?
Caroline Southey, »An den Tod«
1
Männer verließen Lena Caprell nicht. Sie verließ die Männer. So lief das. So war das bisher immer gelaufen.
Doch jetzt stand sie hier, mitten in der Nacht, vor dem lächerlichen Nachtclub ihres Liebhabers, und es wartete keine Limousine auf sie, kein privates Dinner im Baleen auf Grove Island, keine Fahrstuhlfahrt hinauf in die Penthousesuite, die sie in Gedanken bereits neu eingerichtet hatte. Keine langen Stunden mit flackernden Kerzen oder dunklem Wein oder Orgasmen, die sie nicht vortäuschen musste.
Was hatte er gesagt? Du bist gut, Darling, aber ich nicht. Es wird Zeit, dass wir getrennte Wege gehen.
Nein, nein, nein. So sollte das nicht laufen. Nicht nach nur drei Verabredungen. Dafür war sie zu gut.
Sie hatte ihm zwei Wochen Zeit gegeben, nachdem er ihr gesagt hatte, dass es vorbei war, aber jetzt reichte es. Heute war sie zum Angriff übergegangen. Dreihundert im Galleria für ein neues Kleid, dann zweihundert für den Friseur und die Maniküre und eine Enthaarung der Bikinizone. Esme hatte sie außerdem für einen Fünfziger Trinkgeld dazwischen genommen. Fast sechshundert Dollar. So viel hatte sie noch für keinen Mann ausgegeben, nicht einmal für diesen Werbespotregisseur, der ihr ein Vorsprechen bei den Pollo-Tropical-Leuten besorgt hatte.
Sie hatte geglaubt, er wäre es wert. Als sie schließlich noch ein bisschen Parfüm von Glow aufgetragen hatte, bevor sie die Wohnung verließ, normal alles an ihr geglänzt, verführerisch und einladend und bereit für die Liebe.
Sie war früh da gewesen, aber man hatte sie warten lassen. Als sie schließlich reinkam, hatte sie keine Szene gemacht. Nein. Sie hatte mit der Zunge einen Knoten in einen Kirschstiel gemacht und den Barkeeper damit beeindruckt, und als er dann auftauchte, war sie zu ihm gelaufen und hatte ihm einen langen, nassen Kuss gegeben. Vor allen Leuten, ja, damit man sie das nächste Mal nicht mehr warten ließ, aber auch, weil sie nicht mehr warten konnte. Er war wie eine dicke Linie Kokain in der Gästetoilette; sie musste ihn haben.
Aber kein Kuss, keine Umarmung, gar nichts. Er hatte sie weggeschoben, als wäre sie eine Art Groupie, und hatte ihr gesagt, sie solle gehen. Ich bestelle dir ein Taxi, das dich nach Hause bringt. Einfach so.
Hatte sie nicht geweint – echte Tränen? Hatte sie ihm nicht gestanden, wie gerne sie mit ihm zusammen war? So sehr, dass sie auch mit einer einzigen weiteren Verabredung zufrieden gewesen wäre. Das war keine Lüge gewesen.
Du bist wunderschön, wenn du entschlossen bist, Darling, hatte er gemurmelt, aber noch eine Nacht mit mir könnte dein Tod sein.
Ihr Tod. Der Mistkerl hatte ja keine Ahnung. Lena wünschte, sie hätte eine Waffe dabei, dann wäre sie wieder reingegangen und hätte ihm die Eier weggeschossen. Wie konnte er es wagen, ihr das anzutun?
»Nein.« Sie starrte auf das Taxi, das am Straßenrand hielt, nicht willens zu akzeptieren, dass er es für sie gerufen hatte. »Das kann er nicht machen. Nicht mit mir.«
»Hey, Lady, ham’ Sie das Taxi bestellt?«, rief der junge kubanische Fahrer, der laut den neuesten Ricky-Martin-Hit hörte.
Wenn sie in das Taxi stieg, dann war das wie die Anerkennung der Tatsache, dass sie endgültig und unwiderruflich abgeblitzt war. Was ihr nicht passieren durfte, oh nein. Lena schüttelte den Kopf und ging, die hohen Absätze ihrer Lieblings-Manolos hämmerten auf dem Asphalt.
Warum hatte er sie weggeschickt? Nicht, dass sie etwas falsch gemacht hätte, aber was hatte sie getan? Wann hätte sie überhaupt Zeit gehabt etwas Falsches zu tun?
Ich hätte nicht gleich am ersten Abend mit ihm ins Bett gehen sollen, sagte sie sich selbst. Ich hätte ihn warten lassen sollen.
Das war eine ihrer Grundregeln, und am Morgen danach war sie erstaunt gewesen, sie gebrochen zu haben. Wahrscheinlich zu viel Champagner – oder zu viele einsame Nächte. Es war so lange her, dass sie jemanden getroffen hatte, der sie reizte, dass sie die Batterien in ihrem Vibrator schon zweimal gewechselt hatte.
Vielleicht war es der Sex. Die Anziehungskraft zwischen ihnen war wie eine Selbstentzündung gewesen – in dem einen Moment flirteten sie noch; im nächsten lag sie auf dem Rücken unter ihm. Sie zitterte, als sie an die Dinge dachte, die sie ihn hatte tun lassen. Er war nicht wirklich brutal gewesen, aber er hatte sie von heiß und hungrig übergangslos zu wild und pervers getrieben.
Lena presste eine Hand an die makellose Haut an ihrem Hals. Es würde ihm leidtun, sie abserviert zu haben. Sie wusste, wie viel sie wert war. Glaubte er, gepflegte, wunderschöne Frauen kamen jeden Tag in seinen düsteren Freak-Club? Lena war nur aus Versehen hingegangen, weil sie dachte, es wäre ein neuer Salsa-Laden. Der süße Barkeeper, dessentwegen sie geblieben war, erzählte ihr von dem neuen Besitzer – attraktiv, britisch, stinkreich –, der den Laden kaum je verließ.
Lena zitterte, als ihr wieder einfiel, wie sie ihn das erste Mal gesehen hatte. Er hatte sie angeschaut und über den Raum hinweg angelächelt, und sie hatte sofort die Freaks und den Barkeeper und das Salsatanzen vergessen.
Komm mit mir, hatte er an ihrem Haar geflüstert. Das ist so viel besser, als allein zu kommen.
Nein, das ging gar nicht. Überhaupt gar nicht. Sie würde ins Casablanca gehen und eine Tasse Kaffee trinken, vielleicht ein winziges Stück von deren köstlichem Käsekuchen essen und sich beruhigen. Was sie brauchte, war eine Ausrede, um zurückzugehen und mit ihm zu reden, um ihm zu zeigen, was für einen Fehler er machte. Es sollte ihm leidtun, dass er sie so schlecht behandelt hatte.
»Entschuldigung, junge Dame«, sagte jemand hinter ihr. »Haben Sie das verloren?«
Lena blickte sich um und blieb stehen, als sie das Kreuz sah. Mein Gott, was für ein hässliches Ding, ein völlig verdrecktes Kruzifix, groß genug, um es über eine Tür zu hängen. »Nein.«
»Sind Sie sicher?«
Der Schimmer von gelbem Metall unter der Schmutzschicht ließ Lena aufmerksam werden. Wahrscheinlich vergoldet, dachte sie, während sie einen Schritt darauf zuging, aber vielleicht auch nicht. Den Dreck konnte sie abwaschen. »Wo haben Sie das gefunden?«
»Direkt hinter ihnen«, sagte der Mann und deutete auf den Bürgersteig. »Erkennen Sie es wieder?«
Das Gold blitzte in ihren Augen und lenkte sie von dem ab, was er sagte. Unter dem Schmutz war etwas Rundes und Schimmerndes – Strasssteine? Juwelen? Lena streckte die Hand aus, und er legte es auf ihre Handfläche. Es fühlte sich schwer und kalt an, und wenn die großen dunklen Klunker darauf unecht waren, dann würde sie ihre Handtasche inklusive der beiden Schildplatthenkel fressen.
Sie drehte es, sah, was auf der Rückseite stand, und lächelte. »Nein, es gehört mir nicht, aber ich weiß, wem es gehört.« Sie schloss die Finger darum. »Ich bringe es ihm.«
»Ich finde, es ist ein ungewöhnlicher Name.« Er lächelte sie an. »Ist der Mann ein Bekannter von Ihnen?«
»Er ist mein Freund«, erklärte sie stolz und spürte das hübsche Kreuz warm an ihrer Haut. Es musste nur ein bisschen gesäubert werden, und das konnte sie auf der Damentoilette des Clubs erledigen. »Vielen Dank.«
Er kam näher. »Gern geschehen.«
Lena hätte sich abwenden und weiter bis zum Casablanca gehen können, weil es kalt wurde, aber dafür hätte sie den Lichtkegel der Laterne verlassen müssen, und dann würde das Kreuz nicht mehr schimmern. Ein wunderschönes Stück wie dieses sollte gesehen werden – genau wie sie.
»Erlauben Sie mir, Sie ein Stück mitzunehmen, junge Dame.« Er nahm ihren Arm und führte sie hinüber zu einem langen, dunklen Auto, das am Straßenrand stand.
Lena wollte ihm sagen, dass sie nicht mitgenommen werden wollte, aber das wunderschöne, schimmernde Kreuz nahm sie ganz und gar gefangen. Mit dem Daumen rieb sie den Schmutz ab und zählte sieben dunkle Juwelen darauf, wie rote und schwarze Diamanten, falls es so etwas gab.
Was, wenn die wirklich echt sind? Hat er so viel Geld?
»Es gefällt Ihnen, nicht wahr?«, fragte der Mann, während er sie zum Straßenrand führte.
»Ja.« Lena stieg hinten in den dunklen Wagen und fühlte eine tiefe Dankbarkeit, dass der nette Mann das Kreuz gefunden hatte. Und er hatte es ihr ohne großes Aufheben gegeben, und so sollte es sein. Schöne Frauen verdienten es, schöne Dinge geschenkt zu bekommen.
Der Mann redete mit ihr über Belanglosigkeiten, während sie langsam durch die Innenstadt fuhren. Lena musste mehrmals ein Gähnen unterdrücken – sie war so müde –, nickte jedoch und hörte abwesend zu, während sie über die filigranen Goldeinfassungen um die roten und schwarzen Edelsteine auf dem Kreuz fuhr. Es war jetzt fast gar nicht mehr schmutzig, und sie war sicher, dass es in ein Museum gehörte oder zumindest einzigartig war.
Sie drückte es gegen ihr Herz, befriedigt von dem Gedanken, dass keine andere Frau auf der Welt genau so eines haben würde. Und das war auch richtig, denn nur sie besaß genug Stil, um so etwas zu tragen.
Warum ihr neuer Bekannter sie zu einer Kirche brachte anstatt zum Casablanca, wusste sie nicht. Sie war seit einer Ewigkeit nicht mehr in der Messe gewesen. Aber er bestand darauf, dass sie mit ihm ging, und als sie drin waren, zeigte er ihr die hübschen Buntglasfenster. Lena fand sie langweilig im Vergleich zu den strahlenden Farben ihres Kreuzes, verschwieg das jedoch aus Höflichkeit.
Doch es war friedlich im Inneren der Kirche, von dem Weihwasser in dem großen Taufbecken aus weißem Marmor an der Seite des Altars bis hin zu dem breiten Ständer mit den Votivkerzen, die heute Abend alle angezündet waren und in ihren kleinen, blutroten Glasfassungen einen warmen Glanz ausstrahlten.
Lena hielt den Atem an, überrascht, wie schnell die Traurigkeit ihre zufriedene Stimmung auslöschte. Hier vor dem Altar zu stehen war schlimmer, als ihre Kreditkartenabrechnungen zu öffnen. Sie hätte öfter zur Kirche gehen sollen als nur zu Weihnachten, Ostern und den Hochzeiten ihrer Mutter. Wie viele Jahre waren seit ihrer letzten Beichte vergangen? Sie konnte sich nicht erinnern. Zu viele. Viel zu viele.
»Sie wirken unglücklich«, sagte ihr neuer Bekannter und tätschelte ihre Schulter. »Zünden Sie eine Kerze an und beten Sie, meine Liebe. Dann fühlen Sie sich besser.«
Lena nickte und kniete auf dem kleinen, gepolsterten Betstuhl vor den Votivkerzen. Sie wollte ihr Kreuz nicht weglegen, deshalb streifte sie vorsichtig den Lederriemen über ihren Kopf und ließ es an ihrem Herzen ruhen. So. Es hing zu tief für den Ausschnitt ihres Kleides, aber sie konnte sich umziehen, wenn sie zu Hause war.
Sie hob eine Kerze auf und hielt sie an eine andere, bereits brennende Kerze, doch das Gewicht ihrer Trauer verdoppelte sich. Eigentlich schrecklich, wie viele Kerzen schon brannten. So viele gebrochene Herzen in der Welt. Die Menschen kamen her, um für jene zu beten, die ihre Liebe nicht erwiderten. Es waren die, die es nicht verdienten, geliebt zu werden.
Wie sie selbst.
Jetzt konnte Lena erkennen, dass es ihre eigene Schuld war, dass sie verlassen worden war. Wenn sie hübscher gewesen wäre oder jünger oder besser im Bett, dann hätte er sie nicht weggeschickt. Er hatte sie durchschaut. Er hatte sie rausgeworfen, weil sie sich wie eine Hure aufgeführt hatte. Eine billige, gewöhnliche Hure, die hinter seinem Geld her war.
Tränen liefen ihr über das Gesicht, während sie das Kreuz in der Hand hielt. »Vergib mir. Vergib mir.«
Ihr neuer Freund kam zu ihr und baute sich vor ihr auf. Er schien zu verstehen, warum sie weinte. »Sie bemalen Ihr Gesicht und ziehen sich an wie eine Dirne, und genauso werden die Männer Sie behandeln.«
Lena sah zu ihm hoch und schluchzte auf. »Was kann ich tun?«
Er lächelte und deutete auf das Taufbecken. »Waschen Sie sich in Weihwasser, meine Liebe. Nur wer sich von seinen Sünden reinwäscht, kann wahre Erlösung finden.«
Lena war so dankbar, dass sie den ganzen Weg zum Taufbecken über weinte. Sie hielt nur inne, um ihre Schuhe auszuziehen, damit sie nicht nass wurden. Sie würde sie morgen ins Galleria zurückbringen und sich etwas Einfacheres kaufen, etwas, das besser zu einer züchtigen Frau passte.
Unbeholfen, aber bereitwillig stieg Lena zum oberen Rand des Taufbeckens hinauf und lehnte sich über das kalte, klare Wasser. Zuerst wusch sie sich das Make-up aus dem Gesicht und das Gel aus dem Haar. Dann übergoss sie ihren ganzen Körper mit Wasser, um das Parfüm abzuwaschen und den Duft seiner Hände von ihrer Haut.
»Ja, meine Liebe.« Ihr neuer Freund legte ihr eine behandschuhte Hand auf den Kopf. »Alles muss abgewaschen werden.«
Lena spürte die Ungeduld ihres Bekannten. Er war offensichtlich ein vielbeschäftigter Mann und hatte Wichtigeres zu tun, als hier zu stehen und ihr zuzusehen. Sie sollte ihn wirklich nicht aufhalten. Wenn er ihr nur helfen würde, das Kreuz abzunehmen; es war so schwer geworden …
Kaltes Wasser.
Lenas Augen öffneten sich weit, und Luftblasen verließen ihren Mund in einem Schrei. Sie wusste nicht, wo sie war. Ihr Kopf steckte in etwas Weißem, das mit Wasser gefüllt war, und sie konnte ihn nicht herausheben. In einer Badewanne? Einem Pool? Zu klein. Das Gewicht um ihren Hals fühlte sich an wie ein Betonblock, und die Hände, die sie gegen den Rand des Taufbeckens drückten, ließen nicht zu, dass sie den Kopf hob. Sie war wie gelähmt, hilflos. Sie schrie und bekam Wasser in Nase und Mund. Sie zwang es mit ihrem letzten Atemzug heraus, und ihr wurde klar, dass sie niemals wieder atmen würde.
Nicht so. Nicht so.
Ihr Haar trieb vor ihren Augen, während ihre Bewegungen langsamer wurden. Ihre Lungenflügel platzten ihr beinahe aus der Brust, und dann taten sie es und Wasser füllte sie, reinigte sie, kühlte sie, zog sie weg von dem Schmerz und der Angst, von allem.
»Genug, meine Liebe.«
Die Hände ließen Lena los, und sie hob den Kopf aus dem Wasser. Luft raste in ihre Lunge. Sie wurde herumgedreht, und etwas drückte auf ihren Rücken, ließ sie das Wasser erbrechen und aushusten, das sie geschluckt und eingeatmet hatte. Sie schlug um sich, versuchte, sich an ihrem Retter festzuhalten.
Er hob sie auf, wischte ihr das nasse Haar aus dem Gesicht. Er lächelte sie an, als sei er froh, dass sie atmete. »Sind Sie jetzt wieder rein?«
Lena hörte auf zu husten und starrte an sich herunter. Ihr Kleid war ruiniert. Ihr Haar hing in langen, nassen Strähnen vor ihrem Gesicht. Und ihre Hände – sie hatte sich so stark am Rand des Beckens festgekrallt, dass ihre Handflächen verletzt waren. Ihr Magen zog sich zusammen, als ihr klar wurde, dass die Hände, die sie ins Wasser gedrückt hatten, ihre eigenen gewesen waren. Sie hatte sich in diesem verdammten Taufbecken beinahe selbst ertränkt.
Man hat mich unter Drogen gesetzt.
»Was ist mit mir passiert?« Sie wandte sich wieder an den Mann. »Was haben Sie mir gegeben?«
Sein Lächeln verschwand, während er zurücktrat. »Nur das Kreuz. Nur der Sünder kann sich seine Sünden abwaschen. Im Grunde Ihres Herzens wissen Sie das.«
»Nein.« Zu ihrem Entsetzen wandte Lena sich langsam um, wie ein Spielzeug, das per Fernbedienung gelenkt wurde, und ging auf das Taufbecken zu.
»Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, verärgert, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist«, sagte der Mann leise.
»Hören Sie auf.« Sie trat an das Becken und legte die Hände auf den Rand, umfasste ihn fest. »Zwingen Sie mich nicht, das zu tun.« Ihr Rücken schmerzte, und ihre Fingernägel brachen, als sie sie mit aller Kraft in den kalten Stein grub. »Bitte, Gott, ich will nicht sterben!«
Kurz bevor Lena den Kopf unter Wasser steckte, hörte sie ihn sagen: »Dann hätten Sie sich von ihm nicht anfassen lassen dürfen.«
»Okay, hör mal.« Harry Quinn, Detective des Morddezernats von Fort Lauderdale, holte sein Asthmaspray heraus, sprach zwischen den Sprühstößen jedoch weiter. »Eine Schwimmerin, die im Meer ertrinkt, wird nicht an den Strand gespült und rollt dann fast vierhundert Meter weiter und setzt sich auf eine Bank an der Bushaltestelle.« Er hustete. »Nie im Leben. Sie wurde dort hingesetzt.«
Seine Partnerin, Detective Samantha Brown, stimmte ihm schweigend zu. Sie hatte einen direkten Blick auf die Leiche, die noch so dasaß, wie man sie gefunden hatte, auf einer Bank, die Füße über Kreuz, die Hände sittsam im Schoß gefaltet. Wären da nicht ihr nasses Haar gewesen und ihr Cocktailkleid, das an ihrem Körper klebte, dann hätte sie irgendeine Frau sein können, die auf den Bus wartete. Ertrunkene sahen niemals so ordentlich aus.
Sams Nerven waren angespannt gewesen, seit sie der Anruf der Einsatzzentrale erreicht hatte. Die Leiche auf diese Weise vorzufinden, beruhigte sie nicht gerade.
»Erster Eindruck?«, fragte Harry.
»Sie ist nicht geschwommen«, murmelte Sam. »Nicht in diesen Klamotten.«
»Vielleicht ist ihr im Schlaf der Kopf nach hinten gekippt, und es hat wirklich stark geregnet.« Ihr Partner lachte über seinen eigenen geschmacklosen Witz, dann wurde er von einem heftigen Hustenanfall geschüttelt, bis er das Ende des Inhalators erneut in den Mund nahm und sich sein Medikament in die Lungen pumpte.
Harry war noch zwei Wochen von der Pensionierung entfernt, und es war reine Willenskraft, die ihn noch zur Arbeit kommen ließ. Sein Asthma hatte sich so verschlimmert, dass er die meisten körperlichen Tätigkeiten seiner Arbeit nicht mehr schaffte. Sams Boss, Captain Ernesto Garcia, hatte angeboten, Harry einen Schreibtischjob zu geben und ihr jemand anderen an die Seite zu stellen, doch Sam wollte das ihrem Partner nicht antun. Harry war stolz darauf, seit dreiunddreißig Jahren für das Morddezernat des FLPD zu arbeiten; das Mindeste, was sie tun konnte, war, die letzten vierzehn Tage mit ihm durchzustehen.
Und nach Harrys Pensionierung … Sie wollte nicht darüber nachdenken. Harry kannte ihre Geschichte. Ein neuer Partner nicht.
»Wir sind nicht sicher, was passiert ist«, erklärte der anwesende Streifenpolizist. Er hielt einen Moment lang inne und sah zu, wie Sam zu der Leiche ging, und der Ausdruck in seinen Augen wurde weich, als er ihren langen, wohlgeformten Körper wahrnahm. »Jemand könnte sie heraufgetragen haben, um sie vor den Möwen zu schützen.«
Harry blickte in den leeren Himmel, der sich gerade erst rosa zu verfärben begann. »Keine Möwen zu sehen. Das ist ein bisschen komisch.«
Sam entdeckte den Kastenwagen eines lokalen Nachrichtensenders an der Ecke. »Officer, schirmen Sie den Tatort ab, und halten Sie die Leute auf Abstand. Und sorgen Sie dafür, dass die Kameras auf der anderen Seite bleiben.«
»Ja, Ma’am.«
Sie ging zu ihrem Auto, um daraus zwei Styroporbecher mit Kaffee zu holen, und fühlte den Blick des Streifenpolizisten förmlich auf ihrem Hintern. Als ziemlich große Frau mit langem dunkelbraunem Haar und warmen haselnussbraunen Augen bekam sie manche Blicke, aber es war der Rest ihres Körpers, der das Interesse der Männer magisch anzog. Sam war, wie ein höflicher Mann aus dem Team es einmal ausgedrückt hatte, gut gebaut. Der schlichte Hosenanzug, den sie trug, konnte ihre Kurven, die sich durch tägliche Bewegung noch stärker ausprägten, nicht ganz verstecken. Sie trug ihr Haar in einem geflochtenen Zopf oder zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, um dienstlich zu wirken, aber sie erregte immer noch mehr Aufmerksamkeit, als ihr lieb war.
»Du wirst noch ein Magengeschwür bekommen, wenn du weiter so viel von dem Zeug trinkst.« Harry nickte in Richtung des Kaffees in ihrer Hand, während sie zu der Bank gingen. »Ich dachte, du wolltest deinen Konsum einschränken.«
»Speed verkauft mir ja keiner.« Sie blieb stehen und blickte auf die Leiche. »Was denkst du?«
»Absichtlich. Nett. Könnte ein Tourist gewesen sein.« Harry benutzte das Asthmaspray erneut, während er die tote Frau betrachtete. »Sagen wir, er joggt am Strand oder kommt her, um sich noch eine Dosis Sonnenstrahlen für den Hautkrebs abzuholen, stolpert über die Leiche, gerät in Panik, hebt sie auf, trägt sie rüber auf die Bank, um, ich weiß nicht, Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen?«
»Wenn ein Zivilist über eine Leiche stolpert, dann gerät er in Panik, rennt weg, ruft um Hilfe, übergibt sich. Aber er berührt sie nicht oder bewegt sie. Die haben doch inzwischen alle CSI gesehen.« Sam schob sich unter dem gelben Polizei-Absperrband hindurch und ging zu dem Teppich aus Plastikfolie, der die Bank umgab.
Harry spekulierte weiter, während er ihr folgte. »Ja, aber es könnte so ein oberschlauer Teenager oder ein Betrunkener gewesen sein …«
»Sieh dich um.« Sie machte eine Geste mit einem der Becher. »Keine Fußabdrücke und kein Seetang oder Sand an ihr. Und sie ist auch nicht aufgedunsen.« Sie blickte auf den Betonboden unter der Bank. »Da ist ’ne Riesenpfütze mit Wasser. Ich würde sagen, sie sitzt erst höchstens seit einer Stunde hier.«
»Gibt nur einen Weg, das rauszufinden.« Sein Blick glitt von dem nassen Kleid zu den Händen der Frau.
Sam sah die abgebrochenen, blutigen Fingernägel und wandte den Kopf, um sich zu vergewissern, dass die Polizisten die Gegend abgeriegelt hatten. Sie wollte die Leiche gerade berühren, als ein weißer Van am Straßenrand hielt, sodass man die Bank von der Straße aus nicht mehr sehen konnte.
»Warte, der Schornstein auf zwei Beinen ist da.« Harry hustete. »Ich mache mal gut Wetter bei den Medien.«
Sam beobachtete, wie Dr. Evan Tenderson, dessen Mund um die filterlose Zigarette herum zu einem sauertöpfischen Ausdruck verzogen war, aus dem Van sprang und auf sie zustapfte. Der stellvertretende Gerichtsmediziner war ein militanter Raucher. »Guten Morgen, Doc.«
»Scheiß auf guten Morgen, es ist, verdammt noch mal, erst halb sechs Uhr früh«, meinte er und nahm die Zigarette aus dem Mund, sodass man seine nikotingelben, schiefen Zähne sehen konnte, die seine Eltern niemals hatten richten lassen. Er sah die tote Frau an, dann ließ er den Stummel fallen und zog sich ein paar Latexhandschuhe über. »Jetzt habe ich tatsächlich alles gesehen. Wie zum Teufel ist sie da raufgekommen?«
»Das versuchen wir herauszubekommen. Hier.« Sam gab ihm einen der Kaffeebecher, die sie in der Hand hielt. »Schwarz, ein Stück Zucker.«
»Wenn Sie wollen, dass ich schneller arbeite, Brown, dann müssen Sie mir Donuts mitbringen. Oder eine Hure mit einem engen Mund.« Noch ein säuerliches Lächeln entblößte seine gelben schiefen Zähne. »Diese Bemerkung sollte natürlich keine sexuelle Belästigung sein.« Er nahm ein weiteres Paar Handschuhe aus seiner Tasche und streckte sie ihr entgegen.
Sam ließ die Bemerkung unkommentiert. »Ich brauche ihren Ausweis, falls sie einen dabeihat.«
»Sie haben alle einen dabei.« Tenderson stellte seine Tasche ab und setzte sich vorsichtig auf den Rand der Bank, während er sich über die Leiche beugte. »Weiße Frau, vermutlich fünfundzwanzig bis fünfunddreißig Jahre alt, tot.« Er sah an ihr herunter. »Haar, Kleidung und Haut nass.« Er benutzte eine Zange mit einem langen Griff, um die Handtasche an ihrer Schulter zu öffnen und eine Brieftasche herauszuholen, die er Sam zusammen mit einer Asservatentüte gab.
Sam legte die Brieftasche in die Tüte, bevor sie den Verschluss löste und die Brieftasche öffnete. Die Sonne ließ das Siegelhologramm auf der Laminierung über dem lächelnden Passbild der toten Frau aufleuchten. »Lena Caprell, siebenundzwanzig, wohnhaft in Fort Lauderdale, bisher unfallfrei gefahren.«
»Sag ich doch.« Tenderson wandte sich wieder der Leiche zu. Sam wollte gerade zu ihrem Partner gehen, um ihn über die neuen Erkenntnisse zu informieren, als der Gerichtsmediziner aufschrie und seine Hand zurückzog. Er hielt sich das Handgelenk und fluchte laut und ausgiebig. Als er sah, dass Sam ihn beobachtete, schrie er: »Die Schlampe hat mir einen Stromschlag verpasst.«
»Ich dachte, Sie hätten schon alles gesehen.« Sie trat, so nah sie konnte, ohne die Plastikfolie zu verlassen, an die Tote heran und sah das stumpfe Glänzen von altem Metall und verschrumpeltes Leder.
»Ich meine es ernst. Hat sich angefühlt wie ein leichter Stromstoß«, beharrte Tenderson und schüttelte seine Hand aus.
»Sie trägt eine Art Halskette.« Sie holte einen Stift aus ihrer Jacke, schob ihn unter das verschrumpelte Lederband und hob den Anhänger heraus, der daran hing. Obwohl sie Handschuhe trug, achtete sie darauf, die Hände der toten Frau nicht zu berühren. Sie konnte das jetzt nicht mehr riskieren, wo Tenderson direkt neben ihr stand.
Das Kruzifix, das Sam aus dem Kleid zog, war zwanzig Zentimeter lang und sehr dreckig. Es sah sehr alt aus oder war auf alt gemacht. Bei einer archäologischen Ausgrabung wäre es vermutlich eine Sensation gewesen; am toten Körper einer jungen Frau in einem Abendkleid wirkte es fast obszön. Aber es war auch obszön, Lena Caprells Leiche hier sitzen zu sehen, sauber und blass und reglos wie eine Statue. Gestern war sie noch ein Mensch gewesen. Vor ein paar Stunden hätte sie zu Sam aufgesehen und gesprochen oder gelächelt oder geatmet. Jetzt war sie so voller Leben wie die Betonbank unter ihr.
Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Sam blickte auf die Hände der Frau, die so sorgfältig in ihrem Schoß gefaltet waren. Nur sie störten das Bild. Wodurch waren diese hübschen, manikürten Fingernägel so schlimm aufgerissen worden?
Sie sah zu Tenderson und seufzte. Er würde nicht mehr gehen. »Untersuchen Sie ihre Hände.«
»Oh, Süße, hast du mir ein bisschen Haut von dem Bastard besorgt, der dir das angetan hat?«, säuselte Tenderson, während er Lenas Finger untersuchte. Seine Augen wanderten zu dem Kreuz. »Denken Sie, sie war eine gläubige Katholikin?«
»Könnte sein.« Das Gewicht des Kreuzes irritierte Sam. »Oder sie brauchte das Gewicht, um auf dem Teppich zu bleiben.«
»Jesus war ein schwerwiegender Kerl.« Er wandte sich wieder seiner eigenen Hand zu. »Das tut immer noch verflucht weh. Latex isoliert einen verdammten Scheiß.«
Sam musste einen Moment mit der Leiche allein sein, aber es sah nicht so aus, als wenn sie eine Chance dazu bekommen würde. Als sie das Kreuz langsam wieder sinken ließ, drehte es sich durch sein Gewicht. Auf der Rückseite des Kreuzbalkens waren fünf Buchstaben in einer altmodischen Schrift eingraviert. »Da steht etwas drauf.«
Tenderson blickte von seiner Hand auf, die er noch immer wehleidig betrachtete. »Was?«
»Nur ein Wort.« Sam benutzte den Kugelschreiber, um die Rückseite des Kreuzes ins Sonnenlicht zu drehen, wodurch das eingravierte Wort noch tiefer und dunkler wirkte. »Lucan.«
2
Lucan, früherer Chef-Auftragskiller des Darkyn-Highlords Richard Tremayne, Suzerän des neu gegründeten und immer noch namenlosen Jardins und extrem gehasster Außenseiter unter seinesgleichen, blickte hinaus in die zunehmende Dunkelheit. Trotz der mehr als sieben Jahrhunderte, die er jetzt auf der Erde lebte, zuerst als Mensch und dann als eine Kreatur, die Menschen jagte, hatte Lucan nur wenig Zeit in den Tropen verbracht. Hier kam die Nacht so wie ein heimlicher Liebhaber auf einen Balkon, kletterte über das Wolkengitter hinauf, um die pastellfarbene Unschuld des Tages in seinen Mitternachtsmantel zu hüllen.
Wie leicht es wäre, in diese pechschwarze Dunkelheit zu gehen, ihr um die Welt zu folgen und für immer in ihr zu bleiben.
Bevor er sein besonderes Talent dazu nutzte, die Feinde des Highlords zu eliminieren, hatte Lucan mit dem Gedanken an ein solches Leben gespielt. Für viele Jahrzehnte nach seiner Rückkehr als Darkyn war er ziellos und frei herumgewandert, hatte die unsterblichen Angehörigen seiner Art gemieden und Menschen nur als Nahrungsquelle genutzt. Er war nicht glücklich gewesen, aber man hatte ihn in Ruhe gelassen. Jetzt war er weiter aufgestiegen, als er es jemals für möglich gehalten hätte, und dennoch war er der, den alle mieden, den alle verachteten und dem niemand traute – und genauso geplagt von Menschen und Darkyn wie jener Pharao, der das jüdische Volk versklavte und ihrem Gott trotzte. Er wusste, dass er hier nicht willkommener sein würde als irgendwo sonst, wo er versucht hatte, sich eine Heimat zu schaffen.
Das war grotesk. Das passte. Das ließ in ihm den Wunsch aufkeimen, etwas zu töten.
»Mylord, da ist etwas für Euch abgegeben worden.«
Lucan roch mentholhaltige Hustenbonbons und drehte sich weg von der Fensterfront in seiner Suite, von der aus man aufs Meer hinausblickte, zu jemandem, den er noch nicht tot sehen wollte: seinem neu angestellten Tresora. »Wie ich dir schon ungefähr zweitausendmal erklärt habe, musst du mich nicht mit ›Mylord‹ anreden, Burke. Das tun die Kyn, nicht du.«
»Verzeiht.« Herbert Burke war ein dünner, kleiner Mann mit einem ängstlichen Gesichtsausdruck. Geplagt von Allergien dünstete er den Geruch eines Krankenzimmers aus und trug eine Fülle von Taschentüchern, Nasensprays und anderen medizinischen Utensilien mit sich herum, um seinen chronischen Schnupfen zu behandeln. »Das, was da für Euch abgegeben wurde, ist ein bisschen merkwürdig.«
Lucans silbrigblonde Brauen hoben sich. »Ist es eine Frau?«
»Nein, Myl… nein.«
Es war nie eine, leider. Niemand schien mehr zu wissen, was einem neu ernannten Suzerän zustand. »Dann stell es ins Büro, und ich kümmere mich später darum.«
»Danke, Mylord.« Burke wurde blass, als er seinen Fehler bemerkte, und floh.
»Guter Gott. Ich weiß nicht, was ich getan habe, dass ich diesem Menschen eine solche Angst einjage.« Lucans Blick glitt zu dem dunkelhaarigen Mann, der im Sessel saß und einen Stapel Post durchging. »Weißt du, was es ist?«
Sein Seneschall hörte nicht auf zu lesen. »Es könnte Euer Ruf unter den Tresori sein, Mylord.«
»Ich habe seit zweihundert Jahren kein Blut eines menschlichen Dieners mehr getrunken.« Und er würde es auch nicht tun, wenn er die Wahl hatte. Er spürte, wie sich Neugier in ihm regte. »Was sagen sie denn über mich?«
Rafael sah auf. »Dass Ihr einen Mann tötet und verspeist, nur weil er Euch auf die Nerven fällt.«
»Hannibal Lecter tut so etwas«, meinte Lucan. »Ich reiße ihm nur die Kehle heraus und trinke sein Blut.«
Sein Seneschall legte den Brief beiseite, den er gelesen hatte. »Vor drei Nächten, als Ihr wütend auf Burke wart, weil er etwas Wein vergossen hatte, während er Euch bediente …«
»Das war sehr guter Wein«, rechtfertigte sich Lucan.
»… habt Ihr laut darüber spekuliert, wie schwierig es wohl wäre, einen Menschen in einer Badewanne zu ertränken, die mit seinem eigenen Urin gefüllt ist.« Rafaels leerer Gesichtsausdruck wurde ein klein wenig missbilligend. »Burke hatte Angst.«
»Burke ist ein Idiot. Es würde doch viel zu lange dauern, bis er die Badewanne so weit mit seinem Urin gefüllt hätte, dass man ihn darin ertränken könnte.« Er gähnte. »Besser, ich nehme dazu den Auswurf, den er ständig spuckt und hustet.«
»Ich würde Euch bitten, etwas toleranter zu sein, Mylord.« Rafael öffnete einen Umschlag und zog ein dickes Vertragsformular heraus. »Er hat noch nie aktiv einem Suzerän der Darkyn gedient. Er weiß nicht, dass Ihr nur scherzt. Tatsächlich macht Ihr ihn jeden Tag nervöser.«
»Tatsächlich?« Lucan ließ in seiner Stimme etwas von dem Ärger mitschwingen, den er empfand. »Was für ein Glück, dass ich dich als Seneschall habe, Rafael. Andernfalls würde ich keinen meiner Diener und kein einziges verdammtes Wort verstehen, das aus meinem Mund kommt.«
Gelangweilt wandte er sich wieder der Fensterfront zu und sah in die Nacht hinaus. Rafael beendete schweigend die Durchsicht der nie endenden Flut an Post.
»Hier ist eine Liste mit den Bands aus der Gegend, die freitag- und samstagabends spielen können, und die Papiere für die neue Baufirma, die Ihr unterzeichnen müsst, Mylord, an den Stellen, die ich mit einem X versehen habe.« Der Seneschall übergab ihm einen Ordner mit den Unterlagen. »Der Bauleiter bittet um einen Termin mit Euch.«
Lucan strich sich über das Kinn. »Sollten wir das riskieren? Schließlich könnte ein unbedachtes Wort von mir ihn glauben lassen, ich hätte Schreckliches mit seiner Leber vor.«
Die breiten Schultern zuckten. »Vielleicht arbeitet er dann schneller.«
»Werde jetzt ja nicht plötzlich humorvoll, Rafael. Das könnte ich nicht verkraften.« Er holte einen Füllfederhalter aus Gold und Platin heraus, den ihm der dankbare Suzerän von Monte Carlo geschenkt hatte, und schraubte die Kappe ab. Es dauerte einen Moment, bis er wieder wusste, mit welchem Namen er unterzeichnen sollte – er hatte über die Jahrhunderte so viele benutzt, dass er das ständig vergaß –, und dann setzte er seine Unterschrift auf jedes Blatt. »Da.« Er warf den Vertrag seinem Seneschall hin. »Um was für Absurditäten muss ich mich sonst noch kümmern?«
Rafael nickte in Richtung Fenster.« Eine Frau wurde heute Morgen tot in der Nähe des Strandes gefunden. Ertrunken, sagt eine von den Kellnerinnen.«
»Ich habe sie nicht umgebracht.« Lucan sah seine rechte Hand mit neuem Interesse an. »Warst du es?«
»Nein, Mylord. Aber die Frau« – Rafaels Blick glitt zu dem riesigen Bett im angrenzenden Schlafbereich – »war eine der Menschenfrauen, die Ihr vor ein paar Wochen benutzt habt.«
Er gönnte sich manchmal eine Affäre mit einem weiblichen Gast des Clubs, aber sie dauerte selten mehr als einen oder zwei Tage. Dafür sorgte er. »Die Blonde oder die Rothaarige?«
»Weder noch.« Sein Seneschall sah auf seine Uhr. »Es war eine Brünette. Sehr hübsch und ziemlich elegant.«
»Die Schauspielerin. Ich erinnere mich. Mein Gott, was für eine Verschwendung.« Sie war eine gepflegte Schönheit gewesen und so habgierig wie eine venezianische Adlige, die das Familienvermögen aufbessern wollte. Ihre Durchtriebenheit hatte ihn so amüsiert, dass er sie in drei aufeinanderfolgenden Nächten genommen hatte. »Sie wirkte auf mich nicht lebensmüde.« Sie war eher mordlustig gewesen, nachdem er ihr Tête-à-tête beendet hatte. »Finde heraus, was mit ihr passiert ist.«
»Ja, Mylord.« Rafael wandte sich um und ging zur Tür der Suite.
»Noch etwas.« Lucan genoss es zu sehen, wie sein Seneschall stehen blieb und sich seine Schultern versteiften. »Ruf Alisa an und schick sie in mein Büro, wenn sie da ist. Sofort, wenn sie da ist.«
»Wie Ihr wünscht, Mylord.« Rafael verließ die Suite und schloss die Tür leise hinter sich.
Sein Seneschall missbilligte seine Vergnügungen, dessen war Lucan sich bewusst. Zweifellos fand Rafael, dass der Suzerän dieses komischen Haufens die Rolle des Pfarrers spielen sollte, der jede Nacht seine Runde durch den Jardin drehte, den Leuten Händchen hielt, sich ihre Sorgen anhörte und weise Ratschläge gab. Dass er sie mit starker, aber gütiger Hand sicher und geschlossen durch die vor ihnen liegenden Jahrhunderte führte.
Stattdessen mussten sie mit Lucan vorliebnehmen, der so gütig war wie ein Feuerfisch und zehnmal so tödlich.
Die Mitglieder von Lucans Jardin waren zuerst nicht begeistert von seinem Nachtclub gewesen, denn sie hatten zweihundert Jahre damit verbracht, sich in die Gesellschaft von Südflorida zu integrieren, und versucht, wie irgendeine Gruppe von Einwanderern zu wirken. Alles, was die Aufmerksamkeit auf das lenkte, was sie tatsächlich waren, musste um jeden Preis vermieden werden, deshalb waren sie Ladenbesitzer, Bürgermeister und andere respektable Säulen der Gesellschaft geworden.
Lucan hielt das Infusion dagegen für die passendere Tarnung. Wie konnte der neue Darkyn-Suzerän der Stadt sich besser anpassen als mit einem Gothic-Nachtclub, in dem die ichbezogene junge Generation verkehrte? Dafür musste er sich nicht einmal eine neue Garderobe zulegen.
Die Dramatik seiner neuen Umgebung gefiel ihm. Wenn man schon der Feind war, fand Lucan, dann konnte man das ebenso gut offen zur Schau stellen. Seine private Suite ähnelte vielleicht dem Gästezimmer im Weißen Haus, aber unten war die Atmosphäre blutrot und mitternachtsschwarz vom Boden bis zur Decke.
Viele seiner jungen Gäste verkleideten sich wie die Figuren aus den Horrorbüchern, die sie so gerne lasen, und er unterstützte dies, indem er seine Angestellten Gutscheine für Freigetränke in den hiesigen Kostümläden verteilen ließ. Die Spezialität des Hauses war die »Bloody Mother Mary«, serviert in einem schwarzen Glas und dekoriert mit Plastikfangzähnen. Man trank diesen Cocktail durch einen Infusionsschlauch anstatt durch einen Strohhalm. Jeder andere Cocktail auf der Karte war nach einem berühmten Dark-Fantasy-Autor benannt, vom »Stephen King Kahlua and Cream« bis zu den »Straub Berry Margaritas«.
Lucan plante auch ein Sommerkonzert für seine Gäste, bei dem Bands aus der Gegend auftreten würden und eine besondere Performancekünstlerin, die ihren Körper durch subtile Selbstfolter in Kunst verwandelte. Burke hatte ihm abgeraten, aber er riet Lucan von allem ab, was ihm persönliches Vergnügen oder Belustigung bot.
»Am Fort Lauderdale Beach gibt es seit den Achtzigerjahren keinen Gothic-Club mehr, Mylord«, hatte er zu Lucan gesagt. »Ihr solltet besser einen Salsa-Club oder ein Café eröffnen.«
»Ich kann keinen Kaffee trinken, und ich kann keinen Salsa tanzen«, hatte Lucan leichthin geantwortet. »Gothics dagegen bekommen mir sehr gut.«
Burke hatte eines seiner Nasensprays benutzt und war vor sich hin murmelnd gegangen.
Trotz aller Proteste vor der Eröffnung des Infusion war Lucan sehr stolz auf die Früchte seiner Arbeit. Während er seine herrschaftliche Suite verließ und mit dem Fahrstuhl hinunter in den Club fuhr, dachte er darüber nach, einen weiteren Themen-Club in Miami zu eröffnen und zwischen beiden zu pendeln, da mehr als die Hälfte des Jardins in Dade County lebte. Vielleicht würde ein Salsa-Club als südliche Basis genügen.
Wenn er diesmal bleiben konnte. Wenn er diesmal nur bleiben konnte.
Der Club würde erst in zwei Stunden öffnen, und das gesamte Erdgeschoss war leer und still. Lucan folgte dem Geruch der Kirsch-Eukalyptus-Bonbons in sein Büro und tippte den Code ein, der die elektronischen Hochsicherheitsschlösser an der Stahltür öffnete. Drinnen hatte Burke das Licht angelassen, und auf dem Schreibtisch, der einmal einem Schiffsbauer in Irland gehört hatte, stand ein langer weiß-violetter Karton von einem landesweiten Blumenversand. Vorne drauf war Jemand denkt an dich gedruckt.
»Dann hätte mir dieser Jemand eine Frau schicken sollen«, murmelte Lucan, während er seinen Brieföffner benutzte, um das Klebeband an den Seiten des Kartons zu durchtrennen. Er hob den Deckel an und betrachtete den Inhalt.
Zwei Dutzend verblühte Blumen lagen darin, braun und vertrocknet.
»Lilien.« Lucan griff in den Karton, um eine der Blumen herauszuholen. Es klopfte an der Tür, und er schob den Karton auf die Seite seines Schreibtisches, bevor er ein Wurfmesser aus seiner Weste holte. »Herein.«
Die junge Frau in dem lila-grün karierten Stoffmantel, die sein Büro betrat, hielt sich nicht so gerade wie die tote Brünette und war auch nicht so laut wie die dralle Blondine vor ihr. Ihr Gesicht erinnerte ein wenig an das eines Nagetiers, was sie mit dickem Make-up und einem kurzen, stufigen Bob aus auberginefarbenen Haaren zu verstecken versuchte.
»Du hast mich rufen lassen?«, fragte Alisa, auch bekannt als Alice Nora Kruk, mit ihrer sittsamen, höflichen Stimme. Sie behielt den Mantel an und blieb an der Tür stehen, und sie würde, wenn er es ihr sagte, ohne Protest sofort wieder gehen. Das war einer der Gründe, warum er sie öfter benutzte als die anderen Menschenfrauen, denen er begegnete.
Durch die Jahrhunderte hatten die Darkyn die Dienste professioneller Kurtisanen so genossen wie Kinder Süßigkeiten. Seit Lucans Ankunft in Südflorida war diese Frau schnell sein gelegentliches Lieblingskonfekt geworden.
»Ja, liebste Allie.« Lucan steckte das Messer wieder ein und setzte sich in den breiten Lederstuhl hinter seinem Schreibtisch. »Trägst du irgendetwas unter diesem unseligen Clan-Schottenstoff?«
Alisa knöpfte den Mantel sorgfältig auf und enthüllte, als sie ihn öffnete, ein trägerloses Bustier, einen Strapsgürtel und Netzstrümpfe, alles in einem rötlichen Violett. Sie ließ stets einen schmalen Streifen lockiges schwarzes Haar an ihrem Venushügel stehen, und an dem kleinen goldenen Ring, mit dem ihre Schamlippe gepierct war, hing ein herzförmiger Amethyst.
»Wie bezaubernd.« Er setzte sich und genoss die eindeutige Art, mit der sie auf ihn zuging, jede Bewegung zurückhaltend und doch provokativ. Noch ein Grund, warum sie immer noch da war: Allie besaß die Gabe der totalen Selbstkontrolle. »Und, wem hast du heute das Hirn rausgeprügelt?«
»Niemandem. Ich sollte einem Geschäftsmann in Boca den Hintern versohlen, aber er kam schon nach vier Schlägen auf meinem Schoß.« Sie nahm einen pinkfarbenen Kaugummi aus dem Mund und warf ihn in den Papierkorb neben seinem Schreibtisch. »Ich war total klebrig, musste erst duschen, bevor ich herkam.«
Er nahm ein zusammengefaltetes Leinentaschentuch und eine Tube mit Heilsalbe aus seiner Schreibtischschublade und stellte sie in Reichweite. »Das will ich doch hoffen.«
»Ich hör vielleicht bald mit dem Sado-Maso-Geschäft auf.« Sie kniete vor dem Stuhl, schob den oberen Rand ihres Bustiers nach unten und begann, langsam mit ihren durch Implantate vergrößerten Brüsten zu spielen. »Spezialisier mich stattdessen auf Anal. Männer wollen viel mehr Arsch ficken als früher.«
»Deinen«, fragte er und hob ihr Kinn an, »oder wollen sie’s in ihrem?«
»Spielt keine Rolle. Ich kann mit beidem Geld verdienen.« Sie atmete ein, und ihre Pupillen wurden groß, während sie noch mehr Spitzenstoff von ihren Brüsten schob. »Es sei denn, du änderst deine Meinung über uns.«
Lucan war versucht, ein regelmäßigeres und dauerhafteres Arrangement mit ihr zu treffen; er konnte sich ihr Honorar auf jeden Fall leisten. Allies Fähigkeiten waren außerdem von professioneller Qualität, und selbst unter dem Einfluss von l’attrait behielt sie ein bemerkenswertes Maß an Kontrolliertheit. Doch selbst er durfte die alte Tradition des Treueschwurs nicht brechen. Kein Mensch außerhalb der Darkyn-Gesellschaft wurde jemals hineingelassen. Burke ging vielleicht ungeschickt mit der einen oder anderen Weinflasche um, aber er stammte aus einer alten Tresori-Familie, die ihn seit seiner Kindheit zum Dienen erzogen hatte.
»Ich möchte dir die Freuden des Analverkehrs nicht nehmen«, murmelte er und beugte sich vor, um seinen Mund an ihre rechte Schulter zu legen.
»Oh Gott.« Die junge Frau schloss die Augen und stöhnte, als seine Fangzähne sanft ihre Haut durchstießen. »Das ist ein so viel schönerer Schmerz.«
Während Lucan das warme Blut aufsaugte, das aus den Löchern in ihrer weichen, dünnen Haut floss, wanderte sein Blick zurück zu dem Karton mit den verblühten Lilien. Warum machte sich jemand die Mühe, ihm tote Blumen zu schicken? Versuchte Richard, ihm einen seiner kryptischen Hinweise zu geben?
Eine zitternde Hand, die seinen Nacken berührte, ließ ihn die Lippen heben. Er drückte mit dem zusammengefalteten Taschentuch auf die Wunden, die seine Fangzähne hinterlassen hatten, und strich nach wenigen Augenblicken ein bisschen Wundsalbe darauf.
»Bitte«, stöhnte sie, öffnete ihre Schenkel ganz weit und zog an seiner Hand. »Ich brauche es.«
Das Blut einer Frau in seinem Magen verschaffte ihm immer eine Erektion, und Lucan sah keinen Grund, ihr den Wunsch nicht zu erfüllen. Schließlich bezahlte er Allie das Doppelte ihres Standardhonorars. Aber als er seine Hose öffnete, fragte er sich, wie lange er sie noch benutzen konnte. Obwohl ihre Reize leicht abgenutzt waren, konnten sie ihn dennoch in den Blutrausch der Hörigkeit versetzen.
Nein, es würde nicht Alisa sein. Es würde die Leere sein, die ihn von innen auffraß. Die Leere, die niemand füllen konnte, kein Blut, kein Sex, kein Tod.
»Ich brauche es jetzt.« Sie kletterte auf seinen Schoß und stieß in ihrer Hast den Karton mit den Lilien von seinem Schreibtisch. Lucan hörte Wasser gurgeln und hob Alisa aus dem Weg. Mit der Spitze seines Schuhs stieß er den Deckel auf. Zwei zerbrochene Teile einer dünnen Terrakottaphiole fielen heraus.
»Es tut mir leid«, sagte Allie, die langsam aus dem Nebel von l’attrait auftauchte und bestürzt auf die Scherben sah. »War das etwas Wichtiges?«
Rostig aussehendes Wasser lief langsam auf den Teppich zu seinen Füßen. Er roch Kupfer – eines der wenigen Dinge auf der Welt, die ihn töten konnten – und sah, dass der Stängel jeder Lilie in dem Karton in einer dünnen, leicht zerbrechlichen Tonphiole mit der gleichen giftigen Flüssigkeit steckte. »Nicht für mich.«
»Ich erzähle Menschen nicht meine Lebensgeschichte«, erklärte Marcella Evareaux, während sie zusah, wie sich die winzige Wunde in ihrer Armbeuge schloss.
»Ich bin kein Mensch. Ich bin Ihre Ärztin.« Alexandra Keller verschloss das Röhrchen voller Blut, das sie der Frau gerade abgenommen hatte, beschriftete das Etikett mit »ME-1« und stellte es aufrecht in ein Gestell mit weiteren Blutproben. Das Turmzimmer in Marcella Evareaux’ viktorianischem Herrenhaus war so groß und spärlich möbliert, dass jedes Wort leicht hallte und Alex das Gefühl gab, in einem Hörsaal zu stehen und nicht in einem Privathaus. »Warum leben Sie hier eigentlich ganz allein?«
»Warum wollen Sie das wissen?«, entgegnete die große, schwarzhaarige Französin, »wenn das nichts mit Ihren Tests zu tun hat?«
Alex zuckte mit den Schultern. »Ich versuche freundlich zu sein. Sie sind erst der vierte weibliche Vampir, dem ich bis jetzt begegnet bin.«
»Die Darkyn sind keine Vampire. Wir sind Vrykolakas.« Marcella legte sich ein graues Samttuch, das einen Ton dunkler war als die schlichten Silberringe, die sie an jedem Finger trug, um die Schultern. Ihre Bewegungen erzeugten einen schwachen Duft von Glyzinien.
»Das wurde mir bereits gesagt.« Vampire reagierten sehr empfindlich darauf, wie man sie nannte. »Was ist Ihr Talent?« Alle Darkyn hatten eine merkwürdige psychische Fähigkeit, mit der sie auf Menschen einwirken konnten. Alex und Jema Shaw, die einzigen Menschen seit dem Mittelalter, die die Wandlung zum Darkyn überlebt hatten, besaßen Fähigkeiten, die bei Menschen und Vampiren funktionierten.
Dunkle Augen funkelten. »Ich bringe die Menschen, die mir zu viele nervige Fragen stellen, nicht um.«
»Ich hoffe, das gilt auch für ehemalige Menschen.« Alex grinste. »Und würden Sie meine beste Freundin sein? Bitte?«
Anstatt sich zu freuen, wurde Marcellas Blick nun verschlossen. »Ich schließe keine Freundschaft mit … Frauen.«
»Aber das macht wirklich Spaß. Wir gehen zusammen einkaufen, erzählen uns von unseren ehemaligen Freunden, sehen uns Frauenfilme an und leihen uns gegenseitig unsere Klamotten für heiße Dates.« Sie wartete, aber die andere Frau antwortete nicht. »Dann eben nicht. Sie wissen, was das bedeutet. Ich kann Sie dazu zwingen, in einen Plastikbecher zu pinkeln. Oder Sie müssen sich noch mehr nervige Fragen anhören, wie zum Beispiel: Sind Ihnen diese Fangzähne von allein gewachsen oder hat Sie jemand angesteckt?«
»Das war zu einer anderen Zeit, in einem anderen Leben.« Marcella fuhr sich in einer lässigen, verführerischen Handbewegung, die Alex nicht hätte nachmachen können, selbst wenn sie es zehn Jahre vor dem Spiegel üben würde, durch ihre langen schwarzen Locken. »Was spielt das für eine Rolle?«
»Falls Sie sich Sorgen machen, dass ich das ausplaudern könnte, ich kann wirklich den Mund halten«, versicherte ihr Alex. »Fragen Sie Ihren Bruder, er wird sich für mich verbürgen.«
Die Frau schlug in einer lässigen Geste ihre langen Beine übereinander. »Arnauds Meinung von Ihnen war nicht sehr schmeichelhaft, Doktor.«
»Hat er mich eine vorlaute kleine Schlampe genannt, ja?« Alex grinste. »Er hasst einfach jeden. Abgesehen von dem Mädchen draußen in den Sümpfen, zu dem er immer geht.« Als Marcella sie verständnislos ansah, fügte sie hinzu: »Die, deren Vater ihm ständig in den Hintern schießt.«
»Darüber kann ich nichts sagen.« Lange Finger spielten mit den Kristallperlen am Saum des Tuches. »Ich weiß nichts über Sie oder wie Sie zu einer von uns geworden sind.«
Alex’ Wandlung vom Menschen zu einer Darkyn war ihrer Meinung nach der Stoff, aus dem schlechte Seifenopern gestrickt wurden, aber es machte ihr nichts aus, die Geschichte zu erzählen. »Dann haben Sie den monatlichen Newsletter des Jardins nicht bekommen? Ich führte ein ganz normales Leben und arbeitete als plastische Chirurgin in Chicago, als Ihr Boss, der böse Teufel …«
»Der Seigneur.«
»Genau der – mich entführen und nach New Orleans fliegen ließ, wo er mich dazu überredete, ihm das Gesicht zu rekonstruieren. Das tat ich. Er rastete aus, biss mich, gab mir sein Blut und wurde bewusstlos. Seine Schergen brachten mich zurück nach Chicago und ließen mich dort liegen, weil sie dachten, ich würde sterben.« Sie holte tief Luft. »Nur bin ich nicht gestorben.«
Marcella seufzte. »Ich habe Schwierigkeiten, das zu glauben. Wenn das stimmt, dann sind Sie und die andere Frau aus Chicago die einzigen Menschen, die den Wandel überlebt haben, seit …«
»Einem halben Jahrtausend, ja, es war ein bisschen wie der Jackpot im Fangzähne-Lotto«, stimmte Alex zu. »Jedenfalls glaubte ich vier Millionen Dollar später noch mal die wilden Storys des Prinzen der Nacht, kehrte hierher zurück, operierte ein paar seiner gefolterten Freunde, habe mich in ihn verliebt, dämlich wie ich bin, und ließ mich von ihm ganz bis zu Ende verwandeln, um nicht als Laborratte für den König der Schmerzen zu enden.«
»Das wäre dann wohl Richard«, riet Marcella. »Warum sind Sie mit dem Seigneur nach Chicago zurückgekehrt?«
»Da suchten wir nach Thierry Durand. Ich konnte ihm die Beine rekonstruieren, aber mit seinem Verstand sah das ganz anders aus. Er wurde verrückt, nachdem er die Folter der Bruderschaft überlebt hatte, und wir versuchten, ihn vor sich und anderen zu schützen, bis er sich erholt hatte. Aber er entkam. Das war der Punkt, an dem wir Jema Shaw fanden, die andere War-früher-ein-Mensch-wie-ich-und-geriet-in-diese-Scheiße-Frau.« Alex wünschte sich immer noch, sie hätte tausend Dinge in Chicago anders gemacht. »Soweit ich das feststellen konnte, wurde sie als Baby mit Darkyn-Blut infiziert. Aus irgendeinem Grund hat es sie nicht getötet, und dann benutzte ein kranker Mann Drogen und Lügen, um sie dreißig Jahre lang daran zu hindern, sich zu verwandeln.«
Die Frau stützte ihre Hand in ihr Kinn, während sie Alex anstarrte. »Unglaublich.«
»Ekelhaft. Jedenfalls verliebte sich Jema in Thierry – der erholte sich von seinem Wahnsinn draußen schneller als eingesperrt in Michaels Haus –, es gab eine Party, eine Schießerei, einen Schwertkampf, abgehackte Arme und Köpfe, Leute sind gestorben – eben all die Sachen, mit denen sich die Darkyn normalerweise amüsieren. Thierry wurde wieder normal und brachte den verrückten Mann um, der Jema unter Drogen gesetzt hatte. Jema verwandelte sich, ich habe die Überlebenden zusammengeflickt, und dann fuhren wir alle nach Hause.« Alex seufzte. »Irgendwo zwischendrin wurde ich von einem Kupferpfeil in die Brust getroffen, aber das war es so ziemlich.« Sie streckte die Hände aus. »Ta-da.«
»So, so.« Marcella starrte sie für einen Moment an. »Das wäre dann der Grund, warum ich allein lebe.«
Alex lachte, und als sie es tat, mischte sich der Duft von Lavendel mit dem von Glyzinien. Bevor sie den Stimmungswandel der Vampirin ausnutzen konnte, trat ein großer, sehr muskulöser Mann mit hellbraunem Haar und einem Narbengesicht ins Zimmer.
»Hey, Philippe.« Alex begrüßte Michael Cypriens Seneschall mit einem Stirnrunzeln. »Ich dachte, du würdest dir mit Mike in der Stadt die neue Folterkammer ansehen, die die Brüder einrichten.«
Marcellas Augenbrauen hoben sich. »Mike?«
»Sie meint den Seigneur, Madam«, meinte Philippe auf Französisch, das Alex noch immer von Michael lernte, zu Marcella. Zu ihr sagte er in vorsichtigem Englisch: »Wir sind gerade zurückgekehrt und trafen unten Beauregard Paviere. Er möchte mit dir sprechen.«
»Das will er? Ein Vampir – Verzeihung –, ein Vrykolakas, der mit mir sprechen möchte? Das ist neu.« Alex sah Marcella an, während sie ihre Tasche und ihre Blutproben zusammenpackte. »Sie schulden mir eine Lebensgeschichte, wenn ich zurückkomme, um Ihre Adern noch mal anzuzapfen.«
Marcellas Lippen verzogen sich. »Vorausgesetzt, ich bin ein williger Spender.«
Arnauds Schwester begleitete sie nach unten, wo ein großer Mann mit einem langen, ernsten Gesicht, das von zerzaustem braunem Haar umrahmt wurde, in der Eingangshalle auf und ab ging. Er blieb stehen, als er sie die geschwungene Treppe herunterkommen sah, und lief zum Treppenabsatz.
»Sie sind le docteur, oui? Sie werden sofort in meinem Haus gebraucht.« Er war so in Sorge, dass er vor Anspannung zu zittern schien. »Faryl, mein jüngerer Bruder, er ist in ernsten Schwierigkeiten.«
Michael Cyprien, Alex’ Liebhaber, betrat die Eingangshalle. Gerade erst zum Seigneur ernannt, war er der mächtigste Vrykolakas von Amerika und stand allen Jardins in den Vereinigten Staaten vor, weshalb alle Vampire ihn ansahen, sobald er etwas sagte. Alex sah ihn an, weil er normalerweise der heißeste Typ im Raum war und weil er ihr gehörte. »Faryl lebt? Wo war er, Gard?«
Paviere sah beschämt aus. »Das kann ich Euch nicht sagen, Seigneur.«
Alex sah, wie sich Michaels große Gestalt anspannte, und blickte zu Philippe hinüber, der erschrocken aussah. »Was für ein Problem hat Ihr Bruder denn, Mr Paviere?«
»Sein Fleisch verrottet und fällt von seinem Körper.«
»Verrottet und fällt ab?« Nicht noch ein verrückter Vampir. Alex war gerade erst mit so viel Wahnsinn fertig geworden, wie sie in einem unsterblichen Leben ertragen konnte. »Dann wäre Ihr Bruder eine Leiche, und anders als in der Unterhaltungsliteratur kann niemand Tote wieder zum Leben erwecken.«
Beauregard blickte zu Marcella und sagte mit schneller Stimme etwas in einem so alten und merkwürdigen französischen Dialekt, den, da war Alex sicher, kein menschlicher Einwohner des kontinentalen Amerikas jemals gesprochen hatte.
Die Vampirin schüttelte den Kopf. »Faryl ist nicht tot. Gard meint, dass er an Fleischfäule leidet. An …« Sie suchte nach dem nächsten Wort und schnippte dann mit dem Finger. »An Lepra.«
»Unwahrscheinlich«, meinte Alex, »wenn man die spontane Heilung der Darkyn bedenkt.« Sie bemerkte den betroffenen Gesichtsausdruck der anderen drei Vampire. »Oh, kommt schon, jetzt sagt nicht, dass es noch etwas gibt, das ich noch nicht weiß.« Michael hatte bereits vergessen ihr zu erzählen, dass die Darkyn in geschwächtem Zustand auch von anderen Metallen als Kupfer verletzt und getötet werden konnten.
»Ich werde es dir später erklären«, versprach Michael.
»Sie muss mit in mein Haus kommen«, flehte Beauregard den Seigneur an. »Vor dem heutigen Tag hatte ich meinen Bruder zweihundert Jahre nicht gesehen, aber ich glaube, er stirbt.«
»Verrottendes Fleisch tut das mit einem.« Alex blickte in die goldgeränderten türkisfarbenen Augen ihres Geliebten. »Sieht aus, als müsste ich noch einen Hausbesuch machen.«
Michael nickte und wandte sich an den aufgeregten Mann. »Wie kam es dazu, Gard? Warum hat sich Faryl die ganze Zeit vor uns versteckt?«
Paviere ließ den Kopf hängen. »Ich hatte gedacht, er würde es beenden, als er uns verließ, aber wie es scheint, hat er den Glauben behalten. Er hat sich in den Sümpfen ernährt.«
Michael fluchte unterdrückt. »Alexandra, wir müssen uns sofort um Faryl kümmern.«
Philippe fuhr sie von Marcella Evareaux’ Haus am See in den Bezirk Bayou, wo die Dörfer, in denen die Fischer lebten, immer kleiner wurden und der Asphalt schließlich schlammigen kleinen Straßen wich. Gard und Michael wechselten ein paar höfliche Worte, so wie Männer es taten, die sich seit Jahren nicht gesehen hatten, aber es war die Anspannung, die ihr Geliebter ausstrahlte, die Alex den Mund halten ließ.
Aber später würde Cyprien ihr ein paar Antworten schulden.
Die Pavieres lebten auf einer alten Plantage in einem etwas heruntergekommenen Herrenhaus aus Vorbürgerkriegszeiten. Verwitterte, von Kopoubohnen umrankte Marmorsäulen umgaben eine baufällige lange Veranda, und auf den Wiesen um das Haus stand das Gras kniehoch mit Inseln aus blühendem Unkraut darin.
Drinnen, das wusste Alex aus Erfahrung, würde alles makellos sein. Ein leichter äußerer Verfall hielt das Interesse von Touristen und Nachbarn in Grenzen, die sonst vielleicht herausgefunden hätten, dass die Darkyn schon hier lebten, bevor Sherman Atlanta in Schutt und Asche legte.
Eine kleine schwarze Frau in einem wunderschönen geblümten Kleid lief aus dem Haus, als das Auto vorfuhr. »Willkommen in La Moisson, Seigneur Cyprien. Ich bin Ruby, Tresora der Familie Paviere.« Sie neigte den Kopf in Alex’ Richtung und wandte sich sofort an Paviere. »Meister Gard, Meister Faryl ist fort.«
Gards Blick wanderte zu einem der oberen Fenster. »Wie ist er entkommen?«
»Er hat die Riegel an der Tür zerschlagen.« Die schwarze Frau schlang die Arme um sich. »Ich konnte ihn nicht aufhalten.«
Gards Gesichtsausdruck wurde hoffnungslos. »Dann ist es besiegelt. Er geht nach Süden, zu le tueur.« Er legte den Arm um Ruby und ging langsam mit ihr zusammen ins Haus.
»Le was?« Alex blickte die beiden Männer neben sich an. Philippe schüttelte nur den Kopf.
»Le tueur bedeutete ›der Todbringende‹.« Michaels Gesicht wurde völlig ausdruckslos. »Es bedeutet, dass Faryl zu Lucan gegangen ist.«
»Zu dem Typen, der meine Krankenschwester angegriffen hat?« Alex musste das Erschaudern nicht vortäuschen. »Was will er denn von ihm?« Ihre Augen wurden groß, als Michael hinter Gard und Ruby her ins Haus stapfte. »Philippe, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?«
»Faryl sucht Hilfe bei Lucan, anstatt sich an den Seigneur zu wenden.« Der Seneschall verzog das Gesicht. »Das ist eine schwere Beleidigung.«
»Der Typ verrottet. Vielleicht sollten wir es als Gefallen betrachten.« Alex verstand die Situation noch immer nicht. »Und was will er denn überhaupt bei Lucan? Der ist doch kein Arzt, oder?«
»Nein. Faryl geht wegen seines Glaubens zu ihm«, erklärte Philippe leise. »Für Katholiken ist Selbstmord eine Sünde.«
»Ja, die können jeden Verrückten gebrauchen.« Sie rieb sich über den Nacken. »Und was will Faryl von Lucan? Mitleid? Soll er ihm die Beichte abnehmen? Will er sich dort vor seiner Familie verstecken?«
»Nein. Faryl will sich von Lucan töten lassen.«
3
Im dritten Stock eines Apartmenthauses am Palm Royal Place zu wohnen, brachte Samantha Brown drei Dinge: Abgeschiedenheit, Ruhe und den Blick auf einen Kanal anstatt auf ein Wohnhaus. Jeden Tag drei Etagen rauf- und runterlaufen zu müssen, gehörte nicht unbedingt zu den Vorteilen, vor allem an den Tagen, an denen sie eingekauft hatte, aber sie liebte Bewegung.
Um die Ruhe und die Abgeschiedenheit hatte sie allerdings sehr lange kämpfen müssen.
Sam war, ein paar Wochen nachdem Wesley Dwyer ihr neuer Partner geworden war, in ihre jetzige Wohnung gezogen. Sie war gezwungen gewesen, ihre alte Wohnung aufzugeben und sich eine Geheimnummer zuzulegen, als Dwyer anfing ihr nachzustellen, denn er machte ihr Angst, und sie wollte nicht, dass er wusste, wo sie wohnte.
Es gab noch drei weitere Wohnungen auf ihrer Etage. Zwei waren teure Dreizimmerapartments, die sich ältere Ehepaare gemietet hatten, die hier nur ihren Urlaub verbrachten. Die andere Wohnung, die wie ihre über zwei Zimmer verfügte, wurde von Kerianne Lewis bewohnt, einer attraktiven alleinstehenden Blondine, die ihre eigene Computerfirma leitete und genau wie Sam fast nie zu Hause war.
Zuerst hatte Sam versucht, Distanz zu den Nachbarn zu halten. Der Job machte die meisten potenziellen Freundschaften unmöglich, und sie war überzeugt davon gewesen, dass sie mit der hübschen, schicken Keri Lewis so viel gemeinsam hatte wie mit Laura Bush. Dann hatte sie an einem Wochenende Keri mit einem schweren Sessel auf der Treppe entdeckt und ihr geholfen, ihn nach unten zu tragen. Keri hatte sie auf einen Drink in ihre Wohnung eingeladen, und Sam hatte die modern in Rot, Schwarz und Weiß eingerichteten Räume bewundert.
»Wie gefällt es dir, eine Polizistin zu sein?«, hatte ihre Nachbarin gefragt, während sie auf ihrem winzigen Balkon mit Blick auf die andere Hälfte des Kanals Eistee tranken.
Sam zuckte mit den Achseln. »Es ist okay. Ich versuche, mich ins Morddezernat versetzen zu lassen.« Hauptsache weg von Dwyer, der da schon eine wahre Plage geworden war.
»Ich sehe dich nie in Begleitung von Männern«, meinte Keri.
»Keine Zeit.« Und noch weniger Lust, nachdem sie sich Dwyers ständigen Annäherungsversuchen erwehren musste.
»Du könntest deine Frisur ändern.« Sie deutete mit dem Kinn auf Sams Pferdeschwanz. »Dich ein bisschen schminken und schicker anziehen. Du hast eine tolle Figur. Sehr kurvig. Was trägst du, Größe vierunddreißig?«
»Sechsunddreißig. Achtunddreißig, wenn das Top nicht groß genug ausfällt.« Sie schnitt eine Grimasse und sah an sich herunter. »Ich würde das alles eintauschen gegen eine Körbchengröße A und die Chance, mal keinen BH zu tragen.«
Keri kicherte. »Und ich wäre gerne so gebaut wie du. Warum sind wir nur nie zufrieden mit uns selbst?«
Als Sam kurze Zeit später ging, wusste sie nicht mehr über Keri als zuvor, aber von dem Tag an waren die beiden Nachbarinnen wie alte Freundinnen miteinander umgegangen. Keri hatte Sam ein paarmal zum Essen eingeladen, und sie hatten sich zusammen einen Film angesehen. Sam fing gerade an es zu mögen, eine Freundin zu haben, als Dwyer es schließlich zu weit trieb und sie beinahe vergewaltigte, sodass sie eine offizielle Beschwerde im Büro für Interne Angelegenheiten einreichte.
Nach der Befragung, die Sam an jenem Tag durchzustehen hatte, war sie wütend und frustriert gewesen. Einer der IA-Cops hatte ihr, weil sie seine früheren Übergriffe nicht gemeldet hatte, unterstellt, Dwyers Belästigungen »stillschweigend erlaubt« zu haben. Sie war gezwungen worden, vier Tage Urlaub zu nehmen, bis der Fall aufgenommen und untersucht war. Auf dem Weg nach Hause hatte sie eine Flasche Wodka und Orangensaft gekauft, um sich zu betrinken, sobald sie zu Hause war. Als sie Keri auf der Treppe traf, hatte sie diese zu sich eingeladen, um die Katastrophe mit ihr zu feiern.
Keri hatte nicht viel getrunken, aber zugehört, während Sam sich durch vier Screwdriver und zwei Gläser Stoli kämpfte. Schließlich hatte sie ihr den Wodka weggenommen und in den Kühlschrank gestellt.
»Du solltest etwas anderes machen, als hier zu sitzen und wegen eines Mannes unglücklich zu sein«, meinte Keri.
Sam, die sonst nie viel Alkohol trank, hatte ihr erstes richtiges Saufgelage sehr genossen. »Was denn zum Beispiel?«
Was danach passiert war, hatte sie alles über Keri Lewis erfahren lassen, was sie wissen musste, und eine Woche später endete ihre Freundschaft mit einer spektakulären Szene vor Sams versammelten Kollegen. In letzter Zeit ging Keri ihr möglichst aus dem Weg, aber Sam konnte trotzdem nicht an der Tür ihrer Nachbarin vorbeigehen, ohne sich schuldig zu fühlen. Sie hatte zu oft versucht, sich zu entschuldigen, aber das hatte die Situation nur verschlimmert.