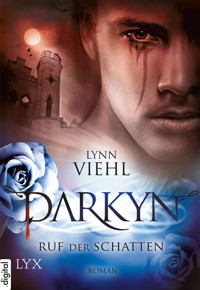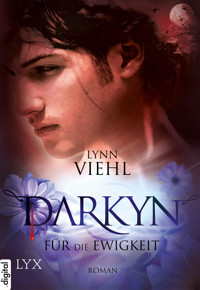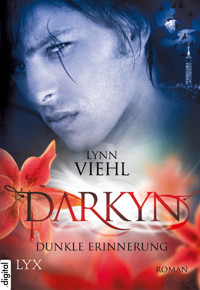4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Spannend und heiß – die HEAT-Romantic-Thrill-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Marc LeClare ist der heißeste Kandidat im Wahlkampf um das Amt des Gouverneurs von Louisiana. Als er bei einem Brand in einem leeren Lagerhaus ums Leben kommt, fällt der Verdacht auf Isobel Duchesne, der einzigen Überlebenden des Feuers. Der Polizist Jean-Delano Gamble übernimmt die Ermittlungen in dem Fall und verhört Isobel. Das brisante an der Sache ist: J. D. und Isobel waren einst ein Liebespaar, das durch unglückliche Umstände getrennt wurde. Als sie einander nun wieder begegnen, lodern die Gefühle erneut hoch. Ein Unbekannter hat es jedoch auf Isobels Leben abgesehen ...
Spannung pur! Die Romantic-Suspense-Reihe von Lynn Viehl - für Fans von Linda Howard und Cynthia Eden.
Band 1: In der Hitze der Nacht
Band 2: Spiel mit dem Feuer
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Ähnliche
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Epilog
Über die Autorin
Alle Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Hat es Dir gefallen?
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:
be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Marc LeClare ist der heißeste Kandidat im Wahlkampf um das Amt des Gouverneurs von Louisiana. Als er bei einem Brand in einem leeren Lagerhaus ums Leben kommt, fällt der Verdacht auf Isobel Duchesne, der einzigen Überlebenden des Feuers. Der Polizist Jean-Delano Gamble übernimmt die Ermittlungen in dem Fall und verhört Isobel. Das brisante an der Sache ist: J. D. und Isobel waren einst ein Liebespaar, das durch unglückliche Umstände getrennt wurde. Als sie einander nun wieder begegnen, lodern die Gefühle erneut hoch. Ein Unbekannter hat es jedoch auf Isobels Leben abgesehen …
LYNN VIEHL
In der Hitze der Nacht
Aus dem amerikanischen Englisch von Nele Junghanns
Prolog
23. Juni 1974
Was zum Henker mache ich eigentlich hier?
Marc LeClare hievte sich aus dem Schlamm und klopfte sich die Vorderseite seiner Kleidung ab. Etwas, das aussah wie vertrocknetes Spinnengekröse, hatte sich um seine Finger gewickelt. Er schüttelte es ab und stellte fest, dass es nur Spanisches Moos war. Der Gestank der schaumigen Schicht auf dem Sumpf stach ihm in die Nase, während das letzte Sonnenlicht durch das Blätterdach der Wacholder- und Eichenbäume schimmerte. Bald würde es dunkel werden, und er war allein.
Allein, verloren und so wütend wie eine Schlange, auf die jemand getreten war.
Louis Gamble und seine Verbindungsbrüder standen wahrscheinlich irgendwo an der Interstate, lachten sich allesamt krank über ihn und tranken das ganze Bier allein aus.
Marc wischte sich das schmutzige Gesicht am Ärmel seiner ebenso schmutzigen Jacke ab. »Diesmal bringe ich sie um.«
Zum Teil war es seine eigene verdammte Schuld. Sein Zimmergenosse hatte schon öfter solche Dinger mit ihm abgezogen, seit sie auf dem College waren, und spätestens als sie die Stadt verlassen hatten und ins Hinterland gebraust waren, hätte er merken müssen, dass etwas faul war. Aber er war sauer auf seine Mutter gewesen, weil sie ihn wieder einmal gedrängt hatte, einen Termin für die Hochzeit festzulegen, und ihm dauernd mit Klagen in den Ohren lag, weil er aus der Football-Mannschaft ausgetreten war. Auch die zwei Bier, die er mit Louis’ Hilfe auf ex getrunken hatte, hatten nichts genützt.
Na los, trink aus. Deine Mama und deine kleine Freundin werden’s nie erfahren.
Louis hatte sie alle überredet, sich in seinen Van zu zwängen und einen Ausflug zu machen, und dann war er nach Westen gefahren, in die tiefste Provinz, über Schotterstraßen, an Truck- Stops und Bootsschuppen vorbei. Marc hatte sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Nicht einmal, als der Transporter mitten in der Pampa stehen geblieben war, hatte er Verdacht geschöpft.
Zu viel Bier, zu wenig Grips.
Scheiße,ichhabdocherstletztesWochenendenachdemÖlgeguckt.Wie immer hatte Louis seine Mimik perfekt beherrscht, als er sich zu ihm umdrehte. GehdochmalrausundziehdenStabraus,Marc.Ichschwöre,wennauchnureineinzigesschwarzesTeilchendranhängt,lassichdiesenSchrotthaufenin Flammenaufgehen.Sein Freund hatte gewartet, bis Marc vor der Motorhaube stand. Dann hatte Louie den Rückwärtsgang reingehauen, den Motor aufheulen lassen und den Kopf aus dem Seitenfenster gestreckt, um ihn lauthals zu verhöhnen. ImmernochdummwiezehnMeterFeldweg.Bisspäter,LeClare.
Er hätte an der Straße bleiben sollen. In ein paar Stunden wären sie zurückgekommen. Wie immer. Aber heute Abend hatte er keine Lust gehabt zu warten, und dann hatte er in den Sümpfen ein Licht gesehen. Er war betrunken genug, um zu glauben, wo ein Licht war, gäbe es auch ein Haus, und vielleicht ein Telefon, von dem aus er Louis anrufen konnte – und dann hatte er das Licht aus den Augen verloren und den Weg zurück zur Straße nicht mehr gefunden –
Es knackte hinter ihm. Er fuhr herum, die Hände zu Fäusten geballt. »Scheiße, Louie, wo wart ihr Wichser denn? Ihr kriegt verdammten Ärger, mich einfach hier am Arsch der –«
Es war nicht sein Mitbewohner, sondern ein junges Mädchen, das halb im Schatten stand und ihn aus riesigen dunklen Augen anstarrte.
Sie war wie vom Donner gerührt, weil sie jedes schmutzige Wort gehört hatte, das er gerade gebrüllt hatte. »Äh, hi. Sorry, ich dachte du wärst – ich wollte dich nicht erschrecken.«
Das Mädchen blieb, wo es war, und beobachtete ihn. Ihre nackten Füße waren schlammverschmiert, aber ihr schäbiges Kleid war sauber. Der Schweiß ließ ihren viel zu langen, dunklen Pony, der ihr über die Augen hing, noch dunkler wirken. Ihr Haar war zu einem kurzen Pferdeschwanz zusammengebunden. In ihrer rechten Hand baumelte eine leere Flusskrebsfalle.
Marcs Blick wanderte von der Falle zu den Knöpfen ihres Kleides gleich unterhalb ihres Schlüsselbeins. Nach den Wölbungen zu urteilen, die die Knopflöcher seitlich auseinanderdehnten, konnte sie alles zwischen dreizehn und sechzehn sein. Was ihm nicht in den Kopf ging, war, warum er das Gefühl hatte, sie zu kennen. Fast so, als wären sie sich schon einmal begegnet, aber andererseits auch nicht. Es war jedenfalls kein besonders beruhigendes Gefühl.
Sie merkte, wo er hinstarrte, und wich misstrauisch einen Schritt zurück.
»Warte.« Aus Angst, dass sie verschwinden könnte, machte er einen Satz die Böschung hinauf zu ihr hin, rutschte aus und wäre beinahe mit dem Gesicht im Matsch gelandet. »Scheiße, warte! Bleib hier, ich brauche Hilfe.«
»Hast du dich verlaufen, Junge?«
Sein Trainer Lewis hatte ihn Junge genannt. Junge, aus dir wird nie ’n Quarterback. Tu der Mannschaft ’nen Gefallen und schwing deinen zierlichen weißen Kreolenarsch hier raus.
Er verlor den Halt und knallte mit dem Kopf gegen einen tief hängenden Weidenast.
»Scheiße!« Er griff sich an den Kopf, der sich anfühlte, als würde er sich gleich in zwei Teile spalten, dann stierte er sie an. »Verflucht noch mal, was glaubst du denn?«
Sie versteifte sich, schlenkerte die Falle in ihrer Hand ein wenig hin und her. »Ich glaube, deine Mama braucht jede Menge Seife, um dir den Mund auszuwaschen. Mach’s gut.«
»He, geh nicht weg.« Er hob die Hand und ließ sie gleich wieder sinken. »Tut mir – tut mir leid, ich hatte einen miesen Tag.«
»Sag bloß.« Sie musterte ihn, und ihre ernste Miene hellte sich ein klein wenig auf. »Woher kommst du?«
Ihre merkwürdig leiernde Art zu reden veranlasste ihn, sie noch einmal genauer zu betrachten. Konnte sie eine Cajun sein? Er hatte seine Mutter sagen hören, sie seien nichts wert und ungebildet und würden alles stehlen, was nicht niet- und nagelfest war. Aber dieses Mädchen sah weder dumm noch kriminell aus, bloß arm.
»Ich bin Marc. Ich komme aus der Stadt.« Schuldgefühle plagten ihn, als ihm bewusst wurde, wie er auf sie wirken musste – ein großer, finsterer Kerl, über und über mit Schlamm bedeckt, der jeden zweiten Satz mit Schimpfwörtern spickte – also blieb er, wo er war, und versuchte, so harmlos wie möglich zu klingen. »Wie heißt du?«
»Geneviève.«
»Schöner Name.« Wie eine Märchenprinzessin. »Du wohnst hier in der Gegend, stimmt’s?«
»Oui.«
Umso besser – dann kannte sie sich hier aus. »Kannst du mir zeigen, wie ich hier rauskomme?«
Sie dachte darüber nach. So lange, dass er merkte, wie seine Haut unter dem Schweiß zu jucken begann. Endlich deutete sie mit der Hand auf die Bäume. »Dort entlang.«
Er folgte ihr durch hüfthohes Gestrüpp, fort vom Flussufer und bergauf zu den Bäumen. Was hatte sie kurz vor dem Dunkelwerden hier draußen zu suchen? War sie hier, um Flusskrebsfallen aufzustellen? Er musste sich beeilen, weil ihr Vorsprung immer größer wurde, aber da er, im Gegensatz zu ihr, den unebenen Untergrund nicht kannte, fiel es ihm schwer, mit ihr Schritt zu halten.
»Ginny, warte auf mich – du bist zu schnell.«
Sie blieb stehen und wartete, bis er sie eingeholt hatte. Er glaubte, sie etwas über Stadtjungs murmeln zu hören, bevor sie fragte: »Was machst du überhaupt hier mitten im Atchafalaya?«
Sich fühlen und aufführen wie ein Hornochse. »Meine Freunde hatten die glorreiche Idee, mich abzufüllen und hier draußen auszusetzen.«
»Das ist nicht lustig.« Sie nahm seinen Arm und zog ihn um eine große Pflanze mit dunklen Blättern herum. Als er zurückblickte, sah er, dass es ein riesiger Busch Giftefeu war. »Du benimmst dich nicht wie ein Betrunkener.«
»Dazu braucht es schon mehr als ein paar Bier.« Ihre Hand auf seinem Ärmel wirkte so klein. Ihre Fingernägel waren kurz und unlackiert, gerade geschnitten, wie mit einer Schere. Sie roch leicht nach Seife und Sonnenschein, was ihm bewusst machte, wie furchtbar er stinken musste. »Wie alt bist du?«
»Siebzehn im nächsten Monat.« Sie neigte den Kopf zur Seite. »Gehst du aufs College in der Stadt, Marc?«
»Ja, ich bin im zweiten Jahr.« Er hasste es. »Ich bin neunzehn.«
»Mein Cousin Darel ist auch neunzehn.« Sie machte eine Handbewegung zur anderen Seite des Bayou. »Er geht zwar nicht aufs College, aber dafür verläuft er sich nie.«
»Ich war noch nie im Sumpf.« Er hatte das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, und klopfte sich wieder auf die Jacke. »Wohnst du bei deinem Cousin?«
»Nein.« Sie zeigte an ein paar Eichen vorbei auf ein schwach schimmerndes Licht. »In dem Haus da oben wohne ich.«
Als sie näher kamen, sah Marc, dass das Haus kaum mehr als eine mit Dachschindeln gedeckte Baracke war. Sie lag ein paar Meter abseits eines kleineren Arms des Atchafalaya, zusammengekauert unter zwei uralten, knorrigen Eichen. Wie passte eine ganze Familie in einen solch winzigen Unterschlupf? Selbst der Geräteschuppen hinter dem Haus, in dem er wohnte, war größer.
»Du wohnst bei deinen Eltern?«
»Oui. Papa stellt Fallen auf und angelt, und Mama verkauft Köder an die Angler, die herkommen. Und ich auch.« Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich, während sie ihn betrachtete. »Was ist denn? Magst du keinen Fisch?«
Er versuchte sich vorzustellen, wie seine vornehme Mutter Fischköder verkaufte. Nicht einmal, wenn man sie unter Drogen setzen würde. »Doch, sehr gern sogar.« Er warf einen Blick auf das Haus und dachte an die anderen Gerüchte, die er über die Cajuns am Bayou gehört hatte. Manche behaupteten, die Männer würden zuerst schießen und dann Fragen stellen. »Meinst du, dein Dad ist angepisst – äh, sauer –, wenn er dich mit mir sieht?«
Sie schüttelte den Kopf. »Du hast doch nichts falsch gemacht. Papa bringt dich in die Stadt zurück.«
Na hoffentlich. Marc hatte keine Lust, sich erschießen zu lassen. Und er wollte nicht, dass seine Mutter Wind von diesem Schlamassel bekam. Außerdem musste er es Louie und seinen Verbindungsbrüdern noch heimzahlen. Und zwar ordentlich.
Aber all diese aufwühlenden Gedanken verebbten wieder, als die letzten Sonnenstrahlen auf Geneviève trafen. Sie hatte weiße, makellose Haut, die ihre Augen beinahe schwarz erscheinen ließ. Und ihr Haar … Gott, ihr Haar war atemberaubend.
Nicht eines der Mädchen, die er gekannt hatte, sah aus wie sie. Klang wie sie. Duftete wie sie. Sie war so exotisch und fehl am Platz wie ein Schmetterling auf einer Müllhalde. Das Gefühl, sie zu kennen, überkam ihn wieder, doch diesmal zusammen mit einem heißen Begehren. Wenn seine Hände nicht so schmutzig gewesen wären, hätte er sie berührt.
»Kommst du auch mit?«
»In die Stadt?« Sie lachte auf. »Warum sollte ich?«
Er fand eine saubere Stelle an seiner Jacke und wischte sich die Hand ab, bevor er nach der ihren griff. Sie hatte feine Schwielen auf der Handfläche, ihre Hand war fest und kräftig. Und in diesem Augenblick wusste er es, so sicher, als könne er in die Zukunft sehen. Es war ihnen bestimmt gewesen, sich zu begegnen. Sich zu berühren.
Sie war es.
Ich werde dieses Mädchen heiraten. »Ich würde mich gern noch weiter mit dir unterhalten.«
1
Heute
»Wow.«
Isabel Duchesne schloss die Tür hinter sich, betrat das leere Lagerhaus und ließ die Dimensionen der Hauptetage und die Fensterreihen zu beiden Seiten des Gebäudes auf sich wirken. Nachdem sie seit fast einem ganzen Jahr nach einer Unterkunft für ihr Gemeinschaftszentrum gesucht hatte – ohne Erfolg –, konnte sie kaum glauben, dass all das bald ihr gehören würde.
Es ist das Mindeste, was ich für dich tun kann, Sable, hatte Marc LeClare gesagt, nachdem er ihr angeboten hatte, ihr sein Grundstück mit dem leer stehenden Lagerhaus für ihr Projekt zu überschreiben. Was meinst du, wie gut mich das in den Umfragen dastehen lässt.
Sie wusste noch, wie sie sein ansteckendes Grinsen erwidert hatte. Solange du es dir nicht zurückholst, sobald du zum Gouverneur gewählt bist.
Marc hatte erwähnt, dass ein Tischler das Lagerhaus für einige Jahre gemietet hatte, was den leichten Geruch nach Kiefernholz erklärte, der immer noch in der Luft hing. Die Spinnweben, das alte Sägemehl und die leeren Regalreihen aus Stahl würden weichen müssen, aber der riesige, offene Raum war ideal.
Mehr als ideal – er war perfekt. Und er gehörte ihr.
Sable musste vor Freude unwillkürlich lachen, während sie sich einmal um sich selbst drehte und alles betrachtete. Sie hatte sich schon damit abgefunden, all ihre Sachen in den winzig kleinen Raum zu quetschen, den sie sich bestenfalls finanziell würde leisten können, und nun hatte sie Platz genug für einen Empfangsbereich mit Aufnahmeschaltern, Büros für sich und die freiwilligen Mitarbeiter, die sie anwerben wollte, und vielleicht sogar einen Bereich für medizinische Untersuchungen schwangerer Frauen und kleiner Kinder.
»Also, meine Stimme ist dir sicher, Marc«, murmelte sie in sich hinein, während sie durch die Hauptetage schlenderte. Oben im Dachgeschoss gab es Lagerräume, für die sie bestimmt auch eine Verwendung finden würde. »Das ist fast zu schön, um wahr zu sein.«
Genauso wie Marc.
Sie verzog unwillkürlich das Gesicht, als sie daran dachte, wie unwohl sie sich bei ihrem letzten Treffen in ihrer Haut gefühlt hatte. Wie schwer sie sich damit getan hatte, was sie sagen, wie sie sich verhalten sollte, und vor allem, wie sie mit ihren neuen Gefühlen umgehen sollte. Sie war sich nicht einmal sicher gewesen, ob sie überhaupt eine Beziehung zu ihm aufbauen wollte.
Marc dagegen war so glücklich gewesen, dass ihm alles egal zu sein schien, wenn sie nur zusammen waren. Er hatte ihr aufmerksam zugehört, sie eingehend betrachtet und sie behandelt, als sei sie das Wertvollste auf der Welt. So wichtig und bewegt sein Leben auch sein mochte, er hatte ihr gesagt, sie käme für ihn jetzt an erster Stelle.
Hoffentlich enttäusche ich ihn nicht.
Sie blickte auf ihr Kostüm hinunter. Es war streng geschnitten, anthrazitgrau mit blütenweißem Besatz. Zieh dich an wie so ’ne Anwältin bei Ally McBeal, hatte ihre Cousine Hilaire ihr geraten, und du fällst überhaupt nicht auf in der Meute. Sie hatte sich unter reichen, mächtigen Menschen nie besonders wohlgefühlt, aber Marc würde ihr helfen – das hatte er ihr versichert.
Sie sind auch nicht besser als alle anderen, Isabel. Und außerdem wissen sie jetzt, dass du zu mir gehörst.
Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien in New Orleans war heutzutage so groß, dass einem oft nichts anderes übrig blieb, als etwas abzureißen oder aufzustocken, um an bezahlbaren Raum zu kommen. Da Sables Programm ausschließlich durch Benefizveranstaltungen und andere private Spenden finanziert wurde, hatte sie sich weder die eine noch die andere Möglichkeit leisten können.
Lass die Finger von den Städtern, hatte ihre Tante gesagt, als Sable ihr von Marcs Angebot erzählt hatte. Caine hat recht – denen ist doch egal, was aus uns wird.
Ihr Lächeln erstarb, als ihr das wieder einfiel, und auch, was Caine Gantry getan hatte, um ihr Projekt zu sabotieren. Wie die meisten anderen Cajuns am Atchafalaya war er mit seiner gesamten Mannschaft bei Sables erster Planbesprechung in der St. Mary Church aufgetaucht. Die Fischer hatten schweigend ganz hinten in der Kirche gestanden, ihrem Vortrag zugehört, sich aber nicht an der Diskussion über das Projekt beteiligt.
Als Sable fertig gewesen war, war Caine als Erster nach vorn gegangen, hatte aber das Unterschriftenblatt ignoriert, das sie ihm hinhielt. Er hatte sich vor ihr aufgebaut und ihr dann ganz ruhig die Liste aus der Hand genommen und zerrissen.
WirkönnenaufdeineWohltätigkeitenverzichten.Unddarauf,dassdeineFreundeausderStadthieraufkreuzenundrumschnüffeln.
Was soll das, Caine? Sie sah ihn an, dann seine Leute. Sie wusste, dass sie mit den Verantwortlichen des Department of Fish and Game um neue Genehmigungsverfahren und Ausrüstung kämpften, und jeder Zweite von ihnen nebenbei in illegale Schmuggelgeschäfte und wer weiß was noch verwickelt war. Habt ihr denn etwas zu verbergen?
Er hatte sich über den Tisch gebeugt, und seine Augen waren genauso kalt wie seine Stimme gewesen. Geh zurück nach Shreveport, Isabel. Du gehörst nicht mehr hierher.
Die Gegensätze ihrer alten Verbundenheit mit der Cajun-Gemeinschaft und ihrer neuen Beziehung zu Marc LeClare kamen ihr zu Bewusstsein. Der künftige Gouverneur von Louisiana schien bereit, eine Menge ihretwegen in Kauf zu nehmen, aber Caine Gantry hatte sich bereits als großes Hindernis erwiesen. Und das würde auch die Presse, wenn sie erst Wind von der Sache mit ihr und Marc bekam. Dann wären sie alle beide zum Abschuss freigegeben.
Wie oft musst du dir noch die Finger verbrennen, bis du’s endlich lernst, Kind?, hatte ihre Tante sie bekniet. Du gehörst nicht in die Stadt.
Es stimmte, dass sie jahrelang nicht in New Orleans gewesen war, nicht seit sie von der Tulane University an die Louisiana State gewechselt hatte. Nicht seit der Nacht des »Summer Magnolias«-Balls – der absolut schrecklichsten Nacht ihres Lebens.
Na, Cajun-Schlampe? Wo ist denn dein Freund?
Schiss, dass er dich für eine mit Schuhen abserviert?
Vergiss deine Corsage nicht!
Und dann das Gelächter, das grausame Gelächter, das nach all den Jahren immer noch in ihrem Kopf nachhallte …
Nein. Sie weigerte sich, auch nur eine Sekunde länger über Jean-Del und die Demütigungen, die sie seinetwegen erlitten hatte, nachzugrübeln. Das ist Vergangenheit. Jetzt ist alles anders. Dank Marc. Ich brauche keine Angst mehr vor diesen Leuten zu haben.
Ein Geräusch, das von oben kam, riss sie aus ihren Gedanken. Es klang wie das Schlurfen von Schuhen.
»Hallo?« Ihre Stimme dröhnte durch die Leere, sie zuckte zusammen und senkte sie ein bisschen. »Marc, bist du da oben?«
Ein Husten war zu hören, dann: »Ja.«
»Ich komme hoch.« Sable nahm ihre Handtasche wieder an sich und stieg die Treppe hinauf. Die schmiedeeiserne Konstruktion quietschte unter ihrem Gewicht, und sie griff nach dem Geländer. »Huch. Tolles Gebäude, aber ich glaube, wir brauchen eine neue Treppe.« Als sie oben angekommen war, konnte sie nichts sehen als undeutliche Umrisse und Schatten. »Marc? Kannst du das Licht anmachen?«
Etwas rührte sich und machte ein schabendes Geräusch, aber das Licht ging nicht an.
»Ist eine Sicherung rausgeflogen?« Ein schwacher, unangenehmer Geruch ließ sie die Nase rümpfen. »Weißt du, wo der Stromkasten ist?« Als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, legte sie ihre Handtasche wieder ab und bewegte sich zaghaft in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Dieser Geruch – Benzin und … Fisch?– wurde stärker.
»Marc? Alles in Ordnung? M-«
Ihr Fuß stieß gegen einen Widerstand, und sie fiel nach vorne. Sie streckte automatisch ihre Arme vor, als sie auf allen vieren neben etwas Großem, Festem in einer Lache klebriger Flüssigkeit landete. Ein noch beißenderer, fürchterlicher Gestank drehte ihr den Magen um. Über ihr gingen flackernd die Lichter an.
Sie kniete in einer dunklen Blutlache. Direkt neben dem Körper eines Mannes.
Er lag mit dem Gesicht nach unten, und ihre weit aufgerissenen Augen starrten auf sein kurzes silbernes Haar. Ein breiter, tiefer Spalt entstellte seinen Hinterkopf, und das Haar war schwarz von geronnenem Blut.
»Oh Gott.« Sie packte ihn, drehte ihn hektisch mit blutigen Händen um und schüttelte fassungslos den Kopf. »Nein, nicht du. Nicht –« Sie verstummte.
Marc LeClares Gesicht war kalt und leblos, und seine gütigen braunen Augen starrten blind zur Decke hinauf.
Sable wischte sich mit ihrer Bluse das Blut von der Hand, bevor sie die Fingerspitzen seitlich an seinen Hals presste. Seine Haut fühlte sich klamm und kühl an, und sie spürte keinen Puls.
Er war tot – und zwar schon eine ganze Weile.
»Gott, bitte, nein.« Sie rappelte sich auf, aber ihre Knie zitterten so sehr, dass sie beinahe wieder hingefallen wäre. Die Galle stieg ihr die Kehle hoch, und sie schluckte, während sie wild um sich blickte.
War er gestürzt? Was hatte ihn so zugerichtet? Wer –Sie sah zu den Lampen hoch und wich langsam zurück zur Treppe. Der Geruch nach Benzin und Fisch wurde stärker.
Wer immer das getan hat, hat auch das Licht angemacht. Hat mich hier hochgerufen.
Etwas kam aus der Dunkelheit auf sie zugeflogen, prallte gegen ihren Kopf, und sie fiel wieder zu Boden. Bei dem Versuch, sich wieder hochzustemmen, rutschte sie in dem Blut aus. Der Gestank nach Fisch und Benzin und Tod raubte ihr den Atem. »Halt – bitte nicht –«
Ein zweiter Schlag schleuderte sie unerbittlich in die Dunkelheit.
Das war verdammt schnell gegangen. Billy Tibbideau griff sich in den Schritt und rückte sich die Eier zurecht. Sie fühlten sich an, als würde ihr Inhalt gerinnen, und auf dem Rücken seines grünen T-Shirts mit der Aufschrift Gantry Charters bildete sich ein breiter Streifen aus Schweiß. Er hatte noch nie eine Frau geschlagen, und das schlechte Gewissen schnürte ihm die Brust zu.
Leg nie im Ärger Hand an eine Frau, Billy, hatte Caine zu ihm gesagt, immer und immer wieder. Du bist ein Mann. Du bist stark. Sie sind schwach.
»Ich musste es tun.« Billy Tibbideau umrundete die bewusstlose Frau und den Toten. »Was kommt die auch her und schnüffelt rum?«
Die verdammten Frauen sind Gottes Strafe für die Männer. Das sagte sein Vater immer. Als er klein gewesen war, hatte sein Vater sich halb totgearbeitet, damit sie ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen auf dem Tisch hatten. Aber hatte seine Mutter es ihm je gedankt? Nein, Sir, sie lag ihm in den Ohren, sobald er einen Fuß ins Haus gesetzt hatte, jammerte herum, weil er trank oder wegen Geld oder wegen Billy, bis sein Daddy ihr eine mit dem Handrücken verpassen musste, damit sie still war.
Laut William Tibbideau senior konnte man mit Frauen sowieso nichts anderes anfangen, als sie zu verprügeln oder zu vögeln – und um sie im Zaum zu halten, musste man beides reichlich tun. Caine verprügelte sie zwar nicht, aber er vögelte viel.
Die Enge in Billys Brust weckte in ihm den Wunsch, auf die Frau einzutreten, aber stattdessen kauerte er sich hin, um ihr ins Gesicht zu blicken, und sah es zum ersten Mal deutlich. »Ach du Scheiße.«
Es war Isabel, Remy Duchesnes Tochter. Die, die den halben Bayou mit ihrem Weltverbesserer-Quatsch in Aufruhr versetzt hatte. Remy hätte schon vor Jahren Vernunft in sie hineinprügeln sollen, aber der Alte hatte seine Frauen noch nie unter Kontrolle gehabt.
Frauen schlägt man nicht, hallte Caines Stimme in Billys Schädel nach.
Hatte sie sein Gesicht gesehen? Hatte sie ihn erkannt?
Billy warf den Austernhammer weg, mit dem er sie k.o. geschlagen hatte, und trat zum Fenster, um einen Blick nach unten in die dunkle Seitenstraße zu werfen. Es war niemand zu sehen, aber er musste sich sputen, wenn er den Job zu Ende bringen wollte. Nicht, dass er es musste – er konnte seine Hände in Unschuld waschen und einfach gehen. Aber dann würde er nicht an das restliche Geld kommen.
Er hatte sich dieses Geld verdient, und sogar mehr als verdient.
Die Halbliterflasche Jack Daniel’s, die er in der Tasche hatte, war fast leer. Er trank sie aus und wischte sich mit dem Ärmel über den Mund. Das schlechte Gewissen ließ ein kleines bisschen nach. Auf dem Heimweg würde er als Erstes bei einem Schnapsladen haltmachen, um sich ein paar Dreiviertelliterflaschen zu besorgen. Seiner Frau würde das nicht gefallen, aber im Gegensatz zu seiner Mutter wusste Cecilia es besser, als ihm Widerworte zu geben, wenn er schlechte Laune hatte.
»Kein Ding. Fackel den Laden ab, Billy, und das war’s.« Er schnappte sich die Kiste mit Flaschen, die er mitgebracht hatte, und trug sie zur Treppe. »Von wegen, das war’s.«
Die beiden leblosen Körper änderten alles – sie mussten mit dem Gebäude zusammen verbrennen. Er würde keine Mordanklage riskieren, nur weil Remys Tochter sich nicht aus anderer Leute Angelegenheiten heraushalten konnte. Mit seinem Feuerzeug zündete er den in drei Flaschen gestopften Stoff an und warf sie in die Ecken des Dachgeschosses. Sobald sie zerschellten, setzte der Stoff das Benzin darin in Brand.
Nichts wie weg. Er schleppte die Kiste die Treppe hinunter und schlüpfte hinaus in die Seitenstraße, dann warf er die restlichen Flaschen durch die Fenster, bevor er hinaufblickte, um das obere Stockwerk brennen zu sehen.
In einer Spalte zwischen den Brettern vor den Fenstern erschienen blutige Finger. Sie krallten sich an die Kante und zerrten daran.
Sie lebte. Sie versuchte zu entkommen.
»Hat sich tot gestellt, die hinterfotzige kleine Schlampe.« Billy rannte auf die andere Seite des Hauses und sah sich von der Ecke aus auf der Straße um, ehe er sich zur Vorderseite des Lagerhauses schlich. Aus den Fenstern würde sie nicht klettern können, aber wenn sie es die Treppe hinunterschaffte –
Isabel kannte Caine. Sie würde es Caine erzählen.
Seine Hände zitterten, als er hektisch seine Taschen durchwühlte, dann fand er den Schlüssel, den er bekommen hatte. Er steckte ihn ins Schloss und drehte ihn um, aber er wendete zu viel Kraft an, und der Schlüssel brach in der Mitte ab. »Verdammte Scheiße.« Er versuchte, das abgebrochene Stück herauszuziehen, aber es klemmte, genauso wie das Schloss.
Die Vollidioten von der Feuerwehr würden es nicht merken, entschied Billy. Hitze und Qualm traten aus den Fenstern im Erdgeschoss. In wenigen Minuten würde das ganze Gebäude in Flammen stehen. Das Wichtigste war, dass Isabel da nicht lebend herauskam. Und ihn nicht bei Caine verpetzte.
Ihm war fast, als könne er spüren, wie sich ihm die große Hand seines Vaters auf die Schulter legte. Eine nörgelnde Zicke weniger auf der Welt – gut gemacht, mein Sohn.
Dem Feuer zuzusehen und sich vorzustellen, wie die Frau da drin verbrannte, vertrieb das letzte bisschen schlechtes Gewissen. Aus irgendeinem Grund hatte er einen knallharten Ständer. Aber damit konnte er leben. Sobald er zu Hause war, würde er Cecilia nageln. Als er das ferne Geräusch einer näher kommenden Sirene hörte, sprintete er um das Gebäude herum nach hinten, wo er seinen Transporter geparkt hatte.
Billy stieg ein, startete den Motor und rieb sich mit der Handfläche den Schritt. Sein Schwanz war so hart, dass er es vielleicht gar nicht mehr bis nach Hause schaffte. Er würde einfach ein Stück vom Gebäude entfernt parken und zusehen, wie es brannte.
Nur um auf Nummer sicher zu gehen.
»Würdest du mir vielleicht mal erklären, warum wir auf einen Feuernotruf reagieren?«
J.D. Gamble warf seiner Partnerin Therese Vincent von der Seite her einen Blick zu. »Das Lagerhaus gehört Marc LeClare.«
»Aha.« Terri beobachtete eine Mutter, die an der Ampel vor ihnen Zwillinge in einem Doppelbuggy über den Zebrastreifen schob. »Cort mal wieder beschäftigt?«
J.D. nickte. »Brandsicherheitskonferenz in Biloxi.«
»Hat er angerufen?«
Die Ampel wurde grün, und er überquerte die Kreuzung. »Ja.«
»Also lässt Cort uns seinen Job machen, als Gefälligkeit für den College-Kumpel von deinem Dad.« Sie schüttelte den Kopf. »Das ergibt absolut Sinn. Sollen wir hinterher noch auf der Feuerwache vorbeifahren und seine Berichte für ihn schreiben?«
»Cort kann besser tippen als du.«
»Jeder Affe kann besser tippen als ich.« J.D.s Partnerin begutachtete ihre auffallend kurzen Fingernägel. Sie ließ sie nicht länger werden, damit sie nicht darauf herumkauen konnte. »J.D., habe ich dir in letzter Zeit mal gesagt, dass dein Bruder ein Arschloch ist?«
Um seinen Mund zuckte es. »Des Öfteren.«
Obwohl es erst acht Uhr morgens war und die meisten Geschäfte noch geschlossen hatten, waren schon ein paar Frühaufsteher unterwegs. Als er Richtung Bienville Street abbog, entdeckte J.D. ein Pärchen mit Federmasken, das Kaffee aus Styroporbechern trank und durch das filigran gearbeitete Eisengitter vor dem Schaufenster eines Antiquitätengeschäfts spähte. Selbst wenn nicht gerade die größte Party des Planeten im Gange gewesen wäre, hätte niemand den maskierten Touristen besondere Beachtung geschenkt. Im Vieux Carré war der Mardi Gras ein Ganzjahresgeschäft.
Terri holte eine Zigarette hervor, ließ aber das Fenster zur Hälfte herunter, bevor sie sie anzündete. Einer der Touristenläden spielte schon Zydeco-Musik, und die spritzigen kleinen Riffs hallten über die fast leere Straße. »Schmeißen deine Leute nächstes Wochenende wieder ihre übliche Soiree?«
Die alljährliche »Noir et Blanc«-Gala, die seine Eltern am Wochenende nach Beginn des Mardi Gras auf ihrem Anwesen im Garden District gaben, war ebenso legendär wie das Restaurant seines Vaters. Obwohl die Touristen jeden Tag scharenweise in das Krewe of Louis strömten, um sich etwas von der rein französischen Speisekarte zu bestellen, war das Familienfest auf fünfhundert prominente Mitglieder der vornehmsten Familien von New Orleans begrenzt. Die Kleiderordnung war streng beschränkt auf zwei Farben – Schwarz und Weiß –, und viele der Freundinnen seiner Mutter flogen jedes Jahr nach Paris auf der Suche nach neuen Ideen, mit denen sie bei der Klatschpresse Eindruck schinden konnten.
»Na klar. Evan und seine Frau fliegen am Freitag aus Montana ein.« Er musterte seine Partnerin. »Meine Mutter hat dir doch eine Einladung geschickt, oder etwa nicht?«
»Was, nein. Ach du meine Güte.« Terri gab sich in gespieltem Bedauern einen Klaps auf die Wange. »Sie muss wohl in der Post verloren gegangen sein.«
Er wusste, was Elizabet machen würde, wenn er sie darauf ansprach – wild mit den Händen herumfuchteln und eins der Dienstmädchen dafür verantwortlich machen. »Dann lade ich dich hiermit ein. Komm vorbei, dann kannst du Evans Frau Wendy kennenlernen. Du wirst sie mögen.«
»Nein, danke.« Sie strich sich über ihr kurzes braunes Haar, dann zog sie ihren anthrazitfarbenen Blazer zurecht. »Meine Garderobe ist einer Party deiner Mama einfach nicht gewachsen.«
»Macht doch nichts.«
»Au contraire, mein Lieber. Wenn du in einem Raum voll weißer Designer-Seidenroben die einzige Frau bist, die bügelfrei trägt, macht das definitiv etwas.« Der Geruch von brennendem Holz wehte ins Auto, und Terri spähte durch die Windschutzscheibe auf den schwarzen Qualm, der immer noch in gewaltigen Rauchsäulen in den Himmel aufstieg. »Da ist es.«
Nachdem er die Polizeisperren hinter sich gebracht hatte, parkte J.D. abseits des Geschehens, einen Block hinter dem Löschfahrzeug. Rote, blaue und weiße Blinklichter erhellten die dunstige Luft wie Disco-Stroboskope. Die Hitze drang in unsichtbaren Wellen durch den Rauch hindurch und verscheuchte jeden, der dem Feuer zu nahe kam. Feuerwehrleute richteten von allen Seiten Schläuche auf das Gebäude, aber es war ganz offensichtlich nicht mehr zu retten. Der Gestank nach nassem, verkohltem Holz und dem Chemieschaum, den sie auf ein ausgebranntes Auto neben dem Gebäude gesprüht hatten, fügte der ohnehin schon dicken Luft noch eine unangenehme Schwere hinzu.
Terri stieg mit J.D. aus und schlug die Autotür zu, während sie sich einen Überblick verschaffte. »Ich hoffe, dieser Typ ist gut versichert«, sagte sie und deutete mit dem Kopf auf das Auto, bevor sie die anderen Gebäude in Augenschein nahm. »Keine besonders gute Stelle für ein Lagerfeuer – der ganze Block hätte in Flammen aufgehen können.«
J.D. ging auf einen Streifenpolizisten zu, der damit beschäftigt war, einen Lagebericht auszufüllen. Der Uniformierte erkannte ihn und ließ sein Klemmbrett sinken. »Lieutenant?«
J.D.s Blick suchte die Menge nach besonders aufmerksamen Gesichtern ab. Die meisten waren Touristen, ein paar von ihnen machten Fotos. »Wie sieht’s aus, Jungs?«
»Sie haben das Feuer fast gelöscht, Lieutenant, doch das Gebäude ist nur noch Geschichte.« Der Beamte grinste. »Aber es ist noch jemand lebend rausgekommen.«
»Glückspilz.« Terri schälte sich aus ihrem Blazer, legte ihn sich über den Arm und zupfte dabei vorne an ihrer Bluse herum. »Muss heiß gewesen sein da drin.«
»Altes Gebäude, ein Haufen Holz«, erklärte er ihr. »Da braucht man nur ein bisschen Benzin und ein Streichholz, und wumm, schon hat man ein Barbecue.«
»Officer. Lieutenant.« Einer der Feuerwehrleute gesellte sich zu ihnen. Auf seiner rußverschmierten Kleidung hatten sich kleine Rinnsale gebildet. »Der Wachmann einen Block weiter behauptet, das Gebäude habe leer gestanden, aber wir haben jemanden da rausgeholt. Wir gehen jetzt rein und sehen nach, ob noch jemand da drin festgesessen hat.«
»J.D. nickte. »Wo ist der Überlebende?«
»Bekommt noch Sauerstoff im Rettungswagen.« Der Feuerwehrmann machte mit dem Kinn eine ruckartige Bewegung nach links.
J.D. sah das zwei Seitenstraßen weiter geparkte Rettungsfahrzeug. Zwei Männer in Sanitäterjacken flankierten eine kleinere Gestalt, die in der Mitte zwischen den beiden offenen Heckklappen saß. Ein Schimmer von dunkelrotem Haar ließ ihn die Augen zusammenkneifen. »Ist das eine Frau?«
»Ja. Und ein echter Hingucker noch dazu.« Der Uniformierte räusperte sich, als Terri ihm einen bösen Blick zuwarf. »Äh, ist laut Zeugenaussagen wohl nicht von hier. Sie hat keinen Ausweis dabei und sagt nicht viel. Ein paar leichte Kopfverletzungen.«
»Schön, dass Ihnen das aufgefallen ist«, sagte Terri gedehnt. »Wo sie doch so ein Hingucker ist.«
J.D. lachte nicht. Zu Terri sagte er: »Fang an, die Leute zu befragen. Ich spreche mit dem Mädchen.«
Sie schnaufte gespielt verächtlich. »Immer sprichst du mit den Mädchen.«
J.D. ließ die Frau mit der Sauerstoffmaske aus Plastik vor Mund und Nase nicht aus den Augen. Sie hatte rote Haare. Ein ungewöhnliches Rot, ein tiefer und reiner Ton, der glühte wie alter Granat. Er kannte nur eine Frau mit dieser ausgefallenen Haarfarbe.
Das kann doch nicht sein.
Er stieg über einen breiten, außerordentlich langen grauen Feuerwehrschlauch und steuerte auf den Rettungswagen zu. Beim Näherkommen bemerkte er weitere beunruhigende Einzelheiten: den zierlichen Körperbau, die blasse Haut, die eleganten Hände mit den langen Fingern. Und weder die nur noch in Fetzen an ihren Beinen herunterhängenden Strümpfe konnten deren wohl geformte Länge verbergen, noch die fünf Zentimeter lange Narbe, die an ihrem rechten Schienbein verlief.
Die Erinnerung traf ihn wie ein Schlag in den Magen.
Alles in Ordnung? Er sah ihr weißes Gesicht vor sich und dass ihr Blut über das Bein lief. Sie war in der Cafeteria hingefallen, direkt neben seinem Tisch. Er hatte ihr aufgeholfen. Du blutest ja –
Einer der Sanitäter sah hoch. »Kann ich helfen, Lieutenant?«
»Nein.« Als er das Blut auf ihrer Kleidung sah, nahm J.D. der Frau die Maske ab. Und obwohl er darauf vorbereitet war, zwang ihn ihr Anblick fast in die Knie. »Sable.«
Große Augen, so dunkel wie Café Brûlot, starrten ihn schockiert an. Sie sagte kein Wort.
Er warf die Maske beiseite, immer noch nicht ganz überzeugt, dass sie real war. Als er die Hand nach ihr ausstreckte, bewegte sie den Kopf gerade so viel, um seiner Berührung zu entgehen – und ihr erstaunter Blick verwandelte sich in einen verärgerten, angewiderten.
Als Reaktion wallte ein rasendes Verlangen in ihm auf, so heiß und stark, dass er am liebsten die Arme um sie geschlungen hätte. Er zwang sich dazu, sie aufmerksam anzusehen, aber er konnte nicht feststellen, woher das Blut kam. »Was ist mit ihr passiert? Wo ist sie verletzt?«
Der Sanitäter hob die Maske wieder auf. »Es geht ihr gut. Sie hat nur etwas zu viel Rauch eingeatmet und den einen oder anderen Schlag auf den Kopf abbekommen. Wahrscheinlich ausgerutscht und hingefallen bei dem Versuch, rauszukommen.«
Er wollte ihr die Kleider vom Leib reißen und sie persönlich untersuchen. »Und das Blut?«
»Die Kopfverletzungen sind keine offenen Wunden. Ich glaube nicht, dass es von ihr stammt.«
J.D. sah einen Anflug von Angst in ihrem Gesicht. »Ist sie hier fertig?«
Der Sanitäter hörte ihre Lunge mit einem Stethoskop ab und nickte dann. »Ja, aber sie muss sich noch einmal gründlicher untersuchen lassen. Vielleicht hat sie eine Gehirnerschütterung.
»Ich kümmere mich um alles.« Er griff nach ihren Armen und spürte, wie sie zusammenzuckte, wie sich die festen Muskeln unter ihrer zarten Haut anspannten. Das letzte bisschen Farbe wich bei dieser ersten Berührung augenblicklich aus ihrem Gesicht, genauso wie damals in der Cafeteria. Ihre dunklen Augen blieben starr auf sein Gesicht gerichtet.
Sie hat Angst. Warum? Es war ja nicht so, dass er sie noch nie berührt hätte. Er hatte sie schon sehr oft berührt. Überall. Jeden Quadratzentimeter von ihr.
Bevor er ihr auf die Beine helfen konnte, tauchte der Streifenpolizist neben ihm auf. »Lieutenant, kommen Sie, das sollten Sie sich mal ansehen.«
Er ließ sie los. »Was ist denn?«
»Sie haben da drin gerade eine Leiche gefunden.« Der Polizist reichte ihm eine verkohlte, aufgeklappte Brieftasche in einem Beweismittelbeutel. »Laut Ausweis ist es Marcus Aurelius LeClare.«
Wie jeder andere Mann auch fickte Billy lieber, als sich einen runterzuholen, aber seltsamerweise hatte er es genossen, in seinem Transporter zu sitzen und sich selbst zu befriedigen, während er das brennende Gebäude beobachtete. Niemand hatte Notiz von ihm genommen, nicht einmal die beiden schaulustigen Alten, die ihren riesigen Lincoln Town Car hinter seinem Transporter geparkt hatten und jetzt draußen standen und gafften. Sie waren gerade mal einen Meter von seinem Fenster entfernt, aber für sie hätte er genauso gut nicht vorhanden sein können.
Obwohl sie ihm das Schauspiel zu verdanken hatten. Ihm, dem unbedeutenden Billy Tibbideau.
Es war komisch. Billy machte seine kleinen Nebenjobs zwar gern, und durch seine Gewitztheit war er auch bisher immer irgendwie davongekommen. Aber dieses Mal erzeugten das Wissen, dass Isabel dort gefangen war und bei lebendigem Leibe verbrannte, und die Tatsache, dass sie das ganz allein ihm zu verdanken hatte, bei ihm ein ganz besonderes Gefühl. Ein Gefühl von Macht.
Und das gefiel ihm.
»Na also, Mädchen«, murmelte er, während seine Faust arbeitete. »Diesmal hab ich dich kleingekriegt, nicht wahr?«
Sein Vergnügen war allerdings nicht von langer Dauer. Es erstarb, sobald er sah, wie ein Feuerwehrmann Isabel Duchesne aus dem brennenden Gebäude schleppte. Als sie auftauchte, hustend und voller Ruß, ließ er augenblicklich von sich ab.
Verdammte Scheiße. Seine Erektion erschlaffte augenblicklich in seiner Hand. Warum zum Geier ist die nicht eingeäschert?
Die alte Dame auf dem Gehweg drehte sich um und starrte ihn an, als wenn sie ihn gehört hätte.
Er stierte missmutig zurück, während er seinen schlappen Penis wieder in die Jeans stopfte und den Reißverschluss hochzog. »Was glotzt du so, du sensationsgeiles Schrapnell?«
Sie machte den Mund auf, um etwas zu sagen, aber dann wechselte ihr Blick zur anderen Seite seines Transporters. Sie packte ihren Mann am Arm und zog ihn zu ihrem Auto zurück.
Billy grinste breit. »Gut so, du solltest lieber –«
Etwas riss an seinem Kopf und ließ ihn gegen das Lenkrad knallen, dann zerrte es ihn quer über die Sitzbank und durch die Beifahrertür.
Der beleibte, dunkle Mann schleuderte ihn gegen die Verkleidung des Führerhauses. »Das verstehst du also unter Arbeiten?«
Billy starrte in Caine Gantrys schwarze Augen. Sein Chef war der einzige Mann, den Billy respektierte – und fürchtete –, mehr als seinen eigenen Daddy.
»Hallo, Caine.« Er warf einen nervösen Seitenblick auf das Feuer. »Ich war – ich habe nur –«
Caine drehte den Kopf und starrte eine Weile auf das in Flammen stehende Gebäude. Mit einem furchterregenden Gesichtsausdruck sah er Billy wieder an. »Du dämlicher Hurensohn.«
Da wusste Billy, dass er sich auf etwas gefasst machen konnte, und tat, was ihm am vernünftigsten erschien: seinem Boss das Knie in die Weichteile zu rammen.
Nur dass Caine sich einen Tick zu früh bewegte und Billys Knie stattdessen seinen Oberschenkel traf. Ebenso gut hätte er auf eine Backsteinmauer treffen können.
Sein Chef lächelte und machte einen Schritt nach hinten. »Danke.«
Caine hatte den Ruf, niemals zuerst zuzuschlagen, und auch nie öfter als ein Mal.
»Es ist nicht so, wie du denkst.« Bei seinem verzweifelten Versuch, Abstand zu gewinnen, wich Billy stolpernd zurück. »Ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin bei der Arbeit, Caine, ehrlich.«
Der Riese kam wieder auf ihn zu. »Bezahl ich dich etwa dafür, dass du hier rumsitzt und dir vor den Augen alter Damen einen abschüttelst?«
Billys Schädel dröhnte vor Wut und Scham, und er schlug noch mal zu, diesmal zielte er auf Caines Bauch und Rippen. Der große Mann stieß ihn einfach zurück und schlug ihm ins Gesicht – ein Mal.
Ein gewaltiger Schmerz explodierte in Billys Kopf, und große dunkle Flecken tanzten vor seinen Augen.
Einen Augenblick später presste Caine ihn mit dem Rücken gegen den Transporter. Er beugte sich über ihn und schnüffelte, dann steckte er die Hand in Billys Gesäßtasche und zog die leere Jackie-Flasche raus.
Er sah Billy in die Augen. »Ich hab dir doch gesagt, was ich mit dir mache, wenn ich dich noch ein einziges Mal beim Trinken erwische, oder?«
Billy schluckte, er schwitzte und zitterte, dann nickte er kurz. »Es wird nicht wieder vorkommen. Es war nur ein Ausrutscher, Caine, nur ein ganz kleiner.«
Die Flasche flog im hohen Bogen auf die Straße und zerschellte.
»Ach, komm schon.« Tränen stiegen Billy in die Augen. »Das kannst du mir nicht antun. Wir sind doch Freunde. Ich habe eine Frau – ich brauche den Job.«
Caine griff in die Brusttasche seines Hemdes, holte ein Bündel Geldscheine heraus und stopfte es Billy in den blutenden Mund. »Mehr leierst du mir nicht aus dem Kreuz.« Er ließ ihn los und machte einen Schritt zurück. »Sieh zu, dass du Land gewinnst.«
Billy spuckte die blutverschmierten Scheine aus und umklammerte sie mit der Hand. »Jetzt sei doch nicht so, Caine. Du und ich, wir können das doch klären. Ich werde mich bessern –«
Der dicke Cajun packte ihn an den Haaren und rammte seinen Kopf gegen die Karosserie, dann ließ er ihn zu Boden fallen. »Ich bin fertig mit dir. Verpiss dich.«
Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Sable saß auf dem Rücksitz des nicht gekennzeichneten Polizeiwagens und versuchte, Ordnung in die Geschehnisse zu bekommen. Marc war tot, und sie wäre selbst fast gestorben. Jemand hatte sie k.o. geschlagen und dann das Lagerhaus in Brand gesetzt.
Um den Mord zu vertuschen.
Warum konnte jemand Marcs Tod wollen? Hatte es mit seinem Wahlkampf zu tun? War es eine Art Attentat gewesen? Sie hatte sich über ihn erkundigt, bevor sie sich kennengelernt hatten, und sie wusste, wie berühmt er war – er galt als Favorit, der die Wahlen mit Leichtigkeit gewinnen würde. Selbst die Presse mochte ihn.
Die Presse.
Die würde bald hier sein und wissen wollen, was passiert war, und sie war die einzige Zeugin. Niemand wusste, wer sie war. Für den Rest der Welt war sie ein Nichts, ein Niemand, irgendeine Wohltätigkeitsfanatikerin mit einem Projekt, für das sich kein Mensch interessierte.
Sie konnte ihnen nicht von ihr und Marc erzählen. Nicht von sich aus. Niemand würde ihr glauben.
»Hübsches kleines Ding«, sagte einer der beiden Polizisten, die draußen neben dem Auto standen, zu dem anderen, und dann glotzten sie sie an. »Zu jung, um die Ehefrau zu sein – vielleicht die Freundin?«
Sie versuchte, die Stimmen nicht an sich herankommen zu lassen, und konzentrierte sich stattdessen auf das, was geschehen war. Sie wusste noch, dass sie die Treppe hinaufgegangen war, diesen fürchterlichen Gestank wahrgenommen und Marc tot vorgefunden hatte. Jemand hatte sie geschlagen, dann ein Schmerz und der Sturz in die Bewusstlosigkeit. Sie war neben Marcs Leiche aufgewacht, inmitten von Flammen. Erst hatte sie versucht, ihn wegzuziehen, aber er war zu schwer gewesen, und das Feuer wütete zu heftig. Sie hatte es zu einem Fenster geschafft, aber es war ihr nicht gelungen, die Bretter davor wegzureißen. Und dann hatte sie sich in das untere Stockwerk vorgetastet. Der dichte, ölige Qualm und die Hitze hatten es unmöglich gemacht, den Weg nach draußen zu finden, und beinahe hätte sie wieder das Bewusstsein verloren.
Ich hätte sterben können da drinnen. Gleich neben Marc.
Der Rest ihrer Erinnerung war bruchstückhaft – sie hatte zu große Angst gehabt. Das Letzte, was sie mitbekommen hatte, war das furchterregende Geräusch der einstürzenden Decke gewesen, und der starke Arm des Feuerwehrmannes, der sie hinausgetragen hatte.
Oh, Gott sei Dank, helfen Sie mir –
Sind Sie verletzt?
Sable blickte an sich hinunter. Marcs Blut war überall. Auf ihrer Bluse und dem Blazer. Auf ihrer Haut, wo es getrocknet war und abblätterte. Und unter ihren Fingernägeln. Für einen Moment wurde ihr schwindelig, und sie hatte das Gefühl, sich übergeben zu müssen.
»Ma’am?« Einer der Streifenpolizisten sah sie mit besorgtem Gesicht an. »Soll ich Lieutenant Gamble holen?«
»Nein, danke.« Sie holte tief Luft und zwang ihre Stimme, fest zu bleiben. »Mir geht’s gut.«
Es ging ihr alles andere als gut. Jean-Delano zu sehen, war genauso ein Schock gewesen wie Marcs Tod. Aber er war nicht mehr ihr Jean-Delano, er war Lieutenant J.D. Gamble, Inspektor der Mordkommission. Einer der Polizisten hatte ihr das gesagt, nachdem Jean-Del sie verlassen hatte, um sich Marcs Leiche anzusehen. Nicht, dass das irgendeine Rolle spielte. Selbst wenn er Bürgermeister von New Orleans gewesen wäre, hätte es keinen Unterschied gemacht. Jean-Del war Vergangenheit, ein Relikt, jemand, dem sie den Rücken gekehrt, den sie vergessen hatte.
Trotzdem hämmerte der Schock, ihn wiederzusehen, weiter auf sie ein, so brutal und gnadenlos wie der Schlag, der sie umgehauen hatte.
Jean-Del, hier. Jean-Del, ein Cop. Sie hatte niemandem ihren Namen gesagt. Woher wusste er, dass ich hier bin?
Die lange, dünne Brünette, die sich ein paar Meter vom Wagen entfernt mit J.D. unterhalten hatte, nahm auf dem Vordersitz Platz und blickte über die Rücklehne hinweg zu ihr nach hinten. Ihr schmales Gesicht wirkte klug, ihre grauen Augen scharfsinnig, und ihre Hände waren von einer seltsamen Schönheit, wie die einer Künstlerin. »Ich bin Sergeant Vincent. Wie geht’s denn so?«
Die unterkühlte Stimme riss Sable aus ihrem Dämmerzustand, aber sie zuckte nicht mit der Wimper, reagierte gar nicht darauf. Sie hatte jahrelang gelernt, sich hinter ihrem eigenen Gesicht zu verstecken, und nun war es an der Zeit, in Deckung zu gehen. »Gut.«
»Schön. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen.« Als sie nickte, holte Sergeant Vincent ein Notizbuch hervor. »Wie lautet Ihr voller Name, Ma’am?«
»Isabel Marie Duchesne.«
Sie notierte ihn. »Isabel, wie lautet Ihre Adresse?«
Sable musste an ihren Vater denken und daran, wie er auf die Nachricht reagieren würde, dass sie beinahe bei einem Brand ums Leben gekommen war. Sie durfte nicht zulassen, dass sie Verbindung zu Remy aufnahmen. »Ich habe keine.«
Die dunklen Augenbrauen der Polizeibeamtin formten sich zu zwei Bogen. »Sie sind obdachlos?«
Was war eine plausible Ausrede? Sie dachte an die Zeitung, die sie, den Anzeigenteil aufgeschlagen, auf dem Vordersitz ihres Wagens hatte liegen lassen. »Ich suche gerade eine Wohnung.« Das war wenigstens nicht ganz gelogen. Sie hatte noch nie sehr überzeugend lügen können, nicht einmal unter den günstigsten Umständen.
»Aber Sie haben doch nicht in dieser Gegend nach einer Wohnung gesucht. Warum sind Sie heute Morgen hierhergekommen, Ms Duchesne?«
»Ich suche außerdem nach Büroräumen.«
Die Brünette klopfte eine Weile mit dem Füller auf dem Notizbuch herum. »Warum erzählen Sie mir nicht einfach, was genau passiert ist, von dem Moment an, als Sie hier angekommen sind?«
Sables Hand, die sich an der Sitzkante festklammerte, begann zu schmerzen. Niemand weiß von uns. Behutsam löste sie die Finger von dem Vinylpolster und legte die Hände in den Schoß. Sie musste ruhig bleiben, einen kühlen Kopf bewahren. Sie brauchte nicht über Marc zu reden. Sie brauchte nichts weiter zu tun, als der Polizei gegenüber eine Aussage zu machen.
Aber J.D. ist die Polizei, erinnerte sie eine fiese kleine Stimme in ihrem Kopf. Und deine Erfolgsbilanz bei ihm ist wirklich beschissen.
Die Polizistin wartete darauf, dass sie etwas sagte. »Ich weiß nicht mehr viel davon.«
Sergeant Vincent sah sie lange an. »Haben Sie Ihr Gedächtnis verloren?«
Sable starrte sie an und wusste nicht, ob das Spaß oder Ernst war. »Es ist nur … alles etwas verschwommen.«
»Tatsächlich?« Sergeant Vincent runzelte die Stirn. »Was haben Sie denn mit Ihren Händen angestellt?«
Sable betrachtete ihre Hände. Einige lange, dunkle Splitter steckten in ihren Handballen. Sie hatte keinen blassen Schimmer, wie sie dahingekommen waren. »Keine Ahnung.«
Ohne jede Vorwarnung schwang sich Jean-Delano hinter das Steuer und knallte die Tür zu. Sable fuhr vor Schreck zusammen.
Nicht Jean-Delano. J.D. Lieutenant Gamble. Nicht vergessen.
Er hatte sich im Lauf der Jahre verändert. Sein Haar war jetzt kürzer, seitlich auf Millimeterlänge geschoren, vermutlich, damit es sich nicht kräuselte. An der Schläfe waren ein paar Silbersträhnen zu sehen. Er war nicht mehr so hager wie auf dem College, seine Schultern wirkten breiter, seine Brust umfangreicher. Eine feine Narbe zog sich über einen Wangenknochen, und im Zusammenspiel mit den Linien, die sich um seine Schläfen niedergelassen hatten, ließ ihn das härter, zäher erscheinen.
»Wir machen das auf der Wache.« J.D. startete den Motor und sah die Brünette an. »Können wir?«
Sable ärgerte sich darüber, dass ihr Herz beim Klang seiner Stimme einen Satz machte. Vergiss seine Stimme, sein Gesicht. Er ist bloß ein Cop.
»Ja, klar.« Sergeant Vincent klappte das Notizbuch zu, während J.D. anfuhr und auf die Straße hinunterfuhr. »Haben wir’s eilig?« Er gab ihr keine Antwort, und sie schnallte sich an. »Na, dann.«
Sable versuchte, ihre Gedanken von J.D. fort und darauf zu lenken, was sie als Nächstes tun musste. Remy – die Nachricht, was passiert war, wäre ein zu großer Schock für ihn. Ihr Vater bekam jetzt Medikamente für sein Herz, und sein Arzt hatte sie vor den Gefahren gewarnt, die jede zusätzliche Aufregung für ihn bedeutete. Also musste sie ihn von der Stadt fernhalten und von dieser Sache. »Ich muss so bald wie möglich telefonieren.«
»Kein Problem, Ms Duchesne.« J.D.s Partnerin zündete sich eine Zigarette an. »Das können Sie von der Wache aus machen.«
J.D.s Blick und der ihre begegneten sich für einen Moment im Rückspiegel. Etwas hatte sich nicht geändert: das erstaunliche Blau seiner Augen. Sie wurden dunkel, wenn er sauer war, und gerade wirkten sie so schwarz wie die tiefste Hölle.
Ich lasse nicht zu, dass er mich wieder so weit bringt.
Terri Vincent liebte ihren Beruf als Polizistin, aber sie war nicht besonders wild auf den Papierkram.
Als J.D. sie ins Hauptquartier zurückfuhr, machte sie sich im Kopf eine Liste der Berichte und Formulare, die sie würde ausfüllen müssen. Es waren einige. Eine Leiche am Schauplatz einer Brandstiftung zu finden, war eine ernste Angelegenheit.
Das New Orleans Police Department war im vergangenen Jahr in das neue, hochtechnisierte Gebäude gezogen, das die Stadt als Teil der laufenden Kampagne zur Verbesserung der Strafverfolgung in der Region gebaut hatte. Das neue Hauptquartier beherbergte alles, was für die tagtägliche Verwaltung der acht dem NOPD unterstellten Polizeibezirke nötig war, einschließlich computerisierter Infrastrukturen, die alles automatisierten, von der ballistischen Auswertung bis hin zur Beweismittelverfolgung. Die Kontroll- und Ermittlungseinheiten der Gemeinden waren verflochten mit Spezialteams, die regionale, staaten- und bundesweite Ermittlungen koordinierten und größere alljährliche Ereignisse wie den Mardi Gras oder den Sugar Bowl überwachten.
Wie bei den meisten großstädtischen Strafverfolgungsbehörden sah es allerdings so aus, als hätte sich die Truppe schon jahrzehntelang in dem neuen Gebäude verschanzt. Zugestellte Arbeitsflächen, reihenweise verwahrloste Aktenschränke und endlose Stapel von Papieren verwandelten jedes Stockwerk in ein Labyrinth. Das neue Computersystem nahm wertvollen Platz weg und produzierte seitenweise Berichte, die dem Chaos noch hinzugefügt wurden.
Terri bemerkte eine Gruppe Collegestudenten, die schweigend und missmutig auf den harten Holzbänken vor dem großen Schalter saßen, der die erste Station auf dem langen Weg ihrer Abfertigung darstellte. Bei irgendjemandem war wohl die Mardi- Gras-Party außer Kontrolle geraten, wenn man von den geschundenen, verschwitzten Gesichtern und den Tüten ausging, die der Schalterbeamte sicherheitshalber an sie verteilt hatte.
J.D. führte die Zeugin geradewegs an der Anmeldung vorbei auf den Fahrstuhl zu. Terri blieb etwas zurück und schickte noch zwei uniformierte Polizisten zu Marc LeClare nach Hause, um die Witwe abzuholen und ins Leichenschauhaus zu begleiten, damit sie den Toten identifizierte.
»Rufst du deinen Dad an?«, fragte Terri, als sie ihn wieder einholte und die Hand nach der Aufzugtür ausstreckte, ehe sie sich schließen konnte.
»Später.« Er schlug mit der Faust auf den Knopf für den zweiten Stock.
Der Gesichtsausdruck ihres Partners gefiel ihr gar nicht. Er schien sich allmählich einzubrennen. »Willst du erst den Vorbericht abfassen?« Sie hoffte es sehr. J.D. konnte viel besser Schreibmaschine schreiben als sie – außerdem brauchte die Zeugin wahrscheinlich einen Moment, um sich zu sammeln.
»Nein.« Als sich die Türen öffneten, lenkte J.D. Sable nach links, auf den Gang zu, an dem die Vernehmungsräume, Büros und kleinen Bürozellen lagen, die zur Mordkommission gehörten.
Er wollte also gleich mit der Befragung loslegen. Vielleicht gar keine so schlechte Idee, wenn man bedachte, wie sich die Presse auf die Story stürzen würde, sobald sie Wind davon bekam, dass Marc LeClare tot war. »Willst du das vielleicht kurz mit dem Captain absprechen, für den Fall, dass es sich als Mord entpuppt?«
J.D. hielt inne. So lange, dass Terri merkte, dass irgendetwas nicht stimmte.
»Nein.« Er steuerte auf den ersten freien Raum zu.