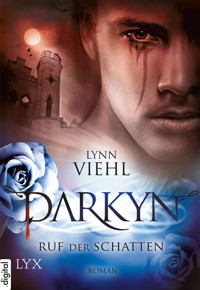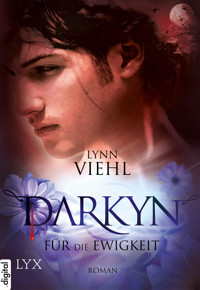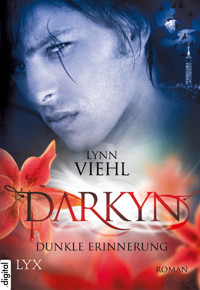9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Darkyn-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Dr. Alexandra Keller ist eine erfolgreiche Schönheitschirurgin, die ihre Praxis auch des Öfteren für Bedürftige kostenlos zur Verfügung stellt. Eines Tages erhält sie einen Anruf von dem Millionär Michael Cyprien, der dringend ihre Hilfe braucht. Als sich Alexandra weigert, seinen Fall zu übernehmen, lässt dieser sie kurzerhand entführen. Was Alexandra nicht weiß: Michael ist ein vierhundert Jahre alter Vampir. Er wurde von seinen Feinden furchtbar entstellt, doch seine raschen Heilungskräfte machen eine Operation nahezu unmöglich. Alexandra muss all ihre Fähigkeiten als Chirurgin aufwenden, um ihm zu helfen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Widmung
Vorspann
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Danksagung
Impressum
LYNN VIEHL
VERSUCHUNG DES ZWIELICHTS
Roman
Ins Deutsche übertragen von Katharina Kramp
Für Anne Rice
Architektin von Träumen
»Sei, wenn du tot bist, so, dann werd’ ich dich töten und dich nachher lieben.«
Shakespeare, Othello
1
»Wir haben schon wieder ’nen Brief von diesem Cyprien gekriegt«, meinte Grace Cho, während sie die Post auf Dr. Alexandra Kellers Tisch legte. Sie tippte mit einem langen Fingernagel auf den obersten Umschlag. »Das M. muss für Mäuse stehen. Er hat sein Angebot verdoppelt.«
»Noch mal?« Alex legte den schweren Albtraum beiseite, den Luisa Lopez’ Krankenakte darstellte. »Du machst Witze.«
»Über vier Millionen Mäuse würde ich niemals Witze machen, Boss.« Grace blickte mit einem leicht verärgerten Ausdruck in ihren exotischen schwarzen Augen über den Rand ihrer Lesebrille. »Warum fliegst du nicht einfach da runter und flickst dem Kerl das Gesicht wieder zusammen?«
Es ging nicht ums Geld. Unter anderen Umständen hätte Alex die OP bei M. Cyprien für ein Zehntel seines ursprünglichen Angebots durchgeführt. Aber jemand, der bereit war, so viel Geld für einen Hausbesuch zu bezahlen, war niemand, den sie als Patienten wollte. Das tat weh – für vier Millionen hätte sie eine Menge bedürftiger Patienten umsonst behandeln können –, aber Alex schob den Brief an den Rand des Schreibtisches. »Schick ihm noch eine Absage und eine Überweisungsempfehlung.«
»Hab ich doch schon sechsmal gemacht«, erinnerte ihre Praxishelferin sie. »Außerdem habe ich ihm zwölf Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Ich kriege langsam einen Komplex.« Sie schob Alex den Brief wieder hin. »Warum rufst du nicht selbst an? Die Nummer steht da unten.«
Alex ging in Gedanken noch einmal den Terminplan für heute durch. Sie musste zwei Überlebende eines Autounfalls und ein Kleinkind mit einer Gaumenspalte operieren, bevor sie ihre Visite im Krankenhaus machte. Dann noch eine komplizierte Operation am Nachmittag. Und außerdem wollte sie sehen, welche Fortschritte Luisa machte, wenn sie überhaupt welche machte. Sie hatte keine Zeit für M. Cyprien und den Teil seiner Anatomie, den er gerne etwas straffer haben wollte.
Grace hatte recht; der geheimnisvolle M. würde es vielleicht erst begreifen, wenn Alex es ihm persönlich mitteilte. Aber sie war beschäftigt, und ihr war einfach nicht danach, freundlich zu einem reichen Sack zu sein.
»Schick ihm noch ein Fax.« Alex holte M. Cypriens neuen Brief aus dem Umschlag. Wie die anderen war auch er auf wunderschönem braun-gelben Leinenpapier gedruckt, auf dem oben ein wichtig aussehendes goldenes Wappen prangte. Das Wappen zeigte ein Schild, auf dem zwei Symbole zu sehen waren: eine stilisierte Vogelkralle und eine Wolke.
»Faxen funktioniert nicht«, meinte Grace. »Ich kann dir die zeigen, die ich ihm schon geschickt habe.«
Was bedeutet dieses Wappen? Vorsicht, Tagträumer, Adleralarm? Das Papier roch leicht süßlich, als wäre es mit Parfüm eingesprüht worden. Vielleicht ist er eine Transe. Alex hatte schon viele Geschlechtsumwandlungen vorgenommen und galt als Koryphäe auf diesem Gebiet. Wenn M. Cyprien sich in einer reichen, homosexualitätsfeindlichen Familie im falschen Körper gefangen sah … »Also schön, ich rufe ihn an.«
Grace hob zwei Akten und eine zerknüllte Papiertüte an, um an Alex’ Telefon zu gelangen. »Bevor die Reillys kommen.«
Alex starrte sie an. »Tyrannin!«
»Drückeberger.« Ungerührt nahm sich die zierliche Koreanerin die Laborberichte, die Alexandra bereits durchgesehen hatte, und ging zurück in den Empfangsbereich.
Alex las den Brief noch einmal. Unter dem ominösen Wolken-Krallen-Wappen stand M. Cyprien, La Fontaine, New Orleans, Louisiana, USA. Keine Hausnummer und kein Straßenname, keine Postleitzahl, keine E-Mail-Adresse. Als einzige Kontaktmöglichkeit war ganz unten auf der Seite eine Telefonnummer aufgeführt – die, die Grace schon mehrfach angerufen hatte.
Vier Millionen Mäuse für eine OP, dachte Alex, während sie die Nummer wählte. Was muss bei ihm so dringend behandelt werden? Vielleicht Verbrennungen? Das erinnerte sie an die andere Arbeit, die heute noch vor ihr lag, und sie klemmte den Hörer zwischen ihrer Wange und ihrer Schulter ein, bevor sie Luisas Akte noch einmal öffnete, um erneut ein paar Daten zu überprüfen. Sie ist jetzt zwei Monate infektionsfrei, also kann ich nächste Woche mit den Hauttransplantationen beginnen. Das Hauptproblem mit den Operationen bei Luisa war allerdings nicht ihre körperliche Verfassung. Die Schmerztherapeutin will sie nicht mehr behandeln, nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist …
Eine freundliche Stimme mit einem leichten Akzent erklang am anderen Ende der Leitung. »La Fontaine, Eliane Selvais.«
»Hier spricht Dr. Alexandra Keller.« Hoffentlich verstand Eliane Englisch; das bisschen Französisch, das Alex beherrschte, enthielt nur Ausdrücke, die gesellschaftlich nicht akzeptabel waren. »Könnten Sie mich mit Mr Cyprien verbinden?«
»Es tut mir leid, Docteur. Das ist leider nicht möglich. Darf ich ihm etwas ausrichten?«
»Sicher.« Vielleicht ging es ja diesmal in seinen Dickschädel rein. »Bitte sagen Sie Mr Cyprien, dass ich seinen letzten Brief – und sein Angebot – erhalten habe. Aber meine Antwort ist immer noch die gleiche. Ich kann nicht nach New Orleans fliegen und ihn operieren.«
»Tatsächlich.« Miss Selvais klang jetzt nicht mehr so freundlich. »Sind Sie ganz sicher, dass Sie keine Ausnahme machen können? Mr. Cyprien ist in großer Not.«
Was für eine merkwürdige Ausdrucksweise! »Wie ich bereits sagte, reise ich nicht zu Patienten. Ich kann die nötigen Voruntersuchungen gerne hier in Chicago durchführen.«
»Mr Cyprien kann New Orleans nicht verlassen.«
»Das kann ich verstehen, denn ich kann Chicago nicht verlassen.« Warum kam er nicht zu ihr? Hatte er Angst vorm Fliegen? Stand er unter Hausarrest? War er auf Bewährung? »Bitte teilen Sie ihm mit, dass ich es sehr bedauere und dass ich ihm alles Gute …«
»Geld spielt keine Rolle, verstehen Sie?«
»Ja, das habe ich mir schon gedacht.« Der Duft des blumigen Parfüms, der vom Briefpapier aufstieg, ging ihr an die Nieren, deshalb knüllte Alex den Brief zusammen. Sie wirft! Mit einer geübten Handbewegung schleuderte sie ihn in den Papierkorb am anderen Ende des Raumes. Er rollte auf dem Rand entlang, bevor er hineinfiel. Und sie trifft! »Es geht hier nicht ums Geld.«
»Um was dann?« Miss Selvais wartete nicht auf eine Antwort. »Frau Doktor, es würde nur ein paar Tage Ihrer Zeit in Anspruch nehmen, und natürlich stellen wir Ihnen voll ausgestattete Räumlichkeiten und die besten Instrumente und Apparate zur Verfügung.«
Oh, natürlich. Typen wie Cyprien konnten sich von allem das Beste leisten. Alex dachte an Luisa, die nicht mal die Packung Kleenex-Tücher draußen in ihrem Wartezimmer bezahlen konnte, und ihr Temperament drohte mit ihr durchzugehen.
Der Geist ihrer Adoptivmutter erschien vor ihrem inneren Auge. Oh nein, das wirst du nicht tun, junge Dame. Du bist jetzt Ärztin, Alexandra, und ihr zu sagen, dass sie sich zum Teufel scheren soll, gehört sich nicht.
Ja, aber das würde viel mehr Spaß machen. »Es tut mir leid. Es ist wirklich nicht möglich. Es gibt mehrere sehr qualifizierte plastische Chirurgen in New Orleans, und meine Praxishelferin hat Mr Cyprien bereits eine entsprechende Liste gefaxt.« Sie konnte immer noch das Parfüm riechen; der Blumenduft musste von dem Papier auf ihre Hände gelangt sein. Was hatte er damit gemacht, das verdammte Papier darin gebadet? »Mehr kann ich wirklich nicht tun, Miss Selvais.«
»Ich werde es Mr Cyprien ausrichten. Merci beaucoup, Dr. Keller.« Sie unterbrach das Gespräch mit einem Klicken.
Erstaunlich, wie die Franzosen es immer schaffen, ein Danke wie Fick dich klingen zu lassen. Alex ging in das angrenzende Untersuchungszimmer und schrubbte sich den Geruch von den Händen. Auf Wiedersehen, vier Millionen.
Alex bekam zwar oft empörende Anfragen von den Reichen und Verwöhnten, doch Cypriens Angebot beunruhigte sie irgendwie, und nicht nur, weil er mit einer enormen Geldsumme winkte.
Wer hatte ihn an sie verwiesen?
Schließlich war sie nicht die einzige plastische Chirurgin auf der Welt. Sie hatte sich einen soliden Ruf für saubere und ethisch vertretbare Arbeit erworben, und ihre Praxis lief gut, aber es gab da draußen Tausende von Ärzten wie sie.
Sie war schon Leuten begegnet, die sehr spezielle, vertrauliche Wünsche hatten, vor allem, wenn sie versuchten, eine neue Identität anzunehmen und/oder einer Verhaftung zu entgehen. Wenn der Preis stimmte, zögerten einige Ärzte nicht. Alex gehörte jedoch nicht dazu, und jeder, der sich in Medizinerkreisen nach ihr erkundigte, wäre ausdrücklich darauf hingewiesen worden.
Wer immer M. Cyprien zu Alexandra Keller geschickt hatte, konnte kein Kollege oder ehemaliger Patient sein.
Die Gegensprechanlage auf ihrem Schreibtisch summte und erinnerte Alex daran, dass sie Besseres zu tun hatte als über einen Mann nachzugrübeln, der niemals ihr Patient werden würde. Sie setzte sich und drückte auf den Knopf. »Ja, Grace?«
»Rate mal, wer fünfzehn Minuten zu früh gekommen ist?«, fragte ihre Praxishelferin laut, um den Streit zwischen einem Mann und einer Frau zu übertönen, den man im Hintergrund hörte.
Alex seufzte. »Schick das glückliche Paar rein.«
Drew Reilly und seine Frau Patricia schrien sich immer noch an, als sie durch die Tür kamen.
»… sehe ich wegen dir so aus.«
»Komm schon, Patti.« Drew fuhr sich mit der Hand über seine rasierte Kopfhaut, unter die Alexandra eine Stahlplatte implantiert hatte, um den Teil seines Schädelknochens zu ersetzen, der vom eingedrückten Dach seines Autos pulverisiert worden war. Sein gesamter Kopf war leuchtend rot, als ob er einen schlimmen Sonnenbrand habe – was neu war –, aber sie sah keine Blasen. »Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass dieser verdammte Unfall nicht meine Schuld war.«
Ein neuer, entsetzlich süßlicher Geruch ließ Alex die Stirn runzeln. Kirschparfüm?
»Wenn du die neuen Reifen gekauft hättest, du Geizkragen, dann wäre das überhaupt nicht passiert.« Patricia versetzte ihrem jungen Ehemann einen Stoß. Sie war nicht angeschnallt gewesen, als das Auto verunglückte, und Alex stellte immer noch das wieder her, was nach dem Flug durch die Windschutzscheibe von ihrem Gesicht übrig geblieben war. Sie funkelte Alex unter ihrem Druckverband wütend an. »Sagen Sie es ihm, Dr. Keller.«
»Wir hatten das Geld nicht«, verteidigte sich Drew.
»Weil du es für die Saufgelage mit deinen verblödeten Freunden ausgegeben hast.«
»Hey. Hey.« Sie schrien sich weiter an, bis Alexandra zwei Finger in den Mund steckte und ein ohrenbetäubend schrilles Pfeifen ausstieß. Als sie still waren, deutete sie auf die Stühle vor ihrem Schreibtisch. »Hören Sie auf sich zu zanken und setzen Sie sich, oder ich schicke Sie direkt zum Therapeuten.«
»Sie braucht den Irrenarzt, Doc, nicht ich«, sagte Drew, während er sich auf den Stuhl fallen ließ. »Sehen Sie, was sie gestern Abend mit mir gemacht hat?« Er deutete auf seine gerötete Haut. »Sie hat fünf Tüten Cherry-Kool-Aid-Pulver in den Duschkopf gefüllt. Wirklich süß, oder?«
Patricia zog ihren Stuhl ein Stück von Drews weg. »Das habe ich nur gemacht, weil ich das Rattengift nicht finden konnte.«
Alexandra sorgte dafür, dass die Reillys sich beruhigten, und untersuchte sie. Dann wies sie Patricia an, das mit dem Kool-Aid zu unterlassen, und machte den beiden einen Termin beim Paartherapeuten. Der bedankte sich bei ihr, indem er Alex anrief und ihr vorwarf, sie wolle wohl, dass er die Reillys mit seinem Geländewagen überfuhr.
»Du kannst es versuchen, George«, sagte sie am Telefon zu ihm, »aber sie haben jetzt eine Menge Metall im Kopf. Pass auf deine Reifen auf.«
Ihr nächster Patient war Bryan Hickson, ein schweigsamer vierjähriger Junge, der sich bewegte und verhielt wie ein kleiner, höflicher Roboter. Das Jugendamt hatte ihn zu ihr überwiesen, und nach drei Jahren Papierkrieg und verschiedenen Aufenthalten in Pflegefamilien durfte Alex endlich den entstellenden Geburtsfehler korrigieren, der seine Oberlippe, seinen Gaumen und seine Nasenlöcher in zwei Teile spaltete. Der Staat wollte nicht für die Entfernung der anderen Narben im Gesicht aufkommen, die durch die Prügel entstanden waren, die er als Kleinkind bekommen hatte, aber die behandelte sie umsonst.
Bryans Pflegemutter, die Pflegekinder aufnahm, damit sie nicht arbeiten gehen musste, wollte nur wissen, ob die Krankenversicherung die Kosten für die Operation übernahm.
»Ich muss doch nicht im Krankenhaus bei ihm bleiben, oder?« Die dicke schwarze Frau knöpfte Bryans Hemd wieder zu, bevor sie ihn in einen uralten Buggy setzte.
»Nein, aber möchte seine biologische Mutter vielleicht mit mir sprechen? Ich kann ihr die Operation am Telefon erklären.« Alexandra wollte Bryans Mutter nicht persönlich treffen.
»Ist ihr egal.« Die Pflegemutter schloss den ausgefransten Gurt um Bryans Hüfte. Der Junge, der vor Energie nur so hätte strotzen müssen, drehte sich auf die Seite und schob seinen Daumen in den deformierten Spalt, der sein Mund war. »Sie is’ wieder schwanger.«
Bryans Mutter waren ihre fünf anderen Kinder bereits weggenommen worden. Wie er waren alle seine Geschwister heroinabhängig geboren worden. Die letzten beiden waren HIV-positiv.
Alex sah, wie sich die Gaumenspalte des Jungen weitete, während er seine Augen schloss und den Daumen lose im Mund hielt; sein deformierter Gaumen erlaubte ihm nicht einmal den Trost des Daumenlutschens. »Jemand muss diese Frau sterilisieren.«
»Die interessiert sich nur für das, was sie sich in den Arm schießen kann.« Die Pflegemutter schob Bryan aus dem Untersuchungszimmer.
Nachdem Alex ihre Nachrichten durchgelesen und Grace gebeten hatte, das Jugendamt wegen Bryans Mutter anzurufen, fuhr sie zum Krankenhaus. Bauarbeiten, die niemals aufzuhören schienen, sorgten für einen heftigen Stau, deshalb nutzte sie die Zeit, um einige Leute zurückzurufen.
»Dr. Charles Haggerty, bitte. Hier spricht Dr. Keller.« Während sie wartete, fuhr sie ihren Jeep an den linken Rand ihrer Spur, um an dem Umzugslaster vorbei auf die Straße vor ihr sehen zu können. Bauarbeiten und ein Unfall mit Blechschaden blockierten drei von vier der nach Osten gehenden Fahrbahnen. Der Verkehr staute sich fast zwei Kilometer zurück.
»Al? Wo bist du?«
»Unterwegs zwischen meinem Büro und dem Krankenhaus.« Die Sonne trat hinter den Wolken hervor, deshalb setzte sie ihre Sonnenbrille auf. »Was ist los?«
»Ich habe hier einen Sechsjährigen mit Downsyndrom, und ich möchte, dass du ihn dir ansiehst. Es muss eine Teil-Glossektomie gemacht werden. Warte mal.« Er sagte zu jemandem: »Ich brauche einen Rachenabstrich und ein großes Blutbild in der Vier, danke, Amanda.« Man hörte Lärm: das wütende Kreischen eines Kindes und den erschrockenen Aufschrei einer Frau. »Oh Scheiße. Mein Patient hat gerade meine Helferin gebissen. Können wir das beim Essen besprechen, Al?«
Alex lachte. »Charlie, bei deiner letzten Einladung zum Essen gab es Erdnussbutterkekse im Bett.« Nach einem langen Gespräch über die Arbeit und bedächtigem, sehr schönem Sex, was sie beides sehr genossen hatte.
»Ich wollte etwas bestellen«, erinnerte er sie. »Du warst diejenige, die so lange über laparoskopische Nervenrekonstruktion streiten musste, bis das Thai-Restaurant geschlossen war. Amanda, könntest du – ja, danke – hier, Melinda.« Das Geräusch eines weinenden Kindes wurde lauter. »Möchtest du Dr. Keller Hallo sagen? Nein? Beiß nicht ins Telefon, Baby – sie ist nicht so hübsch wie du.« Das Weinen des Kindes verebbte, und man hörte ein Schniefen und dann eine mit belegter Stimme gemurmelte Frage. »Oh nein. Dr. Keller kann keine Blue’s-Clues-Sneaker anziehen. Ihre Füße sind zu groß. Sie passt nur in Donald-Duck-Wear.«
Alexandra mochte Dr. Charles Haggerty aus vielen Gründen, und nicht nur, weil er ein großartiger Kinderarzt war, der seinen meist behinderten Patienten so viel Liebe entgegenbrachte. Er lachte über ihre radikaleren Ideen, aber er hörte ihr immer zu und kam ihr nie mit frauenfeindlichem Gehabe oder Konkurrenzdenken-Mist. Ärzte waren meist entweder vom Aussehen her ein Grauen und/oder schlechte Liebhaber, aber Charlie hatte einen schönen Körper, und wenn sie nicht zu müde waren, dann gab er sich wirklich Mühe, ihren damit zu befriedigen. Er drängte sie nicht zu einer Heirat und auch nicht dazu, mit ihm zusammenzuziehen, was ihm zwei weitere goldene Sterne in ihrem Freunde-Buch eintrug.
Aber Charlie war immer eher ein Freund als ein Liebhaber gewesen, und Alex wusste, dass sie ihn gehen lassen sollte.
»Ich brauche eine Frau, die sich um mich kümmert«, hatte Charlie schon mehr als einmal gesagt, »und du brauchst auch jemanden.«
»Hier ist deine Mom, Melly.« Ein Rascheln und ein Stöhnen, als Charlie seine Last in andere Arme gab. »Ich bin sofort bei Ihnen, Justina.« Er stieß den Atem aus. »Was meinst du, Al? Sei mein Calgon-Traummädchen und hol mich hier raus.«
Alex war ehrlich versucht, seine Einladung zum Essen anzunehmen, egal, ob es etwas aus dem Thai-Restaurant oder Kekse im Bett waren. Aber sie musste heute noch zu Luisa, und aus Erfahrung wusste sie, dass sie danach nur noch Chopin hören und ein Glas trockenen Weißwein trinken wollte, um ihre Kopfschmerzen damit zu bekämpfen. »Vielleicht nächste Woche, okay?«
»Musst du wieder zu Lopez?« Seine Stimme wurde weich. »Du musst aufhören, dich deswegen so fertigzumachen, Süße. Bei manchen kann man nur tun, was möglich ist, und für das andere beten.«
»Ich weiß.« Wenn Alex noch an Gott glauben würde, dann hätte sie ihm vielleicht zugestimmt. Eine Lücke entstand in der Spur neben ihrer, und sie zog schnell hinein. »Ich muss weiter, Charlie. Schick mir morgen deine Glossektomie. Ich kümmere mich darum.«
»Ich weiß es zu schätzen. Schlaf ein bisschen, und ich stocke schon mal meine Keksvorräte fürs nächste Mal auf.«
Das Southeast Chicago Hospital war eine Festung der modernen Medizin, um deren Zweitausend-Betten-Gebäude sich über die Jahre ein kleines Dorf aus Spezialkliniken, Ambulanzen und Rehabilitationszentren angesiedelt hatte. Alex parkte in der privaten Ärztegarage und meldete sich an der Rezeption an, bevor sie mit dem Personalaufzug in den vierzehnten Stock fuhr.
Sie war schon hundertmal in Luisas Zimmer gewesen und musste sich immer noch zwingen, den Knopf für die vierzehnte Etage zu drücken. Je höher der Fahrstuhl kam, desto schwerer wurde das unsichtbare Gewicht auf ihren Schultern.
Luisa Lopez war in den Projects auf Chicagos Westside geboren worden und hatte ihr ganzes Leben dort verbracht. Weil sie mit sechzehn schwanger wurde, bekam sie Sozialhilfe und eine eigene Wohnung, aber das Gebäude, in das sie zog, war viel älter als das ihrer Mutter. Die Bewohner waren so gemeingefährlich, dass die Polizei dieses Haus nicht ohne Verstärkung betrat. Luisa jedoch war entschlossen, allein zu leben und für sich und ihr Kind zu sorgen. Sie zog ein und ging zur Abendschule.
»Sie hat für dieses Baby gelebt«, hatte Sophia Lopez Alex bei ihrem ersten Gespräch erzählt. »Todo el mundo, es bedeutete ihr alles.«
Mrs Lopez hatte ihr ein Foto ihrer Tochter aus der zehnten Klasse gezeigt. Luisa war eher unscheinbar und ein bisschen übergewichtig gewesen, mit glatter schokoladenfarbener Haut und hübschen weißen Zähnen, das dicke schwarze Haar zu ordentlichen Zöpfen geflochten. Wirklich schön strahlten nur ihre großen haselnussbraunen Augen, die sie von ihrem puerto-ricanischen Vater geerbt hatte.
Luisa, die zurückhaltend gewesen war und niemanden gestört hatte, nahm abends immer den Bus von der Schule nach Hause, aber junge Frauen ohne Begleitung fallen auf. Eines Abends war ihr entweder jemand gefolgt oder in ihre Wohnung eingebrochen, wo er auf sie wartete.
Wer immer es gewesen war, hatte drei Freunde mitgebracht.
Die Polizei rekonstruierte anhand des Tatortes und einiger zögerlicher Zeugen den Tathergang. Vier Eindringlinge hatten die Wohnung verwüstet und, als sie nichts Wertvolles fanden, ihre Wut an Luisa ausgelassen.
Alex erinnerte sich, wie sie den ersten Bericht aus der Notaufnahme gelesen hatte. Fünf Seiten, vorne und hinten beschrieben, waren nötig gewesen, um die Liste der Verletzungen aufzuführen, die Luisa erlitten hatte. Es war zu viel für ihr ungeborenes Kind gewesen, das sie verlor.
Die Polizei glaubte, dass Luisas Angreifer die Wohnung in Brand steckten, um ihr Verbrechen zu verschleiern, aber jemand auf der Etage roch den Rauch und rief die Feuerwehr. Alex hatte mit dem Feuerwehrmann gesprochen, der Luisa auf dem Boden zusammengerollt fand. Ihre Kleidung brannte, sie hatte Wehen und klammerte sich an den Teddybären, den sie für ihr Kind gekauft hatte. Der Feuerwehrmann, ein erfahrener Mann, hatte geweint, als er Alex beschrieb, wie er die Flammen erstickt hatte und das Spielzeug aus Luisas verbrannten, klammernden Armen reißen musste.
Die Männer, die sie angegriffen hatten, waren immer noch auf freiem Fuß.
Abgesehen von der Kapelle war die Station für Verbrennungen der ruhigste Ort im Krankenhaus. Alex senkte ihre Stimme, als sie mit der Stationsschwester sprach. »Wie geht es ihr?«
»Schlechte Nacht, hat sich zweimal den Tropf rausgerissen.« Die Krankenschwester gab ihr die Krankenakte. »Hat sich auch den Katheter rausgezogen und das ganze Bett vollgepinkelt. Und mich mit ein paar ziemlich üblen Schimpfwörtern bedacht, als ich sie nach dem Frühstück umgelagert habe.«
»Das ist mein Mädchen.« Alex bemerkte, wie viel Morphium Luisa bekommen hatte, und schrieb dann ein Rezept für Valium aus. »Wenn sie heute Nacht wieder wild wird, stellt sie ruhig.«
Weil das Feuer Verbrennungen dritten Grades auf über fünfundvierzig Prozent ihres ohnehin schon unglaublich malträtierten Körpers hinterlassen hatte, ging man davon aus, dass Luisa nicht überleben würde. Alex war von ihrer Mutter gerufen worden, die wütend über die gleichgültige Behandlung durch die anderen Ärzte gewesen war. In gebrochenem Englisch hatte Sophia Lopez ihr damals gesagt, dass sie alles tun würde, was in ihrer Macht stand, damit ihre Tochter überlebte.
Und jedes Mal, wenn Alex Luisa ansah, fragte sie sich, was für eine Art Leben das sein würde.
Heute saß ein großer, schwarz gekleideter Mann neben Luisas Spezialbett für Verbrennungen. Er las mit ruhiger Stimme Psalmen aus der Bibel vor, während die Patientin aus dem Fenster auf der anderen Seite des Zimmers starrte.
Alex überlegte kurz, ob sie sich auf dem Absatz umdrehen und gehen sollte. Das versaut mir endgültig den Tag. Stattdessen zwang sie ihre Lippen zu einem professionellen Lächeln. »Das klingt nicht wie der neueste Linda-Howard-Roman.«
Der Priester hörte auf zu lesen und legte die Bibel beiseite. »Hallo, Alexandra.«
Vater John Keller, Alex’ einziger Bruder und alles, was von ihrer Familie übrig war, lief nicht auf sie zu, um sie zu umarmen. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie sich zuletzt berührt hatten, aber sie nahm an, dass es vor seinem Eintritt in das Priesterseminar gewesen sein musste. Damals war Alex eine dünne Fünfzehnjährige gewesen, die ihn bewundert hatte und ihm überallhin nachgelaufen war, weil er der tollste große Bruder auf dem Planeten war. Selbst, als er davon sprach, Priester werden zu wollen, war sie davon überzeugt gewesen, dass sich dadurch nichts ändern würde. Sie hatte John mehr geliebt als irgendjemanden sonst.
Aber John hatte sich verändert. Gott war ihm wichtiger gewesen als sie, und Alex hatte lernen müssen, dass sie mit dem Allmächtigen nicht konkurrieren konnte.
»Was für eine tolle Überraschung.« Nein, war es nicht; sie brauchte Luisa und John plötzlich so dringend wie ein Match im Wrestling-Käfig. »Ich dachte, heute wäre Fütter-den-Junkie-Tag drüben in St. Luke.«
»Das ist montags und freitags.« John blickte Luisa an. »Heute besuche ich die ans Bett Gefesselten und die Krankenhäuser.«
»Da bist du ja ziemlich weit gefahren.« St. Luke, die Chicagoer Gemeinde, in der ihr Bruder seit fünf Jahren arbeitete, befand sich auf der anderen Seite der Stadt. Alex fielen spontan zwei Krankenhäuser ein, die näher lagen als ihres.
»Das macht mir nichts aus«, meinte John. In der Kirche trug er die lange schwarze Soutane seines Ordens, aber heute war er in seiner Version von Straßenkleidung erschienen, einem einfachen schwarzen Anzug. Und die Sachen standen ihm gut; wenn der Priesterkragen nicht gewesen wäre, hätte man ihn für irgendeinen Geschäftsmann aus der Innenstadt halten können.
Gottes Rechnungsprüfer, der sich die Bücher ansehen will. Alex schluckte ihre säuerliche Belustigung herunter und ging zu dem Spezialbett hinüber, um die vielen tragbaren Monitore zu überprüfen, die es umgaben.
Luisa Lopez’ Gesicht wandte sich langsam um und folgte Alex’ Bewegungen. Eine Schicht Spenderhaut bedeckte ihr Kinn und ihren Nacken, nicht, um die Haut zu ersetzen, die sie verloren hatte, sondern um die freiliegenden Muskeln zu schützen, bis im Labor genügend ihrer eigenen Hautzellen nachgezüchtet worden waren und man während der kosmetischen Phase ihrer Behandlung mit den Transplantationen beginnen konnte.
Wenn wir es bis dahin schaffen. Alex war sich immer noch nicht sicher; wenn Luisa es nicht irgendwann selbst erledigte, konnte sie an jeder größeren Infektion sterben. »Wie geht’s dir, Lu?«
»Shei. Ta.« Hitzeschäden an ihrem Kehlkopf und ihren Lungen ließen sie in einem kaum verständlichen Hauchen Worte in einzelnen Silben hervorstoßen.
»Ist heute auch nicht mein Tag.« Sie überprüfte Luisas Vitalfunktionen und träufelte ihr dann vorsichtig einen Tropfen Tränenflüssigkeit auf die Hornhaut ihrer wütend funkelnden Augen. »Die Michigan Avenue war bis zum Pier runter verstopft. Ich wäre wahrscheinlich schneller hier gewesen, wenn ich in den See gesprungen und geschwommen wäre.«
Die Muskeln um Luisas Augen zogen sich zusammen. Hätte sie noch Augenlider gehabt, wäre es ein Blinzeln gewesen. »Trink.«
Alex hielt ihr die Wassertasse mit dem Strohhalm an den verletzten Mund, aber nach dem ersten Schluck wandte Luisa sich ab. »Schluck noch ein bisschen mehr. Du brauchst die Flüssigkeit.«
»Al. Ko. Ho«, krächzte sie heiser. »Whis. Key.«
»Zu den vielen Betäubungsmitteln, die du bekommen hast, weil du dir die Infusionen rausgerissen hast?« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn ich das mache, Süße, dann war’s das für dich.«
»Schei. Wei. ße«, zischte Luisa, sodass die zerklüfteten Reste ihrer Schneidezähne zu sehen waren.
»Ich nicht.« Alex strich mit dem Finger über Luisas Stirn, einer der wenigen Stellen auf Luisas Oberkörper, an denen nicht auf sie eingeschlagen oder eingestochen worden war oder die verstümmelt oder verbrannt waren. »Meine Haut ist eher karamellfarben als weiß.«
»Du. Schwarz?«
Alex blickte zu John, der den Kopf gebeugt hielt und auf den Rosenkranz in seiner Hand starrte. Eine andere Hautfarbe zu erklären war einfacher, wenn man wusste, welche Farbe die Haut der eigenen Eltern gehabt hatte. Aber das wusste sie nicht. John wahrscheinlich schon, aber er weigerte sich, darüber zu sprechen – noch eine Tür, die er ihr vor der Nase zugeschlagen hatte.
Eigentlich spielte es keine Rolle; Luisa würde wahrscheinlich nie mehr sehen können, welche Hautfarbe jemand hatte. »Ja, ich bin schwarz.«
John sah sie nicht an, aber sie konnte die Wellen der Missbilligung spüren, die von ihm ausgingen. Beide Kellers gingen als Kaukasier durch und waren von weißen Pflegeeltern aufgezogen worden, die sie als solche ausgegeben hatten. John hatte die Kinder, die sie wegen ihrer Hautfarbe hänselten, verprügelt. Er hätte es niemals zugegeben, aber er galt gerne als weiß.
Alex war diese Überheblichkeit egal gewesen, bis sie sich in der sechsten Klasse mit einem afroamerikanischen Flötisten namens Kevin angefreundet hatte. Audra, ihre Adoptivmutter, hatte dem bald Einhalt geboten –wir bleiben unter uns, Alexandra –, aber Alex achtete seitdem nicht mehr auf Hautfarben.
»Hölle. Ich.« Einer der bandagierten Arme flog hoch und schlug gegen Alex. Die Hitze hatte Luisas Finger miteinander verschmelzen lassen, aber es gelang ihr, die verdrehte, flossenartige Masse auf Alex’ Handgelenk zu legen. »Hölle. Ich. Gehe.«
Hölle ich gehe. Ja, dort war sie gewesen, ein paarmal schon.
»Das hat sie zu mir auch gesagt«, meinte John. »Wohin will sie gehen?«
Alex warf ihm einen »Halt den Mund«-Blick zu, bevor sie ihrer Patientin antwortete. »Wir brauchen dich hier, Lu. Du musst bei uns bleiben.«
Dem gepeinigten Mädchen gefiel das nicht. Sie fing an, abgehackte, wortlose Schreie auszustoßen und wand sich in dem speziellen Schaumbett, streckte ihren Körper.
Alex griff nach dem Infusionsständer, damit er nicht umfiel und die Infusionsnadeln herausriss, die Luisa mit Medikamenten und Flüssigkeit versorgten. »John, warte draußen auf mich, ja? Lu, du musst dich sofort wieder beruhigen.« Schnell schnallte sie Gurte um die Extremitäten des Mädchens. »Komm schon, Süße, tu mir das nicht an.«
John ging. Luisa ignorierte Alex’ Versuche, sie zu beruhigen, und drückte gegen die Gurte. Blutroter Eiter drang durch die Verbände auf den offenen Verbrennungswunden, und die Kurve ihrer Vitalfunktionen schoss so rasant nach oben, dass an drei Monitoren Alarm ausgelöst wurde. Die Stationsschwester kam mit dem Reanimationsgerät.
»Luisa, du musst dich jetzt beruhigen. Ich gebe dir etwas, damit du dich entspannen kannst.« Alex zog hastig eine Spritze auf und injizierte sie in den Zugang, dann beobachtete sie die Monitore. »Das wird dir helfen. Ja, Süße. Lass die Medizin wirken.«
Luisa bemühte sich, tief Luft zu holen. »Gi. Mi. Mehr.« Tiefe, ruckartige Geräusche kamen aus ihrer Brust. Sie konnte keine Tränen mehr weinen, aber sie konnte noch schluchzen. »Hif. Mi. Bit. Te.«
»Versuch zu schlafen.« Alex ballte die Hand an ihrer Seite zur Faust, während sie zusah, wie ihre Patientin in Bewusstlosigkeit sank. »Ich sehe morgen nach dir.«
Sie ließ die Krankenschwester mit Luisa allein und trat aus dem Zimmer. John stand dort und wartete auf sie, den Rosenkranz immer noch wie einen göttlichen Glücksbringer um die rechte Hand gewickelt. Vielleicht war er das für ihn.
»Ist es immer so schlimm?«, fragte er.
Er hatte sein sehr besorgtes Priestergesicht aufgesetzt, das, bei dem sie ihm gerne in den Magen boxen wollte.
Man darf keinen Priester schlagen. Sie lockerte ihre Faust. »Nein. Schlimme Tage sind es, wenn sie versucht, sich eine Ader aufzureißen oder ihre Zunge durchzubeißen.« Alex sah demonstrativ auf die Uhr. »Wolltest du noch irgendwas? Eine Spende?«
»Ich will mit dir reden. Ich habe mich gefragt …« Er zögerte, als müsse er seine Worte gut abwägen. »Wann warst du das letzte Mal in der Kirche?«
Zeitfür die Bilanzprüfung also. Nur, dass ich auch Buch führe. »Nicht mehr, seit du nach Südamerika gegangen bist, um all diese armen unwissenden Eingeborenen-Seelen zu retten.« Sie hob die Augenbrauen. »Noch was?«
»Ich fände es schön, wenn du am Sonntag nach St. Luke kämst.« Er schob den Rosenkranz in seine Jackettasche. »Ich halte die Elf-Uhr-Messe.«
»Ich habe alle deine Predigten schon gehört.« Zu oft. »Ich muss operieren. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist.« Sie lief zum Fahrstuhl.
»Alexandra, warte.« Er holte sie ein. »Die Dinge müssen sich ändern, aber ich … ich verstehe, warum du wütend auf mich bist.«
Wütend? Das war noch milde ausgedrückt.
»Okay, dann erinnern wir uns kurz zurück an damals, John. Nachdem unsere Adoptiveltern bei einem Autounfall gestorben waren, bist du gerade lange genug nach Hause gekommen, um sie zu beerdigen und mich ins Internat zu stecken.« Und wie sehr sie ihren Bruder angefleht hatte, sie nicht alleinzulassen. »Du kannst dir das jetzt von mir aus schönreden, aber Tatsache ist, dass du mich im Stich gelassen hast. Erinnerst du dich? Genau wie unsere Eltern.«
Sein Gesichtsausdruck blieb priesterlich. »Ich hatte Verpflichtungen in der Mission.«
»So viele, dass du erst wiederkommen konntest, als ich schon im Vorklinikum war?« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Scheint ein verdammt gottloses Völkchen gewesen zu sein, hm?«
Seine Augen wurden kalt. »Du weißt nicht, wie es für mich gewesen ist.«
Nein, das wusste sie nicht. »Ich habe dich danach gefragt. Oder hast du die zweihundert Briefe nicht gelesen, die ich dir geschrieben habe?«
»Ich habe sie gelesen.«
Das machte ihre letzte Hoffnung zunichte. Sie hatte ihn nie danach gefragt, sondern sich immer an der Vorstellung festgehalten, dass die brasilianische Post versagt hatte und die Briefe dem falschen Priester zugestellt worden waren. »Du hast sie allerdings nicht beantwortet. Nicht einen. Du hast mich ausgeschlossen, John.«
»Das musste ich.« War das Scham in seiner Stimme? Bevor sie es herausfinden konnte, berührte er sie an der Schulter. »Ich bin immer noch dein Bruder, Alexandra. Ich sorge mich um dich.«
»Ja natürlich. Du sorgst dich viel. So viel, dass du eine ängstliche Fünfzehnjährige in eine protzige Schule gesperrt hast, damit du Heiliger-Franziskus-rettet-die-armen-Dschungel-Heiden spielen konntest.«
Er ließ seine Hand sinken. »Ja. Das habe ich.«
»Das ist ein schönes Geständnis, Johnny, aber es ist nicht meine Aufgabe, es mir anzuhören. Denn ich bin die Ärztin und du der Priester. Wenn ich Mist baue, dann kommst du und schwenkst deinen Rosenkranz, bevor meine Patienten zu deinem Gott gehen.« Sie zuckte die Achseln. »So viel haben wir miteinander zu tun.«
Jetzt waren seine Hände zu Fäusten geballt. »Er ist auch dein Gott.«
So vorhersehbar. Luisa interessierte John nicht wirklich, und Alex auch nicht, aber wenn sie nicht in die Kirche ging oder wenn sie den Allmächtigen kritisierte, dann hatte sie immer seine volle Aufmerksamkeit.
»Ich habe aufgehört, an Gott zu glauben, als ich das erste Mal ein Kleinkind mit entzündeten Verbrennungen von Zigarettenstummeln behandelt habe. Er gehört dir ganz allein, Vater.« Die Fahrstuhltür öffnete sich, und sie ging hinein.
2
»Luther Martisse, dreiundfünfzigjähriger Mann mit schwerem kraniofazialen Trauma«, las die Operationsschwester vom Operationsplan ab. »Autounfall?«
Alex benutzte eine Bürste mit harten Borsten, um die antiseptische Seife unter ihre kurzen Fingernägel zu bekommen. »Exfrau mit einem Baseballschläger.«
»Autsch. Zu wenig Unterhalt gezahlt?«
»Die Exfrau hat ihn mit ihrer Schwester im Bett erwischt.« Alex wusch sich die Seife ab und hob ihren Fuß vom Pedal, das den Wasserhahn bediente. »Deren Kiefer habe ich letzte Woche gerichtet.«
Mrs Martisse hätte sich bei den Yankees bewerben sollen, beschloss Alex, nachdem sie sich den Schaden durch das Oszilloskop angesehen hatte. Dieser eine Schlag gegen Luthers Kopf hatte alle vier Innenwände seines Schädels völlig zerstört.
Um seine zerschlagene Augenhöhle zu richten und sein Sehvermögen wiederherzustellen, musste Alex die Operationsdauer ausdehnen und die Knochen mit Dutzenden von Mikroplatten, einer kompletten Platte aus metallenem Geflecht und winzigen Schädelknochenimplantaten stabilisieren.
»Verdammt.« Sie warf eine blutige Sonde beiseite und stellte das Oszilloskop neu ein. Weil die inneren Schädelwände so dünn waren, konnten sie leicht brechen. Genauso wie es Humpty Dumpty ergehen würde, wenn man ihn vom Empire State Building warf. »Luther, ich glaube, ich muss deinen ganzen verdammten Kopf mit Teflon überziehen.«
Alex brauchte noch fünf Stunden, um die Basis neu aufzubauen, dann machte sie den Schädel zu und ließ Luther Martisse in den Aufwachraum bringen. Erst in ein oder zwei Wochen würde sie wissen, ob die Kombination von Platten, Geflecht und Implantaten hielt, und Luther würde noch weitere Operationen benötigen. Viele Operationen.
Nachdem Alex den Polizisten Luthers Prognose geschildert und erklärt hatte, dass er auf keinen Fall als Zeuge im Prozess gegen die Ex-Mrs Martisse aussagen konnte, war sie mehr als bereit, sich nach Hause zu schleppen. Vor der Verbrennungsstation blieb sie stehen und ertrank fast im Meer ihres schlechten Gewissens, bevor sie das Krankenhaus verließ. Luisa zweimal an einem Tag zu besuchen, würde die Patientin nur aufregen, und die Stationsschwester würde sie anfunken, wenn sich etwas veränderte.
Was hatte Charlie gesagt? Bei manchen kann man nur tun, was möglich ist, und für das andere beten.
Ich habe für sie alles getan, was möglich ist, dachte Alex, während sie in das Parkhaus für die Ärzte ging. John kann sich ums Beten kümmern.
Ihre Beziehung oder das Fehlen einer Beziehung zu ihrem Bruder war noch etwas, an dem sie schwer trug. Es tat weh, weil sich Alex’ Gefühle trotz der Tatsache, dass Gott und die Kirche wie eine Wand zwischen ihnen standen, nicht geändert hatten. Ein großer Teil von ihr wollte ihn immer noch bewundern und ihm nachlaufen und ihn dazu überreden, sie nicht alleinzulassen.
John war immer noch der einzige Mensch, den sie jemals bedingungslos geliebt hatte.
Es fiel Alex zwar schwer, sich das einzugestehen, aber einige Dinge waren nicht zu reparieren. Sie konnte ihre Patienten äußerlich zusammenflicken, aber sie konnte nicht auslöschen oder rächen, was man ihnen angetan hatte. Sie konnte nicht heilen, was nicht auf dem CT oder den Röntgenbildern zu sehen war. Sie wusste das, weil die alten Wunden, die John ihr zugefügt hatte, immer noch bluteten.
Alex war so in ihr persönliches Unglück versunken, dass sie die beiden Männer, die sich ihr näherten, erst wahrnahm, als sie nur noch ein paar Meter entfernt waren. Sie kannte sie nicht, aber sie trugen elegante, teure Anzüge.
Ihre automatische Frau-Allein-Abwehrhaltung entspannte sich wieder. Vielleicht sind sie neu oder besuchen jemanden.
»Guten Abend, Dr. Keller«, sagte einer von ihnen und nickte ihr zu, während sie aufeinander zugingen.
»Hi.« Sie hatte ihren Kittel mit dem Namensschild ausgezogen, woher wusste er dann, wie sie hieß? Das war kein amerikanischer Arzt, nicht mit diesem netten Akzent.
Alex war gerade an den beiden vorbeigegangen, als sie etwas Hartes und Stumpfes am Hinterkopf traf und sie nach vorn taumeln ließ. Schmerz explodierte wie eine Landmine in ihrem Kopf, während die beiden Männer nach ihren Armen griffen. Dann trat derjenige, der sie angesprochen hatte, vor sie. Eine große Hand mit einem quadratischen feuchten Tuch kam direkt auf ihr Gesicht zu, zu schnell, um ihr auszuweichen.
Was zum Teufel … zu spät versuchte Alex, die Luft anzuhalten. Der starke chemische Geruch füllte bereits ihren Kopf. Ist das … Äther?
Was immer es war, es ließ sie vier Sekunden später bewusstlos zusammensacken.
»Panem coelestem accipiam, et nomen Domini invocabo«, betete Vater Carlo Cabreri, während er die Hostie hochhielt.
John Keller übersetzte das Latein automatisch ins Englische. Ich nehme das Brot des Himmels und rufe den Namen des Herrn.
Obwohl es kein hoher Feiertag war und ein fremder italienischer Priester die Messe auf Lateinisch hielt, füllten die Gemeindemitglieder von St. Luke die alten Kirchenbänke. Sie kamen, um zu knien und zu beten und die Kommunion zu empfangen, wie ihre Eltern und Großeltern und Urgroßeltern vor ihnen. Wie John es jeden Sonntagmorgen tat, seit er zehn war.
»Du bist jetzt katholisch, John Patrick«, hatte seine Adoptivmutter Audra Keller zu ihm nach seiner Taufe gesagt. Zehn Jahre alt, und Weihwasser tropfte aus seinem Gesicht auf seinen brandneuen Anzug. Alexandra, gerade fünf Jahre alt, hatte an Audras Schulter geweint, weil das Weihwasser kalt gewesen und in ihre Augen geflossen war.
St. Luke war die erste Kirche gewesen, die John jemals von innen gesehen hatte, und der einzige Ort, an dem er jemals zur Messe gegangen war, bevor er Priester wurde. Der alte Gemeindepfarrer Vater Seamus hatte sogar den Kopf geschüttelt, als die Kellers ihn das erste Mal zur Messe mitnahmen.
»Sie sagen, er ist nicht getauft, Audra? Na, also so was.« Er hatte John über das Haar gestrichen. »Aber wir werden die Sünden abwaschen, die du mit dir herumträgst, und noch einen guten Katholiken aus dir machen, Johnny-Boy.«
Seamus, der erst letztes Jahr friedlich im Schlaf gestorben war, hatte niemals erfahren, was Johnny-Boy damals mit sich herumgetragen hatte.
Was er immer noch mit sich herumtrug.
Ihr habt Euer Versprechen nicht gehalten, Vater.
St. Luke war nach dem Vorbild der alten Kirchen gebaut worden, die die ersten gläubigen irischen Einwanderer nach Chicago in ihrer Heimat zurückgelassen hatten, aber das Innere gestalteten die später ankommenden Italiener. Johns Adoptivmutter war davon überzeugt gewesen, dass das der Grund war, warum der Vatikan den Wiederaufbau der Kirche nach dem großen Feuer in Chicago 1871 bezahlt hatte.
»Die Iren haben das zugelassen«, sagte Audra mit amüsierter Resignation, »weil sie da schon die gesamte Stadt mit ihren Fleischfabriken beherrschten.«
Audra und Robert pendelten von ihrem wunderschönen Haus an der South Shore in die Stadt, um in die Kirche ihrer Kindheit zu gehen, aber Alexandra hatte St. Luke nie gefallen. Sie hatte zu John gesagt, dass es ein schrecklicher Ort sei.
»Und es stinkt dort«, hatte sich seine kleine Schwester beschwert. »Als wäre dort jemand gestorben und niemand hat die Leiche gefunden.«
Audra Keller schob den Geruch auf den verkohlten Stein, den man immer noch in der Nähe des Kirchenfundaments sehen konnte, und auf die öligen Gebetskerzen, die immer noch von den Klarissen eines hiesigen Klosters aus ausgeschmolzenem Rinds- und Schweinefett gegossen wurden.
»Warum können die Nonnen nicht Bienenwachs nehmen?«, hatte Johns Adoptivmutter Vater Seamus einmal gefragt. Obwohl sie John oder Alexandra niemals erlaubt hätte, ein Haustier zu halten, setzte sich Audra stets für den Tierschutz ein. »Von dem Gestank dieser Dinger wird allen schlecht.«
»Bienenwachs ist zu teuer«, hatte sie der alte Priester erinnert. »Und der Verkauf der Talgkerzen versorgt das Kloster mit einem bescheidenen Einkommen.«
Trotzdem waren die Kellers mit ihren Adoptivkindern jeden Samstag zur Beichte und jeden Sonntag zur Kommunion gegangen, weil ihre Eltern es so mit ihnen gemacht hatten, genau wie deren Eltern zuvor. Nach seinen Erfahrungen in Übersee hatte John um eine Stelle in St. Luke gebeten und sie bekommen. Damals hatte er das für einen Segen gehalten.
Jetzt fragte er sich, ob Gott gerne Scherze machte.
Die Gemeinde war niemals reich gewesen, aber seit Johns Reise in die Mission nach Südamerika war sie langsam zu einem Slum verkommen. Diejenigen, die es sich leisten konnten, hatten die Gegend bereits verlassen. Der Drogenmissbrauch, immer populär in Zeiten wirtschaftlicher Not, nahm stetig zu, genauso wie Einbrüche, Prostitution und Gewalt von Gangs.
John war nicht klar gewesen, dass die Heimat seiner Kindheit zu einem Ghetto geworden war, bis er die Leitung der Nachbarschaftsmission von St. Luke übernommen hatte, die warme Mahlzeiten an die Bedürftigen ausgab. Das Essen war immer schneller zu Ende als die Schlange der Nutten, Penner und Crack-Abhängigen.
Teller mit wässrigem Chili zu verteilen und gegen das Schlürfen aus dem Matthäus-Evangelium zu lesen war nicht nur sinnlos; es war ein Hohn. John war Priester geworden, um das Böse durch die Festigung des Glaubens zu bekämpfen, nicht um eine Suppenküche für Leute zu leiten, die gerne ihre Seele – oder seine – für einen Schuss oder einen Dollar verkauft hätten.
John hätte sich um seine Gemeinde gekümmert, aber die Menschen schienen ihn nicht zu brauchen. Den Gläubigen, die nach St. Luke kamen, konnte man nachsehen, dass sie inzwischen überzeugt waren, Gott sei taub, was sie anging; so wenige ihrer Gebete wurden erhört. Trotzdem kamen sie treu zur Messe und knieten und beteten den Rosenkranz und riefen Gott an, ihr Leid zu lindern, ob John die Messe hielt oder nicht. Ihre roboterhafte Demut des Glaubens schien grimmig und hoffnungslos, aber sie änderte sich nie und weigerte sich zu sterben. Wie die Gemeinde selbst.
John beobachtete die ernste Miene des italienischen Priesters, während dieser die Augen schloss und betete. Vater Carlo Cabreri war Erzbischof August Hightowers Chefassistent und einer der meistbeschäftigten Priester des Bezirks. Dennoch war Carlo im Refektorium erschienen und hatte darauf bestanden, die Morgenmesse zu halten.
Hightower musste Johns Brief erhalten haben.
Glaubt er, Carlo könnte es mir ausreden? John wusste, dass Hightower ihn auf seine distanzierte Art mochte. Er war Johns erster Beichtvater gewesen und hatte davor seiner Adoptivmutter Audra Keller geholfen, John davon zu überzeugen, Priester zu werden. Vielleicht hat er Cabreri geschickt, um mich daran zu erinnern.
Aber der Bischof würde kein Glück haben, denn es gab nichts zu reden. John war entschlossen.
Sein Blick glitt vom Altargitter zu den Heiligenstatuen, die in den niedrigen Bogen darüber eingeschnitzt waren. Ein dünner Staubfaden hing vom Kinn des heiligen Paulus herab und wehte sanft hin und her, bewegt von dem Luftzug aus einem der zerbrochenen Fenster im Mittelschiff.
»Domine, non sum dignus …«, murmelte der Priester und begann das Gebet, das er dreimal wiederholen würde, bevor er selbst die Hostie aß.
John blendete die übrigen lateinischen Worte aus, während die englische Version der ersten Zeile in seinem Kopf hämmerte. Herr, ich bin unwürdig … ich bin unwürdig …
John war immer unwürdig gewesen. Seine Eltern, das Leben auf der Straße und die Bestie in ihm hatten dafür gesorgt. Als er beschloss, den Minderen Brüdern beizutreten und Priester zu werden, hatte er gehofft, es würde den Mann ändern, der er war. Und er hatte sich geändert.
Jetzt war er unwürdig und ein totaler Versager als Priester.
Während Cabreri sich darauf vorbereitete, den Gläubigen die Kommunion zu spenden, kniete John am Altargitter. Vom symbolischen Fleisch und Blut Christi zu nehmen war eines der heiligsten Rituale des Glaubens, doch jetzt fühlte es sich wie Kannibalismus an. John war nicht würdig, an diese Tafel zu kommen und das Abendmahl zu teilen; er war ein Unreiner.
»Vater?«, flüsterte einer der Messdiener.
John blickte auf und sah, dass der Junge den Teller mit den Hostien unter seinem Kinn balancierte und dass der italienische Priester ihm die ausgestanzte, münzgroße Hostie vor die Nase hielt.
»Corpus Christi«, wiederholte Vater Cabreri geduldig.
John öffnete die Lippen und akzeptierte die Hostie. Die dünne Waffel klebte augenblicklich an seinem Gaumen fest, wo sie bleiben musste, bis seine Spucke sie in eine schluckbare Masse verwandelt hatte. Selbst als er noch ein Junge war, hatte John die Hostie niemals gekaut.
Man kaute nicht auf dem Körper Jesu Christi.
Hei, Padre.
Seit John aus Südamerika zurück war, plagten ihn seine Sinne. Er hörte Stimmen, die nicht da waren, roch Gerüche, die seiner Nase entgangen sein mussten, und schmeckte sogar Sachen im Essen, die er zuvor nie wahrgenommen hatte. Er sagte es seinem Arzt, der einige Tests durchführte, worauf bald eine Krankheit oder ein Gehirntumor ausgeschlossen werden konnte.
»Du bist kerngesund, John. Gesünder als deine Mitbrüder drüben in St. Luke.« Dr. Chase lachte über seinen eigenen Witz. »Ich denke mal, du leidest an einer sensorischen Wahrnehmungsstörung.«
»Wie bitte?« John hatte diese Bezeichnung noch nie gehört.
»Du bist gerade erst zurück nach, was, zwei Jahren im Dschungel? Natürlich hat dein Gehirn andere Nervenverbindungen gebildet, die jetzt Dinge wahrnehmen, die nicht ins Raster passen. Viele Männer, die aus Vietnam zurückkamen, litten an sensorischen Wahrnehmungsstörungen.«
Der Arzt hatte ihm versichert, dass sich dieser Zustand irgendwann ändern würde. Das war nicht passiert, und manchmal war John sicher, dass es schlimmer wurde. Wie jetzt. Der Geruch des Chantilly-Parfüms von der alten Frau zu seiner Linken war so stark, dass er sich über den Rand des Altargitters beugen und sich übergeben wollte.
Als er abrupt aufstand, erschreckte er die Leute, die neben ihm beteten. John ignorierte sie, beugte kurz die Knie vor dem lebensgroßen Kruzifix und lief dann durch den Mittelgang aus der Kirche hinaus. Erst als er draußen stand, konnte er wieder atmen und sich konzentrieren und versuchen, die ekelerregenden Gerüche aus seinem Kopf zu vertreiben. Sie zogen sich zurück, aber ein dunkles Gesicht ersetzte sie. Wieder hörte er die verschlagene Stimme mit dem wissenden Unterton, die ihn eines Nachts aus einem dunklen Eingang in den Slums gerufen hatte.
Hei, Padre.
»Vater? Ist Ihnen schlecht oder so?«
Christopher Calloways nach Kaugummi riechender Atem riss John aus seinen Erinnerungen. Das Mädchen in Rio hatte Pfefferminzkaugummi gekaut, aber nicht aus Vergnügen. Sie tat es, um den Gestank ihrer schwarzen, verrottenden Zähne zu überdecken. Das war der Grund für den Spitznamen ihres Gewerbes, menina do doce.
Süßes Mädchen.
Er stand vor der Statue der Mutter Gottes. Schweiß lief ihm über das Gesicht, und seine beiden Hände waren zu Fäusten geballt.
»Es geht mir gut, Chris.« Er wandte sich leicht von dem Messdiener ab. »Geh wieder rein und zieh dich um.«
»Okay, Vater. Oh Mann, hab ich ganz vergessen. Vater Carlo hat mich geschickt, um Sie zu holen. Man braucht Sie im Pfarrhaus.«
John dachte an den Bischof. Nein, Hightower würde nicht persönlich vorbeikommen. »Will Vater Carlo mich sprechen?«
»Ja.« Der Junge blickte ihn unsicher an. »Und auch die beiden Polizisten, die bei ihm sind.«
Alex war seit ihrem fünften Lebensjahr nicht mehr in einem fremden Schlafzimmer aufgewacht. In Panik schlug sie mit den Händen durch die Luft, bis sie sich erinnerte, dass sie kein obdachloses kleines Kind mehr war, das auf der Straße lebte.
Sie war allerdings immer noch in einem fremden Schlafzimmer.
Die ersten Minuten verbrachte sie damit, ihren Körper nach einem Grund dafür zu untersuchen. Mein Kopf dröhnt, meine Kehle brennt, meine Nasennebenhöhlen schmerzen. Keine gebrochenen Knochen, keine Schmerzen oder Verletzungen zwischen ihren Beinen. Sie war geschnappt und, nach ihrer Benommenheit zu urteilen, mit einem Inhalationsmittel betäubt worden –Äther?–, aber sie war ziemlich sicher, dass man sie nicht geschlagen oder vergewaltigt hatte.
Noch nicht.
Alex verharrte regungslos und ließ den Blick durch das Zimmer gleiten. Sie war allein und sozusagen noch im Warte-Modus. Das Messingbett, die meerblauen Laken, die um ihren Oberkörper und ihre Beine gewickelt waren, und das Zimmer waren ihr völlig fremd. Niemand, den sie kannte, hätte bei der Dekoration so leuchtende Farben gewählt; Spritzer von Rot, Gelb und Orange auf den kühleren türkisfarbenen und blauen Kissen und Laken. Ihre eigene Wohnung war zweckmäßig eingerichtet; Charlies Wohnung war ganz in Cordbeige gehalten und roch nach Junggeselle. Und wo immer John lebte, war es sicher genauso trist wie er.
Nein, der Besitzer dieses Hauses hatte Geschmack und Geld. Die Bilder an den Wänden sahen echt aus und der Teppich dick und teuer. Das Einzige, das sie riechen konnte, waren in der Sonne getrocknete Laken, ihr eigener Schweiß und ein leicht chemischer Geruch.
Alex hob eine Ecke des Lakens an. Darunter war sie völlig nackt. Sie griff nach dem nächstbesten festen Objekt, einer silbernen Schmuckdose, die auf dem Nachttisch stand. Vielleicht war sie überfallen worden, und jemand hatte sie verletzt in dieses Haus gebracht. Aber das wäre extrem dumm gewesen. Warum sollte jemand sie hierherbringen anstatt in das nur wenige Meter entfernte Krankenhaus? Und warum sollte er sie ausziehen?
Zeit,herauszufinden, wessen Schädel ich einschlagen muss. »Hallo?«
Niemand antwortete.
Alex stieg vorsichtig aus dem Bett, die Schmuckdose in der Hand. Ihre Kleider lagen sauber und ordentlich gefaltet auf dem überladenen kleinen Tisch ganz in der Nähe. Sie stellte die Dose gerade lange genug ab, um sich anzuziehen, und ging dann zur Tür, die einen runden Griff und ein Bolzenschloss hatte. Und die fest verriegelt war.
»Hallo? Jemand da draußen?«
Sie rief noch ein paarmal und hämmerte gegen die Tür, zuerst mit der Faust, dann mit der Dose. Keine Antwort. Es gab keine Fenster im Zimmer, und die einzige andere Tür führte in ein Badezimmer, das ebenfalls keine Fenster oder einen anderen Ausgang besaß.
Wenn das Datum und die Uhrzeit auf ihrer Uhr – die auch auf dem Tisch lag – stimmten, dann war sie elf Stunden lang bewusstlos gewesen. Jetzt konnte sie sich genau an die beiden Männer in der Parkgarage erinnern, an den Schlag auf den Hinterkopf, an das Tuch in ihrem Gesicht.
Alex fing an, wieder gegen die Tür zu hämmern, und diesmal schrie sie um Hilfe. Niemand antwortete; niemand kam. Sie machte weiter, bis ihr Hals rau war und ihre Stimme heiser. Dann hörte sie auf und setzte sich aufs Bett. War der Raum schalldicht? Wollte man sie auf Dauer hier festhalten?
Warum entführt mich jemand?
Sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand oder wer die Männer gewesen waren, die sie gekidnappt hatten. Jemand hatte sich viel Mühe gegeben, sie zu entführen, aber warum? Sie war zwar finanziell abgesichert, aber keineswegs reich. John besaß als Priester kein Geld. Sie war während der letzten beiden Jahre mit niemandem außer Charlie Haggerty zusammen gewesen. Sie war noch niemals verklagt worden.
Wer sperrt jemanden, dem er wehtun will, in ein Schlafzimmer mit Queen-Anne-Möbeln und Leinenlaken?
Alex war es leid, sich das alles zu fragen. Wenn sie die Tür nicht öffneten, dann eben nicht. Sie durchsuchte das Zimmer nach etwas, mit dem sie das Schloss knacken konnte. Erst da wurde ihr bewusst, dass nichts im Zimmer aus Glas oder einem zerbrechlichen Material war. Es gab auch keine Spiegel, Lichter oder Lampen, und alle Steckdosen waren entfernt worden. Die einzige vorhandene Lichtquelle war eine Leuchtstoffröhre in der Mitte der gewölbten Decke, die sie jedoch nur hätte erreichen können, wenn sie Möbel aufeinanderstapelte. Dann musste sie feststellen, dass ihr die Möbel zu schwer waren, um sie zu bewegen.
In einem Anflug von Verzweiflung ging sie ins Badezimmer. Auch dort hingen keine Spiegel, und alle Schränke waren leer. Sie riss den Deckel von der Toilettenspülung und stellte fest, dass sie leer und trocken war; als sie abzog, entdeckte sie ein separates Rohr, das in der Wand verschwand und für Wasserdruck sorgte. Die Dusche hatte einen durchsichtigen, aber dünnen Plastikvorhang, der an zerbrechlichen Plastikhaken hing.
Alex ging zurück, stellte sich in die Mitte des Zimmers und sah es mit anderen Augen. Das ist kein Gästezimmer. Das ist ein Aquarium, und ich bin der neue Fisch.
Ohne Vorwarnung wurde die Tür geöffnet und eine hübsche blonde Frau in einem Chanel-Kostüm trat ein. »Bonjour, Dr. Keller.« Sie stellte das Tablett ab, das sie trug. »Willkommen in La Fontaine.«
3
Alex erkannte die Stimme der blonden Frau von ihrem Telefonat. Eliane Selvais, M. Cypriens hochnäsige Sekretärin.
Sie war von dem reichen Kerl mit dem ausgefallenen Briefpapier entführt worden? Sie erinnerte sich an das Wappen mit den ziehenden Wolken und den Vogelkrallen. Das war eine Warnung gewesen.
Träum in den Tag hinein, und du wirst entführt.
Alex sprang auf, rannte zur Tür und lief prompt mit dem Gesicht zuerst vor eine betonharte Brust. Sie holte mit der Schmuckdose aus, um sie dem Mann auf den Kopf zu schlagen, und keuchte, als er sie ihr aus der Hand nahm und über seine Schulter hinter sich warf.
Alex trat einen Schritt zurück. Jemand hatte die Nase dieses Mannes ein paarmal gebrochen, und eine üble Narbe lief von seiner Lippe herunter und verschwand in seinem Hemdkragen. Sein glattes Haar war zu einem kurzen Pferdeschwanz zusammengefasst, der die scharfen Kanten seines Gesichts nicht abmilderte. Das Braun seiner Augen war so hell, dass es an Kaffee mit zu viel Milch erinnerte.
Alex hatte ihr ganzes Leben in Chicago verbracht, einer Stadt voller Gewalt mit zahlreichen Drogenabhängigen, Vergewaltigern und Dieben, wo eine Frau, die allein durch die Straßen ging, zur Zielscheibe wurde. Weil sie kein völliger Schwachkopf war, hatte Alex einige Intensivkurse in Selbstverteidigung besucht und gelernt, sich selbst zu schützen. Sie wusste auch eine Menge über den menschlichen Körper und genau, wo es wehtat.
Schweigend und grimmig griff sie Narbengesicht an. Doch nichts bewegte ihn vom Fleck oder ließ ihn auch nur zusammenzucken; er hielt nur ihre Arme fest und ignorierte ihre Tritte.
»Philippe wird Sie nicht verletzen, Doktor, aber er wird Sie auch nicht vorbeilassen.« Miss Selvais klang beinahe entschuldigend, als der Gorilla sie vorsichtig zu ihr umdrehte. »Ich habe Ihnen einen Salat und Sandwiches gebracht. Blauschimmelkäse-Dressing mögen Sie am liebsten, nicht?«
»Ihr Boss M. Cyprien hat mich entführt.« Alex wollte das klarstellen, für die Aussage, die sie bei der Polizei machen würde. Die Französin nickte, und dumpfe Hitze stieg in Alex’ schmerzendes Gesicht. »Hat er denn seinen verdammten Verstand verloren?«
»Das müssen Sie Mr Cyprien heute Abend selbst fragen. Im Moment sollten Sie etwas essen.« Der dunkle Kamee-Ring, den sie trug, schimmerte, als sie auf das Tablett deutete.
Da Blondie offenbar nicht ganz bei Trost war, wandte sich Alex an Philippe. »Entführung ist eine Straftat. Lassen Sie mich hier raus, und ich werde keine Anzeige erstatten.« Oh doch, das würde sie. La ganz Fontaine würde für diesen kleinen Stunt ins Gefängnis wandern.
»Philippe spricht kein Englisch.« Eliane lächelte. »Und auch das andere Personal nicht.« Sie ging zur Tür. »Ich werde in einer Stunde zurückkommen und das Tablett holen. Bon appétit.«
»Um Himmels willen, das können Sie doch nicht machen. Ich bin Ärztin. Ich habe Patienten.« Alex versuchte ihr zu folgen, aber Philippe blockierte erneut die Tür. »Holen Sie Cyprien und sagen Sie ihm, dass ich mit ihm sprechen will«, rief sie über seine Schulter. »Jetzt!«
Eliane kam wie versprochen zurück und holte das Tablett, wiederholte jedoch nur, dass ihr Chef Alex am Abend sehen wollte. Alex versuchte es auf andere Weise und erzählte ihr von Luisa und den anderen Leuten, deren Leben davon abhing, dass sie zurück nach Hause kam.
»Diese Leute werden jemand anders finden, der sie behandelt«, sagte Cypriens Assistentin und machte eine wegwerfende Geste mit der Hand. »Mr Cyprien kann das nicht.«
»Natürlich kann er einen anderen Chirurgen finden. Es gibt Tausende von ihnen im Süden …«
Die Blondine schüttelte den Kopf. »Leider gibt es keinen, der schnell genug ist.«
Sofort wurde Alex alles klar.
Vor sechs Monaten hatte das Time-Magazin einen Reporter geschickt, um mit Alex ein Interview zu führen. Sie hatte ihn abgewiesen, aber jemand im Krankenhaus musste ihm erzählt haben, wie schnell sie mit dem Skalpell war. Der Reporter beschloss, es auf andere Weise zu versuchen, und hatte heimlich Alex’ Zeit gestoppt und mit der von zwölf Top-Chirurgen bei der gleichen Operation verglichen.
Der Artikel hatte einen besonders geschmacklosen Titel gehabt: ALEXANDRAKELLER, SCHNELLSTESSKALPELLDERWELT.
»Nur weil ich schnell bin, heilt er doch nicht schneller.« Alex hielt Eliane am Arm fest, als sie zur Tür ging. »Sagen Sie ihm das.«
»Das können Sie ihm selbst sagen.« Mit überraschend kräftigem Griff machte sie sich von Alex’ Hand los. »Heute Abend, beim Essen.« Sie deutete auf den Schrank gegenüber vom Bett. »Sie werden dort passende Kleidung finden. Seien Sie bitte um neunzehn Uhr fertig.« Damit ging sie, und Philippe schloss Alex die Tür vor der Nase.
Aus reiner Neugier öffnete Alex den Schrank. Dutzende von schicken Kleidern hingen drin, und eine Reihe Pumps mit niedrigen Absätzen stand darunter. Seidenunterwäsche füllte die Schubladen ganz unten.
Die teuren Sachen – und es gab ein paar Etiketten, die sie »Heilige Scheiße« murmeln ließen, als sie den Namen darauf las – störten sie nicht so sehr wie die Entdeckung, dass alles bis hin zu den hochgeschnittenen Slips genau ihre Größe hatte.
Alex ließ ihre eigenen Sachen an, was Philippe die Stirn runzeln ließ, als er um Punkt neunzehn Uhr die Tür öffnete.
»Vous êtes très têtue«, murmelte er, während er sie betrachtete. Die Narbe, die über sein Kinn lief, wurde leicht rosa.
»Beiß mir in den Arsch.« Sie blickte sich im Flur vor der Tür um, aber alles, was sie sah, waren noch mehr Türen. »Wo ist er?«
Philippe deutete mit einer großen, schwieligen Hand nach links und folgte Alex, als sie in diese Richtung marschierte.
Sie gingen eine Marmortreppe hinunter, durch ein Labyrinth von Korridoren, die geschmackvoll mit noch mehr Bildern und Antiquitäten ausgestattet waren, und standen schließlich in einem höhlenartigen Esszimmer.
Ein Kristallkronleuchter von der Größe eines Volkswagenmotors hing in der Mitte eines barocken Deckenbildes. Die in den Wandputz eingearbeiteten Medaillons waren vergoldet, sodass sie wie Sonnen aussahen, und der Tisch war eine Platte aus weißem Marmor mit Goldeinschlüssen auf sechs massiven Messingstützen. Blassrosa Orchideen erhoben sich aus einer Schale mit Schleierkraut und Farn, die das Herzstück des Tisches bildete.
Auf dem Tisch stand kein Essen, wie sie bemerkte, und nur ein Platz war mit exquisitem, eierschalendünnem Porzellan gedeckt. Der Lebensstil der Reichen und Verbrecher.
»Oh nein.« Alex schüttelte den Kopf, als Philippe den Stuhl für sie zurückzog. »Holen Sie Ihren Chef.«
»Setzen Sie sich, Dr. Keller«, sagte eine tiefe Stimme hinter ihr. Als sie herumwirbelte, stand dort niemand. Dann entdeckte sie die Gegensprechanlage, die diskret in die Wandpaneele eingepasst war. »Meine Assistentin hat ein köstliches Mahl für Sie zubereitet. Crêpes mit Krebsfleisch, gefüllt mit Artischocken, glaube ich.«
»Ich habe keinen Hunger.« Alex überlegte, ob sie sich ein Messer schnappen sollte, bis sie sah, wie scharf Narbengesicht sie beobachtete. »Können wir es nicht hinter uns bringen? Ich habe Patienten, die auf mich warten.« Und ich muss die Polizei anrufen. Und Anzeige erstatten.
»Vielleicht ist es besser, wenn Sie noch nicht essen. Philippe, apportez-la-moi.«
Philippe führte Alex aus dem Esszimmer und eine weitere Treppe hinunter, diesmal ins Kellergeschoss.
Sie sah keine Heizungsanlage oder Werkzeugregale in Cypriens Keller; tatsächlich war es hier schöner als oben. Die Antiquitäten waren museumsreif, die Teppiche makellos und von erfahrenen persischen Händen fein gewoben. Alles war in sehr dramatischen Schwarz-, Gold- und Rottönen gehalten, Pufffarben, aber irgendwie passte es. Mittelalterliche Bilder von Burgen und Rittern hingen an den Wänden, aber die Farben wirkten frisch, als wären sie erst gestern gemalt worden. Sie bemerkte die verhüllten Staffeleien in einer Ecke, roch die frische Ölfarbe und das Terpentin. Ein riesiges altes Buch, in verwittertes braunes Leder gebunden, lag bei einem Sessel. Die Klimaanlage war so kalt gestellt, dass die Luft klirrte. Offensichtlich lebte und arbeitete der Mann hier.
Vielleicht hat er Angst, ausgebombt zu werden. Alex sah ein merkwürdiges Arrangement aus blutroten Samtvorhängen, die von der Decke herab um ein Himmelbett hingen. Noch ein Geruch stieg ihr in die Nase, und sie blickte durchs Zimmer auf der Suche nach seiner Quelle.
»Ich bin hier, Dr. Keller.« Ein Vorhang bewegte sich. »Sie sollten sich auf meinen Anblick vorbereiten.«
Vorbereiten, dass ich nicht lache. Alex hatte schon schwer verletzte und entstellte Leute gesehen, die nicht einmal mehr entfernt an Menschen erinnerten. Machte er sich wirklich Sorgen, dass seine faltigen Wangen sie schockieren könnten?
Als sie auf das Bett zuging, war sie endlich in der Lage, den merkwürdigen Geruch zu identifizieren – es duftete nach Rosen, genau wie das Briefpapier, das er ihr geschickt hatte – und je näher sie kam, desto intensiver wurde der Duft. Als würde Cyprien in einem Bett aus Rosen liegen.
Vielleicht tat er das. Nachdem er sie hatte entführen lassen, so als decke seine Versicherung das als ärztliche Überweisung ab, konnte sie nichts mehr überraschen.
Philippe stellte sich vor sie – für einen großen, kräftigen Mann konnte er sich pfeilschnell bewegen – und hielt sie davon ab, die Vorhänge zu öffnen.
»Weg da.« Sie blickte finster in sein ausdrucksloses Gesicht. »Oh, verdammt … Cyprien, rufen Sie le Pitbull zurück, okay?«
»Philippe.«
Narbengesicht zog sich zurück, aber nicht ohne ihr vorher einen ausdrücklich warnenden Blick zuzuwerfen. Alex riss den Vorhang zur Seite und blickte hinein.
Es lagen keine Rosen auf dem Bett, nur M. Cyprien. Und er hatte keine faltigen Wangen.