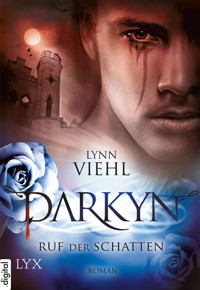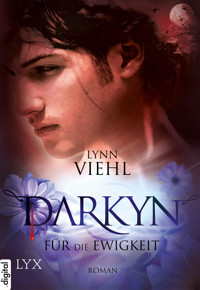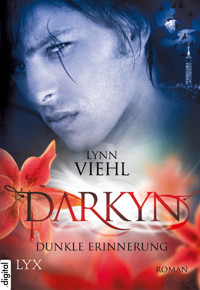4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Spannend und heiß – die HEAT-Romantic-Thrill-Reihe
- Sprache: Deutsch
Teresa Vincent arbeitet im Morddezernat von New Orleans. Als in der Stadt immer wieder verheerende Brände gelegt werden und Menschen in den Flammen umkommen, nimmt sie die Ermittlungen auf. Bei ihren Nachforschungen ist Teresa auf die Hilfe des attraktiven Brandermittlers Cort Gamble angewiesen, mit dem sie vor sechs Monaten einmal eine heiße Nacht verbracht hat. Nun müssen sie zusammenarbeiten, um dem hinterhältigen Brandstifter das Handwerk zu legen. Dabei können sie die starke Anziehungskraft zwischen ihnen nicht ewig leugnen ...
Spannung pur! Die Romantic-Suspense-Reihe von Lynn Viehl - für Fans von Linda Howard und Cynthia Eden.
Band 1: In der Hitze der Nacht
Band 2: Spiel mit dem Feuer
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Über die Autorin
Alle Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Hat es Dir gefallen?
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:
be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Teresa Vincent arbeitet im Morddezernat von New Orleans. Als in der Stadt immer wieder verheerende Brände gelegt werden und Menschen in den Flammen umkommen, nimmt sie die Ermittlungen auf. Bei ihren Nachforschungen ist Teresa auf die Hilfe des attraktiven Brandermittlers Cort Gamble angewiesen, mit dem sie vor sechs Monaten einmal eine heiße Nacht verbracht hat. Nun müssen sie zusammenarbeiten, um dem hinterhältigen Brandstifter das Handwerk zu legen. Dabei können sie die starke Anziehungskraft zwischen ihnen nicht ewig leugnen …
LYNN VIEHL
Spiel mit dem Feuer
Aus dem amerikanischen Englisch von Nele Junghanns
Tag für Tag arbeiten Polizisten, Feuerwehrleute
und Rettungssanitäter viele Stunden, um uns aus
Gefahrensituationen zu retten.
Oft müssen sie ihr Leben riskieren, während sie versuchen, unseres zu schützen, und doch sind sie immer da,
wenn wir sie am meisten brauchen.
Dieser Roman ist diesen Männern und Frauen gewidmet.
Es sind die Tapfersten und Besten von uns.
1
Anstatt die Zwillingsdämonen des Sommers aus dem French Quarter zu vertreiben – die Hitze und die Feuchtigkeit, die typisch waren für Mitte Juli –, schlang die Nacht ihre gewaltigen dunklen Arme um sie und zog sie fest an sich. Sie machte sie sich zu Verbündeten und lockte sie von den Kais und aus dem Sumpf in die Straßen, damit sie dort zu dritt ihr Unwesen treiben konnten.
In New Orleans war damit zu rechnen, dass selbst das Wetter von Zeit zu Zeit aufbegehrte.
Die drei arbeiteten sich von Kneipe zu Kneipe. Sie ließen Kondenstropfen auf der Außenseite von Plastikbechern und Schweißperlen auf der geröteten Haut erhitzter Gesichter entstehen und Kleidung, Haare und Gemüter welk werden wie einen Salatkopf unter der Wärmelampe. Sie legten sich drückend auf die Leiber der Touristen, umschlossen ihre Lungen und verfolgten sie auf Schritt und Tritt, bis diese mit hochgezogenen Schultern in ihre hübschen, freundlichen, klimatisierten Hotels zurücktrotteten.
Mit den Touristen hatten sie wirklich ein leichtes Spiel.
Nach Mitternacht hatten nur noch die Einheimischen mit ihrem dünnen Blut genug Rückgrat, um die dunkle, stickige Hitze zu ignorieren und in ihre Lieblingskneipen zu huschen, wo die Klimaanlage zwar ein Witz, aber dafür die Musik zauberhaft war und die Flaschen in Eis gepackt wurden.
Alle Einheimischen wussten, dass ein vernünftiges Jazzquartett und ein kaltes Bier fast alles wettmachen konnten.
Douglas Simon wollte mehr als nur einen Drink, als er das Maskers Tavern betrat und kurz stehen blieb, um sich das Gesicht mit einem Taschentuch abzutupfen. Sein Erscheinen brachte ihm bestenfalls beiläufige Seitenblicke der wenigen entlang der Theke verteilten Gäste ein.
Nicht dass Douglas Simon je große Aufmerksamkeit erregte, wenn er irgendwo auftauchte. Er war von durchschnittlicher Größe und Statur, ohne besondere Merkmale. Sein kurzes Haar und die Augen, alles von einem verwaschenen Braun, spiegelten sein stilles, bescheidenes Auftreten wider. Von derselben Farblosigkeit war auch der Anzug, den er trug.
Der Barkeeper nahm Douglas jedoch ins Visier und drehte sich um, um einen Sicherheitsschalter an der Wand neben der Kasse zu betätigen.
Einen Augenblick später kam ein gut gekleideter, schwarzhaariger Mann aus dem Büro des Chefs. »Doug.«
»Mr Belafini.« Douglas streckte die Hand aus, doch sie wurde ignoriert. So stehen die Dinge also. Ich bin immer noch nicht gut genug, dass er mir die Hand gibt. »Ich komme hoffentlich nicht zu spät.« Er hatte gerade festgestellt, dass die Batterie seiner Armbanduhr während der dreijährigen Aufbewahrung im Gefängnis von Angola den Geist aufgegeben hatte.
»Sie kommen genau richtig.« Stephen Belafini deutete auf einen privaten Partyraum, der links von der Bar lag. »Wollen wir?«
Douglas folgte Stephen in den Raum, und sein Blick überflog die leeren Tische. Kein Killer stand bereit, um ihn aus der Bar zu geleiten und ihn auf seine letzte Fahrt mitzunehmen. Außerdem waren die Wände und die Tür verglast, sodass jeder sie deutlich sehen konnte.
»Freut mich, Sie zu sehen.« Als der andere ihm einen scharfen Blick zuwarf, fügte Douglas hinzu: »Ich dachte, dass vielleicht Ihr Vater da wäre, und der kann ziemlich Furcht einflößend sein.«
»Das Gefängnis hat Sie wohl ein bisschen paranoid gemacht, Doug.« Stephen lächelte und zeigte seine perfekten Zähne. »Ich konnte das nicht sagen, als ich Sie in Angola besucht habe, weil die Wachleute ihre Ohren überall hatten, aber mein Vater will, dass Sie wissen, dass Ihre Loyalität gegenüber der Familie sehr geschätzt wird.«
Wie sehr, blieb noch abzuwarten. »Danke.«
»Normalerweise hätte mein Vater einen Wagen geschickt, um Sie heute Abend abzuholen«, fuhr Stephen fort, »aber wir wussten nicht, wo Sie wohnen.«
»Ich habe ein Zimmer drüben im Big Easy Sleep Motel gemietet.« Er schämte sich nicht dafür. »Was Besseres konnte ich mir nicht leisten.«
»Ab heute Abend werden Sie es können.«
Hielt Belafini ihn etwa für einen Vollidioten? »Gab es irgendwelche Probleme, die abgemachte Summe zu beschaffen?«
»Überhaupt nicht. Machen Sie sich wegen des Geldes keine Sorgen. Wenn Sie mich fragen, haben Sie sich jeden Cent davon verdient. Setzen Sie sich.« Stephen zog am Ecktisch einen Stuhl zurück. »Ich muss das Geld aus dem Safe holen.« Er deutete mit dem Kopf zum Chefbüro. »Wollen Sie was trinken?«
Douglas setzte sich vorsichtig hin. Er konnte sich nicht entspannen, solange er diesen Ort nicht mit dem verlassen hatte, was man ihm versprochen hatte. »Einen Gin Tonic, bitte.«
»Gin Tonic, kommt sofort.« Stephen verließ den Raum, redete mit dem Barkeeper und verschwand dann im Chefbüro.
Der Letzte, der das Maskers Tavern lebendig verließ, tat das ohne große Eile. Er ging durch eine Seitentür nach draußen, über die Straße und in ein kleines Hotel. Trotz der rasch rückwärts zählenden Ziffern auf seiner Uhr, die er auf Countdown gestellt hatte, wurde er nicht hektisch. Zwar hatte er seinen Job diesmal ein bisschen anders gemacht als sonst, aber er hatte vorher mehrere Praxistests durchgeführt. Er wusste auf die Sekunde genau, wie viel Zeit er noch hatte.
Vier Minuten.
Im Hotel durchquerte er die Eingangshalle, nickte der gähnenden Rezeptionistin zu und fuhr dann im Aufzug in den zweiten Stock, wo sein Zimmer lag. Dort angekommen, schob er den Riegel vor und zog sich das Jackett aus.
Drei Minuten.
Er blieb am Bett stehen, auf dem sein Fernglas und der säuberlich gefaltete Seidenschal lagen, und nahm beides an sich. Er schüttelte den Seidenschal aus, presste sein Gesicht in den zarten Stoff und atmete tief ein. Er hatte ihn der Frau, der er gehörte, vor einiger Zeit gestohlen, und der schwache Duft, der immer noch daran haftete, trieb ihm die Tränen in die Augen.
Die Frau – seine Frau – duftete immer nach Flieder.
Sie wäre sicher angewidert, wenn sie ihn jetzt sehen könnte, in diesem Zimmer. Die Klimaanlage recycelte ratternd die Luft und spuckte sie wieder aus wie ein nasskaltes Niesen. Den billigen Teppich zierte ein schrilles Paisleymuster in Rot, Grün und Gelb, während die Tagesdecke auf dem Bett ein stilisiertes Feuerwerk in Avocado, Gold und Blau zur Schau stellte. Im Bad, das etwa dieselbe Größe hatte wie der dürftige Kleiderschrank, hatte er einen verbeulten Eiskübel aus Plastik vorgefunden, in Zellophan eingewickelte Gläser mit einem leichten Schatten von Seifenrückständen und, um den Toilettensitz geschlungen, eine Papierbanderole, auf der Blitzblank für Ihr Wohlbefinden! stand.
Er hätte sich auch niemals ein Zimmer in einer solchen Absteige genommen, wenn es nicht diesen einmaligen Blick aus dem Seitenfenster gehabt hätte. Mit dem Fernglas konnte er im Westen von St. Louis bis zur Canal Street und im Osten bis zur Pirate’s Alley sehen. Zu diesem Fenster ging er jetzt, klappte die beiden Fensterflügel auf und ließ die Nachtluft herein.
Zwei Minuten, dreißig Sekunden.
Was er im Maskers gemacht hatte, hatte der Mann schon viele Male zuvor getan. Er war sozusagen zu einem Experten auf diesem Gebiet geworden. Er war nie in der Nähe seines Werks geblieben, um sich das Ergebnis anzusehen, aber diesmal war die Situation eine ganz besondere.
Diesmal war es etwas Persönliches.
Es hatte ihn einiges gekostet: Geld, Zeit und nicht zuletzt Stolz. Manche würden sagen, dass er seine Zukunft aufs Spiel setzte, vielleicht sogar sein Leben, indem er sich über die sehr deutlichen Anweisungen bezüglich seines Jobs hinwegsetzte. Aber in seinem Metier kam man nur ganz nach oben, wenn man Risiken einging.
Diese Nacht würde seine Unabhängigkeitserklärung und gleichzeitig seine Himmelfahrt sein.
Die Nonnen, die ihn in der katholischen Schule unterrichtet hatten, würden seine Entscheidung zwar nicht billigen, aber sie hatten teilweise dazu beigetragen, ein brennendes Bedürfnis nach Selbstbestimmung in ihm zu wecken. Schwester Mary Thomas hatte ihn Bibelverse auswendig lernen lassen, wie den aus Levitikus, der schon seit Wochen in seinem Kopf nachklang: »Du sollst weder säen noch ernten, was von selbst wächst, und die Trauben, die ohne Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen.«
Zwei Minuten.
Heute Nacht würde er seine Arbeit tun und sich um seine Zukunft, seinen Stolz und sein Schicksal kümmern. Heute Nacht würde er sich um Cortland Gamble kümmern.
Er sah sich selbst nicht als verzweifelt an, sondern nur als gerecht. Nach dieser Nacht würde er sich nehmen, was ihm gehörte, was ihm schon immer zustand. Er würde Gamble, den Mann, der es gewagt hatte, ihm das wegzunehmen, dafür bestrafen. Seinen Rivalen umzubringen, war eine immer wiederkehrende Fantasie gewesen, aber Mord würde zu schnell gehen, wäre zu leicht. Gamble musste begreifen, was es bedeutete, im Angesicht eines unerreichbaren Herzenswunsches zu leben wie ein halb verhungerter Fuchs, der nach den Trauben eines unbeschnittenen Weinstocks lechzte.
Gamble hatte versucht zu ernten, was er nicht gesät hatte. Der Marshal sollte leiden, so wie er selbst hatte leiden müssen.
Eine Minute.
Völlig ruhig wartete und beobachtete er. Als es nur noch dreißig Sekunden waren, fuhr vor dem Maskers ein Taxi vor. Der Fahrer stieg eigens aus, um seinem Fahrgast, einer dünnen, eleganten Frau in einem hübschen geblümten Kleid, die Tür zu öffnen.
»Du wirst das fette Trinkgeld noch bereuen«, murmelte er, als er sah, wie die Frau dem Taxifahrer ein Bündel Geldscheine in die Hand drückte.
Zwanzig Sekunden.
Während sie sich auf der Straße umschaute, wandte die Frau ihr Gesicht für einen kurzen Moment dem Hotel zu. Sie war leicht nach vorn gebeugt, die Schultern hängend, der Rücken gekrümmt. Die Straßenlaterne, unter der sie stand, offenbarte ihr langes schwarzes Haar und das schmale, ängstliche Gesicht. In der Bewegung schimmerte ihr Haar golden im Licht.
Der Schal glitt ihm aus den Fingern und schwebte unbemerkt zu Boden.
Die Frau zog sich ihr feines elfenbeinfarbenes Schultertuch fester um den Körper und eilte in die Bar.
Zehn Sekunden.
Er rannte aus dem Zimmer, drei Treppen hinunter und schaffte es gerade noch rechtzeitig auf die Straße, um die erste Explosion mitzubekommen. Der Boden bebte, und überall in der Straße zersprangen Fensterscheiben, als am Eingang der Bar ein riesiger Feuerball explodierte. Die Detonation war so gewaltig, so laut, dass er rückwärts gegen die Fassade des Hotels geschleudert wurde und sein Rücken hart auf den Beton prallte.
Eine Frau lief schwankend an ihm vorbei und hielt sich die Ohren zu. Ihr Mund war zu einem stummen Schrei verzerrt.
Er konnte sich nicht rühren. Es war nicht sie. Das war unmöglich. Sie hatte keinen Grund hierherzukommen. Keinen. Es sei denn, sie wäre Gambles Informantin gewesen …
Schwester Mary Thomas hatte ihn so viele Verse auswendig lernen lassen. Vielleicht war es gar nicht Levitikus gewesen. Es konnte auch aus dem Galaterbrief stammen. Irgendwas mit Was der Mensch sät.
Als er das entfernte Heulen von Sirenen hörte, begann er in der Tasche seines Jacketts nach seinem Handy zu kramen. Er musste viermal wählen, bis er die Nummer richtig hatte.
Eine dezente Stimme meldete sich mit: »Crescent City Hospice«.
»Ist Mrs Belafini da?«, fragte er mit heiserer, zitternder Stimme.
»Nein, Sir, bedaure. Kann ich ihr etwas ausrichten?«
Wie ging dieser Vers? Was ein Mensch sät … was immer ein Mensch sät …
»Sir?«
Eine gewaltige Welle aus Hitze und Rauch traf ihn, durchdrang seine Kleidung, brannte in seinen Augen. »Wo ist sie denn?«
»Sie hat mich vor etwa einer halben Stunde gebeten, ein Taxi zu rufen, und sich abgemeldet. Ich weiß nicht, wo sie hinwollte.« Die Stimme der Krankenschwester nahm einen besorgten Tonfall an. »Ist alles in Ordnung, Sir?«
Er hörte sie nicht. Er hörte nur die sanfte Stimme von Schwester Mary Thomas, wie sie ihren Sechstklässlern aus dem Brief des Paulus an die Galater vorlas.
Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten! Denn was der Mensch sät, das wird er ernten.
Das Telefon fiel ihm herunter und zerschlug auf dem Asphalt.
Im historischen French Quarter von New Orleans brannte es nicht oft, und der Live-Spot-Übertragungswagen von Channel Eight traf zwei Minuten nach dem ersten Löschzug am Unglücksort ein. Weitere Fahrzeuge, die schmale Straße und aufsteigende Flammen und Rauch hielten die zu spät gekommenen Presseteams zurück, und so kam es, dass nur eine einzige Kamera auf die Feuerwehrleute gerichtet war, als sie ihren koordinierten Angriff auf das brennende Lokal starteten.
Heiße Glut fiel vom Himmel, glühende Flocken aus schwarzen, rot durchzogenen Wolken. Die attraktive Rothaarige im blassgelben Anzug schien sie gar nicht wahrzunehmen, als sie sich neben der Stoßstange des nächstbesten Löschfahrzeugs postierte und in eine Kamera sprach, die ein bärtiger Mann mittleren Alters auf sie richtete, um dessen Hals noch drei Fotokameras hingen.
»Wie unzählige übergroße Bienen müssen unsere tapferen Feuerwehrleute in ihren dicken gelben Schutzjacken, mit schwarzen Stiefeln und Helmen«, sagte Patricia Brown und drehte sich zu dem in Flammen stehenden Lokal um, ehe sie wieder in die Kamera blickte, »dieses Inferno umschwärmen, um die todbringenden Flammen zu bekämpfen. Wie Sie sehen, ist die gesamte einundzwanzigste Kompanie zu diesem schrecklichen Brand der Alarmstufe drei angerückt.«
Sie machte eine Handbewegung, und der Kameramann schwenkte zu den rot-silbernen Löschzügen und den Feuerwehrmännern, die mit vereinten Kräften die schweren Schläuche abwickelten, bereitlegten und an die Straßenhydranten anschlossen. Patricia schaltete das Mikrofon ab und nutzte die Zeit, um ihren Lippenstift nachzuziehen und einen Blick in den Seitenspiegel des Ü-Wagens zu werfen.
»Komm runter, und hör auf mit den Insektenvergleichen«, sagte sie zu ihrem Spiegelbild. »Sei ruhig, aber betroffen. Schwer betroffen. Blut verkauft sich gut.«
Sie vergewisserte sich, dass der frische Lippenstift nicht auf ihre Zähne abgefärbt hatte. Als die Kamera sie wieder ins Visier nahm, war sie in Position und hatte wieder ihr schwer betroffenes Gesicht aufgesetzt.
»Sobald das Feuer in Schach gehalten werden kann, werden diese engagierten Männer das Gebäude betreten, um nach Überlebenden zu suchen. Wir halten Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Von hier aus« – sie warf einen flüchtigen Blick über die Schulter – »sieht es allerdings nicht besonders gut aus. Patricia Brown, Live Spot Eight News.«
»Du klingst ein bisschen kratzig, Baby«, sagte ihr Kameramann, als er aufhörte zu filmen und stattdessen begann Fotos zu schießen. »Hol dir mal ein Wasser aus dem Wagen.«
»Das liegt nur an diesem verdammten Rauch, Dave. Ich kriege kaum Luft.« Patricia sah, wie ein silberner SUV, der ihr bekannt vorkam, am Straßenrand hielt, und vergaß ihre Atemprobleme. »Gamble ist da. Los, komm.«
»Er wird nicht mit dir reden«, prophezeite Dave. »Er redet nie mit dir.«
»Vielleicht ja dieses Mal.« Sie befingerte unauffällig ihre Haare. »Fahr an mich ran, sobald ich am Bordstein bin.«
»Das wird ihm auch nicht gefallen.«
»Tu es einfach.« Als sie am SUV ankam, setzte sie ihr besorgtes Lächeln auf. »Fire Marshal Cortland Gamble ist soeben am Schauplatz des Brandes im Maskers Tavern hier im Quarter eingetroffen.« Sie hielt kurz inne, um den hochgewachsenen, breitschultrigen Mann aussteigen zu lassen, ehe sie um die Tür herumkam und er in der Falle saß. »Marshal Gamble, haben Sie schon eine Ahnung, was diese tödliche Feuersbrunst ausgelöst hat?« Sie hielt ihm das Mikrofon vor die Nase.
»Noch nicht.« Cort gab Dave ein Zeichen, mit dem Filmen aufzuhören. Dabei fiel sein Blick auf ihre gelben Lederpumps. »Sie stehen auf meinem Tatort, Tricia.«
»Liegt denn eine Straftat vor? Könnte es vielleicht das Werk des Brandstifters, des Torchers, sein?« Als er nicht antwortete, schaltete sie das Mikrofon ab, ließ es sinken und sorgte dafür, dass ihre blauen Augen groß und hilflos wirkten. »Cortland, bitte.« Sie legte ihm eine manikürte Hand auf den Arm, und die dezente Andeutung eines Akzents, wenn sie auf Sendung war, schlug um in einen zähen Südstaatendialekt, der sich in die Länge zog wie Kaugummi. »Meine Sendeleiterin schreit nach Einzelheiten, und Sie wissen, was für ein Aas sie sein kann. Ich wäre Ihnen wirklich dankbar für alles, was Sie mir sagen können.«
Noch vor einem Jahr wäre Cort vielleicht in Versuchung gewesen herauszufinden, wie weit ihre Dankbarkeit genau gehen würde, aber in letzter Zeit machte er einen großen Bogen um hübsche, wie aus dem Ei gepellte Frauen wie Patricia Brown. Um genau zu sein, war er dem gesamten weiblichen Geschlecht seit Mardi Gras so weit wie möglich aus dem Weg gegangen.
Kühle braun-grüne Augen leuchteten in der nebelhaften Erinnerung an eine Nacht vor fast sechs Monaten. Er hatte sie mit seinem Mund bearbeitet, ihre Schenkel fest unter seinen Händen, ihre Hüften, die sich anhoben und an ihn pressten, vor Ungeduld drängend. Er hatte sie so lange geneckt, bis sie gesagt hatte: »Muss ich wieder die Pistole holen?«
»Sie kriegen Ihre Stellungnahme.« Er machte eine Kopfbewegung in Richtung der anderen Reporter, die außerhalb der Reihe von geparkten Streifenwagen, die als provisorische Abtrennung diente, zusammengepfercht standen. »Dann, wenn alle anderen sie auch kriegen.« Er ging an ihr vorbei.
Bevor Tricia ihm folgen konnte, versperrte ihr ein uniformierter Streifenpolizist den Weg. »Sie haben den Mann gehört, Lady. Gehen Sie da rüber.«
Cort meldete sich beim Branddirektor am Tatort, hielt sich ansonsten aber im Hintergrund. Seine Männer gehörten zu den bestausgebildeten Feuerwehrleuten im Land, und sie wussten mit einem Brand umzugehen. Der Druck von Tausenden Litern Wasser aus den Schläuchen ließ das Feuer nach und nach zurückweichen, durchtränkte alles, was ihm als Nahrung gedient hatte, und verwandelte die Flammen in dichten grauen Qualm.
Sobald es sicher war, das Gebäude zu betreten, gingen die Männer hinein und begannen fast augenblicklich, Leichen herauszutragen. Die Reporter schoben sich vorwärts, heiß darauf, Fotos von den Opfern zu machen, aber die uniformierten Polizisten drängten sie zurück. Drei Rettungssanitäter stürmten nach vorne, um die Vitalzeichen zu prüfen, doch dann wurden sie langsamer und tauschten frustrierte Blicke mit den Feuerwehrleuten aus. Die Zahl der Opfer wuchs rasch über fünf hinaus, und der anfängliche Eifer und die Enttäuschung kehrten sich um in Schock und stummes Entsetzen.
Während der Branddirektor ging, um zur Presse zu sprechen, wies Cort die Männer ruhig an, die Toten um die Gebäudeecke und weg von den gierigen Objektiven der Medien zu bringen. Den Sanitätern gingen bald die Leichensäcke aus, und sie brachten Laken, um die restlichen Körper zuzudecken, bis der Leichentransporter kam.
Cort bemerkte, dass einer der Jüngeren dastand und auf die eingehüllten Leichen starrte. In seinem Gesicht mit den weit aufgerissenen Augen standen die Fassungslosigkeit und Erschütterung geschrieben, die die erfahreneren Männer zu verbergen gelernt hatten, daher ging er zu ihm hinüber. Als er näher kam, sah er, dass der Feuerwehrmann der Sohn seines Chefermittlers war.
»Wie geht es dir, Jack?«
»Das ist so was von beschissen.« John McCarthy schien sich der Tatsache, dass er mit dem Chef seines Vaters sprach, gar nicht bewusst zu sein, als er den Kopf ruckartig in Richtung der Reihe von Toten bewegte. »Weißt du, wo wir fünf davon gefunden haben?«
Angesichts der Verletzungen an den Händen und Hälsen einiger Opfer konnte Cort es sich vorstellen. Sie hatten sich wahrscheinlich beim Versuch zu entkommen die Hände blutig geschunden und dann ihre Hälse mit den Händen umklammert, als der Rauch das Leben aus ihnen herauspresste. »Vor einem Ausgang.«
»Dem hinteren. Alle auf einem Haufen. Die Tür war verschlossen und zugekettet.« Er blickte auf ein zugedecktes Opfer hinab. »Das Mädchen hier ist höchstens achtzehn oder neunzehn. Ich hab eine Cousine in ihrem Alter.«
Cort sah Tränen in den wütenden, blutunterlaufenen Augen des jungen Mannes. Worte des Mitgefühls würden ihm die Last nicht nehmen, würden die Tatsache nicht wegwischen können, dass sie nicht jeden retten konnten, so erbittert sie auch kämpften. Manchmal konnten sie niemanden retten.
Das gehörte zum Job.
Motorradlärm zog Corts Aufmerksamkeit für einen Moment auf sich, und er sah einen großen, schlaksigen Jugendlichen mit schwarzer Lederjacke und schwarzem Helm mitten ins Geschehen düsen. Der Branddirektor ging auf den jungen Kerl zu, um ihn wegzuschicken, doch ein paar Schläuche verhedderten sich, sodass er die Richtung wechselte, um sich zunächst darum zu kümmern.
Der Motorradfahrer parkte, stieg ab und trat auf den Bürgersteig vor dem Maskers.
»Ich muss mal eben dem Chief zur Hand gehen«, sagte Cort zu Jack. »Ich brauche hier jemanden, der uns die Presse und die Schaulustigen vom Hals hält. Bist du dazu in der Lage?«
Der Feuerwehrmann sah ihn an, als erkannte er ihn jetzt erst. »Verdammt, Marshal, ich … ich meine, ja, Sir.«
»Gut.« Cort klopfte auf das an seinem Gürtel befestigte Funksprechgerät. »Melde dich, wenn du Hilfe brauchst.« Zielsicher ging er auf den Motorradfahrer zu.
Feuer faszinierte die Menschen. Als Cort bei der Feuerwehr angefangen und gesehen hatte, wie viele davon angezogen wurden, Gebäude brennen zu sehen, hatte ihn das erschreckt und angewidert. Aber mit den Jahren hatte er gelernt, dass es für die meisten ein unfreiwilliger, schreckerfüllter Zwang war, ähnlich dem, wenn man an einem schlimmen Autounfall vorbeifährt und unfähig ist wegzusehen.
Aber das gab diesem Motorradrocker immer noch nicht das Recht, mitten auf dem Schauplatz eines gefährlichen Brandes aufzukreuzen.
Cort kam von hinten, als der Biker gerade seinen Kinnriemen löste, und packte ihn mit der Hand an der linken Schulter. »Einen Moment.«
Der Motorradfahrer hielt einen Augenblick inne, dann nahm er den Helm ab und drehte sich um. Die goldene Dienstmarke eines NOPD-Detectives hing an einer dünnen schwarzen Kordel um einen blassen Hals. Ein Aufflackern über ihnen warf Licht auf ein klug wirkendes Gesicht mit feinen Zügen, struppigem Haar und schmalen haselnussfarbenen Augen. Unter der Fliegerjacke aus schwarzem Leder verbargen sich eine zerknitterte, schlichte weiße Bluse und die leichte Erhebung eines Schulterhalfters.
Cort ließ die Hand sinken. »Detective Vincent.«
»Marshal Gamble.« Das kaum vorhandene Lächeln, das Terri Vincents Lippen umspielte, war fast so kühl wie ihre Stimme.
Terris Mund war einer der Gründe, warum er ihr aus dem Weg gegangen war. Ein anderer war das Wissen, was sie damit anstellen konnte. »Was machst du denn hier?«
»Irgendwas von wegen Mord ging über den Äther, und ich war gerade auf dem Heimweg.« Sie fuchtelte sich vor dem Gesicht herum, um herumfliegende Asche zu vertreiben, und nahm dann das Gebäude in Augenschein. »Sieht schlecht aus, was?«
»Ja.«
Cort war seit Mardi Gras nicht mehr in Terris Nähe gewesen, und er stellte ein paar deutliche Veränderungen an ihr fest. Sie war dünner und ihre Haut stärker gebräunt. Ihr Haar sah kürzer aus, aber als sie den Kopf wegdrehte, merkte er, dass sie es hatte wachsen lassen und es nun nach hinten gekämmt und im Nacken hochgesteckt trug. Unter den Augen hatte sie dunkle Ringe. Als sie einen Notizblock und Stift hervorholte, sah er, dass sie ihre Nägel kurz und gerade abgeschnitten hatte.
Damit sie nicht daran herumkaut, wenn sie nicht rauchen kann.
Wie immer trug die Mordermittlerin nicht das kleinste bisschen Make-up. Eine leichte Einkerbung in ihrer Unterlippe verriet ihm, dass sie wieder zu viel geraucht hatte. Ihre schlichte braune Hose war zu weit und wies tiefe Falten auf, als trüge sie sie schon seit einer Woche. Wären die Haarspange und die sanfte Erhebung von Brüsten unter der Lederjacke nicht gewesen, hätte sie nicht einmal wie eine Frau ausgesehen.
Es gab nicht eine verfluchte Sache an ihr, die er mochte, und dennoch verspürte Cort das Verlangen, sie an die nächstbeste Wand zu zerren, dagegen zu pressen und mit seinen Händen zu erkunden, was sich an ihr noch verändert hatte. Und dann noch mal mit seinem Mund.
Terri wandte den Blick ab, als zwei weitere Bahren aus dem Gebäude getragen wurden. »Wie viele sind da drin?«
»Wir wissen es noch nicht.« Er deutete mit dem Kopf auf die Tragen. »Damit sind es zwölf Leichen.«
Ihr Gesichtsausdruck änderte sich nicht, doch er erwartete auch keine Reaktion von ihr. Genau wie sein Bruder J. D. war Terri schon oft mit dem Tod in Berührung gekommen. »Wieder ein Werk des Torchers?«
»Möglich.« Sie hatte den Fall also mitverfolgt. Wahrscheinlich, damit sie hämisch über Corts Unfähigkeit triumphieren konnte, den Serienbrandstifter dingfest zu machen. »Aber kein Wort zur Presse.«
»Soll das heißen, dass ich Tricia Brown kein Exklusivinterview geben darf? Mist, das war’s dann wohl mit meinem Schmiergeld.« Sie zog die Jacke aus und band sie sich an den Ärmeln um die Taille. »Dann geh ich mich mal mit den Polizisten unterhalten und werfe einen Blick auf die Leichen. Bis demnächst, Marshal.«
Die lässige Art, mit der sie ihn abblitzen ließ, war ihm schon immer nahegegangen. Nach dem, was während des Mardi Gras zwischen ihnen passiert war, war dies ein Schlag ins Gesicht. »Ich will dich nicht hier haben.«
In ihren Augen flackerte etwas auf. »Dann solltest du noch eine Beschwerde bei meinem Boss einreichen.« Sie ging an ihm vorbei.
Terri Vincent war müde. Sie hatte eine Doppelschicht eingelegt und versucht, liegen gebliebenen Papierkram aufzuarbeiten, bevor ihre Versetzung durch war. Es hatte sie ganze neun Stunden mit dem Zwei-Finger-System an ihrer alten Schreibmaschine, eine komplette Flasche Tipp-Ex und sechs Aspirin gekostet, sich durch diesen Stapel zu kämpfen. Als sie sich ausgestempelt hatte, wollte sie nur noch nach Hause, sich irgendwo fallen lassen und schlafen, bis sie neunundzwanzig war.
Das Einzige, was ihr an der Polizeiarbeit wirklich auf den Wecker ging, waren die Schreibarbeiten.
Sie hatte Cort Gamble die Wahrheit gesagt: Der Notruf aus dem French Quarter war bei ihr eingegangen, als sie auf dem Weg nach Hause war. Das Morddezernat arbeitete während der Friedhofsschicht mit einer Notbesetzung, und der Verantwortliche zog es nach dreißig Jahren Dienstzugehörigkeit vor, sich Howard Stern anzusehen, statt Notrufe entgegenzunehmen. Da es drei Uhr morgens war, hatte sie es für ziemlich sicher gehalten, dass Cort Gamble nicht da sein würde.
Ich sollte niemals nach Vegas gehen, dachte sie, als sie sich von ihm entfernte. Wahrscheinlich würde ich meine Hose verspielen, und das Ende vom Lied wäre, dass ich anstelle der Klamotten mit einem Fass herumlaufen würde.
Als Terri sich bei den Polizeibeamten meldete, die versuchten, die Menschenmenge unter Kontrolle zu halten, wanderte ihr Blick immer wieder zu dem Fire Marshal zurück, der dabei war, den Tatortermittlern Anweisungen zu geben. Sie hatte sich selbst eingebläut, Cort nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken – Masochismus war nicht ihr Ding, und Cort schien sie jedes Mal dabei zu ertappen, wenn sie zu ihm hinsah –, aber im Moment war er beschäftigt, und sie konnte ihn so lange beobachten, wie sie wollte.
Wenn es um Cortland Gamble ging, gab es eine Menge, worüber man in Verzückung geraten konnte.
Terri hatte schon immer auf große Männer gestanden, und der Marshal maß stattliche eins fünfundneunzig, hatte breite Schultern und lange Glieder. Andere Männer seiner Statur schlackerten vielleicht herum wie Menschenaffen, aber er bewegte sich schnell und mit großer Leichtigkeit. Sein braunes Haar war stets kurz geschnitten, sein kantiger Kiefer glatt rasiert und seine Kleidung so makellos, dass er jederzeit für das Titelbild der GQhätte posieren können.
Selbstverständlich war alles an Cort Gamble immer perfekt. Alles andere wäre unter seiner Würde gewesen. Manchmal fragte sie sich, ob er auch seine Boxershorts bügelte.
Außerdem zog der Marshal mit geradezu religiöser Beharrlichkeit sein Fitnessprogramm durch, joggte jeden Morgen und stemmte Gewichte. Terri wusste das, weil sie im selben Fitnessstudio waren, obwohl sie sich gezielt darum bemüht hatte, seine Trainingszeiten rauszufinden, um nicht gleichzeitig mit ihm dort zu sein. Er musste seine Gewichte seit dem Frühjahr heraufgesetzt haben, denn alles an ihm war ein bisschen fester, ein bisschen muskulöser geworden. Als die Hitze ihn dazu brachte, die Jacke abzustreifen, stellte sie fest, dass selbst die Venen an seinen Armen sich mehr hervorhoben.
Zu blöd, dass die ganze Stärke und äußerliche Schönheit nicht wettmachen, dass du nach wie vor einhundertzehn Kilo Volltrottel bist.
Als hätte er ihre Gedanken gehört, sah Cort über die Straße hinweg zu ihr hin.
Ehe er ihr den »Blöde Zicke«-Blick schenken konnte, wandte Terri sich lässig einem Uniformierten zu und erteilte ihm Anweisungen, mit der Befragung der Umstehenden zu beginnen. Während sie sprach, hatte sie ein merkwürdiges Gefühl, als sträubten sich ihre feinen Nackenhärchen und als schnürte sich ihr Brustkorb zusammen. Ein Blick über die Schulter bestätigte, dass Cort sie immer noch beobachtete – mit einem noch aggressiveren Ausdruck als dem »Blöde Zicke«-Blick.
Sie hatte keine Ahnung, warum. Wie er ja schon deutlich gemacht hatte, wollte er sie nicht hier haben.
Sie kannte Cortland Gamble seit zehn Jahren, seit sie von der Polizeiakademie abgegangen war. Sein Bruder Jean-Delano war in ihrer Klasse gewesen, und der gesamte Gamble-Clan war bei der Abschlussfeier aufgekreuzt. Da J. D. und seine Brüder drei der bestaussehenden Männer der Stadt waren, hatte jede Frau bei der Zeremonie ein Auge auf sie geworfen.
Terri hatte J. D. gut leiden können, selbst dann noch, als sie sich beim Schießwettbewerb den ersten Platz teilen mussten. Als er sie zu sich gerufen hatte, um sie seiner Familie vorzustellen, war sie darauf vorbereitet gewesen, seinen großen Bruder auch zu mögen.
Und jetzt sieh dir an, wohin das geführt hat, chérie.
Vor Terris Gesicht tauchte ein Mikrofon auf. »Detective Vincent, können Sie unseren Zuschauern irgendwelche Einzelheiten über die Opfer dieser schrecklichen Tragödie erzählen?«
»Nicht, solange Sie mir dieses Ding vor die Nase halten, Trish.«
Patricia wich zurück, aber nur ein kleines Stück. »Kommen Sie schon, Detective, Sie wären nicht hier, wenn diese Menschen nicht ermordet worden wären. Sagen Sie mir irgendwas.«
»Na gut.« Terri beugte sich vor und senkte ihre Stimme zu einem Murmeln. »Gelb ist wirklich nicht Ihre Farbe.«
Sie ließ die Reporterin wutschnaubend stehen, überquerte die Straße und lief um das Gebäude herum in die Seitenstraße, wo die Leichen aufgereiht waren. Ein jung wirkender Feuerwehrmann stand Wache, während zwei Techniker der Gerichtsmedizin dabei waren, die Überreste in Säcke zu packen. Die Hände des jungen Mannes waren zu Fäusten geballt, und sein vom Rauch geschwärztes Gesicht wies um die Augen herum ungleichmäßige saubere Flecken auf.
Terri ging als Erstes zu ihm und zückte ihre Dienstmarke. »Detective Vincent, Morddezernat.« Sie las das Namensschild an seiner Jacke: MCCARTHY. So hieß auch einer von Corts leitenden Brandermittlern. Zur Feuerwehr zu gehen lag oft genauso in der Familie wie Polizist zu werden. »Sind Sie verwandt mit Gil McCarthy?«
»Mein Dad.« Er betrachtete sie argwöhnisch. »Was kann ich für Sie tun, Ma’am?«
»Zunächst mal aufhören, mich Ma’am zu nennen. Ich bin Terri.« Sie ging vor der Leiche, die am weitesten von den Technikern entfernt lag, in die Hocke und lüpfte eine Ecke des Lakens. Das Gesicht des jungen Mannes darunter wies kleinere Verbrennungen und Verletzungen auf, doch seine rot glühende Haut und der Mund und die Nasenlöcher, die schwarz vom Ruß waren, ließen keinen Zweifel an der Todesursache. Seine weit aufgerissenen dunklen Augen trugen den ausdruckslosen, starren Blick des Todes. »Sehen sie alle so aus?«
»Nur fünf davon. Die letzten beiden hier« – er deutete mit dem Kopf zum anderen Ende der Reihe – »sind ziemlich schlimm verbrannt.«
Terri hörte ein reißendes Geräusch, dann ein Plätschern und das leise Fluchen eines der Techniker. Leiche auseinandergerissen. Sie holte ihre Zigaretten heraus und hielt das Päckchen dem jungen Feuerwehrmann hin. »Wollen Sie?«
»Ja.« Er hatte in die Richtung geblickt, aus der das Geräusch gekommen war, und bediente sich mit zitternder Hand.
»Gehen wir da rüber.« Sie ging voran zur Hausecke, wo sie erst seine und dann ihre eigene Zigarette anzündete. »Ich bin Ihrem Dad letzten Sommer am See begegnet. Er ist da mit einem ganz hübschen Aquamaster rumgefahren, und zwar wie eine gesengte Sau. Gehört der ihm, oder hat er ihn gemietet?«
»Er hat ihn gekauft.« Er zog an der Zigarette und blies eine zittrige Rauchwolke aus. »Meine Mom hätte ihn fast umgebracht, aber er hat gesagt, entweder den oder ein Motorrad.«
»Gutes Boot für den Golf. Ich muss ihn mal bearbeiten, dass er mit mir übers Wochenende tauscht.« Sie deutete mit dem Kopf auf ihre Harley.
»Oh Mann.« In seinen Augen flackerte Unternehmungslust auf. »Wie viel Sachen macht die denn?«
»Ich hab sie bisher auf hundertvierzig gebracht, aber bei hundertneunzig ist Ende. Sie läuft auch super leise. Ich hab extra mehr Ablenkplatten in die Schalldämpfer einbauen lassen.« Sie blickte sich beiläufig um und sah, dass die Techniker fertig waren. »Wann haben Sie das nächste Mal frei?«
»Nächstes Wochenende.«
Sie zog eine eselsohrige Visitenkarte raus und schrieb eine Adresse auf die Rückseite. »Das ist mein Haus am See, falls Sie und Ihr Dad es mal benutzen wollen.« Sie reichte ihm die Karte. »Schlüssel liegt unter dem Geranientopf.«
Er wirkte etwas unsicher. »Sind Sie sicher, Detective?«
»Sagen Sie Gil nur, er soll das Bier wieder auffüllen.« Ihre Blicke begegneten sich. »Manchmal muss man einfach mal raus. Macht den Kopf frei.«
»Ja.« Er umklammerte die Karte fest mit der Hand. »Danke.«
Terri ließ ihn weiter Wache stehen und ging wieder zu den Leichen zurück. Nachdem sie sich mit den Gerichtsmedizinern abgesprochen hatte, zog sie den Reißverschluss des ersten Leichensacks auf und suchte behutsam den Körper ab. Der Inhalt der verkohlten Brieftasche des Opfers war noch lesbar, und sie notierte sich Namen und Adresse, bevor sie die Brieftasche wieder dahin zurücksteckte, wo sie sie gefunden hatte, und zum nächsten Leichnam ging.
Die Konfrontation mit einem brutalen und frühzeitigen Tod gehörte zu Terris Arbeit, aber gewöhnen konnte sie sich niemals daran. Sollte das eines Tages geschehen, würde sie den Dienst quittieren.
Drei weitere Opfer wurden in die Seitenstraße hinausgetragen, während Terri sich die Reihe entlangarbeitete. Das Maskers hatte viel Jungvolk angelockt – die meisten Opfer waren kaum Mitte zwanzig. Zwei der weniger verbrannten Mädchen trugen Bauchtaschen mit gefälschten Führerscheinen: Sie sahen so jung aus, dass sie vielleicht gerade mal Teenager waren. Sechs hatten keinen Ausweis bei sich, und vier andere waren so stark verkohlt, dass Terri nicht mal mehr ihre Gesichtszüge erkennen konnte.
Sie zog den letzten Reißverschluss auf und streckte sich, um einen Moment durchzuatmen. Sie war seit sieben Jahren beim Morddezernat, und sie hatte noch nie so viele Tote auf einmal gesehen. Diese Menge war irgendwie erdrückend. Vor allem jetzt, wo sie die Namen der meisten kannte und wusste, wo sie gewohnt hatten und was für Fotos sie bei sich trugen. Mindestens drei der Männer waren Väter von kleinen Kindern gewesen.
So viele Leben zerstört, einfach so.
Aber noch war es kein Fall für sie. Es gab keine Anzeichen, dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen war, keine offensichtlichen Schusswunden, nichts, das auf Mord hindeutete. Es konnte ein tragischer Unfall oder Fahrlässigkeit gewesen sein: defekte Leitungen, ein Feuer in der Küche, eine achtlos weggeworfene Zigarette. Aber irgendwas schien faul zu sein. Etwas in ihr war bereits wachgerüttelt und scharrte ungeduldig mit den Füßen, begierig darauf, dieses kranke Arschloch zu stellen, das das hier angerichtet und so viele Menschenleben ausgelöscht hatte.
Nicht, wenn Cort Gamble irgendwas zu melden hat.
»Arschloch.«
Terri drehte sich um, um herauszufinden, wer ihr da aus der Seele sprach, und sah den Gerichtsmediziner von New Orleans, Grayson Huitt, neben der ersten Leiche kauern. Der Pathologe war ein sonnengebräunter, blonder Exsurfer und besaß die dazu passende unbeschwerte Persönlichkeit. Im Moment sah er allerdings genauso glücklich aus, wie sie sich fühlte.
»Hey, Doc.«
Der struppige Blondschopf erhob sich, und die harten Linien um seinen Mund herum verschwanden, sobald er sie entdeckte. »Detective Vincent.« Er stand auf und kam zu ihr. »Verdienst du dir nachts noch was nebenher?«
»Der Notruf kam, als ich gerade vom Spätdienst kam.« Sie entfernte sich einen Schritt von der Reihe der Opfer. »Bei den meisten habe ich Führerscheine gefunden, aber ich brauche noch Fotos der unverbrannten Gesichter für die Familien.« Die Angehörigen zu benachrichtigen, war das Einzige, was sie noch mehr hasste als den Papierkram. »Ich schätze, du brauchst Zahnarztunterlagen für einige von ihnen.«
Gray musterte die aufgereihten Leichen. »Wir können das mit den Benachrichtigungen übernehmen.«
»Nein, ihr habt schon genug zu tun. Lass uns das machen.« Sie fuhr sich mit einer Hand durch den Nacken und musste feststellen, dass sie schweißnass war. »Fünfzehn. Großer Gott, Gray, die meisten waren noch Kinder.«
»Ich weiß.« Er legte ihr tröstend einen Arm um die Taille und drückte sie. »Fahr nach Hause, versuch ein paar Stunden zu schlafen. Wir kümmern uns um sie.«
Er roch nach dem exotischen Kaffee, den er kannenweise trank, und es war ein schönes Gefühl, einen Moment lang ihren Kopf an seinen Arm zu lehnen. Gray war in Ordnung, jemand, auf den man sich stützen und verlassen konnte, wenn einem alles zu viel wurde. Zu schade, dass sie niemals mehr sein würden als Kumpels.
»Gibt es ein Problem, Detective?«
Cort Gambles unterkühlte Stimme ließ Terri kurz die Augen schließen. Wieso, Marshal? Haben Sie nicht selbst genug davon?
»Nein.« Sie wich von Gray zurück und trat ihm gegenüber. Der Fire Marshal stand nur einen halben Meter entfernt, zwar mit Wasser- und Rußflecken auf der Jacke, aber ansonsten so perfekt wie immer.
Terri wusste, dass sie verboten aussah, aber sie hatte keine Lust, die Abscheu in Corts Augen zu sehen. Das hatte sie bereits einmal zu oft. Nein, worauf sie wirklich Lust hatte, waren eine Zigarette, ein Bier und eine ruhige, dunkle Ecke, wo sie beides genießen konnte.
Eine dunkle Ecke, beispielsweise in Toronto.
»Gray, ich bin morgen um sieben wieder da«, sagte sie und blickte immer noch in die kalten Augen des Marshals. »Ruf mich an, wenn die Porträts abgeholt werden können.« Sie verließ die Seitenstraße und ging auf ihr Motorrad zu.
Cort folgte ihr. »Was treibst du hier? Nachtschicht?«
Bei ihm klang es so, als täte sie ihren Dienst nur, um ihn auf die Palme zu bringen. »Ich arbeite, wenn es mir aufgetragen wird, Marshal. Wie jeder andere Cop in der Stadt.«
»Das ist noch nicht euer Fall.«
Er wollte sie nicht hier haben. Weder hier noch irgendwo in seiner Nähe. Als müsste er ihr das noch sagen. Dachte er allen Ernstes, sie würde nicht merken, wie er ihr seit dem Mardi-Gras-Ball seiner Mutter aus dem Weg gegangen war? Hätte nur noch gefehlt, dass er es in Schriftgröße zwanzig auf die Titelseite der New Orleans Tribune drucken ließ: Terri, bleib mir vom Hals!
Sie hätte ihn in Ruhe gelassen. Zu wissen, was er empfand, konnte ihr nicht das Herz brechen, denn dazu war es schon in viel zu viele Teile zerfallen.
»Hast du mich gehört? Das hier ist nicht …«
»Ich hab’s gehört, und so Gott will, werde ich nicht mehr hier sein, wenn es wirklich feststeht.« Sie nahm ihren Helm. »Bis dann.«
Er legte eine Hand auf ihr Motorrad. »Was redest du da? Du bist immer noch im Morddezernat.«
J. D. schien ihr Versetzungsgesuch nicht erwähnt zu haben. Andererseits war J. D. ja auch in den Flitterwochen. Er hatte Sable Duchesne geheiratet, die Liebe seines Lebens und die Frau, wegen der er beinahe suspendiert worden wäre. Er hatte Besseres zu tun, als über seinen Bruder und seine Partnerin nachzudenken, zum Beispiel seine neue Braut über den Strand jagen.
»Entweder willst du mich oder nicht, Marshal.« Mit den Ellenbogen schob sie seine Hand einfach weg. »Entscheide dich.« Sie streifte sich den Helm über und zog den Kinnriemen fest.
Als sie auf das Motorrad stieg, beugte er sich vor. »Ich will dich nicht.«
Sie klappte das Visier hoch und schenkte ihm einen letzten, langen Blick. Sie brauchte sich nicht vorzustellen, wie er nackt aussah. Dank einer langen, heißen Nacht, in der er betrunken bei ihr vorbeigekommen war, wusste sie es.
Ich habe dir vertraut, und so redest du mit mir. Als wäre ich Abschaum.
Es hatte eine Weile gedauert – die Hoffnung starb zuletzt –, bis Terri nach ein paar Wochen endlich eingesehen hatte, warum Cort Gamble sie seitdem behandelte wie eine blutende AIDS-Patientin: Er bereute es, die Nacht mit ihr verbracht zu haben. Die Nacht, in der er all ihre Fantasien hatte wahr werden lassen, die Fundamente ihrer Welt erschüttert und sie dann allein in einem kalten, leeren Bett hatte aufwachen lassen.
Dass er sie am Morgen danach alleingelassen hatte, war nicht das Schlimmste gewesen. Das hatte sie vorher auch schon erlebt. Auch nicht, wie er sie seitdem behandelte – jeder machte mal Dinge, die er später bereute. Sie musste es wissen, denn er gehörte zu ihren Dingen.
Nein, Cort hatte ein Recht auf seine Gefühle. Terri war ein großes Mädchen, sie kam damit klar. Sie war nie der Meinung gewesen, dass er ihr irgendwas schuldig war.
Aber das hier – dass er ihr seine Verachtung geradezu unter die Nase rieb –, das konnte sie wirklich nicht gebrauchen.
Das war das Allerschlimmste.
»Kein Problem«, sagte sie sehr sanft, ehe sie das Motorrad startete und in die Nacht hinausfuhr.
2
Die Nachricht von den fünfzehn Todesopfern im Maskers Tavern wurde durch die Associated Press im Handumdrehen verbreitet und über Nacht zur nationalen Schlagzeile gemacht. Sie wurde bei CNN bis ins kleinste Detail aufgerollt und bildete die Hauptmeldung in jeder Morgensendung im ganzen Land.
Patricias Prophezeiung traf genau zu: Blut verkauft sich gut.
Cort verließ das French Quarter erst, nachdem er seine Brandstiftungseinsatztruppe positioniert hatte und der Unglücksort abgesichert war, und dann musste er das Gebäude, in dem sein Büro lag, durch den Hintereingang betreten, um die Presse zu umgehen, die die Vorderseite belagerte.
Corts Assistentin Sally, eine freundliche und tüchtige junge Frau, die vorher in der Notrufzentrale gearbeitet hatte, wartete dort schon mit einer dampfenden Tasse Kaffee, einem Stapel Nachrichten und einem handgeschriebenen Terminplan.
»Der Bürgermeister will Sie um zehn mit einem vorläufigen Bericht in seinem Büro sehen«, sagte sie, als sie ihm den Kaffee reichte. »Fragen Sie nicht nach den Anrufen von Zeitungen und Fernsehsendern. Und mit Dan Rather oder Peter Jennings wollen Sie wohl nicht sprechen, oder?«
»Nein.« Cort sah auf seine Uhr und stellte fest, dass es noch nicht mal sieben war. »Wer hat Sie denn so früh hierhergeschleift?«
»Der Nachtschichtleiter. Er hasst das Telefon, und anscheinend klingelt es seit fünf Uhr morgens ununterbrochen.« Sie folgte ihm in sein Büro und legte ihm die zu erledigenden Sachen auf den Schreibtisch. »Irgendjemand, mit dem Sie reden wollen?«
»Gil McCarthy. Und mit jedem aus der Einsatztruppe.« Er trank von Sallys exzellentem Kaffee und fügte dann widerwillig hinzu: »Detective Vincent vom Morddezernat.«
»J. D.s Partnerin?« Sally hob die Augenbrauen. »Die redet noch mit Ihnen?« Sie gab einen Laut von sich, als grenzte das an ein Wunder.
Was, rückblickend betrachtet, wahrscheinlich auch so war. »Stellen Sie sie einfach durch.«
»Aye, aye, Captain.« Auf dem Weg nach draußen schloss sie seine Jalousien.
Cort schaltete den Computer an und begann den vorläufigen Bericht zu tippen, den der Bürgermeister in zwei Stunden auf seinem Schreibtisch haben wollte. Als Brandinspektor war Cort dafür zuständig, alle Brände innerhalb der Stadtgrenzen zu überwachen, die verschiedenen Brandarten auszuwerten und einzuschätzen, ob ein bestimmtes Muster vorlag, das auf Vorsatz oder böse Absicht hinweisen konnte.
Im Maskers-Fall hatte er herzlich wenige Anhaltspunkte, abgesehen von der hohen Opferzahl und der Schnelligkeit, mit der das Gebäude abgebrannt war. Was auch immer das Feuer ausgelöst hatte, es war schnell, stark und wirkungsvoll gewesen. Nach der Verteilung der Fensterglasscherben und anderen äußeren Schäden zu urteilen, hatte die Kneipe nicht einfach bloß Feuer gefangen.
Etwas war innerhalb des Gebäudes detoniert.
Es gab nur einen aktiven Brandstifter in New Orleans, dem er diesen Job zutraute, und den verfolgte Cort schon seit Monaten. Wenn das Maskers das Werk des Torchers war, war er fällig. Mit Mord in fünfzehn Fällen hatte er sich einen Aufenthalt in Angola, dem größten Hochsicherheitsgefängnis der USA, verdient und, wenn seine Rechtsmittel ausgeschöpft waren, eine tödliche Injektion.
Sein Handy klingelte, und er meldete sich. »Gamble.«
»Du bist gestern Nacht nicht zu Hause gewesen«, sagte ein Mann mit starkem französischem Akzent. »Deine Mutter sieht dich im Fernsehen. Sie ruft mich an. Sie ist sauer auf dich. Und ich soll jetzt mit dir schimpfen.«
Als er die Stimme seines Vaters hörte, ließ Cort sich in seinen Stuhl sinken. »Ich bin keine fünfzehn mehr, Dad.«
»Wenn ich ihr das sage, schimpft sie mit mir.«
»Ich habe eine Flasche Maison Surrenne.«
Es gab nichts, was Louis Gamble mehr liebte als französischen Cognac, außer vielleicht noch einer guten Zigarre dazu. »Sechsundvierziger?«
»Sechsundvierziger.«
»Na gut, genug geschimpft.« Seine Stimme wechselte von forsch zu sanftmütig.
»War keine gute Nacht, was? Ich bring dir was zum Mittagessen.«
Louis Gamble gehörte das Krewe of Louis, das berühmteste französisch-kreolische Restaurant von New Orleans. Er war außerdem der beste Koch in der Stadt, und Essen war sein Allheilmittel.
»Nein danke, Dad. Da bin ich nicht mehr hier.« Cort lehnte sich in seinem Stuhl zurück und rieb sich die Augen. Dass er während der Suche nach einer neuen Wohnung vorübergehend zu seinen Eltern gezogen war, war zwar sehr bequem gewesen, dass sie sich – in ihrem Alter – Sorgen um ihn machen mussten, war hingegen gar nicht in Ordnung. Er musste die Suche vorantreiben und so bald wie möglich wieder ausziehen. »Tut mir leid, dass ich nicht angerufen habe.«
»Deine Mutter wird einen Aufstand proben wollen, wenn du nach Hause kommst. Und du wirst sie lassen.«
Seine Mundwinkel hoben sich. »Ich werde sie lassen.«
»Lâche pas la patate, mon fils.«
Lass die Kartoffel nicht fallen. Ein Sprichwort der Cajun, das so viel bedeutete wie Gib nicht auf. Louis hatte es von Sable übernommen, J. D.s frisch angetrauter Ehefrau. Cort hatte den Verdacht, dass die Vorliebe für Sumpf-Slang, die sein Vater neuerdings hegte, einerseits eine Sympathiebekundung für seine neue Schwiegertochter und andererseits einen kleinen Seitenhieb gegen Corts Mutter darstellte.
»Oui, père.« Er beendete das Gespräch und trank den lauwarmen Kaffee aus, bevor er einen Blick in seine oberste Schreibtischschublade warf. Er wollte den unbeschrifteten, unverschlossenen Umschlag, der sich unter seinem Papiervorrat verbarg, eigentlich nicht rausholen. Das wollte er nie.
Und doch öffnete Cort die Schublade, hob den Papierstapel an und zog den Briefumschlag hervor, wie er es seit Mardi Gras fast jeden Tag getan hatte. Er drehte ihn in den Händen und wünschte sich, er könnte ihn einfach in den Papierkorb neben seinem Schreibtisch werfen. Und wusste, dass er das niemals tun würde.
Cort öffnete die Lasche und nahm drei Fotos heraus. Sie waren vor zehn Jahren bei der Abschlussfeier seines jüngeren Bruders an der Polizeiakademie gemacht worden.
Das erste zeigte eine jüngere Version von J. D. in seiner Polizeiuniform, der seinen Arm um Terri Vincent legte. Damals war sie schon genauso groß und dünn gewesen, hatte aber ihr dunkles Haar zu einem langen Pferdeschwanz zusammengenommen. Der Einzige, der lächelte, war J. D.
Terri dagegen hatte die Kamera angesehen – oder vielmehr Cort, der die Kamera hielt – wie einen Junkie mit einem Messer in der Hand, dem sie in einer dunklen Gasse begegnet war.
Wenn Cort jetzt zurückdachte, musste er zugeben, dass sie womöglich recht gehabt hatte. Er war an jenem Tag alles andere als freundlich zu ihr gewesen. Zwar höflich, aber die Feindseligkeit auf den ersten Blick war unübersehbar gewesen und hatte auf Gegenseitigkeit beruht.
Um ehrlich zu sein, hatte er sie an diesem Tag wie einen bewaffneten Drogensüchtigen behandelt.
Natürlich nicht ohne guten Grund. Cort hatte mitbekommen, wie sie mit den anderen Absolventen rumgealbert und einen Witz nach dem anderen gerissen hatte, einige davon ziemlich derb. Ihm war aufgefallen, dass sie Zigaretten rauchte, eine Angewohnheit, die er persönlich schon immer verabscheute. Kein Freund erschien auf der Bildfläche, und keine der weiblichen Absolventinnen schien mit Terri befreundet zu sein. Sie schien sich damit zufriedenzugeben, mit den Kerlen rumzuhängen. Cort hatte einige Mädchen gekannt, die lieber Jungs gewesen wären, aber bei allen hatte sich das ausgewachsen und aus ihnen waren hübsche, attraktive Frauen geworden.
Terri Vincent hatte diese Verwandlung offensichtlich nie durchgemacht, und es schien sie auch nicht zu kümmern. Das hatte ihn einerseits irritiert und andererseits geärgert. Er bevorzugte selbstbewusste, feminine Frauen, die nicht versuchten, den Männern Konkurrenz zu machen. Und doch hatte keines der Mädchen, mit denen er zusammen gewesen war, eine derart intensive und unerschütterliche Anziehungskraft auf ihn ausgeübt wie Terri vom ersten Augenblick an.
Das zweite Foto war ein Gruppenschnappschuss, auf dem J. D. zu sehen war, der sich mit Terri unterhielt, und ein paar Freunde aus ihrer Klasse. Corts Mutter Elizabet hatte sich dafür die Kamera ausgeliehen, und Terri, die gerade seinen Bruder angrinste, war im Profil getroffen. Sie war nicht schön, nicht einmal, was Cort als hübsch bezeichnen würde, außer auf diesem Foto: Die Sonne hatte ihr direkt ins Gesicht geschienen, und ihre gelbbraune Haut hatte geleuchtet. Genauso wie ihr Lächeln.
Natürlich hatte sie Cort nie so angelächelt. Nicht ein einziges Mal in zehn Jahren. Aber er hatte sie noch einmal leuchten sehen. In jener Nacht, als er sie dazu gebracht hatte.
Etwas verkrampfte sich in ihm, bis er diese ganz speziellen Erinnerungen beiseiteschob und zum dritten und letzten Foto überging, das Terri Vincent zeigte, die ganz allein am Ende einer leeren Stuhlreihe saß. Das war gewesen, kurz nachdem die Gambles gegangen waren, um J. D. nach Hause zu bringen und zu feiern. Cort erinnerte sich, dass sein Bruder Terri eingeladen hatte mitzukommen, doch sie hatte abgelehnt und behauptet, ihre Familie würde irgendwo auf sie warten. Cort war noch etwas länger geblieben, um sich mit einem Freund zu unterhalten, und so hatte er rausgefunden, dass sie J. D. angelogen hatte.
Ihre Familie war gar nicht da. Niemand war zu Terris Abschlussfeier gekommen.
Cort wusste nicht, warum er das dritte Bild gemacht hatte und warum er nicht zu ihr gegangen war und darauf bestanden hatte, dass sie mitkam. Er hätte es gern getan, aber sie war mit J. D. befreundet, nicht mit ihm. Außerdem hätte er nicht garantieren können, dass er die Finger von ihr gelassen hätte.
Er hatte zugesehen, wie sie noch weitere Angebote, bei irgendjemandem mitzufeiern, ausschlug, und dann hatte sie sich von der Veranstaltung fortgeschlichen, genauso, wie sie gekommen war: allein.
Als Cort den Film später hatte entwickeln lassen, hatte er seiner Mutter Abzüge von allen Bildern gegeben, außer von diesem. Er hatte die Negative behalten und die Aufnahme von Terri allein nie jemandem gezeigt, nicht mal seinem Bruder. Natürlich hielt er sein Verhalten für pubertär und zwanghaft. Er hätte die Fotos schon vor Jahren wegwerfen sollen, aber jedes Mal, wenn er das versuchte, endete es damit, dass er sie vorsichtig wieder in den Umschlag steckte und zurücklegte. So wie jetzt.
Sally klopfte zweimal und steckte dann den Kopf rein. »Ich habe frischen Kaffee gemacht. Und selbst gebackene Muffins, wenn Sie wollen.«
Er schloss die Schublade. »Erhoffen Sie sich eine Gehaltserhöhung?«
Sie grinste. »Klar, immer.«
Sally versorgte ihn mit Kaffee, bis er den Bericht fertig hatte und Gil anrief, um zu fragen, wie es bei ihm voranging. Sein Chefermittler ließ seine Männer bereits den Unglücksort durchkämmen, den Schaden fotografieren und Beweisstücke eintüten.
»Dem Geruch nach wurde Kerosin als Brandbeschleuniger verwendet«, sagte Gil. »Es stinkt überall danach. Bisher keine Behälter oder Brandsätze. Keine Ähnlichkeit mit bisherigen Fällen, aber der Kerl war ein Profi.«
»Suchen Sie weiter.« Sein Handy klingelte wieder. »Wir reden später noch.« Er wechselte die Telefone. »Gamble.«
»Mein Sohn war letzte Nacht in dieser Kneipe«, sagte eine tiefe, raue Stimme.
Die Stimme war unverkennbar. »Tut mir leid, das zu hören.« Cort wusste, dass der Mafiaboss Frank Belafini nur einen Sohn hatte, Stephen, den er als seinen Nachfolger vorgesehen hatte.
»Nein, tut es nicht, aber es wird Ihnen bald leidtun.«
Das Telefon in seinem Büro war an ein Aufnahmegerät gekoppelt, aber er hatte keine Möglichkeit, ein Gespräch auf seinem Handy mitzuschneiden. »Was wollen Sie, Belafini?«
»Den Hurensohn, der Stephen umgebracht hat.«
Und das aus dem Munde eines Mannes, der mehr Morde angeordnet hatte, als irgendjemand zählen konnte. »Sie wissen doch ganz genau, dass das nicht passieren wird.«
»Sie finden ihn und bringen ihn mir, Gamble. Oder ich finde ihn, und Sie können dabei zusehen, wie meine Jungs die Stadt auseinandernehmen, Block für Block.«
»Jetzt kommen Sie schon, Detective, können Sie nicht wenigstens bestätigen, dass es Mord war?«, bettelte Tricia Brown am Telefon.
Terri kritzelte auf ihrer Schreibtischunterlage herum, und aus dem Kabel, das zu einem Mikrofon führte, wurde ein Strick. »Welchen Teil von ›kein Kommentar‹ verstehen Sie denn nicht, Trish?«
»Wir haben fünfzehn Leichen«, stellte die Reporterin fest und klang, als hätte sie die Opfer des Maskers Tavern direkt vor sich auf dem Schreibtisch liegen. »Irgendjemand muss für ihren Tod verantwortlich sein, und die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, wer.«
Terri zeichnete ein glotzäugiges Strichmännchen, das an dem Strick hing. »Sie finden, jemand sollte dafür gekreuzigt werden, und Sie möchten persönlich den ersten Nagel reinschlagen. Glauben Sie, dass Sie es damit zu Good Morning America oder Regis and Kelly schaffen?«
»Ich bin Journalistin.« Patricia warf ihre Selbstgerechtigkeit über Bord und ging fließend zu verletzter Würde über. »Ich berichte über Tatsachen.«
»Sie sind ein Spürhund für Einschaltquoten, Trish.« Terri nahm einen roten Stift und malte dem Strichmännchen einen feschen Haarhelm. »Wenn Sie ein Exklusivinterview über den Fall ergattern, brauchen Sie nicht mehr jedes Mal, wenn Charlie Boudreaux im Urlaub ist, den Wetterfrosch zu spielen. Es sei denn, der Senderchef, dem Sie es besorgen, beschließt schon vorher, sein Versprechen endlich wahrzumachen.«
Sie sog zischend die Luft ein. »Ich kriege Sie schon noch …«
»Nur, wenn Sie mich vorher küssen.« Terri drückte den Knopf, der das Gespräch auf dieser Leitung beendete, und dann einen anderen, um die Zentrale anzurufen. »Wenn sie nicht einen Mord gestehen will, leiten Sie bitte alle künftigen Anrufe von Patricia Brown an den Pressereferenten weiter.«
»Ja, Detective.«
»Vincent.«
Terri legte auf, und als sie den Kopf hob, erblickte sie den Chef des Morddezernats, George Pellerin, der sich vor ihrem Schreibtisch aufgebaut hatte. Das breite, auf hässliche Art interessante Gesicht ihres Chefs war nicht rot, was für gewöhnlich bedeutete, dass er nicht vorhatte, sie wegen irgendwas zusammenzustauchen. »Sir?«
»Packen Sie Ihre Sachen.« Er reichte ihr einen weißen Umschlag. »Ihre Versetzung ist durch.«
Sie widerstand der Versuchung, in Jubelschreie auszubrechen, als sie sich ihre neue Aufgabenzuweisung ansah. Sie wurde vorübergehend in die OCU, die Abteilung für organisiertes Verbrechen, versetzt, die erste Wahl in ihrem Antrag. »Danke, Captain.«
»Freuen Sie sich bloß nicht zu früh«, grummelte er. »Sobald sich Gamble mit seiner Frischvermählten genug in der Sonne von Jamaica geaalt hat, sind Sie wieder zurück.«
Was in drei Wochen der Fall sein würde. Lang genug, dass Cort mit einem anderen Polizeibeamten zusammen an seinem Kneipenbrand arbeiten konnte. Er würde glücklich sein, und sie brauchte ihr Gesicht nicht mehr ständig mit einem unechten Lächeln zu verkrampfen. »Ja, Sir.«
»Hazenel übernimmt Ihre unabgeschlossenen Fälle, also bringen Sie ihn auf den neuesten Stand, bevor Sie gehen.« Pellerin wies mit einem Blick auf den Detective am anderen Ende des Gruppenraums, bevor er sie scharf anschaute. »Sie haben gestern Nacht den Maskers-Notruf entgegengenommen.«
»Er kam ziemlich spät rein. Ich dachte, ich erspare Jerry den Weg.« Sie deutete mit dem Kopf auf den Bericht in ihrer Schreibmaschine. »Ich fasse gerade die Angehörigenberichte zusammen.«
»Nehmen Sie mich in den Verteiler auf. Und Vincent …«
»Sir?«
»Machen Sie es sich nicht zu bequem.« Er tippte auf die Kante ihres Schreibtischs. »Ich will Sie in drei Wochen wieder hier sehen.«
Aus Pellerins Mund war das definitiv ein Kompliment. »Ja, Sir.«
Lawson Hazenel war nicht gerade begeistert, Terri und den Stapel Akten zu sehen, den sie eine Stunde später auf seinem Schreibtisch ablud. Sein unscheinbares, offenherziges Gesicht verzog sich sichtlich, als er erst den Haufen und dann sie musterte. »Vielen Dank, Vincent. Als hätte ich nicht schon genug zu ackern.«
»Heul dich beim Captain aus, Haze.« Sie nahm die oberste Akte und warf sie ihm hin. »Die hier ist noch offen. Kneipenbrand im Quarter gestern Nacht. Fünfzehn Tote, vielleicht auch mehr. Melde dich bei Gray Huitt, er müsste die aktuellen Zahlen haben.«
»Jetzt brauch ich eine Versetzung.« Er schlug den Ordner auf und überflog die erste Seite. »Hat die Feuerwehr es schon als Brandstiftung bestätigt?«
»Nein, aber der Laden ist verdammt schnell in Flammen aufgegangen. Als wäre er aus Pappe gewesen.« Sie löste die Seiten mit den Personalien der Opfer aus ihrem Notizblock und gab sie ihm. »Ich habe die vorläufigen Berichte geschrieben, und eine Opferhilfeeinheit kümmert sich um die Anrufe bei den Angehörigen. Marshal Gamble müsste heute noch eine Stellungnahme abgeben.«
»Marshal Gamble.« Law heftete die Notizen in den Ordner ein. »Korrigier mich, wenn ich falschliege, aber war er das letzte Mal, als du von ihm gesprochen hast, nicht noch ›dieses gefühllose Arschloch, das mich zur Tippse degradiert hat‹?«
»So schlimm ist er gar nicht, wenn man ihn näher kennt«, log sie.
»Da sagt dein Cousin aber was anderes.« Er legte den Kopf schief. »Angeblich hat Gamble ihm fast den Kiefer gebrochen, als er sich an Mardi Gras mit ihm geprügelt hat.«
Cort war in eine Schlägerei mit ihrem Cousin Caine Gantry geraten, als sie wegen des Mordes an dem Gouverneurs-Kandidaten Marc LeClare gegen Caine ermittelt hatten. Terri wusste immer noch nicht genau, um was es bei diesem Kampf überhaupt gegangen war.
»Mein Cousin war an dem Abend wirklich ein Vollidiot«, sagte sie. »Ich hätte ihn ja selbst fast über den Haufen geschossen.«
Der andere Polizist sah skeptisch aus. »Wenn du dich auf einmal so gut mit dem Marshal verstehst, warum machst du dann diesen Ausflug in die OCU?«
»Ich brauch einfach mal eine Abwechslung. J. D. ist nächsten Monat zurück, und ich auch.« Sie mochte Lawson Hazenel, aber sie hatte nicht vor, ihm ihr Herz auszuschütten. »Lass uns die anderen Akten durchgehen, damit ich hier verschwinden kann.«
Nachdem sie Lawson kurz über die übrigen offenen Fälle ins Bild gesetzt hatte, packte Terri das Nötigste von ihrem Schreibtisch zusammen und trug die Kiste zum Fahrstuhl. Weil sie eng mit einigen Bundesbehörden zusammenarbeitete, waren die Büros der Abteilung für organisiertes Verbrechen vor Kurzem in das Gerichtsgebäude am anderen Ende des Blocks gezogen. Dort fuhr Terri hin, meldete sich am Empfang und wurde zu ihrem neuen Schreibtisch im Gruppenraum der Organized Crime Unit begleitet, der dem des Morddezernats zum Verwechseln ähnlich sah.
Abgetrennte Kabinen, die der Diskretion dienten, bildeten ein Labyrinth aus ordentlichen Schreibtischen, laufenden Computern und Kriminalbeamten in Zivil. Während sie ihre persönlichen Dinge verstaute, nickte sie den wenigen zu, die sie kannte. Der Computer auf ihrem Schreibtisch war ausgeschaltet, aber bei seinem Anblick musste sie ein Stöhnen unterdrücken. Sie kannte sich mit Computern wohl am wenigsten von allen NOPD-Mitarbeitern aus, ein Grund, warum sie drüben im Morddezernat immer noch eine Schreibmaschine benutzte.
»Ich hoffe, für dich gibt es auch ein Handbuch«, sagte sie zu dem Gerät.
»Für jeden gibt es eins.« Ein großer, dunkler Mann tauchte in der Lücke zwischen ihren Kabinenwänden auf. Es war entweder ein tief gebräunter Weißer oder ein hellhäutiger Afroamerikaner. Es war unmöglich an seinem glatt rasierten Schädel und den eindringlichen, unergründlichen schwarzen Augen zu erkennen. »Dann sind Sie wohl Therese Vincent.«
»Terri. Hi.« Sie streckte die Hand aus.
»Sebastien Ruel. Willkommen in der OCU.« Nach einem knappen Händedruck deutete er auf das große Eckbüro. »Lassen Sie uns reden.«