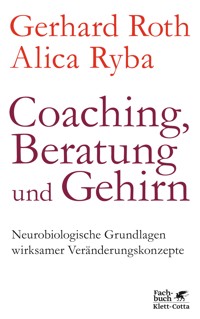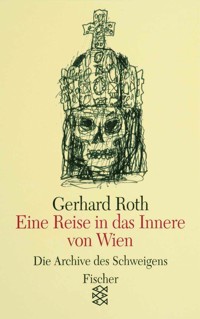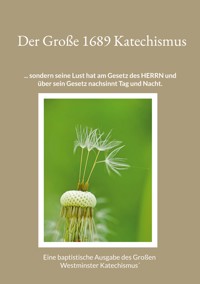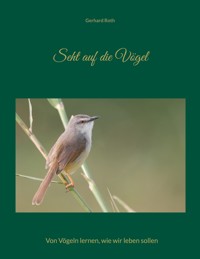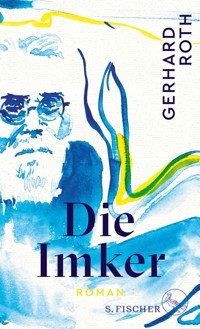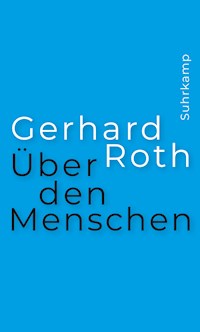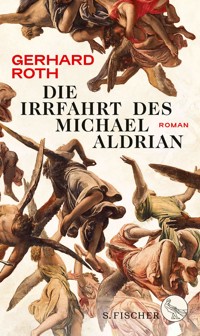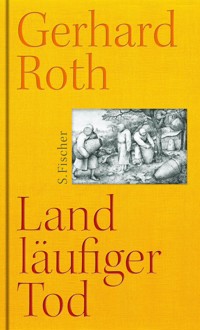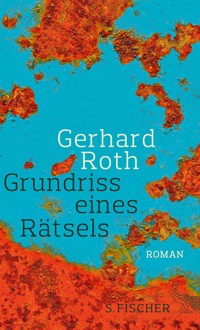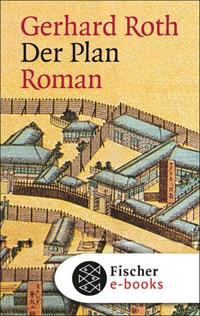9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Wunder der Erinnerung, ein Triumph autobiographischer Literatur Die erste Erinnerung ist ein flackernder Schwarzweißfilm: Winter 1945, ein Fliegerangriff auf einen Zug, den das Kind überlebt. Zwanzig Jahre später ist aus dem Kind ein junger Medizinstudent geworden, der in der Anatomie der Grazer Universität Leichen seziert und heimlich ersten Schreibversuchen nachhängt. Dazwischen entfaltet sich ein Leben in unvergesslichen Geschichten und exemplarischen Szenen: meisterhaft und aus dem überwältigenden Reichtum der Erinnerung erzählt Gerhard Roth von den Bedrängnissen durch Elternhaus, Schule und Religion, aber auch von der Flucht in die Wunderwelten des Kinos und der Literatur und vom Glück, Menschen zu begegnen, die das eigene Leben für immer verändern. Mit Aufrichtigkeit und Hingabe erzählt Gerhard Roth vom Rätsel der Kindheit und dem Wagnis des Erwachsenwerdens: von der Entdeckung des eigenen Ich und dem Weg ins Leben, vom Gang der Zeit und dem Wunder der Erinnerung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 936
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Gerhard Roth
Das Alphabet der Zeit
Über dieses Buch
Die erste Erinnerung ist ein flackernder Schwarzweißfilm: Winter 1945, ein Fliegerangriff auf einen Zug, den das Kind überlebt. Zwanzig Jahre später ist aus dem Kind ein junger Medizinstudent geworden, der in der Anatomie der Grazer Universität Leichen seziert und heimlich ersten Schreibversuchen nachhängt. Dazwischen entfaltet sich ein Leben in unvergesslichen Geschichten und exemplarischen Szenen: meisterhaft und aus dem überwältigenden Reichtum der Erinnerung erzählt Gerhard Roth von den Bedrängnissen durch Elternhaus, Schule und Religion, aber auch von der Flucht in die Wunderwelten des Kinos und der Literatur und vom Glück, Menschen zu begegnen, die das eigene Leben für immer verändern.
Mit Aufrichtigkeit und Hingabe erzählt Gerhard Roth vom Rätsel der Kindheit und dem Wagnis des Erwachsenwerdens: von der Entdeckung des eigenen Ich und dem Weg ins Leben, vom Gang der Zeit und dem Wunder der Erinnerung – große autobiographische Literatur.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011
© 2007 by Gerhard Roth
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401316-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Die Erinnerung ist eine [...]
Prolog
Die Reise 1945
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Eins Kindheit
Im Gartenhaus
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Die Rückkehr
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Die Dinge
Sterben
Feuer
Vater
I.
II.
III.
Weidweg 9
Die Fliege
Die Stadt
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Die Entstehung der Bilder
I.
II.
III.
Eine Theateraufführung
Personen, Masken
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Meine Brüder und ich
Aus der anderen Welt
I.
II.
Der Teddybär
Das Maskenfest
Partikel
I.
II.
III.
IV.
V.
Der Brief
Nächtliche Zwischenfälle, tägliche Visiten
I.
II.
Krank
I.
II.
III.
IV.
V.
Hamstern
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
Mein Mordversuch an Paul
I.
II.
III.
IV.
V.
Wie es weitergeht
I.
II.
Im toten Winkel
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Großmutter
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Streit, Ohrfeigen
I.
II.
Blutvergiftung
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Der Wal
Der Eismann
Der Zauberer
Der schwarze Hund
I.
II.
III.
Die Eisenbahnseite
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Nach dem Brand
I.
II.
III.
IV.
V.
Onkel Fritzl. Erster Besuch
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Die Heuschrecken
I.
II.
III.
IV.
V.
Verbotene Orte
I.
II.
III.
Buffalo Bill auf der Leinwand
I.
II.
III.
IV.
Die Chiffre
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Schundheftl
I.
II.
III.
IV.
V.
Pompeji
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Die lange Walz
Verwandte und andere Besucher
I.
II.
Doktorspiele
I.
II.
III.
IV.
V.
Der Radiergummi
I.
II.
III.
IV.
Ein Selbstmord
I.
II.
III.
IV.
V.
Die Heimstunde
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Die Bibliothek
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Lesen und Leben
I.
II.
III.
IV.
Schule
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Schlittenfahren
I.
II.
III.
IV.
Demaskierung
Ein Zwischenfall
Das »Naturalienkabinett«
I.
II.
III.
IV.
V.
Der verlorene Schuh
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Der Triebwagen
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Kaleidoskop
I.
II.
III.
Das Abenteuer
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Frau Prangl
I.
II.
Puzzles
Verschluckte Soldaten
I.
II.
III.
IV.
V.
Im Turnsaal
I.
II.
Fernweh
I.
II.
III.
Das Äffchen
I.
II.
III.
IV.
Beim Gärtner Kirov
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Not und Noten
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Die Brosche
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Fußball
I.
II.
III.
IV.
V.
Schulzahnarzt
I.
II.
Adi
I.
II.
III.
Redseligkeit
I.
II.
III.
IV.
Die Sandviper
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Lur-Grotte
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Mariatrost
I.
II.
Medizinische Lehrbücher
I.
II.
III.
Der Rezeptblock
I.
II.
III.
IV.
Purzel, der Hampelmann
I.
II.
III.
Auf dem Land
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Die Uhr
I.
II.
III.
IV.
V.
Speedway-Rennen
I.
II.
III.
Der Überfall
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
»Kein Platz für sie«
I.
II.
III.
»Zeig, was du kannst«
I.
II.
III.
IV.
V.
Der Umzug
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Geidorfgürtel 16
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Zurück ins Niemandsland
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Zwei Jugend
Bücher, Fotografie
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Elisabeth-Volksschule
I.
II.
III.
Scherrer
I.
II.
III.
Selbstmordgedanken
I.
II.
III.
IV.
Terror
I.
II.
III.
IV.
Versuch einer Traumbeschreibung
I.
II.
III.
IV.
Das Hemd
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Die Glasfabrik
I.
II.
III.
Gullivers Reisen
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Die Amsel
I.
II.
Die enge Welt
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Indianerspiel
I.
II.
III.
IV.
Soucek
I.
II.
III.
IV.
Kepler-Realgymnasium
I.
II.
Das Mädchen mit der weißen Mütze
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Bücher
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
Briefmarken
I.
II.
III.
IV.
Frau Hofer
I.
II.
III.
IV.
V.
Ein schlimmes Ereignis
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Epilepsie
I.
II.
III.
IV.
Berge
I.
II.
III.
IV.
Fliegen
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Kino, Filme
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Ordnung, Disziplin, Kritik, Freundschaft – ein Selbstporträt
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Sturm Graz
I.
II.
III.
IV.
V.
Fronleichnam
I.
II.
III.
IV.
Schloss Limberg
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Der Betriebsausflug
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Jugendverbot
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Das Geheimnis
I.
II.
III.
Der Unfall in der Herrengasse
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Fußball: Auf und ab
I.
II.
III.
IV.
Lachtalhaus
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Ausgeliefert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
Begegnung mit dem Religiösen
I.
II.
III.
Die Entdeckung
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Die Comic-Hefte im Feuerofen
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Im Zwischenreich
I.
II.
III.
Karl-May-Sammelbilder
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Charlie Rivel
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Professor Binder
I.
II.
III.
IV.
Insekten, Fußball
I.
II.
III.
Staatsvertrag
I.
II.
Großglockner
I.
II.
III.
IV.
V.
Schwimmen
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Alte Hüte
I.
II.
III.
Ein neues Schuljahr
I.
II.
Ein Autounfall
I.
II.
III.
Omis Krankheit
I.
II.
III.
Buchmüller
I.
II.
Schläge
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Zeit der Bedrängnis
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Die Taubstummenanstalt
I.
II.
III.
Eislaufen
I.
II.
III.
IV.
Das Tagebuch
I.
II.
III.
IV.
Omis Tod
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Die Tücke der Dinge
Wiedersehen mit Onkel Fritzl
I.
II.
III.
Die Befreiung
I.
II.
Die Firmung
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Großvater
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Genua 1956
I.
II.
III.
IV.
V.
Reisetagebuch
I.
II.
Das Kino wird meine wirkliche Welt
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Die Metamorphose
I.
II.
Der schwarze Falke
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Der Kinogeher
I.
II.
III.
IV.
V.
Mit Dr. Mabuse im Kinosaal
I.
II.
III.
IV.
V.
Radio
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Tormann
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Was vorher war
I.
II.
III.
IV.
V.
Der Ungarnaufstand
I.
II.
III.
Schach und Politik
I.
II.
III.
Die Bande
I.
II.
III.
IV.
V.
Fragen tauchen auf
Unbehagen
I.
II.
III.
Der Halbbruder
I.
II.
III.
IV.
G.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Abschied
I.
II.
III.
Im Krankenhaus
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Venedig, Grado
I.
II.
III.
Neue Freunde
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Mädchen
I.
II.
III.
IV.
IV.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Eine Rauferei
I.
II.
In der neuen Klasse
I.
II.
III.
IV.
V.
Selbstbetrachtung
I.
II.
Schwierigkeiten mit dem Vater
I.
II.
Eine Affäre
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Wer bin ich?
I.
II.
Picasso
Pauls Anfall
Wortverdreher, Sinnverdreher
Das rote Tagebuch
I.
II.
III.
Cesenatico
I.
II.
III.
Theater
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Der Nürnberger Prozess
I.
II.
III.
IV.
Großvater spricht mit mir
I.
II.
Die anderen
Religion
Politik
Der okkulte Tisch oder Das Tischerlrücken
Erika
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Schikurs
I.
II.
Ein treuer Diener
I.
II.
III.
Abschied und Wiedersehen
I.
II.
III.
Schlossberg
I.
II.
III.
Ferien
Kollaps
I.
II.
III.
Das blaue Heft
I.
II.
III.
IV.
V.
Neue Versuche
I.
II.
III.
Die Veränderung
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
Die verlorene Erinnerung
I.
II.
III.
Turbulenzen
I.
II.
Die achte Klasse
Der Priester
Der Zen-Meister
Jonas
Musterung
I.
II.
III.
Matura
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Der Entschluss
I.
II.
III.
Das Knochencolloquium
I.
II.
Latein
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Sezieren
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Literarische Versuche
Theater – Wolfgang Bauer
I.
II.
III.
IV.
V.
Nach dem Theater
I.
II.
III.
IV.
In der Freizeit
I.
II.
Aufzeichnungen eines überflüssigen Menschen
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Heimito von Doderer
I.
II.
III.
IV.
H. C. Artmann
Gerhard Rühm
Drogen, ein Ausblick
I.
II.
III.
IV.
V.
Peter Pongratz
Herzstillstand
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Gehirnsektion
I.
II.
Drei Tod
1970. Kapitel
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
1973. Kapitel
I.
II.
III.
IV.
V.
2001. Kapitel
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Anhang
Mein Vater
I.
II.
III.
Meine Mutter
Die Liebesgeschichte
Epilog
Bilderzählung
Die Erinnerung ist eine Fata Morgana in der Wüste des Vergessens.
Prolog
Die Reise 1945
I.
Die Fahrt nach Würzburg im Alter von zweieinhalb Jahren war seine erste Erinnerung und damit auch seine wahre Geburt.
Er hatte die Geschichte so oft gehört, dass er nicht mehr wusste, was er sich selbst gemerkt und was er zu den Erzählungen dazufantasiert hatte.
Sein Vater, hatte ihm seine Mutter kurz vor ihrem Tod noch in einem Brief geschrieben, sei in einem Lazarett im unterfränkischen Mainbernheim als Stabsarzt stationiert gewesen und habe sie, da die Russen nach Österreich vorstießen, gedrängt, von Graz zu ihm nach Deutschland zu kommen, wo die Amerikaner erwartet wurden. Seine Besorgnis habe er mit dem schlechten Ruf der russischen Soldaten als Vergewaltiger begründet, und mit seiner und ihrer Mitgliedschaft bei der NSDAP, für die er bei den Amerikanern mehr Gnade erhoffte.
Am 19. Januar 1945 sei seine Mutter mit ihm und seinen beiden Brüdern Paul, damals vier Jahre alt, und Helmut, den sie im November des Vorjahres zur Welt gebracht hatte, aufgebrochen. Sie seien jedoch nicht bis zum Bahnhof gekommen, da die Stadt kurz nachdem sie das Haus verlassen hatten bombardiert worden sei und sie im Schlossbergstollen hatten Zuflucht nehmen müssen, wo sie mehrere Stunden auf das Ende des Angriffes warteten. Durch die Annenstraße, in der die meisten Häuser getroffen waren und brannten, habe seine Mutter mit ihren Kindern und zwei Reisekoffern sodann den Bahnhof erreicht, es hätte jedoch die ganze Nacht gedauert, bis die Eisenbahnschienen wieder repariert waren, weshalb sie in der zugigen Halle und in Befürchtung eines weiteren Bombenangriffs den Morgen abgewartet habe. Erst dann sei der Zug, der sie nach München bringen sollte, eingefahren. Man habe sie jedoch mit ihren Kindern nicht einsteigen lassen wollen, da es sich um keine reguläre Verbindung, sondern um einen Verwundetentransport gehandelt habe, dessen Waggons mit einer weißen Kreisfläche und dem roten Kreuz gekennzeichnet waren. Trotzdem sei es ihr gelungen, in einem Abteil Platz zu nehmen. Als sie ein wütender Feldwebel, der ihr vom Bahnsteig gefolgt war, wieder hinausgewiesen habe, hätte sie sich an einen Offizier gewandt, der die Angelegenheit mit einem knappen Befehl regelte.
II.
Meine Erinnerung setzt ein, als mich ein verwundeter Soldat mit einem Kopfverband und einer Augenbinde auf seine Knie hebt. Ich will mich losreißen, aber meine Mutter ermahnt mich, stillzuhalten. Mein Bruder Paul sitzt auf dem Schoß eines Gefreiten, dessen Mütze mir in Erinnerung geblieben ist, während ich sein Gesicht vergessen habe. Helmut liegt in den Armen meiner Mutter. Sie ist eine groß gewachsene, hübsche und selbstbewusste Frau und wird von den verwundeten Soldaten mit Höflichkeit behandelt.
Das Abteil ist eiskalt, denn die Fenster haben keine Scheiben mehr. Ich erinnere mich an die draußen vorbeiziehenden Wälder, Wiesen und Häuser ohne Menschen. Es ist eine echolose Leere, durch die wir fahren, und im Zug ist es still, als sei der Ton des Films, in dem wir selbst zu sehen sind, ausgefallen. Der Krieg hat allem die Farbe entzogen, der Himmel ist hell, die Landschaft ein sich stetig veränderndes Schattenbild, die Soldaten tragen graue Uniformen. Wenn ich mich in die Erinnerung vertiefe, sehe ich ein sich allmählich in Schwärze verwandelndes Farbbild, auf dem es noch ein Dunkelbraun von Mutters Pelzjacke und Strümpfen gibt und einen roten Schal, der einem Soldaten im Hintergrund gehört. Der Waggon zittert und rüttelt in einem fort, wir werden durch die Fliehkraft zuerst auf die eine, dann auf die andere Seite gedrückt. Plötzlich die Schwärze eines Tunnels. Anstelle der unterbelichteten Bilder das Schwarzbild des Schlafes, der Ohnmacht und des Todes.
Ich höre nur die Geräusche der Dampflokomotive, das Zischen, das Pfeifen, das Rattern, das schwere, harte Keuchen, unterbrochen vom regelmäßigen Klopfen der Schwellen.
Unser Atem ist als weißer Dampf sichtbar, wie Plasma auf Fotografien von okkultistischen Sitzungen. Der Dampf löst sich auf und wird von neuen Atemgebilden abgelöst. Mir fällt das Phänomen des Atems als Merkwürdigkeit auf, eine schrecklich zur Schau gestellte Verwundbarkeit der Menschen.
Der Zug hält. Von meiner Mutter werde ich erfahren, dass es der Bahnhof Mautern war, und auch mein Freund Günter Brus, der als Kind den Vorfall zufällig vom Balkon seines Großvaters aus mit dem Fernglas beobachtet hatte, wird mir die Ereignisse bestätigen, als wir vierzig Jahre später auf der Reise nach Amsterdam den Bahnhof passierten und ich anfing, darüber zu sprechen.
Schon kurz nach der Weiterfahrt des Zuges werden die Geräusche der Dampflokomotive von Explosionslärm übertönt, der die Gesichter der Soldaten und das meiner Mutter augenblicklich verändert. Der Wandel ist so unmittelbar, dass ich die Bedrohung spüre, die aus dem Nirgendwo auf uns zukommt. Nicht der Explosionslärm ist es, der mich plötzlich mit Angst erfüllt – ich finde ihn im Gegenteil »interessant« (er weckt meine Neugier) –, sondern das Mienenspiel der Soldaten mit ihren verbundenen Köpfen und Gliedmaßen, das Anspannung, Schrecken und Verstörung ausdrückt. Bevor ich zu weinen beginne, bremst der Zug, und die Fahrgäste und Gepäckstücke beginnen ein Eigenleben, fliegen durch die Luft, und auch wir fallen auf den Fußboden, werden hochgerissen, verlieren das Gleichgewicht und tauschen es gegen eine Hundertstel Sekunde der Schwerelosigkeit ein, um schließlich irgendwohin geschleudert zu werden. Das alles sehe ich in Form von Schwarz-Weiß-Aufnahmen vor mir: Koffer, Säcke, menschliche Körper, die für ewig fliegen, ein in allen Phasen wie in den Fotografien von Muybridge festgehaltenes Chaos, ein Durcheinanderwirbeln, Fallen und Aufschlagen, ohne jedoch selbst einen Schmerz zu verspüren, so als sei ich ebenfalls nur ein Gegenstand. Und ohne Übergang wird daraus ein farbiger, flimmernder Film, der ein Hinausgehoben- und -geschobenwerden von Körpern durch die Fenster zeigt, ein Gedränge, einen Menschenstrom, der sich aus dem Eisenbahnwaggon ergießt in eine grelle Außenwelt. Der Himmel ist weiß, milchig, zu Füßen die Stoppeln abgeernteter Maispflanzen auf weicher Ackererde. Inseln von Schnee in einer offenen Welt. (Ich habe keine Erinnerung an Wörter, nur an Bilder.)
Meine Mutter hält den Säugling im Arm, ich spüre ihre Hand auf meiner. Jetzt zeigt mir Paul sein Gesicht. Im Gegensatz zu dem meiner Mutter sehe ich seines nur in Schwarz-Weiß. Paul zeigt mit dem Finger zum Himmel, und ich höre seinen Schreckenslaut, der in meiner Erinnerung nachhallt. Als ich in die Richtung schaue, in die mein Bruder weist, sehe auch ich hinter einem Telegrafenmast und -drähten das Flugzeug. Es ist nahe genug, dass ich das Emblem auf den Flügeln erkennen kann (von dem ich später erfahren werde, dass es das »Pfauenauge« der englischen Luftwaffe gewesen ist) und Einzelheiten der Maschine, eine »Spitfire«. Wie ein mechanischer Raubvogel nähert es sich uns im Tiefflug und feuert einen Hagel von Geschossen auf uns ab. Zuvor sehe ich aber (in meiner Erinnerung zu einem Standbild gefroren) die Kanzel des Flugzeugs, darin jemand, der einen Lederhelm trägt, eine starre Pilotenfigur in einem Riesenspielzeug, als betrachtete ich in einem dunklen Raum ein auf die Leinwand projiziertes Dia, und wie das strahlend helle Lichtbild ist auch meine Erinnerung etwas Immaterielles, nicht Greifbares, nur ein Phantom.
Einige Jahre später ging ich mit meinem Großvater ins Panoptikum, wir saßen vor einem optischen Gerät und blickten durch das Okular in ein scheinbar riesiges Gehirn, in dem die gespeicherten Erinnerungen zu sehen waren: Tiere, die Ansicht eines Dampfers im italienischen Badeort Grado, der Start eines Doppeldeckers der Gebrüder Wright, die Erstbesteigung des Matterhorns durch Edward Whymper und sein Todessturz oder einfach der schneebedeckte Chimborazzo. Genauso blicke ich heute in mein eigenes Gehirn und sehe, wenn ich daran denke, das Standbild des Piloten im Glaskörper seiner Kanzel. Er trägt eine Fliegerbrille und hat das Aussehen eines Insektenwesens, etwas Kaltes und Tödliches geht von dieser Kopffotografie aus, die ich nun weiterbewege, als würde ich die Namen auf einem Abspann verschwinden lassen und durch andere ersetzen …
Wir laufen in völliger Stille über den Stoppelacker, und meine Mutter stürzt mit Helmut am Arm und reißt mich mit. (»Dreimal mussten wir uns auf das abgeerntete Maisfeld werfen«, schrieb sie in ihrem Brief an mich.) Auch die Soldaten liegen verstreut am Boden, als wir uns schon wieder erheben und weiterlaufen. Überraschenderweise wirkt alles harmlos, nur das Gesicht meiner Mutter ist verzerrt, sie bleibt stehen und betrachtet das Blut und die zerrissenen Strümpfe an ihren Knien. Ich höre ihren keuchenden Atem. In Zeitlupe schwenkt mein Blick jetzt zu einer Gestalt, die auf dem Boden liegt, ein Blutfaden rinnt aus dem Mundwinkel, die Lider sind halb geschlossen und die Augäpfel verdreht, dass man das Weiß sieht. Es ist der erste Tote, den ich zu Gesicht bekomme, ohne zu wissen, dass es ein Toter ist und was der Tod bedeutet. Paul läuft in das Bild und zeigt aufgebracht auf Patronenhülsen aus Messing – seltsame Gegenstände, die wie zufällig zwischen den Maisstoppeln liegen. Meine Mutter zieht uns hastig weiter, wir haben kein Ziel, es gibt kein Ziel, nur den endlosen Acker und den Himmel und hinter uns einen metallenen Schatten – die dampfende Eisenbahn und darüber in der Luft jener, der uns vor sich hertreibt und vor dem wir uns auf die Maisstoppeln werfen. Wir stürzen in einen Graben, laufen durch das eisige Wasser eines Baches, dann den gegenüberliegenden Hang hinauf, zwischen nackten Büschen, deren Zweige uns ins Gesicht schlagen (beobachtet, wie gesagt, von einem Siebenjährigen mit Fernglas, den ich fast vierzig Jahre später kennenlernen werde).
Ich weiß nicht, wie wir in das Bauernhaus gekommen sind. Durch ein Fenster sehe ich meinen jüngeren Bruder, den Säugling, auf dem Arm eines Soldaten. Dieser springt mit ihm hinter einen Misthaufen, und das Flugzeug feuert auf sie. Der Soldat erhebt sich mit Helmut auf dem Arm und stolpert nach Luft ringend in das Haus.
III.
»Wir blieben allein in dem Bauernhaus«, schrieb seine Mutter in ihrem Brief weiter, »weil der Besitzer aus Angst vor Bomben den nahe gelegenen Stollen aufgesucht hatte.« Sie habe den Kindern die Strümpfe ausgezogen, die Kleider zum Trocknen aufgehängt, habe sich die blutigen Knie gewaschen und heißen Tee gemacht. Sie sei, schrieb sie ihm weiter, zu »ausgelaugt« gewesen, um in den Stollen zu flüchten, und die überstandene Gefahr hätte ihr die Angst vor den Bomben genommen.
Kurz vor Mitternacht habe sie ihre Kinder geweckt und sei mit ihnen zum Zug zurückgekehrt. Die Lokomotive, deren Kessel durch den Beschuss zerstört worden war, war durch eine andere ersetzt worden und die verwundeten Soldaten, die inzwischen in der Umgebung Unterschlupf gefunden hatten, saßen schon im Abteil. Wie viele bei dem Angriff ums Leben gekommen oder verletzt worden waren, wusste seine Mutter nicht mehr. Der Zug hielt nach kurzer Fahrt in Selzthal, einem düsteren, von einem Bach durchschnittenen Ort. Dort übernachtete sie mit ihren Kindern zusammen in einem Bett, ohne die Mäntel auszuziehen, weil das Zimmer ungeheizt war. Er hatte keine Erinnerung daran, auch nicht, dass eine Frau mit einem Kleinkind auf einem Sofa lag. Deren Kleidung, schrieb seine Mutter, sei ärmlich gewesen und der Kinderwagen, in dem sie auch ihre Habseligkeiten transportierte, alt und schäbig. Ohne auf die Proteste der Frauen zu hören, sperrte jemand die Tür von außen ab … In der Nacht wurde seine Mutter dann durch eine Sirene aus dem Schlaf gerissen. Sie sprang auf, um hinauszusehen, aber die Tür war noch immer verschlossen. Sie rüttelte, sie trommelte, sie rief – niemand kam. Aus dem Fenster konnte sie beobachten, wie Menschen zum Luftschutzkeller liefen – endlich erschien ein Bub und öffnete. Er war in Eile und machte sich sofort davon. Zusammen mit seiner Mutter brach auch die andere Frau auf. Der Luftschutzkeller war überfüllt mit Passagieren, unter die sich nur wenige Einheimische mischten. Niemand sprach. Eine Frau und ein Verwundeter fielen in Ohnmacht und wurden auf eine Bahre gelegt. Nach der Entwarnung am frühen Morgen, schrieb seine Mutter, sei der Zug, der sie über Linz und Nürnberg nach Würzburg bringen sollte, in den Bahnhof eingefahren. Seine Mutter holte das Gepäck aus dem Zimmer und musste dabei feststellen, dass die Frau, die inzwischen verschwunden war, ihren stark abgenutzten Kinderwagen stehen gelassen und gegen den ihren eingetauscht hatte. Kurz darauf hängte ein Beamter ihr und den Kindern eine Schnur mit einem Stück Pappkarton und einer Nummer darauf um den Hals, zur Identifizierung im Falle, dass ihnen etwas zustoßen sollte. Dabei befiel seine Mutter eine so heftige Abneigung einzusteigen, dass sie umkehrte und den Fahrdienstleiter im Stationsgebäude aufsuchte, mit der Bitte, die Billetts zu ändern. Angesichts des Unverständnisses und der energischen Ermahnungen, dass der Zug ohne sie abfahren würde, weigerte sie sich erst recht, die vorgesehene Strecke zu fahren, ohne dass sie aber einen Grund für ihr Verhalten angeben konnte. Mit Hartnäckigkeit und Zigaretten erreichte sie schließlich, dass die Billetts geändert und auf einen anderen Zug umgeschrieben wurden, der über Salzburg nach München fuhr. (Das war besonders wegen der bereits vergebenen Identifizierungsnummern schwierig gewesen.) Am Salzburger Bahnhof musste sie wegen eines Voralarms neuerlich in den Luftschutzkeller. »Längst stimmten die Fahrpläne nicht mehr«, schrieb sie in ihrem Brief, »längst war der gesamte Schienenverkehr nur noch auf Improvisation aufgebaut. Er brach zusammen, Teile nahmen den Betrieb wieder auf, dafür fielen andere Teile aus.« Aus diesem Grund sei die Fahrt mit einer nie nachlassenden Anspannung verbunden gewesen, es habe von einem Augenblick auf den nächsten höchste Aufmerksamkeit geherrscht, um jederzeit auf das Schlimmste vorbereitet zu sein, mehrmals sei sie in einen Erschöpfungsschlaf gesunken, aus dem sie immer wieder durch ihre Angst gerissen worden sei.
In Salzburg gelang es ihr neuerlich, in einen Fronturlauberzug mit Verwundeten zu steigen, der aber von München weiter nach Köln fuhr, sodass sie sehen musste, wo sie mit ihren Kindern blieb. Am Bahnhof in München herrschte ein so großes Chaos, dass sie befürchtete, eines ihrer Gepäckstücke oder sogar ihre Kinder, die sie drängte, sich an den Griffen der Koffer festzuklammern, aus den Augen zu verlieren. Inzwischen verbreitete sich die Nachricht, dass der Bahnhof in Nürnberg bei einem Bombenangriff getroffen worden sei und hunderte Menschen dabei ihr Leben verloren hätten, darunter, wie sie später erfuhr, auch Passagiere jenes Zuges, mit dem zu fahren sie sich geweigert hatte. Ihr Mann, der im Lazarett davon in Kenntnis gesetzt wurde, ließ sich sofort nach Nürnberg bringen, da ihm seine Frau die Ankunftszeit und Reiseroute vor ihrer Abfahrt mitgeteilt hatte. Mehrere Stunden suchte er in Haufen von Erschlagenen und Verbrannten nach seiner Frau und den Kindern. Inzwischen hatten diese einen weiteren Zug nach Augsburg genommen, wo es bereits den nächsten Fliegeralarm gab und sie wieder einen Luftschutzkeller aufsuchten. Durch einen Zufall – eine Lokomotive hatte einen technischen Defekt und der Zug Verspätung – gab es am Abend noch eine Verbindung nach Würzburg.
Seine Mutter habe jedes Zeitgefühl verloren gehabt, schrieb sie, auch Hunger und Durst habe sie keinen verspürt, alles habe sie wie ferngesteuert gemacht, nicht wie in Trance, sondern mit klarem Kopf, in einer Mischung aus größter Konzentration und Lethargie. Ihre Kinder schliefen auf den Bänken des Eisenbahnwaggons, es wurde Nacht, und in der sie umgebenden schwarzen Leere setzt seine Erinnerung wieder ein.
IV.
Ich erwache im lichtlosen Nichts. Es ist still, aber bevor ich zu weinen anfange, weil ich mich allein glaube, spüre ich die Wärme und den Atem meiner Mutter, die mir ins Ohr flüstert, leise zu sein. Nie werde ich die Finsternis und die Lautlosigkeit vergessen, in die ich geraten war. Ich höre kein Eisenbahngeräusch, denn der Zug war, wie meine Mutter schrieb, an einem Waldrand stehen geblieben, und der Schaffner hatte den Passagieren die Anweisung erteilt, nicht zu sprechen, kein Zündholz zu entflammen, nicht zu rauchen und auf dem Platz zu bleiben, denn über unseren Köpfen flögen feindliche Flugzeuge, die Würzburg bombardierten. An die Geräusche der Bomber erinnere ich mich nicht, ich höre nicht das »unheimliche Dröhnen«, von dem meine Mutter schrieb, ich höre nur Atemgeräusche, Husten, Räuspern, Seufzen und Stöhnen, ab und zu unverständliches Geflüster oder das unterdrückte Aufweinen eines Kindes.
Irgendwann in der Endlosigkeit des Wartens darf ich an das Fenster treten und hinausschauen, und ich sehe in der Dunkelheit Flammen vom Himmel fallen, es sind nicht die Feuerzungen des Heiligen Geistes, sondern Bomben, die auf eine brennende Stadt – Würzburg – fallen. Wie auf Röntgenbildern sehe ich durch die Glasscheibe im Zugabteil Schwärze und Helligkeit. Die Helligkeit ist in eifriger Bewegung, die Schwärze lastet. Ich kann die Bilder nicht deuten, ich verstumme vor ihrer überwältigenden Schönheit. Riesenfunken fallen vom Himmel auf die zuckenden, sich stetig verändernden Flammen. Ich begreife nicht, weshalb alle schweigen, aber die fehlende Tonspur im Erinnerungsfilm macht aus der Szene etwas Introvertiertes, wie Regentropfen, die über eine Glasscheibe laufen. Ich kann den Film solange ich will in meinem Kopf abspulen, immerfort und immerfort, ohne an einen Anfang oder ein Ende zu gelangen. Und doch verwandeln sich die Bilder. Je länger ich sie betrachte, desto deutlicher nehme ich die Unheimlichkeit wahr, die in ihnen verborgen ist. »Die Lokomotive«, schrieb meine Mutter, »hatte die Kessel gelöscht, wie gelähmt starrten wir auf das Schauspiel der Vernichtung.«
V.
Kitzingen, wo seine Mutter sich mit seinem Vater verabredet hatte, war nur 25 Kilometer entfernt, und doch schien es aussichtslos, es in dieser Nacht noch zu erreichen. Trotzdem kam sie dort an, weckte die Kinder und trug die Weinenden in das dem Bahnhof gegenüberliegende Gasthaus. Fremde Menschen halfen ihr. Der Wirt, selbst verängstigt, führte sie in einen stockdunklen Raum mit zwei Betten und geschlossenen Vorhängen. Er verbot ihr, Licht zu machen. Seine Mutter hatte eine Taschenlampe bei sich, mit der sie kurz auf den Boden leuchtete, um sich zu orientieren. Dieser kurze Lichtstrahl, der das Zimmer erhellte, blieb unerklärlicherweise in seiner Erinnerung haften. Er sieht die Stahlrohrbetten, den geblümten Überzug, die runde Nachttischlampe, bevor die Dunkelheit wieder alles verschwinden lässt. Seine Mutter legte ihre Kinder auf die Betten, wo sie in tiefen Schlaf versanken, aus dem sie ein Donnern, wie sie es noch nie gehört hatten, aufschreckte. Sie weinten vor Entsetzen und wurden von ihrer Mutter aufgehoben und unter die Betten gelegt, ehe sie selbst schluchzend zu ihnen gekrochen kam. Eines ihrer Kinder fragte sie nach dem furchtbaren Getöse, sie antwortete, es sei ein Gewitter. Und weshalb sie unter den Betten lägen? Und weshalb sie weinte? »Du hast versucht, mich zu trösten, als ich dir gestand, dass ich mich fürchtete«, schrieb sie in ihrem Brief. »Du hast mir erschrocken über die Wangen gestreichelt«, fuhr sie fort, »und mich angefleht, nicht traurig zu sein.« Als er das las, sah er das verzerrte Gesicht seiner Mutter wieder vor sich und spürte ihre Tränen und ihre Umarmungen. Er schwor sich, nie mit jemandem darüber zu sprechen, denn er wusste, dass es ein Geheimnis war, das nur sie beide betraf.
Als das Donnern und Dröhnen endlich aufhörte, krochen sie unter dem Bett hervor.
VI.
Im Gestöber des stickigen, feinen Staubes – Verputz rieselt von der Decke – umarmt und küsst mich meine Mutter, ich sehe uns beide, sie und mich, hustend in einem gelben Licht. Auf dem Gang und vor dem Haus sind eilige Schritte zu hören. Ich habe meine Brüder vergessen. (Ginge es nach meinem Gedächtnis, wären sie nicht anwesend.)
Aber dann, auf dem nächsten Filmstreifen meines Erinnerungsarchivs, kann ich sie als stumme Schatten wieder erkennen.
VII.
Seine Mutter wählte ein einziges Mal in ihrem Brief eine lyrische Beschreibung für den Augenblick, als sie ins Freie traten. Sie schrieb: »Der Himmel war intensiv hellblau und rosa gefärbt, und schmutziger Schnee lag auf dem Platz vor dem Bahnhof.« Sie trugen die Pappschilder mit den Identifikationsnummern um den Hals, die man ihnen in Selzthal umgehängt hatte, und ihre Kleider waren weiß von Staub.
VIII.
Ich finde den Anblick lustig. Der Staub hat auch unser Haar grau gefärbt, sodass wir wie alte Zwerge aussehen, und wir fangen müde an zu spielen.
IX.
Irgendwie war es seiner Mutter gelungen, seinen Vater zu benachrichtigen, dass sie im Gasthaus gegenüber dem Bahnhof auf ihn warte. Sofort ließ er sich von Nürnberg nach Kitzingen bringen, »wo er euch in die Arme schloss. Tränen liefen über seine Wangen«, beendete seine Mutter den Brief.
X.
Ich stehe jedoch vor einem fremden Mann, von dem ich erst allmählich erfahre, dass es mein Vater ist. Er trägt eine Uniform. Er ist riesengroß. Ist es nicht seltsam, dass ich alles in Schwarz-Weiß sehe? Der Mann steigt aus einem VW-Kübelwagen. Am Steuer sitzt ein Fahrer mit Schiffermütze und schaut durch die Windschutzscheibe auf die Straße. Mein Vater lacht – es ist das Foto, das bei einer anderen Gelegenheit von ihm aufgenommen wurde und das sich in meinem Kopf mit der Erinnerung an diese Begegnung verbunden hat.
EinsKindheit
Im Gartenhaus
I.
Bis die russischen Soldaten aus der Steiermark abzogen und von den Engländern abgelöst wurden, blieben seine Eltern in der Nähe von Würzburg. An jene neun Monate hat er kaum Erinnerungen. Seine Mutter berichtete ihm von einem Grafen, der den gleichen Familiennamen trug wie sie. Im Gartenhaus von dessen Park fanden seine Eltern mit ihren Kindern eine notdürftige Unterkunft.
II.
Ein einstöckiger gelber Pavillon. Zahlreiche Fenster, weiße Wände, ein Tisch mit einem gewebten Tuch, auf dem Früchte ein Ornament bilden, besonders die langen Fransen sind geheimnisvoll. In Kartons auf dem Parkettboden Kleidungsstücke. Ich schlafe auf einem Sofa unter einem gold-schwarz gemusterten Bettüberwurf. Ich friere. Wir sind in einem lautlosen Jenseits angelangt. Wo ist der Krieg? Schnee liegt auf einer Wiese, auf den Ästen der Bäume, auf den Wegen. Da es keinen Ofen im Gartenhaus gibt, ist jeder Wechsel von Unterwäsche schmerzhaft. Mein Bruder Paul und ich stapfen hinter zwei Kindern zum Schloss hinauf. Es ist ein kurzer, stark flimmernder Schwarz-Weiß-Film, der vor meinem inneren Auge abläuft, ich habe ihn schon öfter gesehen, wenn ich in der Nacht wach lag. Die anderen Knaben tragen Wintermäntel, einer von ihnen hat eine Schirmmütze auf dem Kopf. Sie ziehen einen eisernen Schlitten hinter sich her, der vorne eine Rundung hat wie ein Bischofsstab. Paul ist schneller als ich, und die beiden Buben und er fangen zu laufen an. Ich kann mich an kein Geräusch erinnern, an kein Wort. Plötzlich sitzen wir zu viert auf dem Schlitten, ich muss, weil ich als Letzter gekommen bin, vorne Platz nehmen. Ich sehe jetzt den Schnee unter mir, über den wir abwärts gleiten, im nächsten Augenblick stürze ich. Der Schlitten kippt nach der Seite um und eine der Kufen schneidet sich in meinen Hals. Ich ersticke. Das Filmfragment ist zu Ende, es folgt Schwärze, die mir den Eindruck vermittelt, ich befände mich allein in einem dunklen Kino. Nach langer Pause höre ich meine Mutter sprechen. Ich fühle ihre Arme, ihr Haar, ihre Körperwärme. Jetzt beugt sich mein Vater über mich. Er hat eine Militärkappe auf dem Kopf. »Damals hast du eine Quetschung des Kehlkopfes erlitten und ich brachte dich ins Gartenhaus«, erzählt meine Mutter. »Als Vater vom Lazarett kam, hat er dich verarztet. Du konntest zwei Tage nicht sprechen. Du standest unter Schock. Lange konntest du dich nicht beruhigen.«
III.
Die ganze Zeit, die ich in der Nähe von Würzburg verbrachte, verbinde ich mit Kälte. Im Gartenhaus gibt es wie gesagt keinen Ofen, und gäbe es einen, wir hätten nichts zu heizen. »Auch im Schloss«, erzählte meine Mutter weiter, »wurde nicht geheizt, bis auf das Kaminzimmer.« Ich habe es einmal gesehen, ich erinnere mich an den großen, geschliffenen Spiegel im goldenen Rahmen und an einen orientalischen Teppich, dessen Schönheit mich fasziniert. Er ist braun, rot und schwarz und für mich ein Mirakel. (Ich bin davon überzeugt, dass das Muster einen Sinn ergibt und will in seine Wirklichkeit eintreten, um ihn zu begreifen.) Nach und nach tauchen eine Biedermeierkommode mit vielen Schubladen auf, Polstermöbel, ein Luster. Und auch das Feuer im Kamin sehe ich flackern, spüre jedoch nichts von seiner Wärme, und es verlöscht langsam in Schwärze. »Ich habe eine Decke für uns verlangt«, fuhr meine Mutter fort, »aber es gab keine. Ich habe mich mit den Mänteln beholfen, dem Bett- und dem Tischtuch – ihr habt trotzdem gefroren, bis Vater euch eine Decke vom Militär brachte.«
IV.
Der Himmel ist blau, und die Tochter unseres Namensdoppelgängers, ein Mädchen mit brünetten Locken, sitzt auf einer Schaukel und schwingt sich hoch hinauf in die Luft, sie schwebt zurück, ihr Kleid wirft die wunderbarsten Falten, und ihr Schatten folgt ihr ruhelos über den Boden, hin und her.
V.
»Zu Ostern«, sagte meine Mutter, »wurdest du mit Paul eingeladen, Eier zu suchen.« Ich sehe ein großes gelbes aus Pappe hinter einem Busch. Paul findet hüpfend zwei bunte, und das Mädchen schwirrt herum und zeigt uns, was es gefunden hat. Das Pappei wird geöffnet, darin liegt Schokolade. Gleich darauf ist das Spiel zu Ende, und wir müssen alles in der Vorhalle des Schlosses auf einen Tisch legen, neben dem der Graf steht.
VI.
Seine Mutter erzählte ihm auch, wie sein Vater in Gefangenschaft geraten war und sie ihn im 15 Kilometer entfernten Lager besuchte. Unterwegs hätten ihr auf Lastautos vorbeifahrende Soldaten nachgepfiffen, sagte sie. Sie habe seinen Vater nur kurz sehen und ein paar Worte mit ihm wechseln dürfen, dann habe sie sich beeilt, wieder nach Hause zu kommen.
VII.
In dieser Zeit taucht auch »der Neger« auf. Er gibt mir eine Orange, in die ich in Unkenntnis, dass sich unter der schönen Farbe eine bittere Schale verbirgt, hineinbeiße. »Der Neger« nimmt mich auf seinen Arm. Er lacht. Ich sehe seinen Panzer. Der Panzer mit der Kanone und den Ketten entführt ihn, und ich weine über das Schicksal, das ihn mir nimmt.
VIII.
Am häufigsten erzählte ihm seine Mutter, wie sie seinen Vater zum zweiten Mal im Gefangenenlager besuchen wollte und erfahren habe, dass er nicht mehr dort sei, und niemand ihr Auskunft geben konnte, ob er verlegt oder entlassen worden sei. Sie sprach kaum Englisch. Irritiert und mit wachsender Verzweiflung habe sie sich auf den Rückweg gemacht und sich von der Hitze und dem Fußmarsch erschöpft unter einen Baum gesetzt. Während sie sich den schlimmsten Gedanken hingegeben und geradezu gewusst habe, dass sie ihn womöglich nie mehr wiedersehen würde, weil man ihn als ehemaliges Mitglied der NSDAP und Kriegsgefangenen vermutlich nach Amerika überstellt habe, habe sie plötzlich ihren Namen rufen hören und als sie aufblickte, ihn von weitem eilig auf sie zukommen sehen. (In meiner Vorstellung sehe ich die beiden sich in die Arme schließen und das Wort ENDE auf die glücklich Vereinten projiziert, während die Kamera langsam von ihnen wegzoomt.)
Die Rückkehr
I.
Vielleicht sind wir in unserer Kindheit auf andere Weise intelligent, schöpferisch und klarsichtig als im Erwachsenenalter. Wenn ich über diese Zeit schreibe, tauchen viele Einzelheiten auf, mag sein, dass es falsche Erinnerungen sind, aber selbst dann drücken sie etwas aus, das möglicherweise wichtiger ist als die vorgebliche Wahrheit …
II.
Oktober 1945. Die Eisenbahnfahrt nach Graz ist mir als Eingeschlossensein in einem zitternden, ruckenden Schattentunnel in Erinnerung.
Nichts von der Landschaft, durch die wir fuhren, ist in meinem Kopf mehr vorhanden, nur dieser Innenraum, eine riesige alte Ziehharmonika, in die ich irgendwie hineingelangt bin. Sie gibt die grässlichsten Töne von sich. Sie knirscht, sie pfeift, sie rattert, sie röchelt, und ein unsichtbarer Spieler stampft dazu mit den Füßen. Das Gedränge, der Gestank im Abteil sind bedrohlich. Menschen streiten, schreien, heulen, schieben, übergeben sich. Ich sitze auf einem Koffer und habe die Eingebung, dass mir nichts geschehen kann. Ich darf mich nur nicht bewegen, ich muss alles so hinnehmen, wie es sich ereignet. Der Balg der Ziehharmonika könnte zusammengedrückt werden und die Menschen durcheinanderfallen, sich gegenseitig erdrücken und langsam ersticken, aber mein Koffer ist ein Fels, eine Insel, solange ich auf ihm sitze, bin ich in Sicherheit. Ich weiß auch plötzlich, dass es eine nächste Situation geben wird: Darin werde ich auf dem Bahnsteig stehen und das, was ich jetzt gerade erlebe, wird bereits Vergangenheit sein. Ich beginne mir vorzustellen, dass ich bereits jetzt, während ich noch in Bedrängnis bin, am Bahnsteig stehe und in Wirklichkeit an meine Situation zurückdenke. Auch dieser Gedanke entsteht ohne Anstrengung von selbst, und von da an wird diese Zukunftsschau, wie auch die Überzeugung, es könne mir nichts geschehen, zu meinem Verhalten gehören, wenn ich mich in einer misslichen Lage befinde.
III.
Merkwürdigerweise sind meine Eltern und Geschwister fast zur Gänze aus meiner Erinnerung ausgeblendet. Ich sehe nur amerikanische Soldaten mit Stahlhelmen und Schirmkappen, die nach den »Papieren« verlangen, was jedes Mal eine seltsame Aufregung und Geschäftigkeit unter den Fahrgästen hervorruft. Die Soldaten werden offensichtlich als Bedrohung empfunden, mich aber streicheln sie, schenken mir ein freundliches Lächeln oder stellen mir eine Frage. Ich fühle mich dadurch erhöht, denn die anderen werden kontrolliert, gefilzt, ausgefragt. Erst jetzt taucht mein Vater auf, und ich sehe ihn (wie in einer jener Theaterinszenierungen, die auf ein Minimum an Ausstattung reduziert sind) sich erheben und mit ungekannter Höflichkeit die »Papiere« vorweisen. Er lächelt bei jeder Frage, die an ihn gerichtet wird, und ich weiß nicht, weshalb ich mich für ihn schäme. Erst viele Jahre später erkenne ich, dass es wegen seiner Unterwürfigkeit ist, die er fremden Autoritäten gegenüber an den Tag legt; meine Mutter hingegen trägt eine kokette Aufmüpfigkeit zur Schau, die mir ebenfalls erst Jahre später bewusst wird.
Vielleicht interpretiere ich alles erst nachträglich in die Erinnerungspartikel hinein, die in meinem Kopf in Bewegung geraten sind – aber weshalb sollten diese Überlegungen und Empfindungen mir damals unmöglich gewesen sein?
IV.
In der Stadt angekommen, erwache ich. Irgendwann bin ich in tiefen Schlaf gefallen, aus dem ich gerissen wurde. Mein Blick fällt auf die grelle Lampe an der Decke des Eisenbahnwaggons. Ich sehe die Glühdrähte und schließe die Augen, doch werde ich sofort wieder wachgerüttelt, auf die Beine gestellt und vorwärtsgeschoben. Die Eltern schleppen sich an Gepäckstücken ab, wir steigen Treppen hinunter in fahl beleuchtete Gänge voller Menschen, andere Treppen wieder hinauf in die Bahnhofshalle. Ich bin zu benommen, um unterscheiden zu können, was ich träume und was sich wirklich ereignet. Niemand erwartet uns, da alle Züge Verspätung haben und nur unregelmäßig verkehren. Wir sind im Freien, die Straßen sind kaum beleuchtet, anstelle von Häusern Schutthaufen und Ruinen, außerdem Bombentrichter, denen wir ausweichen müssen. Ich fürchte mich vor den Löchern, in denen man für ewig verschwinden kann. (Ich weiß noch, wie ich am nächsten Tag ein zerbombtes Wohnhaus anstarrte, an dem eine Wand fehlte, sodass man dort, wo die Zimmer nicht durch Planken abgedeckt waren, hineinsehen konnte: Ich erkannte selbst das Muster der Wandbemalung und weiße Flecken an den Stellen, an denen die Bilder gehangen hatten. Auch in die Bombentrichter spähte ich hinein. Ich blieb vor jedem einzelnen stehen und schaute in die Tiefe des Erdlochs. Später dachte ich dann gar nicht mehr daran, dass sie aus dem Krieg stammten.)
Ich klammere mich am Ärmel meiner Mutter fest. Irgendwann überqueren wir die Brücke über den aufgestauten Mühlgang. Vom E-Werk hängen Lampen herunter, die ein schwaches gelbes Licht auf das Wasser fallen lassen. Ich empfinde Angst. In der Schwärze, die uns umgibt, ist das Wasser schwärzer als sonst. Dahinter das dunkle Wohnhaus am Kirchweg 9, in dem die Großeltern wohnen. Meine Mutter ruft, mein Vater wirft einen Kieselstein gegen das Fenster, und als endlich das Licht angeht, sehe ich, dass mein jüngerer Bruder Helmut auf dem Arm meines Vaters schläft und der ältere gegen die Eingangstür taumelt. In mehreren Wohnungen gehen Lichter an, die Großeltern öffnen und umarmen uns. Es ist mir unangenehm, dass Omi mich küsst, ich rieche den Küchengeruch, der von ihr ausgeht, und verstehe nicht, was ich mit ihr zu tun habe. Erst von jetzt an habe ich ihr Gesicht in meinem Kopf. Sie lacht in einem fort, drückt uns an sich und hat feuchte Augen.
V.
Immer wieder erzählte ihm seine Mutter, dass er seiner Großmutter die Frage gestellt habe: »Wie geht es Ihnen?« Dabei seien ihm vor Müdigkeit die Augen zugefallen.
»Du wirst doch nicht Sie zu mir sagen … Hört ihr, er hat mich gefragt, wie geht es Ihnen?«, habe seine Großmutter ausgerufen und es jedem erzählt.
Einige der Hausparteien zeigen sich auf dem Gang und begrüßen seine Eltern, die mühsam in den zweiten Stock hinaufsteigen.
VI.
Nach einer warmen Mahlzeit erhole ich mich.
Erstaunt stelle ich fest, dass meine Großeltern Nachtkleidung tragen. Großvater Richard hat widerborstiges graues Haar, das an den Schläfen kurz geschnitten und nach hinten gebürstet ist, doch widerstrebt es jeder Richtung und steht büschelweise in die Höhe. Er hat ein volles Kindergesicht und eine kleine Nase, milde braune Augen und einen Oberlippenbart. Er ist klein und stämmig und hat von seiner Arbeit als Glasbläser – wie ich als Kind erfuhr – einen auffallend großen Brustkorb und muskulöse Oberarme. Der Brustkorb geht in einen stattlichen Bauch über. Daneben fallen mir seine kurzen Beine auf, von denen, wie sich herausstellt, das rechte an der Hüfte steif ist, weswegen er sich beim Stiegensteigen abmüht und sein Humpeln in der Wohnung nicht zu übersehen ist. (Beim Ausgehen stützt er sich dann immer auf einen Stock, der ansonsten in der Ecke neben der Eingangstür lehnt.) Omi, die mein Großvater Mizzi nennt, hat dünnes blondes Haar, einen weißen, fülligen Körper und als hervorstechendstes Merkmal fröhlichblitzende blaue Augen. Ihre Zähne sind mangelhaft, und sie hat, wie mir erst später auffällt, etwas Ländliches an sich, etwas von einer Magd. Bald schon bemerke ich, dass sie warmherzig und liebevoll ist. Wenn ich Schutz suche, wende ich mich deshalb zuerst an sie. Ihr größter Schatz ist eine Bernsteinkette mit großen ovalen Steinen. In einem von ihnen ist eine Pflanze eingeschlossen, die ich immer wieder zu sehen wünsche. Großvater hustet stark, da er, wie mein Vater betont, an chronischer Bronchitis leidet, was immer das auch ist. Und er versucht mir verständlich zu machen, dass es eine Berufskrankheit ist, viele Glasbläser litten daran. Großvater habe Gläser, Medizinfläschchen und sogar Briefbeschwerer hergestellt, so wie man mit dem Mund Seifenblasen fabriziert (die ich damals schon kenne).
Die Wohnung ist notdürftig eingerichtet und besteht nur aus einer Küche und einem Zimmer. Ein »Sparherd«, der mit Holz oder Kohle befeuert wird, auf einem weißen Hocker (»Stockerl«) ein Waschlavoir aus emailliertem Aluminium, daneben eine Schale mit Seife, und an der Wand hängen Handtücher. Über den Sparherd ist eine Schnur zum Wäschetrocknen gespannt, an der, solange ich mich erinnern kann, immer Kleidungsstücke, Socken, Hemden und anderes hängen. (Ich stellte mir oft vor, ich lebte auf einem Schiff mit der Wäsche als Segel und dem Herd als Kommandobrücke.) Links vom Fenster, das grüne Läden hat, steht die weiße Kredenz mit einem Rasierspiegel, der an einem Nagel hängt, rechts ein Tisch mit Eckbank. Vom Schlafzimmer hat man Ausblick auf den Mühlgang, das E-Werk und das Wehr, die die ganze Nacht über beleuchtet sind. Die Möbel sind aus hellbraunem, lackiertem Holz, die wuchtigen Betten haben hohe Fuß- und Kopfteile und sind mit großen Pölstern, den Kopfkissen, ausgestattet. Über dem Ehebett hängt ein riesiger gerahmter Schutzengel, der zwei Kinder über einen Bach geleitet – das einzige Bild in der Wohnung. Wegen dieses Bildes will ich bleiben. Es allein verwandelt die Armseligkeit des Raumes in etwas Geheimnisvolles. Ein hellbrauner »Kasten«, der Kleiderschrank, die Kuckucksuhr an der Wand, die mich mit dem ersten Ruf in ihren Bann zieht, und in den Fenstern Blumentöpfe mit roten Pelargonien. Da es für alle Bewohner des Stockwerks nur ein Plumpsklo auf dem Gang gibt, steht unter den Betten ein Nachttopf. Wie ist es möglich, dass wir so selbstverständlich in diese grauenvolle und doch anziehende Welt, vor der mir ekelt und die mich zugleich fesselt, eindringen? Ich kann die Großeltern in ihren Nachtkleidern nicht begreifen. Omi kocht Tee und wartet sogar Zwieback auf, der dicke, an einen Käfer erinnernde Mann, mein Großvater, blickt mich mit müden Augen an. Sein Atem rasselt, er hustet, er spuckt in ein zerknittertes Taschentuch, das er in einer Hand hält – und ich entdecke, dass ihm an zwei Fingern Glieder fehlen, an einem davon hat er anstelle des Nagels nur eine dunkle kleine Kralle.
VII.
Am nächsten Tag sitzen wir in der Küche.
»Ich habe deine Bücher aus der Wohnung am Geidorfgürtel geholt, bevor die Russen gekommen sind«, sagt Omi zu meinem Vater. Sie nimmt aus dem Kleiderschrank im Schlafzimmer einen Stapel medizinischer Werke und legt sie auf den Tisch.
Gedankenverloren schlägt mein Vater eines, einen anatomischen Atlas, auf. Großvater und er rauchen Zigaretten, die mit ihrer Glut und dem bläulichen Dunst die Küche in einen wichtigen Ort verwandeln. Im Atlas sehe ich ein Gesicht ohne Haut, die roten Muskeln, die blauen Venen, die gelben Nervenbahnen, wie mir später immer wieder erklärt wird, aber für mich ist es eine unheimliche, fantastische Darstellung eines Menschen. Ich ahne, dass sie etwas mit dem Tod zu tun hat und starre sie an. Das Auge auf dem Bild ist freigelegt, eine weiße Kugel mit einer blassgrauen Regenbogenhaut und der schwarzen Pupille. Dieses Bild bleibt mir im Gedächtnis, denn durch seinen Anblick fühle ich, ohne es wirklich zu verstehen, dass mein Vater etwas anderes ist als die übrigen Menschen. Er kennt alle Geheimnisse, auch die furchtbarsten. (Zugleich trat ich selbst durch dieses anatomische Bild in die Welt des Körpers ein. Was für andere Kinder Landkarten waren, die sie zum Träumen abenteuerlicher Reisen animierten, waren für mich die Abbildungen im anatomischen Atlas.) Ich erinnere mich an den sengenden Schrecken, der mich beim ersten Anblick der Darstellung des Kopfes durchfuhr, es war die Ahnung, unter der Haut selbst so auszusehen. Mein Großvater beugt sich staunend über die Abbildung und stammelt, dass der menschliche Körper ein Wunder sei. Dabei blickt er meinen Vater respektvoll an, dass ich glaube, er sei der Hüter dieser Geheimnisse und Wunder.
VIII.
Ich schlafe übrigens im Zimmer der Großeltern, mein älterer Bruder zwischen ihnen, ich auf einer Matratze vor dem Kleiderschrank, Vater und Mutter mit Helmut in der Küche. Die Nachtkleidung von Großvater besteht entweder aus einem langen Flanellhemd oder knielangen, gestreiften Unterhosen, die über dem Nabel mit einer Schnur zusammengebunden werden, und einem weißen Unterhemd mit Knöpfen. Er sieht erbarmungswürdig aus, Großmutter in ihrem rosa Nachthemd hingegen fröhlich. Ich schaue, wann immer ich Gelegenheit dazu habe, zum riesigen Schutzengel über dem Bett hinauf, und ich begreife, dass es offenbar Wesen gibt, die ich nicht erkennen kann. Mit Sicherheit können die Erwachsenen Engel sehen, wie mein Vater das Innere des menschlichen Körpers. Großvater ist ein Zauberer. Er wird von einem Engel beschützt und ist Herr über ihn. Der Engel lebt hinter dem Holzrahmen und dem Glas, wo er die beiden Kinder beschützt. Das Glas macht Großvater selbst, die durchsichtige Substanz der Fensterscheiben. Aus Glas sind auch Vasen und Bierkrüge und bunte Murmeln gemacht, und ich bewundere Großvater ebenso wie meinen Vater.
Dieser Glaube wird nie erschüttert werden, er löst sich nur unmerklich auf. Heute weiß ich, dass er erst für mich an Bedeutung verlor, als ich mich selbst entdeckte.