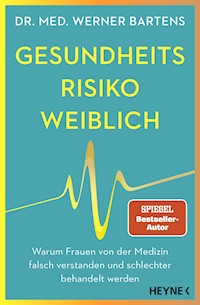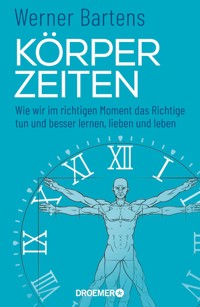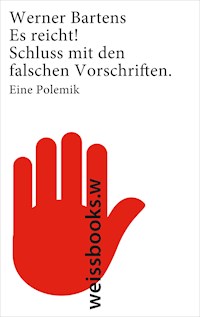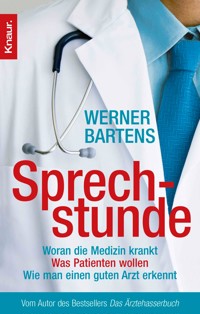7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die Ärzte: arrogant, unnahbar, dilettantisch. Die Patienten: wehrlos. Ob sie an einen Quacksalber oder eine Koryphäe geraten sind, wissen Patienten erst, wenn es zu spät ist. Auf Gedeih und Verderb sind sie den Ärzten ausgeliefert. Der Arzt und Medizinjournalist Werner Bartens weiß aus eigener Erfahrung, wie es in den Praxen und Krankenhäusern zugeht: Zu viele Technokraten und Versager verbergen sich unter dem weißen Kittel. Schonungslos berichtet er von Größenwahn, Pfusch und Ignoranz. Seine Diagnose: Wir sollten aufhören, nur über die Kosten des Gesundheitswesens zu reden, und uns endlich wieder auf das Wesentliche konzentrieren – auf die Bedürfnisse der Menschen, die Hilfe beim Arzt suchen. Das Ärztehasserbuch von Werner Bartens : Aktuelle Debatten im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Werner Bartens
Das Ärztehasserbuch
Ein Insider packt aus
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Beipackzettel
Selbstdiagnose
1. Sprechstunde
Was Ärzte so sagen
Viel zu klein
Es ist ja nichts Ernstes
Dann eben nicht
2. Feind ist der Patient
Moderner Menschenhandel
Morbus Freitag
Eine Frage der Erziehung
Genervt von den Angehörigen
Mohnkuchen
Psychiatrische Beratung
Schwierige Patienten
Schonkost um jeden Preis
3. Jenseits der Schamgrenze
Ein bisschen mehr Intimpflege
Ihr Unmenschen
Lust auf mehr
Wundervolle Anatomie
4. Chefvisite
Selbst schuld
Man will sich ja wohl fühlen
Das Fest der Liebe
Familienmedizin
5. Seelenlose Medizin
In der Abstellkammer
Medizinischer Fortschritt
Ermutigung
Sie sind eine Risikoschwangere
Der letzte Kampf
6. Man muss auch an die Kosten denken
Impfschaden
Falsche Voraussetzungen
Die Patienten wollen es schließlich so
Eine Frage der Prioritäten
7. Ohne Rücksicht auf Risiken und Nebenwirkungen
Jäger und Sammler
Nutzlose Therapie
Vollständige Aufklärung
Drecksarbeit
Fehler gibt’s hier nicht, basta
Man kann ja nie wissen
Spiel mir das Lied von der Angst
8. Auf Leben und Tod
Schicksalhafter Rekordversuch
Therapie wie im Fluge
Tödlicher Schwindel
9. Stationen der Abstumpfung – die Arztwerdung des Menschen
Auf der Suche nach einer Diagnose
Alte Kameraden
Ach so, es ist nur psychisch
Auf Eierfang
Doktorspiele
Auf Tauchstation
Auf der Flucht vor den Kranken
10. Kunstfehler im System – Medizin vor Gericht
Schraube in der Schlagader
Schwierige Fehlersuche
11. Erste Hilfe: Was sich dringend ändern muss
Schluss mit der Krankrederei
Keine Angst mehr vor den Patienten
Kranke dürfen nicht zu Kostenfaktoren reduziert werden
Ärzte sollen Patienten versorgen oder forschen – nicht beides
Neue Ärzte braucht das Land
Prinzip Hoffnung: Es gibt auch andere Ärzte
12. Überlebenshilfe für Ärzte – Tips für den Alltag
Fazit:
13. Überlebenshilfe für Patienten – Ärztelatein und andere Begriffe, die nicht im medizinischen Wörterbuch stehen
Danke an
Beipackzettel
Liebe Patientin, lieber Patient, liebe Ärztin, lieber Arzt!Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Buches beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker beziehungsweise an Ihre Patienten oder die ärztlichen Standesorganisationen.
Anwendungsgebiete: Dieses Buch soll Ihre Wahrnehmung schärfen und Ihnen die Augen öffnen. Manchmal geht es im folgenden um Inkompetenz und Pfusch der Mediziner. Mindestens so wichtig sind aber die vielen alltäglichen Grausamkeiten, die Ärzte im Umgang mit ihren Patienten begehen: Der Missbrauch des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Die Ignoranz und Gefühlskälte der Mediziner. Die Unfähigkeit mancher Ärzte, sich in die Nöte, Ängste und Sorgen der Patienten hineinzuversetzen, oder ihr Unwille, es wenigstens einmal zu versuchen.
»Hass« ist ein großes Wort. Es ist eher eine Art Hassliebe, die in diesem Buch zum Ausdruck kommt. Eine Enttäuschung darüber, wie aus idealistischen jungen Studenten in wenigen Jahren zynische Ärzte werden können. Wie manche Mediziner die Medizin mit Füßen treten. Wie sie verkennen, was die Menschen, die ihnen anvertraut sind, wirklich brauchen. Wie sie die Patienten als ihre natürlichen Feinde und als lästige Störenfriede ansehen, anstatt als den Sinn und das Ziel all ihrer Bemühungen.
Gegenanzeigen: Es gibt viele gute Ärzte in diesem Land, die sich aufopferungsvoll um ihre Patienten kümmern und Tag und Nacht für sie da sind. Die erkennen, was für die Patienten wichtig ist und was in Wirklichkeit das Problem ist, wenn der Kranke diese oder jene Beschwerden angibt. Wenn Sie als Patient das Glück haben, an einen solchen Arzt zu geraten, und ihm vertrauen, bleiben Sie um alles in der Welt bei ihm. Dann brauchen Sie dieses Buch nicht. Und wenn Sie ein solcher Arzt sind, der fast alles richtig macht und seine Patienten ernst nimmt, brauchen Sie dieses Buch ebenfalls nicht.
Dosierung und Art der Anwendung: Sie können dieses Buch von vorne bis hinten lesen. Diese Art der Lektüre hat sich bei ähnlichen Produkten bestens bewährt, doch auch wenn Sie Kapitel überspringen, ist bisher nichts über schädliche Wirkungen bekannt.
Soweit von Ihrem Arzt nicht anders empfohlen, lesen Sie dieses Buch dreimal täglich, am besten morgens, mittags und abends nach den Mahlzeiten. Sie sollten die Seiten unzerkaut zu sich nehmen, etwas Flüssigkeit kann nicht schaden, wobei Alkohol die Wirkung verstärken kann. Wer zu Bluthochdruck oder leichtem Schlaf neigt, sollte das Buch in kleinerer Dosis und nicht am Abend vor dem Einschlafen zu sich nehmen.
Sie sollten kontinuierlich lesen, am besten fünf bis sieben Tage hintereinander, sonst könnten sich während zu langer Pausen Resistenzen bilden. Eine erhöhte Dosis benötigen Sie möglicherweise, wenn ein akuter Arztbesuch bevorsteht.
Dieses Buch wurde ausschließlich an Erwachsenen getestet. Erfahrungen mit Kindern liegen noch nicht vor. Aus bisherigen Untersuchungen lässt jedoch nichts darauf schließen, dass Kinder und Jugendliche das Buch nicht vertragen könnten. Um eventuelle Überreaktionen auszuschließen, sollte die tägliche Dosis für Kinder jedoch vorsichtshalber halbiert werden.
Risiken und Nebenwirkungen: Zu Beginn der Lektüre kann es sein, dass Sie sich verunsichert fühlen und keinem Arzt mehr vertrauen wollen. Das geht vorbei. Nach und nach werden Sie sich in Ihrer Urteilskraft gestärkt sehen und spüren, bei welchem Arzt Sie sich wohl fühlen und wem Sie sich anvertrauen wollen.
Selbstdiagnose
Es ist eine seltsame Art der Verrohung, eine stetig anschwellende Gefühllosigkeit, die angehende Doktoren während der Verwandlung vom idealistischen Novizen im Medizinstudium zum abgebrühten Assistenzarzt durchmachen. Nur wenige behalten ihre offene, menschenfreundliche Art bei. Es ist offenbar schwer, sich angesichts all des Leidens, über das man als Mediziner liest, das man sieht und aus nächster Nähe erfährt, das Gespür für die Nöte und Ängste der Kranken zu bewahren oder es gar weiterzuentwickeln. Dabei sind es im Umgang mit Patienten in erster Linie diese Empfindsamkeit und dieses Einfühlungsvermögen, auf die es ankommt.
Die Patientin war Mitte Sechzig, eine Winzerfrau aus einem weithin für seinen guten Wein bekannten Ort. Sie litt an einer Zuckerkrankheit, die schlecht eingestellt war, das heißt, ihr Blutzucker schwankte extrem und brachte die Patientin immer wieder an den Rand der Bewusstlosigkeit. Akut war die Dame wegen einer Thrombose stationär aufgenommen worden und befand sich längst wieder auf dem Weg der Besserung. Ich war – neben zwei anderen Medizinern auf unserer Station – als junger Assistenzarzt mit für sie zuständig. Sie hatte offenbar Vertrauen zu mir gefasst, denn sie fragte mich immer wieder, wie es um sie stünde und denn nun mit ihr weiterginge.
Eines Tages fühlte sich die Patientin nicht so wohl. Es ging ihr nicht gut, ihr war schlecht und auch ein bisschen schwindelig. Aber weder ihre Blutwerte noch andere Untersuchungsbefunde deuteten darauf hin, dass ein Rückfall zu befürchten war oder sich ein neues Leiden ankündigte. Ihrer baldigen Entlassung stand nichts im Weg. Doch als ich eines Tages in ihrem Zimmer vorbeischaute, fragte mich die Patientin: »Herr Doktor, muss ich sterben?«
Sie litt, sie war innerlich aufgewühlt, und sie war sichtlich beunruhigt. Ich sagte nur beiläufig: »Sterben müssen wir alle mal.«
Das fand ich wahrscheinlich cool und angesichts der oft unvorhersehbaren Krankheitsverläufe und Schicksalsschläge, mit denen man es in der Medizin oft zu tun hat, angemessen und auf gewisse Weise sogar originell.
Um Coolness geht es in der Medizin aber nie. Wie leicht wäre es für mich gewesen, mich an die Bettkante der Frau zu setzen, ein paar tröstende Worte zu sagen und ihr den Glauben und die Zuversicht zu vermitteln, dass sie schon bald wieder nach Hause würde zurückkehren können. Sie würde gesund entlassen werden, und es gab keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Statt dessen kam ein lakonischer Spruch von mir.
Immerhin entschuldigte ich mich ein paar Tage später verdruckst bei der Patientin für mein wenig mitfühlendes Verhalten. Sie sagte, dass sie meine Worte schon längst wieder vergessen hätte. Mir ging es anders.
Als sie eine Woche darauf tatsächlich aus der Klinik entlassen wurde, beschämte sie mich, indem sie sich besonders herzlich und mit einem beachtlichen Weinkontingent für meine Zuneigung, Hilfe und Unterstützung bedankte.
Das konnte so nicht weitergehen. Was war da mit mir passiert?
Ich war grob und unsensibel mit der Patientin umgegangen, hatte sie nicht verstanden, nicht mal zu verstehen versucht. Mir war sonnenklar gewesen, dass sie sich auf dem besten Weg zur Genesung befand und ihrer baldigen Entlassung aus medizinischer Sicht nichts im Weg stand. Sie hingegen machte sich große Sorgen. Sie konnte nicht einschätzen, was ihr verändertes Befinden zu bedeuten hatte, merkte aber, dass es ihr nicht gutging. Und sie hatte Angst, offenbar sogar Todesangst.
Das war nicht ich gewesen, der so mit der Patientin umsprang. Und natürlich war ich es doch beziehungsweise der Teil von mir, den die Zeit in der Klinik immer stärker zum Vorschein gebracht hatte. Ich war auf dem besten Wege, abzustumpfen und unempfindlich zu werden gegenüber den Bedürfnissen der Patienten. Hatte ich früher alte Menschen gemocht, wurden sie in der Klinik plötzlich zur Bedrohung, wenn sie krank wurden und ständig etwas forderten. Patienten begannen, lästig zu werden, Angehörige sowieso. Ich wollte ihnen immer häufiger aus dem Weg gehen in der Klinik und begann sogar über die schlechten Witze zu lachen, die immer wieder von den Ärzten über die Kranken gemacht wurden.
Ich sah die anderen Assistenzärzte um mich herum, die Oberärzte und Chefärzte, von denen sich viele zynisch und gefühlskalt gaben. Sie wurden oberflächlicher, wenn sie Hilfe und Unterstützung brauchten. Sie pflegten ihren Sarkasmus und ihre Sticheleien gegenüber Kollegen und Patienten, anstatt ehrlich zu sich und den anderen zu sein und darüber zu reden, wie überfordert und ausgebrannt sie sich immer wieder fühlten und dass sie manchmal einfach nicht mehr konnten. Wann immer es möglich war, vermieden sie den Patientenkontakt. Manche waren in den Alkohol geflüchtet, andere in die Forschung oder in Affären.
Was war da los? Hatten sie diese Haltung aus Selbstschutz im Krankenhaus entwickelt? War es Ausdruck ihrer Anspannung und Überlastung? Mir war das irgendwann egal. Ich wusste nur: So wollte ich nicht werden, das konnte es nicht sein. Es musste dringend etwas passieren.
Mir fielen nicht nur meine eigenen Erfahrungen ein, die ich als Patient mit Ärzten gemacht hatte, sondern auch die zahlreichen Erlebnisse, die mich während meiner Arztwerdung im Studium und im Beruf irritiert, verstört und verletzt hatten. Manche dieser Erinnerungen bezogen sich auf extreme Vorfälle, die meisten schienen jedoch typisch zu sein und sich in Variationen immer und immer wieder zu wiederholen: die Erniedrigung und Entwürdigung der Patienten, die fehlende Anteilnahme und das so wenig ausgeprägte Mitgefühl. Die Arroganz der Ärzte, ihre fehlende Zeit und das Unvermögen, hinter den geschilderten Beschwerden die wirklichen Notlagen der Kranken und Hilfesuchenden zu erkennen.
Viele dieser Geschichten habe ich hier aufgeschrieben. Die meisten habe ich selbst erlebt, andere nach den Schilderungen der unmittelbar Betroffenen dargestellt. Sie geben einen Eindruck davon, woran es mangelte, was mir bitter aufstieß. Vielleicht geben sie auch ein paar Hinweise darauf, woran es in unserem Gesundheitswesen in erster Linie mangelt.
Was ich an mir selbst während meiner Zeit in der Klinik immer häufiger beobachtete und von den Ärzten um mich herum in aller Deutlichkeit vorgeführt bekam, schreckte mich ab. So wollte ich nicht sein, so wollte ich nicht werden. Ich spürte, dass ich auf Dauer nicht als Arzt im Krankenhaus und auch nicht in der Praxis würde arbeiten können, dass dann zu vieles bedroht wurde, was mir wichtig war, und ich ernsthaft Schaden nehmen könnte. So nebensächlich die Erfahrung mit der Winzerfrau erscheinen mag, bald nach meiner verfehlten Antwort auf ihre Frage ahnte ich, dass ich in nicht allzu ferner Zeit den Beruf wechseln würde.
Ein paar Monate später habe ich gekündigt. Ich habe diesen Entschluss nie bereut. Den letzten Anstoß, dass dies die richtige Entscheidung war, bekam ich durch die Reaktion der ärztlichen Kollegen, mit denen ich zuletzt im Krankenhaus zu tun hatte. Einige von ihnen sagten mit wehmütigem Blick zu mir: »Du hast es gut. Ich würde ja auch etwas anderes machen, wenn ich eine Alternative hätte.«
1. Sprechstunde
Was Ärzte so sagen
Was der Beckenboden und eine Hängematte gemeinsam haben können, wie besorgte Mütter hormongesteuert fragen, warum auch Krampfadern gedemütigt werden können, und was ein junger Mann beim Arzt erlebt, nachdem er es endlich geschafft hat, ein Regal aufzubauen.
Die junge Frau hatte mit dreiundzwanzig ihr erstes Kind bekommen. Dabei war es bisher geblieben. Inzwischen war sie neunundzwanzig Jahre alt. Sie hatte keine Beschwerden, sie ging einfach deshalb zu ihrer Frauenärztin, weil ein Kontrolltermin anstand. Früher hatte sie einige Jahre als Krankenschwester gearbeitet, deshalb nahm sie die Vorsorgetermine ebenso ernst wie die U-Untersuchungen für ihre Tochter.
Nach der Untersuchung sagte die Gynäkologin zu der Frau: »Sie haben einen Beckenboden wie eine Hängematte. Das sieht gar nicht gut aus.«
Die Frau war verstört und ärgerte sich über die Ausdrucksweise der Ärztin, deren Worte sie gekränkt hatten. Zudem hatte sie bisher nichts davon bemerkt, dass ihr Beckenboden durchhing.
Sie war noch in Gedanken über das, was sie gerade gehört hatte, da redete die Frauenärztin schon weiter: »Wenn Sie nichts dagegen unternehmen, werden Sie später mal Probleme bekommen, dann können Sie früh inkontinent werden, ein Gebärmuttervorfall kann drohen, und vielleicht müssen Sie noch mit ganz anderen Schwierigkeiten rechnen.«
Die Patientin wollte etwas sagen, sie malte sich die Schrekkensvision aus, wie sie selbst in wenigen Jahren – vielleicht schon mit Mitte Dreißig – den Urin nicht mehr würde halten können, wie ihr Unterleib ihr ständig Beschwerden machte. Gleichzeitig dachte sie, dass sie momentan ja gar nichts spürte und weder mit dem Wasserlassen noch mit sonstigen Körperfunktionen irgendwelche Probleme hatte. Darüber wollte sie mit der Frauenärztin gern sprechen, doch die war bereits beim nächsten Punkt.
»Sie können Übungen machen, es gibt da dieses Buch, das kann ich Ihnen nur empfehlen – halten Sie sich daran.«
Und schon reichte ihr die Ärztin die Hand zum Abschied und geleitete sie zur Tür. Die junge Frau wollte eigentlich noch so viel sagen und fragen, aber offenbar war die Gelegenheit dafür verpasst, so dass sie sich nur mit einem schüchternen Händedruck verabschiedete. Kaum war sie aus der Praxis, ging sie in die nächste Buchhandlung und kaufte das Übungsbuch für den Beckenboden. Erst als sie ihr Auto aufschloss, hielt sie inne und fragte sich: »Was war das denn jetzt?«
Ein anderes Beispiel zeigt ebenso, wie manche Ärzte Patienten und ihre Angehörigen vor den Kopf stoßen. Dieser Fall ereignete sich nicht in der Arztpraxis, sondern im Krankenhaus: Der junge Ingenieur musste wenige Tage vor Weihnachten in die Klinik. Er hatte hohes Fieber, starke Kopfschmerzen, sein Nacken war steif. Gelegentlich packte ihn der Schüttelfrost. Die Ärzte in dem großen städtischen Krankenhaus dachten zunächst an eine Hirnhautentzündung, die Symptome wiesen darauf hin. Doch alle weiteren Untersuchungen ergaben keine eindeutigen Hinweise.
Auch nach drei Tagen ging es dem Mittdreißiger, der zuvor immer gesund gewesen war, noch nicht besser. Das Fieber blieb, er hatte weiterhin starke Schmerzen; dazu der Schwindel und die Übelkeit. Die Familie war in großer Sorge. Zum einen wollten die Eltern wissen, ob ihr Sohn Weihnachten zu Hause würde verbringen können. Viel mehr beunruhigte die Angehörigen aber, dass die Ärzte offenbar auch nach mehreren Tagen noch nicht recht wussten, woran der junge Mann litt und wie er zu behandeln war.
Nach vier Tagen reichte es der Mutter. Sie hielt die Ungewissheit und die Sorge um ihren Sohn nicht mehr länger aus. Als sie einen der Assistenzärzte sah, stellte sie sich ihm in den Weg und fragte, was denn nun los sei und was ihr Sohn hätte. Der junge Mediziner wich ein paar Schritte zurück, schaute sie distanziert an und sagte zu der verängstigten Mutter lapidar: »Hören Sie doch auf mit Ihren hormongesteuerten Fragen, dadurch wird es auch nicht besser.«
Ähnlich beleidigt fühlte sich eine Patientin in der Praxis eines Facharztes. Die ältere Dame ging zum Rheumatologen, weil ihr seit längerem schon die Hände weh taten. Besonders morgens konnte die Zweiundsechzigjährige die Handgelenke nicht gut bewegen, sie waren steif und fühlten sich manchmal wie gelähmt an. Sonst ging es ihr ganz gut, aber bis sie morgens in Schwung kam und alltägliche Bewegungen im Haushalt ohne Steifigkeitsgefühl und Schmerzen ausüben konnte, dauerte es inzwischen ein bis zwei Stunden.
Der Rheumatologe sah sich die Hände der Frau an und wollte dann sehen, wie es um die Beweglichkeit ihrer anderen Gelenke bestellt war. Die Frau entkleidete sich bis auf die Unterwäsche. Er betrachtete sie von oben bis unten, und als er auf die Beine sah, entfuhr es ihm: »Mein Gott, Sie haben ja Stampfer!«
Die Patientin wusste, dass ihre Beine nicht schön anzuschauen waren, weil sie von oben bis unten mit Krampfadern überzogen waren. Sie hatte sich schon zweimal operieren lassen, aber die Krampfadern waren immer wiedergekommen. Ihre Beine waren ihr peinlich, und manchmal mochte sie sich deswegen selber nicht – aber so etwas Hässliches hatte noch nie jemand zu ihr gesagt, erst recht kein Arzt. Sie fühlte sich gedemütigt.
Das Schlagwort von der sprechenden Medizin kann nicht bedeuten, dass die Ärzte immer mehr reden, den Patienten nicht zuhören und ihnen über den Mund fahren oder sie sogar kränken und beleidigen. Doch derartige Erfahrungen machen viele Menschen beim Arzt, auch ein Zweiunddreißigjähriger, der gerade dabei war, ein Regal in seiner Wohnung aufzubauen. Er hatte es nach einigen vergeblichen Versuchen und Flüchen endlich geschafft, da passierte es. Der junge Mann hob das fertige Regal an, drehte sich ein bisschen, da hörte er dieses knackende Geräusch in seinem Rücken. Er ahnte, was geschehen war, denn in seiner Lendenwirbelsäule breitete sich ein dumpfer Schmerz aus, und er konnte sich augenblicklich kaum noch bewegen. Es war ein Kreuz!
Nur mit Mühe schaffte er es zum nächsten Orthopäden, der glücklicherweise nur wenige hundert Meter entfernt seine Praxis hatte. Er konnte überhaupt nur gehen, wenn er den Oberkörper nach vorne beugte und die Beine bei seinen Schritten kaum anhob. Sich im Wartezimmer hinzusetzen bereitete ihm unendliche Schwierigkeiten.
Als er im Sprechzimmer des Arztes war, ging alles ganz schnell. Der Orthopäde schaute kurz auf den Rücken des Patienten, drückte ein bisschen an der Wirbelsäule herum, und dann fing er an zu reden. Der junge Mann kam überhaupt nicht dazu, seine Fragen loszuwerden und seine Befürchtungen, weil der Arzt sich schon wieder an den Schreibtisch gesetzt hatte und gerade ein Rezept ausfüllte.
Als der schmerzgeplagte Mann sich soweit sortiert hatte, dass er seine diversen Anliegen vorbringen konnte, drückte ihm der Orthopäde das Rezept für ein Schmerzmittel in die Hand und verabschiedete sich mit der Empfehlung, nach zwei, drei Wochen Medikamenteneinnahme nochmals vorbeizuschauen, wenn die Beschwerden bis dahin nicht verschwunden sein sollten.
Der Patient erhob sich, wobei es ihm erneut höllisch in den Rücken fuhr. Wortlos ging er aus dem Sprechzimmer. Er war wütend. Wobei er sich nicht sicher war, was ihn mehr ärgerte: Das selbstherrliche, ignorante Verhalten des Arztes, der ihn höchstens eine Minute lang gesehen hatte und ihn nicht einmal nach seinen Beschwerden oder danach gefragt hatte, was er wissen wollte. Oder aber seine eigene Sprachlosigkeit. Denn mindestens so groß wie der Ärger über den Arzt war der Ärger des Patienten über sich selbst. Eigentlich hatte er wissen wollen, ob es etwas Ernstes sei, ob er sich Sorgen machen müsse und wie lange die Beschwerden wohl anhalten würden. Zudem wollte er wissen, ob er sich schonen müsse, wann er wieder Sport machen könne oder ob sonst irgend etwas zu beachten wäre. Jetzt wusste er nichts von alledem, außer, dass ihm der Rücken furchtbar weh tat.
Viel zu klein
Wie groß der Kopf eines Kindes nach ärztlicher Vorstellung exakt zu sein hat, was für originelle Ähnlichkeiten Ultraschallmessungen ergeben können, wie schnell ein Kind geboren werden kann, wenn es die Bürokratie erfordert, und wie hilfreich es sein kann, wenn es Geschwister gibt.
Die grazile Frau war zum zweiten Mal schwanger, mittlerweile in der 30. Woche. Sie hatte einen sehr zarten und schmalen Körper, aber trotzdem machte ihr der immer runder werdende Bauch keinerlei Beschwerden. Es ging ihr in der zweiten Schwangerschaft ebensogut wie in der ersten. Da ihr Mann Arzt war, hatten sich beide dazu entschlossen, dass sie das Kind in der Klinik zur Welt bringen würde, in der er arbeitete. Jetzt stand wieder ein Kontrolltermin an.
Die Ärztin, die sie in der Ambulanz betreute, machte einen entschlossenen, zupackenden Eindruck, auch wenn sie noch recht jung wirkte. Sie fragte kurz nach dem bisherigen Verlauf der Schwangerschaft, dann begann sie mit der Untersuchung. Die werdende Mutter schaute währenddessen auf das Mobile an der Decke und dachte daran, wie sie den Sommer genießen würden, wenn das Kind im Frühjahr zur Welt käme. Die Ärztin fuhr währenddessen eine Weile mit dem Ultraschallkopf auf dem Bauch herum, dann entfuhr ihr ein überraschtes »Ooh!« Das Ehepaar schaute irritiert.
»Der Kopf ist zu klein«, sagte die Ärztin entschieden.
Der Mann stutzte.
»Na ja, ist das ein Wunder?«, entgegnete der Mann und wollte beschwichtigen. »Sehen Sie sich doch meine Frau an, wie klein und zierlich sie ist. Das wird doch wohl der Grund dafür sein.«
»Nein, das ist deutlich zu klein. Das müssen wir ernst nehmen. Sie sollten in drei Tagen noch einmal zur Kontrolle kommen«, insistierte die Ärztin.
Der Mann war zwar selbst Mediziner, doch er arbeitete als Augenarzt und kannte sich daher in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe nicht genauer aus. Ihm fiel jedoch seine Schwägerin ein, bei der ein Ultraschall in der 28. Schwangerschaftswoche ebenfalls ziemlich seltsam verlaufen war. Während der Untersuchung hatte der Arzt damals gemurmelt, dass der Kopf des Babys »ziemlich groß« sei. Seine Schwägerin war irritiert und beunruhigt, weil sie fürchtete, dass mit dem Kind etwas nicht in Ordnung wäre. Diese Sorge steigerte sich noch, denn der Arzt hatte seinerzeit auch gegrummelt: »Kann auch mal ein Anzeichen für einen Wasserkopf sein.« Hinterher hatten sie seine Schwägerin tagelang trösten und beruhigen müssen. Als die Tochter dann zur Welt kam, war sie gesund und völlig normal – bis heute, mit mittlerweile neun Jahren.
Passierte ihnen jetzt so etwas Ähnliches? Eigentlich hatte er zwar das Gefühl, dass die Ärztin sich geirrt haben musste bei ihrer Ultraschallmessung, aber so genau konnte man es schließlich nicht wissen – auch er als Arzt natürlich nicht. Seine Frau war ebenfalls beunruhigt. Sie war sich bisher sicher gewesen, dass mit dem Baby in ihrem Bauch alles in Ordnung war. Als sie wieder zu Hause waren, fühlten sich beide angespannt. Nachts, vor dem Einschlafen, malte sich das Ehepaar aus, was alles der Grund für den zu kleinen Kopf sein konnte.
Drei Tage später war das Paar wieder in der Klinik. Wieder war die junge Assistentin da, wieder zückte sie den Ultraschallkopf. Sie vermaß nochmals den Schädel des Ungeborenen in verschiedenen Richtungen. Als sie fertig war, machte sie wieder ein besorgtes Gesicht und begann ihren Vortrag.
»Ich bin zu den gleichen Ergebnissen gekommen wie vor drei Tagen. Es gibt verschiedene Ursachen, wenn der Kopf …«
»Halt, halt, schauen Sie sich erst mal das an, bevor Sie weiterreden.«
Der Mann hatte die Ultraschallbilder ihres ersten Kindes mitgebracht, eines völlig gesunden, mittlerweile dreijährigen Jungen. Er hatte seinerzeit in der 30. Schwangerschaftswoche genau die gleichen Schädelmaße gehabt.
»Aber diese Werte sind nicht normal«, sagte die Ärztin beharrlich.
»Wir möchten mit einem Oberarzt reden, bevor Sie uns hier weiter Horrorgeschichten erzählen«, forderte der Mann.
Nachdem der Oberarzt aufgetaucht war, fand der Ambulanztermin schnell ein Ende. Der erfahrene Frauenarzt schaute kurz auf den Ultraschall, dann mit strengem Blick auf die Assistenzärztin.
»Ich weiß gar nicht, was Sie hier wollen«, sagte er freundlich zu dem Ehepaar. »Alles normal, kein Grund zur Sorge.«
Er wünschte den beiden noch alles Gute für die Geburt. Was er zu seiner Assistentin sagte, die das Paar so verunsichert hatte, bekamen sie nicht mehr mit.
Die Geburt verlief dann völlig komplikationslos. Zumindest aus medizinischer Sicht. Allerdings war es zeitlich etwas knapp. Denn die hochschwangere Frau wurde noch aufgehalten. Sie hatte bereits Presswehen, der Muttermund war schon weit geöffnet. Es ging alles sehr schnell, die beiden stürmten in die Klinik.
Am Eingang kamen sie jedoch nicht weiter.
»Sie müssen sich erst anmelden«, sagte die Dame am Empfang kategorisch.
»Das geht nicht«, sagte der Mann. »Das Kind kommt gleich, meine Frau hat bereits stärkste Wehen. Außerdem arbeite ich hier.«
»So schnell wird es schon nicht kommen«, sagte die Empfangsdame und schob in aller Ruhe das Aufnahmeformular über den Tresen.
Kaum im Kreißsaal angekommen, kam das Baby auch schon zur Welt. Es war gesund und ist es bis heute. Manchmal, wenn die Kinder gerade wieder besonders dickköpfig sind und sich streiten, müssen sich die Eltern anschauen und schmunzeln und an ihre viel zu kleinen Köpfe denken.
Es ist ja nichts Ernstes
Wie sich plötzlich alles dreht, warum der Patient eine Erklärung für seine Beschwerden findet, der Arzt aber die heile Welt des Patienten sofort wieder kaputtmacht und dieser daraufhin jede zukünftige Erschütterung fürchtet.
Ihm war schwindelig, und das schon seit ein paar Monaten. Anfangs hatte es den zweiundvierzigjährigen Unternehmensberater nur kurz irritiert, denn er war sicher, dass es an der derzeitigen Stressituation im Beruf und in der Familie lag. Er war unter Druck. Sein Arbeitgeber verlangte mehr von ihm, als er bewältigen konnte, die Familie beklagte sich, dass er immer weniger Zeit hatte. Das wusste er, und er wusste auch, dass es zu viel war, was da gerade alles bei ihm zusammenkam. Er war überzeugt, dass seine Symptome nachlassen würden, sobald er wieder etwas langsamer machen würde.
Doch die Beschwerden wurden nicht weniger, im Gegenteil. An manchen Tagen kam es sechs- oder achtmal vor, so dass er das Gefühl hatte, alles um ihn herum würde sich drehen. Er wollte sich kurz festhalten, fuhr zusammen, so sehr verunsicherte ihn dieser kurze Blitz. Doch kaum fasste er an die Tischplatte, um Halt zu suchen, war es auch schon wieder vorbei. Nach zwei Monaten, in denen der Schwindel an manchen Tagen immer wiederkam und dann für eine Woche oder länger ganz ausblieb, um dann wieder einzusetzen, hatte er genug. Er ging zum Arzt.
Zuerst war er beim Kardiologen. Der untersuchte ihn, machte einen Ultraschall vom Herzen und von den Halsschlagadern, ließ ein EKG in Ruhe und in Belastung schreiben. Er konnte aber nichts Außergewöhnliches feststellen, außer dass der Unternehmensberater einen leicht erhöhten Blutdruck und ebenso leicht erhöhte Blutfette hatte. Der Herzspezialist empfahl dem besorgten Mann, mehr Sport zu treiben und zum Neurologen zu gehen.
Der korrekt gescheitelte Neurologe war ein Arzt, der jede Gefühlsregung zu unterdrücken schien und mit monotoner Stimme sanft vor sich hin redete. Er ließ sich kurz die Beschwerden schildern, dann schickte er den Mann durch seinen Untersuchungsparcours. Für die Wartezeiten zwischen den einzelnen diagnostischen Tests drückte er ihm ein Buch über Schwindel in die Hand. Da der Mann wusste, dass er sich in letzter Zeit zuviel zugemutet hatte, las er zuerst das Kapitel über psychosomatisch bedingten Schwindel. Was er dort erfuhr, bestätigte ihn in seiner Vermutung: Stressbedingter Schwindel trat typischerweise in größeren Gruppen und bei unangenehmen Gesprächen auf, stand dort zu lesen – nach ein wenig Alkohol und während sportlicher Betätigung waren die Beschwerden hingegen verschwunden.
So stand es in dem Buch, und so war es auch bei ihm. Er wusste, dass er an Supermarktkassen, in vollen Kaufhäusern und Restaurants manchmal unsicher wurde und das Gefühl hatte, sich vergewissern zu müssen, dass er noch mit beiden Beinen auf dem Boden stand. Dann kontrollierte er argwöhnisch sein Gleichgewicht. Eine übersteigerte Form der Selbstwahrnehmung und -beobachtung. Auch das stand in dem Buch. Ferner, dass Schwindel nach Kopfschmerzen das häufigste Symptom in der Praxis der Allgemeinmediziner und Hausärzte ist und dass zwischen einem Drittel und der Hälfte der Patienten die Schwindelbeschwerden aufgrund von Stress oder anderen psychosomatischen Schwierigkeiten haben.
Das beruhigte ihn, und während er weiter untersucht wurde, breitete sich Erleichterung in ihm aus, da seine Beschwerden offenbar keine bedrohliche organische Ursache hatten. Er beschloss jetzt schon, demnächst – jedenfalls nach Abschluss des aktuellen Projekts – kürzerzutreten, sich mehr um seine Familie zu kümmern und sich und seiner angeschlagenen Psyche etwas Gutes zu tun. So konnte es jedenfalls nicht weitergehen.
Doch zunächst folgten weitere Untersuchungen. Er wurde verkabelt und in einem Drehstuhl herumgeschleudert, bekam einen Kopfhörer mit Tongeräuschen aufgesetzt und musste in einer abgeschirmten Kammer irrlichternden Lichtimpulsen folgen, während die Bewegungen seiner Augen und die Hirnströme, die mit seinen Hörnerven zusammenhingen, aufgezeichnet wurden. Seine Ohren wurden mit kaltem und heißem Wasser gespült, und während dieser seltsamen Prozedur wurde ihm wirklich schwindelig. Eine komische Situation – er lag in einem Sessel, und alles um ihn herum drehte sich. Aber die Assistentin, die ihm auf diese Weise die Ohren wusch, versicherte ihm, dass dies allen Patienten während der Untersuchung so ginge. Völlig normal.
Beschwingt ging er zur abschließenden Besprechung noch einmal in das Sprechzimmer des Arztes. Der fragte nochmals nach den genauen Umständen der Beschwerden, und der Unternehmensberater erwähnte ausdrücklich, dass er keinen Schwindel spüre, wenn er etwas Alkohol getrunken habe oder jogge. Er wartete darauf, dass ihn der Arzt fragte, wie es in seiner Seele aussehe und ob ihn etwas bedrücke. Doch der Mediziner erwähnte mit keinem Wort, dass die Beschwerden auch eine psychische Ursache haben könnten. Er fragte nicht nach den weiteren Lebensumständen des Patienten, nicht nach seinem Beruf, nicht nach seinem Privatleben.
Statt dessen konfrontierte er ihn mit einer möglichen Diagnose. »Vestibuläre Paroxysmie« lautete der zungenbrecherische Name. Der Unternehmensberater zuckte innerlich zusammen. Das saß. Die Diagnose ist zwar schwer zu beweisen und wird nur gestellt, wenn die Ärzte nichts anderes finden, aber der Neurologe konnte dem Patienten damit eine Erklärung für seine Beschwerden bieten: Wenn der Gleichgewichtsnerv etwas lädiert ist, womöglich, weil eine kleine Arterie ihn bedrängt, können manchmal überschießende Signale ans Gehirn gesandt werden, die zu gelegentlichen Schwindelirritationen führten. Da der Patient unterschiedlich stark auf die Reizung mit kaltem und heißem Wasser reagiert habe und sich dies auch in der Nervenmessung bestätigte, liege dieser Verdacht nahe, sagte der Arzt.
Kurze Stille, der Patient war irritiert. Gerade noch hatte er geglaubt, selbst die Ursache für seine Beschwerden gefunden zu haben. Ihm war plötzlich alles ganz klar geworden, und jetzt machte dieser Arzt wieder alles kaputt, indem er eine Art Verlegenheitsdiagnose aus dem Hut zauberte, die den Patienten erneut verunsicherte und aus einem manchmal etwas hypochondrisch und neurotisch veranlagten Gesunden einen Kranken machte.
»Hier ist das Rezept«, sagte der Neurologe. »Zu Beginn nehmen Sie das eine Woche lang einmal täglich, dann zweimal täglich für mindestens drei Monate.«
Der Patient war schockiert. Eben noch hatte er sich so entlastet gefühlt, und jetzt hatte er eine neue Diagnose. Er wollte, dass der Arzt mit ihm über seine Sorgen sprach und ihm vielleicht noch gut zuredete, dass die Beschwerden wahrscheinlich wieder verschwinden würden, wenn er es etwas ruhiger angehen ließe und sich nicht permanent überforderte.
»Aber so schlimm ist es doch gar nicht«, sagte der Patient fast flehend.
»Es ist ja auch nichts Ernstes, und die Medikamentendosis ist sehr gering, aber wenn Sie nicht darunter leiden würden, wären Sie ja wohl kaum hierhergekommen«, sagte der Arzt und öffnete die Tür, um den Patienten zu verabschieden. Der Arzt sagte zwar noch, dass die Diagnose oft als einzige Erklärung übrigbleibe, wenn alle organischen Ursachen ausgeschlossen seien, aber das bekam der verunsicherte Mann kaum noch mit.