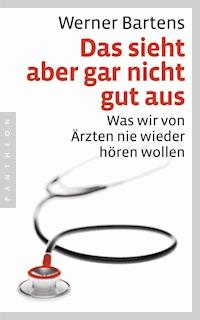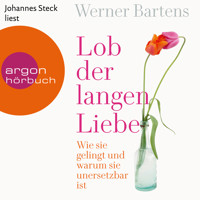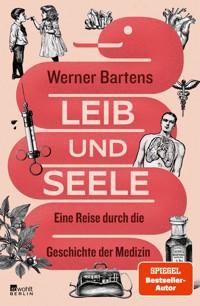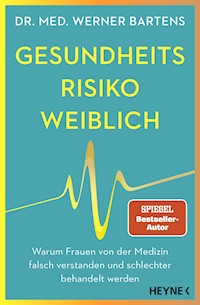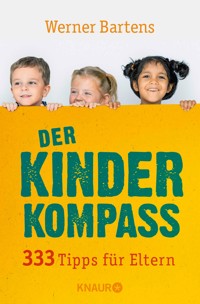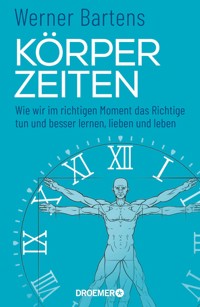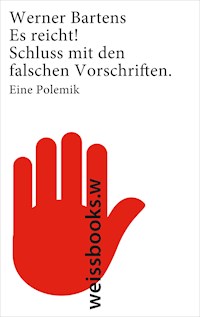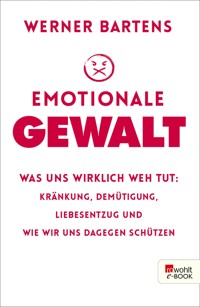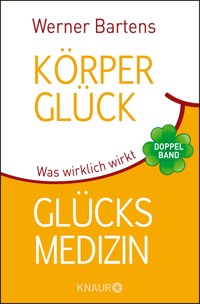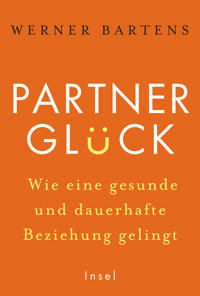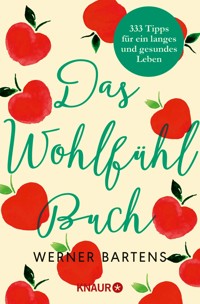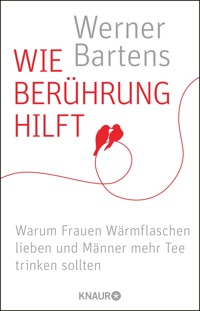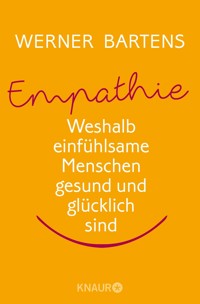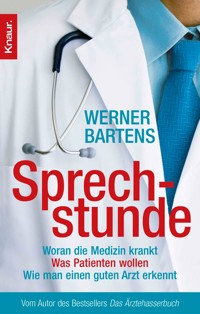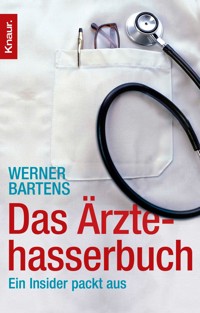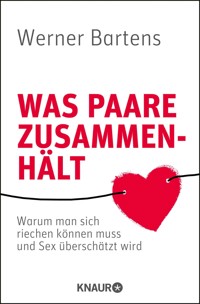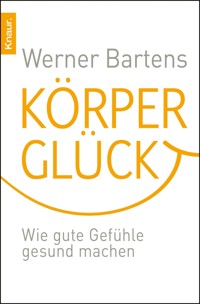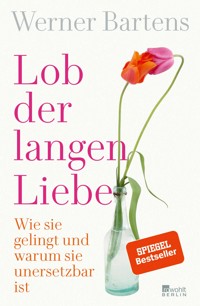
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wer am Anfang einer Beziehung steht, dem helfen unzählige Ratgeber. Aber was ist mit denen, die schon länger oder richtig lang zusammen sind? Eine längere Beziehung wirft immer – egal, ob die Partner in ihren Dreißigern, Vierzigern oder Fünfzigern sind – grundsätzliche Fragen auf. Rund zwei Drittel aller Paare fühlen sich in ihrer Beziehung unsicher, sie beschäftigen sich – offen oder insgeheim – mit der Frage, ob sie so weiterleben möchten. Aber wer eine langjährige Beziehung aufgibt, so erklärt der Arzt und Bestsellerautor Werner Bartens, gibt einen Schatz an Gemeinsamkeiten, Erfahrungen und Vertrautheit auf, den das Paar in Jahren gesammelt hat. Und gesünder lebt man zu zweit sowieso, wie die Forschung weiß, außerdem glücklicher und, anders als der überzeugte Single vielleicht meint: mit wesentlich mehr Sex. Aber eine lange Beziehung stellt auch Anforderungen: Werner Bartens erklärt, worauf es in einer richtigen Partnerschaft ankommt, ganz egal, wie alt man ist. Ohne Schmetterlinge im Bauch geht's auch: sogar besser, sagt Bartens, denn Sie werden sich in ihrer langen Beziehung so glücklich fühlen, wie Sie am Anfang gerne gewesen wären.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Werner Bartens
Lob der langen Liebe
Wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist
Über dieses Buch
Eine Fülle von Ratgebern kümmert sich um frisch verliebte Paare. Aber was ist mit denen, die schon länger oder richtig lang zusammen sind? Eine längere Beziehung wirft immer – egal, ob die Partner in ihren Dreißigern, Vierzigern oder Fünfzigern sind – grundsätzliche Fragen auf. Rund zwei Drittel aller Paare fühlen sich in ihrer Beziehung unsicher, sie beschäftigen sich – offen oder insgeheim – mit der Frage, ob sie so weiterleben möchten. Aber wer eine langjährige Beziehung aufgibt, so erklärt der Arzt und Bestsellerautor Werner Bartens, gibt einen Schatz an Gemeinsamkeiten, Erfahrungen und Vertrautheit auf, den das Paar in Jahren gesammelt hat. Und gesünder lebt man zu zweit sowieso, wie die Forschung weiß, außerdem glücklicher und, anders als der überzeugte Single vielleicht meint: mit wesentlich mehr Sex. Doch eine lange Beziehung stellt auch Anforderungen: Werner Bartens erklärt, worauf es in einer richtigen Partnerschaft ankommt, ganz egal, wie alt man ist. Ohne Schmetterlinge im Bauch geht’s auch: sogar besser, sagt Bartens, denn Sie werden sich in Ihrer langen Beziehung so glücklich fühlen, wie Sie am Anfang gerne gewesen wären.
Vita
Dr. med. Werner Bartens ist leitender Redakteur im Wissenschaftsressort der «Süddeutschen Zeitung». Er gilt als einer der einflussreichsten deutschen Publizisten zum Thema Gesundheit. Seine Bücher «Was Paare zusammenhält», «Glücksmedizin» und «Das Ärztehasserbuch» standen monatelang auf der «Spiegel»-Bestsellerliste. Zuletzt erschien von ihm bei Rowohlt Berlin «Emotionale Gewalt» (2018).
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung Müggenburg/plainpicture
ISBN 978-3-644-00486-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Eine Ermunterung
Ein Ehepaar erscheint vor dem Scheidungsrichter. Er ist sechsundneunzig Jahre alt, sie fünfundneunzig. Der Richter fragt irritiert: «Warum lassen Sie sich denn jetzt noch scheiden?»
Antwort des Paares: «Wir wollten erst warten, bis die Kinder tot sind.»
Dieses hochbetagte Paar hat es schon ziemlich lange miteinander ausgehalten, immerhin. Trotzdem spricht die Begründung der beiden, warum sie sich so spät doch noch trennen wollen, nicht gerade dafür, dass sie in den vielen Jahrzehnten zuvor eine glückliche Ehe geführt hätten. Vielmehr haben sie eine der klassischen Erklärungen dafür genannt, warum sie sich nicht schon viel früher haben scheiden lassen: wegen der Kinder.
Dabei könnten Paare mittlerweile eigentlich wieder mehr Zutrauen in ihre Beziehung haben. Und das trotz dieser vermaledeiten Vierziger-Regel. Statistisch gesehen nämlich leben in Großstädten mehr als vierzig Prozent aller Erwachsenen als Singles, wie es regelmäßig in den einschlägigen Erhebungen heißt. Und von den Ehen, zu denen sich die wenigen Wagemutigen dann doch irgendwann (und von Jahr zu Jahr in einem immer höheren Alter) entschließen, werden fast vierzig Prozent wieder geschieden. Keine besonders guten Aussichten also für alle, die an längeren Beziehungen interessiert sind, geradezu ein Grund, verzweifelt einsam zu einem vierzigprozentigen Schnaps zu greifen, wenn es nicht – siehe oben – doch noch einen Funken Hoffnung geben würde. Denn seit 1990 sind die Ehen wieder deutlich haltbarer geworden, zumindest gilt das für die erste Halbzeit. Paare schaffen es mittlerweile, wieder länger zusammenzubleiben. Die mittlere Dauer einer standesamtlich geschlossenen Verbindung in Deutschland hat sich in den vergangenen dreißig Jahren erheblich verlängert.
Die Ehen, die im Jahr 1990 – also in der Zeit rund um die Wiedervereinigung – geschieden wurden, waren hingegen weitaus weniger bruchsicher gewesen. Sie hielten im Durchschnitt gerade mal gut zehn Jahre, dann war Schluss. Im Jahr 2018 ist die Dauer der Beziehungen, die mit einer Scheidung endeten, immerhin auf durchschnittlich fünfzehneinhalb Jahre angestiegen. Fünf Jahre länger, das bedeutet fast um die Hälfte mehr. Da ist zwar immer noch eine Menge Luft nach oben, aber trotzdem ist es ein vielversprechendes Indiz, das die Menschen ermuntern könnte, sich langfristig zu binden.
Allerdings muss man gleich ein wenig Wasser in den Wein schütten: Zwar dauert es mittlerweile erheblich länger, bis ein verheiratetes Paar die Verbindung wieder auflöst. Doch wirklich stabiler sind die Ehen nicht geworden, denn ein anderer Trend ist unverkennbar: Immer mehr Paare lassen sich auch nach vielen Jahren der Gemeinsamkeit noch scheiden, also dann, wenn sie selbst schon in ihren fünfziger oder sechziger Jahren sind. Statt gemeinsam als Rentnerpaar auf der Bank in der Sonne zu sitzen und die Enkel zu beaufsichtigen, gehen die Beziehungen der Silver Ager noch erstaunlich oft in die Brüche.
Die Babyboomer werden auf ihre alten Tage offenbar ungeduldig mit sich und dem Partner. So hat sich beispielsweise die Anzahl der Ehepaare, die sich sehr spät, also noch nach sechsundzwanzig oder mehr gemeinsamen Ehejahren getrennt haben, zwischen 1992 und 2012 mehr als verdoppelt. Partnerschaften halten also wieder etwas länger – aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dann für immer und ewig zusammenzubleiben, leider geringer geworden. Das kann nicht allein an der gestiegenen Lebenserwartung und der größeren Mobilität im Alter liegen.
Es verhält sich also mit der Ehe bei weitem nicht so, wie es gemeinhin Kindern nachgesagt wird, die angeblich «aus dem Gröbsten raus» sind, wenn erst die frühen Jahre glücklich überstanden sind. Gerade wenn die Kinder fast erwachsen sind und flügge werden, findet oftmals eine Generalinventur der Beziehung statt und führt zur späten Trennung. Für die Best Ager gilt daher, dass sie gerade dann noch etwas für ihre Partnerschaft tun sollten, wenn sie in die Jahre gekommen ist. Die Ehe bietet besonders in jener schwierigen Phase, wenn sie bereits Rost angesetzt hat und die Routinen eingeschliffen sind, längst keinen «sicheren Hafen» mehr.
Manche Partnerschaft droht allerdings auch schon früher morsch zu werden, also bereits vor der «Rosenhochzeit», wie das zehnjährige Ehejubiläum manchmal genannt wird. Dabei lassen sich einige Sollbruchstellen schon frühzeitig erkennen – und krisenfest ausbessern. In diesem Buch werden die ersten Anzeichen für das drohende Ehe-Aus beschrieben und hilfreiche Hinweise gegeben, wie sich ein Scheitern der Beziehung vermeiden lässt.
Sich zu trennen scheint auf den ersten Blick nämlich relativ leicht zu sein; das geht recht schnell und ist heutzutage immer seltener mit moralischen Vorwürfen verbunden. Wenn es plötzlich rauer zugeht, der Zauber der ersten Verliebtheit schon lange verflogen ist und statt glühender Leidenschaft vor allem mäßig prickelnde Gewohnheiten den Alltag bestimmen, dann ist es oft schwieriger, zusammenzubleiben. Aber es lohnt sich, meistens jedenfalls – und dafür gibt es viele gute Gründe, die ebenfalls in diesem Buch aufgezeigt werden.
Etliche langgediente Paare fragen sich zwar, was von ihrer Liebe bleibt, wenn nach etlichen Jahren Gemeinsamkeit noch immer so viel Ehe übrig ist. Sie raufen sich dann trotzdem mehr schlecht als recht zusammen und versuchen es auch weiterhin als Paar. Häufig geschieht dies aber aus rein pragmatischen Gründen – die Kinder, langfristige Schulden, das gemeinsame Haus oder schlicht aus Bequemlichkeit und der bangen Ungewissheit, was danach kommen könnte. Die Angst vor dem Neuen ist oftmals größer als der alltägliche Horror zu Hause. Die Partner stottern dann ernüchtert die vielen gemeinsamen Jahre ab, die sie noch vor sich haben, ohne miteinander zufrieden oder gar glücklich zu sein. Kann man so machen, ist aber keine schöne Perspektive.
Mit sich und ihrem Partner im Reinen sind solche Paare denn auch nur selten. Sie haben stattdessen das Gefühl, im Leben irgendwann an der entscheidenden Stelle falsch abgebogen zu sein und längst den Zeitpunkt verpasst zu haben, an dem sie noch umkehren oder eine andere Richtung hätten einschlagen können. Sie hadern mit sich und ihrem fehlenden Mut und kämpfen sich an ihrem Partner ab. Manche bemitleiden sich selbst oder verfallen gar in allgemeine Resignation. Die Zündschnur der Liebe wird nach und nach immer kürzer. Ist sie schließlich endgültig abgebrannt, kommt es dann doch irgendwann zur Explosion, und der angestaute Frust und Ärger entladen sich.
Auf die Idee, jetzt noch etwas für ihre Beziehung tun zu können, kommen solche in sich und ihrer Partnerschaft gefangenen Menschen oftmals gar nicht mehr. Dabei ist «Selbstwirksamkeit» nicht nur für Paarkonflikte, sondern in allen schwierigen Lebensphasen eine äußerst hilfreiche Ressource. Psychologen verstehen darunter, sich nicht in seiner Opferrolle einzurichten und zu resignieren, sondern auszuloten, was man selbst tun kann, um etwas an seiner Lage zu ändern.
Dazu gehört es beispielsweise, sich zu sagen: Ich kann es eigentlich sehr wohl mit meinem Partner schaffen, wir versuchen es noch mal gemeinsam, ich strenge mich dafür an und lasse mich nicht so schnell unterkriegen. Wichtig ist dabei allerdings, auch Misserfolge und Stillstand zu akzeptieren. Beides wird es zwischendurch unweigerlich geben. Halten beide das aus, steigen die Frustrationstoleranz und das Durchhaltevermögen.
Anstatt verzweifelt auf die angeblich verlorenen Jahre und die derzeitigen Blockaden in der Beziehung zu starren, geht es auch anders. Das gemeinsame Glück – oder wenigstens die Zufriedenheit miteinander – lässt sich bewahren, und die Liebe kann durchaus zum Bleiben bewegt werden. Zusammen zu sein und es auch zu bleiben kann nämlich ziemlich gut sein und alte Liebe sogar die beste.
Der Begriff «alt» genießt zwar in vielerlei Hinsicht keinen guten Ruf in einer vor allem an Mehrwert und Innovationen orientierten Gesellschaft, in der «neu» automatisch mit «besser» gleichgesetzt wird. Allerdings ist es höchste Zeit, das zu ändern. Schließlich gibt es etliche Gründe, warum neben altem Wein, alten Streichinstrumenten und alten Freunden endlich auch das Wortpaar «alte Liebe» viel positiver bewertet werden müsste. Alt kann schließlich auch bedeuten, dass etwas bewährt ist, wertvoll und aus diesen Gründen besonders kostbar.
Auch chronische Beziehungen – so nenne ich jenes trostlose Zusammensein von Paaren, das nicht nur schon lange andauert, sondern auch erhebliches Leid für beide Seiten mit sich bringt – lassen sich erfreulich gestalten und zu einem Quell der Lebensfreude statt der Bitternis machen. Es braucht allerdings eine neue Wahrnehmung des anderen und des Zusammenseins, man kann auch sagen, dazu ist ein neues Mindset nötig. Ein neuer Blick auf die Liebe und das gemeinsame Leben als Paar muss her.
Besser alte Liebe als neue Probleme
«Es gibt nur einen Weg, eine glückliche Ehe zu führen, und sobald ich erfahre, welcher das ist, werde ich erneut heiraten.»
(Clint Eastwood)
Um die Liebe zu bewahren, ist es hilfreich, die verschiedenen Konjunkturen der Liebe realistisch anzuerkennen. Während in vielen anderen Bereichen des Alltags sehr wohl akzeptiert wird, dass es unterschiedliche Phasen im Leben gibt, sei es in der Kindheit, während der Pubertät, in mittleren Jahren und im Alter, aber auch in Zeiten der Ausbildung und im Beruf, werden die Liebe und das Zusammenleben als Paar noch immer hoffnungslos verklärt, so als ob es immer gleich bliebe wie im Schlussbild eines romantischen Films.
Man sollte sich für einen Moment – und in der Liebe immer wieder – klarmachen, was hier eigentlich Ungewöhnliches von einem Paar erwartet wird: Es geht um nicht weniger als den abrupten Wechsel des Aggregatzustandes von zwei Menschen, die sich kurz zuvor meist noch vollkommen fremd waren, oft einander nicht mal kannten. Dann finden sie sich und sind plötzlich aufs innigste miteinander verbunden.
Und nach diesem rasanten Frontalzusammenstoß an Zuneigung und Begeisterung sollen sie es dann auf Dauer miteinander aushalten? Also auch dann, wenn die anfängliche Leidenschaft längst wieder eingeschlummert ist? Es gibt leichtere Aufgaben im Leben, trotzdem wird diese enorme Anpassungsleistung völlig unterschätzt – und gleichzeitig gnadenlos idealisiert. «Es wird nach einem Happy End / im Film jewöhnlich abjeblendt», beobachtete Kurt Tucholsky und nannte auch den Grund dafür im Rückblick auf die gemeinsame Zeit: «Ach, Menschenskind, wie liecht det weit / wie der noch scharf auf Muttern war (…) Die Ehe war zum jrößten Teile / vabrühte Milch un Langeweile / und darum wird beim Happy End / im Film jewöhnlich abjeblendt».
Während es sonst ein ständiges Auf und Ab im Leben gibt, gelegentliche Hochs und Tiefs nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind, wird von der Liebe ein ewig währendes Glücksgefühl der märchenhaften Schwerelosigkeit und hormongetränkten Leidenschaft erwartet, ein altersloses wonniges Miteinander, ein rosarotes Bällebad voller übermütiger Emotionen und Sinnenreize. Höchste Zeit, dieses Zerrbild ein wenig zurechtzurücken – und den Menschen Mut zu machen, sich trotzdem, für mehr als einen Lebensabschnitt, aneinander zu binden.
Für langgediente Paare wie auch für Alleinstehende auf der Suche nach einer Partnerschaft wäre es wichtig, sich mit Neugier auf etwas ganz Einfaches einzustellen: Die unterschiedlichen Lebensschwellen und Lebensstufen müssen anerkannt und angenommen werden, weil sie eben nicht nur das Leben allgemein, sondern auch das Liebesleben und eine Partnerschaft durchziehen und mitbestimmen, wie man sich fühlt. Da gibt es ständige Aufs und Abs und neben heiteren eben auch immer wieder düstere Momente.
Die Schweizer Ärztin und Autorin Elisabeth Kübler-Ross hat in den 1960er Jahren fünf Phasen beschrieben, die typisch dafür sind, wie Menschen damit umgehen, wenn sie erfahren, dass sie an einer unheilbaren Krankheit leiden:
Zuerst, in der Zeit unmittelbar nach der Diagnose, überwiegt das Leugnen, das Nicht-wahrhaben-Wollen. Es kann doch nicht wahr sein, dieser Befund kann schlicht nicht stimmen, die Untersuchung muss ein falsches Ergebnis geliefert haben! Bald darauf folgen Ärger und Zorn, gepaart mit der Frage, warum ausgerechnet ich? Es werden Ursachen und Erklärungen gesucht. Betroffene forschen in ihrer Lebensgeschichte, grübeln darüber nach, was sie falsch gemacht haben könnten oder weshalb es gerade sie erwischt haben könnte.
Danach folgt eine Phase, in der viele Menschen hoffen, durch Wohlverhalten oder besondere Rituale ihr Schicksal noch günstig beeinflussen zu können. Sie ernähren sich anders, trennen sich von ihrem Partner, ziehen sich zurück oder gehen auf eine große Reise – oftmals sehr zur Verwunderung ihrer nächsten Umgebung. Es folgen schließlich Niedergeschlagenheit und Leid, bis letztlich das Unvermeidliche angenommen wird.
Okay, die Liebe ist nur in besonders schweren Fällen mit einem unheilbaren Leiden zu vergleichen, und das Annehmen des Unvermeidlichen sollte nicht am Ende stehen. Aber auch in einer Beziehung geht es darum, die Zyklen und Wechselfälle des Miteinanders kennen- und schätzen zu lernen und sie halbwegs parallel oder – was noch schwieriger ist – sogar gegenläufig auszuhalten. Dann zeigt sich nämlich meistens, dass die Beziehung doch viel mehr trägt, als ihr beide bisher zugetraut haben, und dass alte Liebe meistens besser ist als neue Probleme.
Mich fasziniert seit langem, welche gesundheitlichen Auswirkungen es hat, wenn Partnerschaften, Begegnungen, Berührungen und gegenseitiges Verständnis gelingen – und wozu es führt, wenn all das fehlt.
Interessanterweise gibt es vergleichsweise wenige Untersuchungen dazu, wie es Menschen geht, wenn sie älter werden und schon länger als Paar zusammenleben. Die meisten Bücher beschäftigen sich mit jungen, sozusagen «frischen» Partnerschaften. Im Mittelpunkt dieses Buches stehen dagegen die sozialen Beziehungen zwischen Menschen, die schon länger zusammen sind, ihr Miteinander und ihre Liebe nach vielen Jahren. Seit langem habe ich mit Fachleuten und «Betroffenen» darüber gesprochen und habe mich in Büchern und Artikeln mit Menschen und ihren Beziehungen zueinander auseinandergesetzt. Diese Erkenntnisse sind selbstverständlich auch in dieses Buch eingegangen.
Denn hier möchte ich zeigen, was die typischen Erfahrungen und Herausforderungen sind, wenn die Partner gemeinsam ihre vierziger, fünfziger, sechziger, siebziger oder achtziger Jahre mitsamt all den dazugehörigen Krisen bewältigen müssen – und wie sie dies zusammen gut hinbekommen und auch weiterhin zusammenbleiben, ohne sich dabei ständig auf die Nerven zu gehen.
Ein realistischer Blick auf den Lauf der Liebe ist übrigens keineswegs ernüchternd oder gar abschreckend. Er hilft vielmehr dabei, besser miteinander zurechtzukommen, gemeinsam zufrieden zu sein und weder sich noch den Partner noch die Beziehung mit überzogenen Ansprüchen und falschen Erwartungen zu überfordern.
Auf dem Weg zur langen Liebe
Was die Liebe so schwer macht
«Von Weitem sieht eine Ehe außerordentlich einfach aus.»
(Hans Fallada)
Es ist ein Kreuz mit der Liebe. Wir wollen dem Diktat unseres Herzens folgen, uns dabei aber nicht vollständig selbst aus den Augen verlieren – oder allenfalls für den kurz währenden Moment der akuten Verliebtheit. Wir wollen uns selbst verwirklichen, aber trotzdem voller Hingabe manchmal alles vergessen. Wir wollen selbständig sein, aber dennoch sicher sein, dass wir uns auch in der größten Abhängigkeit auf den anderen verlassen können. Wir sind meistens ökonomisch unabhängig und haben eine eigene Ausbildung, sodass wir uns es leisten könnten, die Beziehung – und auch eine Ehe – aufzukündigen. Wir haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von achtzig Jahren und mehr, wie sollen wir uns da sicher sein, dass die Anziehung der ersten Monate für die nächsten fünfzig Jahre hält? Und wir haben diese enorme Auswahl an Möglichkeiten. Schwierig das alles, wirklich schwierig.
«Ich und Du wir waren ein Paar / jeder ein seliger Singular», schreibt Mascha Kaléko. Sehr schön, aber wie macht man das, ein Paar und trotzdem ganz selber zu sein?
Die Liebe als Überforderung
«Lebst du mit ihr gemeinsam –
dann fühlst du dich recht einsam.
Bist du aber alleine – dann frieren die Beine.
Lebst du zu zweit? Lebst du allein?
Der Mittelweg wird wohl das richtige sein.»
(Kurt Tucholsky)
Unsere Vorstellungen von der Liebe sind heillos überfrachtet. Das zeigt sich in Partnersuchanzeigen, in Dating-Shows – oder auch nur im Gespräch mit der besten Freundin oder dem Freund. Der Mann fürs Leben soll schließlich zugleich der verlässliche Kumpel sein und ein augenzwinkernder Lebenskünstler, der immer für eine Überraschung gut ist. Dazu sei er bitte schön auch ein geschickter Heim- und Handwerker, natürlich irgendwie kreativ, der engste Vertraute, erfolgreich im Job, ein leidenschaftlicher Liebhaber, der große Kümmerer und dann auch noch ein wunderbarer Vater. Einen knackigen Po, mindestens aber ein Grübchen im Kinn, hat er natürlich auch, um das nicht zu vergessen.
Gesucht wird also eine Art Casanova in gehobener Position, der am Wochenende das Unkraut jätet, abends geduldig mit den Kindern die Hausaufgaben durchgeht und morgens schon den Müll rausgetragen hat, bevor er ihr Kaffee und Croissants ans Bett bringt. Ein Mittelding also aus Robert Habeck, Elon Musk, George Clooney und diesem netten Wuschelkopf, der immer die Gemüsekiste vor die Tür stellt.
An die Traumfrau werden nicht minder hohe Erwartungen gerichtet. Sie soll bitteschön eine herzenswarme gute Fee sein, umsichtig und fürsorglich im Haus, eine hervorragende Köchin und natürlich eine aufopferungsvoll liebende Mutter. Sie hat auch nach einer am Bett der kranken Kinder durchwachten Nacht noch eine porentief reine Haut, gleichzeitig ist sie beruflich erfolgreich, ohne privat ihre eigenen Interessen zu vernachlässigen. Und abends verwandelt sie sich in einen aufregenden Vamp, zumindest aber in eine Granate im Bett.
Man muss sich das wohl als eine Kreuzung aus Mutter Teresa, Penélope Cruz, Christine Lagarde und einem bulgarischen Unterwäsche-Model vorstellen. Darf’s vielleicht noch ein bisschen mehr sein? Eine eierlegende Wollmilchsau ist jedenfalls nichts dagegen.
Natürlich ist das alles etwas überspitzt. Aber mal ehrlich, ganz unter uns, wer hat auch nur annäherungsweise einen solchen Partner oder eine solche Partnerin? Wo gibt es die? Oder wer kennt auch nur ein einziges Paar, auf das wenigstens die Hälfte der genannten Eigenschaften zutrifft und die nicht nur selbst beide solche Hauptgewinne sind, sondern die voller Sehnsucht nur darauf warten, sich wieder zu sehen und miteinander zu verschmelzen? Kein Wunder, dass kaum eine Beziehung diese Ansprüche auf Dauer aushält. Was bleibt, sind ebenso sehnsüchtige wie unerfüllte Phantasien – und der ernüchtert-zweifelnde Blick auf dieses amorphe Etwas, das sich da neben einem im Bett herumwälzt.
Realistisch ist ein solch überladenes Bild von der Liebe (und dem Liebespartner!) nämlich keineswegs. Seit mit dem Zeitalter der Romantik die ideelle Überhöhung der Ehe in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einsetzte, begann die gegenseitige Überforderung. Aus einer nüchtern geschlossenen oder gar von außen arrangierten Zweck- und Arbeitsgemeinschaft, wie es in den Jahrhunderten zuvor meistens der Fall war, sollte fortan ein heiterer Lustgarten werden. Und seitdem leiden die meisten Paare unter den zu hohen Erwartungen.
Nur weil nach der romantischen Wende ab 1820 die Ansprüche an die Partnerschaften zunahmen, wurden sie nicht automatisch besser. Es gab in den folgenden zweihundert Jahren (und gibt sie bis heute) auch weiterhin zahlreiche miese Ehen und zerrüttete Verhältnisse in großer Zahl. Aber die Hoffnung auf den einmaligen Traumpartner, das Streben nach Erfüllung und die Erwartung des großen Glücks im Kleinen blieben; diese wunderbaren Wunschvorstellungen ließen sich nie wieder ganz einfangen.
Allerdings muss man die Romantiker des 19. Jahrhunderts auch ein wenig in Schutz nehmen. Ihre Vorstellung von der romantischen Liebe war nicht gleichbedeutend mit dem, was heute oftmals darunter verstanden wird, also leidenschaftlicher Hingabe und körperlicher Ekstase. Romantische Autoren verstanden darunter vielmehr eine tiefe innere Verbundenheit, die mit Seelenverwandtschaft wohl am besten zu übersetzen ist. Und damit kommen sie dem Zustand der langen, dauerhaften Liebe, der durch große Nähe und Vertrautheit charakterisiert ist und nicht durch wilde Leidenschaft, ja schon recht nahe.
Herumgesprochen hat sich das allerdings kaum. Denn nicht weniger als die oder der eine unter Millionen sollen es im heutigen Anforderungsprofil an den Partner schon sein, eine persönliche Maßanfertigung, von einer höheren Schicksalsmacht sorgfältig geschnitzt und zwar exklusiv für die eigenen Bedürfnisse. Der auf den ersten Blick irritierende Buchtitel «Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest»[1] bringt sehr schön auf den Punkt, warum es wenig hilfreich ist, auf den Traumprinzen oder die Traumprinzessin zu warten und alle potenziellen Kandidaten daran zu messen. Das ist meist der sichere Weg ins Unglück. Das Glück in der Liebe liegt zu großen Teilen in den eigenen Händen, nicht in denen des Wunschpartners.
Mit etwas Abstand betrachtet, ist es ja sowieso ein großes Paradox: In jüngster Zeit beschleunigt sich die gesellschaftliche Entwicklung noch rasanter als zuvor. In vielen gesellschaftlichen, ökonomischen und staatlichen Bereichen werden die Hochs und Tiefs, auch die Phasen der Ernüchterung und des Stillstands immer häufiger und sind manchmal im Alltag sehr schmerzhaft zu spüren – aber ausgerechnet in der Partnerschaft soll alles so heiter und zuckersüß fortbestehen wie am Anfang? Das kann nicht funktionieren, und wer diese Erwartung an eine Beziehung und seinen Partner hat, wird scheitern. Rückschläge und Enttäuschungen sind dann unweigerlich programmiert.
Die Tragik des Begehrens
«Da ist die Angst, niemals den Gipfel zu erreichen (und nicht einmal zu wissen, welcher Weg hinaufführt), aber auch die Angst, ihn tatsächlich zu erklimmen (und nun zu wissen, dass es nicht mehr höher geht).»
(Zygmunt Bauman, Soziologe)
Die Sagengestalt des Königs Midas ist in verschiedenen eindrucksvollen Erzählungen überliefert. Eine der bekanntesten Mythen berichtet von seinem Wunsch, dass alles, was er anfasse, doch unmittelbar zu Gold werden möge. Dionysos erfüllte ihm dieses Begehren, und der König war begeistert: Er berührte einen Baum nur leicht, und dieser verwandelte sich sofort in Gold. In der Aussicht auf unerschöpflichen Reichtum lud Midas sogleich zu einem großen Festessen. Der Saal wurde prachtvoll geschmückt, die lange Tafel bog sich vor köstlichen Speisen, und zahlreiche Gäste waren gekommen. Doch als Midas den ersten Bissen zum Mund führen wollte, verwandelte sich dieser augenblicklich in Gold und war nicht mehr zu genießen. Als bald darauf seine geliebte Tochter eintraf, freute sich Midas sehr, nahm sie zur Begrüßung herzlich in den Arm – woraufhin sie ebenfalls zu Gold wurde und erstarrte.
Midas verzweifelte, trauerte – und magerte obendrein ziemlich ab. Schon bald bat er Dionysos flehentlich darum, seinen vor kurzem noch so heiß ersehnten Wunsch schleunigst wieder zurückzunehmen. Schließlich konnte er so nicht mehr lange weiterexistieren, er würde zugrunde gehen. Dass sein Wunsch so schnell und umfassend in Erfüllung ging, machte ihn zwar für einen winzigen Moment glücklich, sodann sein Leben aber unerträglich, denn er dominierte fortan alles. Statt Glück kam großes Unglück über ihn.
Und die Moral von der Geschichte? Die Lehre für die Liebe? Der Hunger bleibt, auch wenn die größte Sehnsucht gerade erst erfüllt wurde. Und ein Reich aus purem Gold mag zwar eine schöne Vorstellung sein, letztlich kommt es aber vor allem auf ganz alltägliche Dinge wie zwischenmenschliche Begegnungen und Berührungen an – und die Möglichkeit, satt zu werden.
Dass sich Lust und Begehren nicht für immer erfüllen und niemals auf Dauer stillen lassen, zeigt diese Sage eindrucksvoll. Nietzsches Diktum «Doch alle Lust will Ewigkeit / will tiefe, tiefe Ewigkeit!» deutet ein paar Jahrtausende später in eine ähnliche Richtung. Vielleicht passt es dazu, dass die Franzosen, die sich in Liebesdingen ja der Legende nach besonders gut auskennen sollen, für den körperlichen Höhepunkt der Liebe, den Orgasmus (und das direkte Gefühl danach), die schöne Umschreibung «La petite mort» gefunden haben, der kleine Tod.
Was für ein Sprachbild! Man kommt der perfekten Erfüllung der Lust zwar für einen kurzen Augenblick ziemlich nahe und ahnt, wie das sein könnte, wenn es immer so wäre. Aber schon kurz darauf fühlt es sich ein bisschen so an wie Sterben, weil die Ekstase anschließend nun mal nicht bewahrt werden kann. Da man jedoch bereits davon gekostet hat, folgt unweigerlich eine melancholische Sehnsucht nach der Lust, und man strebt nur umso mehr danach.
Auch der Mythos um die Figur des Königs Tantalos ist eine hilfreiche Metapher für die Tragik des menschlichen Begehrens. Tantalos wollte die Götter, die ihm das Privileg gewährt hatten, ein Festessen für sie auszurichten, auf eine Probe stellen. Waren sie ihm tatsächlich so überlegen und durchschauten alles? Um dies herauszufinden, tötete er seinen eigenen Sohn, zerkleinerte ihn und ließ ihn zum Mahl servieren.
Die Götter bemerkten die Untat allerdings sehr schnell und bestraften Tantalos dafür mit den dann nach ihm benannten Qualen. Diese bestanden unter anderem darin, dass der Übeltäter an einen Baum gefesselt wurde, der voll mit prallen Früchten hing. Trotz aller Anstrengungen konnte er diese aber niemals erreichen. Er war dem Ziel immer verführerisch nahe, es blieb ihm aber auf Dauer versagt. Eine andere, ganz ähnliche Strafe bestand darin, dass Tantalos mit immerwährendem Durst geschlagen wurde, während er bis zum Kinn in einem Teich stehen musste. Jedes Mal, wenn er seinen Kopf neigte, um daraus zu trinken, wich das Wasser jedoch vor ihm zurück und versiegte bis unter den Grund um seine Füße.
Diese beiden Sagen von Midas und Tantalos haben zwar sehr unterschiedliche Hintergründe und Motive. Doch egal, ob dem Protagonisten das Begehren umgehend befriedigt oder es ihm immer wieder versagt wird: Erfüllung bekommen sie beide nicht, können sie gar nicht bekommen. Zufrieden werden sie deshalb auch nie sein, und das Begehren ist endgültig zum Scheitern verurteilt, auch wenn die Sehnsucht bleibt und sogar immer größer wird.
Ähnlich verhält es sich mit der Idealvorstellung von einer perfekten Beziehung und der großen Liebe. Die Sehnsucht wird vermutlich sogar immer größer, je ernüchternder sich die Alltagswirklichkeit mit dem Partner gestaltet. Und wenn schon die Partnerschaft nicht das bietet, was man sich davon erwünscht und erträumt hat, sollen wenigstens die eigenen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Die Liebe und das, was davon noch übrig geblieben ist, wird statt zu einem Fest der Gemeinsamkeit immer öfter zum durchkalkulierten Ego-Trip.
Von Eva Illouz, die auf die Gleichnisse von Midas und Tantalos im Zusammenhang mit der Tragik des Begehrens hingewiesen hat, stammt die nüchterne Einsicht: «In vieler Hinsicht sind wir im Sex- und Gefühlsleben zum Midas geworden und versuchen, alles in die goldene Ewigkeit des Begehrens zu verwandeln», schreibt die israelische Soziologin. «Doch dass wir unsere Liebessehnsüchte aus Institutionen und Konventionen befreit haben und sie stattdessen der Logik des Begehrens gehorchen lassen, hat uns ihre Erfüllung nicht leichter gemacht.»[2] Die moralische, sexuelle und emotionale Freiheit, die als große Errungenschaft der vergangenen Jahrzehnte gefeiert wird, hat unbestreitbar viele Vorteile gebracht. Die Liebe stellt sie allerdings vor große Herausforderungen.
Die Liebe als Selbsterfahrungstrip und strategisches Kalkül
«Brauchen wir heute überhaupt noch Paare? Das Paar scheint eine überflüssige Einrichtung geworden zu sein, es stört das Individuum in seiner Entwicklung und zwingt es, sich mit seinen Widersprüchen herumzuschlagen. Paare schaffen Verwirrung, Konflikte, Einsamkeit und Schmerz. Schon die Zahlen sprechen gegen das Paar, da sich immer mehr Leute für ein Leben allein entscheiden.»
(Eva Illouz, israelische Soziologin)
Es klingt paradox: Ausgerechnet Liebe und Romantik sind mehr denn je strategischen Überlegungen und seltsam anmutenden Kalkulationen unterworfen. Waren es in früheren Zeiten klare ökonomische Rechnungen («Hektar besteht / Schönheit vergeht»), so wird die Liebe heute von den Partnern bereits früh grundsätzlich hinterfragt und dann geschwind auf ihren emotionalen Nutzwert abgeklopft, manchmal gar wie eine Art Tauschgeschäft bewertet. Die Wahrnehmung einer Partnerschaft, ja, schon die Bereitschaft, überhaupt eine einzugehen, folgt immer öfter einem klaren Kalkül. Das Denken, das dahinter steht, ähnelt ökonomischen Überlegungen, wird also diktiert von der Frage: Was habe ich eigentlich davon? Bringt mir das etwas? Und lohnt sich das überhaupt noch? Wenn ja, zu welchem Preis?
Gerät die emotionale Balance aus Geben und Nehmen nach ein paar Jahren in eine Schieflage, stellt sich für viele Paare erneut die Frage: Zahlt sich das für mich überhaupt noch aus – und bekomme ich das, was ich zuvor im Übermaß in das gemeinsame Leben und für den Partner investiert habe, irgendwann wieder zurück auf mein imaginäres Beziehungskonto? So mancher kommt bei diesen Schaden-Nutzen-Bilanzen zu einem ziemlich ernüchternden Ergebnis, wenn die Vor- und Nachteile aufgelistet und Soll und Haben gegeneinander aufgewogen werden.
Zu dieser Aufrechnung der Liebesbeweise kann es zwar in jedem Alter kommen, aber zunehmend sind jetzt die reiferen Jahrgänge davon betroffen und müssen sich und ihren Nutzen für den anderen bewerten lassen. Und das, obwohl sie sich doch längst so sicher wähnten! Mancher mag sich da wie der ältere Arbeitnehmer fühlen, der fürchtet, in den Vorruhestand geschickt zu werden oder eine Abfindung angeboten zu bekommen, weil er sich für das Unternehmen nicht mehr lohnt. Deshalb ist auch eine Ehe, die schon fünfzehn, zwanzig Jahre oder länger andauert, keineswegs davor geschützt, nicht noch mit einer großen Explosion zu zerbrechen.[3] In Umbruchphasen wie der Midlife-Crisis, den Wechseljahren oder dem Ende der Berufstätigkeit kommen solche Neubewertungen in Partnerschaften mittlerweile häufiger vor.
Die israelische Soziologin Eva Illouz hat in ihren Büchern darauf hingewiesen, dass die Erwartungen an eine Partnerschaft zwar von ökonomischen Prinzipien geprägt sind, aber nicht mehr primär darauf abzielen, gut versorgt zu sein und materielle Vorteile zu genießen, also das zu erreichen, was man früher als eine «gute Partie» bezeichnet hätte. Es geht nicht um genügend Geld, es geht um das Optimum an Gefühlen.
In vielen Partnerschaften ist vielmehr das Ziel in den Vordergrund gerückt, möglichst zahlreiche und möglichst unterschiedliche Erfahrungen zu machen, «sich dabei selbst zu spüren» und eine Vielfalt an intensiven Gefühlen und persönlichen Reifungsprozessen zu durchleben.[4] Die maximale Ich-Verwirklichung soll es sein, und das steht mir schließlich zu, lautet die gesellschaftlich akzeptierte Maxime.
Beziehungen werden demnach vor allem als hilfreiche Mosaikstücke zur Selbstfindung verstanden – immer verbunden mit der Hoffnung, dass ein paar besonders kostbare Edelsteine darunter sein mögen, wenn man eine neue Liaison eingeht. Die dienen dann natürlich einzig dazu, das eigene Gesamtkunstwerk noch wertvoller zu machen. Status und Selbstwert bemessen sich mittlerweile zu großen Teilen daran, wie viele emotionale Entwicklungsschübe, Beziehungserlebnisse (und damit auch Sexpartner) jemand bereits vorweisen kann und ob sie die eigene Entwicklung «wirklich weitergebracht» haben oder nur Stillstand bedeuteten.
Nebenbei sei erwähnt, dass Kinder in diesem Modell von Beziehungen eine Zumutung sind, denn sie bringen das Streben nach Autonomie und Hedonismus gehörig ins Wanken. Kein Wunder, dass die Entscheidung für das erste Kind in einem immer höheren Alter getroffen wird – und immer mehr Kinder im Nachhinein finden, ihre Eltern hätten sich auch bei dieser Entscheidung hauptsächlich um sich selbst gedreht. Zwar sehen manche Paare die Geburt eines Kindes auch als eine Form der Selbstverwirklichung an. Besonders Männer sind dann aber manchmal überrascht, dass sie mit einem kleinen Kind nicht das gleiche Leben weiterführen können wie zuvor, sondern dass es einen radikalen Einschnitt für das Paar wie für jeden Einzelnen von beiden bedeutet, wenn sie Eltern sein sollen.
Es ist naheliegend, dass dieser egozentrische Hang zur Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung es mit sich bringt, schnell ungeduldig zu werden und mit dem Ist-Zustand nur selten zufrieden zu sein. Immer ist da diese Unruhe, verbunden mit bohrenden Fragen: Soll das etwa schon alles gewesen sein? Was kann ich in Zukunft noch von dem Langweiler erwarten, mit dem ich schon so lange zusammen bin? Und wie geht es weiter, wenn der Partner seine Reserven an Gefühlsaufwallungen, intensiven Erlebnissen und aufregenden Begegnungen schon aufgebraucht haben sollte und fortan nur noch sparsam neue Emotionen preisgibt oder gar nicht mehr zu überraschenden Ereignissen bereit ist?
Immer auf dem Sprung
Wer seine Beziehung nach ökonomischen Kriterien – was habe ich davon? – bewertet, entwickelt eine neue Sicht auf das Miteinander. Der Alltag als Paar ist dann nicht etwas, was Geborgenheit und Nestwärme vermittelt und als vertraut und verlässlich erlebt werden kann, sondern vor allem als Defizit, als Abwesenheit von Neuem, als schmerzhafter Mangel an Anregung und Überraschung. Dabei kann Liebe ja auch bedeuten, vom Partner wie von einem inneren Kaminfeuer gewärmt zu werden, ihm nicht ständig etwas Neues bieten und kein Animationstheater für ihn aufführen zu müssen, sondern vor allem dieses flauschige Persil-Gefühl gemeinsam zu erleben: Da weiß man, was man hat.
Zudem führt die Erwartungshaltung, dass die Beziehung ein steter Quell an emotionalem Zuwachs zu sein habe, leider auch dazu, dass ein plötzliches Ende immer möglich ist und zur permanenten Option wird. Nicht nur theoretisch, wie das für jedes Paar gilt, sondern praktisch, schon im nächsten Moment. Verlässlichkeit ist kaum noch gegeben. Sicherheit ist spießig, etwas für Bausparer. Werden die Ansprüche vom Partner nicht mehr ausreichend erfüllt, kann die Partnerschaft rasch zum Abschluss gebracht werden. Es regiert das aus der Wirtschaft bekannte Prinzip «fix it or close it»: Was nicht zufriedenstellend funktioniert, wird beendet, und zwar schnell.
Dieses latente Bedrohungsgefühl kann in seiner Wirkmächtigkeit gar nicht überschätzt werden: Keiner kann sich seiner Liebe mehr gewiss sein, nichts ist auf Dauer ausgerichtet, Garantien gibt es sowieso keine mehr. Tragisch, aber nun mal nicht zu ändern, wenn die unausgesprochene Übereinkunft, gegenseitig sein Gefühlsleben und den gemeinsamen Erfahrungsschatz zu bereichern, nicht mehr eingelöst wurde. Schließlich müssen ständig neue Eindrücke gesammelt werden, und wenn das nicht möglich ist, muss halt schleunigst ein neuer und mittelfristig vielleicht gar eine ausreichende Zahl an neuen Partnern her.
Weil die Selbstverwirklichung und die Gier nach erfüllenden Erlebnissen über allem stehen, werden Partnerschaften mittlerweile manchmal ziemlich abrupt beendet, wie Eva Illouz beobachtet hat – gleichsam nebenbei per Kurznachricht oder mit einer knappen Notiz auf dem Küchentisch. Wer das Gefühlsleben des anderen nicht ausreichend bedient, hat es schließlich nicht anders verdient, als flott abgefertigt zu werden, so die Logik dieses emotionalen Tauschhandels. Auftrag nicht erledigt, Mission abgebrochen, du bist gefeuert – diese Abfolge hat etwas von einem fehlgeschlagenen Job in einem James-Bond-Streifen.
Illouz hat im Gespräch mit dem «Spiegel» ein schönes Bild skizziert, wie sich jemand aus seiner langjährigen Beziehung davonschleicht, auch wenn er ansonsten höchste moralische Ansprüche für sich reklamieren würde: So könne beispielsweise ein engagierter Tierschützer, der streng vegan lebt und sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagiert, Knall auf Fall seine Frau verlassen, indem er ihr in einer sparsamen SMS die leider unumgängliche Trennung verkündet. Seinem Selbstbild zufolge versteht er sich dennoch weiterhin als jemand, der ehrenwerte ethische Standards einhält[5], die er aber auf seine Beziehung nicht anzuwenden braucht, das ist schließlich etwas anderes.
Denn das eigene Gefühl steht über allem und wird daher zum absoluten Gradmesser für die Qualität einer Beziehung – und sobald es enttäuscht wird, rechtfertige dies auch ein schnelles Ende, vermutet Illouz. Diese Generation hat schließlich früh gelernt, ausführlich über ihre eigenen Gefühle zu sprechen, und ist geübt in der Nabelschau. Sie verfügt daher auch über ein erstaunliches Repertoire, sich sogar die mieseste Trennung schönzureden – und das eigene abgründige Verhalten auch noch zu rechtfertigen.
Die Bilanzbuchhaltung einer Liebesbeziehung liest sich dann beispielsweise so: Da die emotionalen Grundbedürfnisse vom Partner nicht mehr ausreichend erfüllt werden konnten, sind – leider, leider – auch die Vorstellungen vom gemeinsamen Liebesglück nicht mehr zu verwirklichen. Es ist wie beim Räumungsverkauf: alles neu, alles muss raus. Dann können weder ethische Normen noch moralische Standards eine Trennung verhindern. Das Engagement für die Beziehung schwindet rapide. Wer nicht genügend Abwechslung und Anregungen in die Partnerschaft einbringt, kann im Tausch dafür auch kein weiteres langjähriges Miteinander mehr erwarten, so die selbstsüchtige Logik.
Gleichzeitig bringt es dieses emotionale Kalkül mit sich, dass Affären nur noch selten als moralisch verdammenswert gelten. Schließlich dient Fremdgehen doch nur dazu, den eigenen Reichtum an Erfahrungen weiter zu vergrößern. Seitensprünge gelten weniger als Kränkung des Partners, sondern als Mittel zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Nachreifen in fremden Betten könnte als Zielvorgabe formuliert werden. Wird das Verlangen nach Intimität und Sex in der langjährigen festen Beziehung nicht mehr genügend befriedigt, ist es nur naheliegend, sich auch woanders danach umzusehen und zu bedienen.
Zwar haben Schuldzuweisungen und Versuche, dem anderen ein schlechtes Gewissen einzureden, in Beziehungen ebenso wenig zu suchen wie der tadelnd erhobene Zeigefinger, trotzdem ist es erstaunlich, wie sich die moralischen Maßstäbe hier in den vergangenen Jahrzehnten verschoben haben.
Weder Paartherapeuten noch Scheidungsrichter stellen heutzutage noch die Frage nach der Schuld, wenn eine Partnerschaft nach längerer Zeit zerbricht. Es geht nicht mehr darum, wer wen wie oft und warum hintergangen hat. Wichtiger ist, wer was vom anderen nicht bekommen hat.
Droht also das Ende der konventionellen Paarbeziehung, wie es das Zitat von Eva Illouz andeutet, wonach Paare bald «eine überflüssige Einrichtung» sein könnten, die es nicht mehr braucht? Die israelische Soziologin selbst gibt darauf die überraschende Antwort, dass die Paarbeziehung allein deswegen schon zu verteidigen ist, weil darin die letzte soziale Form besteht, sich «dem herrschenden Ethos unserer Zeit zu widersetzen».
Ein konventionelles Paar, das in der Lage ist, «nichtberechnende Handlungsweisen wie Verzeihen oder Selbsthingabe» zu praktizieren, stellt sich damit schließlich auch gegen die Kultur der Auswahl und der Optimierung und «gegen die Vorstellung vom Ich als Schauplatz ständiger Aufregung, Vergnügung und Selbstverwirklichung», schreibt sie.
Wer trotz aller Versuchungen zusammenbleibt, sendet somit ein Signal, dass es ihm nicht um zusätzlichen Mehrwert geht oder darum, immer aus dem Vollen zu schöpfen und die niemals endende Ego-Tour fortzuführen. Vielmehr werden hier die Mühen der Dauer und die Kunst des Verweilens gepflegt, ohne jedes neue Angebot begierig anzunehmen. Das marktwirtschaftliche Prinzip von der Nachfrage, die durch immer neue und schon deshalb interessante Angebote stimuliert wird, ist dann zumindest in diesem intimen Bereich außer Kraft gesetzt.
Gerade ein Paar kann bewährte, fast ein wenig altmodische Tugenden pflegen, die im sonstigen Leben nach und nach in Vergessenheit zu geraten drohen. Dazu gehört es beispielsweise, so Illouz, «einander als einzig zu betrachten, nicht zu berechnen, Langeweile zu dulden, Selbstentwicklung aufzuhalten, mit einer oft mittelprächtigen Sexualität auszukommen und echte Hingabe einer vertraglichen Unsicherheit vorzuziehen». Wenn das keine verlockenden Aussichten sind!
Wann ist es eigentlich Liebe?
«Ich merkte, dass ich vollkommen entspannt war, mich nicht verstellen musste, nicht zusammenreißen, dass den Menschen nichts an mir störte. Dass mich nichts an ihm störte. Vermutlich bedeutet Liebe für jeden etwas anderes. Für mich ist es – den anderen in Ruhe zu lassen.»
(Sibylle Berg[6])
Das Römische Reich hatte viele großartige Momente zu bieten, satte Jahre, enorme Erfolge. Es erlebte eine riesige Ausdehnung und war über viele Jahrhunderte das Maß aller Dinge in der antiken Welt – nicht nur politisch, sondern auch sozial, kulturell, technologisch und wirtschaftlich. Doch dann zerfiel es, wurde zerstückelt und brach schließlich auseinander. Viele Historiker sagen, die Anzeichen dafür hätte man schon früh erkennen können, auch zur Blütezeit des Imperiums gab es schon etliche Indizien, die auf den drohenden Zerfall hindeuteten.
Trägt der Vergleich vom Imperium Romanum mit dem riesigen Reich der Liebe? Es ist immerhin auch ein ziemlich großer Bogen, den die Liebe zu spannen vermag. Der Anfang ist leicht und fühlt sich gigantisch an, weil da alle Regler auf zehn gedreht sind. Volles Programm, ungefiltert und ohne Absicherung. Das merkt man, selbst wenn man sonst nicht wirklich sensibel ist. Das Dumme ist nur: dieser Zustand bleibt leider nicht auf Dauer bestehen, er hält nicht ewig an.
In den ersten Monaten und Jahren einer Beziehung gibt es zwar immer wieder eine Liebes-Flut, doch dann droht dauerhafte Ebbe, und viele Beziehungen gehen auseinander. «Wir haben uns als Paar verloren», «Wir funktionieren nur noch» oder «Ständig gibt es Streit», heißt es dann oft. Was verloren geht im Miteinander, wie das passiert, was dabei vor sich geht – und wie es möglicherweise zu verhindern ist, das soll hier immer wieder nachgezeichnet werden.
Spannend ist dabei zu beobachten, welche frühen Hinweise es dafür gibt, dass die Partnerschaft in Gefahr ist – auch wenn in der Beziehung weiterhin für Brot und Spiele gesorgt ist und der äußere Schein stimmt.
Liebe ist das Gegenteil von Multitasking. Da hat anfangs nichts anderes Platz. Kein Zweifel und keine Nachfrage. Liebe ereignet sich – wie übrigens auch das Glück oder die Gesundheit – als ein Schwebeteilchen der Selbstvergessenheit. Aus medizinisch-physiologischer Sicht müsste man ergänzen, dass sich dieser exklusive Aggregatzustand wohl am ehesten mit einer betörenden Mischung aus Rausch, Sucht und Vierhundert-Meter-Lauf vergleichen lässt. Und wer gerade eine Stadionrunde läuft, kann nicht nebenbei noch Kugelstoßen oder zum Stabhochsprung antreten, das geht garantiert schief.
Der Vergleich mit dem Rausch ist übrigens ziemlich naheliegend. Verschiedene Forscher bewerten den Zustand der akuten Verliebtheit so, als hätte man ungefähr ein Promille Alkohol im Blut.
Vom Sprint auf die Langstrecke
«Große Zeit ist’s immer nur, wenn’s beinahe schiefgeht, wenn man jeden Augenblick fürchten muss: jetzt ist alles vorbei. Da zeigt sich’s. Courage ist gut, aber Ausdauer ist besser. Ausdauer, das ist die Hauptsache.»
(Theodor Fontane)
Selbstvergessenheit ist das Stichwort. Alles drum herum ausblenden, wegschieben, ignorieren. Ganz bei sich sein mit diesem Behaglichkeitsschauer des Erlebens – und damit auch ganz beim anderen. Distanz gibt es nicht, jedenfalls nicht zu den eigenen Gefühlen und zum anderen. Nahe kann gar nicht nah genug sein. Ein Ego-Trip der besonderen Art ist das, was die Liebe auslöst, und er führt auf pfeilgeradem Weg in das Herz eines anderen.
Wer hingegen Abstand hält und abwägt, sich Kopf oder Herz über der Frage zerbricht, ob er schon liebt, noch liebt oder vielleicht auch nicht mehr liebt, der sollte es vielleicht lieber seinlassen mit der Liebe. In seiner überwältigenden Dringlichkeit ist die Liebe nämlich unbedingt und ausschließlich. Zumindest gilt das am Anfang.
Die Analogie zwischen der Liebe und einem VierhundertMeter-Lauf geht so: Beides bringt einen anfangs schnell in den Zustand der Kurzatmigkeit, beginnt zwar mit großer Leichtigkeit, wird aber auf Dauer sehr anstrengend. Wie auf der Tartanbahn so ist auch in der Liebe der Sympathikus deutlich hochreguliert, also jener Teil des vegetativen Nervensystems, der den Körper in kurzer Zeit voll auf Touren bringt: Das Herz schlägt dann schneller, die Lungenbläschen weiten sich, der Stoffwechsel legt ein paar Schippen drauf und die Körperspannung nimmt zu.
Höchste Konzentration, alles ist voller Energie und zum Platzen gespannt. Außerdem scheint der ganze Mensch vor Euphorie und Lebenslust nur so zu bersten. Bäume ausreißen ist aus Gründen des Naturschutzes mittlerweile verpönt, aber als Ersatzhandlungen sind Luftsprünge und spontane Knuddelattacken unter frisch Verliebten populär geblieben.
Im Gehirn von Liebenden wird vermehrt das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Dieser Neurotransmitter wirkt wie ein körpereigenes Aufputschmittel. Es ist aber nicht etwa eine Art Tankanzeige für gleichmäßiges Glück, sondern zuständig für die besonderen Höhenflüge. Dopamin ist schlauer und subtil, der Flash beruht nicht auf einem monotonen Glücksgefühl, rosarotem Einheitsbrei sozusagen, sondern dieses feine Stöffchen ist ein Besser-als-erwartet-Hormon.
Dopamin wird nämlich besonders dann freigesetzt, wenn etwas überraschend anders ist, wenn sich diese Frau oder dieser Mann als noch toller, noch umwerfender, noch entzückender erweisen als vermutet. Dieser Mensch riecht so betörend fremd, macht komische, anregende Geräusche, ist auf unbekannte Weise einnehmend – das bringt Liebende außer Rand und Band und das Dopamin auf Hochtouren.
Die große Leichtigkeit des Seins, das Übermaß an Lust- und Glückshormonen, führen überdies dazu, dass der Körper in eine Art Superman-Modus (oder Superwoman-Modus) schaltet. Deshalb werden zusätzliche Belastungen auch gar nicht als besonders belastend empfunden, sondern als tranceartiger Rausch, der mühelos zu bewältigen ist. Der Körper schüttet zwar etliche Stresshormone aus, aber die dienen allein dazu, den Organismus zu noch mehr Höchstleistungen und Freudensprüngen zu animieren.
Jene Hormone, die vorhanden sind, weil etwas als belastend empfunden wird, werden hingegen zügiger abgebaut. Außerdem ganz praktisch: Wir haben buchstäblich ein dickeres Fell. Deshalb heilen die Wunden von Liebenden auch deutlich schneller, und ihre Schmerzen tun weniger weh.