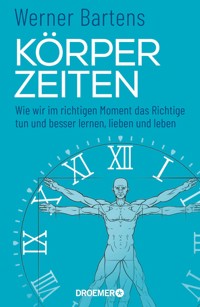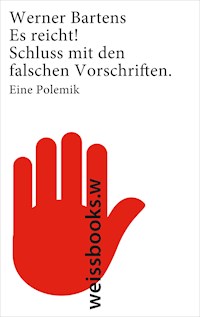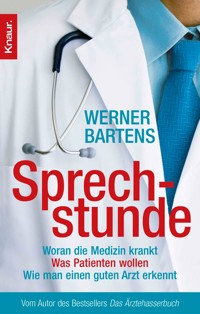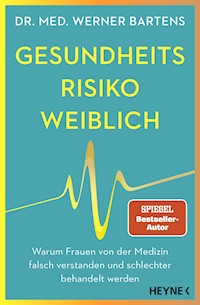
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Sind Frauen und Männer gleichermaßen von Krankheiten betroffen? Vor dem Virus, dem Krebs, dem Knochenbruch oder der Entzündung scheinen alle Menschen gleich zu sein: eine folgenschwere Fehlannahme, die in der Medizin erst allmählich erkannt wird. Denn Frauen sind anders krank als Männer, sie empfinden anders, ihre Symptome sind anders und die benötigten Therapien auch. Dass diese Erkenntnis noch nicht Teil der täglichen ärztlichen Praxis ist, hat ernste Konsequenzen für Patientinnen: Sie werden oftmals später behandelt, bekommen weniger eingreifende Therapien, und ihre Leiden werden weniger schnell und weniger gut erkannt. Wie umfassend die Medizin Frauen benachteiligt, warum dies in fast jedem Bereich der Heilkunde so ist, welche Denkmuster dahinterstecken und vor allem: Welche Gefahr das konkret für Leib und Leben der Frauen bedeuten kann, zeigt Dr. med. Werner Bartens anhand zahlreicher Beispiele. Er zieht dafür die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse heran und präsentiert erste erfolgreiche Schritte zu einer besseren medizinischen Versorgung von Frauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DR. MED. WERNER BARTENS
GESUNDHEITSRISIKOWEIBLICH
Warum Frauen von der Medizinfalsch verstanden und schlechterbehandelt werden
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Sämtliche Inhalte dieses Buches wurden – auf Basis von Quellen, die der Autor und der Verlag für vertrauenswürdig erachten – nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und sorgfältig geprüft. Trotzdem, und darauf weist der Autor ausdrücklich hin, stellt dieses Buch keinen Ersatz für eine individuelle medizinische Beratung dar. Wenn Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt. Verlag und Autor haften nicht für nachteilige Auswirkungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit den Informationen stehen, die in diesem Buch enthalten sind.
Originalausgabe 2022
Copyright © 2022 by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Kerstin Lücker
Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch,unter Verwendung eines Motives von Shutterstock.com / Akane1988
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-29391-8V001
www.heyne.de
Vorwort
Medizin ist nicht neutral. Sie wird von Menschen gemacht, und Menschen haben Vorurteile, Vorannahmen und sind geprägt durch Vorbilder und Traditionen – im Guten wie im Schlechten. Das wirkt sich auch darauf aus, wie Medizin betrieben wird und wie Männer und Frauen behandelt werden. Wenn man ihr schon einen bestimmten Artikel zuordnen wollte, dann müsste es nicht »die Medizin« heißen, sondern »der Medizin«. Denn die Medizin ist männlich.
Das weltweite medizinische Wissen ist immens, und es wächst beständig weiter an. Die Kenntnisse über Krankheiten, ihre typischen Symptome, den Verlauf, die passende Diagnostik und die beste Therapie sind extrem vielfältig. Allerdings stammt dieser umfangreiche Wissensschatz fast vollständig aus Studien an männlichen Zellen, männlichen Versuchstieren und männlichen Menschen; Studien, die mehrheitlich von Männern geplant, umgesetzt, ausgewertet und aufgeschrieben worden sind1.
Erstaunlich eigentlich, dass über Jahrzehnte und Jahrhunderte wissenschaftliche Forschung nur so betrieben wurde, dass nur Männer die Studienobjekte waren. Dabei ist doch der Gedanke mehr als naheliegend, dass ein Körper angesichts seiner Fähigkeit, Kinder auszutragen und zu gebären, auch anders sein muss – was den Stoffwechsel angeht, die Funktion vieler Organe und nicht zuletzt die Reaktion des Immunsystems, das während der Schwangerschaft ja einen Organismus tolerieren muss, der immunologisch verschieden ist.
Zu dieser einseitigen Art der fast ausschließlich männlichen Betrachtung der Medizin ist es nicht etwa aus bösem Willen gekommen oder weil Männer Frauen absichtlich diskriminierten. Lange Zeit wurde schlicht angenommen, dass sich die Zellen, Zellkulturen, Versuchstiere und auch die für wissenschaftliche Studien untersuchten Menschen untereinander zumindest in biomedizinischer Hinsicht weitgehend gleichen. Daher, so die Vermutung, müsse es unabhängig vom Geschlecht der Menschen, die behandelt werden, schon stimmig sein, sich in der Medizin hauptsächlich an den Männern zu orientieren.
Der heillos fortschrittsoptimistische Satz, wonach sich das medizinische Wissen angeblich alle sieben Jahre verdoppelt, bekommt vor diesem Hintergrund einen schalen Beigeschmack2. Schließlich ist über die typischen Beschwerden von Frauen, die optimalen Untersuchungsmethoden, wenn Frauen krank sind, sowie die beste Behandlung und den Genesungsverlauf erkrankter Frauen noch ziemlich wenig bekannt.
Zwar wurde das Problem in den letzten zwei, drei Jahrzehnten von einigen Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen (und von noch weniger Ärzten und Wissenschaftlern) erkannt, und es sind grundlegende Arbeiten zum Thema erschienen, von denen einige wichtige hier zitiert werden. Ein deutlicher Anstieg der wissenschaftlichen Projekte und Publikationen ist allerdings erst in den vergangenen fünf Jahren zu beobachten. Hier besteht ein eklatanter Forschungsrückstand, und es ist ein rasanter Wissenszuwachs zum Thema geschlechtergerechte Medizin notwendig, der allerdings von einem erschreckend niedrigen Niveau aus beginnt.
»Die medizinische Forschung orientiert sich am männlichen Normkörper«, sagt Sabine Oertelt-Prigione, die Deutschlands erste Professur für geschlechtersensible Medizin innehat: »Frauen zeigen bei den gleichen Erkrankungen aber häufig andere Symptome. So sind bei Männern die klassischen Symptome für einen drohenden Herzinfarkt starke Brustschmerzen, junge Frauen können in dieser Situation unter Übelkeit und Schwindel leiden. Asthma zeigt sich bei Jungen durch stärkere Geräusche beim Atmen, bei Mädchen oft durch trockenen Husten.« Für die Diagnose von Erkrankungen, aber auch während der Behandlung sei es deshalb wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte diese geschlechtsspezifischen Unterschiede endlich stärker berücksichtigen.
Um zu verdeutlichen, wie groß der Rückstand ist, hilft ein Blick in die Public Library of Medicine (»PubMed«). In dieser weltweit größten online-Datenbank für biomedizinische Fachartikel waren im Jahr 2000 unter dem Schlagwort »Gender Medicine« 1287 Publikationen gelistet. Im Jahr 2021 sind hingegen 16865 Fachbeiträge zu dem Thema erschienen, wobei besonders steile Anstiege in den Jahren 2014 und 2019 zu verzeichnen sind. Diese Zahlen und der Zuwachs mögen auf den ersten Blick beeindruckend wirken. Wie klein der Forschungsanteil zum Thema Gendermedizin tatsächlich ist, wird allerdings deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Datenbank jedes Jahr um rund 500000 Einträge wächst und dort inzwischen mehr als 32 Millionen Artikel zu allen Bereichen der Medizin verzeichnet sind.
Natürlich blieb es auch früheren Generationen von Ärztinnen und Ärzten nicht verborgen, dass es unterschiedliche Geschlechter gab und gibt. Die daraus resultierenden Unterschiede wurden – mit Ausnahme von Krankheiten der Sexualorgane und den damit zusammenhängenden Hormonveränderungen – jedoch lange Zeit nicht für klinisch relevant erachtet und deswegen auch nicht weiter beachtet. Zudem gibt es ja schon lange das Fach Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Wozu sich also zusätzlich um eine »weibliche« Medizin kümmern?
Frauen galten aus medizinischer Sicht als zumeist etwas kleiner und etwas leichter geratene Männer, die außer ihren typischen Frauenleiden und einer oftmals anderen psychischen Verfassung keine Besonderheiten aufwiesen. Warum sich also in Forschung und Praxis spezifisch mit ihnen beschäftigen? Waren ihre medizinischen Belange nicht genauso abgedeckt, wenn neue Medikamente an Männern erforscht oder andere innovative Therapiemethoden an männlichen Probanden ausprobiert wurden?
Zwar hatten die Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) der USA, die mächtigste Forschungsförderorganisation der Welt, bereits 1993 angekündigt, dass sie medizinische Studien künftig nur noch dann fördern würden, wenn auch Frauen als Versuchsteilnehmer darin aufgenommen werden. Doch viele Wissenschaftlerteams hielten sich nicht an diese Vorgabe – oder sie werteten die Ergebnisse nicht nach Geschlechtern getrennt aus, wenn Frauen doch als Probanden teilgenommen hatten, sodass die Erkenntnisse aus solchen Untersuchungen keinerlei Nutzen für die Frauen erbrachten3.
Auch in Medikamententests und anderen Studien, in denen neue Therapien erprobt wurden, hielten sich die Studienleiter oftmals nicht an die Empfehlung, die neuen Arzneimittel gleichermaßen an Frauen wie an Männern zu testen und zu erforschen. Es verwundert daher nicht, zu welch niederschmetterndem Ergebnis eine Analyse von US-Behörden 2001 kam: Acht der zehn verschreibungspflichtigen Pharmaka, die zwischen 1997 und 2000 wegen gefährlicher Nebenwirkungen vom Markt genommen werden mussten, brachten »ein größeres Risiko für Frauen als für Männer mit sich«4.
Wenngleich sich das Bewusstsein für die besonderen Belange von Frauen in Diagnostik und Therapie in einigen Bereichen inzwischen deutlich verbessert hat und immer mehr Ärztinnen und Ärzte erkennen, dass es entscheidend für eine gute Medizin ist, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu berücksichtigen, hat die Gendermedizin auch weiterhin einen schweren Stand. An den meisten Universitäten ist sie noch nicht institutionell etabliert, also ohne eigenen Lehrstuhl, eigenes Institut und die entsprechende Ausstattung. Sie wird oftmals als abwegiges Spezialgebiet oder unwichtige Nischendisziplin betrachtet und nicht als ein zentrales Thema für die medizinische Ausbildung, Forschung und Praxis.
Dabei sollte die angemessene Berücksichtigung von Frauen in der Medizin mittelfristig gar kein eigenständiges Fachgebiet sein, sondern zum Denken und Handeln in jeder medizinischen Disziplin gehören. Frauengesundheit und Gendermedizin bieten sich als ein interdisziplinäres Querschnittsthema an, das selbstverständlich das ärztliche Vorgehen in Theorie und Praxis bestimmen sollte.
Die vielfältigen genetischen, biologischen, anatomischen, physiologischen, klinischen aber auch die psychischen und sozialen Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu kennen, ist entscheidend für eine erfolgreiche individuelle Behandlung. Werden diese Erkenntnisse in die praktische Versorgung einbezogen, ist das übrigens nicht nur für die Untersuchung und Behandlung von Frauen von erheblicher Bedeutung, sondern auch gewinnbringend für die Betreuung von Männern. Zumindest, wenn gute medizinische Qualität der Anspruch sein soll.
Sex, Geschlecht und Gender
Es gibt Männer und Frauen, und es gibt Menschen, die sich keinem Geschlecht eindeutig zugehörig fühlen oder im Laufe ihres Lebens einen Wandel durchmachen. Allen Menschen ist jedoch gemeinsam, dass sie zwar nicht allein, aber eben auch von ihrer Biologie in dem bestimmt werden, was sie sind, was sie fühlen, erleben und wie sie sich verhalten. Und außerdem werden sie davon bestimmt, wie sie von ihrer Umwelt geprägt worden sind.
Prozentual zu gewichten, ob es nun »die Gene« sind oder eine schwere Kindheit oder rückständige – zumindest aber gesundheitsschädliche – Rollenbilder, die mehr zum Gesundheits- und Krankheitsverhalten der jeweiligen Geschlechter beitragen, ist unmöglich. Zudem handelt es sich bei diesen beiden Polen weder um getrennte noch um gegensätzliche Welten. Vielmehr beeinflusst das gesellschaftliche wie das persönliche Umfeld und Erleben die Biologie – unter dem Stichwort Epigenetik gibt es dazu ein stetig wachsendes Forschungsfeld – und die Biologie wirkt sich darauf aus, wie sich Menschen verhalten, und entscheidet beispielsweise mit darüber, was sie essen, wie viel sie sich bewegen und mit welchen anderen Menschen sie sich besonders gerne umgeben.
Wenn es um den Einfluss des Geschlechts in der Medizin geht, wird – je nach Standpunkt – gerne die Bedeutung der Biologie, inklusive ihrer Nachbar- und Nebendisziplinen wie Genetik und Biochemie betont, sowie die unterschiedliche Anatomie und Physiologie von Mann und Frau. Oder aber man misst der frühkindlichen Prägung größeres Gewicht bei, den Einflüssen, die einen Menschen während der Erziehung und seiner sonstigen Sozialisation formen. Gemäß dieser letzteren Denkweise stehen die gesellschaftlichen Einflüsse und die Umweltfaktoren im Mittelpunkt der Argumentation.
Der kanadische Neurobiologe Michael Meaney hat in dieser seit Jahrzehnten schwelenden Nature-or-Nurture-Debatte (hat nun die »Natur«, also die Biologie den entscheidenden Einfluss auf den Menschen und seine Entwicklung, oder haben es Erziehung, Umwelt und Prägung, englisch: »Nurture«?) einen schönen Vergleich gewählt: Wer könnte schon mit Sicherheit bestimmen, was mehr zu einem Rechteck beiträgt, die Längs- oder die Querseite? Und, so müsste man Meaneys Bild wohl ergänzen, wer würde sich überhaupt anmaßen zu behaupten, was im jeweiligen Falle die Längs- und was die Querseite ist?
Im Folgenden geht es immer wieder darum, zwischen dem biologischen Geschlecht (englisch: Sex) und dem sozialen Geschlecht (englisch: Gender) zu unterscheiden. Das biologische Geschlecht spielt eine Rolle, wenn es beispielsweise um den genetischen Einfluss der beiden weiblichen X-Chromosomen geht, von denen eines per Zufall oft nur unvollständig aktiviert wird. Daraus kann sich eine Neigung zu Krankheiten ergeben oder aber auch der Schutz davor. Die unvollständige Aktivierung kann auch dazu beitragen, dass die Immunreaktion von Frauen – beispielsweise nach einer Impfung – zumeist heftiger ausfällt5.
Zu den Unterschieden, die das biologische Geschlecht mit sich bringt, gehören außerdem ein unterschiedlicher Knochenbau von Männern und Frauen, eine andere Lungengröße oder die Neigung, dass Frauen auf nahezu alle Schadstoffe und Gifte, inklusive Tabakrauch, körperlich empfindlicher reagieren und daraufhin schneller krank werden, um nur einige Beispiele zu nennen.
Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt es nicht nur in der Art und Ausprägung ihrer Beschwerden, sondern sogar auf der zellulären Ebene. Die Zellen von Frauen und Männern arbeiten anders, auch die zeitliche Rhythmik ist eine andere, was sich an vielen Stoffwechselvorgängen zeigt, die in unterschiedlicher Form ablaufen und zu unterschiedlichen Tageszeiten ihren Höhepunkt haben. Das ist für die Behandlung von Krankheiten, aber auch für die Bestimmung von Laborwerten von Bedeutung.
Medikamente müssen deshalb manchmal nicht nur anders dosiert werden, sondern sie entwickeln auch zu anderen Tageszeiten ihre optimale Wirkung6. Diese Erkenntnisse sind längst noch nicht in die praktische Medizin eingeflossen, obwohl das sehr wichtig wäre. So ist das Schmerzempfinden am späten Nachmittag um etwa ein Drittel geringer ausgeprägt als am frühen Morgen, weswegen Termine beim Zahnarzt möglichst nach 16 Uhr stattfinden sollten.
Umgekehrt gibt es natürlich auch etliche biologische Faktoren, denen Männer stärker ausgesetzt sind. So führen auf dem Y-Chromosom lokalisierte Erbanlagen wie das SRY-Gen zur Bildung der Hoden und einer anschließenden Testosteronproduktion. Das trägt nicht nur im Laufe der Entwicklung zur Maskulinisierung der Geschlechtsorgane und des Körperbaus bei, sondern ermöglicht auch neuronale Verknüpfungen im Gehirn, die Jahre später zu interessanten Verhaltensweisen in der männlichen Pubertät führen und noch später zu bestimmten Krankheiten disponieren können7.
Mit dem sozialen Geschlecht sind hingegen Rollenbilder und Rollenerwartungen gemeint, denen sowohl Frauen als auch Männer unterliegen. Sie haben sich teilweise seit Jahrhunderten verfestigt und lassen sich nur schwer abschütteln. Sie gelten daher nicht als naturgegeben, sondern als »soziale Konstruktion«, sind also nicht in etwaigen biologischen Unterschieden begründet, sondern in tradierten gesellschaftlichen Normen und Bewertungen.
Dabei handelt es sich um typische Verhaltensmuster von Männern und Frauen. Hier gibt es eindeutige Unterschiede, wenn es beispielsweise darum geht, ärztliche Hilfe zu suchen, Präventionsangebote wahrzunehmen, Krankheiten und Schmerzen zu ertragen oder sich versorgen zu lassen, aber auch um geschlechtertypisches Verhalten in der Ernährung, dem Sport oder gegenüber absehbaren Risiken durch Suchtverhalten oder andere potenziell selbstschädigende Muster.
Diese sozialen Konstruktionen sind allerdings nicht nach dem Schwarz-Weiß-Prinzip auf die Geschlechter verteilt, sondern fluide und in den letzten Jahren zudem gehörig in Bewegung geraten. Kaum ein Mensch verhält sich rein stereotyp männlich oder weiblich; jeder zeigt immer eine Mischung, die allerdings mal 90 : 10, mal 50 : 50 ausfallen kann. Dennoch lösen die Zuordnungen zum sozialen Geschlecht zuverlässig bestimmte Reaktionen und Gegenreaktionen in der Medizin aus – Ärzte gehen mit weiblichen Patienten und weiblichem Rollenverhalten beispielsweise anders um als mit männlichen, auch wenn beide von der gleichen Krankheit betroffen sind und ähnliche Behandlungen vorgesehen wären8.
Bei manchen Leiden wirken sich das soziale Geschlecht und ein typisches Rollenverhalten unmittelbar auf die medizinischen Risiken und den Krankheitsverlauf aus: So versorgen Frauen traditionell häufiger und intensiver sowohl kleine Kinder als auch kranke und gebrechliche Angehörige, besonders die Eltern oder Großeltern. Das setzt sie stärker als Männer diversen Ansteckungsrisiken aus, die sie nicht vollständig dadurch ausgleichen, dass sie – auch dies ist rollenbedingt – stärker auf Sauberkeit und Hygiene achten. Sie gehen anders mit Schmerzen um als Männer, ihre Kommunikation mit Ärztinnen und Ärzten folgt anderen Mustern, und sie verhalten sich anders, wenn sie schwer oder chronisch erkranken.
Kann man das auch anders sehen?
Obwohl Frauen in der Medizin häufiger unter Fehldiagnosen zu leiden haben als Männer, sind es besonders die Männer, die weit vor der Zeit sterben. Die Sterblichkeit unter Männern der Arbeiterklasse liegt in den industrialisierten Ländern fast doppelt so hoch wie jene der Frauen aus der gleichen gesellschaftlichen Gruppe. Und die Hälfte dieser Todesfälle sind auf schädliches, geschlechtertypisches Verhalten zurückzuführen, für das es eingefahrene Rollenmuster gibt.
Aus diesem Grund sterben fast doppelt so viele Männer an Unfällen oder – häufig vermeidbaren – Verletzungen. In den USA lag der Anteil der Todesopfer durch Unfälle und Verletzungen bei Männern zuletzt bei 7,6 Prozent. Bei den Frauen waren es hingegen »nur« 4,4 Prozent. In Europa ist diese Verteilung ganz ähnlich.
Männer gehen rücksichtsloser mit ihrer eigenen Gesundheit um, es gehört bei vielen von ihnen zum Selbstverständnis, Schmerzen und erste Anzeichen von Erkrankungen zu ignorieren, auch wenn das Klischee von der »Männergrippe« das Gegenteil suggeriert. Männer üben im Durchschnitt gefährlichere Berufe aus, sie rauchen mehr, sie trinken mehr Alkohol, sie ernähren sich schlechter und nehmen ärztliche Untersuchungen und Vorsorgeangebote weniger oft wahr als Frauen.
Männer werden zudem häufiger drogenabhängig, und sie verhalten sich in diversen Lebensbereichen riskanter. Aus diesem Grund unterliegen sie Gesundheitsgefahren, die weniger in ihrer Biologie als in ihrem Verhalten und den Rollenmustern, denen sie folgen, begründet sind. Eine Gendermedizin, die für eine geschlechtersensible Heilkunde eintritt, müsste sich auch der Herausforderung stellen, spezifische Nachteile und Risiken für Männer zu erforschen und zu beheben.
Biologisches und soziales Geschlecht wirken nicht unabhängig voneinander auf die Menschen ein, sondern sie stehen in enger Wechselwirkung zueinander. So können durch eine fleisch- und fettlastige, aber ballaststoffarme Ernährung sowie durch Rauchen und Alkoholkonsum bestimmte Krankheits-Gene aktiviert werden, wozu eine obst- und gemüsereiche Kost bei demselben Individuum nicht führen würde.
Auf der anderen Seite bremsen regelmäßige Bewegung, Zufriedenheit im Alltag und andere ausgleichende Faktoren genetische Krankheitsauslöser womöglich so stark aus, dass ein Leiden gar nicht erst zum Ausbruch kommt. In diesen Fällen beeinflusst also das geschlechtertypische Verhalten (»gender«) die Biologie (»sex«).
Chronischer Stress, Angst, Einsamkeit und andere seelische Belastungen führen hingegen dazu, dass sich die Informationsverarbeitung im Gehirn und ihre Modulation ändert. So werden durch Stress und Ausgrenzung bestimmte neurobiologische Muster verändert und schließlich »erlernt«. Dadurch kann sich in den Nervenfasern eine größere Schmerzempfindlichkeit ausprägen und gebahnt werden.
Die Schmerzschwelle sinkt, Schmerzreize werden bevorzugt ins Gehirn weitergeleitet und dabei sogar noch verstärkt, während andere, sich auf die Schmerzempfindung dämpfend auswirkende Faktoren in ihrer Aktivität vermindert sind. Das Verhalten wirkt sich also mittelfristig auf die Biologie aus. Umgekehrt bestimmt die Biologie das Verhalten mit, etwa wenn bestimmte Hormonkonstellationen und neurobiologische Verknüpfungen zu mehr Ängsten oder Aggressionen führen.
Aus diesem Grund ist es im Sinne einer ganzheitlichen Medizin wichtig, immer beide Seiten – sowohl Natur als auch Umwelt – zu berücksichtigen. Die Wechselwirkungen halten ein Leben lang an, sind in verschiedenen Altersphasen unterschiedlich stark ausgeprägt, und es gilt sie zu beachten, anstatt einseitig entweder die naturwissenschaftliche oder die psychosoziale Dimension zu betonen.
Die Crux mit der Sprache
Sprache prägt das Denken und Handeln der Menschen – und die Menschen prägen und verändern die Sprache in ihrem Alltag. Vor dem Hintergrund einer seit Jahrtausenden währenden Benachteiligung von Frauen gibt es seit einigen Jahren diverse Versuche, mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache herzustellen, um so auf Diskriminierung hinzuweisen. Besonders populär sind das Binnen-I und das Gendersternchen geworden. Durchgesetzt hat sich jedoch noch keine dieser Initiativen, laut Umfragen sprechen sich nur sechs bis sieben Prozent der Menschen in Deutschland für die »Gendersprache« aus.
Grammatisch und semantisch stringent und logisch ist keiner der bisherigen Versuche, die Sprache in Richtung mehr Geschlechtergerechtigkeit zu verändern. Zudem besteht ein Ziel aller Sprachreformen darin, dass die Sprache einfacher und leichter zugänglich wird. Auch dies wird mit den verschiedenen Facetten der Gendersprache nicht erreicht, im Gegenteil. Deshalb wird den Verfechterinnen und Verfechtern solcher Initiativen oft vorgeworfen, nur eine kleine akademisch-mediale Klientel zu bedienen und andere Gesellschaftsschichten auszuschließen. Auch die Tradition von Frauen aus der ehemaligen DDR, von denen viele heute noch sagen, »Ich bin Arzt«, oder »Ich bin Mechatroniker«, würde damit ignoriert, so der Vorwurf.
In diesem Buch spielt das Geschlecht der Handelnden und Behandelten eine große Rolle. Ärzte reagieren anders auf Frauen als auf Männer und lassen ihnen andere Untersuchungen und Therapien zukommen – weil sie Frauen oder Männer sind. Bei Ärztinnen ist das anders. Die Nachteile für Frauen sind evident, und sie sind von ihrem Geschlecht abhängig.
Im Text wird daher häufig – wenn auch nicht durchgängig – die männliche und die weibliche Form verwendet. Es ist also von Ärztinnen und Ärzten die Rede, sowie von Patienten und Patientinnen; manchmal auch von weiblichen Ärzten oder männlichen Patienten. Damit soll der Versuch unterstrichen werden, immer wieder auf die Bedeutung des Geschlechts und der Geschlechterrollen in der Medizin aufmerksam zu machen.
In eigener Sache
Es dauert viele Jahre, bis man zum Arzt oder zur Ärztin sozialisiert worden ist und sich an verschiedene medizinische Denkmuster gewöhnt hat. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, der nicht nur mit der Ansammlung von Wissen zu tun hat, sondern vor allem mit den Erfahrungen, Ritualen, Einschätzungen und Bewertungen, die von den Lehrenden, aber auch von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen weitergegeben werden.
Diese berufliche Formung und Ausbildung im Wortsinne findet während des Medizinstudiums und der zahlreichen Klinikpraktika statt, die während des Studiums notwendig sind. Es geschieht zudem in den Seminaren »auf Station« und während der Famulaturen. Später als Assistenzarzt geht es dann weiter mit der Fortbildung und Prägung der medizinischen Persönlichkeit und hört während der gesamten ärztlichen Tätigkeit nie auf.
Wenn man sich zusätzlich zur Arztwerdung auch für Wissenschaft interessiert, kommt eine besondere Prägung in diversen Forschungsinstituten und Laboren hinzu. Anfangs findet die Ausbildung und Erweiterung des Horizontes rein medizinisch statt, später – je nach Schwerpunkt und Interesse – geht es darum, das medizinische Wissen zu erlernen und den Umgang mit wissenschaftlichen Studien, Statistiken und Experimenten einzuüben.
Das Weltbild und die Vorstellungen davon, wie sich Patientinnen und Patienten zumeist verhalten, was ihnen fehlt, welche Beschwerden für sie typisch sind und was ihnen helfen könnte, sind keineswegs in Stein gemeißelt. Sie bestimmen aber sowohl die Arbeit als Ärztin und Arzt als auch die der wissenschaftlich tätigen Mediziner in den Laboren.
Während meiner Ausbildung habe ich vielfältige Impulse und Anregungen bekommen und währenddessen kleine Arztpraxen, riesige Ambulanzen, städtische Kliniken, Universitätskrankenhäuser, aber auch Reha-Kliniken und konfessionelle Krankenhäuser in Millionenmetropolen, Kleinstädten und auf dem Land kennengelernt. Forschungseinrichtungen unterschiedlicher Größe und Qualität waren ebenfalls darunter. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland; in Frankreich, Großbritannien und den USA.
Ich habe beispielsweise an der Universität Montpellier in Südfrankreich während eines einjährigen Studienaufenthalts jeden Morgen von acht bis ein Uhr in verschiedenen Krankenhäusern auf Station mitgearbeitet und mitgeholfen, Blut abzunehmen, die Patienten klinisch zu untersuchen und sie zu versorgen, bevor nachmittags die Vorlesungen und Seminare anstanden.
Die praktische Ausbildung gehört in Frankreich sinnvollerweise schon früh zum klinischen Teil des Medizinstudiums und steht dort ab dem dritten Studienjahr mit täglichen Vormittagsschichten auf dem Stundenplan. Alle Studierenden werden in Krankenhäusern eingeteilt und arbeiten zusammen mit älteren Studierenden und jungen Ärzten vollintegriert mit. Nach drei bis vier Monaten auf einer Station wechselt man das Krankenhaus und die Abteilung, sodass die Möglichkeit besteht, im Verlauf des Studiums viele Fachdisziplinen kennenzulernen.
In Cardiff, der Hauptstadt von Wales, habe ich während einer Famulatur mehrere Wochen in der Notaufnahme verbracht. In dieser rauen Hafenstadt an der britischen Westküste durfte ich mithelfen, Patienten zu verarzten. Unter ihnen waren viele Hafen- und Werftarbeiter, die nach Arbeitsunfällen oder Schlägereien in unsere Ambulanz kamen, weil ihre Wunden zu nähen und andere Notfälle zu betreuen waren. Seinerzeit befand sich in Cardiff die zweitgrößte Notaufnahme Großbritanniens nach dem Hammersmith Hospital in London. Rund um die Uhr kamen Verletzte, Verunfallte oder akut Erkrankte in die Tag und Nacht geöffnete Ambulanz, die dringend Hilfe brauchten.
Besonders viele Notfallpatienten kamen absehbar ab elf Uhr abends, wenn die Pubs gerade geschlossen hatten und es hinterher Raufereien gab, sowie nach den Trinkgelagen am Wochenende. Zwei hünenhafte Polizisten waren permanent im Wartebereich der Notaufnahme postiert und achteten darauf, dass die Ordnung einigermaßen eingehalten wurde und es in der Ambulanz nicht zu weiteren Tumulten kam. Schließlich ging es dort oft handfest zu, etwa wenn beide Kontrahenten einer Prügelei verletzt waren und nun gemeinsam darauf warten mussten, bis ihre Blessuren versorgt wurden. Auch in Großbritannien ist es üblich, dass angehende Doktoren schon früh im Studium an der medizinischen Versorgung teilnehmen, Hand anlegen und von den erfahreneren Ärzten lernen.
In den USA habe ich fast ein Jahr lang an den berühmten National Institutes of Health (NIH) in Bethesda geforscht, einer einzigartigen Ballung wissenschaftlicher Expertise nördlich von Washington, D.C., wovon die Porträtgalerie in der Eingangshalle von »Building 10« mit mehr als 70 mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Wissenschaftlern eindrucksvoll Zeugnis ablegt (die U-Bahn-Station der »red line«, die unmittelbar an den Campus angrenzt, heißt passenderweise »Medical Center«).
Hier kamen die originellsten und begabtesten Wissenschaftler aus den USA und vielen anderen Ländern zusammen, um neue Forschungsprojekte in einzigartiger Atmosphäre voranzutreiben. Die erste erfolgreiche Gen-Therapie fand hier statt, gleichzeitig wurden Traditionen gepflegt und die Fachleute früherer Tage angemessen gewürdigt.
So machte beispielsweise einmal pro Woche Donald Fredrickson in der Abteilung Visite, in der ich forschte und zu der auch Krankenstationen gehörten. Fredrickson war damals schon etwa 70, und er hatte einige seltene Erkrankungen als Erster beschrieben, darunter die Tangier-Krankheit, von der weltweit nur etwas mehr als 100 Fälle bekannt sind und die nach den Bewohnern von Tangier Island vor der Küste Virginias benannt ist. Die Einteilung der Fettstoffwechselstörungen »nach Fredrickson« kennt jeder Medizinstudent.
Später war ich als Postdoc im Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg in der Arbeitsgruppe des viel zu früh verstorbenen Nobelpreisträgers Georges Köhler tätig, der schon in jungen Jahren die monoklonalen Antikörper entwickelt und beschrieben hatte. Dort forschten wir zu den verschiedenen Akteuren und Substanzen des Immunsystems, zu Interferonen und Immunglobulinen und versuchten zu beschreiben, welche spezifische Rolle diese Moleküle im Abwehrsystem spielen und was passiert, wenn sie gentechnisch ausgeschaltet oder neue Gene mittels molekularbiologischer Methoden hinzugefügt werden. Biologen, Biochemiker, Mediziner, Physiker, Mathematiker und Informatiker arbeiteten in diesen Teams zusammen, interdisziplinär und bunt gemischt aus dem In- und Ausland.
Als Arzt an den Universitätskliniken in Freiburg und Würzburg kam ich mit einer Reihe engagierter und talentierter Ärztinnen und Ärzte in Kontakt; schon bald bildeten sich jenseits des Berufs Bekanntschaften und Freundschaften. Manche der Kolleginnen und Kollegen waren herausragende Kliniker, andere wurden zu renommierten Wissenschaftlern. Etliche von ihnen sind inzwischen als Chefärzte, Instituts- oder Abteilungsleiter tätig oder nehmen andere verantwortungsvolle Positionen ein, in Unikliniken, Krankenhäusern, Arztpraxen, Forschungslaboren oder in anderen Bereichen der Medizin oder der Gesundheitspolitik.
Diese Erfahrungen zähle ich relativ ausführlich auf und zwar aus einem bestimmten Grund: Denn wo immer ich tätig war oder für eine begrenzte Zeit Einblicke in die Medizin und die Wissenschaft gewinnen durfte, ergab sich ein ähnliches Bild: Ich hatte zwar immer mehrere Kolleginnen, aber die leitenden Positionen in Kliniken und Laboren hatten fast ausschließlich Männer inne. So habe ich auf der Führungsebene fast nur männliche Rollenbilder und Vorbilder in den Arztpraxen, Ambulanzen und Krankenhäusern und auch in der Wissenschaft erlebt.
Das war meistens sehr lehrreich, oft anregend und manchmal ziemlich unterhaltsam. Es gab charismatische Führungspersönlichkeiten darunter, ein paar charmante Frohnaturen, die unermüdlichen Arbeiter, aber natürlich auch die Drückeberger und Hallodris – so wie es vermutlich überall zugeht, wenn Menschen beruflich miteinander zu tun haben. Zwar habe ich auch von den erfahreneren Kolleginnen sehr viel gelernt und mir von ihnen abschauen dürfen; meistens waren sie geduldiger als die männlichen Kollegen. Frauen waren jedoch in den leitenden Positionen und auf den Chefsesseln kaum zu finden.
Dabei gibt es sehr viele Frauen in der Medizin. Es gibt mehr Ärztinnen als Ärzte, unter den Pflegekräften finden sich bei Weitem mehr Frauen als Männer, und in den für die Patientenversorgung ebenfalls wichtigen Heil- und Hilfsberufen sind die Frauen auch deutlich in der Mehrheit. Viele von ihnen sind beeindruckende Persönlichkeiten, etliche arbeiten engagiert und aufopferungsvoll.
Kolleginnen hatte ich immer während meiner medizinischen Laufbahn, im Studium sowieso, aber auch später als Arzt und in der Forschung. Viele Assistenzärztinnen waren darunter, aber nur noch wenige in leitender Position und daher sehr wenige Oberärztinnen. Die Chefärztinnen waren ganz rar, mir fällt höchstens eine Handvoll ein. Je weiter es in der Hierarchie nach oben ging, desto weniger Frauen gab es.
Wenn es um berufliche Themen ging, spielten Frauen ebenfalls keine besondere Rolle. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir im Studium oder später als Ärzte darüber gesprochen hätten, dass die Empfindungen, Symptome, Beschwerden und Krankheitsverläufe bei Frauen womöglich anders sein könnten als bei den männlichen Patienten. Wir haben uns die entsprechenden Fragen schlicht nicht gestellt.
Der Heilungsverlauf nach einer Operation oder schweren Erkrankung war natürlich individuell unterschiedlich, aber das schien nicht vom Geschlecht abhängig zu sein. Bei keinem einzigen Krankheitsbild kam uns das in den Sinn – und Krankheiten und Symptome gibt es wahrlich viele in der Inneren Medizin, dem Fachgebiet, in dem ich tätig war.
Das Thema Geschlecht spielte für uns jedoch gar keine Rolle – auch für die Frauen in meinem medizinischen Umfeld nicht, soweit ich mich daran erinnern kann. Zumindest habe ich es seinerzeit nicht wahrgenommen, falls es doch so gewesen sein sollte. Krankheit war Krankheit, und die konnte groß wie klein, dick wie dünn, arm wie reich, alt wie jung und eben gleichermaßen Mann wie Frau befallen; egal aus welchen Schichten, Volks- und Einkommensgruppen die Kranken stammten.
Auch in der Kinderklinik, in der ich im letzten Studienabschnitt während des Praktischen Jahres vier Monate zubrachte, fiel mir keine Unterscheidung zwischen Mädchen und Jungen auf, außer dass einige wenige Krankheiten das eine Geschlecht nun mal öfter betrafen als das andere. Magersucht kommt beispielsweise deutlich häufiger bei Mädchen als bei Jungen vor.
Natürlich gab es Unterschiede in der Häufigkeit, mit der die Geschlechter von manchen Krankheiten befallen waren. Das wussten wir im Medizinstudium wie auch später als Ärzte, aber das waren statistische Quantifizierungen, die aus unserer Sicht nichts mit einer bei Frauen und Männern unterschiedlichen Qualität des Erlebens und Erleidens zu tun hatten oder gar mit dem ärztlichen Umgang damit. Ein Knochenbruch war ein Knochenbruch, und die Ausprägung einer Zuckerkrankheit hing von der Genetik, vom Blutzuckerspiegel und der Therapietreue ab und nicht vom Geschlecht.
Vor dem Virus, dem Krebs, dem Knochenbruch, der degenerativen Erkrankung oder der Entzündung schienen alle Menschen gleich zu sein. Krankheiten hatten etwas Urdemokratisches für uns – und das ist ja nicht das Schlechteste, was man darüber sagen kann. Krankheiten schienen der große Gleichmacher zu sein, und das letzte Hemd hat sowieso keine Taschen. Am Lebensende geht es um die pure Existenz und den Abschied von der leiblichen Hülle, egal was man vorher gehabt hat oder gewesen ist.
Auch in der Forschung fiel es mir und den anderen Wissenschaftlern in meinem Umfeld nicht ein, auf mögliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu achten. Wenn es doch so gewesen sein sollte, habe ich es zumindest nicht mitbekommen. An den NIH, den Elite-Instituten in den USA, an denen ich forschen durfte, war dies genauso wenig der Fall wie am Max-Planck-Institut in Freiburg, an dem ich eine Weile tätig war.
Vielleicht habe ich seinerzeit auch nur nicht darauf geachtet und es nicht mitbekommen, dass sich jemand darüber Gedanken machte. In der Forschung lernte ich neben Deutschen und Amerikanern auch Kanadier, Russen, Franzosen, Spanier, Schweden, Briten, Italiener, Japaner und Chinesen kennen und arbeitete teilweise intensiv mit ihnen zusammen. Aber auch bei ihnen hatte ich nicht den Eindruck, dass sie in ihren Forschungsarbeiten auf etwaige Unterschiede zwischen den Geschlechtern geachtet hätten und sie das Thema beschäftigte.
Während meiner wissenschaftlichen Tätigkeit werteten wir neben der Laborarbeit, die für unseren Studien notwendig war, gelegentlich auch größere Patientenkollektive aus. Neben der Grundlagenforschung hat diese klinische Forschung eine große Bedeutung für die Medizin. Dazu listeten wir zwar sorgfältig auf, wie groß der Anteil der Männer und Frauen in den Untergruppen und nach Alter sortiert jeweils war, aber bei der Auswertung der Ergebnisse auf mögliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu achten, kam uns nicht in den Sinn.
Ob es um Cholesterin, Fettstoffwechselstörungen und andere Risikofaktoren für Herzinfarkt und Schlaganfall ging oder um die diversen Antikörper, T-Zellen, Interleukine und andere Akteure im Immunsystem, spielte seinerzeit keine Rolle. Das Geschlecht unserer Studienteilnehmer war schlicht nicht von Bedeutung – ebenso wenig wie das der Versuchstiere, die gelegentlich für die Forschung notwendig waren.
Zudem meinte ich damals zu wissen, dass es gute Gründe dafür gab, Frauen weniger in Medikamentenstudien einzubeziehen als Männer. Spätestens nach dem Contergan-Skandal Anfang der 1960er-Jahre war besondere Vorsicht in Medikamentenstudien und Experimenten geboten. Frauen und Kinder galt es tunlichst aus der Forschung herauszuhalten, nicht aus den Beobachtungsstudien oder Umfragen, aber aus interventionellen Studien, in denen neuartige Therapien oder andere Substanzen ausprobiert wurden. Schließlich hätten sie schwanger sein können und sie oder ihr noch ungeborenes Kind durch die wenig erprobten Medikamente geschädigt werden können.
Frauen galten in der Forschung zudem als weitaus weniger berechenbar als Männer, schließlich warf ihr Zyklus allmonatlich das Wechselspiel der Hormone, Transmitter und all der anderen Substanzen, die sich im Körper bestimmen und erfassen ließen, gehörig durcheinander. Wer konnte schon vorhersagen, was mit ihnen geschehen würde, wenn sie eine neue Arznei bekamen? War es also nicht vor allem zu ihrem Schutz und dem des ungeborenen Lebens, wenn man sie aus der Forschung heraushielt?
Ein Bewusstseinswandel für die Bedeutung des Geschlechts in der Medizin setzte auch bei mir erst später ein, lange nach dem Medizinstudium und nach meiner Tätigkeit als Arzt. Obwohl es während der praktischen Ausbildung im Studium und in den ersten Jahren meiner ärztlichen Tätigkeit Irritationen und erste Anhaltspunkte gab.
Der Vorsprung schmilzt
Die Lebenserwartung von Frauen in Deutschland liegt deutlich über jener von Männern. Im Durchschnitt werden Frauen knapp fünf Jahre älter, der Unterschied beträgt derzeit exakt 4,7 Jahre. Im Jahre 2020 konnten Männer mit einer Lebenserwartung von 78,9 Jahren rechnen, Frauen kamen hingegen auf 83,6 Jahre, Tendenz bei beiden Geschlechtern steigend.
Gut vierzig Jahre zuvor, 1980, war der Unterschied zwischen den Geschlechtern noch deutlich stärker ausgeprägt und betrug fast sieben Jahre. Damals konnten sich die Männer nur auf 69,6 und die Frauen auf immerhin 76,3 Jahre durchschnittliche Lebenserwartung einstellen. So erfreulich dieser »Gewinn« für Männer wie Frauen auch ist, stellt sich dennoch die Frage, was den Unterschied ausmacht – und warum er mittlerweile kleiner geworden ist.
Biologisch gilt der »Östrogenschutz« für Herz und Gefäße, über den Frauen mindestens bis zu den Wechseljahren verfügen, als Erklärung dafür, dass Frauen länger leben. Die weiblichen Geschlechtshormone sind es demnach, die Arterien und besonders die Herzkranzgefäße geschmeidig halten und davor bewahren, frühzeitig zu verkalken und dichtzumachen. Zumindest bis zu den Wechseljahren sind Frauen also besser vor Herzinfarkt und Schlaganfall geschützt. Danach gleicht sich das Risiko stetig wieder an und wird für Frauen sogar zu einer immer größeren Gefahr.
Vergleiche von Nonnen und Mönchen im Kloster haben jedoch gezeigt, dass dieser biologische Vorteil der Frauen vermutlich nur ein bis zwei Jahre in der Lebenserwartung betragen würde, wenn die Lebensführung beider Geschlechter exakt identisch wäre – Beten und leichte Arbeiten, eine gemäßigte Lebensführung mit festen Essens- und Schlafenszeiten, wenig Aufregung und zumindest offiziell kein Sex.
Der Östrogenschutz liefert also keine zufriedenstellende Erklärung für den großen Unterschied in der Lebenserwartung von Frauen und Männern. Dieser liegt wohl eher in unterschiedlichen Verhaltensweisen begründet. Was auch durch die Tatsache untermauert wird, dass der Unterschied in der Lebenserwartung der Geschlechter deutlich kleiner geworden ist, seit sich geschlechtstypische Verhaltensweisen in Berufsausübung und Freizeit geändert haben. Männer sind heutzutage seltener in hochriskanten Berufen wie im Bergbau, als Holzfäller, als Soldat oder im Kampfeinsatz tätig, während sich die Frauen im Alltag wie in der Freizeit deutlich riskanter verhalten als früher und beispielsweise mehr rauchen.
Ein weiterer Grund für den sich stetig verringernden Unterschied in der Lebenserwartung besteht allerdings gerade darin, dass Frauen medizinisch schlechter versorgt und anders behandelt werden als Männer. Ihre Beschwerden werden nicht so ernst genommen und manchmal schlicht übersehen, besonders wenn sie nicht in das typische Muster fallen, das vom männlichen Idealpatienten in Praxis wie Theorie geprägt ist.
Dadurch erleiden Frauen handfeste Nachteile und gesundheitliche Schäden. Wie umfassend die Medizin Frauen benachteiligt, warum dies in fast jedem Bereich der Heilkunde so ist und welche Denkmuster dahinterstecken, ist Thema dieses Buches und wird aus vielerlei Perspektiven beleuchtet.
Höchste Zeit also, endlich darüber aufzuklären, wie Frauen unter der chronischen Missachtung in der Medizin leiden – und zwar ganz konkret. Sie werden oftmals später behandelt, bekommen weniger eingreifende Therapien, und ihre Leiden werden weniger schnell und weniger gut erkannt. Welche Gefahr das im Detail für Leib und Leben der Frauen bedeuten kann und welche anderen Nachteile sie dadurch haben, werde ich anhand zahlreicher Beispiele erläutern. Zudem werde ich vielversprechende Möglichkeiten aufzeigen, wie sich das ändern lässt und wo es bereits erfolgreich geändert wird.
Allerdings ist es noch ein weiter Weg, bis sich die Bedingungen für Frauen, die zu Patientinnen werden, ändern. Denn die meisten Benachteiligungen passieren nicht vorsätzlich oder werden gar achselzuckend in Kauf genommen. Vielmehr liegt es an unbewussten Mechanismen, Traditionen, Denkmustern und Fehlwahrnehmungen in der Medizin.
Teilweise trägt auch das ihnen zugeschriebene und über Jahrhunderte erlernte, anerzogene und gesellschaftlich vorgegebene Rollenbild und Verhalten der Frauen dazu bei, dass sie sich in Arztpraxen, Ambulanzen und Krankenhäusern nicht das notwendige Gehör verschaffen können, um bestmöglich behandelt zu werden. Dies zu ändern, ist jedoch die Aufgabe der Medizin und ihrer Institutionen und kann nicht primär den Frauen angelastet werden. Oftmals sind die Widerstände groß – auch in einem Umfeld, in dem es um Frauengesundheit geht, und in einem medizinischen Fachbereich, der hauptsächlich von Frauen betrieben wird, wie das folgende Beispiel deutlich macht.
Was die Medizin von Frauen lernen kann
Die Frau kam zur Geburt von Zwillingen in die große Berliner Klinik. Die Schwangere kam am mittleren Vormittag. Sie wirkte leise, scheu und etwas verunsichert, und deswegen war es umso erstaunlicher, mit welcher Gewissheit sie gegenüber den Hebammen und dem Ärzteteam verkündete, dass heute Nachmittag gegen drei Uhr ihre beiden Kinder zur Welt kommen würden.
Die Hebammen, Ärztinnen und Ärzte wussten nicht, ob sie nach dieser Ansage schmunzeln oder sich ärgern sollten. Zumindest nahmen sie angesichts dieser entschiedenen Festlegung sogleich eine gewisse Oppositionshaltung ein. Nach den ersten Untersuchungen schüttelten sie erst recht den Kopf und machten auch der Schwangeren ziemlich deutlich, wie wenig sie von ihrer zeitlichen Prognose hielten. Der Geburtsvorgang würde sich noch über etliche Stunden hinziehen, bis tief in die Nacht, vermutlich bis weit in den nächsten Tag hinein, so die einhellige medizinische Einschätzung.
Zunächst wollte das Team die Schwangere sogar wieder nach Hause schicken, weil es bis zur Geburt voraussichtlich noch ziemlich lange dauern würde, was die werdende Mutter aber entschieden ablehnte. Sie hatte kein gewinnendes Wesen, wirkte etwas ungepflegt, zudem verhielt sie sich dickköpfig. Dem Geburtshilfe-Team war sie auf Anhieb und mit Nachdruck unsympathisch, und es machte sich eine gewisse Abwehrhaltung ihr gegenüber breit.