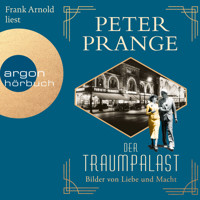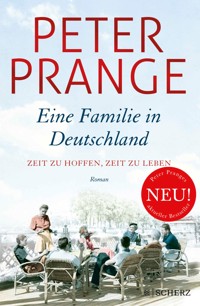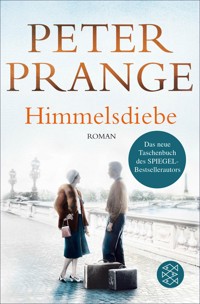9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große, als TV-Zweiteiler verfilmte Bestseller mit Gesamtauflage von weit über 1 Mio. Exemplaren: jetzt wieder lieferbar! Ein Schicksal, wie nur in Deutschland zu finden ist. Barbaras Geschichte beginnt im Oktober 1944 und schließt im Oktober 1990. Ihre Familie wird durch den Zweiten Weltkrieg auseinandergerissen und kann erst ein halbes Jahrhundert später wieder zusammenfinden. Dazwischen liegen die Jahre des nackten Überlebenskampfes unmittelbar nach dem Krieg, des Kalten Krieges, des sich Arrangierens in verschiedenen Welten – bis zur Wiedervereinigung 1989. Für Barbara scheint es nur eine Wahl zu geben, die Wahl zwischen Vernunft und Verlangen. Die Wahl zwischen zwei Männern, zwischen Westen und Osten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 806
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Dr. Peter Prange
Das Bernstein-Amulett
Geschichte einer Familie aus Deutschland
Roman
Über dieses Buch
Ein Schicksal, wie nur in Deutschland zu finden ist. Barbaras Geschichte beginnt im Oktober 1944 und schließt im Oktober 1990. Ihre Familie wird durch den Zweiten Weltkrieg auseinandergerissen und kann erst ein halbes Jahrhundert später wieder zusammenfinden. Dazwischen liegen die Jahre des nackten Überlebenskampfes unmittelbar nach dem Krieg, des Kalten Krieges, des sich Arrangierens in verschiedenen Welten – bis zur Wiedervereinigung 1989. Für Barbara scheint es nur eine Wahl zu geben, die Wahl zwischen Vernunft und Verlangen. Die Wahl zwischen zwei Männern, zwischen Westen und Osten ...
Peter Pranges großer, als TV-Zweiteiler verfilmter Bestseller hat eine Gesamtauflage von weit über 1 Mio. Exemplaren.
Weitere Titel von Peter Prange:
›Unsere wunderbaren Jahre‹
›Die Rose der Welt‹
›Ich, Maximilian, Kaiser der Welt‹
›Die Philosophin‹
›Die Principessa‹
›Werte: Von Plato bis Pop – alles, was uns verbindet‹
Die Webseite des Autors: www.peterprange.de
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Vorbemerkung
Widmung
Prolog: 1990
Erstes Buch Der Zusammenbruch 1944/45
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Zweites Buch Die Stunde null 1946/47
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Drittes Buch Wiederaufbau 1953–1960
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Viertes Buch Zweigeteilt 1961/62
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Fünftes Buch Kleine Schritte 1970/71
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Sechstes Buch Wieder vereint 1989/90
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Epilog: 1990
Danke!
Dieser Roman erzählt eine Geschichte, wie sie nirgendwo sonst auf der Welt hätte stattfinden können – außer in Deutschland, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Die Handlung selbst ist jedoch frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und vom Autor unbeabsichtigt.
Für meine Eltern
»Mit Deutschland – sehen Sie – ist das so wie bei einem Ameisenhaufen: Sie können einen Ameisenhaufen auch nicht durchteilen, dann laufen die armen Tiere rüber und ’nüber und versuchen verzweifelt, ihre Brut in Sicherheit zu bringen. Sie handeln nicht nach ihrem Verstand, sondern nach ihrem Instinkt.«
Ein anonymer DDR-Flüchtling
Prolog: 1990
»Sollen wir ewig hier rumsitzen und warten, oder fangen wir ohne den Herrn Professor an?«, fragte Werner. »Ich bin dafür, wir fangen an!«
»Vielleicht kommt Christian ja doch noch«, meinte Tina.
»Wie denn? Durch den Schornstein wie der Nikolaus? Er ist ja seit Wochen verschwunden. Vielleicht weiß er gar nicht, dass wir hier sind.«
»Das kann er sich doch denken. Er ist ja nicht so blöd wie du.«
»Wenn Egoismus ein Zeichen von Intelligenz ist, dann bin ich allerdings blöder als er.«
Es war Barbaras fünfundsechzigster Geburtstag – und ihre Tochter und ihr zweitältester Sohn stritten, als wären sie nicht siebenunddreißig und zweiundvierzig, sondern sieben und zwölf. Alex, ihr Mann, der mit ihr am Kopfende der Festtafel saß, gab den Kellnern ein Zeichen, dass sie das Essen auftragen sollten.
Barbara hätte nicht gedacht, dass sie diese Räume je wiedersehen würde. Hier war sie aufgewachsen, hier hatte sie die glücklichsten und schrecklichsten Stunden ihres Lebens genossen und durchlitten. Es war ihr Elternhaus, das Schloss, von dem aus ihre Familie seit Generationen den Gutshof bewirtschaftet hatte. Vor fast dreißig Jahren hatte sie diesen Ort verlassen, für immer, wie sie damals dachte. Ob es richtig war, hier ihren Geburtstag zu feiern? Noch dazu ohne Christian?
Von draußen klatschten dicke Regentropfen gegen die Fensterscheiben. In dem Saal herrschte klammfeuchte Kälte. Für Oktober war es viel zu kühl. Ihr Vater hätte bei diesem Wetter ein Feuer im Kamin angezündet, doch wo früher der Kamin in die Wand eingelassen war, stand heute eine Tiefkühltruhe mit einer Eiskremkarte darauf. Das Herrenhaus war zu DDR-Zeiten ein Kinderheim gewesen; jetzt, ein Jahr nach der Wiedervereinigung, wurde es von einer westdeutschen Restaurantkette als Gasthof genutzt, mit Geldautomaten und Computerspielen in der Eingangshalle. Werner, der den Raum für die Geburtstagsfeier gemietet hatte, überlegte schon, was sie mit den Gebäuden, wenn sie der Familie wieder gehörten, anstellen würden. Barbara aber hatte Zweifel, ob sie wirklich noch einmal von vorn anfangen sollten, an diesem Ort, mit dieser Vergangenheit. Es war doch längst vorbei und entschieden, sie konnten die Zeit nicht mehr zurückdrehen.
»Barbara, Liebling – wo bist du?« Sie blickte in das Gesicht ihres Mannes, der ihr mit einem Lächeln ein Sektglas reichte. »Ich würde gerne mit dir anstoßen.«
Alex strich ihr eine Strähne aus dem Gesicht, die sich aus ihrer Frisur gelöst hatte, als plötzlich vom Flur her erregte Stimmen und lautes Poltern in den Saal drangen.
»Platz da! Ich bin hier der Ehrengast!«
Barbaras Herz setzte für eine Sekunde aus. Im nächsten Moment flog die Flügeltür zum Speisesaal auf, eine Kellnerin sprang erschrocken zur Seite. Die Gespräche am Tisch verstummten, alle Köpfe wandten sich zur Tür.
»Christian …«
Barbara biss sich auf die Lippe. In der Tür stand ihr ältester Sohn. Aber wie sah er aus? Sein Gesicht war verwüstet, sein Haar hing ihm nass in die Stirn, der Anzug war voller Falten und verdreckt. In der Hand hielt er eine offene Wodkaflasche.
»Na bravo, der Herr Professor gibt sich die Ehre!«, sagte Werner.
Christian achtete nicht auf seinen Bruder. Mit schwankenden Schritten ging er durch das Spalier der Gäste auf seine Mutter zu. Nur mühsam hielt er sich auf den Beinen.
»Mein Gott, bin ich froh, dass du da bist«, flüsterte Barbara und stand auf, um ihn zu umarmen. »Wo bist du gewesen? Wo hast du die ganze Zeit gesteckt?«
Christian presste sie wie ein Liebhaber an sich und gab ihr einen schmatzenden Kuss auf den Mund. Ein scharfer Geruch von Alkohol schlug ihr entgegen. Im nächsten Moment stieß er sie mit einer heftigen Bewegung von sich.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!«, lallte er mit schwerer Zunge. »Herzlichen Glückwunsch zu deinem wunderbaren Leben!«
»Was soll der Unsinn?«, fragte Alex. »Was ist das für ein Auftritt?«
Christian stierte ihn mit trüben, betrunkenen Augen an. »Wer bist du denn, fremder Mann? Was willst du hier?« Dann wandte er sich wieder von ihm ab und prostete Barbara mit der Wodkaflasche zu: »Prost, liebste Mama! Oder besser: nasdrowje! Auf die Liebe! Auf das Universum! Amen!«
Die Worte trafen sie wie Ohrfeigen. Barbara hatte sie schon einmal gehört, vor vielen, vielen Jahren, aus einem anderen Mund, in einem anderen Leben. Ein fürchterlicher Verdacht regte sich in ihr. Wenn Christian diese Worte sagte, konnte das nur eins bedeuten: Er hatte die Wahrheit herausgefunden, ihr großes, dunkles Geheimnis, das er niemals erfahren durfte. Ihre Hand zitterte so stark, dass sie ihr Glas auf dem Tisch absetzen musste.
Christian nahm die Flasche an die Lippen und trank einen Schluck. Dann stieß er einen Rülpser aus und warf sie hinter sich. Mit einem Klirren ging sie an der Wand zu Bruch, in großen Schlieren rann der Wodka an der Tapete herab.
»Ach ja, bevor ich’s vergesse – dein Geschenk!«
Plötzlich ganz nüchtern, griff er in seine Tasche und fuhr mit der geschlossenen Faust auf den Tisch. Um seine dunklen, fast schwarzen Augen, mit denen er Barbara fixierte wie ein Forscher ein Insekt, zuckte es nervös, während er ganz langsam die Faust öffnete.
»O Gott …«, sagte Alex, und seine Stimme überschlug sich fast. »Das ist ja unglaublich! Das ist ja die echte. Wo zum Teufel kommt die denn her?«
Barbara fasste sich unwillkürlich an den Hals. Nein, sie hatte sich nicht geirrt – Christian wusste Bescheid.
In seiner Hand glänzte eine Goldkette, mit einem Bernstein-Amulett als Anhänger. Dieselbe Kette, wie Barbara sie heute an ihrem fünfundsechzigsten Geburtstag trug. Und während sie das Amulett auf ihrer Brust befühlte, bestürzt und entsetzt und gleichzeitig erleichtert, dass die Zeit der Lügen nun ein Ende hatte, wanderten ihre Gedanken in die Vergangenheit zurück, weiter und weiter, bis zu jenem Tag, als sie zum ersten Mal die Kette getragen hatte, die echte, die nun ihr Sohn in Händen hielt, am schönsten Tag in ihrem Leben …
Erstes BuchDer Zusammenbruch 1944/45
1
Barbara öffnete weit das Fenster ihres Mädchenzimmers, und mit ausgebreiteten Armen, die Griffe beider Fensterflügel in den Händen, blickte sie in die Landschaft hinaus.
Es war ein Tag jenseits der Zeit. Ein tiefblauer Himmel, an dem hier und da ausgefranste Wolkenfetzen verharrten, als hätten sie auf ihrer Reise die Richtung verloren, spannte sich über die weite, nur von wenigen Hügeln unterbrochene Ebene jenseits des Schlosses und der Gutsgebäude. Die Sonne tauchte die abgeernteten Felder und Wiesen in ein goldgelbes Licht. Auf der Koppel am See graste im Schatten der Apfelbäume eine Stutenherde. Glatt wie ein Spiegel glänzte der See, kein Luftzug kräuselte die Oberfläche. Es war so still wie am ersten Tag der Schöpfung. Weder Vogelzwitschern noch Grillenzirpen störte den tiefen Frieden dieser Morgenlandschaft, im Altweibersommer des Jahres 1944.
»Papa hat gesagt, es kommen über zweihundert Gäste. Und alle wegen uns. Ist das nicht großartig?«
»Nicht wegen uns – wegen dir«, sagte Alex. »Mach die Augen zu und dreh dich nicht um.«
Brav wie ein Lamm schloss sie die Augen. Wie immer, wenn er sie um etwas bat, tat sie einfach, was er sagte – obwohl das gar nicht ihrem Wesen entsprach. Aber sie hatte aufgehört, sich darüber zu wundern. Alex hatte eine so ruhige, vernünftige Art, dass sie ihm blindlings vertraute. Zärtlich berührte er ihren Hals. Sie spürte ein leichtes, angenehmes Kribbeln im Nacken. Was machte er da?
»Aua! Der blöde Verschluss!«
»Jetzt hast du dich verraten!«, rief sie triumphierend.
»Na gut, du kannst die Augen aufmachen.«
Als sie aufschaute, war Barbara für einen Moment irritiert. Die Landschaft vor ihr war verschwunden; stattdessen sah sie ihr eigenes Gesicht – in dem Handspiegel von ihrer Frisierkommode, den Alex ihr vorhielt.
»Na, wie gefällt sie dir?«, fragte er voller Erwartung.
Barbara biss sich vor Freude auf die Lippen. Um ihren Hals schmiegte sich eine goldene Kette, in der sich die Sonnenstrahlen funkelnd brachen, aus hauchdünnen, feingesponnenen Fäden, die ganz ähnlich wie ihr eigenes rotblondes Haar geflochten waren. Am Ende der Kette hing ein Bernstein-Amulett von der Größe eines Kieselsteins, das dunkelrotbraun auf ihrer beigefarbenen Bluse schimmerte.
»Sie ist wunderschön.«
»Wirklich? Findest du? Hast du schon den Einschluss gesehen?«
Sie versuchte zu erkennen, was in dem Bernstein verborgen war. Eine Ameise? Ein Käfer? »Das ist ja eine richtige Biene«, staunte sie.
»Nein!«, rief er. »Keine Biene – eine Bienenkönigin!« Er nahm das Amulett in die Hand, polierte die Oberfläche an der Manschette seines Uniformrocks und hielt es gegen das Licht. »Siehst du hier, den langen Hinterleib? Ich habe alle Juweliere von Königsberg abgeklappert, bis ich sie endlich fand. Die meisten hatten nur Einschlüsse mit langweiligen Insekten. Aber ich wollte unbedingt eine Bienenkönigin für dich.«
Seine blauen Augen leuchteten vor Begeisterung in seinem von tausend Sommersprossen übersäten Gesicht. Barbara wusste nicht, was sie mehr an ihm mochte: diese leuchtenden blauen Augen oder die vielen Sommersprossen auf seiner hübschen kleinen Nase und seiner braunen Haut.
»Was bist du nur für ein Schatz«, sagte sie und strich ihm über das kurze, blonde Haar. »Danke, Alex. Ich werde immer an dich denken, wenn ich sie trage.« Dann wurde sie ganz ernst. »Aber hast du keine Angst, dass das Unglück bringt?«
Alex runzelte die Stirn. »Unglück? Was meinst du?«
»Wenn der Bräutigam seiner Braut schon vor der Hochzeit ein Geschenk macht?«
»Nur keine Bange«, lachte er. »Die Kette ist nur zu deinem Geburtstag. Den hast du ja heute auch. Dein Hochzeitsgeschenk bleibt mein Geheimnis, bis nach der Kirche.«
Barbara nahm sein Gesicht zwischen ihre Hände und schaute ihn an. »Womit hab ich dich eigentlich verdient?«
»Womit hab ich dich verdient?«, flüsterte er.
Sie schmiegte sich an ihn und schloss die Augen. Als ihre Lippen sich berührten, stieg wieder die Ahnung jenes merkwürdigen, ebenso unheimlichen wie herrlichen Gefühls in ihr auf, das sie manchmal beim Reiten überkam, wenn sie frühmorgens am Bach entlangritt und ihr Pferd immer schneller galoppierte, oder auch beim Klavierspielen, wenn sie das Fortissimo so lange hinauszögerte, bis es fast nicht mehr ging. Dieses Gefühl war vielleicht ein Dutzend Mal über sie gekommen, und jedes Mal war sie anschließend in die Küche gegangen, um ein Schmalzbrot zu essen. Weil ihr dabei immer irgendetwas fehlte.
»Ich kann es kaum abwarten bis heute Abend«, flüsterte sie Alex ins Ohr. »Ich möchte ganz nah bei dir sein. So nah es nur geht …«
»Hast du immer noch die ollen Reitklamotten an?«
Wie zwei erwischte Pennäler fuhren Barbara und Alex auseinander. Hilde, Barbaras Mutter, stand im Zimmer, das Brautkleid über dem Arm. Sie hatte wirklich ein Talent, immer genau im falschen Moment hereinzuplatzen!
»Alex, meinen Sie wirklich, dass Sie sich noch im Zimmer Ihrer Braut aufhalten sollten?« Hilde legte das Kleid aufs Bett und klatschte in die Hände. »Raus jetzt mit Ihnen! Es ist höchste Zeit!«
»Nicht bevor ich Ihnen die Hand geküsst habe, gnädige Frau«, erwiderte Alex und beugte sich über ihre Hand. Dann ging er zur Tür. Mit einem Fuß schon draußen, drehte er sich noch einmal um. »Vergiss nicht«, sagte er mit einem Augenzwinkern zu Barbara, »wir haben heute noch eine wichtige Verabredung.«
Hilde sah ihm kopfschüttelnd nach. »Man weiß nie so recht, woran man bei ihm ist«, sagte sie, nachdem Alex die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Seine Manieren sind wirklich comme il faut, nur diese flapsigen Bemerkungen. Aber was ist, Kindchen, was schaust du mich plötzlich so an? Du siehst ja ganz traurig aus.«
»Jetzt wird mir doch ein bisschen blümerant«, sagte Barbara. »Wenn ich mir vorstelle, dass ich in ein paar Stunden eine verheiratete Frau bin, und nicht mehr deine Tochter.«
»Was redest du da für einen Unsinn? Nicht mehr meine Tochter?«, fragte Hilde und nahm Barbaras Hand. »Und wenn du selbst schon Enkelkinder hast, wirst du immer noch mein Mädchen sein.« Zusammen setzten sie sich auf die kleine Couch, die Barbara zu ihrem vierzehnten Geburtstag geschenkt bekommen hatte. »Für mich ist das wie gestern, dass du zur Welt gekommen bist. Mein Gott, was war ich stolz, als ich dich im Arm hielt. Außer dir habe ich ja sonst nichts Praktisches im Leben fertiggebracht.«
»Vergiss nicht deinen selbstgemachten Johannisbeerlikör!«
»Und jetzt bist du eine junge, wunderhübsche Frau.« Liebevoll streichelte sie Barbaras Wange. »Warum musst du auch schon mit neunzehn heiraten?«
»Weil ich ihn liebe, Mama.«
»Bist du dir ganz sicher, Barbarachen?« Sie sah ihre Tochter fest an. »So sicher, dass du wirklich dein ganzes Leben mit ihm verbringen willst? Nur mit ihm und keinem andern?«
»Natürlich, Mama«, sagte Barbara und entzog ihrer Mutter die Hand. »Warum fragst du das überhaupt?«
»Weil ich selber lange genug verheiratet bin«, erwiderte Hilde mit einem Anflug von Wehmut. »So eine Ehe ist ja nicht nur ein einziger langer Hochzeitstag. Außerdem, wenn ich dich manchmal Klavier spielen höre, so voller Hingabe und Leidenschaft … Ist Alex da nicht ein bisschen zu nüchtern? Ich meine, ein Physiker. Soviel ich weiß, mag er weder Musik noch Pferde. Aber das sehe ich ja erst jetzt«, unterbrach sie sich und griff nach Barbaras Kette. »Hat er dir die geschenkt?«
»Ist die nicht schön? Guck mal, mit einer echten Bienenkönigin.«
Hilde betrachtete voller Anerkennung das Amulett. »Geschmack hat er, das muss man ihm lassen. Wirklich, sehr, sehr hübsch. Nur trag sie nicht zu oft, sonst nutzt sie sich ab.« Sie rückte die Kette am Hals ihrer Tochter zurecht und griff nach dem Brautkleid. »Aber jetzt sollten wir zusehen, dass du fertig wirst. Die Friseuse kommt in einer halben Stunde.«
Doch Barbara machte keine Anstalten aufzustehen. Stattdessen spielte sie mit dem Amulett auf ihrer Brust. »Eines musst du mir aber vorher noch sagen, Mama …«
»Nämlich?«
Barbara schlug die Augen zu ihr auf, und mit einem Grinsen fragte sie: »Macht man dabei eigentlich das Licht aus?«
Hilde zuckte zusammen. »Kindchen, du fragst manchmal Sachen! Da muss man ja direkt rot werden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin«, fügte sie hinzu und beugte sich zu Barbara, um ihr den Rest ins Ohr zu flüstern, »ich hatte es immer am liebsten mit Licht. Doch sag Papa bloß nicht, dass ich dir das erzählt habe. Das würde er mir nie verzeihen. Du weißt ja, wie streng er manchmal ist.«
Barbara nahm ihre Mutter in den Arm und gab ihr einen Kuss. »Du bist zwar eine völlig überkandidelte Frau und zu nichts zu gebrauchen, aber doch die beste Mamutschka der Welt.« Dann schmiegte sie sich ganz eng an diesen warmen, vertrauten Körper. »Ach, Mama, es könnte alles so herrlich sein, wenn Alex nicht morgen zurück an die Front müsste. Warum kann er nicht einfach dableiben und zusammen mit mir glücklich sein?«
»Psst«, sagte Hilde und strich ihrer Tochter übers Haar. »Heute ist heute, und morgen ist morgen. Lass uns für heute alle diese unschönen Dinge einfach vergessen …«
2
Die Vermählung der Gutstochter Barbara von Ganski mit dem Leutnant der Infanterie Alexander Reichenbach war das größte gesellschaftliche Ereignis seit Monaten im Landkreis Greifswald. Die von Ganskis gehörten zu den bedeutendsten Großgrundbesitzern der Gegend; das Gut der Familie, Daggelin bei Boddenhagen, umfasste achthundert Hektar Ackerland, Wiesen und Wälder. Der Gutsherr und Vater der Braut, Albin von Ganski, war Konsul von Norwegen, Ehrensenator der Universität und bis 1933 Landtagsabgeordneter der Deutschnationalen Volkspartei.
Die Familie Reichenbach gehörte nicht dem Landadel an, sondern stammte aus Dresden. Alex’ Vorfahren waren meist Handwerker und Kaufleute, im 19. Jahrhundert waren einige Universitätsprofessoren hinzugekommen. Die private Handels- und Kreditbank, die Alex’ Vater Konstantin Reichenbach als Inhaber und Direktor führte, hatte vor über siebzig Jahren dessen Großvater gegründet.
Die »dicke Marie«, wie die gotische Hauptkirche im Zentrum der Hansestadt hieß, war eine Stunde vor Beginn der Trauzeremonie bereits bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Menschenmassen, die sich auf den uralten Holzbänken drängten, wären unmöglich in der Dorfkirche von Boddenhagen untergekommen, geschweige denn in der Kapelle von Schloss Daggelin. Aus allen Himmelsrichtungen waren die Gäste herbeigeströmt, Studienkollegen und Garnisonskameraden von Alex ebenso wie Jugendfreundinnen Barbaras, Pächter und Großgrundbesitzer aus der Umgebung oder Geschäftsfreunde von Alex’ Vater. Nur die Westphals aus Essen im Ruhrgebiet, Barbaras Onkel Alfred und seine Familie, hatten wegen der unsicheren Lage im Reich kurzfristig abgesagt.
Ein Raunen ging durch die Menge der Schaulustigen, die vor dem Portal der »dicken Marie« auf die Ankunft der Brautleute wartete. Vom Marktplatz rasselte im scharfen Trab die offene Hochzeitskutsche heran, gezogen von vier prächtigen Füchsen mit grünroten Schabracken, den Farben der Familie von Ganski.
»Brrrr … hoooooo …«
Respektvoll trat die Menschenmenge beiseite. Die Kutsche hielt genau vor dem Ehrenspalier, das eine Abordnung der Greifswalder Studentenschaft bildete, angeführt von einem hochgewachsenen, schwarzhaarigen Mann Mitte dreißig in brauner SA-Uniform, der energisch die Neugierigen zurückdrängte und die kleine Treppe aus dem Wagen herausklappte.
Ausgerechnet der, dachte Barbara.
Der sich da so wichtig machte, war Karl-Heinz Luschnat, in einer Person Doktor der Rechtswissenschaften, Justitiar einer Waffenfabrik und Standartenführer der SA. Er war so ziemlich der letzte Mensch, den sie an diesem Tag sehen wollte. Doch wie so oft hatte Karl-Heinz es mal wieder geschafft, dass man nicht auf ihn verzichten konnte.
Nachdem das Treppchen bereit war, klemmte er sich die Mütze unter den Arm und streckte seine freie Hand aus, um Barbara beim Aussteigen zu helfen. Doch sie ignorierte ihn einfach und wartete, dass ihr Vater voranging. Dabei ahmte sie die Art ihrer Mutter nach, die, immer wenn ihr ein Mensch unangenehm war, den Kopf in den Nacken warf und mit teilnahmsloser und gerade dadurch unnahbarer Miene in die Luft schaute. Erst als ihr Vater auf der Straße stand, raffte Barbara ihr Brautkleid hoch und erhob sich.
»Jeder Zoll eine Freifrau«, sagte Albin mit einem Lächeln, aus dem gleichzeitig Anerkennung und Stolz sprachen, während Barbara hoheitsvoll mit seiner Hilfe die Kutsche verließ. »Ich bin mal gespannt, wie dir das bürgerliche Leben schmecken wird, ohne das Adelsbrimborium.«
»Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst«, erwiderte Barbara mit gespielter Verwunderung.
»Apropos«, sagte Albin. »Wo bleiben Alex und seine Eltern denn?«
Mit gerunzelter Stirn blickte er über den Platz. Hinter ihnen hielt gerade die zweite Kutsche mit Hilde. Karl-Heinz nutzte den Augenblick, um Barbara ein paar Worte zuzuflüstern.
»Ich warne dich … Noch kannst du umkehren. Es ist der Fehler deines Lebens!«
»Ich hab dir schon hundertmal gesagt«, zischte sie zurück, »mein Leben geht dich nichts an!«
»Wenn ich eins hasse, dann Unpünktlichkeit«, sagte Albin verärgert. Doch als er sich seiner Tochter wieder zuwandte, waren die Falten auf seiner Stirn schon wieder verschwunden. »Na ja, gehen wir auf jeden Fall schon mal hinein. Wir wollen den Pastor nicht länger warten lassen.«
Während Barbara am Arm ihres Vaters die Marienkirche betrat, rollte eine schwarze, schwere Limousine über den Marktplatz: der Maybach der Familie Reichenbach. Alex hatte seine Eltern in der Wohnung am Rubenowplatz abgeholt, die sie ihm und Barbara zur Hochzeit geschenkt und in der sie die Nacht verbracht hatten. Wie immer waren die Vorhänge im Fond des Wagens zugezogen, eine Angewohnheit, die noch aus der Zeit stammte, als Alex’ Mutter in den großen Ufa-Filmen mitspielte und sich deshalb in der Öffentlichkeit vor zudringlichen Blicken schützen musste.
»Findest du es nicht – wie soll ich sagen – etwas provokant, im Frack statt in der Uniform zu heiraten, mein Junge?«
Die Limousine war so geräumig, dass Alex seinen Eltern wie in einer Kutsche gegenübersaß. Konstantin, sein Vater, sah ihn mit sorgenvoller Miene an, während er ein wenig mechanisch die Hand seiner Frau Christel streichelte. Solange Alex zurückdenken konnte, hielten die beiden wie zwei Turteltauben Händchen, und wahrscheinlich würden sie das mit hundert Jahren noch tun. Alex wünschte sich, dass Barbara und er das später genauso machen würden.
»Ich finde den Frack absolut richtig«, sagte seine Mutter und zog bestens gelaunt an ihrer Zigarettenspitze. »Erstens sitzt er Alex wie angegossen, und zweitens ist ein Frack das einzige Kleidungsstück, in dem ein zivilisierter Mann heiraten kann. Wenn sich dadurch irgendein Idiot provoziert fühlt – ja du meine Güte! Dann ist ihm eben nicht zu helfen.« Sie paffte ein paar blaue Ringe in die Luft. »Deine Vorsicht, Konstantin, nur ja nichts Falsches zu tun, nimmt manchmal groteske Züge an.«
Darin gab Alex seiner Mutter recht: Sein Vater war in den letzten Jahren übervorsichtig geworden. Vielleicht hatte es ja mit Christels Unfall zu tun. Es war 1938 passiert, bei Filmaufnahmen in Davos. Sie spielte eine Skilehrerin, die im Liebeskummer einen Steilhang hinabraste. Kurz vor dem Auslauf verkantete ihr Ski, sie stürzte und brach sich die Hüfte. Das hatte nicht im Drehbuch gestanden. Seitdem saß sie im Rollstuhl, und ihre Filmkarriere war vorbei. Doch so schlimm der Unfall gewesen war: Das allein, dachte Alex, konnte nicht der Grund sein, warum Konstantin nur noch ein Schatten seiner selbst war. Aus dem großen, entschlossenen Mann, den er aus seiner Kindheit in Erinnerung hatte, war ein nervöses Wrack geworden, mit sechzig Jahren schon ein Greis, der mit fahrigen Bewegungen und unruhigen Blicken eine Zigarette nach der anderen rauchte, seine Frau ängstlich auf Schritt und Tritt begleitete und, wenn er auf Reisen war, alle paar Stunden anrief, um sich zu vergewissern, dass ihr nichts passiert war. Von dem alten Bild, das Alex von seinem Vater in sich trug, war in der Realität nur noch die weiße Nelke übrig geblieben, die Konstantin sich jeden Morgen ins Knopfloch steckte. Doch die Blume an seinem Revers war so falsch wie das Gebiss in seinem Mund.
»Keine Angst, Papa«, sagte Alex, »ich werde niemand provozieren. Ich habe den Frack nur gewählt, weil er am besten zu meinem Geschenk für Barbara passt.«
»Das schönste Geschenk, das ein Bräutigam seiner Braut in diesen Zeiten machen kann«, sagte seine Mutter und tätschelte sein Knie.
»Und sich selbst dazu«, sagte Alex. »Ich weiß gar nicht, womit ich so ein Glück verdient habe. Als mein Kommandeur mir die Mitteilung machte, habe ich mich vor meinen Kameraden fast geschämt.«
Energisch wie selten schüttelte Konstantin den Kopf. »Nein, mein Junge. Das hat nichts mit Glück zu tun, und schämen brauchst du dich ganz sicher nicht. Was du da für Barbara und dich erreicht hast, verdankst du allein deinem Fleiß und deinem Talent.«
Der Chauffeur öffnete den Wagenschlag und half Christel hinaus. Als sie in ihrem Rollstuhl saß, machte Alex Anstalten auszusteigen. Doch Konstantin legte ihm die Hand auf den Arm.
»Noch eine Sekunde, mein Junge«, sagte er, die Zigarette im Mundwinkel.
»Ja, Papa?«
»Ich will es uns beiden ersparen, dir die Dinge zu sagen, die ein Vater seinem Sohn vor der Hochzeit so sagt. Du bist alt genug, um zu wissen, was du tust. Doch eins möchte ich dir noch geben.« Er griff in die Innentasche seines Rocks und zog einen Briefumschlag daraus hervor. »Hier, nimm das bitte und steck es ein.«
Alex schaute das Kuvert verwundert an. Es trug die Initialen seines Vaters und war versiegelt.
»Was ist darin, Papa? Ein Scheck? Ihr habt uns doch schon die Wohnung …«
»Nein, kein Scheck, Alex, und auch kein Geld.« Konstantin drückte seinen Arm und schaute ihn mit seinen wässrigen, blauen Augen an. »Falls mir je etwas zustoßen sollte, mach den Umschlag auf. Ich habe alles darin aufgeschrieben, was du dann wissen und tun musst.«
»Aber Papa«, sagte Alex erschrocken. »Was soll das? Bist du etwa krank?«
»Nein, mein Junge, mach dir keine Sorgen. Es ist nur für den Fall der Fälle.«
»Bitte, Papa, sei ehrlich! Verschweigst du mir etwas?«
Konstantin schüttelte mit einem müden Lächeln den Kopf. »Nur eine von meinen überflüssigen Vorsichtsmaßnahmen. Wahrscheinlich wirst du das Kuvert nie öffnen. Aber jetzt, Alex«, sagte er dann und rückte sich die Nelke im Knopfloch zurecht, »möchte ich endlich meine schöne Schwiegertochter bewundern.«
Albin runzelte in der Kirche irritiert die Stirn, als er seinen Schwiegersohn im Frack erblickte. Doch Alex schenkte ihm ebenso wenig Aufmerksamkeit wie der Kanzel mit den Bildnissen der Reformatoren. Er hatte nur Augen für Barbara, seine Braut.
Sie stand vor dem Altar, mit dem Rücken zu ihm, in einem schlichten, enganliegenden weißen Kleid ohne Schleppe, in aufrechter Haltung wie ihr Vater an ihrer Seite. Sie trug das Haar hochgesteckt, so dass ihr schlanker Hals mit dem rotblonden Flaum im Nacken zu sehen war. Sie hatte seine Kette angelegt. Als Alex auf der Höhe der Kanzel war, drehte sie sich zu ihm um. Ihre Augenpaare begegneten sich, und es war, als würden ihre Blicke verschmelzen. Mit einem Lächeln hinter ihrem hauchdünnen Schleier nickte Barbara ihm zu und schlug den Schleier zurück. Sie war so schön, dass Alex schlucken musste. Sie hatte die Lippen leicht geöffnet, als wolle sie etwas sagen, auf ihren Wangen bildeten sich zwei Grübchen, und aus ihren grünen Augen sprach grenzenlose Erwartung. Dunkel funkelte das Amulett auf ihrer Brust. Wie oft hatte er sich diesen Augenblick vorgestellt – im Hörsaal der Universität, im Offizierskasino, vor allem aber, wenn er nachts einsam auf Wache war, unter einem fremden Himmel, in Frankreich, Rumänien oder Griechenland. Und jetzt, als dieser Augenblick Wirklichkeit wurde, sie dastand und auf ihn wartete, auf ihn, Alexander Reichenbach, fünfundzwanzig Jahre alt und seiner eigenen Auffassung nach ein Mann ohne alle Eigenschaften, um die Liebe dieser Frau zu verdienen, war es für ihn wie eine Offenbarung.
Während der gesamten Zeremonie war Alex so von Barbaras Gegenwart gebannt, dass er von all den Sätzen, die der Pfarrer sprach, kein einziges Wort mitbekam. Als aber die Frage an ihn erging, ob er Barbara zur Frau nehmen wolle, um sie zu lieben und zu ehren, in guten und in schlechten Tagen, da schaute er sie an, in ihre großen grünen Augen, strich eine Strähne, die sich aus ihrer Frisur gelöst hatte, aus ihrer Stirn und sagte ganz einfach, als wäre dies die natürlichste Sache der Welt: »Ja, das will ich. Bis dass der Tod uns scheidet.«
3
»Nein!«, rief Albin und schlug mit der flachen Hand so heftig auf den Tisch, dass die Gläser klirrten. »Nein und abermals nein! Diesen Skandal nehme ich nicht hin!«
»Ich glaube nicht, dass Sie das zu entscheiden haben, Herr von Ganski!«, erwiderte Alex ebenso laut.
Am Kopfende der Tafel, im Beisein sämtlicher Gäste, von denen einige bereits verstohlen den aufflammenden Wortwechsel zwischen Bräutigam und Schwiegervater verfolgten, blickten die zwei sich mit funkelnden Augen an. Längst hatten sie Messer und Gabel sinken lassen, und das Essen auf den Tellern vor ihnen war kalt.
»Vergesst nicht, was für ein Tag ist«, versuchte Hilde die zwei zu beruhigen. »Wenigstens heute wollten wir diese Dinge beiseitelassen.«
»Papperlapapp!«, rief Albin. »Der Krieg steht auf des Messers Schneide, und mein frischgebackener Schwiegersohn erweist sich als Drückeberger!«
»Drückeberger? Mit elf Nahkampfeinsätzen und drei Verwundungen?« Christel war so erregt, dass sie sich beim Sprechen aus ihrem Rollstuhl vorbeugte, als wolle sie dem neben ihr sitzenden Albin an den Kragen. »Sie haben ja keine Ahnung, wovon Sie reden, Sie aufgeblasener Zuckerrübenbaron!«
»Bitte lass das, Mama!«, sagte Alex. »Es ist absolut überflüssig, dass du mich rechtfertigst.«
»Während Ihre Kameraden im Graben krepieren, wollen Sie sich in Ihrem Universitätslabor verstecken!« Albin zog ein angewidertes Gesicht. »Ich hatte ja gleich so ein Gefühl«, sagte er und warf seine Serviette auf den Tisch, »wie Sie da in die Kirche reinspaziert kamen, in Frack und Lackschuhen wie ein Dandy.«
»Sie machen es sich verdammt leicht«, schnaubte Alex. »Sie und Ihresgleichen haben uns die Suppe eingebrockt, die wir jetzt auslöffeln sollen.«
»Das ist eine Frechheit!«
»Und wer dazu nicht hurra schreit, den bezeichnen Sie als Feigling.«
»Seid ihr eigentlich verrückt geworden?!«
Fassungslos sah Barbara die beiden an. Sie war so entsetzt, dass es ihr zunächst die Sprache verschlagen hatte. Das Schlimmste war passiert, was sie sich an diesem Tag nur vorstellen konnte. Zwischen ihrem Vater und ihrem Bräutigam war ein böser Streit entbrannt, und Barbara wusste: Wenn Albin sich einmal in irgendetwas verrannte, dann konnte er sich zu den fürchterlichsten Ausfällen hinreißen lassen, dann schreckte er vor nichts zurück.
Darin war er genauso wie sie.
Bis vor fünf Minuten war Barbaras Welt noch in Ordnung gewesen. Vor der Trauung hatte sie mit ihrem Vater den Notar aufgesucht, das war ein uralter Brauch der Familie: Wann immer ein Stammhalter der von Ganskis heiratete – und Barbara war der Stammhalter, Hilde hatte nach ihr keine Kinder mehr bekommen –, wurde ihm der Besitz des Erbhofs Alt-Daggelin übertragen, auf dem die Geschichte der Familie ihren Anfang genommen hatte und der erstmals 1427 urkundlich erwähnt worden war. Zu Alt-Daggelin gehörten gerade vierzig Hektar Land rund um das Schloss, die bis zur Stutenkoppel am See reichten und wirtschaftlich kaum eine Rolle spielten. Doch darum ging es nicht; die Übertragung sollte die Kontinuität der Familie und ihres Besitzes dokumentieren, genauso wie die monatliche Pacht von einer Reichsmark, die ihr Vater künftig an sie entrichten musste, als Ausdruck der Tatsache, dass jeder einzelne von Ganski nur ein kleines, austauschbares Glied in einer großen Kette war.
Nach der Trauung, beim Verlassen der Kirche, gab es eine wunderbare Überraschung für das Brautpaar: Vor dem Portal stand, anstelle der Hochzeitskutsche, ein feuerrotes, zweisitziges Cabriolet, ein BMW Dixi, das Geschenk der Westphals aus dem Ruhrgebiet. Obwohl Barbara keinen Führerschein hatte, setzte sie sich – zum Entsetzen ihrer Mutter – ans Steuer. Alex zeigte ihr, wie man das Auto bediente, und nach fünf Minuten hatte sie es begriffen. Mit wehendem Schleier drehte sie ein paar Runden um die »dicke Marie«; dann brauste sie in Richtung Daggelin davon, in einem solchen Tempo, dass Alex in den Kurven die Augen schloss und sich mit beiden Händen am Armaturenbrett festhielt.
Als das Brautpaar und die Gäste auf dem Schloss eintrafen, war für das große Festessen alles gerichtet. Im Saal, in den Nebenräumen, selbst im Musikzimmer sowie in der Eingangshalle, wo auf einem dunklen, rissigen Wandgemälde der Stammbaum der Familie von Ganski prangte, waren Tische und Bänke aufgeschlagen. Dreißig Kapaune, zwanzig Gänse und sechs Ferkel waren geschlachtet worden, Dutzende von Hummern und Aalen lagerten auf Eis, Hasenrücken und Rehkeulen schmorten in den Töpfen, und im Küchenhof briet schon seit dem frühen Morgen ein Mastochse am Spieß. Im Laufschritt holten die Diener Champagner und Wein aus dem Keller und füllten die Gläser nach, kaum dass sie ausgetrunken waren, und in dem alten Schloss summte es bald wie in einem Bienenhaus.
Die prächtige Stimmung rührte aber nicht nur von den Speisen und Getränken her. Neugierig beäugte man die berühmte Schwiegermutter der Braut, die manchmal so laut auflachte, dass es im ganzen Saal zu hören war. Schade, dass sie in keinem Film mehr auftrat! Zu gerne würde man sich mit der mal unterhalten … Weil sich das aber niemand traute, widmete man sich den Gerüchten, die um Albin kursierten. Hatte er nun ein Verhältnis mit der blutjungen Gutssekretärin oder nicht? Ein Kostverächter war Albin noch nie gewesen, und hübsch genug war die kleine Markwitz allemal, die die Lohndiener herumkommandierte, als wäre sie die Tochter des Hauses: eine zweite Mona Lisa mit ihrem glatten brünetten Haar und dem feinen Lächeln auf den Lippen. Und diese seltsamen Augen, die sie unablässig über die Festtafel schweifen ließ – das eine grün, das andere braun … Eine höchst eigenartige Laune der Natur, die auch der alte Dorfarzt Dr. Wiedemann nicht erklären konnte.
Doch bevor man ergründet hatte, ob an dem Gerücht etwas dran sei, war diese überraschende Unruhe am Kopfende der Tafel entstanden. Obwohl nur die wenigsten Gäste mit eigenen Ohren hören konnten, was dort geredet wurde, pflanzte sich die Nachricht in Windeseile fort, von Tisch zu Tisch, und bald wussten alle Anwesenden im Saal und in den Nebenräumen Bescheid: Alex hatte Barbara sein Hochzeitsgeschenk gemacht – seine Freistellung vom Wehrdienst. Aufgrund der kriegswichtigen Bedeutung seiner Doktorarbeit durfte er an das physikalische Institut der Universität zurückkehren, um seine Forschung wiederaufzunehmen.
Barbara war Alex vor Glück um den Hals gefallen. Ihr Mann musste nicht mehr an die Front, er würde dableiben, sie nicht allein auf Daggelin zurücklassen. Stattdessen würden sie nach Greifswald fahren und zusammen in ihre Wohnung einziehen, wie ein richtiges Ehepaar, ja vielleicht sogar eine Hochzeitsreise machen, als gäbe es gar keinen Krieg.
Es war zu schön, um wahr zu sein.
»Haben Sie überhaupt kein Gewissen?«, herrschte Albin seinen Schwiegersohn an. »Denken Sie nicht an die Kinder, die in den Bomben umkommen, an die Mütter, die ihre Söhne verlieren?«
»Willst du Alex darum an die Front zurückjagen?«, rief Barbara. »Damit er mich so schnell wie möglich zur Witwe macht?«
Als hätte sie gar nicht gesprochen, ging Albin über ihre Frage hinweg. Barbara spürte, wie sich Wut in ihre Erregung mischte. Wie sie diesen Kommandoton hasste, diese herrische, selbstgerechte Art!
»In dieser Situation ist es Ihre gottverdammte Pflicht, Ihrem Land zu dienen!«
»Meinem Land«, sagte Alex, gleichfalls ohne auf Barbara zu achten, »kann ich als Physiker ebenso nützen wie als Soldat.«
»Und ganz sicher mehr«, fügte seine Mutter hinzu, »als wenn er sich dafür totschießen lässt!«
Albin schüttelte mit stummer Verbiesterung den Kopf. Barbara sah, wie es in ihm brodelte. Sein Gesicht war ganz blass, doch über den Wangenknochen leuchteten dunkelrote Flecken auf seiner Haut. Gleich würde er explodieren.
Doch statt des erwarteten Ausbruchs wandte Albin sich unvermittelt an Alex’ Vater. »Und Sie, Herr Reichenbach«, sagte er. »Haben Sie gar keine Meinung zum Verhalten Ihres Sohnes? Finden Sie seine Entscheidung richtig?«
Konstantin hatte bislang schweigend dem Streit beigewohnt. Die Schultern noch weiter vorgebeugt als sonst, saß er mit seiner Nelke im Knopfloch abseits am Tisch – an Hildes Seite, getrennt von seiner Frau – und steckte sich eine Zigarette nach der anderen an. Zögernd hob er seine blauen Augen zu Albin.
»Was ist in solchen Zeiten schon richtig?«, fragte er leise zurück. »Egal, was man tut, es ist immer irgendwie falsch. Jeder kann nur seine Haut retten. Ich weiß, das ist erbärmlich, aber …« Mitten im Satz brach er mit einem hilflosen Achselzucken ab.
Albin zog die Mundwinkel nach unten, als würde ihm übel. »Eine saubere Einstellung«, sagte er voller Verachtung. »Da braucht man sich über den Sohn nicht zu wundern.« Er lachte einmal zynisch auf. »Als Bankier ist es vermutlich normal, so zu denken. Da ist es ja gleichgültig, ob die Welt untergeht – Geld kann man immer irgendwie hin- und herschieben. Wissen Sie, was Sie in meinen Augen sind?« Er blickte Konstantin mit zusammengekniffenen Augen an. »Ein Parasit, ein ganz gemeiner Schma-«
»Jetzt reicht’s aber, Papa!«, fuhr Barbara dazwischen. »Beleidige nicht auch noch meinen Schwiegervater!«
»Ist schon gut, Barbara«, sagte Konstantin. »Vielleicht hat er ja recht.«
Mit mühsam kontrollierten Bewegungen nahm Albin einen Schluck Wasser aus seinem Glas. »Für meine letzte Bemerkung entschuldige ich mich in aller Form, Herr Reichenbach«, erklärte er mit einem kurzen Kopfnicken zu Konstantin, der die Entschuldigung mit einer kaum merklichen Handbewegung akzeptierte. »Doch meine Forderung bleibt bestehen. Alex meldet sich bei seiner Einheit zurück, und Barbara bleibt bei uns auf Daggelin, oder …«
»Oder was?«, fragte Alex.
»Oder ich breche auf der Stelle jeden Verkehr mit Ihnen und Ihrer Familie ab!«
Mit zusammengepressten Lippen, so dass die Muskeln auf seinen Wangen scharf hervortraten, blickte er geradeaus, ohne jemanden anzusehen.
Alex erhob sich von seinem Platz.
»Ich kann nicht von dir verlangen, dass du mit mir kommst«, sagte er zu Barbara, »aber du musst verstehen, dass ich hier nicht länger bleiben kann.« Er rückte seinen Stuhl an den Tisch und wandte sich zum Gehen.
Barbara fühlte sich plötzlich so allein wie noch nie in ihrem Leben. Mit einer Mischung von Hilflosigkeit und Wut blickte sie ihren Mann an, dann ihren Vater, dann wieder ihren Mann.
»Und ich? Was soll ich tun?«
»Hierbleiben natürlich!«, entschied Albin, ohne sie anzuschauen.
»Das musst du selber wissen«, sagte Alex und verließ den Tisch.
Als hätte jemand ein verabredetes Zeichen gegeben, beugten die Gäste im Saal sich über ihre Teller und nahmen mit übertriebenem Eifer die Gespräche auf, die in der Zwischenzeit vollständig verstummt waren. Jeder vermied es, Alex anzuschauen, der mit erhobenem Kopf, weiß wie eine Wand, auf die geöffnete Flügeltür zuging, durch die in der Halle bereits die Musiker beim Auspacken der Instrumente zu sehen waren. Barbara war verzweifelt. Sie konnte Alex unmöglich gehen lassen! Sie warf einen flehenden Blick auf ihren Vater, doch der ignorierte sie und starrte mit versteinertem Gesicht auf einen imaginären Punkt im Raum.
»Papa«, flüsterte sie, »bitte, tu doch etwas.«
»Untersteh dich, dem Kerl nachzurennen!«
Schon wieder ein Befehl, schon wieder eine Drohung! Mit einem Ruck wandte Barbara sich von ihrem Vater ab.
»Warte, Alex!«, rief sie.
Als sie vom Tisch aufsprang, riss sie mit einer Rüsche ihres Kleides ein Glas um. Ohne darauf zu achten, beugte sie sich zu ihrer Mutter und drückte sie so fest an sich, wie sie nur konnte. »Ich liebe dich, Mama«, sagte sie mit eiligen, abgerissenen Worten. »Aber Papa lässt mir keine Wahl.« Dann richtete sie sich auf und drehte sich noch einmal zu Albin herum. »Das verzeihe ich dir nie!«
Alex wartete auf sie. Ohne nach links oder rechts zu schauen, durchschritt Barbara den Saal und hakte sich bei ihm unter. Alle Blicke waren nun auf sie gerichtet, niemand unternahm mehr den Versuch, seine Neugier zu verbergen. Barbara spürte, wie ihr Unterkiefer zitterte, und hatte Angst, in Tränen auszubrechen. Die wenigen Meter bis zur Tür erschienen ihr wie ein endlos langer Marsch.
In der Halle trat ihnen Karl-Heinz Luschnat in seiner SA-Uniform entgegen und verstellte ihnen den Weg. »Ich weiß nicht, wer Ihre Beschützer sind«, sagte er und blickte Alex mit hasserfüllten Augen an. »Aber es müssen verdammt mächtige Leute sein.«
Alex stieß ihn beiseite. »Was reden Sie da für einen Unsinn?«
»Mit so was wie Ihnen machen wir sonst kurzen Prozess! Darauf können Sie Gift nehmen!«
4
Mit seinem Lackschuh stieß Alex die Tür auf und trug Barbara über die Schwelle ihrer dunklen Wohnung. Erst im Schlafzimmer ließ er sie zu Boden gleiten.
»Wenn du nicht möchtest«, flüsterte er, »ich meine, nach allem, was passiert ist, wir müssen es nicht heute tun.«
Barbara knipste das Licht an. Sie nahm sein Gesicht zwischen ihre Hände und schaute ihn an. »Doch, Alex, ich möchte es.«
Sie wusste nicht, ob sie sich täuschte, doch für einen Augenblick schien es ihr, als ob er rot geworden wäre.
Mit einem Grinsen blinzelte er ihr zu: »Dann gehe ich jetzt wohl mal ins Bad.«
Sie hatte zwar keine genauen Vorstellungen, wie das zwischen Brautleuten üblich war, aber irgendwie hatte sie angenommen, dass sie sich gemeinsam ausziehen würden. Danach hätte sie ihre Mutter fragen sollen! Nun musste sie sich den Arm verrenken, um die Knöpfe am Rückenausschnitt ihres Kleides zu öffnen. Über den Flur konnte sie hören, wie Alex die Badezimmertür schloss.
Sie ging ans Fenster und machte die Vorhänge zu. Dann zog sie sich aus. Als sie die Wäsche auf den Stuhl legte, sah sie sich plötzlich im Spiegel. Sie konnte kaum glauben, dass sie das war: eine nackte Frau, die sich ihr ungeniert entgegenbeugte, obwohl sie nichts am Körper trug als eine goldene Kette um den Hals, von der ein Amulett herabhing.
Für eine Sekunde überlegte Barbara, ob sie Alex so empfangen sollte, wie sie war. Schon wieder eine Frage, auf die sie keine Antwort hatte! Mit einem Seufzer nahm sie ihr Nachthemd aus der Reisetasche und streifte es sich über.
Das Herz klopfte ihr bis zum Hals, als sie die kühle Bettdecke auf ihrer Haut spürte. Vom Bad her hörte sie Alex’ Schritte näher kommen. Was sie gleich miteinander tun würden, wusste sie zwar ungefähr, aber sie hatte keine Ahnung wie. Barbara beschloss, einfach abzuwarten, was er tat, und sich ihm ganz anzuvertrauen.
Als er hereinkam, lächelte sie ihn zärtlich an. Scheu, fast schüchtern erwiderte er ihr Lächeln. Dann löschte er das Licht und legte sich zu ihr.
»Hab keine Angst«, flüsterte er, während er an ihre Seite glitt. »Ich werde ganz vorsichtig sein.«
»Das brauchst du nicht«, flüsterte sie zurück. »Fühl mal, wie sehr ich mich auf dich freue.«
Sie nahm seine Hand und führte sie an ihre Brust, damit er den Schlag ihres Herzens spürte. Sanft umfing seine Hand ihren Busen. »Komm«, sagte sie. »Komm zu mir, mein Schatz.«
»Ich glaube«, sagte er so leise, dass sie ihn kaum verstand, »ich bin genauso aufgeregt wie du.«
Für einen Augenblick war sie verdutzt. Was meinte er damit? Dann ging ihr ein Licht auf. »Ist es für dich auch das erste Mal?«
In dem dunklen Raum konnte sie sein Gesicht nur ahnen. Doch sie glaubte zu erkennen, dass er nickte.
»Aber warum hast du mir das nicht gleich gesagt?«
»Bitte, lach mich nicht aus.«
»Aber ich lach dich ja gar nicht aus.« Sie nahm ihn in den Arm und küsste ihn. »Es ist doch viel schöner so.« Dann richtete sie sich auf und streifte sich ihr Nachthemd über den Kopf. »Komm«, sagte sie noch einmal, »ich helfe dir …«
Draußen schlug eine dunkle, einsame Glocke. Zwei Uhr. Mit diebischer Freude betrachtete Barbara den nackten Körper ihres Mannes, der, vom Licht des Mondes beschienen, an ihrer Seite lag und schlief, ein seliges Lächeln im Gesicht. Er war ihr so nah gewesen, wie zwei Menschen einander nur nah sein können. Jetzt war sie wirklich seine Frau, und niemand auf der Welt, auch nicht ihr Vater, konnte etwas daran ändern.
Sie selbst war noch viel zu aufgewühlt, um zu schlafen. Behutsam, um Alex nicht zu wecken, löste sie sich aus seiner Umarmung und stand auf. Nackt, wie sie war, verließ sie das Zimmer und betrat den Flur. Es war ein prickelndes Gefühl, ohne ein Stück Stoff am Körper durch die Wohnung zu gehen, ohne Scham oder Angst, dass jemand sie sah. Im Gegenteil, wenn jemand sie sah, dann würde es Alex sein, und die Vorstellung erregte sie. Irgendwann, beschloss sie, wenn sie ein bisschen vertrauter miteinander waren, wollte sie dafür sorgen, dass das Licht anblieb.
Mit ihren bloßen Füßen ging sie in Richtung Bad. Sie wollte sich waschen. Ein kleiner, herrlicher Gedanke zuckte ihr durch den Kopf. Wer weiß, vielleicht hatte sie schon ein Kind empfangen? Alex würde so ein wunderbarer Vater sein … Zum Glück waren sie sich beide darin einig, dass sie Kinder wollten.
Doch statt ins Bad ging sie in die Küche. Warum sollte sie sich waschen? Sie hatte Hunger. Ihre Schwiegereltern hatten in der Wohnung übernachtet, vielleicht hatten sie etwas Essbares eingekauft. Sie öffnete die Vorratskammer. Im Kasten fand sie ein halbes Schwarzbrot. Dann musste sie lächeln. Neben dem Brot war ein Töpfchen Griebenschmalz, mit einem Zettel von Alex: »Damit Du nicht verhungern musst, mein Engel.«
Während sie das Brot bestrich, erinnerte sie sich, wie sie ihn kennengelernt hatte. Das war jetzt drei Jahre her, auf einem Ausflug mit ein paar BDM-Mädchen und Studenten nach Wieck, den ausgerechnet Karl-Heinz Luschnat organisiert hatte. Ausgerechnet, weil Karl-Heinz ihr selber den Hof machte und sich nicht die geringste Mühe gab, das zu verbergen. Er war gerade Gruppenführer geworden, und jeder sagte ihm eine glänzende Karriere in der Waffenfabrik voraus. Eine Verbindung mit Barbara und ihrer Familie wäre die Krönung seiner Pläne gewesen.
Barbara empfand ihn als einen wichtigtuerischen Streber, der noch dazu fast doppelt so alt war wie sie. Während des ganzen Ausflugs war sie darum vor allem damit beschäftigt, sich ihn vom Leib zu halten. Das war auch der Grund, warum sie am »Utkiek« das Fahrgastschiff verpasste, mit dem die anderen auf dem Ryck weiterfuhren. Als sie sich umdrehte, stand Alex auf der alten, hölzernen Klappbrücke hinter der Anlegestelle und lächelte sie an. Im Gegensatz zu ihr hatte er offenbar mit Absicht das Schiff verpasst.
»Sind Sie schon mal in Eldena gewesen?«, fragte er.
Natürlich kannte sie die alte Klosterruine. Doch weil sie ihn sympathisch fand, mit seinen leuchtenden Augen und den vielen Sommersprossen auf der hübschen kleinen Nase, schüttelte sie den Kopf, und zusammen machten sie sich auf den Weg.
»Studieren Sie noch oder haben Sie Heimaturlaub?«, fragte sie, als sie nach ein paar Minuten die Ruine erreichten, ein einsames, umbuschtes, haushohes Fenstergemäuer, das mit starken Pfeilern neben einer Hütte aufragte. Dahinter konnte man bis aufs Meer sehen.
»Ich studiere – noch. Bis zum Examen. Dann muss ich einrücken.«
»Und was ist Ihr Fach?«
»Physik.«
»Auweia!«, rutschte es ihr heraus.
»Warum auweia? Was möchten Sie denn später studieren?«
»Mein Vater meint, ein Studium sei nichts für Mädchen«, sagte sie. »Aber das ist mir egal. Wenn ich das Abitur erst habe, studiere ich auch – und zwar Musik!«
»Dann haben unsere Fächer ja doch etwas miteinander gemeinsam.«
»Physik und Musik? Nie im Leben!«
»Und ob!«, beharrte er mit einem Lächeln. »Das Gemeinsame ist die Mathematik.«
Barbara musste laut lachen. »Das wird ja immer schöner!«
»Soll ich’s Ihnen beweisen?«, fragte er und schaute sie herausfordernd an.
»Da bin ich aber gespannt!«
»Sie wissen, was eine Oktave ist?«
»Wollen Sie mich beleidigen? Der achte Ton der Tonleiter natürlich!«
»Entschuldigen Sie«, sagte er und wurde für einen Moment rot. Doch als er weitersprach, war von der kurzen Verunsicherung nichts mehr zu merken. »Und woran erkennen Sie, dass es genau der achte Ton ist?«
»Das hab ich im Gehör!«
»Ich gratuliere Ihnen zu Ihren Ohren! Doch woher wissen es Ihre Ohren?«
Jetzt musste Barbara passen.
»An den Schwingungen!«, sagte er. »Der achte Ton der Tonleiter hat exakt doppelt so viele Schwingungen wie der Grundton. Eins durch zwei gleich Oktave.«
»Kann schon sein«, sagte Barbara. »Aber für mich ist Musik viel mehr. Musik ist Gefühl, Hingabe, Leidenschaft.«
Alex schüttelte den Kopf. »Musik ist vor allem Vernunft!«, erwiderte er, ebenso ruhig wie entschieden. »Sie ist nichts anderes als in Töne verwandelte Mathematik! Haben Sie schon mal überlegt, warum Männer und Frauen fast immer in Oktaven singen?«
»Was für eine komische Frage! Weil es harmonisch klingt natürlich!«
»Aber warum klingt es harmonisch? Doch nur, weil die Oktave doppelt so schnell schwingt und trotzdem der gleiche Ton ist. Sie spaltet die Einheit in zwei Teile, und das Ergebnis ist die Wiederholung desselben, das gleichzeitig etwas anderes ist.«
Barbara dachte nach. »Sie meinen, wie zwei Hälften, die zusammengehören?«
»Genau! Die Oktave ist das vollkommene Symbol der Einheit. Und es ist allgegenwärtig.« Er trat durch das hohe Steinfenster der Ruine und schaute auf das Meer hinaus. Am Horizont senkte sich die Nacht über das Wasser, und in der Abenddämmerung konnte man die ersten Sterne ahnen. »Das ganze Weltall ist ein einziges gigantisches System von Schwingungen. Wir können in der Physik die Frequenzen aller Planeten berechnen und die Schwingungszahlen zueinander in Beziehung setzen.«
»Und wie soll das gehen?«
»Ganz einfach, durch Oktavieren. Sie müssen nur die Winkelgeschwindigkeiten der Planetenbewegung an den Extrempunkten ihrer Ellipsen messen. Das hat schon Kepler getan. Und auf diese Weise im Kosmos die sieben Ur-Harmonien ermittelt, Oktave, Quinte, Quarte und so weiter, mit unwiderlegbarer mathematischer Konsequenz.«
Sie brauchte eine Weile, um seine Worte zu verdauen. Lieber Himmel, war das kompliziert! Plötzlich fiel bei ihr der Groschen. »Heißt das«, fragte sie voller Staunen, »dass die Sterne singen?«
Irritiert drehte er sich zu ihr um. Dann lächelte er sie an. »So hätte ich es zwar nicht ausgedrückt, aber eigentlich haben Sie recht: Ja, genauso ist es – der ganze Kosmos singt!«
»Ich hätte nie gedacht«, sagte Barbara, »dass Physik so romantisch sein kann.«
»Pardon«, erwiderte er ein wenig hastig und wurde ein weiteres Mal rot. »Ich wollte keinen romantischen Unsinn erzählen, und wenn sich mein Gerede so angehört hat, tut es mir leid.«
»Schade«, sagte Barbara.
»Schade was?«
Sie schaute zu Boden. Auf einmal hatte sie das Gefühl, selbst ein bisschen rot zu werden. »Schade, dass Sie sich so gegen Romantik sträuben«, sagte sie leise.
Eine Haarsträhne hatte sich aus ihrer Frisur gelöst und hing ihr im Gesicht. Sie wusste selbst nicht warum, aber sie traute sich nicht, sie einfach wie sonst beiseitezublasen. Sie stand nur da und schaute zu Boden. Plötzlich spürte sie seine Berührung auf ihrer Haut. Ruhig, ohne ein Wort, doch so selbstverständlich, als hätte er es schon viele, viele Male getan, hob er ihr Kinn, blickte sie mit seinen leuchtenden blauen Augen an und strich ihr die Strähne aus dem Gesicht.
Den Weg zur Anlegestelle hatten sie anschließend schweigend zurückgelegt. Sie hatten sich weder geküsst noch irgendwelche Zärtlichkeiten ausgetauscht, nicht einmal Händchen hatten sie gehalten. Doch seit diesem Tag wusste Barbara, dass Alex der Mann war, mit dem sie den Rest ihres Lebens zusammen sein wollte. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick, es war viel mehr: Es war Gewissheit.
Sie fröstelte. Inzwischen wurde es ihr ohne Kleider doch ein bisschen kalt. Sie stand vom Küchentisch auf, räumte Teller und Messer in die Spüle und stellte das Schmalztöpfchen in die Vorratskammer. Dann kehrte sie ins Schlafzimmer zurück.
»Alex«, flüsterte sie, nachdem sie zu ihm unter die Decke geschlüpft war.
»Ja, mein Engel?«, murmelte er.
»Ich möchte, dass du mir etwas versprichst.«
»Alles, was du willst.« Er schlug die Augen auf und blinzelte sie an. »Nur nicht, dass ich mir die Nase abbeiße.«
»Ich meine es ernst, Alex.« Sie sah ihn eindringlich an. »Versprich mir, dass du nie auf meinen Vater hörst. Dass du dich nie freiwillig an die Front zurückmeldest. Dass du nie unser Glück aufs Spiel setzt, egal, ob wir es verdient haben oder nicht. – Versprichst du mir das?«
Er nahm sie in den Arm und küsste sie. »Ja, Barbara. Das verspreche ich dir. Großes Hochzeitsehrenwort.«
5
Greifswald, im Januar 1945
Liebste Mama,
Du weißt ganz genau, wie sehr ich Briefeschreiben hasse! Warum zwingst Du mich dann dazu? Das ist jetzt schon mein 17. Anlauf, und ich habe immer noch keine Antwort von Dir. Telefonieren probiere ich schon gar nicht mehr. Entweder komme ich nicht durch, oder wenn doch, dann hat die Markwitz offenbar Anweisung, meine Anrufe abzuweisen.
Papa ist ja so ein Dickschädel!! Als wäre das Leben nicht auch so schon schwer genug. Aber er soll sich ja nicht einbilden, dass ich klein beigebe. Solange er nicht alles zurücknimmt, werde ich keinen Fuß auf Daggelin setzen. Nie, niemals!!! Bitte sag ihm das von mir. Vor allem soll er sich bei Alex’ Eltern entschuldigen. Hat er wenigstens das inzwischen getan?
Das Weihnachtsfest war wunderschön. Alex und ich haben zuerst die Kirche besucht, und danach haben wir den Baum angezündet und uns einen ganz romantischen Abend gemacht, nur wir zwei. Wir haben uns bei der Hand gehalten, in die Flammen geschaut und leise all die schönen Lieder gesummt.
Ach, liebste Mamutschka, warum kann ich Dich nicht anlügen? Weihnachten war überhaupt nicht schön. Das erste Weihnachtsfest, das ich nicht auf Daggelin verbracht habe … An Heiligabend habe ich schon beim Frühstück geweint, und den ganzen Tag über war ich so schlecht gelaunt, dass ich fast mit Alex Streit angefangen hätte, nur weil er am Nachmittag noch eine Stunde in seinem Institut gearbeitet hat. Als Pastor Wollenweber in der Predigt dann auch noch sagte, dass der Krieg nicht eher enden würde, als bis Friede in die Herzen der Menschen eingekehrt sei, war meine Stimmung ganz dahin. Woher soll dieser Friede denn kommen? Wenn man mittags nur noch zwischen elf und zwei kochen kann, weil das Gas rationiert ist, und man beim Fleischer für ein paar Suppenknochen fast betteln muss? Wir sind nach dem Abendessen gleich ins Bett gegangen.
Gott sei Dank, dass Alex bei mir ist! Ich wüsste nicht, wie ich es ohne ihn aushalten sollte. Er ist so ein wunderbarer Ehemann. Obwohl er sich jeden Tag in die Arbeit stürzt, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt (er sagt immer: »Wenn Beten nicht hilft, dann Arbeit!«), findet er immer wieder Zeit, zusammen mit mir zu lesen oder Radio zu hören oder mir beim Einrichten der Wohnung zu helfen. Abends ist er allerdings meistens so müde, dass er schon vor mir ins Bett geht.
Ich bin sicher, Alex wird einmal ein bedeutender Physiker. Von seiner Dissertation verstehe ich zwar nicht mal den Titel (es geht um Atome, das sind so winzig kleine Teilchen, dass man sie nicht mal sehen kann), außerdem ist alles so geheim, dass er gar nicht darüber reden darf, aber ich spüre, wie wichtig ihm seine Arbeit ist. Wenn ich je eine Rivalin fürchten muss, dann seine Arbeit. Die liebt er fast so sehr wie mich – doch zum Glück nur fast!
Ach, Mamutschka, jetzt habe ich wieder einen langen Brief geschrieben, obwohl ich das Briefeschreiben doch hasse. Daran kannst Du sehen, wie sehr ich Dich vermisse. Manchmal, wenn es an der Tür klingelt, stelle ich mir vor, Du stehst da, um uns zu besuchen. Wie schön wäre das! Aber dann ist es doch nur der Gasmann, der jetzt jede Woche den Stand abliest.
Sei ganz herzlich gegrüßt und umarmt von
Deiner Barbara
PS. Eben kommt Alex mit einer Nachricht nach Hause, die alle unsere Pläne über den Haufen wirft. Sein Institut soll nach Dresden verlagert werden! Der genaue Termin steht noch nicht fest, aber Alex sagt, ich soll am besten gleich mit Packen beginnen. Wir werden erst mal bei seinen Eltern wohnen. Mein Gott, wie soll das alles nur enden?
Schloss Daggelin, 7. Februar 1945
Liebe Barbara,
wenn ich Dir heute schreibe, geschieht dies ohne Wissen Deines Herrn Vaters. Doch die Umstände zwingen mich dazu.
Hier geht es drunter und drüber. Die Flüchtlingstrecks haben derart zugenommen, dass sie nicht länger auf den Vorwerken versorgt werden können. Sie breiten sich jetzt auch auf Daggelin selbst aus. Im Hof, in den Scheunen, ja sogar im Schloss kampieren wildfremde Menschen! Es sieht aus wie in Wallensteins Lager.
Vorgestern wurde Dein Herr Vater zum Volkssturmführer ernannt, und drei von den Mädchen haben sich zum Wehrmachthelferinnenkorps gemeldet. Deine Mutter steht fast ohne Hilfe da. Die wenigen eigenen Leute, die uns noch geblieben sind, haben alle Hände voll zu tun, um den Betrieb aufrechtzuerhalten; außerdem müssen sie die Zwangsarbeiter im Zaum halten, die täglich frecher und aufmüpfiger werden.
Bitte komm! Wir brauchen Dich dringend! Komm, so schnell Du nur kannst!
Herzliche Grüße und Heil Hitler!
Elisabeth Markwitz
Gutssekretärin
6
Von ferne, im diffusen Licht der Abenddämmerung, wirkte Daggelin wie ein verwunschenes Märchenschloss. Barbara sah es, nachdem sie endlich den Ortsausgang von Boddenhagen passiert hatte. Mit seinen Türmchen, Giebeln und Erkern, die von weißen Schneehauben bedeckt waren, erhob sich das Schloss vor dem grauen Wolkenhimmel weithin sichtbar auf seiner Anhöhe über die weite Winterlandschaft, durch die sich endlose schwarze Züge im Schritttempo dahinschleppten, eine stumme, gewaltige Prozession: Menschen und Tiere mit Vehikeln aller Art, Fuhrwerken und Motorrädern, Lastwagen und Tretrollern, Autos und Handkarren.
Zum Glück hatte Barbara sich erst in Boddenhagen in den Treck einreihen müssen. Wie in einem Nadelöhr kamen hier die verschiedenen Ströme auf ihrem Weg von Ost nach West zusammen. Bis dahin war sie mit ihrem Dixi auf kleinen Nebenstraßen einigermaßen zügig vorangekommen, obwohl die Fahrt bei der Schneeglätte oft zur gefährlichen Rutschpartie wurde. Sie hatte Alex am Morgen in Greifswald zur Bahn gebracht. In der Stadt selbst war die Lage noch halbwegs normal gewesen. Alex’ Zug, der über Berlin nach Dresden fuhr, hatte mit nur einer Stunde Verspätung den Bahnhof verlassen.
Alle paar Meter musste sie anhalten, weil irgendwo auf der Straße einer der überladenen Leiterwagen umgekippt oder mit Radbruch liegen geblieben war. Nervös trommelte Barbara mit den Fingern auf dem Lenkrad. Je näher sie Daggelin kam, desto unruhiger wurde sie. Was würde sie auf dem Schloss erwarten? Knapp vier Monate waren seit ihrer Hochzeit vergangen. Seitdem hatte sie ihre Eltern weder gesehen noch gesprochen. Wie würde ihr Vater reagieren, wenn er sie plötzlich sah? Würde er überhaupt mit ihr sprechen? Er war imstande, sie wie eine Zigeunerin vom Hof zu jagen. Und wenn sie zehnmal die Eigentümerin von Alt-Daggelin war.
Es war schon dunkel, als sie den Gutshof erreichte. Im Haupttor hatten sich die Fuhrwerke eines ankommenden und eines aufbrechenden Trecks ineinander verkeilt. Barbara parkte ihr Auto abseits der Einfahrt und stieg aus. Ohne dass jemand Notiz von ihr nahm, als wäre sie eine Fremde, quetschte sie sich an den wiehernden und ausschlagenden Pferden vorbei durch das Tor in den Hof.
Was für ein Paradies hatte sie verlassen, und was für ein Tohuwabohu fand sie nun vor! Überall flackerten offene Feuer, an denen abgekocht wurde, überall liefen Menschen hin und her, in den wunderlichsten Kleidern, wie bei einem riesigen, makabren Kostümfest, rufend und winkend, jeder schien etwas zu brauchen und zu suchen. Manche hatten ihre Möbel von den Leiterwagen geholt und zu kleinen Gruppen zusammengestellt, wie Zimmer unter freiem Himmel, mit einem Teppich aus Schnee und Morast.
Plötzlich sah sie ihren Vater, keine zwei Meter vor ihr, in einem Uniformmantel und mit einer Volkssturmmütze auf dem Kopf. Er stieg gerade von einem Fuchswallach, Troll, seinem alten Trakehner. Als er sich umdrehte, trafen sich ihre Blicke. Sein Gesicht drückte völlige Überraschung aus, und in seinen Augen blitzte etwas auf. War es Freude? Oder war es Zorn?
»Barbara …«
Er ließ die Zügel aus der Hand gleiten und machte zwei Schritte auf sie zu. Für eine Sekunde hatte Barbara alles vergessen, sie wollte auf ihn zulaufen und ihn umarmen. Doch plötzlich musste sie wieder daran denken, was er ihr angetan hatte, an ihrem Hochzeitstag.
Bevor er ein weiteres Mal den Mund aufmachen konnte, warf sie den Kopf in den Nacken und sagte: »Ich bin nur gekommen, um Mama zu helfen!«
Ohne ihm die Hand zu geben, ließ sie ihn stehen und lief ins Haus. Sie fand ihre Mutter in der großen Leuteküche, auf der Rückseite des Hühnerhofs, in der es von fremden Menschen nur so wimmelte. Ein Blick auf Hildes Erscheinung genügte, um Barbara zu sagen, dass sie keine Minute zu früh gekommen war.