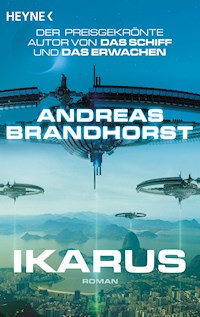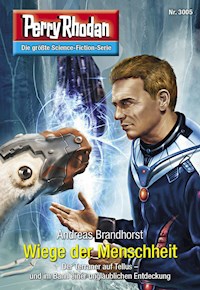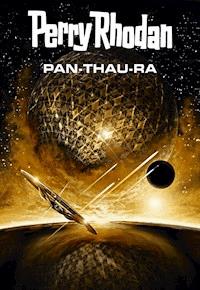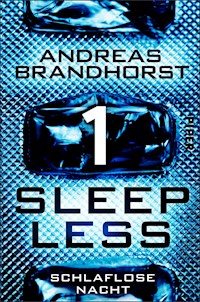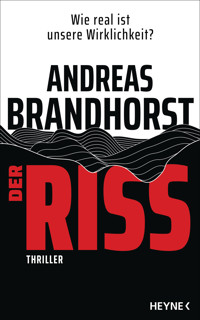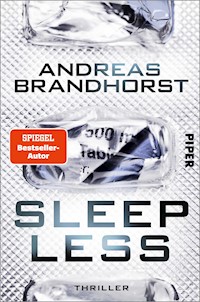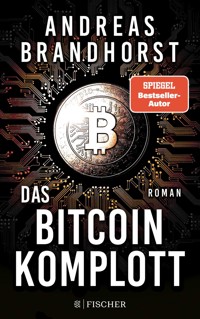
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der neue Wirtschaftsthriller zur Bitcoin-Revolution. Von Bestseller-Autor Andreas Brandhorst. Die Weltwirtschaft schlittert in die Krise. Eine Gruppe Investoren rund um den Finanzmagnaten Francis Forsythe attackiert die angeschlagenen Notenbanken, um Bitcoin als neue Leitwährung durchzusetzen. Doch die alten Mächte wehren sich mit allen Mitteln. Der Schlüssel zu Erfolg und Misserfolg liegt in der Geschichte und hat mit Satoshi Nakamoto zu tun, dem Erfinder der Digitalwährung, dessen Identität noch immer ein Geheimnis ist. Als Martin Freeman, Journalist und Buchautor, ihm durch einen Zufall auf die Spur kommt, gerät er in größte Gefahr. Für Fans von Marc Elsberg, Andreas Eschbach und Tom Hillenbrand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 725
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Andreas Brandhorst
Das Bitcoin-Komplott
Thriller
Thriller
Über dieses Buch
Die Weltwirtschaft schlittert in die Krise. Eine Gruppe Investoren rund um den Finanzmagnaten Francis Forsythe attackiert die angeschlagenen Notenbanken, um Bitcoin als neue Leitwährung durchzusetzen. Doch die alten Mächte wehren sich mit allen Mitteln. Der Schlüssel zu Erfolg und Misserfolg liegt in der Geschichte und hat mit Satoshi Nakamoto zu tun, dem Erfinder der Digitalwährung, dessen Identität noch immer ein Geheimnis ist. Als Martin Freeman, Journalist und Buchautor, ihm durch einen Zufall auf die Spur kommt, gerät er in größte Gefahr.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Andreas Brandhorst, geboren 1956 im norddeutschen Sielhorst, zählt mit Thrillern wie Das Erwachen, Die Eskalation und Sleepless und Science-Fiction-Romanen wie Das Schiff und Omni zu den erfolgreichsten Autoren unserer Zeit. Spektakuläre Zukunftsvisionen sind sein Markenzeichen. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Literaturpreise. Andreas Brandhorst hat dreißig Jahre in Italien gelebt und ist inzwischen in seine alte Heimat in Norddeutschland zurückgekehrt.
Weitere Informationen finden Sie aufwww.tor-online.de und www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2022 Andreas Brandhorst
Für die deutsche Erstausgabe:
© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign
Coverabbildung: Aliaksandr Marko / Adobe Stock
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491560-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
»Eigentlich ist es gut, dass die Menschen der Nation unser Banken- und Geldsystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh.«
Henry Ford (1863–1947), Gründer der Ford Motor Company
»Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation, und es interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht.«
Mayer Amschel Rothschild (1744–1812), Gründer der Rothschild-Banken-Dynastie
»Der Verfall seiner Währung ist wohl das größte Unglück, das ein Volk treffen kann. Selbst ein verlorener Krieg bringt ihm nicht so einen schweren Schaden wie der Ruin des Geldwesens.«
Alfred Lansburgh (»Argentarius« 1872–1937), Bankier, Vom Gelde
»Es gibt keine subtilere und auch keine sicherere Methode, einer Gesellschaft ihre Grundlagen zu entziehen, als die Zerstörung ihrer Währung. … und kaum einer unter einer Million versteht das wirklich.«
John Maynard Keynes (1883–1946), britischer Ökonom
Prolog
Ein Sturm braute sich zusammen, über dem Meer und auf der ganzen Welt.
Francis Forsythe beobachtete, wie sich der Himmel verfinsterte und düsteres Grau die Silhouetten der Orkney-Inseln im Norden und Nordosten verschlang. Der Wind türmte die Wellen zu hohen Brechern auf, schmetterte sie tief unten gegen die Klippen von Dunnet Head und schickte ein dumpfes Donnern zum alten Leuchtturm.
Forsythe stand neben den Spiegeln mit der Lampe, die zum letzten Mal vor einigen Jahren geleuchtet hatte. Er liebte diesen Ort hoch in Schottlands Norden. Hier konnte selbst er für einige Stunden das Drama vergessen, das sich hinter den Kulissen der Welt anbahnte.
Langsam ging er weiter, zwischen Lampe und Fensterwand, bis er Klippen und Meer auf der rechten und das karge Land auf der linken Seite hatte.
Ein kleiner Wagen weiß wie Schnee kam über das schmale graue Band der Straße und hielt auf dem Parkplatz vor dem Leuchtturm, direkt neben der silbergrauen Limousine, und aus dem weißen Wagen stieg ein Mann, Anfang dreißig, mit kurzem blonden Haar und gekleidet in einen kobaltblauen Anzug – Simon.
Für einen Moment stand er im Wind und trotzte hoch aufgerichtet den Böen. Dann ging er zur Limousine, klopfte ans Fenster der Beifahrerseite und stieg ein.
Der neue Bericht, dachte Forsythe.
Er war stehen geblieben, den nachdenklichen Blick auf den Parkplatz gerichtet. Eine knappe Minute verging, bevor sich die Fahrertür der silbergrauen Limousine öffnete und ein würdevoller Mittsiebziger ausstieg. Anthony – Butler, Sekretär und manchmal auch eine Art Resonanzboden – sah am Leuchtturm hoch, bevor er zur Treppe ging.
Forsythe drehte sich um und blickte wieder über das stürmische Meer. Ihm blieben noch zwei oder drei Minuten, bis Anthony eintraf, bis die andere Welt zurückkehrte, die er eigentlich nie verlassen hatte.
Der Butler erschien früher als erwartet und war ein wenig außer Atem. »Simon hat den neuen Bericht gebracht, Sir. Er rät Ihnen, sich die Zahlen sofort anzusehen. Es ist sehr wichtig, betont er.«
Zahlen, dachte Forsythe und spürte, wie sich vertraute Aufregung in ihm entfaltete.
Er nickte. »Kehren wir zum Haus zurück.«
Mit seinen dicken steinernen Mauern und dem fast bis zum Boden reichenden Dach schien sich das Haus im Sturm zu ducken. Es war keine Villa, sondern ein einfaches kleines Gebäude, vor zehn Jahren von jemandem erbaut, der das schottische Hochland mochte, dem die Einsamkeit aber schon bald zu viel geworden war. Er hatte das Haus nicht weit vom Leuchtturm entfernt beim kleinen See namens Loch of Easter Head errichtet und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, darunter eine Internetverbindung per Satellitenlink, aber die Stille an diesem Ort konnte schwerer sein als die großen grauen Mauersteine.
Es war Abend geworden. Der Wind warf Regen gegen die dunklen Fenster, die den Flammenschein des Kaminfeuers widerspiegelten.
Francis Forsythe saß am Feuer, in einem üppig gepolsterten breiten Sessel, und las den neuen Bericht auf seinem Tablet. Anthony und Simon hatten am Tisch Platz genommen und sprachen leise miteinander, aber er nahm sie gar nicht wahr. Zahlen sprangen ihm entgegen und erzählten spannende Geschichten. Die anderen hielten ihn für jemanden, der genau rechnete und kühl abwog, bevor er Entscheidungen traf, und das stimmte auch. Aber wenn ihm die Zahlen von ihrer Bedeutung erzählten, von ihren Zusammenhängen und Verbindungen, fühlte er sich wie ein Kind, das ein aufregendes Buch las.
Er fragte sich, ob es dem jungen, adretten und hochintelligenten Simon ähnlich erging, wenn er mit seinen Analysen und Bewertungen beschäftigt war. Vielleicht brauchte man ein besonderes Talent, um die Stimme der Zahlen zu hören.
Mit knappen Wischbewegungen blätterte Forsythe durch den Bericht und folgte der Geschichte vom bevorstehenden Ende der Welt. Eine Stunde verging, dann eine zweite. Gelegentlich verließ Anthony seinen Platz am Tisch und legte Feuerholz nach. Simon wartete geduldig.
Schließlich ließ Forsythe das Tablet sinken und klappte die Schutzabdeckung zu. Nachdenklich blickte er in den Kamin und beobachtete den Tanz der Flammen.
»Nun?«, fragte der junge Simon, als er seine Neugier nicht mehr im Zaum halten konnte. »Wie beurteilen Sie die Situation, Mister Forsythe?«
Der ließ sich einige Sekunden Zeit, bevor er antwortete: »Was ist Ihre Meinung, Simon?«
Anthony saß dem jungen Analysten gegenüber, trank einen Schluck Tee und hörte aufmerksam zu.
»Die Situation ist ernst«, sagte Simon. »Die Regierungen müssen umgehend handeln. Ich habe bereits offizielle Empfehlungen vorbereitet. Nächste Woche beim G20-Gipfel in Paris …«
Er unterbrach sich, als Forsythe den Kopf schüttelte.
»Seit wann arbeiten Sie für Amethyst Prognosis, Simon? Seit zwei Jahren, nicht wahr?«
»Sie haben mich vor zwei Jahren und drei Monaten in Ihr Team geholt, Sir.«
»Weil Sie ein guter Analyst sind. Fast hätte Whitestone Sie mir weggeschnappt.« Forsythe gestattete sich ein kurzes Lächeln. »Sie haben einen sehr klaren Blick für die einzelnen Bilder. Doch manchmal kommt es nicht so sehr auf die Details an, sondern auf das gröbere Raster des großen Bilds.«
»Sie meinen die makroökonomischen Zusammenhänge?«
»Ich meine noch viel mehr als das.«
»Das Knäuel«, warf Anthony ein.
Forsythe nickte.
»So nennt Mister Forsythe das größte der großen Bilder, das Gesamtbild«, erklärte Anthony dem jungen Simon.
»Ein Knäuel«, bestätigte Forsythe. »Mit vielen Knoten, kaum zu entwirren. Wem es gelingt, ins Innere dieses Knäuels zu schauen …«
»… der ist anderen Beraterfirmen und Investmentfonds gegenüber im Vorteil«, spekulierte Simon.
»Denn er weiß, was geschehen wird. An den Börsen. Am Aktienmarkt. In der Politik. Überall auf der Welt.«
»Was haben Sie gesehen?«, fragte Simon. »Was wird geschehen?«
Forsythe blickte erneut ins Feuer. Der Butler kannte seinen Herrn gut und hatte verstanden. »Wie schlimm ist es, Sir?«
»Noch schlimmer, als ich bisher befürchtet habe«, sagte Forsythe ernst. »Die alte Welt geht zu Ende. Wir haben oft über den Zusammenbruch gesprochen, Anthony. Als eine Möglichkeit.«
»Als Hypothese, Sir. Als ein Schreckensbild.«
Forsythe seufzte schwer. »Manchmal werden Albträume wahr.«
Simon sah ihn aus großen Augen an.
»Wie viel Zeit bleibt uns noch, Sir?«, fragte Anthony.
»Einige wenige Wochen. Vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr, wenn die Regierungen die drastischen Maßnahmen ergreifen, die wir ihnen empfehlen werden. Aber sie können die Lawine nur verlangsamen, nicht aufhalten.« Forsythe stand auf. Wind und Regen hatten offenbar nachgelassen. Die Fenster waren dunkel und still. »Geben Sie den anderen Bescheid, Anthony. Wir müssen uns so bald wie möglich treffen.«
»Soll ich sie herbestellen, Mister Forsythe?«, fragte der Butler und erhob sich ebenfalls.
»Nein, es würde zu lange dauern, bis alle hier sind. Wir brechen sofort auf und fahren zurück nach London. Dort werden die Sieben beraten, wie man die Welt vielleicht noch retten kann.«
Martin Freeman
1
Martin hörte, wie sich hinter ihm die Tür des großen Arbeitszimmers öffnete.
»Wie sieht’s aus?«, fragte seine Schwester Jasmin.
Er drehte sich halb um. Barfuß stand sie da, das blonde Haar struppig, der türkisblaue kaftanartige Kittel voller Flecken. Die großen nussbraunen Augen hatten ihren Glanz verloren, und sie war noch etwas blasser als sonst.
»Hast du die ganze Nacht gemalt?«, fragte Martin.
»Ein neues Bild«, sagte sie und kam einige Schritte näher. »Vielleicht krieg ich’s diesmal richtig hin.« Sie deutete auf den breiten, gewölbten Monitor, der fast von einer Seite des Schreibtischs zur anderen reichte. »Wie ist die Lage? Müssen wir die Villa verkaufen?« Jasmin lächelte schief. Vom Trading verstand sie nicht viel.
»Es ist alles in Ordnung. Die Kurse steigen.« Martin wies nicht darauf hin, dass einige der Altcoins stark gesunken waren. Er verdankte es nur einer rechtzeitig platzierten Verkaufsorder, dass sich seine Verluste in Grenzen hielten. Aber der Bitcoin stieg, und nur das zählte.
»Irgendwann verzockst du dich, und dann ist Schluss«, befürchtete Jasmin.
»Mach dir keine Sorgen. Wir können weiterhin hier wohnen.« Martin fügte seinen Worten eine Geste hinzu, die dem ganzen Anwesen galt: der Villa mit Blick auf den Genfer See, die ihre Eltern gebaut hatten, den drei Nebengebäuden und dem großen parkartigen Garten.
»Manchmal frage ich mich, ob du nicht einfach nur Glück hast.«
Martin lachte kurz. »Glück gehört dazu«, sagte er und dachte: Aber das Glück ist ein unzuverlässiger Verbündeter.
Jasmin stand wie verloren da. »Es ist seltsam. Du verdienst viel Geld mit Trading, möchtest aber jemand anders sein, ein berühmter Buchautor. Und ich …« Sie verzog das Gesicht. »Ich weiß gar nicht, wer ich bin und wer ich sein möchte.«
Plötzlich wusste Martin, warum seine Schwester zu ihm gekommen war. Er stand auf, ging zu ihr und umarmte sie.
»Du bist Jasmin«, sprach er leise in ihr Ohr. »Und du wirst eine große Malerin sein. Aber jetzt …« Er wich ein wenig zurück und hielt sie an den Schultern. »Geh schlafen.«
»Möchtest du das Bild sehen?«
Ihm blieb noch eine Stunde bis zu dem Treffen, das er am vergangenen Abend vereinbart hatte. Zeit genug.
Jasmin führte ihn in ihr Atelier. Das Fenster bot Blick in den Garten hinter der Villa. Hohe Bäume, Eichen und Buchen, spendeten im Sommer angenehmen Schatten. Der Herbst hatte ihre Farben verändert, sie schienen ein buntes Gewand zu tragen.
Auf mehreren fleckigen Werktischen lagen Tuben, Blätter mit Entwürfen, manche von ihnen halb zerknüllt, und zahlreiche Pinsel. Ein kleinerer runder Tisch blieb Paletten vorbehalten, einige von ihnen aus poliertem Holz, die anderen aus Porzellan oder Metall. Farbspritzer bedeckten die weißen und beigefarbenen Wände – Jasmin hatte mit ihnen ein »skurriles Ambiente« schaffen wollen.
Die Leinwand auf der Staffelei am Fenster präsentierte vor allem rote, gelbe und braune Farbtöne, darin eingebettet ein Gesicht mit weit aufgerissenen Augen und den Mund zu einem Schrei geöffnet.
Martin betrachtete es eine Zeitlang.
Jasmin sah ihn von der Seite an. »Na? Was sagst du?«
Unbehagen erfasste Martin. »Nicht schlecht. Ich meine, ziemlich gut. Hast du dich von Edvard Munch inspirieren lassen?«
»Munch?«
»Das Bild ähnelt ein bisschen dem Schrei.«
Jasmin starrte auf die Leinwand.
»Wen stellt es da?«, fragte Martin. »Wer schreit dort?«
Seine Schwester antwortete nicht. Sie hatte plötzlich Tränen in den Augen.
»Es ist ein gutes Bild«, sagte Martin. »Sehr ausdrucksvoll.« Er legte ihr den Arm um die Schultern. »Komm.«
Er führte sie in ihr Zimmer, das wie immer den Eindruck erweckte, als wäre es seit Tagen nicht aufgeräumt worden. Laken und Decke waren so zerwühlt, als hätte im Bett ein Kampf stattgefunden.
Jasmin sank auf die Matratze, ohne dass er nachhelfen musste. Als er sie zudeckte, hatte sie bereits die Augen geschlossen, und für einen Moment dachte er, dass sie eingeschlafen war, erschöpft nach der langen Nacht. Doch dann hob sie plötzlich die Lider und sah zu ihm hoch.
»Ich habe mich selbst gemalt«, sagte Jasmin.
»Schlaf jetzt.« Er zog ihr die Decke hoch bis zum Kinn. »Es wird alles gut.«
Jasmin schloss wieder die Augen, und eine Minute später schlief sie tatsächlich.
Martin sah auf sie hinab. Die meiste Zeit über ging es ihr gut, aber manchmal pendelte ihre Stimmung innerhalb kurzer Zeit wie bei einer bipolaren Störung zwischen Euphorie und Depression. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, ob sie ärztliche Hilfe brauchte.
Er kehrte ins Arbeitszimmer zurück, aber seine Gedanken blieben bei Jasmin.
Begonnen hatte es vor vier Jahren, kurz nach dem tragischen Autounfall, dem ihre Eltern zum Opfer gefallen waren. Zwei Tote, ein Schwerverletzter, er selbst; Jasmin hatte nur leichte Verletzungen erlitten. Vielleicht fühlte sie sich schuldig, weil sie mit ein paar Schrammen davongekommen war. Ihre Flucht in die Malerei nahm Martin hin, denn das geerbte Vermögen gab ihnen beiden genug Spielraum.
Stellte das Bild, das sie in der vergangenen Nacht gemalt hatte, eine Warnung dar? Und wenn ja, wovor warnte es?
Martin verscheuchte die düsteren Gedanken. Ein wichtiges Treffen stand bevor, ein Gespräch mit Vincent Moreau, einem Broker mit einer Vergangenheit, in der es einige dunkle Stellen gab. Von ihm erhoffte er sich wichtige Informationen über einen Mann, der zur Legende geworden war: Satoshi Nakamoto.
2
»Woher haben Sie meine Telefonnummer?«, fragte Vincent Moreau. »Sie ist nicht gerade allgemein bekannt.«
Sie saßen in einem kleinen Café beim Park der Universität von Genf. An den anderen Tischen drängten sich junge Leute, die meisten von ihnen vermutlich Studenten. Nur einige wenige trugen Atemmasken mit Cartoon-Motiven, sicheres Zeichen einer überfälligen Sars-Impfung; gerade in der Schweiz nahm man diese Regeln sehr ernst. Andere präsentierten das Zeichen der erneuerten Impfung ganz offen, ein kleines blaues oder rotes Dreieck an der Schläfe oder auf dem Handrücken. Es ermöglichte gewisse Vergünstigungen und Privilegien, zum Beispiel beim Besuch öffentlicher Veranstaltungen. Fälschungen waren nur unter großem Aufwand möglich, denn die winzigen Striche und Punkte, aus denen das Dreiecksmuster bestand, bildeten einen Mikrocode, der sich mit einem Scanner leicht überprüfen ließ.
»Ihr Name stand auf einer Liste, die zum Vermächtnis meines Vaters gehörte«, antwortete Martin, was nur die halbe Wahrheit war oder vielleicht nur ein paar Prozent davon, zumal Moreaus aktuelle geheime Telefonnummer ganz gewiss nicht auf dieser Liste stand. Auf seine besonderen Kontakte wies Martin jedoch nicht hin, die sollten sein Geheimnis bleiben.
Moreau musterte ihn. Er war ein unauffälliger Mann Anfang sechzig, mit Halbglatze und so schlank, dass er fast dürr wirkte. Nichts an ihm verriet, dass er zu den bedeutendsten Finanzjongleuren der Schweiz und vielleicht in ganz Europa gehörte.
»Ich hoffe, es war keine schwarze Liste«, sagte er ruhig. »Sie ähneln ihm. Die Augen und das Kinn erinnern mich an David. Gott sei seiner Seele gnädig. Mein Beileid.«
Das klang irgendwie seltsam, fand Martin.
»Doppeltes Beileid«, fügte Moreau hinzu. »Ihre Mutter kam bei dem Unglück ebenfalls ums Leben, nicht wahr? Sie sind noch jung, es muss Sie ziemlich hart getroffen haben.«
»Es war schwer, insbesondere für meine Schwester. Aber wir sind darüber hinweg.«
Moreau lehnte sich zurück, mit beiden Händen an der Tischkante, und musterte ihn erneut. »Warum haben Sie mich angerufen, Mister Freeman? Oder sollte ich besser ›Herr‹ Freeman sagen? Als was fühlen Sie sich? Als Amerikaner wie Ihr Vater? Als Deutscher wie Ihre Mutter Katharina? Oder vielleicht als Schweizer, weil Sie hier in Genf aufgewachsen sind?«
»Ich fühle mich als Mensch«, sagte Martin und kam zum Thema zurück. »Sie haben vor Jahren mit meinem Vater zusammengearbeitet, bei Bordier & Cie, einer der letzten großen Privatbanken in der Schweiz.«
»So groß ist sie eigentlich gar nicht«, wandte Moreau ein. »Sie hat nur noch sieben Geschäftsstellen, soweit ich weiß, und die Anzahl der Mitarbeiter ist auf knapp zweihundert geschrumpft.«
»Aber das verwaltete Vermögen ist in den letzten Jahren gestiegen«, hielt Martin dagegen. »Von knapp dreizehn Milliarden Franken auf zwanzig, der größte Teil davon in Investmentfonds. Und seit der europäischen Deregulierung auch in Kryptowährungen.«
»Zwanzig Milliarden«, wiederholte Moreau. »Im internationalen Maßstab sind das Peanuts.«
»Es hat schon mal jemand von Peanuts gesprochen und ist damit gehörig ins Fettnäpfchen getreten«, erinnerte Martin.
Moreau nickte kurz. »Hilmar Kopper im April 1994, wenn ich mich richtig erinnere. Damals war er Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank. 2007 holte er den späteren neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Ackermann in die Firma.«
»Ein Fettnäpfchentreter gab dem anderen die Klinke in die Hand.«
»So könnte man es nennen, Mister Freeman. Das Victory-Zeichen hätte sich Ackermann damals nach der Gerichtsverhandlung sparen können, es war wirklich dumm.« Dass sich Moreau so genau daran erinnern konnte, war für Martin ein Hinweis dafür, dass der Mann Anfang sechzig zu dieser Zeit schon im Geschäft gewesen war.
Moreau zögerte kurz. »Sie haben mir noch immer nicht gesagt, warum Sie sich unbedingt mit mir treffen wollten.«
Martin sah sich um. An den anderen Tischen wurde laut gesprochen und gelacht, und die beiden Kellnerinnen bewegten sich wie in einem schnellen Tanz, während sie den Gästen Kaffee und Brioches brachten.
Ein Mann in mittleren Jahren betrat das Café, mit grau meliertem Haar, hoher Stirn und schmalen Wangen. Er trug eine cremefarbene Stoffhose, ein Flanellhemd und eine hellbraune Lederjacke, und an der rechten Schläfe zeigte sich ein daumennagelgroßes karmesinrotes Impfzeichen. Er ging zu dem kleinen Ecktisch, der gerade frei geworden war, setzte sich und bestellte Kaffee und Kuchen.
»Als Sie und mein Vater Bordier & Cie verließen, kam es zu einem Skandal«, nahm Martin das Gespräch wieder auf.
In Moreaus Gesicht kam es zu einer subtilen Veränderung. Er zog die Hände von der Tischkante und legte sie so auf die Armlehnen des Stuhls, als wollte er aufstehen. »Wenn es Ihnen darum geht, vergeuden Sie meine Zeit.«
»Nein, bitte, bleiben Sie sitzen. Darum geht es mir nicht. Ich meine, es gab damals Verhandlungen und Vergleiche, mein Vater hat viel Geld verloren …«
»Das ist nicht meine Schuld«, betonte Moreau.
»Ich werfe Ihnen nichts vor«, versicherte Martin. »Bitcoin. Darum geht es mir. Ich schreibe ein Buch darüber.«
»Das haben Sie am Telefon erwähnt. Ein Buch über Bitcoin. Das ist alles?«
»Es wird ein sehr wichtiges Buch.« Es klang fast so, als wollte er sich selbst davon überzeugen. »Ich erkläre darin die Gründe, warum der Bitcoin schon bald den US-Dollar als Leitwährung der Welt ablösen wird. Und ich habe vor, die Identität von Satoshi Nakamoto zu enthüllen.«
Moreau schwieg einige Sekunden. »Und deshalb wenden Sie sich an mich?«
»Sie und mein Vater gehörten zu den ersten Bankern, die nach der Deregulierung mit Bitcoins gearbeitet haben. Der damalige Skandal hatte ebenfalls damit zu tun. Nein, nein«, sagte Martin schnell, »ich will Sie nicht danach befragen, versprochen. Mir geht es vor allem um den Bitcoin und Nakamoto. Es heißt, dass Sie Kontakt zu ihm hatten. 2009, als alles begann.«
»Wer sagt das?«, fragte Vincent Moreau.
Martin zog ein kleines Tablet aus der Jackentasche, kaum größer als ein Smartphone, klappte es wie ein Buch auf und drehte es, damit Moreau das Display sehen konnte.
»Was ist das?«
»Ein Forumsbeitrag, den ein gewisser ›1966nextworld‹ geschrieben hat und in dem er ein Gespräch mit ›Satoshi N.‹ erwähnt.«
Moreau zuckte mit den Schultern. »Was habe ich damit zu tun?«
»Das Testament meines Vaters enthielt mehrere Passwörter, die mir vollständigen Zugriff auf seine Computer gaben«, erklärte Martin. »Zum Glück, denn andernfalls wären die Private Keys und damit seine Bitcoins für immer verloren gewesen. In mehreren Dateien fand ich Aufzeichnungen von Forumsbeiträgen und Gesprächen in verschlüsselten Chatrooms. Einige Beiträge bringen Sie mit dem Nickname ›1966nextworld‹ in Verbindung.«
Wieder schwieg Moreau einige Sekunden lang.
»Interessant«, sagte er schließlich. »Was haben Sie sonst noch in den Computern Ihres Vaters entdeckt?«
»Haben Sie Satoshi Nakamoto damals kennengelernt?«, fragte Martin. »Wissen Sie, wer er ist oder war?«
Moreau überlegte. »Was wissen Sie über Bitcoin, Mister Freeman?«
»Ich weiß genug darüber, um damit zu traden«, lautete die verärgerte Antwort.
»Was wissen Sie von den Anfängen?«
Martin fragte sich, ob Moreau ihn auf die Probe stellen wollte.
»Satoshi Nakamoto hat den Bitcoin erfunden, im Jahr 2008, vermutlich unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise, ausgelöst durch die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers ein Jahr zuvor. Ich nehme an, er plante den Bitcoin als eine Art Gegenentwurf zum vorherrschenden Währungssystem, denn der Bitcoin unterliegt keiner staatlichen Kontrolle.«
»Digitales Gold«, sagte Vincent Moreau. »Eine harte Währung, die den Menschen Sicherheit und Schutz bieten soll. Eine Möglichkeit, Vermögen in Zeiten von hoher Inflation des Fiatgeldes, also des gewöhnlichen Geldes, zu bewahren. Eine Zuflucht für alle, die Ruin und Armut fürchten.«
»Eine Revolution«, sagte Martin. »Geld, das seinen Wert behält, weil es nicht von irgendwelchen Zentralbanken nach Belieben gedruckt werden kann. Demokratisches Geld, auf das staatliche Organe keinen Einfluss nehmen können. 2008 veröffentlichte Satoshi Nakamoto sein Bitcoin-White-Paper, und ein Jahr später kam es zur Implementierung einer Open-Source-Software, der Blockchain, einer Art digitalem Kassenbuch, in dem alle Transaktionen verzeichnet und validiert werden. Damit war der Bitcoin geboren.«
»Es war keine leichte Geburt«, entgegnete Moreau. »Eine Zeitlang dümpelte der Bitcoin vor sich hin. Kaum jemand interessierte sich dafür. Kennen Sie die Geschichte von den beiden großen Pizzen?«
Martin nickte. »Die erste Bitcoin-Transaktion, die ein physisches Gut betraf.« Dafür brauchte er keine Gedächtnisstütze, er steckte das Tablet wieder ein. »Am 18. Mai 2010 schrieb jemand namens Laszlo im ›Bitcoin Forum‹: ›Ich werde 10000 Bitcoin für zwei große Pizzen zahlen.‹ Er fügte an, dass die Pizzen auch zu ihm geliefert werden sollten und welche Zutaten er wünschte. Laszlo fand die Vorstellung cool, etwas mit Bitcoin kaufen zu können, mehr steckte nicht dahinter. Am 22. Mai berichtete er im Forum vom erfolgreichen Kauf der beiden Pizzen für zehntausend Bitcoin. Damit ging er in die Geschichte ein, denn zum ersten Mal war etwas mit Bitcoin gekauft worden. Besser und klüger wäre es gewesen, hätte Laszlo seine zehntausend Bitcoin zur Seite gelegt und gewartet – sie wären heute gut eine Milliarde US-Dollar wert.«
»Wäre die große Spekulationsblase vor drei Jahren nicht geplatzt, wären sie noch viel mehr wert«, sagte Moreau. »Die Marktkapitalisierung des Bitcoin stieg auf vier Billionen Dollar. Heute liegt sie bei etwa zweieinhalb Billionen. Laszlo war ein dummer Mann ohne Weitblick.«
»Wer immer damals Bitcoins gekauft und behalten hat, ist heute reich«, fuhr Martin fort. »Das gilt insbesondere für Satoshi Nakamoto. 2009 und 2010 hat er über eine Million Bitcoin geschürft. Insgesamt sollen sich 1125150 in seinem Besitz befinden, mehr als hundert Milliarden US-Dollar nach dem aktuellen Kurs. Sind das ebenfalls Peanuts, Monsieur Moreau? Es wäre genug, um so manchen Staatshaushalt zu sanieren!«
Vincent Moreau schwieg. Sein Gesicht gab nichts preis.
»Niemand weiß, wer hinter dem Namen Satoshi Nakamoto steckt, der wahrscheinlich ein Pseudonym ist«, sprach Martin weiter. »Nakamoto trat nie an die Öffentlichkeit, gab sich nie zu erkennen. Er wurde zur Legende. Andere versuchten, Nakamotos Ruhm und Reichtum für sich zu beanspruchen, zum Beispiel Craig Wright, Jörg Molt und einige andere. Aber sie alle wurden als Betrüger entlarvt.«
Moreau sah ihm in die Augen. »Haben Sie es darauf abgesehen? Auf Ruhm und Reichtum?«
»Ich behaupte nicht, Nakamoto zu sein.«
»Aber Sie würden gern herausfinden, wer er ist«, sagte Moreau. »Deshalb haben Sie mich angerufen und um ein Treffen gebeten. Sie möchten in Ihrem Buch Nakamotos Identität enthüllen und dadurch berühmt werden.«
»Es wäre ein Knüller«, gestand Martin. »Es würde dem Buch zweifellos zum Erfolg verhelfen.«
»Aber vielleicht gehen Ihre Hoffnungen noch weiter«, spekulierte Moreau. »Vielleicht glauben Sie, Zugang zu über einer Million Bitcoin zu erhalten, wenn es Ihnen gelingt, Satoshi Nakamoto zu identifizieren.«
»Nein«, widersprach Martin, »ich habe es nicht auf sein Geld abgesehen. Mein Vater hat mir genug Bitcoins hinterlassen.«
»Solange der Kurs steigt, ist alles in bester Ordnung.« Moreau beugte sich vor und trank den Rest seines kalt gewordenen Kaffees. »Aber wenn es erneut zu einem Kursrutsch kommt wie vor drei Jahren, sähe die Sache anders aus, nicht wahr? Ein guter Trader sollte eine solche Möglichkeit nie außer Acht lassen. Außerdem liebt Ihre Schwester teure Einkäufe. Wenn sie sich schlecht fühlt, was gelegentlich passiert, macht sie eine Tour durch die nobelsten Boutiquen von Genf. Wie lange können Sie das noch bezahlen?«
Es gefiel Martin ganz und gar nicht, was er da hörte. »Haben Sie mich ausspioniert?«
»Oh, ›ausspioniert‹ ist ein dummes Wort, Mister Freeman. Ich habe mich informiert, weil ich gern über die Menschen Bescheid weiß, mit denen ich mich an einen Tisch setze.«
Er wollte das Gespräch beenden und gehen, Martin spürte es.
»Haben Sie Nakamoto gekannt?«, fragte er schnell. »Lebt er noch? Wissen Sie, wie ich ihn erreichen kann?«
»Ich fürchte, Sie haben sich zu viel von mir versprochen, Mister Freeman. Ich weiß nicht, wer Satoshi Nakamoto ist. Ich weiß nicht einmal, ob er noch lebt. Aber ich bin nicht ganz mit leeren Händen gekommen.« Er holte seine Brieftasche hervor, entnahm ihr einen kleinen, gefalteten Umschlag und legte ihn auf den Tisch. »Das habe ich Ihnen mitgebracht.«
Martin nahm den Umschlag und öffnete ihn. Er enthielt eine SD-Karte.
»Eine kleine Hommage an Ihren Vater. Ein Dankeschön für einen Gefallen, den er mir damals getan hat, für eine Information, ohne die ich nicht hier säße. Die Daten auf der Karte ermöglichen Ihnen einen Blick in die nahe Zukunft. Die Deutsche Bank, über die wir vorhin gesprochen haben, spielt dabei übrigens eine nicht unbeträchtliche Rolle.«
Moreau stand auf.
»Vielleicht können Sie die Daten für Ihr Buch verwenden«, fügte er hinzu. »Oder dazu, den Rest Ihres Vermögens in Sicherheit zu bringen. Leben Sie wohl, Mister Freeman.«
Damit ging er, bezahlte am Tresen und verließ das Café.
Martin sah ihm nach, steckte den Umschlag in die Jackentasche und machte sich auf den Heimweg.
Der Mann mit dem grau melierten Haar wartete eine halbe Minute, nachdem Martin das Café verlassen hatte. Dann legte er eine Banknote auf den Tisch, stand auf und trat nach draußen.
Ein kühler Herbstwind rauschte in den Baumwipfeln des Universitätsparks.
Der Mann knöpfte sich seine Lederjacke zu, schlug den Kragen hoch, hob sein Smartphone ans Ohr und erstattete Bericht.
Die Sieben – Francis Forsythe
3
Der Himmel über London wurde dunkel und die Stadt zum Lichtermeer.
Im achten Stock eines vor wenigen Jahren errichteten Büroturms saß Francis Forsythe mit dem Rücken zum Fenster an seinem Schreibtisch. Die drei großen Computermonitore vor ihm zeigten letzte Berichte und den Plan, den er selbst entwickelt hatte und den er in wenigen Minuten den Sieben präsentieren wollte. Es war kein perfekter Plan, einige Schwachstellen ließen sich nicht leugnen, aber Forsythe hielt die Risiken für vertretbar.
»Sir?«
Anthony hatte das Büro betreten, nachdem er kurz angeklopft hatte. In einem dunkelgrauen Anzug stand er da, wie immer in eine Aura der Würde gehüllt.
»Sind alle anwesend?«, fragte Forsythe.
»Ja, Sir. Sie warten im Konferenzraum.«
»Lassen Sie das Buffet eröffnen, Anthony.«
»Das habe ich bereits veranlasst, Sir.«
»Wer kam als Erster, wer als Letzter?«, fragte Forsythe.
»Mister Kowalkow traf zwanzig Minuten vor den anderen ein und führte mehrere Telefongespräche über eine sichere Verbindung«, antwortete Anthony. »Miss Xanadu kam drei Minuten nach den anderen.«
Manchmal gab die Reihenfolge des Eintreffens Auskunft über die Hierarchie. »Hat sie etwas dabei?«
»Sie trägt Computerlinsen und einen Mikrotransponder im linken Ohr.«
»Xanadu kommt nie ohne ihr kleines Spielzeug«, bemerkte Forsythe. »Ich nehme an, im Showroom ist alles bereit?«
»Seit einer Stunde, Sir.«
»Gut.« Forsythe nickte.
Anthony ging zur Tür, seine Schritte lautlos auf dem dicken Teppich.
»Wie ist die Stimmung bei den anderen?«, schickte ihm Forsythe hinterher.
Der Butler blieb stehen und drehte sich um. »Erwartungsvoll, Sir.«
»Haben Sie einen Rat für mich, Anthony?« Diese Frage stellte er nicht zum ersten Mal. Anthony Wilkinson, Butler und Sekretär, war manchmal auch Berater und sogar ein Freund.
Anthony überlegte. »Die anderen kennen natürlich die Berichte, aber ich glaube, sie alle sehen nur Teile des großen Bildes und werden überrascht sein. Mein Rat lautet: Folgen Sie Ihrem Weg, Sir.«
Forsythe stand auf. »Sagen Sie ihnen, dass ich in einer halben Stunde da sein werde. Sie sollen das Buffet genießen.«
»Sehr wohl, Sir.« Anthony verließ das Büro und schloss die Tür hinter sich.
Francis Forsythe wandte sich vom Schreibtisch ab, trat zum Fenster und sah über die Stadt. Die Londoner Filiale von Amethyst Prognosis befand sich im elften Stock eines Büroturms in der City, unweit der St Mary Axe, wo sich »The Gherkin« erhob, die »Gewürzgurke«, ein hundertachtzig Meter hoher Wolkenkratzer, entworfen vom Architekten Norman Foster, dem die Deutschen die neue Reichstagskuppel und die Franzosen das Viaduc de Millau verdankten. Für Forsythe hatte »The Gherkin« nie wie eine Gurke ausgesehen, eher wie eine futuristische Rakete, bereit zu einer langen Reise und der Erforschung fremder Welten. In früheren Jahren hatte er, wenn er nicht mit Zahlen und Analysen beschäftigt war, darüber phantasiert, mit dem Raumschiff aufzubrechen, das sich nur wenige Hundert Meter entfernt erhob.
Forsythe betrachtete den Lichterteppich und dachte an die Millionen Menschen, die in London ihr Leben lebten, ohne etwas von dem Abgrund zu ahnen, vor dem sie alle standen. Nach dem Austritt aus der Europäischen Union erholte sich London, und mit der Metropole erholten sich auch die Regionen, die vom einstigen United Kingdom übrig geblieben waren. Unabhängigkeit und steuerliche Vergünstigungen waren zum Fundament eines anhaltenden Aufschwungs geworden.
Viele der Menschen dort draußen glaubten, das Schlimmste überstanden zu haben, aber sie irrten sich. Das Schlimmste stand erst noch bevor, und es hatte nichts mit der EU zu tun.
Forsythe kehrte zum Schreibtisch zurück, sah sich noch einmal den Plan an und übertrug die Daten schließlich in sein Tablet. Dann fuhr er den Computer herunter und machte sich auf den Weg.
Zwei Minuten vor Ablauf der halben Stunde betrat er den Konferenzraum.
4
»Meine Damen und Herren, ich grüße Sie«, sagte Francis Forsythe mit einem freundlichen Lächeln.
Zwei seiner Gäste – Jurij Kowalkow aus Russland, der als Erster eingetroffen war, und Desna Laghari aus Indien – saßen mit Tellern und Gläsern am runden Tisch in der Mitte des etwa vierzig Quadratmeter großen Konferenzraums. Drei weitere – Jiang Taiji aus China, Pauline Laurent aus Kanada und Samuel »Sammy« Winster aus den USA – standen am Buffet, wählten Leckerbissen aus und ließen sich dabei von den beiden Kellnern beraten. Xanadu betrachtete die bunten tropischen Fische im großen Aquarium an der linken Wand.
»Sie haben sich Zeit gelassen«, knurrte Jurij, der manchmal sehr direkt sein konnte. Die tiefe Stimme schien nicht recht zu dem kleinen, blassen Mann zu passen, der vor wenigen Wochen in Moskau seinen sechzigsten Geburtstag gefeiert hatte. Forsythe kannte ihn als Drahtzieher zwischen Kreml, Oligarchen und den russischen Geheimdiensten. Er tanzte auf gefährlichem Parkett, ohne jemals ins Straucheln zu geraten.
Forsythe deutete eine Verbeugung an. »Dafür bitte ich ausdrücklich um Entschuldigung. Es war gut investierte Zeit, wenn ich so sagen darf.«
»Was ist so wichtig, dass Sie ein persönliches Treffen für notwendig halten, Mister Forsythe?«, fragte Pauline. In der linken Hand hielt sie inzwischen einen Teller mit verschiedenen Meeresfrüchten und dunklen Oliven. Eine von ihnen spießte sie mit einer kleinen silbernen Gabel auf, steckte sie in den Mund und sah Forsythe mit gewölbten Brauen an.
Mit ihren siebenundfünfzig Jahren war sie noch immer eine sehr schöne Frau, auf eine unaufdringliche, zurückhaltende Art. Sie trug einen dunkelgrünen Hosenanzug, der gut zu ihrem schulterlangen schwarzen Haar passte. An der schlichten Halskette hing ein unauffälliger, in Gold eingefasster Edelstein klar wie Glas. Forsythe vermutete, dass es sich um einen Diamanten handelte, vielleicht mehrere Millionen Neue Britische Pfund wert. Pauline Laurent liebte teuren, unauffälligen Schmuck. Es war vielleicht ihre einzige Schwäche.
Unter der Ägide ihrer Familie war CanCore zum größten Rohstoffkonzern der Welt geworden, mit einem Börsenwert von hundertfünfzig Milliarden US-Dollar. Zwanzig Jahre lang hatte Pauline Laurent als Aufsichtsratsvorsitzende die Geschicke von Canadian Core geleitet und mit Zink, Nickel, Kobalt, Blei, Uran und nicht zuletzt Diamanten, die in ihrem Leben eine besondere Rolle spielten, viel Geld verdient und wichtige Kontakte in Wirtschaft und Politik überall auf der Welt geknüpft. Doch Pauline hatte schon früh die Zeichen der Zeit erkannt und auch Anteile an Unternehmen außerhalb der Rohstoffmärkte erworben, um CanCore künftigen Krisen gegenüber zu wappnen.
Vor einigen Jahren war sie in den Ruhestand gegangen, hatte aber weiterhin erheblichen Einfluss auf die Geschäftsführung und gehörte nach wie vor zu den Personen, deren Entscheidungen Folgen für die ganze Weltwirtschaft nach sich zogen. Vor allem ihr Netz aus wichtigen Kontakten machte sie zu einem Angelpunkt von Industrie und Politik, zumal sie Freundschaften zu Staatspräsidenten und Premierministern rund um den Globus pflegte, dabei jedoch darauf achtete, immer im Hintergrund zu bleiben.
»Was auch immer der Grund sein mag, ich bin sehr dankbar für die Einladung«, verkündete Samuel »Sammy« Winster aus New York fröhlich. »Sie gab mir Gelegenheit, eine kleine Auszeit zu nehmen und noch einmal diese wundervolle Stadt zu besuchen.«
Forsythe nickte ihm zu. Mit seinen neununddreißig Jahren war Winster der Jüngste der Sieben, ein extrovertierter Mann, der gern lächelte und lachte. Doch in seinen Augen verbarg sich eine dunkle Tiefe, erkennbar nur für jemanden, der es verstand, hinter die Maske zu blicken.
Sammy Winster war Vorstandsvorsitzender von Whitestone, des größten Vermögensverwalters der Welt. Er gebot über siebzehn Billionen US-Dollar, mehr als das Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union, ein großer Teil davon angelegt in Pensionsfonds und ETFs, börsengehandelten Fonds.
Winster hatte vor zwei Jahren die Nachfolge von Salomon Fray angetreten, des Mannes, der Whitestone 1988 gegründet hatte und auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen war. Böse Zungen behaupteten, dass Winster hinter Frays plötzlichem Tod steckte, aber die Erben und Konkurrenten hatten ihm nichts nachweisen können.
»Es gibt viel zu sehen in London«, sagte Forsythe unverbindlich. »Aber zuerst werden Sie hier etwas zu sehen bekommen.«
»Das klingt interessant«, sagte Desna Laghari und untermalte ihre Worte mit einem sanften Lächeln. Die schlanke Inderin trug einen opalblauen Sari und war einundfünfzig Jahre alt. Forsythe verglich sie mit einer hübschen Blume, die zu verblühen begann. Von Delhi aus leitete sie »GoWi« beziehungsweise »Golden Wisdom«, einen Investmentfonds, dem die neue große Mittelschicht Indiens ihr Geld anvertraute. Außerdem war sie Erbin der Laghari-Holding mit Anteilen an den wichtigsten Industrien in Indien und Südostasien.
Desna Lagharis Einfluss auf Asiens Wirtschaft war fast ebenso groß wie der des schweigsamen achtundvierzig Jahre alten Jiang Taiji aus Peking, von dem es hieß, dass sich der chinesische Aktienmarkt so entwickelte, wie er es wollte. Er leitete »Shuguang«, was in Mandarin »Morgenröte« bedeutete: ein Konsortium aus zweiundneunzig großen Unternehmen, dem sich auch Huawei und Alibaba angeschlossen hatten. Vermutlich hatte Jiang Taiji auch direkte Verbindungen in den chinesischen Staatsapparat, aber wenn es deshalb in ihm zu Loyalitätskonflikten kam, ließ er sich nichts anmerken.
Forsythe hatte zunächst gezögert, ihn den Sieben hinzuzufügen, doch ohne ihn wäre die Runde nicht komplett gewesen. Immerhin betrug Chinas Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt inzwischen dreiundzwanzig Prozent.
Forsythe blieb zwischen Buffet und Tisch stehen. »Gefallen Ihnen die Fische, Xanadu?«
Niemand kannte ihren vollständigen Namen. Niemand wusste, wo sie geboren war und wann. Ihr Alter ließ sich schwer schätzen, zwischen vierzig und fünfzig, vermutete Forsythe. Vor fünfzehn Jahren hatte sie die Softwareschmiede »Extra« geschaffen, damals ein kleines Start-up in Kaliforniens Silicon Valley, das mit einer Marktkapitalisierung von fast drei Billionen Dollar inzwischen den ersten Platz der größten börsennotierten Unternehmen belegte, noch vor Apple und Microsoft. »Extra« entwickelte KI-Systeme und bot überall auf der Welt Aus-einer-Hand-Lösungen an: nicht nur die Software, sondern auch perfekt darauf abgestimmte Hardware.
In den vergangenen beiden Jahren war mehrmals versucht worden, in das »Andromeda« genannte Computersystem von Amethyst Prognosis einzudringen, und Forsythe vermutete, dass »Extra« dahintersteckte, aber Beweise gab es nicht.
Xanadu wandte sich von dem großen Aquarium ab. »Ich bin einmal zwischen solchen Fischen geschwommen«, sagte sie, ging langsam zum Tisch und wählte einen Platz, wobei sie einen leeren Stuhl zwischen sich und sowohl Jurij als auch Desna ließ, wie Forsythe bemerkte. »Beziehungsweise getaucht. In der Karibik.« Mit einem geheimnisvollen Lächeln fügte sie hinzu: »In einem anderen Leben.«
Forsythe fragte sich, was sie damit meinte.
Sie trug rote Schuhe mit hohen Absätzen, aber nicht zu hohen, und ein dunkles Röhrenkleid, das sich eng an ihren schlanken Körper schmiegte, aber nicht zu eng, und an manchen Stellen aus silbernen Metallfacetten zu bestehen schien. Die Computerlinsen gaben ihren Augen einen goldenen Ton, fast die gleiche Farbe wie das lange blonde Haar.
Xanadu »die Exotin«, wie die anderen sie manchmal nannten. Wer sie zum ersten Mal sah, hatte den Eindruck, einem Menschen aus einer anderen Welt zu begegnen.
Natürlich wusste sie um ihre Wirkung, und sie ging ganz bewusst damit um. Es gehörte zu dem Mythos, den sie für sich erschaffen hatte.
»Ich hoffe, das Buffet ist nach Ihrem Geschmack«, sagte Forsythe. »Falls Sie besondere Wünsche haben, wenden Sie sich bitte an die Kellner oder an Anthony.«
Sein Butler und Sekretär stand neben der Tür, nicht nur als Bediensteter, sondern auch als Beobachter.
Jurij Kowalkow schob seinen Teller zurück. »Warum sind wir hier?«, fragte der kleine Mann mit der tiefen Stimme.
Jiang, Pauline und Sammy kamen vom Buffet zum Tisch, setzten sich aber nicht. Forsythe blieb ebenfalls stehen.
»Ich habe Sie hierhergebeten, weil wir die Welt retten müssen«, sagte er.
Einige Sekunden lang herrschte Stille.
Pauline sah ihn groß an und schien sich zu fragen, ob er sich einen Scherz erlaubte. Xanadu neigte ein wenig den Kopf, und für einen Moment sah Forsythe den Transponder in ihrem linken Ohr.
»Keine Kleinigkeit«, kommentierte Desna.
»Vorhin haben Sie gesagt, dass wir hier etwas zu sehen bekommen«, erinnerte Sammy. »Was wollen Sie uns zeigen?«
Forsythe deutete zum Buffet. »Wenn Sie noch etwas essen oder trinken möchten …«
»Dazu hatten wir eine halbe Stunde lang Zeit«, sagte Jurij Kowalkow. »Von mir aus kann es losgehen.«
Die anderen nickten.
»Also gut.« Forsythe ging zur Tür auf der anderen Seite des Tisches. »Bitte folgen Sie mir.«
5
Auf dem großen Tisch im Showroom bildeten Tausende von bunten Dominosteinen lange Schlangen, die über ein sorgfältig gestaltetes Gelände führten, vorbei an kleinen Hügeln oder über sie hinweg, durch Tunnel und über Brücken. Ab einigen Stellen erhoben sich Räder, Schaukeln und mechanische Vorrichtungen mit Stangen und Wippen. Ein Absperrband verhinderte, dass jemand direkt an den Tisch herantreten konnte.
»Domino?«, fragte Pauline verwundert.
»Ein Spiel?«, fügte Jurijs Bass hinzu.
Forsythe ging zu einem zweiten, wesentlich kleineren Tisch, auf dem eine Fernbedienung lag. Damit schaltete er den an der Wand hinter dem großen Tisch angebrachten Bildschirm ein.
Eine Tabelle erschien dort und erklärte die Farben der Dominosteine. Sie repräsentierten Banken, Industrien, Versicherungen, Pensionsfonds, staatliche Institutionen und gesellschaftliche Ereignisse wie Streiks, Massenproteste und Vandalismus.
»Einen neuen Rekord brechen Sie damit nicht, Francis«, sagte Xanadu mit ihrer melodischen Stimme. »Es sind nicht genug Steine. Ich glaube, der aktuelle Rekord liegt bei fast fünf Millionen. Dies hier sind …«
»Anthony?«, fragte Forsythe.
»Es sind neuntausendneunhundertvierzehn Steine, Sir«, lautete die Antwort.
Forsythe gab den anderen ein wenig Zeit, die Anordnung zu betrachten.
Jiang und Pauline gingen langsam am Absperrband entlang zur linken Seite. Samuel Winster, Jurij und Desna traten zur rechten Seite. Xanadu blieb vorne stehen, bei Forsythe und Anthony.
Sammy grinste, streckte die Hand aus und tat so, als wollte er einen Dominostein kippen. Als er Forsythes Blick bemerkte, zog er die Hand wieder zurück.
»Keine Angst, ich verderbe Ihnen nicht die Show«, sagte er.
»Deshalb sind wir hier?«, brummte Jurij. »Um uns ein Dominospiel anzusehen?«
»Er wird sich etwas dabei gedacht haben«, war Xanadu überzeugt. »Nicht wahr, Francis?«
Forsythe drehte sich halb um. »Anthony?«
Der würdevolle Mann im dunklen Anzug ging zum Absperrband und löste es von einer der dünnen Stangen, an denen es befestigt war. »Sir?«
Forsythe trat durch die Lücke und zum Tisch.
»Was passiert, wenn ich einen der Dominosteine kippen lasse?«, wandte er sich an die anderen.
»Das ist nicht schwer zu erraten«, antwortete Pauline Laurent. »Die Steine werden fallen, einer nach dem anderen.«
»Wollen wir es ausprobieren?« Forsythe lächelte und wartete einige Sekunden, bevor er sich ein wenig vorbeugte und einen roten Dominostein berührte.
Der kippte und stieß gegen den nächsten, der daraufhin ebenfalls fiel. Weitere Steine kippten und fielen, aus dem vereinzelten Klicken und Klacken wurde ein Rauschen. Nach wenigen Sekunden hörte es auf, es wurde wieder still. Auf dem Wandschirm hinter dem Tisch erschien der Hinweis: Maßnahmenkatalog 1.
»Ich glaube, jemand hat beim Aufstellen der Dominosteine einen Fehler gemacht«, sagte Jurij.
»Warten Sie’s ab.«
Ein weiterer Dominostein fiel, ohne dass Forsythe ihn angerührt hatte, und das Klicken und Klacken begann von neuem. Etwas, das wie ein großes Uhrwerk aussah, geriet in Bewegung. Dahinter drehte sich ein zwischen zwei Miniaturwolkenkratzern aufragendes Jahrmarktriesenrad und beförderte einen gelben Stein zur anderen Seite, was dazu führte, dass eine weitere Kolonne aus Dominosteinen fiel.
Lange Reihen von Steinen kippten und fielen. Zwei Wellen breiteten sich aus, eine zur rechten, die andere zur linken Seite.
»Hübsch«, kommentierte Desna Laghari, aber sie lächelte nicht. Forsythe fragte sich, ob ihr aufgefallen war, dass das Blau einiger Steine dem ihres Saris entsprach.
Der Hinweis auf dem Wandschirm wechselte zu Maßnahmenkatalog 2.
Die Bewegungen der Dominosteine auf dem Tisch verlangsamten sich. An einigen Stellen hörten sie auf, an anderen setzten sie sich fort, aber nicht schnell, als wären die Steine schlecht platziert, Hügel hinauf und hinunter, durch Tunnel, in denen das Klacken und Rauschen widerhallten, über schmale Brücken, auf denen die Steine manchmal schwankten, wie unschlüssig, ob sie fallen sollten oder nicht. Kleinere Wellen breiteten sich aus, nicht zu den Seiten, sondern nach vorn und hinten.
Maßnahmenkatalog 3 hieß es auf dem großen Bildschirm an der Wand.
Das Klicken und Klacken dauerte an, ohne seine Geschwindigkeit zu verändern. Schließlich fielen die letzten Steine, und Stille kehrte zurück.
Jiang Taiji betrachtete den Tisch mit großer Aufmerksamkeit, stellte Forsythe fest.
»Nicht schlecht«, erklärte Samuel Winster großzügig. »Ein paarmal sah es so aus, als käme der Rest der Dominosteine davon, aber dann ging es doch weiter. Allerdings …« Er deutete auf die Mitte des Tisches. »Die Steine dort sind übrig. Alle sind gefallen, bis auf jene wenigen.«
Sieben Steine in sieben verschiedenen Farben umringten in der Mitte des Tisches eine Kugel, einen kleinen Globus mit den vertrauten Linien der Kontinente.
Der Wandschirm wurde dunkel.
»Sieben«, sagte Xanadu. »Wie wir. Ich nehme an, das ist kein Zufall. Alle sind gefallen, aber sieben stehen. Sie haben alles überstanden.«
»Was wollen Sie uns damit sagen?«, fragte Jurij und ging am Tisch entlang.
Forsythe deutete zur Tür, die Anthony wieder geöffnet hatte. »Kehren wir in den Konferenzraum zurück. Dort erklären ich Ihnen alles.«
6
Sechs Tablet-Computer markierten sechs Plätze am runden Tisch.
Forsythe vollführte eine einladende Geste. »Bitte setzen Sie sich.«
Anthony stand neben der geschlossenen Eingangstür und betätigte dort einen Dimmer, woraufhin es dunkler wurde. Ein leise summender Beamer projizierte einen blauen Amethyst auf die hundertfünfzig Zoll große Leinwand an der Rückwand des Konferenzraums. Darunter erschien der Schriftzug Amethyst Prognosis.
Forsythe selbst blieb stehen, die Fernbedienung aus dem Showroom in der einen Hand, und wies mit der anderen auf die Tablets. »Ich habe einen ausführlichen Bericht vorbereitet …«
»Wir kennen die letzten Berichte«, unterbrach ihn Sammy Winster mit einem fröhlichen Lächeln. »Ich nehme an, wir alle haben uns auf dem Weg hierher damit beschäftigt.«
»Diesen Bericht kennen Sie noch nicht«, erwiderte Forsythe geduldig. »Ich habe ihn selbst erstellt. Er fasst alles zusammen und rückt die Dinge in die richtige Perspektive. Die Anlage des Berichts besteht aus dem Datenmaterial, das Amethyst Prognosis beim kommenden G20-Gipfel in Paris präsentieren wird. Es betrifft den ›Maßnahmenkatalog 1‹.«
Desna Laghari saß ihm am nächsten. Ihr blauer Sari knisterte leise, als sie sich vorbeugte und mit dem Zeigefinger über das Display wischte.
Forsythe gab ihnen allen Gelegenheit, einige Absätze seines Berichts zu lesen und einen Blick auf die Anlage zu werfen, bevor er einen Knopf der Fernbedienung drückte. Auf der Leinwand erschien eine Schrift.
Der erste Stein: ImmoInvest.
Forsythe sprach, während die anderen lasen. »Ich bin immer der Meinung gewesen, dass Wetten kein gutes Geschäft sind. Das heißt, solange der Faktor Glück dabei eine wichtige Rolle spielt, und das ist oft der Fall.«
»Derivate«, sagte Xanadu, ohne von ihrem Tablet aufzusehen.
Forsythe nickte ihr zu und fuhr fort: »Die letzte große Finanzkrise begann am 9. August 2007 durch den sprunghaften Anstieg der Zinsen für Interbankfinanzkredite. Ich lasse hier den Wirtschaftseinbruch durch die Corona-Pandemie ganz bewusst außer Acht, die im März 2020 einen Börsencrash ohne unmittelbare ökonomische Ursachen zur Folge hatte. Der Grund für die Krise von 2007 war die spekulativ aufgeblähte Immobilienblase in den USA. Ihren Höhepunkt erreichte sie ein Jahr später, genauer gesagt: am 15. September 2008 durch den Zusammenbruch der amerikanischen Großbank Lehman Brothers. Bis dahin hatte die breite Öffentlichkeit angenommen, dass Banken, zumal die großen, nicht pleitegehen können, weil sie sich gegenseitig absichern.«
»Wir wissen es besser«, warf Jurij Kowalkow ein.
»Ja, denn genau durch diese gegenseitigen Verknüpfungen fielen damals weitere Dominosteine, sogar ziemlich viele«, sagte Forsythe. »Eine Bank nach der anderen kollabierte, überall auf der Welt. Die Regierungen mussten eingreifen, um das Finanzsystem zu stabilisieren und einen Zusammenbruch zu verhindern.« Er legte eine kurze Pause ein. »So wie sie auch nach Paris in ein paar Tagen eingreifen werden.«
»Sie meinen den ersten Maßnahmenkatalog«, kommentierte Pauline Laurent.
Forsythe nickte erneut und bemerkte, dass Jiang Taiji mit gerunzelter Stirn las. Der schweigsame, reservierte Chinese aus Peking hatte noch immer kein Wort gesagt. »Der Krise des Finanzsystems vor zwanzig Jahren folgte eine Krise der Realwirtschaft. General Motors meldete Insolvenz an und musste viele Mitarbeiter entlassen. Anderen großen Unternehmen ging es ähnlich. Die Arbeitslosigkeit stieg sprunghaft an. Eine Wirtschaftskrise drohte, ähnlich der sogenannten Großen Depression, die im Oktober 1929 begann und die ganze Welt ins Unglück stürzte, denn letztendlich führte sie zum Zweiten Weltkrieg. Aber im Vergleich mit dem, was uns jetzt bevorsteht, erscheint das Chaos der Großen Depression wie ein heiterer kleiner Kindergeburtstag.«
Erneut drückte er den Knopf der Fernbedienung, und der Beamer projizierte Hinweise und Zahlen auf die Leinwand.
»Derivate sind immer noch ein beliebtes Finanzinstrument. Futures, Optionen, Swaps … Einige von Ihnen haben viel Geld damit verdient. Aber der Handel damit gleicht dem Ritt auf einer Rasierklinge, denn Derivate sind letztendlich Wetten, die man gewinnen oder verlieren kann. Vor der Finanzkrise, die 2007 begann, betrug das globale Derivat-Volumen etwa fünfhundert Billionen Dollar. Im Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt der ganzen Welt belief sich damals auf etwa sechzig Billionen Dollar. Hat man aus der Krise gelernt? Wie Sie wissen, haben die G20-Staaten im April 2009 das Financial Stability Board gegründet, gewissermaßen als Frühwarnsystem für zukünftige Krisen. Doch nur wenige Jahre später, im Jahr 2014, wuchs das weltweite Derivat-Volumen auf siebenhundert Billionen Dollar, während das globale BIP knapp achtzig Billionen erreichte.«
Forsythe hob die freie Hand und ließ sie wieder sinken. »Nein, meine Damen und Herren, liebe Freunde, man hat nichts aus der Krise gelernt. Das Wetten ging weiter. Es war zu reizvoll, es verhieß zu viel Geld. Allerdings nahm jemand die Finanzkrise zum Anlass, über eine Alternative nachzudenken, über ein Geldsystem, das sich der Kontrolle von Staaten und Banken entzieht, über ein ›demokratisches Finanzsystem‹, wenn Sie so wollen. Dieser Mann nannte sich Satoshi Nakamoto, und er schuf die Grundlagen für den Bitcoin. Dazu gleich mehr.«
Alle sahen ihn an, alle bis auf Jiang Taiji, der noch immer den Bericht auf seinem Tablet las. Die Falten in seiner Stirn waren tiefer geworden.
»Inzwischen sind die globalen Derivate auf eins Komma eins Billiarden Dollar gewachsen, bei einem weltweiten BIP von knapp hundertzwanzig Billionen Dollar. Noch nie gab es so viele Wetten und so viele Schulden. Ein weiterer Faktor kommt hinzu: Noch nie war so viel Geld im Umlauf, denn die Regierungen ließen während der Pandemie von 2020/21 immer mehr Geld drucken, um die Wirtschaft zu stützen. Eine gewaltige Blase entstand, größer als jemals zuvor. Sie wird platzen, mit einem Knall viel, viel lauter als der vor zwanzig Jahren. Laut genug, um die ganze Welt zu erschüttern. Die Auswirkungen könnten ebenso verheerend sein wie ein Dritter Weltkrieg.«
Einige Sekunden lang war nur das leise Summen des Beamers zu hören.
»Dies ist … dramatisch«, sagte Jiang Taiji, und seine Worte hatten besonderes Gewicht. »Ein explosionsartiger Anstieg der Inflation bei einer gleichzeitigen Implosion des Finanzsystems …« Er hob den Blick, der bisher aufs Tablet gerichtet war, und wies auf den Bildschirm: »Wer oder was ist ImmoInvest? Und was hat es mit dem ersten Stein auf sich?«
»ImmoInvest ist ein deutscher Immobilienfonds mit einer Marktkapitalisierung von neunzehn Milliarden Euro«, erklärte Forsythe. »Dort wird die Katastrophe beginnen, in wenigen Wochen. Der erste Stein.«
»Neunzehn Milliarden?«, wiederholte Pauline. »Das mag in einem regionalen oder auch nationalen Maßstab viel Geld sein. Aber kann ein solcher Betrag für das Auslösen einer Katastrophe genügen, die Sie mit dem Dritten Weltkrieg vergleichen?«
Die Fernbedienung in Forsythes Hand klickte. »Der berühmte Tropfen, liebe Pauline. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die Immobilienpreise in Deutschland fallen seit Monaten, und in den kommenden Tagen werden sie noch stärker sinken. Das bringt mehrere Immobilienfonds in Schwierigkeiten. ImmoInvest wird Insolvenz anmelden, was allein für sich genommen nicht sehr schlimm ist, aber zu den Anlegern gehört auch die Deutsche Bank, die ohnehin seit Jahren in erheblichen Schwierigkeiten steckt und vom Internationalen Währungsfonds als riskanteste Bank der Welt eingestuft wurde. Ihr Derivat-Volumen ist von sechsundvierzig Billionen Euro im Jahr 2019 auf inzwischen fünfundsechzig Billionen angestiegen, mehr als das Zehnfache des Bruttoinlandsprodukts von Deutschland. Und die Deutsche Bank ist dreimal so groß, wie es Lehman Brothers im Jahr 2008 gewesen ist, und noch dazu eng mit vielen anderen Banken und Unternehmen verknüpft. Ihr Fall wird eine Kettenreaktion auslösen.«
»Die Dominosteine«, warf Xanadu ein.
»Ja. Sie werden fallen, einer nach dem anderen, immer schneller.«
»Der erste Maßnahmenkatalog hat das Fallen der Steine aufgehalten«, erinnerte sich Desna.
»Dabei handelt es sich um die Maßnahmen, die Amethyst Prognosis in Paris den G20-Staaten vorschlagen wird«, erläuterte Forsythe. »Maßnahmen zur Stützung des Finanzsystems. Wir werden klarmachen, wie ernst die Lage ist und dass so schnell wie möglich wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Das System, meine Damen und Herren, ist an seine Grenzen angelangt. Wir stehen am Abgrund.«
»Aber die ersten Maßnahmen genügen nicht«, sagte Pauline. »Sie verhindern nicht, dass die nächsten Steine kippen.«
»Sie verlangsamen das Kippen und Fallen. Dadurch bekommen wir etwas mehr Zeit.«
»Wir«, brummte Jurij Kowalkow.
»Wir«, bestätigte Forsythe. »Die Sieben.«
»Zeit wofür?«, wollte der Russe wissen. Er schien sein Tablet kaum angerührt zu haben.
»Für den Plan«, antwortete Forsythe. »Dafür, die Welt zu retten. Und um Satoshi Nakamoto zu finden. Das ist sehr, sehr wichtig.«
»Sie halten die Katastrophe für unvermeidbar, wenn ich es richtig verstehe«, sagte Desna Laghari. »Ihrer Meinung nach lässt sie sich nur ein wenig verzögern.«
Forsythe nickte ihr zu. »Sie haben richtig verstanden.«
»Eine Katastrophe so schlimm wie der Dritte Weltkrieg.« Sammy Winster wirkte noch immer fröhlich. »Und sie beginnt in Deutschland. Schon wieder, ist man versucht zu sagen.«
»Wir stehen an einem Wendepunkt«, betonte Forsythe. »Eine neue Ära wird beginnen, ein neue Abschnitt in der Menschheitsgeschichte.«
Sammys Lächeln verschwand. Er verzog sogar ein wenig das Gesicht. »Ist das nicht ein bisschen zu theatralisch?«
»Es mag theatralisch klingen, aber es ist nicht übertrieben. Das Finanzsystem der Welt wird unter der Last seiner Schulden zusammenbrechen, und die Realwirtschaft wird mit in den Abgrund gerissen. Es ist unvermeidlich. Die Lawine hat sich bereits in Bewegung gesetzt, das Weltwirtschaftssystem steht unmittelbar vor dem Kollaps. Ein Crash wie nie zuvor, und er wird in wenigen Wochen stattfinden.«
»Das Ende des Kapitalismus?«, fragte Pauline. »Und dann? Was wird sich aus den Trümmern erheben?«
»Anarchie«, sagte Forsythe. »Ein dunkles Zeitalter wird beginnen. Wenn wir nichts dagegen unternehmen.«
»Und wie wollen Sie die Welt retten, Francis?«, fragte Xanadu. Das Licht der Lampe über dem Tisch spiegelte sich in ihren goldenen Augen wider. »Womit?«
Forsythe betätigte die Fernbedienung. Der Plan erschien auf der Leinwand.
»Siebzig Billionen Dollar«, sagte er. »Zehn Billionen für jeden von uns, also zehntausend Milliarden pro Kopf, das wird unser Gewinn sein, unter Berücksichtigung aller kurzfristigen Verluste. Genug, um die Trümmer der alten Welt beiseitezuräumen und eine neue aufzubauen.«
Jiang Taiji blickte zur Leinwand. »Mit Bitcoin?«
»Das alte Geld wird bald das Papier nicht wert sein, auf dem es gedruckt ist«, erklärte Forsythe. »Wir machen den Bitcoin zur neuen Weltwährung, unter unserer Kontrolle. Und wer den Bitcoin kontrolliert, der kontrolliert auch die neue Weltwirtschaft und mit ihr die neue Weltordnung.«
»Der Bitcoin kann nicht kontrolliert werden«, sagte Desna, doch es klang nicht wie eine Feststellung, eher wie eine Frage. »Er basiert auf einer dezentralen, über zahllose Computer auf der ganzen Welt verteilten Blockchain ohne einen Single-point-of-failure, der sich kompromittieren ließe.«
»Deshalb brauchen wir Satoshi Nakamoto. Wir brauchen ihn vor allem deshalb, damit niemand anders sein Wissen anwenden kann.« Forsythe deutete zur Leinwand und drückte wieder einen Knopf auf der Fernbedienung. Einzelheiten des Plans erschienen.
Die Sechs lasen.
»Sie wollen den Crash steuern«, sagte Jiang Taiji langsam.
»Die Lawine rollt«, erklärte Forsythe, »und sie lässt sich nicht aufhalten. Doch wir werden sie in eine bestimmte Richtung lenken, damit sie möglichst wenig Schaden anrichtet.«
»Möglichst wenig Schaden für wen?«, fragte Xanadu, und ihre goldenen Augen schienen zu leuchten.
»Für uns«, sagte Forsythe. »Ich möchte nicht verlieren, wofür ich mein ganzes Leben gearbeitet habe, und ich denke, das gilt auch für Sie.«
»Gezielte Pleiten und Konkurse?«, fragte Samuel Winster. Er lächelte nicht mehr, und seiner Stimme fehlte die sonst übliche Fröhlichkeit.
»Wir stoßen hier und dort Dominosteine an, um zu bestimmen, wo etwas kippt und fällt. Jeder von Ihnen hat dabei wichtige Beiträge zu leisten.«
»Wir zerstören die Welt, um sie zu retten?«, knurrte der kleine Jurij Kowalkow.
»Wir sind wie Feuerwehrleute«, erklärte Forsythe, »und wir legen ein Gegenfeuer, um den Brand zu bekämpfen.«
Die Tür öffnete sich, und Anthony kam mit einem Serviertablett herein, auf dem sieben Sektgläser standen.
Forsythe nahm das erste und wartete, während die anderen ihre Gläser erhielten.
»Lassen Sie uns auf den Erfolg des Plans anstoßen«, sagte er dann. »Trinken wir auf die neue Welt.«
»Moment.« Xanadu stand auf, und die anderen erhoben sich ebenfalls. »Unsere Unternehmung sollte einen Namen bekommen«, schlug die Exotin vor. »Wie wäre es mit … ›das Bitcoin-Komplott‹?«
Francis Forsythe lächelte und nickte.
Die Sieben hoben ihre Gläser und tranken.
Vincent Moreau
7
Vincent Moreau verließ das kleine Café beim Park der Universität und ging nach Nordwesten, zum Englischen Garten. Ein böiger kalter Wind wehte, und dunkle Wolken kündigten Regen an, aber trotzdem waren viele Touristen unterwegs, einige von ihnen mit mehr oder weniger hübsch bedruckten Atemmasken. Viele von ihnen fotografierten sich vor dem Nationaldenkmal, vor den beiden bronzenen Frauen, Verkörperungen der Republik Genf und Helvetia, die sich an der Taille umfasst hielten und in Richtung Schweiz blickten.
Die Brücke Pont du Mont-Blanc brachte ihn zur anderen Seite der Rhône, und dort setzte Moreau seine Wanderung über die Uferpromenade zur Rotonde du Mont-Blanc mit dem Sissi-Denkmal fort, wo sich ebenfalls die Touristen drängten. Der See lag nicht glatt, der Wind gab ihm schaumgekrönte Wellen.
Immer wieder sah sich Moreau unauffällig um, wie er es sich in den letzten Wochen zur Angewohnheit gemacht hatte. Niemand folgte ihm, aber ganz sicher war er nicht. Auf der Rotonde schritt er zwischen den Gruppen einher, blieb stehen, setzte sich wieder in Bewegung und hoffte, auf diese Weise einen eventuellen Schatten zu verwirren, der sich womöglich an seine Fersen geheftet hatte.
Schließlich setzte er den Weg zum nicht weit entfernen Port Wilson fort, verharrte dort bei den Anlegestellen mit den zahlreichen Booten und fragte sich, wie viel David Dean Freeman aus Illinois seinem Sohn Martin erzählt hatte. War die SD-Karte bei ihm in den richtigen Händen?
Erste Regentropfen fielen. Moreau beschloss, zum Parkhaus zurückzukehren.
Als er es zehn Minuten später erreichte, wurde aus dem Nieseln ein Platzregen, der die Menschen von den Straßen vertrieb und unter Markisen und in Hauseingängen Schutz suchen ließ. Moreau ging die Treppe zum zweiten Stock hoch – er nahm nie den Aufzug, wenn es sich vermeiden ließ – und entschied sich, sofort nach Zürich zu fahren und nicht auf eine Reaktion von Martin Freeman zu warten. In etwa dreieinhalb Stunden konnte er dort sein, kurz nach Mittag, und das bedeutete, dass er keinen ganzen Börsentag verlor.
Fast alle Plätze des Parkdecks im zweiten Stock waren besetzt. Moreau ging an den Wagen vorbei, in Gedanken bereits in Zürich und bei den Geschäften des Nachmittags. Sein blauer E-Toyota stand neben einer Säule; Moreau parkte immer so, dass er auf einer Seite kein Fahrzeug neben sich hatte.
Er drückte die Taste des Funkschlüssels und hörte das Klacken der Entriegelung.
Als er sich der Fahrertür näherte, trat jemand hinter der Säule hervor. Moreau blieb erschrocken stehen.
»Überrascht?«, fragte Irene mit einem falschen Lächeln.
Ihre Hände waren leer, das sah er sofort. Keine Pistole.
»Was machst du hier?«
»Was machst du hier?«, hielt sie ihm entgegen und warf mit einer ruckartigen Bewegung des Kopfes das lange rotbraune Haar zurück. Sie stand mit dem Rücken zum Licht, ein Teil des Gesichts blieb im Schatten. »Hier in Genf?«
»Geschäfte«, sagte Moreau. »Ich nehme an, dies ist keine zufällige Begegnung. Du bist mir gefolgt.«
»Hast du ihn getroffen? Hast du mit ihm gesprochen?«
Moreau atmete tief durch. »Ich hab keine Ahnung, wen du meinst.«
Irene lächelte erneut, streckte die Hand aus und berührte ihn mit einem langen Fingernagel an der Nasenspitze. »Ich sehe, wenn du lügst. Hast du das vergessen?«
Moreau erinnerte sich an alles, an ihren herrlich warmen Körper, nicht annähernd so kalt wie das Lächeln, an ihre weichen Lippen.
Irene zog die Hand zurück. »Was hast du ihm gesagt? Wie viel hast du ihm verraten?«
»Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig.«
»Hast du noch immer nicht begriffen, dass diese Sache viel größer ist als wir beide? Gregor hat davon erfahren.« Irene schüttelte den Kopf, ihr Haar wogte. »Ich habe dich gewarnt.«
Irenes kühler Blick verriet die dritte Person nicht, sondern blieb auf Moreau gerichtet. Dennoch merkte er, dass sie nicht allein waren – jemand stand hinter ihm. Zwei Sekunden verstrichen und entschieden über sein Leben. Er hätte sich umdrehen oder zur Seite springen können, dann wäre ihm vielleicht die Flucht gelungen, mit einem Zickzacklauf zwischen den geparkten Wagen zur Rampe oder zur Treppe.
Aber Vincent Moreau blieb stehen. Er vergeudete seine letzte Chance, indem er Irene ansah und in ihrem Gesicht nach einem Rest von dem suchte, was sie einst verbunden hatte.
Die Kugel, die ihn tötete, hörte er nicht. Der Schuss war ohnehin nicht sehr laut, ein Schalldämpfer schluckte den Knall.
Martin Freeman
8
Martin saß an seinem Schreibtisch vor dem großen gewölbten Bildschirm und hielt die SD-Karte, die er von Vincent Moreau erhalten hatte, unschlüssig in der Hand. Es gab besonders hinterhältige Schadsoftware, die sich im System einnistete, ohne dass man eine bestimmte Datei aufrufen oder auf einen E-Mail-Anhang klicken musste –, es genügte, einen USB-Stick einzustecken oder eine Datenkarte in einen Kartenleser zu schieben.
Er startete ein spezielles Sicherheitsprogramm, das er von seinen Freunden bei »Tron« erhalten hatte, einer Gruppe von Hackern, die glaubten, die Welt verbessern zu können, indem sie die geheimen Datenbanken von Konzernen und Regierungen plünderten und alles veröffentlichten, »was unter den Teppich gekehrt werden sollte«, wie sie es nannten. Martin blieb ein wenig auf Abstand zu der Gruppe, denn einige Mitglieder von Tron bewegten sich nahe am Rand von Cyberterrorismus.