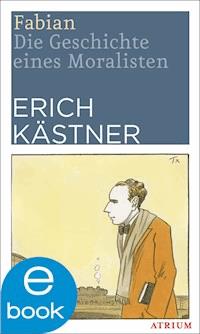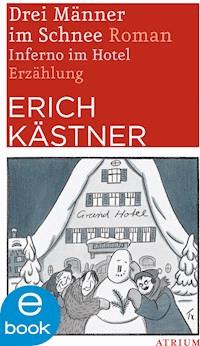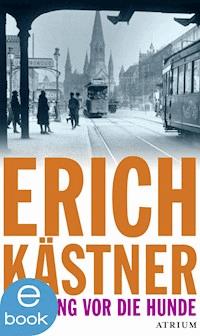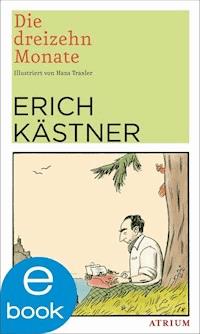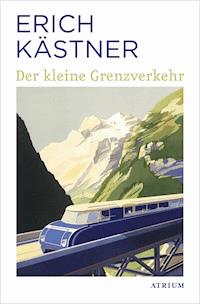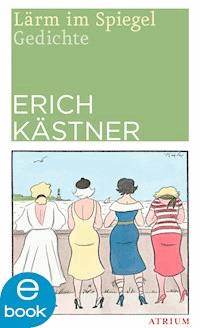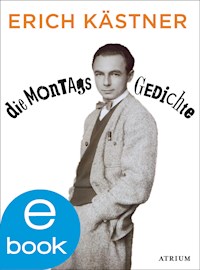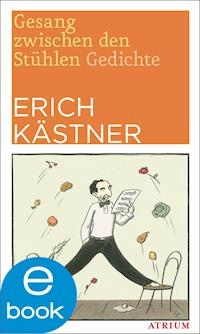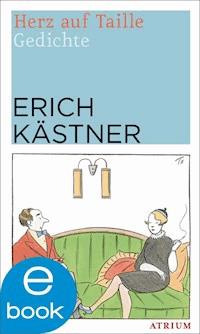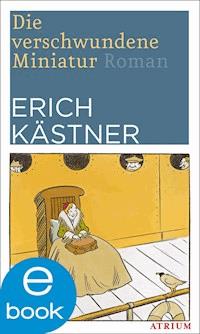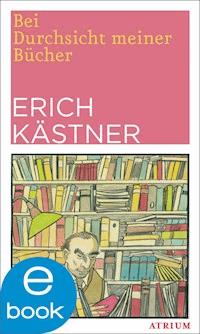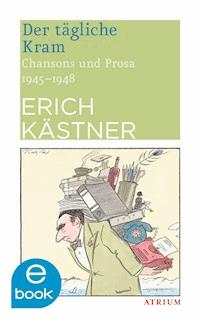Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nachdem Erich Kästner 1933 von den Nazis als Autor verboten worden war, entschloss er sich, ein geheimes Tagebuch zu führen. Dazu griff er auf ein blau eingebundenes, unbeschriftetes Buch zurück, das er zwischen den anderen viertausend Bänden seiner Bibliothek versteckte. Aus Sicherheitsgründen fertigte Kästner seine Aufzeichnungen außerdem stenografisch an. Von 1941 bis zum Kriegsende schrieb Erich Kästner auf, was sich an der Front und in Berlin ereignete, notierte Heeresberichte und Massenexekutionen ebenso wie die Kneipenwitze über Goebbels und Hitler, die schon bald nur noch hinter vorgehaltener Hand gemacht wurden. Er dokumentiert seinen zunehmend von Stromsperren und Bombenangriffen geprägten Alltag bis zur bedingungslosen Kapitulation im Mai 1945 und berichtet, was sich in den Monaten danach abspielte. Die jetzt vorliegende, von Sven Hanuschek zusammen mit Silke Becker und Ulrich von Bülow herausgegebene und umfangreich kommentierte Ausgabe umfasst neben Kästners Kriegstagebuch auch seine gesammelten Notizen für einen Roman über das "Dritte Reich", ein umfangreiches Vorwort sowie zahlreiche Zeitungsartikel, die Erich Kästner im Blauen Buch aufbewahrte.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erich Kästner
Das Blaue Buch
Geheimes Kriegstagebuch 1941–1945
Herausgegeben von Sven Hanuschek in Zusammenarbeit mit Ulrich von Bülow und Silke Becker
Aus der Gabelsberger’schen Kurzschrift übertragen von Herbert Tauer
Abkürzungen
Deutsches Literaturarchiv, Marbach am Neckar
GAGesamtausgabe
Krit.Kritische
n.e.nicht ermittelt
NLNachlass
RSKReichsschrifttumskammer
UAUraufführung
Erich Kästner am 2.9.1943 auf der Terrasse der Villa von Edith und Erich Stückrath in Neu-Babelsberg, Ludwig-Troost-Straße (heute Virchowstraße) 19/21. (Nachlass Werner Buhre)
»Auch heute hatten die Betriebe ab Mittag zum Jubeln frei«[1]
Kästners Kriegstagebücher: Eine Einführung
Sven Hanuschek
Erich Kästner war durch seine Lyrikbände seit Herz auf Taille (1928) und den Roman Fabian (1931) bereits renommiert, als die Hitler-Diktatur 1933 ihre ersten Schritte tat; mehr als das: Er war durch seine Kinderbücher und die erste Verfilmung populär, so populär, dass der Ufa-Film Emil und die Detektive (1931) bis ins Jahr 1936 noch gelegentlich öffentlich gezeigt und mit dem Namen des Autors beworben wurde. Da waren seine Bücher schon längst öffentlich verbrannt worden – in Berlin stand er unter den Zuschauern –, zusammen mit vielen Titeln von Kolleginnen und Kollegen, die er kannte oder mit denen er befreundet war. Die meisten von ihnen emigrierten, Kästners näheres Umfeld lichtete sich in den Jahren nach 1933 schnell; seine Kinderbuchverlegerin Edith Jacobsohn floh ebenso wie sein Illustrator Walter Trier, auch einige seiner Freundinnen verließen das Land. Kästner war berühmt und auch finanziell erfolgreich, seine Bücher waren in viele Sprachen übersetzt, die meisten Exilländer hätten ihm offen gestanden. Dennoch blieb er in Deutschland, eine damals wie heute nicht unmittelbar nachvollziehbare Entscheidung.
Sicher glaubte er, seine Mutter Ida werde die dauerhafte Trennung von ihrem Sohn und Lebensinhalt nicht überstehen, eine Einschätzung, die sich um das Ende des Krieges herum und in den ersten Jahren der deutschen Teilung bestätigt hat. Zum anderen hat er immer wieder auf seinem Anspruch beharrt, Zeitzeuge sein zu wollen, mitzuschreiben, um den großen bilanzierenden Roman des ›Dritten Reichs‹ vorlegen zu können. An diesem Anspruch maß er sich selbst und wurde er von anderen gemessen. Er bürdete sich damit eine schwere Last auf, die aus Fehleinschätzungen heraus entstanden ist: Wie viele seiner Zeitgenossen dachte er, das nationalsozialistische Regime werde ein kurzer Spuk bleiben und vielleicht ein paar Monate dauern, höchstens aber ein Jahr. Und er glaubte, dass es schon nicht so schlimm werden würde – obwohl er sich seiner Gefährdung bewusst war.
Er überwinterte die zwölf Jahre der Diktatur, indem er Unterhaltungsromane im Ausland veröffentlichte, zusammen mit Freunden unter deren Pseudonymen recht erfolgreiche Boulevardstücke schrieb und das Drehbuch für den Ufa-Renommierfilm Münchhausen (1943) unter dem Pseudonym Berthold Bürger. Im Übrigen versuchte er, seinen regelmäßigen Alltag in der Berliner Bohème aufrechtzuerhalten, solange es ging – und es ging erstaunlich lange, trotz gefährlicher Ausnahmesituationen und den Einschränkungen, die der Krieg mit sich brachte. Erst nach Münchhausen wurde er mit einem Totalverbot überzogen. Die bisherigen Strategien funktionierten nicht mehr, er durfte weder unter Pseudonymen (anderer wie eigenen) noch im Ausland veröffentlichen, weder die Theater noch die Filmstudios konnten noch helfen; in den letzten beiden Kriegsjahren musste er tatsächlich von der Substanz leben, von dem Geld, das er gespart hatte, von Freundinnen und Freunden, ohne zu wissen, wie lange das gut gehen würde.
Der hier vorliegende Band ersetzt gewissermaßen den großen Roman über die NS- und Kriegsjahre, den Kästner nicht schreiben konnte, und nebenbei macht er deutlich, warum der Autor sein Projekt nach 1945 recht schnell aufgegeben haben muss. Die Kriegstagebücher im Verbund mit den Skizzen für den geplanten Roman zeichnen zudem nicht für das ganze Jahrzwölft, aber doch für lange Phasen ein genaues Bild des Alltags in der Diktatur; sie verdeutlichen die deutsche Mentalität jener Jahre auch der Menschen, die in Opposition zum Regime standen, ohne sich geradewegs einer deutschen Variante der Résistance anschließen zu wollen. Das waren nicht allzu viele zu Beginn, soweit eine solche Aussage vor der Durchsetzung einer zuverlässigen Demoskopie getroffen werden kann; es wurden aber mit den (Kriegs-)Jahren immer mehr.
Fußnoten
Tagebucheintrag vom 27. 3. 1941.
Knappe Chroniken: 1941 und 1943
Kästners Kriegstagebücher samt der zahlreichen Beilagen – Zeitungsartikel, Nietzsche-Notizen und anderes – sowie der Anläufe für zwei Romanprojekte sind zum einen lakonische Mitschriften eines Alltags und einer Mentalität. Zum anderen liefern sie, wenn man den schieren Gedächtnisstützen des Autors, seinen Anspielungen, Nebengeschichten und einigen der Hinweise auf damals geläufige Halb- und Viertelprominente nachgeht, ein Zeitpanorama von geradezu Rabelais’scher Üppigkeit. Einigen dieser Nebengeschichten geht der Kommentar dieser Ausgabe nach, es finden sich immer wieder Biografien, die nach einer ausführlichen Recherche oder einer Verfilmung schreien; um hier wenigstens zwei zu nennen: Der österreichische Schauspieler Leo Reuss hatte seit den zwanziger Jahren Engagements an den großen Berliner Bühnen, 1934 erhielt er wegen seiner jüdischen Herkunft Arbeitsverbot und ging wieder nach Österreich. Dort gab er sich 1936 bei einem Vorsprechen in Salzburg als bärtiger Tiroler Bauer ›Kaspar Brandhofer‹ aus, als theaterinteressierter Laie in Lederhosen, der unbedingt auf die Bühne wolle; tatsächlich wurde er am Wiener Theater in der Josefstadt engagiert und erhielt sehr positive Kritiken, als scheinbar völkisch-naives Originalgenie. Er beging dann den Fehler, sich selbst zu enttarnen, mit der Folge, dass er nun auch in Österreich keine Engagements mehr erhielt. Reuss emigrierte in die USA und war dort bis zu seinem frühen Tod 1946 ein gefragter Nebendarsteller in Hollywood – unter dem Namen Lionel Royce. Felix Mitterer hat das Stück In der Löwengrube (1998) über ihn geschrieben, es gibt mehrere Biografien,[2] und offenbar hatte auch Kästner dieses Leben als ›Stoff‹ im Blick.
Ein anderer Fall, den Kästner nur nebenbei erwähnt, ist der Vorwärts-Redakteur Hans Wesemann, der sich im Londoner Exil von der Gestapo anwerben ließ und an der Entführung des NS-kritischen Publizisten Berthold Jacob aus Basel nach Deutschland beteiligt war; Wesemann wurde von den Schweizer Behörden inhaftiert, konnte nach dem Zuchthaus nach Venezuela emigrieren und war einige Jahre in Texas interniert; er ist 1971 in Lateinamerika gestorben und hat postum etliche Spionage-Geschichten erzeugt – er habe für den KGB gearbeitet, sei in New York gesichtet worden und anderes mehr. Die größte Öffentlichkeit erlangte seine Verwechslung mit dem Journalisten Hans Otto Wesemann, dem langjährigen Intendanten der Deutschen Welle. Auch die bislang einzige Biografie über Hans Wesemann kann sein Leben nach dem Krieg nicht zuverlässig rekonstruieren.[3]
So kurios solche Nebengeschichten sein mögen, ist doch offensichtlich, dass die Bereitschaft des Chronisten Kästner allmählich sinkt, das Beobachtete – neben allen anderen Emotionen – auch komisch zu finden; am Ende, bei der Wiedergabe des Berichts von Männe Kratz, der Auschwitz entronnen ist, scheint er selbst überwältigt, sprachlos. Seine Kommentierung des Kriegsverlaufs ist zu Anfang gleichzeitig eine Kommentierung der Nachrichtenpropaganda und -mechanik der Diktatur, 1941 noch erstaunlich patriotisch gehalten; auch diese Tendenz lässt im Verlauf der Notizen stark nach. Kästner hat einmal bemerkt, er habe auch aus Langeweile nicht Tag für Tag mitschreiben können, die Sprünge in den ersten Monaten sind zum Teil erheblich.
Nachdem die Kriegstagebücher erst 1941 und nicht mit den ersten Jahren der NS-Diktatur einsetzen, werden schon zu Beginn Alltagsprobleme beschrieben, die neben den Kriegsereignissen und dem massiven Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft nur frivol wirken können. So ist einmal davon die Rede, dass seine Lebensgefährtin Luiselotte Enderle nicht mehr bei Kempinski einkaufen wolle: »Die Verkäufer sind von reichen Kunden samt und sonders bestochen. Fünfzig Mark als Schmiergeld sind keine Seltenheit. Und die Verkäufer bedienen ostentativ nur noch solche ›Kunden‹. Sie plaudern mit ihnen, sie wickeln ihnen vor aller Augen Waren ein, die es für die andern ›nicht gibt‹.« (18. 1. 1941) Es werde viel geschoben, man könne, »für entsprechende Preise, alles kaufen«. Als wolle Kästner die Frivolität selbst ausstellen, notiert er einige Zeit später: »Was es in den letzten Monaten wirklich im Überfluss gab waren: Sekt, Hummern und Orchideen. Sekt gibt es zurzeit so wenig wie nie früher. Orchideen gibt es aber noch« (13. 5. 1941). Die Tagebücher sind Mitschriften, Tagesbeobachtungen eben; was der Verfasser davon hielt, wusste er ohnehin und sah keine Veranlassung, die eigenen Notizen auch noch moralisierend oder anders zu interpretieren. Deshalb finden sich kaum Kommentare, und wenn es denn welche gibt, können sie zu Beginn durchaus irritierend ausfallen. Er lernt einen Leutnant der Panzerjäger kennen, der bei der Gestapo ist, lässt sich in dessen Wohnung einladen und die angehäuften Vorräte vorführen, einen Cognac servieren und ein zeitgemäßes zweideutiges Etablissement zeigen; obwohl ganz offen erwähnt wird, der Leutnant habe sich bei der Gestapo erkundigt, ob gegen Kästner etwas vorliege, und über seine sonstigen Taten in seiner Eigenschaft als Gestapo-Mann nichts bekannt wird, meint der Kommentator nur, das sei doch mal ein »harmloser, quietschvergnügter Junge« (18. 1. 1941).
Kästner verteidigt den deutschen Film gegenüber Beate und Kurt von Molo, die im Ausland französische und amerikanische Filme gesehen hatten und zu behaupten wagten, es sei nicht mehr möglich, in Deutschland gleichwertige Filme zu drehen (19. 1. 1941). Immer wieder referiert er Gerüchte, die teilweise, so oder ähnlich, stimmten – wie schlimm die deutschen Nicht-Nationalsozialisten im unbesetzten Teil Frankreichs behandelt würden (»Eine interessante Tatsache«, 19. 1. 1941) oder dass sich Walter Benjamin umgebracht habe. Dabei ist dem Diaristen schon immer klar, dass er weder der deutschen noch der ausländischen Presse je ganz trauen kann.
Er sammelt Wanderlegenden, Flüsterwitze (»Der Krieg wird wegen seines großen Erfolges verlängert«, 26. 1. 1941), dokumentiert kleine Erfolge des Widerstands oder freut sich über eine missglückte Rede des Wiener Reichsstatthalters Baldur von Schirach in einer Fabrik in Floridsdorf: Die Arbeiter »übertrieben ihre Begeisterung ins Ironische so, dass sie zwei Stunden lang ohne Pause die Lieder der Bewegung sangen und in Siegheilrufe ausbrachen, sodass Baldur, nachdem er zwei Stunden lang auf dem Rednerpodium abgewartet hatte, endlich wieder nach Hause fuhr, ohne auch nur ein Wort gesprochen zu haben« (23. 1. 1941).
Den größten Teil des Tagebuchs macht hier noch die laufende Kriegsberichterstattung aus. Ab und zu kommentiert der Verfasser die sich fortzeugenden Widersprüche, aber meistens in einer Haltung, als sei er kein Oppositioneller, sondern ein Repräsentant Deutschlands – auch diesmal entwickle sich der »Balkan zur Höllenmaschine Europas« (29. 1. 1941), oder: »Für meine Begriffe ist nun eine besonders wichtige Frage, ob es Deutschland gelingt, die Landung in England erfolgreich durchzuführen, ehe die amerikanische Atlantikflotte mithelfen kann, diesen Landungsversuch (und vor allem den Nachschub) zu stören.« (9. 2. 1941) Tagelang verfolgt Kästner die Meldungen über die Flucht des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß nach Großbritannien, die Kriegserklärung an die Sowjetunion findet er »psychologisch sehr interessant«, Goebbels’ Ansprache sei der »melancholische Versuch einer staatsmännischen Rechtfertigung« gewesen, an die Nationalsozialisten selbst gerichtet und nur namentlich an das Volk (22. 6. 1941). »Es hat den Eindruck, als ob Deutschlands ›Kreuzzug gegen den Bolschewismus‹ in allen, auch den unterdrücktesten Ländern, eine geradezu erstaunliche Sympathiesteigerung für Hitler hervorgerufen habe.« (26. 6. 1941)
Sehr hellhörig war Kästner von Anfang an gegenüber den laufenden Steigerungen des Antisemitismus. Im September 1941 verspürte er »eine neue innenpolitische Aktivität«, unübersehbar begannen die Deportationen in die Vernichtungslager, Kästner konnte sie freilich noch nicht genau einordnen: »Und seit Tagen werden die Juden nach dem Warthegau abtransportiert. Sie müssen in ihren Wohnungen alles stehen und liegen lassen und dürfen pro Person nur einen Koffer mitnehmen. Was sie erwartet, wissen sie nicht.« Pauline und Günther Schlesinger, von Kästner fälschlich als Ehepaar bezeichnet, waren seine Nachbarn in der Roscherstraße 16. Sie hätten ihn »gefragt, ob ich Möbel, Bilder, Bücher, Porzellan usw. kaufen will. Sie hätten sehr schöne ausgesuchte Dinge. Aber das Geld werden sie wohl auch nicht mitnehmen dürfen« (Ende Oktober 1941). Die Mutter starb in Theresienstadt, der Sohn wurde in Auschwitz ermordet.
Auch die Einträge für das Jahr 1943 bleiben noch vergleichsweise knapp; sie sind nicht mehr die des abgeklärten Weltpolitik-Kommentators von 1941, die Distanz gegenüber dem Regime wird expliziter, auch risikofreudiger formuliert: Es sei viel geschehen seit 1941, und die »Stimmung der Bevölkerung ist sehr ernst geworden« (18. 2. 1943). Der »totale Krieg« war erklärt worden, die Nachrichten aus Stalingrad wurden immer eindeutiger, die Luftangriffe auch auf Berlin nahmen zu. Kästner und Enderle erlebten in einem Hausflur, »peinlich nahe, das Niedergehen einer Luftmine hinter den Kurfürstendammtheatern« (11. 3. 1943). Einen der schwersten Angriffe auf Berlin sahen sie von einem sicheren Kellerfenster in Babelsberg aus: »Die glitzernden ›Christbäume‹, der Flakhagel, drei abstürzende Flugzeuge, die Jagdflieger, die, im Scheinwerferkranz, rote Erkennungsraketen abwerfen, die Mondsichel, die über dem Wald hochstieg und immer wieder von den Schöneberger und Charlottenburger Brandwolken verdeckt wurde […]« (24. 8. 1943) Die Sammelleidenschaft für Flüsterwitze ist ungebrochen, so notiert Kästner den zeitgemäßen Berliner Gruß »Bleiben Sie übrig!« (25. 8. 1943) und ein reformiertes Tischgebet: »Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, und iss mit uns, wenn du Marken hast.« (1. 9. 1943)
Der Blick auf die Opfer der Diktatur ist unverändert aufmerksam; aus München hört Kästner »merkwürdige Dinge«, von »Studentenunruhen«, Flugblättern und der Hinrichtung von vier Studenten war die Rede – hier hat ihn ein Gerücht über die Weiße Rose erreicht (11. 3. 1943). Auch über die Verbrechen in den Vernichtungslagern werden Einzelheiten bekannt: »Von den Judenerschießungen im Osten erzählte jemand, dass vorher ein SS-Mann mit einem Pappkarton von einem zum andern geht und ihnen die Ringe und Ohrringe abzieht.« (18. 2. 1943) In der deutschen Hauptstadt gibt es nur noch »Restabholungen der Berliner Juden (darunter Lastwagen voller Kinder zwischen 3 und 6 Jahren)« (11. 3. 1943).
Ab August 1943 werden Kästners Notizen ironisch und immer galliger; unübersehbar geht alles um ihn herum zu Bruch, ganz buchstäblich. Die Wohnung seines Freundes Werner Buhre fällt den Bombardierungen zum Opfer, anschließend im Februar 1944 Kästners eigene; er muss über Monate mit der Reichsschrifttumskammer verhandeln, ob seine verlorenen Manuskripte etwas wert waren oder nicht – schließlich ist er ja ein verbotener Autor, hätte sie also nicht verkaufen dürfen … Er kommentiert die Privilegien der NS-Bonzen und Goebbels-Aufrufe im Völkischen Beobachter zur Evakuierung Berlins, zum »Heroismus in Bombennächten«: »Die Bevölkerung wird wie ein Duellant behandelt, dem die Sekundanten lachend eine alte Plempe in die Hand drücken und dessen Gegner sichtbar einen Revolver hat.« (7. 8. 1943)
Fußnoten
Vollständige Literaturangaben ab S. 355. – Vgl. Haider-Pregler 1998, Ambesser 2005.
Zur Verwechslung mit Hans Otto Wesemann vgl. Hagedorn 2011; die erste Biografie über Hans Wesemann: Barnes/Barnes 2001.
Der Autor beschreibt sein Buch
Erich Kästner ist unter allen Klassikern der frühen Moderne vermutlich der einzige, der sofort auf die neuen Medien seiner Zeit reagiert hat; zuerst war er Journalist und Kritiker, der in Tageszeitungen in Leipzig veröffentlichte, dann in den großen Berliner Blättern. Er schrieb zusammen mit dem Komponisten Edmund Nick eines der ersten Hörspiele, für den Breslauer Rundfunk, er eignete sich schnell das neue Medium Film an und entwickelte Drehbücher aus fremden und eigenen Stoffen. Er überließ seine Bestseller nicht fremden Adapteuren, sondern übernahm das gleich selbst, in den ausgehenden Vierziger- und beginnenden Fünfzigerjahren sogar in einem solchen Umfang, dass die Filmarbeit auf Kosten eigener neuer Projekte ging. Kästner war ein Medien-Mann durch und durch, und so sind seine Kriegstagebücher nicht nur ein Bild des Kriegsalltags und der letztlich hilflosen Flüsterwitze, die in ihrer Weise auch eine volkstümliche Medienkritik darstellen, sondern ganz explizit auch die permanente Analyse von Nachrichten, die Kästner sich zusammenholen musste – aus den offiziellen Medien, aus Erzählungen von Bekannten und Unbekannten, aus Gerüchten … Als professioneller Journalist hatte er vielleicht ein paar Einblicke, ein paar Quellen mehr als die Durchschnittsbürger, die nun eher nicht mit Zeitungs- und Filmleuten im Künstlerrestaurant von John Rappeport, im Bardinet oder im Café Leon verkehrten.
Kästners Anliegen, überhaupt ein Kriegstagebuch zu führen, ist in gewisser Weise Medienkritik; er wolle »ab heute wichtige Einzelheiten des Kriegsalltags aufzeichnen«, nicht nur als Gedächtnisstütze – »damit ich sie nicht vergesse« –, sondern auch, um die Deutungen der Zeit selbst und die Distanz zu ihnen dokumentieren zu können, »bevor sie, je nachdem wie dieser Krieg ausgehen wird, mit Absicht und auch absichtslos allgemein vergessen, verändert, gedeutet oder umgedeutet sein werden« (16. 1. 1941). Die Nachwelt, ein bisschen pathetisch gesagt, soll nachvollziehen können, wie schwierig es war, sich zurechtzufinden zwischen all den Meldungen, Deutungen, Gerüchten, dem Propagandageschrei; sie soll interpretieren lernen.
Erich Kästner hat 1961 den Prosaband Notabene 45 veröffentlicht, als Bearbeitung des authentischen Tagebuchs, das er während der NS-Diktatur in Deutschland geführt hat, für die Jahre 1941, 1943 und 1945. Für die Veröffentlichung vorgesehen hatte er nur das Jahr 1945, aus ihm allein ist Notabene 45 entstanden; die gerade zitierten Sätze fehlen also in der Publikation zu Lebzeiten, es ist aber nur legitim, diesen seinen Skeptizismus auch gegen die Selbstkommentare des Autors zu wenden. Seine eigene Beschreibung der Druckvorlage in Notabene 45 gilt für das ganze Tagebuch, nicht nur für die 1945er-Anteile: Die Rede ist von einem »blau eingebundene[n] Buch«, einem Blindband, den er als Tagebuch verwendet hat, verfasst in »winziger Stenographie« (VI, 303).[4] Das ist jedoch nicht der Fall; das Kriegstagebuch wie die Roman-Notizen sind in der üblichen Gabelsberger Kurzschrift geschrieben, die Kästner stets benutzt hat, in der üblichen Größe. Weil damals weit mehr Menschen dieses Kurzschriftsystem beherrschten als heute, durfte das Buch also tatsächlich nicht in falsche Hände fallen.
Seine Notizen nennt Kästner »Stichworte«, »als seien es Einfälle für künftige Romane« – genau das waren sie, eine Sammlung für künftige Romane, im Konjunktiv steckt schon die Resignation im Rückblick, die Aufgabe des Projekts. Er habe die Arbeit dreimal wieder abgebrochen, warum, wisse er nicht mehr, schrieb er 1961: »Außer allerlei nicht mehr auffindbaren Gründen dürfte mitgespielt haben, daß der Alltag auch in Krieg und Terror, trotz schwarzer Sensationen, eine langweilige Affäre ist«, »mühsam genug, ihn hinzunehmen und zu überdauern«, deshalb »begnügte ich mich mit Stichproben« (VI, 303). Warum das »Blaubuch« die Kriegsjahre überstanden hat und dem Schicksal von Kästners Wohnung entging, wo es zeitweise, »aufs Sichtbarste verborgen, zwischen viertausend anderen Büchern im Regal« gestanden hatte, erklärt der Autor mit seiner Umsicht angesichts der zunehmenden Luftangriffe auf Berlin: Er steckte es »zu dem Reservewaschbeutel, der Taschenlampe, dem Bankbuch und anderen Utensilien in die Aktenmappe, die ich kaum noch aus den Händen ließ« (VI, 303).
Erich Kästner hat in Notabene 45 nur Aufzeichnungen der ersten Hälfte des Jahres 1945 publiziert, sehr stark überarbeitet (ich komme darauf zurück). Eine erste Transkription des ganzen Tagebuchs, die 1998 Arthur Lux vorgenommen hat, lag vor den Kästner-Biografien vor, die 1999 zu Kästners Hundertstem erschienen sind, Teile davon waren erstmals im Apparat der ersten kommentierten Ausgabe von Notabene 45 nachzulesen, im Rahmen der Werkausgabe (1999). Eine neue Übertragung aus der Gabelsberger Kurzschrift hat Herbert Tauer vorgenommen. Sie liegt der ersten vollständigen Edition des Blauen Buchs zugrunde, die Silke Becker und Ulrich von Bülow 2006 als Band der Reihe Marbacher Magazine des Deutschen Literaturarchivs herausgegeben haben. Die vorliegende Ausgabe übernimmt den Text und das Nachwort der zweiten Auflage der Marbacher Edition (2007) nahezu unverändert, der Kommentar erscheint in deutlich erweiterter und neu strukturierter Form. Mit der Atrium-Neuausgabe, mit der das gesamte Tagebuch einschließlich der Notizen für ungeschriebene Romane für ein breites Publikum vorliegt, lässt sich überprüfen, wie weit es mit Kästners Selbstbeschreibung her ist – um bloße »Stichworte« handelt es sich keineswegs.
Fußnoten
Erich Kästners Werke werden mit römischer Bandnummer und Seitenzahl (also Band 4, S. 303 in der Form IV, 303) zitiert nach der bislang einzigen kommentierten Werkausgabe, Kästner 1998.
1945 (I): Das Überleben der Eltern
Ich war eine Ameise, die Tagebuch führte. (VI, 304)
Offensichtlich hat Kästner sich 1945 nicht mehr ›gelangweilt‹, sein 45er-Tagebuch hat einen ungleich größeren Umfang als die vorhergehenden. Hier wird auch besonders deutlich, dass er keineswegs nur Beobachter gewesen ist. Allein die dramatische Flucht von Berlin nach Mayrhofen in Tirol macht ihn zum Akteur; dass sie nötig war, daran kann kein Zweifel bestehen. In den letzten Monaten, selbst in den letzten Tagen vor Kriegsende gab es noch zahlreiche Verhaftungswellen, Hinrichtungen, Lynchjustiz von angezählten NS-Horden, in der zeitgeschichtlichen Forschung gibt es einen Ausdruck dafür – ›Endphaseverbrechen‹ – , und über die wusste man als mittendrin steckender Zeitzeuge und potentielles Opfer nur zu gut Bescheid.
Bevor es zur Beschreibung der Flucht nach Mayrhofen und des Systemwechsels kommt, den Kästner dort erlebt, verfolgt er in seinem Tagebuch die Geschichten und Lebensläufe weiter, die er auch schon 1941/43 im Blick hatte. Seine Medienkritik an der sogenannten Gräuelpropaganda rückt stärker in den Vordergrund; deren Schicksal sei es, wie das jeder Propaganda, dass einige sie glaubten, und einige eben nicht. Die Notate des Jahres 1945 zeigen ein Land in Auflösung: Kästners Tagebuch beschreibt das Thema Unterwegssein, Flüchtling-Sein aus den verschiedensten Gründen, geschlagene Soldaten, untergetauchte Deserteure, Vertriebene aus Osteuropa, eine regelrechte Völkerwanderung. Kästner findet das Bild eines zerstörten Ameisenhaufens, »und ich war eine Ameise unter Millionen anderer, die im Zickzack durcheinanderliefen« (VI, 304).
Vor dem 22. März 1945, dem ersten Eintrag im vergleichsweise sicheren Mayrhofen, notiert er immer wieder beklommen die Sorgen um Ida und Emil Kästner, seine Eltern; sie war 73, er 77 Jahre alt. Dresden war bisher von Angriffen verschont geblieben, Ende 1944 jedoch bekam Kästner im Radio zu hören: »Heute mittag flog der Feind in Sachsen ein.«[5] Immer wieder hörte er vom Alarm in der Nähe der Eltern, ermunterte sie, nur ja lange im Keller zu bleiben und ihn nach der Vor-Entwarnung noch nicht zu verlassen. Bereits im Januar 1945 wurden Gerüchte über die Bombardierung Dresdens laut, das waren aber nur die ersten kleineren Angriffe. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 wurde das mit Flüchtlingen und kriegsgefangenen Zwangsarbeitern[6] vollgepfropfte Dresden durch Tieffliegerangriffe in zwei Wellen niedergebrannt, an den folgenden Tagen folgten Nach-Angriffe bei Tag. Technisch war dies eine beinah exakte Wiederholung der deutschen Bombardierung von Coventry am 14. November 1940: Die erste Angriffswelle sprengte die Dächer auf und machte die Straßen unpassierbar, die folgende setzte Brandbomben in die nun offenen Häuser, mit hohen Verlusten der Zivilbevölkerung. Es handelte sich technisch um den gleichen Ablauf, die militärischen und industriellen Einrichtungen von Dresden wurden zerstört, aber auch große Teile der Altstadt, und mit dem Zehnfachen an Opfern gegenüber Coventry.
Kästner hörte tagelang nichts mehr von seinen Eltern; sie hatten Glück im Unglück gehabt: Die Dresdner Neustadt hatte nicht die volle Stärke des Bombardements zu spüren bekommen, sondern nur den ersten Teil. Es gab keinen Strom, kein Wasser, die Scheiben waren geborsten, die Wohnung nicht mehr zu heizen – aber das Haus stand noch, im Unterschied zur zerstörten Villa von Kästners Tante Lina Augustin. Am 23. Februar, knapp zehn Tage nach der Bombardierung, erhält Kästner endlich einen ganzen Stapel von Postkarten und Briefen von Ida Kästner, zu seiner unendlichen Erleichterung: »In ihrer Wohnung Glasbruch und alles voller Ruß. Sie schliefen im Korridor; Mama auf dem Sofa, Papa auf zusammengesetzten Stühlen. Sie holen das Essen im Löwenbräu. Im übrigen frieren sie, was das Zeug hält« (27. 2. 1945).
In Elfriede Mechnigs Nachlass haben sich die Briefe Ida Kästners erhalten, in ihnen kann man die Andeutungen von Kästners Mutter über den »schrecklich großen Angriff« (21. 2. 1945) direkt nachlesen, darunter auch ihre lakonische Bemerkung zur Katastrophe: »Uns geht es recht gut Haus und Wohnung steht noch« (26. 2. 1945). Ihre Geburtstagswünsche verknüpft sie mit dem vergeblichen Wunsch nach einem Besuch – »hoffentlich sehen wir uns dann bald mal. Zu deinem 46ten Geburtstag wünschen wir mein herzensguter Junge Millionenfaches Aller=Allerbestes bleib immer gesund und munter in dieser furchtbaren Zeit« (20. 2. 1945). Natürlich war die Postverbindung in beide Richtungen gefährdet, und auch Bekundungen der Sehnsucht blieben nicht aus: »Wenn doch recht bald ein Lebenszeichen von meinem guten Jungen käme.« (22. 2. 1945)[7]
Doch sogar in der Mayrhofener Zeit riss die Postverbindung nicht ab; erst mit Kriegsende hörte Ida Kästner mehrere Monate nichts von ihrem Sohn, in dieser Zeit nahm ihre Altersdemenz in einem Ausmaß zu, dass sie sich nicht mehr erholte. Sie verbrachte ihre letzten Jahre bis zu ihrem Tod 1951 in einer Pflegeeinrichtung, kaum noch ansprechbar, bei einem späten Besuch Erich Kästners erkannte sie ihn nicht mehr.
Fußnoten
Erich an Ida Kästner, 21. 11. 1944; Nachlass Erich Kästner im Deutschen Literaturarchiv Marbach (DLA).
Einer von ihnen war Kurt Vonnegut, der 1969 darüber seinen Roman Slaughterhouse-Five or The Children’s Crusade veröffentlichte; deutsch 1970/2016 (Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug).
Alle Zitate nach dem Konvolut Ida Kästner im Nachlass Erich Kästner (DLA).
1945 (II): Mayrhofen
I will show you fear in a handful of dust. T.S. Eliot, The Waste Land (1922)
Es lässt sich einigermaßen präzise rekonstruieren, wie die ganz und gar unwahrscheinliche Chance, das Kriegsende mit einem Ufa-Filmteam in Mayrhofen zu überleben, zustande kam. Heinrich Breloer hat 1986 einen Dokumentarfilm über diese Zeit gedreht, Das verlorene Gesicht. Er konnte zwölf Jahre nach Kästners Tod noch einige der Beteiligten sprechen, darunter vor allem den Schauspieler Ullrich Haupt und Luiselotte Enderle. Sie erzählte ihm, einer der Initiatoren der Filmexpedition sei Wolfgang Liebeneiner gewesen, seit 1942 einer der Produktionschef der Ufa: »Und der hatte den Wunsch, die einzelnen Herstellungsgruppen etwas nach Norden und etwas nach Süden zu bringen, damit man gegebenenfalls nach dem Krieg gleich wieder zu produzieren anfangen konnte.«[8] Liebeneiners Herstellungsgruppe, mit Gustav Knuth, Karl Schönböck, Victor de Kowa und anderen, wurde in die Lüneburger Heide ›evakuiert‹, um dort den Phantomfilm Das Leben geht weiter zu drehen.[9] Kästners Freund Eberhard Schmidt leitete die andere Herstellungsgruppe, die nach Süden abgestellt wurde. Er hatte noch Formulare, die vom Reichsfilmintendanten Hans Hinkel blanko unterzeichnet worden waren. »Eberhard schrieb, ich sei der Autor des Drehbuchs, das in Mayrhofen verfilmt werde, und vervollständigte die Gültigkeit der Ausweise durch seine eigene Unterschrift.« (VI, 345) Luiselotte Enderle wurde, als Ufa-Dramaturgin, von Liebeneiner nach Innsbruck geschickt, »um mit einem dort wohnhaften Schriftsteller einen Filmstoff zu erörtern« (VI, 345f.). Kästner konnte sich aufgrund dieser tadellosen Reisepapiere noch die nötigen Unterlagen besorgen und holte sein Geld von der Bank. Er gehörte nun zu einem sechzigköpfigen Ufa-Team, das in Tirol angeblich die Außenaufnahmen des Films Das verlorene Gesicht drehen sollte. Schmidt war der Produktionsleiter, Harald Braun der Regisseur, Herbert Witt war neben Kästner Drehbuchautor; die Hauptrollen sollten Ullrich Haupt und Hannelore Schroth spielen.
Die Fahrt zusammen mit Schmidt nach Tirol ist im Tagebuch detailliert beschrieben; der zweisitzige DKW keuchte von einer Kontrolle der Feldgendarmerie zur nächsten, im Fränkischen Jura fing der Sperrholzwagen Feuer, das sich aber mit Schnee löschen ließ. In der Nähe von München, in Olching, pausierten die Fernreisenden bei Freunden Schmidts und stellten das marode Auto auf dem Gutshof unter. Schmidt erklärte dort seinen »Jugendgespielen«, die nicht recht verstehen konnten, »wozu Goebbels noch Filme brauche« (VI, 347), wie das ganze Filmunternehmen zustande gekommen war: »Man habe ein paar konsequente Lügner beim Wort genommen, nichts weiter. Da der deutsche Endsieg feststehe, müßten deutsche Filme gedreht werden. Es sei ein Teilbeweis für die unerschütterliche Zuversicht der obersten Führung. Und weil das Produktionsrisiko in den Filmateliers bei Berlin täglich wachse, müsse man Stoffe mit Außenaufnahmen bevorzugen.« (VI, 348) Auch Ullrich Haupt erzählte, Goebbels habe den Trick offensichtlich nicht durchschaut. Alle Filmleute waren sich über ihren ›Auftrag‹ im Klaren. Auf die Frage, ob er das Drehbuch gelesen habe, antwortete Haupt: »Ach woher! Stellen Sie sich mal vor, aus dem brennenden, bebombten Berlin fragt einer: ›Wollen Se ins Gebirge?‹ Da lesen Se kein Drehbuch, da fahren Se hin!«[10]
Nachdem Schmidt und Kästner mit Nahverkehrszügen glücklich in Mayrhofen eingetroffen waren, blieben Kästner und Enderle von Mitte März bis Anfang Juni hier in der Pension Steiner, bei »sehr freundlichen Leuten. Er hält Vieh. Sie ist die Hebamme des Ortes. Viktoria, die Tochter, hilft im Haus. Ein Sohn ist gefallen. der andere kämpft noch irgendwo« (VI, 350). Heinrich Breloer hat auch Viktoria Steiner ausfindig gemacht; sie zeigte ihm das Schlaf- und das damalige Arbeitszimmer Kästners, doch ein bisschen mehr als eine »unbeheizbare Dachkammer«.[11] Am 25. März 1945 notierte Kästner, dass der Bürgermeister und der Ortsgruppenführer von Mayrhofen Steiners besuchten und ihnen die Nachricht brachten, auch ihr zweiter, erst 18-jähriger Sohn sei gefallen. »Wir traten vor die Haustür und hörten die Frauen schreien. Mit Weinen hatte ihre Klage nichts zu tun. Es klang gräßlich und wie in einer Irrenanstalt. […] Was dann folgte, weiß ich nur vom Hörensagen. Der Vater erlitt einen Herzanfall. Die Mutter riß das Hitlerbild von der Wand. Sie wollte es zertreten und in den Garten hinauswerfen. Später machte sie zweimal den Versuch, durch die Hintertür in die Nacht zu rennen. Beide Male wurde sie gepackt und zurückgehalten. Heute früh hing das Hitlerbild wieder an der Wand. Und vor Hansl Steiners schwarzumrahmter Fotografie, nicht weit von der des Bruders, stand ein Teller mit Gebackenem.« (VI, 355)
Viktoria Steiner fand diese Beschreibung »a bißl übertrieben«, »wie halt die Schriftsteller sind, a bißl übertreibens«. Sie liest in Breloers Film ein Gedicht vor, das Kästner für Steiners geschrieben hat und das sich in keiner Ausgabe findet: »Und wieder nahn wir Deinem Thron, o Herr, vor Tränen blind. / Du nahmst uns auch den letzten Sohn, / und der war noch ein Kind. / Sein Leben ist so rasch verweht, / wie über Dach der Rauch. / Wie schwer das unser Herz versteht, / o Herr, den zweiten auch. / Vergeblich war es, das Gebet: / Laß einen auf der Welt. / Der Krieg hat beide abgemäht, / wie Blumen auf dem Feld. / Nun fuhr der Tod die Ernte ein, / durchs ferne Himmelstor, / Millionen Eltern stehn allein / und schauen stumm empor. / Krieg nimmt ein End, / Schmerz endet nie, / bis er das Herz zerbricht. / Herr, tröste uns und tröste sie, / wir selber können’s nicht.«[12] So konventionell die Bildersprache sein mag, so wenig sie zum kühlen ›neusachlichen‹ Kästner passen mag – immerhin handelt es sich um mitfühlende Gelegenheits-, ja Gebrauchslyrik, von der Sprecherin in Breloers Film ein bisschen leiernd vorgetragen wie ein Gebet in der Kirche. Ganz verstellen musste sich der Verfasser dafür sicher nicht – immerhin erklärt er sich unzuständig für Trost, und der unbarmherzige ›Krokodilsgott‹ des Gedichts hat nicht viel mit dem regional zuständigen katholischen Herrn zu tun.
Die Dorfbevölkerung duldete die Berliner nur widerwillig. Besonders die Leiterin eines evakuierten Lehrerinnenseminars am Ort, eine ›fanatische‹ Nationalsozialistin, fühlte sich von den Großstädtern gestört. Sie war mit dem Tiroler Gauleiter Franz Hofer befreundet und zettelte einen Versuch an, die Berliner für den Volkssturm heranzuziehen und sie vier Wochen lang beim »Kreisstandschützenkommando« auszubilden.[13] Durch den Druck von Berliner Behörden konnten Schmidt und Harald Braun die Aktion abwenden; dafür bemühten sie sich, die Mayrhofener bei Laune zu halten: Sie bekamen die Welturaufführung von Josef von Bákys Via Mala zu sehen, einem Film, der 1944 fertiggestellt worden war und der vor Kriegsende nicht mehr in die Kinos kam. Dessen Außenaufnahmen waren tatsächlich in Mayrhofen gedreht worden, anders als die markierten Dreharbeiten der Schmidt-Produktionsgruppe: »Die Kamera surrte, die Silberblenden glänzten, der Regisseur befahl, die Schauspieler agierten, der Aufnahmeleiter tummelte sich, der Friseur überpuderte die Schminkgesichter, und die Dorfjugend staunte. Wie erstaunt wäre sie erst gewesen, wenn sie gewußt hätte, daß die Filmkassette der Kamera leer war! Rohfilm ist kostbar. Bluff genügt. Der Titel des Meisterwerks, ›Das verlorene Gesicht‹, ist noch hintergründiger, als ich dachte.« (VI, 370)
Seit dem 4. Mai 1945 hieß die ›Ostmark‹ wieder Österreich, Kästner nimmt amüsiert die Kehrtwendungen der Bürger zur Kenntnis. Aus den Fahnen mit dem Hakenkreuz im weißen Kreis auf rotem Grund nähten die Bäuerinnen mit Hilfe einiger Betttücher rot-weiß-rote österreichische Fahnen; die »Hausväter« standen vor ihren Spiegeln, »zogen Grimassen und schabten, ohne rechten Sinn für Pietät, ihr tertiäres Geschlechtsmerkmal, das Führerbärtchen, von der Oberlippe« (VI, 391; 4. 5. 1945). Hitler hatte sich am 30. April erschossen, am 8. Mai unterzeichnete Wilhelm Keitel die Kapitulationsurkunde. Mayrhofen wurde zum Verkehrsknotenpunkt: Die italienischen Zwangsarbeiter zogen nach Italien zurück, die geschlagene deutsche Armee floh nach Deutschland, am 5. Mai kamen die ersten Amerikaner, die Widerstandskämpfer aus dem Untergrund konnten sich wieder zeigen. Eberhard Schmidt versuchte, bei den Bavaria-Filmstudios in Geiselgasteig neue Aufträge zu organisieren, und schickte den Filmbeauftragten der Besatzungsbehörde, Bill Kennedy, nach Mayrhofen; der stellte auch Kästner Arbeit für den Herbst in Aussicht.
Wieder in Olching bei Schmidts Freunden, hörte Kästner von der Besetzung von Thüringen, Sachsen und Mecklenburg durch sowjetische Truppen – eine Reise nach Dresden zu den Eltern war damit in weite Ferne gerückt. Kästner musste sich einem ersten Verhör durch amerikanische Offiziere unterziehen; er musste sich die Frage anhören, warum er in Deutschland geblieben sei, und detailliert über seine Auslandsreisen Auskunft geben. Seine Erinnerungen an das Gespräch klingen, als hätten beide Seiten einander nicht recht verstanden – Kästner wusste nicht, worauf Joseph Dunner hinauswollte, und der »bohrte an mir herum wie ein Dentist an einem gesunden Zahn. Er suchte eine kariöse Stelle und ärgerte sich, daß er keine fand. Was ich zwölf Jahre lang getan und wovon ich gelebt hätte? […] warum war ich, unmittelbar nach dem Reichstagsbrand, nach Berlin zurückgekommen, statt in der Schweiz zu bleiben […]? Um Augenzeuge zu sein? Wovon denn Augenzeuge? Als verbotener Schriftsteller und unerwünschter Bürger? Wie hätte ich denn hinter die Kulissen blicken dürfen?« (VI, 439; 18. 6. 1945) Angesichts dieser zweifellos berechtigten Fragen von Dunner gerät das Romanprojekt Kästners wieder in den Blick; das Überleben in der Diktatur erforderte ein Mindestmaß an Anpassung, auf die Kästner nicht gerade seinen verhörenden US-Offizier hinweisen wollte. Im Tagebuch notiert er sich aber die Frage, »wann es möglich sein wird, den Leuten ein Bild vom wirklichen Verlauf zu geben«, sie »können sich nicht in das Leben von uns hineinversetzen« (18. 6. 1945), und mit dem geplanten Roman wäre das zweifellos möglich geworden – hier kommt auch ein Zungenschlag von Rechtfertigung ins Spiel. Letztlich wurde Kästner bescheinigt, er sei von dem »Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. März 1946nicht betroffen«, wenn auch erst 1946 und von der 10. Münchner Spruchkammer.[14]
Die Bewegungsfreiheit nahm bereits 1945 wieder zu; auf kurzen Ausflügen nach München konnte Kästner alte Bekanntschaften und Freundschaften wieder anknüpfen – er traf Wolfgang Koeppen, Robert A. Stemmle, Rudolf Schündler und Werner Buhre. Mit Schündler, Arthur Maria Rabenalt und Eberhard Schmidt wurde ein Kabarett geplant, das einmal Die Schaubude heißen sollte. Bei Kästners zweiter Vernehmung in München musste er den sechsseitigen Fragebogen der amerikanischen Besatzer ausfüllen. Für ein paar Tage kehrte er nochmals nach Mayrhofen zurück, Kennedy besuchte ihn ein weiteres Mal, diesmal in Begleitung eines britischen Presseoffiziers: »Es war Peter de Mendelssohn!« (VI, 461) Man erzählte sich gegenseitig die Unglücke der letzten Jahre; Mendelssohn war neben Robert Neumann und Klaus Mann einer der wenigen Emigranten, die umlernen konnten und in englischer Sprache geschrieben hatten. In Details hat Mendelssohn Notabene 45 korrigiert und Kästner auch gebeten, seine Darstellung zu ändern: Nach seiner Erinnerung habe man in Mayrhofen nicht Streuselkuchen gegessen, sondern Napfkuchen; und Hilde Spiel und er hätten zwar 1943 ein Kind verloren, aber nicht bei einem deutschen Bomberangriff. Der Verlust »hatte seine Ursache in einem abscheulichen Ungluecksfall infolge der chaotischen Zustaende in der Klinik bei der Entbindung und der allgemeinen seelischen und nervlichen Zermuerbung durch den Krieg«. Bei den letzten ›verzettelten‹ Angriffen auf London im Januar 1944 geschah ihnen »das zweite Unglueck, das in Ihrer Darstellung mit dem ersten durcheinander geraten ist. In der Nacht vom 28. Januar 1944 kriegten wir einen Tausend-Kilo-Batzen auf den Kopf und unser Haus brach ueber uns zusammen. Hilde warf sich quer ueber das Bett unserer kleinen, damals vierjaehrigen Tochter Christine, um sie zu schuetzen. Waere die schwankende Mauer, an der das Bett stand, statt nach rechts nach links umgekippt, so haette sie Mutter und Kind erschlagen. So erschlug sie meinen Schreibtisch.«[15]
Mendelssohns Motiv, Kästner in Mayrhofen aufzusuchen, war aber nicht der Austausch persönlicher Erinnerungen. Er bot ihm die Mitarbeit an einer neuen, noch zu gründenden Zeitung an, der Süddeutschen Zeitung; Kästner mochte noch nicht zusagen: »Ich machte alles Weitere […] davon abhängig, ob die erste Station auf meiner Rückreise ins öffentliche Leben München heißen werde oder nicht. So blieb das Thema in der Schwebe.« (VI, 461) Dass der designierte SZ-Chefredakteur langjähriger »Hauptschriftleiter« der katholischen Zeitschrift Hochland gewesen war, mag ein weiterer Grund für Kästners Reserviertheit gewesen sein.
Gerüchte von einem Abzug der amerikanischen Besatzer zugunsten französischer beendeten das Tiroler Idyll. Aus sicherem Abstand ironisiert Kästner die Angst der Ufa-Leute vor den neuen Herren, nordafrikanischen Regimentern mit »Soldaten einer recht fremdartigen Rasse«, denen »der Ruf vorausging, ihr Appetit auf europäische Frauen kenne keine Rücksicht« (VI, 466) – im originalen Tagebuch vermerkt er nur lakonisch, Vorarlberg solle »geräumt werden« (29. 4. 1945). Enderle und Kästner blieben für einen knappen Monat, den Juli 1945, in Schliersee bei Enderles Schwester Lore. Seltene Besucher hielten Kästner auf dem Laufenden, ein amerikanischer Sanitätsfeldwebel sorgte für die Verpflegung. Kästner beendet Notabene 45 wie das originale Tagebuch mit der Erzählung eines den Konzentrationslagern Auschwitz, Melk und Ebensee entronnenen Häftlings, Männe Kratz. Im August 1945 ist Kästner in München angekommen, er wird eine Stelle als Feuilletonchef der Neuen Zeitung antreten, dem Blatt der amerikanischen Besatzungstruppen.
Fußnoten
Enderle in Breloer 1986. – Die Darstellung der Mayrhofen-Episode und des Verhältnisses von Tagebuch und Notabene 45 folgt Hanuschek 1999 u.ö.
Knuth 1974, S. 184f.
Haupt zit. n. Breloer 1986.
Enderle 1966, S. 79.
Steiner zit. n. Breloer 1986.
Landrat des Kreises Schwaz. Heranziehung zum kurzfristigen Notdienst, 5. 4. 1945; Nachlass Kästner (DLA).
Notariell beglaubigte Abschrift im Nachlass Kästner (DLA).
Mendelssohn an Kästner, 28. 3. 1961, Nachlass Kästner (DLA).
»Vom Selbstverschönerungsverein schon gar nicht«? Zum Verhältnis von Notabene 45 zu den Kriegstagebüchern
Erich Kästner war ein begabter Selbstdarsteller, nicht nur seiner Mutter gegenüber, auch seinem Publikum, seinen intellektuellen Zeitgenossen, seinen Kritikern gegenüber. Erfolgreich hat er seine Rolle in der Hitler-Diktatur verteidigt, auch gegenüber so kritischen Emigranten wie Robert Neumann. In seiner Autobiografie rechnete Neumann ihm hoch an, dass er in Deutschland geblieben war »und dabei rein durch den Stil seiner Existenz all jene Lügen strafte, die behaupten, man habe wenigstens mit halber Lautstärke mit den Hunden heulen müssen, um ihnen nicht zum Fraße vorgeworfen zu werden. Kästner heulte nicht. Er konspirierte nicht […]. Was Kästner tat, war bloß: er setzte sich sichtbar ins Kaffeehaus, er schrieb ein, zwei Filme ohne ein politisches Wort, er rührte Goebbels zuliebe nicht einen Finger. Nichts geschah ihm. Wie es ja überhaupt auch für Schriftsteller keinen ›Befehlsnotstand‹ gab, diese Nach-Nazi-Ausrede der Feiglinge – sondern nur einen endemischen Mangel an Zivilcourage.«[16]
Zweifellos ist Neumann hier dem Freund sehr zugewandt; immerhin gehört zu den Filmdrehbüchern ja auch Münchhausen, der große Jubiläumsfilm der Ufa. Hier lassen sich aber Durchhalte-Mentalität ebenso herauspräparieren wie die Kritik an einem wahnsinnigen Regime und die Konstatierung einer Zeit, die aus den Fugen ist. Vielleicht hatte Neumann also doch auch diesen Film im Sinn. Der Kaffeehaustisch und Kästners tatsächliches Verhalten, wie es sich im Folgenden wird nachvollziehen lassen, sind hier schon so falsch nicht beschrieben.
Die umfangreichste Selbstdarstellung hat Kästner im veröffentlichten Tagebuch Notabene 45 geleistet; abgesehen von dieser Publikation in den frühen sechziger Jahren gibt es zu Lebzeiten nur knappe Interviews, einzelne Reden über Teilaspekte (wie die Bücherverbrennung) und kleine autobiografische Notizen für PEN-Verzeichnisse, meist recht pauschale Zehnzeiler, in denen er davon spricht, er sei während der Diktatur zwölf Jahre verboten gewesen. Im veröffentlichten Tagebuch dagegen beschreibt er ausführlich seine äußeren Lebensumstände vom 7. Februar bis zum 2. August 1945, mit zahlreichen eingeschobenen Anekdoten und Rückblenden aus den vergangenen zwölf Jahren. Notabene 45 ist, ähnlich wie das Parabelstück Die Schule der Diktatoren (1956), ein ungeheuer ambitionierter und befrachteter Text – er sollte die ›Aufarbeitung‹ des Nationalsozialismus durch den Autor belegen, zum Teil auch den großen Zeitroman über das ›Dritte Reich‹ ersetzen, den Kästner ja mehrfach als Grund angegeben hatte, warum er in Deutschland geblieben war, und damit auch seine Entscheidung für die ›innere‹ und gegen die ›äußere‹ Emigration rechtfertigen.
Kästner sah sein Tagebuch als eines von vielen »kleinen Bildern« (VI, 306), die Notate als »Beobachtungen aus der Perspektive einer denkenden Ameise« (VI, 304). Die ›kleinen Bilder‹ des knappen halben Jahres sind bunt genug und so anschaulich geschrieben, wie das eben nur Kästner konnte. In seinen Vorbemerkungen zu Notabene 45 erläutert er, wie er bei der Veröffentlichung mit dem Originaltagebuch umgehen wolle: »Meine Aufgabe war, die Notizen behutsam auseinanderzufalten. Ich mußte nicht nur die Stenographie, sondern auch die unsichtbare Schrift leserlich machen. Ich mußte dechiffrieren. Ich mußte das Original angreifen, ohne dessen Authentizität anzutasten.« (VI, 304) Kästner beschreibt hier ein Paradox – entweder sein Dokument ist authentisch, oder er hat es verändert, ›angegriffen‹. Die Veränderung der Form, der Sprache gar, verändert aber auch das Gesagte. Er konnte den Kuchen nicht essen und behalten, behauptete aber, genau dies habe er getan: »Ich habe den Text geändert, doch am Inhalt kein Jota.« Das Buch sei nach wie vor »ein Dokument«, es sei »das Journal geblieben, das es war«, seine Irrtümer habe er »sorgfältig konserviert, auch die falschen Gerüchte, auch die Fehldiagnosen. Ich wußte nicht, was ich heute weiß« (VI, 304f.). Er sei »nicht vom Verschönerungsverein«, und vom »Selbstverschönerungsverein schon gar nicht« (VI, 305). Fünfzehn Jahre lang hatte Kästner bis zu diesem Text hin Darstellungen des ›Dritten Reichs‹ gelesen, und das einigermaßen systematisch; die Vorstellung, dieses Wissen bei der Bearbeitung des originalen Tagebuchs einfach ausblenden zu können, klingt naiv. Der Notabene 45 Anfang der sechziger Jahre schrieb, war ein anderer als der Diarist im nationalsozialistischen Deutschland der Kriegsjahre, dessen geistige Statur wir mit dem vorliegenden Band nachvollziehen können.
Sein Buch ist von der zeitgenössischen Kritik als ›prophetisch‹ beschrieben worden, als Beispiel dafür, was die ›guten Deutschen‹ schon vor Kriegsende haben wissen können. Für Jean Améry war es ein »einzigartige[s] Dokument«,[17] Hermann Kesten lobte Kästners Sprache, »die ganz einfach und natürlich klingt, wie geschwinde, genaue erzwahrhaftige Notizen«;[18] Sybil Gräfin Schönfeldt rühmte »dieses penibel authentisch gehaltene Tagebuch«, das sich lese »wie eine grandios erfundene Geschichte im Stil und mit der Wirkung eines authentischen Tagebuches«.[19] Ein Vergleich mit dem Originaltagebuch zeigt, dass Kästner zu einem kleinen Teil so verfahren ist, wie er das behauptet hat: Er hat seine Notizen in diesen Fällen tatsächlich nur vervollständigt, ganze, lesbare, vor allem verständliche Sätze aus ihnen gemacht, nötige Kontexte nachgeliefert, aus der Erinnerung weitere Details hinzugefügt, karge, angedeutete Anekdoten zu auch stilistisch ausgefeilten gemacht; die oben zitierten Notabene-Passagen lassen sich ohne Weiteres neben die im Folgenden abgedruckten originalen aus den vierziger Jahren stellen.
Darüber hinaus hat er aber in Notabene 45 eine Kommentarebene eingezogen, die sich nun im Original kaum rudimentär findet; schwere Eingriffe, die besonders Kästners damalige Einschätzungen verändern, sie oft überhaupt erst einfügen. Die Tagebucheinträge haben häufig eine Zweiteilung; zuerst schildern sie einen Vorgang, anschließend kommentieren sie ihn. Bei diesen zweiten Teilen in Notabene 45 kann man fast durchgehend sicher sein, dass sie erst 1960 geschrieben wurden. Dabei kann es sich um ganz legitime Zuspitzungen, Redensarten, Sprichwörter à la »Die Kleinen hängt man, die Großen lassen sich laufen« handeln (VI, 340); aber auch um fragwürdige ›kulturkritische‹ Allgemeinheiten: »Über den schizoiden Menschen ist viel geredet worden. Es wäre soweit, über die Schizophrenie der Ereignisse nachzudenken.« (VI, 371) Das Schema der Ergänzungen lässt sich am Eintrag zu Hitlers Geburtstag verdeutlichen; im Original schreibt Kästner: »Gestern war also Hitlers Geburtstag.« (21. 4. 1945) In Notabene 45 wird daraus: »Gestern war Hitlers 56. Geburtstag. Der letzte Geburtstag? Der letzte Geburtstag.« (VI, 372) Über Hitlers Tod notiert Kästner kommentarlos, wenn auch mit ironisierender Markierung: »Hitler ist in Berlin ›gefallen‹.« (2. 5. 1945) Für den Druck schreibt er: »Hitler liegt, nach neuester Version, nicht im Sterben, sondern ist ›in Berlin gefallen‹! Da man auf vielerlei Art sterben, aber nur fallen kann, wenn man kämpft, will man also zum Ausdruck bringen, daß er gekämpft hat. Das ist nicht wahrscheinlich. Ich kann mir die entsprechende Szene nicht vorstellen. Er hätte dabei mit Ärgerem rechnen müssen, mit der Gefangennahme, und dieses Spektakel konnte er nicht wollen. Ergo: er ist nicht ›gefallen‹.« (VI, 385) Weitere Beispiele sind müßig; das Schema zieht sich durch das ganze Buch, wobei gerade hier fraglich bleibt, ob Kästner tatsächlich nur etwas wortreich seine distanzierenden Anführungszeichen ausformuliert, den späteren Leserinnen und Lesern erklärt.
Eine weitere Einschränkung der behaupteten ›Authentizität‹ ist die durchgehende Metaphorisierung des Buches. Kästner konnte offenbar kaum ein Ereignis in seiner ursprünglichen nüchternen Beschreibung stehen lassen, er musste sich immer noch ein ›witziges‹ Bildchen dazu ausdenken; in ihrer Häufung wirken sie oft unangemessen, oder sie treten einfach auf der Stelle. Auch ohne die Gegenkontrolle mit dem Original wirken diese Passagen unglaubhaft – ein nüchterner Tagebuchschreiber hält sich nicht mit preziösen Analogien auf, hier ist das Original der überarbeiteten Version haushoch überlegen. Kästners letzter Berlin-Eintrag schließt: »Ich klebe hier fest wie eine Fliege an der Leimtüte.« (VI, 341) Sein erster aus dem Zillertal beginnt: »Die Fliege klebt nicht mehr an der Tüte. Es hat ihr jemand aus dem Leim herausgeholfen. Eine Art Tierfreund? Der Vergleich hinkt.« (VI, 345) Dann hätte er ihn weglassen können, wie er das im Original auch getan hat. Solche Formulierungen gibt es im 1961er-Buch immer wieder: Die Zeit spielt Kaleidoskop, die verkehrte Welt herrscht, Kästner lebt als Käfer zwischen Baum und Borke, und so weiter, und so fort.
Mag man diese Interpolationen noch als unterhaltsames Kabarett akzeptieren, als Auflockerung des zeitgeschichtlich strengen Stoffs, fällt das bei einem durchgehenden Bild sehr viel schwerer. Kästner verwendet immer wieder die Theater- und Filmmetaphorik für die Vorgänge in Deutschland: »Wir hatten ein kleines Stück Geschichte gesehen, als wären es ein paar Meter Bergfilm gewesen, und waren wieder unter uns.« (VI, 399) Beim Blick auf das brennende Berlin, vom sicheren Ketzin aus, überliefert er als Kästner-Bonmot: »Es ist, als komme man ins Kino, und der Film habe schon angefangen.« Eine der neben ihm stehenden Frauen habe daraufhin die Taschenlampe »kurz aufblitzen« lassen »und fragte geschäftig: ›Darf ich, bitte, Ihre Eintrittskarten sehen? Was haben Sie für Plätze?‹ ›Natürlich Loge‹, antwortete Karl, ›Mittelloge, erste Reihe!‹« (VI, 310) Hitler kopiere Muster aus dem Lesebuch und spiele Napoleon-Dramen nach; seitenlang malt sich Kästner diese Analogie aus: »›Die Kontinentalsperre‹, ›Die Landung in England‹ und ›Wende und Ende vor Moskau‹« habe Hitler »textgetreu inszeniert« (VI, 375). Die Österreicher hätten eben Theaterblut, auch dies eine unverdauliche Metapher wie alle Bemerkungen Kästners zu den ›Ostmärkern‹, als gebe es nicht genug vor der eigenen Tür zu kehren (so nachvollziehbar die Bemerkungen aus der Situation selbst ja sind). Bei Hitlers letzter Inszenierung, »Die Belagerung und Befreiung Berlins«, werde man ohne den Polenkönig Sobieski und sein Entsatzheer auskommen müssen: »In der letzten Minute der letzten Szene kann kein Mensch den Sobieski übernehmen, dafür ist die Rolle zu schwierig. Und so wird das Stück schlimm enden.« (VI, 375f.) In Ansätzen findet sich diese Metaphorik bereits im hier vorliegenden Original.
Heinrich Breloer hat mehrere Zeitzeugen nach ihr gefragt, und alle widersprachen mehr oder minder heftig. Sie hätten nicht im Theater gelebt; Theater habe im Unterschied zur Zeitgeschichte eine Ordnung; Hitler sei in Babelsberg nicht als schlechter Schauspielkollege angesehen, sondern von den nicht wenigen, die in dauernder Gefahr lebten, gehasst worden. Am deutlichsten formulierte Ullrich Haupt seine Ablehnung: »Erstmal ist das leider Gottes kein Theaterstück gewesen. Und […] wenn gelebte oder erlebte Geschichte zu einem Geschichtsbild geformt oder umgeformt wird, dann ist das besonders bei Literaten immer mit einem kleinen schielenden Blick auf die Ewigkeit hin. […] Was immer fehlt, ist die irrsinnige Angst, die dahintersitzt.« Wirklichkeit ist kein Film; Kästners berufsmäßige Neugier und seine schätzenswerte Rolle als Beobachter, der nicht dazugehörte, verführten ihn zu falschen Schlüssen. Haupt benannte den Fehler an dieser Haltung: »Die absolute Subjektivisierung. Dieser kleine, schicke Trick: Ich in der Loge – er hatte ein Arbeitszimmer, war hier der Tisch, da war ein Fenster, da sah man auf Tennisplätze, und da auf die Berge – und ich, mit einem Abstand glücklicherweise abgeschrieben, so daß man mich gar nicht mehr wahrnimmt – sehr kokett! – sehe nun so’n bisschen wie der liebe Gott zu.«[20]
Entscheidende Interpolationen betreffen aber nicht nur den Bilder- und Metaphernreichtum des Buches. Einige Wertungen von 1945 hat Kästner ausgelassen, etwa in der Aufzählung inzwischen abgehalfterter Nazi-Größen die vergleichsweise lobende Erwähnung Goebbels’: »Am besten hat sich noch Goebbels aus der Affäre gezogen, der Intellektuelle, als er mit seiner Familie gemeinsam Schluss machte.« (24. 5. 1945) Und Kästner hat seine eigene Rolle gebührend Notabene 45 eingeschrieben, im Original findet sich davon kein Wort: »Gestern warnte mich jemand. Die SS, das wisse er aus zuverlässiger Quelle, plane, bevor die Russen einzögen, eine blutige Abschiedsfeier, eine ›Nacht der langen Messer‹. Auch mein Name stünde auf der Liste. Das ist kein erhebender Gedanke.« (VI, 341) Mag sein, dass Kästner ein solches Gerücht nicht notieren musste, weil nicht anzunehmen war, er könnte es vergessen. Dass Kästner allein die »Achillesferse«, der einzige »schwache Punkt« der Ufa-Leute gewesen sein soll, klingt bei einem derart surrealen und permanent gefährdeten Unternehmen jedoch nicht recht glaubwürdig. »Ein kurzes Telefongespräch mit dem Propagandaministerium oder auch nur mit dessen Innsbrucker Filiale würde ausreichen, Eberhards gewagtes Spiel zu durchkreuzen. Wir könnten nur hoffen, daß die örtlichen Amts- und Würdenträger meinen Namen niemals gehört oder längst wieder vergessen haben.« (VI, 352f.) Sicher wird so ein Anruf ausgereicht haben – aber er hätte auch andere Personen betreffen können oder Sachverhalte wie etwa den, dass der ganze Ufa-Aufwand nur Mummenschanz mit einem klaren Ziel war, dem Davonkommen von sechzig Menschen. Schließlich schrieb Kästner, wieder nur in der gedruckten Fassung, wie er sich vor einem drohenden Besuch des Staatsrats Hans Hinkel bei den Bavaria-Studios in München sorgte: »Jetzt fehlt nur noch, daß Hinkel das Bedürfnis empfände, in Mayrhofen nach dem Rechten zu sehen! Er würde nicht wenig erstaunt sein, wenn er mich zu Gesicht bekäme. Und beim Staunen ließe er es wohl kaum bewenden. Dafür wäre, bei der Art unserer Bekanntschaft, kein Anlaß. Ich müßte mir vom Maskenbildner einen Schnurrbart kleben lassen und mich auf Steiners Alm verkriechen. Doch auch dann fände er meinen Namen auf der Ufa-Liste!« (VI, 371f.) Schmidt habe über Kästners Sorgen gelacht, Hinkel werde nicht kommen, und falls doch, werde er Kästner geflissentlich übersehen und ihn das merken lassen, »denn das könne ihm, eines Tages nach Torschluß, von bescheidenem Nutzen sein« (VI, 372).
Im Original ist von einer Gefährdung Kästners durch den Reichsfilmintendanten keine Rede, hier findet sich die Mutmaßung, dass es dem Beamten mehr darum gehen werde, sich selbst kurz vor dem Zusammenbruch in Sicherheit zu bringen (21. 4. 1945). Überdies galt Hinkel als eher ›moderater‹ NS-Funktionär. Willi Schaeffers, der im ›Dritten Reich‹ das Kabarett der Komiker weiterführte, schrieb in seiner Autobiografie, der Staatsrat habe alle »Schikanen und Schwierigkeiten, die uns einige gestrenge Herren, vor allem seitens der SS, immer wieder bereiteten, […] geschickt geglättet«. Hinkel habe frühmorgens die Berichte in Goebbels’ Vorzimmer gelesen, »das Blatt, das uns betraf«, vernichtet und Schaeffers angerufen. »Im Nachthemd stand ich ihm Rede und Antwort.«[21]
Fußnoten
Neumann 1963, S. 422.
Améry 1974.
Kesten 1961.
Schönfeldt 1961.
Haupt zit. n. Breloer 1986.
Schaeffers 1959, S. 185.
Der nicht geschriebene Roman
Kästner ist von Kollegen mehrfach befragt worden, warum er nicht emigriert sei. Eine spätere, der Fragen leicht überdrüssige Antwort war das Epigramm Notwendige Antwort auf überflüssige Fragen: »Ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen. / Mich läßt die Heimat nicht fort. / Ich bin wie ein Baum, der – in Deutschland gewachsen – / wenn’s sein muß, in Deutschland verdorrt.« (I, 281) In seinen letzten Jahren beschlichen Kästner Zweifel, ob er sich richtig entschieden habe. Fritz J. Raddatz gegenüber sprach er davon, »falsch gelebt zu haben«; er soll Raddatz beschworen haben, die DDR zu verlassen: »Machen Sie sich nicht auch schuldig?«[22] Münchner Mitgliedern von Amnesty International erklärte er, er sei »nicht mehr der Ansicht, daß man entscheidend zur Beseitigung einer Diktatur dadurch beitragen kann, daß man bleibt«[23].
Eine andere Antwort, die Kästner 1945/46 oft gegeben hat, drehte sich um ein großes Projekt – den ›großen Roman des Dritten Reichs‹. Peter de Mendelssohn erinnerte sich an diese Antwort, 15 Jahre nach Kästners Tod: »Wir feierten ein Wiedersehn, und ich fragte ihn sofort: Erich, wie war das denn nun? Warum bist du eigentlich dageblieben? Hättst doch schließlich rausgehen können, dir diesen ganzen Ärger ersparen können. Sagt er: Ja, ich bin dageblieben, weil ich mir gesagt habe: einer muss das von Anfang bis zu Ende miterleben, und zwar nicht irgendeiner, sondern einer, der es dann nachher auch schildern kann, und den Leuten begreiflich machen kann. Sage ich, na, hast du denn ein Tagebuch geführt? – Sagt er, absolut, vom ersten bis zum letzten Tag ist alles da, und das werde ich jetzt verwenden. Das werd’ ich jetzt ausarbeiten. Ich sag’, du, das ist überhaupt das Wichtigste, was du als Schriftsteller jetzt machen kannst, du musst dieses Buch über die 12 Jahre Hitlerdeutschland schreiben. Das kann außer dir niemand, du musst es machen, versprich mir, dass du das machen wirst. Er sagt: ich verspreche dir’s, ich habe nichts anderes im Kopf augenblicklich. Wir haben ihn dann nach München geholt, an die Redaktion der Neuen Zeitung, da hab ich ein bissl mitgeholfen, und von da ab hab ich ihn dann regelmäßig gesehen, jedes Jahr mehrmals, und ihn immer gefragt, Erich, was ist mit dem Buch, und das Buch kam und kam und kam nicht, und er hat es natürlich nie geschrieben.«[24]
Ähnlich lebendige, etwas negativer gefärbte Erinnerungen hatte Ullrich Haupt. Auch er habe Kästner gefragt, warum er geblieben sei, als weltweit erfolgreicher Autor; leider kann sein Nach-Spielen und -Sprechen Kästners schriftlich kaum wiedergegeben werden: »Da sagt’ er, ›nein, nein, ich bin geblieben, weil einer von uns als Augenzeuge, all das miterlebend, hierbleiben musste, um nach dem Krieg den Bericht über diese Zeit, den Tatsachenbericht über diese Zeit zu schreiben.‹ Das fand ich ganz – das war ein Grund. Das war sogar etwas Heldenhaftes […]. Aber – 45 musst’ ich dann nach Amerika zurück, und dann kam ich Anfang der fünfziger Jahre wieder, treffe Herrn Kästner auf der Straße, ein wohlsituierter Herr, tadellos angezogen, mit einem schlichten Homburg und so weiter – es war ihm offensichtlich sehr peinlich, als er mich sah, und ich sagte ›Herr Kästner!‹, und ich dachte, na, vielleicht hat er dich nicht erkannt, ›ich bins doch, Ulli Haupt!‹, und er sagte, ›jaja, ich weiß schon‹ – er sächselte ja immer so’n bisschen. Ich sagte: ›Sagen Sie mal, Sie erinnern sich doch noch an unsere vielen Gespräche, und da haben Sie doch auch gesagt, […] dass Sie das Buch dieser Zeit schreiben wollten, den Augenzeugenbericht, den möcht’ ich gerne haben.‹ Das war ihm ganz schrecklich, und da sagte er: ›Das ist leider nicht geschrieben worden, und es tut mir furchtbar leid, und ich muss jetzt gehen‹, und weg war er.«[25]
Im hier vorliegenden stenografierten Originaltagebuch gibt es Notizen Kästners zu zwei Romanprojekten. Die Doppelgänger ist ein Fragment, von dem vermutlich Mitte der dreißiger Jahre bereits einige Kapitel existiert haben und das in einen zentralen Bildbereich von Kästners Gesamtwerk führt, das voller Spiegel, Oberflächen, doppelter Böden, Zwillingspärchen und eben Doppelgänger ist; offenbar hat er um 1940/41 über eine Fortsetzung nachgedacht.[26] Die weit umfangreicheren Teile der Notizen betreffen einen Roman ohne Titel, für den Kästner in mehreren Anläufen (und entsprechend mit einigen Wiederholungen) schon recht systematisch gesammelt hat – den Roman der Jahre in der NS-Diktatur. Kästner muss früh erkannt haben, dass er diesen Roman nicht schreiben würde. »Ich merkte, daß ich es nicht konnte. Und ich merkte, daß ich’s nicht wollte.« (VI, 305) Unter den Argumenten, die Kästner in seinen Vorbemerkungen von Notabene 45 versammelt, ist von seiner Skepsis gegenüber allen Verfahren die Rede, das Grässliche der Zeitgeschichte in irgendeine Form von ›Kunst‹ bringen zu wollen, Skepsis gegenüber »Kunst, die sich breitmacht«: »Wir müssen der Vergangenheit ins Gesicht sehen. Es ist ein Medusengesicht, und wir sind ein vergeßliches Volk. Kunst? Medusen schminkt man nicht.« (VI, 306) Was hat Kästner gemeint, nun, angesichts seiner Sammlung für den nicht geschriebenen Roman?
Um die Komisierung der Herrschenden, die Darstellung des »Nero Europas« als »den Hanswurst seiner selbst« (VI, 423) kann es nicht gegangen sein, denn zwei Anekdoten aus der Roman-Sammlung hat Kästner für Notabene 45 ausformuliert und unter den 28. Mai 1945 gesetzt, als Erzählungen Otto Wernickes und Gustav Knuths am Stammtisch bei Rappeport. In der Kurzfassung der Romanfragmente lauten sie: »Hitler im Wintergarten zu einer Schauspielerin: ›Da, fassen Sie mal, – die Muskeln. Göring kann höchstens eine halbe Stunde den Arm hochstrecken, dann muss er pausieren. Ich kann es zwei Stunden hintereinander.‹ Eine Schauspielerin begrüßt Hitler, mit erhobenem Arm; Hitler gibt ihr die Hand; dann umgekehrt, dann umgekehrt.« (Hier S. 245, vgl. VI, 422f.) Versuche, das Grauen mit farcenhafter Komik darzustellen, hat es selten, aber doch immer wieder gegeben, angefangen mit Charlie Chaplins Satire The Great Dictator (1940) und Heinrich Manns Roman Lidice (1942); extrem in seinem schwarzen Humor ist sicher George Taboris Theaterstück The Cannibals (1968), auch in Mutters Courage (1979) und Mein Kampf (1987) hat er Aspekte des ›Dritten Reichs‹ in grotesker Weise gestaltet. Alle diese Beispiele, wie Kästners entsprechende Einträge, zeigen, dass Komik immer auch ein Mittel der Distanzierung ist, als Medusenschminke durchaus ungeeignet – hier wird nicht zugedeckt, sondern sichtbar gemacht.
Angesichts der Roman-Notizen hätte man sich eine Art Fabian im ›Dritten Reich‹ vorstellen können, einen neuen Jakob Fabian, nachdem der Gang vor die Hunde stattgefunden hat. Ein solcher Charakter wäre ein kritischer Beobachter gewesen, ein Zeitzeuge mit satirischem Blick, vielleicht nicht zuallererst ein Widerstandskämpfer, aber die hätten als ›typische‹ Protagonisten ohnehin nicht zur Verfügung gestanden. Der neue Antiheld wäre wieder ein guter Sohn geworden, einer, »der da bleibt, um Chronist zu sein«, und der seine Eltern »nie in gefährlichen Situationen im Stich ließ« (Roman D, S. 235). Eine Notiz über die »Eltern in Dresden«: »Die Traurigkeit über das Benehmen dem Sohn gegenüber; über die Verständnislosigkeit des Staates dem ›guten Jungen‹ gegenüber.« (Roman D, S. 237) Dieser neue Fabian ist nicht mehr Werbefachmann, sondern ein Schriftsteller, ganz offensichtlich ein Alter Ego seines Verfassers, »der die Zeit überwintert, aber privat viele Abenteuer hat; […] man soll ihn für einen begeisterten Privatier halten. Er zeigt sich den Spitzeln als Bumerang. Hat Geld von Hollywood.« (Roman D, S. 236) Er schreibt an Theaterstücken mit und geht inkognito zu den Premieren, »während sich der ›Autor‹ verneigt« (Roman D, S. 235). Auch dieser Protagonist hätte viele amouröse Abenteuer erlebt oder beobachtet. Kästners Freundinnen bzw. zeitweilige Geliebte Cara Gyl und Herti Kirchner kommen in den Notizen vor, auch »Marianne«, mit der ein »er« nie dauerhaft zusammenkommen kann, weil immer einer von beiden fest gebunden ist, wenn der bzw. die andere gerade ›frei‹ ist. Überhaupt changiert in der Roman-Sammlung der Protagonist permanent zwischen ›ich‹ und ›er‹, nachdem Kästner ein realistisch arbeitender Schriftsteller war, hätte er die Figur zweifellos nah an sich herangeschrieben. Die historischen Ereignisse sollten in »Sondertexten« integriert werden oder eben in anekdotischer Form wie in Notabene 45; auch die wiederholte Auseinandersetzung Kästners mit Nietzsche nimmt einigen Raum ein. Das Selbstbild des Autors als ›Idealist‹ in politischer Hinsicht hätte ein Grundthema des Romans werden können, »ein Wahnsinn, Idealist zu sein und für die Masse, dieses Pack, die tödlichen Konsequenzen zu ziehen. Ossietzky, der außerdem auch für Tucholsky den Kopf hinhielt. Was allerdings auch Tuch nicht vor seinem Schicksal bewahrte« (Roman D, S. 246