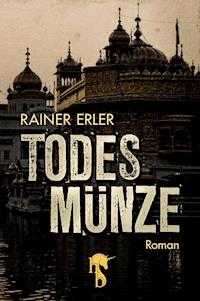3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Blaue Palais
- Sprache: Deutsch
Hinter der Fassade eines prächtigen Herrenhauses wird im Institut des Blauen Palais' an den explosivsten und umstrittensten Forschungsgebieten der Menschheit gearbeitet: Parapsychologie, Hirnforschung, bahnbrechende Energieformen – und endlich scheint das größte Faszinosum der Menschheit gelöst: Der schottische Forscher Ian McKenzie hat im Blauen Palais den Schlüssel zur Unsterblichkeit entdeckt. Doch die mit dem neuen genetischen Code programmierten Fliegen sind eine unberechenbare Gefahr für die Menschheit. Die Wissenschaftler im Blauen Palais aber wollen dennoch mehr – sie übertragen den Code auf Menschen und gehen damit einen Schritt zu weit ... Das Blaue Palais ist eine alte Villa, hinter deren Mauern exzellente Forscher das Unmögliche möglich machen. Die genialen Wissenschaftler um Louis Palm geraten immer wieder in hochexplosive, illegale Situationen und müssen feststellen, dass ihre Forschungen einen Preis haben ... Und so bleibt kein Fortschritt ohne Konsequenzen – für das Leben der Wissenschaftler oder für das der ganzen Menschheit ... Der Blaue-Palais-Zyklus besteht aus fünf eigenständigen Romanen: • Das Blaue Palais. Das Genie • Das Blaue Palais. Der Verräter • Das Blaue Palais. Das Medium • Das Blaue Palais. Unsterblichkeit • Das Blaue Palais. Der Gigant Für die fünfteilige Verfilmung der Science-Thriller wurde Rainer Erler von der ESFS (European Science Fiction Society) als bester europäischer Science-Fiction-Drehbuchautor ausgezeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Rainer Erler
Das Blaue Palais
Unsterblichkeit
Roman
1
Plötzlich schien in den Räumen des biochemischen Labors eine geradezu atemlose Stille zu herrschen. Die weißen Ratten hockten träge und regungslos hinter den Gitterstäben ihrer Käfige. Die Laufräder der Mäuse standen still. Das ständige Plätschern und Tropfen, das Sirren der Zentrifugen und Gefriertrockner, das Summen der Kühlschränke und der zahllosen kleinen Aggregate, die zerhackten, pulverisierten, mischten und rührten, die pumpten und destillierten, das alles schien mit einem Schlag verstummt zu sein. Nur die Klimaanlage, die das Labor mit einem Überdruck gefilterter, keimfreier Luft füllte, damit keinerlei Verunreinigung in die Räume eindrang, blies Louis Palm, dem Leiter des Blauen Palais, ihren kühlen Hauch ins Gesicht. Aber er achtete nicht darauf.
Er stand an dem kleinen Fenster dieses ehemaligen Kornspeichers in der Remise des Palais und sah hinüber zum Hauptgebäude mit seiner abgeblätterten blauen Farbe. Hinter fast allen Fenstern, in Büros und Labors brannten die kalten Leuchtstoffröhren. Dort wurde geforscht und gedacht, ein »Mini-Brain-Trust« junger Wissenschaftler, die frei und unabhängig von den Zwängen einer staatlichen Administration, auch frei vom Profitdenken der Industrie, der Natur und ihren Geheimnissen auf die Spur kommen wollten. Böen eines steifen Herbstwindes wirbelten die ersten gelben Blätter vom Park herüber in den Hof. Der alte Kühn, das Faktotum des Hauses, stand in Gedanken versunken vor einem Asternbeet, das er den Schnecken und dem Unkraut zum Trotz am Rand des verfallenen Springbrunnenbassins angelegt hatte. Er fühlte sich unbeobachtet, zog seinen grauen Arbeitsmantel aus, legte ihn sorgsam zusammen und setzte sich darauf, neben die spärlichen, struppigen Blüten. Er blinzelte in die gelbe Abendsonne und schob seine speckige Ledermütze aus der Stirn.
Palm lächelte. Aber dann lauschte er wieder hinter sich in diese ungewöhnliche Stille und hörte das hastige Rascheln von Papier. Er wandte sich um.
Sibilla Jacopescu, die ebenso charmante wie ehrgeizige Biologin des Blauen Palais, schob ihrem Freund und Kollegen Jeroen de Groot die letzten beiden losen Seiten einer vergilbten und zerfledderten Publikation über den Tisch und lehnte sich zurück. Sie sah Palm erwartungsvoll an: »Und? Wie geht es weiter?« Palm zuckte bedauernd die Schulter und verließ seinen Platz am Fenster. »Ich weiß es nicht. Das war alles, was wir noch finden konnten. Kühn hat den ganzen Heizungskeller durchsucht und alle Kartons mit Altpapier durchwühlt. Ich fürchte, wir werden das Resümee dieser Arbeit, die Quintessenz gewissermaßen, nie erfahren.« Er setzte sich auf einen der Hocker vor den Tisch mit den Mikroskopen und beobachtete Jeroen de Groot, der die letzten beiden Seiten gerade überflogen hatte. Der blickte nun auf, abwesend und irritiert.
»Ja«, sagte Palm, »das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Der Zufall hat mir diese Arbeit in die Hand gespielt. Und jetzt möchte ich von Ihnen hören, was Sie beide davon halten.«
Jeroen zögerte mit einer Antwort, sortierte und stapelte pedantisch die losen Blätter auf der Mitte des Tisches und ließ dann die Hände nachdenklich auf der Titelseite des Manuskriptes ruhen. Die Arbeit war in Englisch abgefasst, dem neuen Latein der Wissenschaft, insbesondere der Biochemie, und mit einer gewissen Nachlässigkeit auf billigem Saugpostpapier abgezogen worden. Die Klammern, die das Ganze ursprünglich zusammengehalten hatten, waren durchgerostet.
»Egal, wie viele Seiten fehlen …«, sagte Jeroen schließlich, »das, was ich eben hier gelesen habe, ist entweder der größte Schwachsinn, der je veröffentlicht wurde – oder die größte Sensation!« Er schien tief beeindruckt und schaute auf Sibilla.
Sie teilte seine Begeisterung nicht, lachte nur, stand auf und rief im Weggehen hinter sich: »Ich tendiere mehr zu Schwachsinn!« Sie ging an den Rattenkäfigen entlang und ließ ihren Fingernagel über die Gitterstäbe rattern.
Die ungewöhnliche Stille, die eben noch über diesem Labor gelastet hatte, war innerhalb einer einzigen Sekunde dahin.
Die Tiere stoben in die hintersten Ecken ihrer Käfige, quiekten, drängten sich erschrocken zu pelzigen Knäueln.
»Warum tun Sie das?«, wollte Palm wissen.
»Ein Adrenalinstoß belebt auch Ratten hin und wieder. Positiver Stress vertreibt Depressionen. Im Übrigen habe ich zu tun!«
Sie räumte die Requisiten der letzten Versuchsreihe zur Seite und stapelte Kolben und Spritzen im Wasserbecken.
»Mein Gott, diese Hektik!«, sagte Jeroen. »Kann man nicht so ein Thema, selbst wenn du es für Schwachsinn hältst, zu Ende diskutieren?«
Sie kam zurück. Ihr rumänisches Temperament steuerte auf einen der bekannten dramatischen Ausbrüche zu. Aber überraschenderweise blieb sie ganz ruhig, ganz sachlich und setzte sich wieder an den Tisch zu Jeroen.
»Zu Ende diskutieren?«, fragte sie. »Wir haben noch gar nicht damit angefangen. Und ob jetzt das Resümee, die Quintessenz dieser Theorie, vorliegt oder im Heizungskeller vermodert – worum es dem Verfasser hier geht, wissen wir doch zu genau: eine Spekulation! Wie heißt er überhaupt?« Sie griff nach dem Stapel, den Jeroen bereitwillig freigab und ihr zuschob.
»Ian Mackenzie«, sagte er. »Ein Schotte, wenn man dem Namen trauen darf. King's College, Cambridge.« Sie las die Titelseite nochmals gründlich durch. »Nie von dem gehört. Und die Veröffentlichung ist bereits über drei Jahre alt. Wenn etwas dran wäre an dieser Theorie …« Sie las den Titel der Arbeit vor: »›Shortening of DNA under reproduction‹ von Ian Mackenzie, Fellow am King's College in Cambridge. Also Verkürzung der DNS bei ihrer Reproduktion. Wenn dieser Vorgang, der hier beschrieben wird, stimmt, und wenn er steuerbar wird, dann heißt das – für welche Organismen auch immer – Unsterblichkeit!« Mit einem kräftigen Schwung landete das Manuskript wieder auf der Seite von Jeroen. »Wenn also etwas dran wäre an dieser Theorie«, fuhr sie fort, »ich meine, in drei Jahren sprechen sich Sensationen doch wenigstens unter Kollegen herum, dann wüssten wir doch inzwischen alle, wer dieser Ian Mackenzie ist, oder …?«
Jeroen ergriff das Manuskript und stand auf. »Vielleicht ist es überall im Altpapier gelandet, wie hier bei uns. Wir werden doch zugeschüttet mit Papier! Rund zweihunderttausend Biochemiker publizieren jedes Jahr über fünfzigtausend neue Forschungsergebnisse. Jeder von uns hat doch längst jeden Überblick verloren!«
Sibilla schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht an die unentdeckten Genies. Wenn das hier mehr wäre als Spekulation, dann hätten das weder die Fachwelt noch die Öffentlichkeit übersehen. Besonders nicht die Kollegen dieses Mackenzie im King's College.«
Jeroen ging ein paar Schritte durch den Raum, dann blieb er neben Palm stehen. »Sie hatten doch einen Grund, uns die Papiere hier auf den Tisch zu legen, oder?«
Palm nickte. »Richtig. Sie sind seit zwei Monaten auf der Suche nach einem neuen Programm. Ich bin nicht Biochemiker. Ich kann die Fakten und Spekulationen dieses Mackenzie nicht auseinanderhalten. Ich habe nur begriffen, was er letzten Endes meint.« Er wandte sich um und beugte sich über das Okular eines der Mikroskope. Er drehte nachdenklich an der Fokussierung, schaltete das Licht ein, sah nichts als verschwommene bunte Ringe, mit denen er nun spielte, die er veränderte, in weiße Nebel auflöste, die blutigrote Schlieren produzierten. Langsam, nachdenklich, fast beiläufig sprach er weiter: »Altern und Sterben scheinen, nach Mackenzies Ausführungen, in unseren Lebensfaden einprogrammiert zu sein – um das Leben als Ganzes zu erhalten.«
Jeroen widersprach: »Das sagt nicht nur Mackenzie. Ich glaube, in diesem Punkt sind wir Biochemiker uns alle einig. Die Lebensbedingungen auf unserem Planeten haben sich in Millionen Jahren laufend verändert – und verändern sich weiter. Nur durch eine rasche Folge von Generationen, nur durch Tod und Neubeginn wird die Anpassung und damit das Überleben einer Art gesichert. Aber es gibt keinen Grund anzunehmen, dass der Begriff des menschlichen Lebens zwangsläufig und für alle Zeiten untrennbar mit dem Begriff des Todes verknüpft bleiben muss – sofern es uns gelingt, das entsprechende Programm in uns zu entschlüsseln – und nach der Theorie des Herrn Mackenzie – zu verändern.«
Sibilla hatte ihre Arme weit über den weißen Plastiktisch gestreckt und den Kopf darauf gelegt, und nun lächelte sie mit sanfter Ironie Jeroen an: »Eine faszinierende Idee für dich, was? Endlich das neue Programm nach Wochen des Grübelns. Wie sagte unser großer Kollege und Nobelpreisträger Severo Ochoa? ›Wir Biochemiker fangen langsam damit an, Gott zu spielen‹ …« Sie wischte das Pathos des großen Kollegen vom Tisch und stand wieder auf. »Ich gebe zu, es ist beschissen«, fuhr sie temperamentvoll fort. »Da beschäftigen wir uns in diesem Haus mit den Problemen einer Welt von übermorgen und der Nachprüfung unserer Ideen, an der Realisierung in der fernen Zukunft werden wir gehindert. Denn zwischen heute und dem Tag X liegt der Tod – für jeden von uns, früher oder später …« Sie versuchte mit einem Lachen den ernsten Aspekt etwas zu entschärfen. »Es ist doch absurd«, fuhr sie fort, »jede Stunde bringt uns neue Erkenntnisse und Erfahrungen, und die allerletzte macht dann alles zunichte! Ich finde das unmenschlich!«
Jeroen nickte. »Mackenzie findet das auch und spekuliert mit einer fundierten Theorie – und du nennst das Schwachsinn.«
»Wenn ich recht verstanden habe«, mischte Palm sich ein, »spricht Mackenzie an keiner einzigen Stelle vom Tod. Er spricht vom ›Altern‹. Organismen altern, wenn nicht mehr neue, junge Zellen an Stelle der verbrauchten treten können, wenn der Zerfall nicht gestoppt wird, der Verfall der Organe, wenn die Funktionsfähigkeit nicht erhalten bleibt, Stoffwechsel, Kreislauf, Gehirn – und damit die Jugend …!«
»Wer das Altern besiegt, besiegt auch den Tod!«, ergänzte Jeroen. Er ging zu seinem Schreibtisch, legte das Manuskript sorgsam in eine der Schubladen und betrachtete nochmals lange das Deckblatt. »Nur fünfzig oder hundert Exemplare wurden gedruckt. Vielleicht noch weniger. Wie kam es ins Haus hier, ins Blaue Palais? Und wie kam es ins Altpapier?« Palm schwieg und zuckte die Schultern.
»King's College, Cambridge …«, fuhr Jeroen fort. »Da bahnt sich vielleicht hinter fest verschlossenen Türen die Sensation des Jahrhunderts an. Drei Jahre sind bereits vergangen …« Er schob nachdenklich die Schublade zu und wandte sich wieder Palm und Sibilla zu.
»Drei Jahre«, sagte Sibilla, »eine unendlich lange Zeit in unserer Wissenschaft. Vermutlich hat dieser Mackenzie seine Versuche mit Taufliegen, die er da beschreibt, längst ohne Ergebnis eingestellt.«
2
Es wurde eine lange Nacht.
Bis gegen Morgen brannten die Lichter in der Bibliothek des Blauen Palais. Die Kollegen der verschiedenen Fachrichtungen hatten sich dort versammelt, unter dem schwülstigen Stuck der Renaissancedecke und zwischen albernen, pseudobyzantinischen Säulen. Sie diskutierten Mackenzies Theorie. Jeroen de Groot hatte kurz referiert und die Idee erläutert. Aber ihr Widerspruch klang nicht mehr sehr überzeugend. Die Faszination, die von Mackenzies Gedanken ausging, hatte irgendwann auch sie ergriffen. »Durch Zellteilung wird das Gewebe erneuert«, erklärte Jeroen, »und das Altern beginnt unwiderruflich dann, wenn die Zellen diese ihre Fähigkeit verlieren, sich zu teilen. Menschliche Zellen teilen sich etwa fünfzigmal, bei einem Dreißigjährigen – im Durchschnitt – noch zwanzigmal. Irgendwann aber ist Schluss. Nach einer ganz bestimmten Anzahl von Teilungen geht den Zellen die Fähigkeit, sich selbst zu reproduzieren, verloren.«
Jeroen versuchte sich anschaulich auszudrücken. Er sprach ja nicht zu Biochemikern. Büdel war Kybernetiker und hatte den Computer des Hauses unter sich. Polazzo war Chemiker, Louis Palm Mathematiker und Astronom. Und Yvonne, Palms rechte Hand, war Psychologin. »Also ein Fehler im Programm!«, warf sie ein.
»Nein«, widersprach Jeroen, »kein Fehler. Im Gegenteil. Es gehört zum Programm. Es ist offenbar Teil eines universellen Plans. Denn alle Lebewesen, alle Organismen, die sich einer stets verändernden Umwelt anpassen müssen, sind gezwungen, zu altern, abzutreten und einer neuen Generation Platz zu machen, die dann angepasster ist. Uns geht das nicht anders. Ein Trick der ›Schöpfung‹, der uns allerdings nicht sehr glücklich macht. Andererseits: Ohne diesen Trick wäre das Leben auf unserem Planeten längst wieder verschwunden oder hätte sich zumindest auf die primitivsten Formen beschränkt. Höher entwickelte Organismen und die vorhandene Vielfalt entstehen nur durch eine rasche Generationsfolge der einzelnen Arten.«
»Ich beneide den Herrn vom andern Stern«, wandte Büdel ein. »Der wird tausend Jahre alt oder noch älter oder ist bereits längst unsterblich.«
»Kaum!«, entgegnete Sibilla. »Es sei denn, er beherrscht bereits den Trick, von dem Mackenzie träumt.« Palm winkte ab: »Wenn ich recht verstanden habe, ist auch die Entwicklung intelligenter Wesen davon abhängig, dass die Generationen dicht aufeinander folgen. Deshalb glaube ich nicht an tausendjährige oder gar unsterbliche Extraterristen. Ewiges Leben wäre das Ende einer jeden Art – es sei denn, sie fände Mittel und Wege, alle Umweltbedingungen zu beherrschen – und zwar in kosmischen Größenordnungen. Und das halte ich für unmöglich.«
Das war ein Stichwort für Polazzo: »Aus meinem Blickwinkel spricht nichts für die Verwirklichung von Mackenzies Traum – auch wenn er ein Urtraum aller Menschen ist. Ein Spiel mit dem Machbaren – weiter nichts. Der Natur ins Handwerk pfuschen ist immer ein Risiko. Als Chemiker weiß ich, wovon ich rede. Meine Zunft wird am Ende aller Tage geschlossen in eine Hölle marschieren, die sie selbst verschuldet hat.« Er lachte sarkastisch. Dann fuhr er fort: »Sollten wir je darüber abstimmen, ob Mackenzies Traum von der Unsterblichkeit ein Programm für unser Team abgeben soll oder nicht – ich sage schon jetzt: Ich bin dagegen!« Er stand auf, ging zur Tür, aber dann blieb er doch.
Palm hatte ihn von seinem Platz aus am Arm gepackt. »Warten Sie. Wir wissen noch zu wenig, fast nichts. Wir sprachen vom Altern …« Er gab Jeroen ein Zeichen fortzufahren.
»Gut«, nahm dieser sein Referat wieder auf, »irgendwann beginnt der Mensch zu altern. Das Gewebe ermüdet, das eine Organ früher, das andere später. Aber da sie alle voneinander abhängig sind, nimmt diese ›natürliche Katastrophe‹ eben ihren Lauf. Unaufhaltsam!« Er füllte sich einen Pappbecher am Automaten mit Kaffee. Der schmeckte zwar nicht besonders, aber er war wenigstens heiß und vermittelte die Illusion, man käme trotz der späten Stunde wieder zu Kräften für die nächste Runde. »Bei jeder Teilung einer Zelle teilt sich mit den Chromosomen ja auch die DNS. In diesem fadenartigen Molekül steckt unser ganzer Bauplan, sind alle Erbanlagen, alle Steuerbefehle an die Zellen enthalten. Und dieser genetische Code wird nun für die neue Zelle abkopiert, eine Art Lochstreifen oder Magnetband oder noch besser: eine Filmkopie. Bild für Bild, Buchstabe für Buchstabe wird möglichst fehlerfrei für die neue Zelle übertragen. Der gesamte Code wird weitergegeben – halt, nein: nicht der ganze Code. Es fehlt ein winziges Stück. Bei jeder Teilung scheint sich der Faden mit all seinen lebenswichtigen Informationen an den Enden verkürzt zu haben. Die neue Kopie ist kürzer ausgefallen als das Original. Dem Film fehlt in seiner neuen Version ein kurzes Stück der Anfangs- und Schlussszene – oder auch nur der Start- und Nachspannbänder, auf denen noch keine wichtige Information enthalten ist.«
»Das alles sagt Mackenzie?«, wollte Yvonne wissen.
»Nein, das wussten wir bereits ohne ihn. Und wir wissen das ziemlich genau. Wir wissen auch, dass nach etwa fünfzig Teilungen die Start- und Nachspannbänder verbraucht sind und nun die kritische Zone kommt. Was nach der fünfzigsten Teilung wegfällt, ist ausgerechnet der Befehl an die Zelle, sich zu teilen. Die Fähigkeit, sich zu reproduzieren geht als erstes verloren. Aus! Der Organismus regeneriert sich nicht mehr. Ein simpler, böser Trick.« Jeroen schwieg und widmete sich seinem Kaffee. Seine Brillengläser beschlugen durch den Dampf. An seinem weißen Labormantel, den er vergessen hatte abzulegen, wischte er sie wieder klar, so gut das eben ging. Dann zog er den Mantel aus und warf ihn in die Ecke. Für das keimfreie Labor war er ohnehin bereits »kontaminiert« und reif für die Wäsche.
Sibilla hatte inzwischen die Fortsetzung des Referats übernommen: »Und nun zu Mackenzie und seiner simplen Überlegung! Es gibt eine einzige Ausnahme von dieser eben beschriebenen Regel: Keimzellen! Bei ihnen ist das anders. Dort wird die DNS bei einer Teilung nicht verkürzt. Das ist logisch, denn Erbinformationen, Baupläne und Steuerbefehle müssen ja komplett und absolut vollständig an die Nachkommen weitergegeben werden.«
Büdel hatte die große Müdigkeit übermannt. Er gähnte und sah sich daraufhin erschrocken und schuldbewusst um.
»Es interessiert dich nicht besonders?«, fragte ihn Sibilla. »O doch, rasend«, antwortete er, »ich warte nur auf die Pointe.«
»Bitte«, sagte sie und schlug das vergilbte Manuskript wieder auf. »Die Pointe heißt nach der Erkenntnis von Mackenzie: ›Tandem-RNS-Polymerase.‹ Ein Ferment. Und dieses Ferment, so sagt er, verhindere in den Keimzellen die Verkürzung.« Sie stand auf und öffnete ein Fenster.
Palm hatte in Gedanken ein Tabu durchbrochen und sich in einem der Gemeinschaftsräume des Palais eine Zigarette angezündet. Als Sibillas Blick ihn traf, warf er sie kaum angeraucht durch das offene Fenster hinaus in den Hof, ohne weiteren Kommentar.
»Es scheint ganz einfach«, fuhr nun Jeroen wieder fort: »Wenn dieses Ferment auch in allen anderen Zellen eines Organismus wirksam werden könnte – ja, dann wäre das Problem mit der Sterblichkeit auf elegante Art gelöst …«
3
»Ian Mackenzie?«
Die ältere Dame hinter der Rezeption der Universitätsverwaltung war sichtlich zusammengezuckt. Ihr schmaler Mund wurde noch schmaler. Sie sah sich hilfesuchend um, aber die Kolleginnen schienen alle beschäftigt.
Sie erhob sich und starrte Jeroen und Sibilla zweifelnd an, als habe sie nicht richtig verstanden. »Ian Mackenzie?«, wiederholte sie.
»Ja. Haben Sie unseren Brief nicht bekommen?« Jeroen war bereit, auf leise, höfliche Art alle Unklarheiten aufzuklären. »Er arbeitet doch hier. Wir wollen ihn sprechen, weiter nichts.«
Die Dame antwortete nicht. Zögernd kam sie näher und wischte mit beiden Handflächen immer wieder nervös über den schwarzen Taft ihres Gouvernantenkleides.
»Glauben Sie uns«, versuchte es nun Sibilla mit einem gekünstelten Lächeln, »wir sind wirklich angemeldet.« Aber sie erhielt für diesen Hinweis keine Bestätigung.
»Ian Mackenzie. Hier am King's College, Cambridge«, wiederholte Jeroen. »Sie müssen ihn doch kennen. Er ist Biochemiker, also Mitglied des Department of Physics …«
Die ältere Dame reagierte immer noch nicht. Ein wenig verkrampft wandte sie sich ab, ging zögernd, wie sie gekommen war, zurück zu ihrem Schreibtisch, setzte sich umständlich, dann schlug sie ein bereitliegendes, abgegriffenes Buch auf und blätterte darin. Ihre Hand zuckte bereits in Richtung des Telefons. Aber dann wischte sie wieder ihre Handflächen über den schwarzen Stoff, als müsste sie sie trocknen. »Bitte, warten Sie draußen«, sagte sie schließlich zu den beiden Besuchern. »Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Ich gebe Ihnen dann Bescheid.« Sie wartete, bis Jeroen und Sibilla das Zimmer verlassen hatten, dann erst wählte sie eine Nummer.
»Auch hier wird Wissenschaft betrieben«, begann Jeroen, als sie in der muffig düsteren Vorhalle mit ihren bunten gotischen Fenstern standen. »Eingezwängt in eine Verwaltungshierarchie, die einem die Luft zum Atmen nimmt, zwischen Bürokraten und Schreibtischhyänen schlimmster Sorte …« Er trat ans Schwarze Brett und versuchte die »Bekanntmachungen«, »Anweisungen« und »Verfügungen« zu entziffern, die mit dickem Filzstift rot umrandet waren. »Bei solchen Gelegenheiten lernt man das Blaue Palais zu schätzen, trotz seiner permanenten Geldnot und seiner isolierten Lage. Als Wissenschaftler verblödet man dort, aber man ist glücklich.« Er lachte und studierte die Suchanzeigen: Möblierte Zimmer, Bücher, Plattenspieler, Bridgepartner und Assistentenplätze. Nach einem letzten Blick auf den »Veranstaltungskalender« (Filmvorführungen, Meditationsabende, Yoga und so weiter) wandte er sich ab. Dabei traf er mit einem Gentleman zusammen – randlose Brille und graue, buschige Schläfen –, der das Direktionssekretariat gerade verließ und ohne von Jeroen oder Sibilla Notiz zu nehmen auf einer der schwarzlackierten Wartebänke Platz nahm. Er entfaltete irgendein Journal und vertiefte sich in die Lektüre.
Jeroen sah auf seine Uhr und begann nervös auf und ab zu wandern. Sibilla lehnte an einer der Sandsteinsäulen der Halle. Der raue Stein war von den Wartenden blankgeschliffen und dunkel, speckig verfärbt. Sie suchte in ihrer Umhängetasche nach einem Notizblock und einem Stift, legte das Papier flach gegen die Wand und begann mit winziger Schrift Notizen zu machen.
Jeroen unterbrach seine Wanderung und blieb bei ihr stehen: »Was schreibst du?«
»Fragen an Mackenzie«, antwortete sie, ohne sich stören zu lassen. Sie bemerkte auch nicht den kurzen, interessierten Blick des Gentleman auf der Wartebank.
Schließlich, nach einer fast einstündigen Wartezeit, klopfte Jeroen wieder an die dicke Eichentür des Sekretariats und betrat den Raum, ohne auf eine Einladung zu warten.
Die ältere Dame im Taftkleid war verschwunden. Ihr Schreibtisch war tadellos aufgeräumt.
»Miss Bedford ist bereits zu Tisch«, verkündete ein Mädchen in einem etwas zu kurzen Rock. Sie kam mit schneeweißen, dünnen Beinen aus dem Nebenraum und war hauptsächlich damit beschäftigt, mit einem giftgrünen Band ihr rotblondes Haar zu bändigen.
»Wann kommt sie zurück?«, wollte Jeroen wissen.
»Erst morgen wieder. Sie arbeitet nachmittags in der Bibliothek.« Bevor Jeroen die Tür temperamentvoll wieder hinter sich zuwerfen konnte, rief sie ihm noch nach: »Bleiben Sie in der Nähe. Es ist jemand für Sie unterwegs!«
Und als Jeroen sie zweifelnd ansah, lächelte sie ihn an und fügte schnippisch hinzu: »Das habe ich natürlich nur durch Zufall mitbekommen. Beeiden könnt' ich's nicht.« Damit verschwand sie wieder im Nebenraum.
»Mackenzie kommt!« Jeroen nahm Sibilla am Arm und führte sie aus dieser hohen, stickigen Wartehalle hinaus auf den weitläufigen Campus. »Wohin?«, fragte sie. »Ihm entgegen!«, antwortete er.
Ein steifer, kalter Wind fegte durch die Bäume, brach sich an den pittoresken Fassaden der zahlreichen Gebäudekomplexe, die über den Park verteilt waren. Zuckerbäckergotik wie aus dem Bilderbuch. Die Trampelpfade durch den Rasen, vor einer Stunde noch von Studenten bevölkert, waren verwaist. Mittagszeit. Von irgendwoher erklang ein blechernes Glockenspiel.
Hinter offenen Fenstern im ersten Stock übte jemand Klavier. Ein Stockwerk tiefer ratterte ein Fernschreiber.
Auf einem der Plattenwege näherte sich ein hagerer Mann in einem grobkarierten Tweedjackett. Er ging betont langsam, eine Hand in der Tasche des Jacketts, in der anderen trug er eine zusammengefaltete Tageszeitung.
Sibilla und Jeroen sahen ihm erwartungsvoll entgegen. Es war in diesem Teil des Campus, im Augenblick zumindest, der einzige Mensch bis auf den Gärtner, der unter den Platanen die Blätter zusammenkehrte. »Mister Mackenzie?«, rief Jeroen dem Fremden entgegen, als dieser noch ein Dutzend Schritte entfernt war, aber der reagierte nicht darauf, blickte Jeroen und Sibilla nur höflich distanziert an, nahm die Hand aus der Jackettasche, wechselte die Zeitung in die andere Hand, blieb schließlich stehen: »Good afternoon.«
»Good afternoon.« Sibilla lächelte und reichte dem Ankömmling die Hand. »Sie haben unseren Brief bekommen, Mister Mackenzie?«, fragte Jeroen.
Der andere beantwortete die Frage auf seine Weise. »Mein Name ist Campbell. Francis Campbell. Sie müssen im Augenblick mit mir vorlieb nehmen.« Sein Deutsch war perfekt und sein englischer Akzent minimal. »Es gehört zu meinen Aufgaben«, fuhr er fort, »deutsche Kollegen zu betreuen, die das College besuchen. Es tut mir leid, dass Sie warten mussten. Man hat mich zu spät von Ihrem Erscheinen verständigt. Sie sind das erste Mal in Cambridge?«
»Ja«, sagte Jeroen, »aber es sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe.«
Campbell lächelte. »Zugegeben, das Essen und das Klima sind besser auf dem Kontinent. Aber hier kann man leben. Und arbeiten.« Er sah sich um.
Der Gentleman mit den grauen, buschigen Schläfen und mit der randlosen Brille hatte eben das Portal verlassen und war grußlos an der Gruppe vorbeigegangen. Er ging zielstrebig auf ein einzelstehendes Gebäude zu, das mit seinen hohen gotischen Fenstern, seiner durchbrochenen Fassade und seinen Giebeltürmchen einen ausgesprochen sakralen Eindruck machte.
»Ach ja«, sagte Campbell, und es klang wie ein spontaner Einfall: »Ihr Brief!« Er hatte ihn in der Tasche, säuberlich zusammengefaltet, immer noch im aufgeschnittenen Kuvert. Sibilla erkannte den Absenderstempel des Blauen Palais.
Er entfaltete den Brief, dann blickte er interessiert auf Sibilla. »Keinerlei Andeutung, worum es geht. Nur die Bitte um ein Gespräch. Also gut. Was kann ich für Sie tun?«
»Die Bitte um ein Gespräch mit Ian Mackenzie!«, korrigierte Jeroen.
Aber Campbell blieb mit seinem Blick bei Sibilla. »Was Sie erfahren wollen, können Sie auch durch mich erfahren!«, sagte er nur.
»Ach, Sie arbeiten beide zusammen?« Sibillas Schlussfolgerung klang ein wenig naiv – oder provozierend. Campbell senkte den Blick, wandte sich zum Gehen. »Keineswegs.« Er folgte dem Gentleman, der das seltsame Gebäude fast erreicht hatte. »Aber ich bin informiert!«, ergänzte er.
Dann gingen sie schweigend über den Rasen. Campbell blickte kurz zum Himmel, in die Kronen der Platanen, die gerade erst anfingen, ihr Laub abzuwerfen. »Gehen wir hinein, es wird kühl«, sagte er und hielt die schwere Eichentür auf.
Essensdunst schlug ihnen entgegen und der Duft nach parfümierten Desinfektionsmitteln und Bodenwachs. Das Gebäude beherbergte eine einzige große Halle. Beleuchtungskörper von der Form alter Straßenlampen waren an das hohe Holzgebälk montiert und verstärkten den düsteren, muffigen Eindruck dieses holzgetäfelten Raumes, statt ihn zu erhellen.
Lange Tische aus dunkelgebeizten Holzplatten standen dicht an dicht. Mädchen in hellblauen Kitteln und mit weißen Häubchen räumten gerade die Tabletts mit dem abgegessenen Geschirr in hohe fahrbare Gestelle und schoben sie in den angebauten Küchentrakt.
Die meisten der Tische waren mit Studenten besetzt, die noch diskutierten, über Büchern und Zeitschriften brüteten und Tee aus unförmigen Plastiktassen tranken.