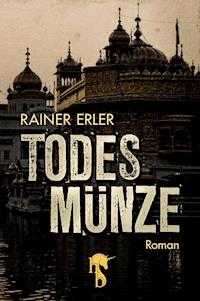3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Hochzeitsreise durch den Südwesten der USA entpuppt sich für ein junges Paar als Albtraum: Monica und Mike werden aus heiterem Himmel von einem Krankenwagen verfolgt, Mike wird entführt. Seine Frau Monica kann in letzter Sekunde fliehen und springt vor einen vorbeifahrenden LKW. Der Fahrer nimmt die aufgelöste junge Frau auf und lässt sich überzeugen, gemeinsam nach Mike zu suchen. Bei ihren Nachforschungen stoßen die beiden auf eine gefährliche und perfekt organisierte kriminelle Organisation, die mit Organhandel Millionen verdient … Nach diesem Roman entstand einer der erfolgreichsten deutschen Filme: »Fleisch« wurde mit Jutta Speidel in der Hauptrolle von Rainer Erler als Produzent und Regisseur verfilmt und in 127 Ländern gezeigt. Der Film wurde mit der »Goldenen Nymphe« des Festivals von Monte Carlo ausgezeichnet. 2008 wurde der Roman erneut verfilmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Rainer Erler
Fleisch
Roman
1
Sie trommelte gegen die Scheiben, aber keiner hörte sie. Die dicken Gläser, mehrere hintereinandergesetzt, verschluckten jeden Ton.
Sie schnitt Grimassen: ein Clown in Großmutters Brautkleid. Der altmodische Blumenhut mit der breiten Krempe rutschte von den frisch aufgedrehten blonden Locken, als sie versuchte, die zierliche Nase mit den unzähligen Sommersprossen an der Scheibe plattzudrücken.
Sie spielte »Fisch im Aquarium«, die blauen Augen weit aufgerissen, die zur Feier dieses Tages karminrot bemalten Lippen zu einem halbgeöffneten Karpfenmaul gespitzt.
Die Hände fächelten langsam hinter den Ohren wie Kiemen. Das hatte Erfolg: Die Musiker ließen ihre Instrumente sinken, winkten ihr zu. Nur Mike blieb ernst, oder versuchte es wenigstens.
Er beugte sich vor zu einem Mikrofon und flüsterte: »Monica, du störst!«
Aber Monica schüttelte den Kopf, deutete auf ihre Uhr, pfiff – unhörbar – auf zwei Fingern und winkte mit unmissverständlicher Geste: Los, raus hier, beeil dich!
Wieder beugte sich Mike zu einem Mikrofon: »Noch zehn Minuten!«
Monica hob fünf Finger – nur fünf.
»Na«, sagte Sidney, der Mundharmonikaspieler, »dann beeilen wir uns eben, bevor Mike größeren Ärger bekommt«, und klemmte sich sein Instrument zwischen die Lippen.
»Hört mal, der Termin ist um zwölf, ist doch so, oder?«
Mike nickte. »Stimmt, um zwölf. Aber wir brauchen 'ne halbe Stunde bis hin …«
»Halbe Stunde?« Ronnie Williams, der Leiter der kleinen Amateur-Band, versuchte, Nervosität erst gar nicht aufkommen zu lassen. »Wir haben noch Zeit wie Heu! Und bevor ihr anfangt zu pfuschen …«
Er hob die Hand, um den Einsatz zu geben.
Doch Monica hatte ihm bereits wieder die Schau gestohlen.
Hinter der schalldichten Scheibe, die das winzige Studio im Keller der Universität von dem Raum mit der Technik trennte, hatte sie ihre Pantomime der unglücklichen, versetzten Braut mit großem Erfolg weitergespielt.
»Hör mal, Mädchen, du gefährdest ernstlich deine Ehe«, rief Ronnie in das nächstbeste Mikrofon. »Keiner kommt hier raus, bevor die Aufnahme steht, auch nicht dein Mike!«
Monica brach in ein theatralisches Schluchzen aus und vergrub ihr Gesicht tief in die rosa Plastikröschen ihres Brautstraußes.
Sergio Sollima, der jüngste Professor für Byzantinistik in den gesamten Vereinigten Staaten, war aufgesprungen. Sein Hobby war recording – jetzt fungierte er im Studiokeller hin und wieder als »Toningenieur«. Er versuchte, Monica zu trösten. Mit einer großen Operngeste schloss er sie in seine Arme.
Mike blickte finster durch die spiegelnde Scheibe, nahm langsam seine Gitarre hoch – wie jene berühmte Winchester 73 – und drückte ab.
Tödlich getroffen sank Monica zu Boden und verschwand damit aus dem Gesichtskreis der Anwesenden. Sergio schien verzweifelt. Er stieß unhörbare Verwünschungen gegen den Meuchelmörder und zukünftigen Ehemann der schönen Toten aus, hob anklagend die Faust und schwor, sie zu rächen.
Die schöne Tote war mittlerweile zum Mischpult gekrochen, hatte auf den roten Knopf der Gegensprechanlage gedrückt und rief nun über den Kommandolautsprecher dröhnend und unüberhörbar in die gespannte Stille des Studios: »Mike – ich liebe dich …!«
2
»How much is anyone worth? How much is anyone worth?
Is it measured at the moment of our birth?
All we learn, all we burn, how much profit will it earn?
How much is anyone worth? How much is anyone worth?«
»Was ist der Mensch wert, so in Dollar und Cent?
Was bringt's ihm, wenn er so durchs Leben rennt?
Was er lernt und verdient – was bleibt denn am End?
Was bleibt übrig von ihm, so in Dollar und Cent?«
»Na ja«, schrieb Monica in einem Brief an ihren Bruder, der in Deutschland lebte und in Heidelberg studierte, »so ähnlich würde ich das übersetzen. Bei einem Song ist das mit dem Übersetzen doch immer reine Glückssache.«
Es war ihr Hochzeitslied. Donald Arthur hatte es geschrieben und ihr den Text am Morgen in einem Kuvert mit roter Schleife überreicht, zusammen mit den Noten: Die stammten von Thomas. Der hatte die Nacht über komponiert. Sie hatte das irrsinnig lieb von den beiden gefunden und war ihnen um den Hals gefallen, erst Donald, dann Thomas, dann den übrigen – einem nach dem anderen. Und dann waren sie in den Keller der Uni gegangen, um das Lied auf Band aufzunehmen.
»What is the value of a life? What is the value of a life?
Do you measure it in dollars, joy or strife?
All we win, all we lose, does that figure in our dues?
What is the value of a life? What is the value of a life?«
»Was ist so ein Leben denn wert?
Egal, ob's Glück oder Ärger beschert,
das in Geld zu messen ist sicher verkehrt,
aber was war's am Ende denn wert?«
Jetzt hörte sie die Melodie, und plötzlich war die ganze Alberei vorbei. Sie hatte feuchte Augen: ihr Hochzeitslied! Und Mike begleitete es auf der Gitarre. Country music.
Die war ungeheuer populär geworden in den letzten Jahren. Einfache Melodien, die ins Ohr gingen, ein wenig schnulzig, ein wenig sentimental, ein rührseliger Text mit Hintergedanken. Donald hatte vor, das Band mit der fertigen Aufnahme der kleinen Radiostation anzubieten, die in der Universitätsstadt Princeton die Hörer mit Nachrichten, Musik und Werbespots versorgte.
Victor Young, »Musikchef« des Senders – es gab insgesamt nur sieben Mitarbeiter –, hatte versprochen, den Song auszustrahlen, wenn er einigermaßen was taugte.
»What do I get for a soul? What do I get for a soul?
Although life is over, is it ever whole?
When it’s all said and done, was it profit or just fun?
What do I get for a soul? What do I get for a soul?«
»Was ist für 'ne Seele denn drin?
Wenn alles vorbei ist, bringt sie Gewinn?
Investieren in Seelen? Macht das denn Sinn?
Wie viel Profit ist denn drin?«
Ronnie hatte eine dufte Stimme. Die klang nach Lagerfeuer und Prärie. Eine Stimme mit »Western-Look«, eine, die nach Leder roch und nach Pferd, dachte Monica, und sie musste darüber lachen. Sergio, der Byzantinist und Toningenieur, blickte kurz erstaunt zu ihr hoch. Wahrscheinlich dachte er, sie heult. Na, wenn schon. So irrsinnig weit entfernt davon war sie ja nicht.
»What would you pay for a man?
What would you pay for a man?
Does a general bring more than a private can?
What he is, or is not, will that matter when he’s shot?
What would you pay for a man?
What would you pay for a man?«
»Was glaubst du, was ein Mensch einbringen kann?
Was kostet ein General, was ein einfacher Mann?
Und zerfetzt im Graben, was bringen sie dann?
Ob man sie tot, ohne Orden, noch irgendwo anbringen kann?«
Heute Nachmittag oder besser noch heute Abend würde, wenn alles klappte und Victor Young auf die Sache einstieg, jeder in Princeton und Umgebung auf Kanal drei das Lied hören können. Ihr Hochzeitslied. Dazu ein Glückwunsch der Kommilitonen. Den müsste man allerdings bezahlen. Achtzehn Dollar oder so. Und vielleicht übernahm ein anderer Privatsender das Lied, hier an der Ostküste, oder auch im Westen. Die tauschten ja oft ihre Bänder mit Programmen aus. Und vielleicht hörte dann ein Musikredakteur von NBC oder CBS den Song, so aus Zufall. Wenn einer vom großen Network anbiss und das Lied in die Hitparade lancierte …
Donald und Thomas hatten dann auf jeden Fall ausgesorgt, so etwas brachte ja Millionen. Da war nicht nur ihr Studium gesichert und ihnen ein Job beim Sender sicher … Bestimmt zahlten sie dann ihren Musikern der ersten Stunde saftige Tantiemen. Tausend Dollar – oder zwei – für Mike an der Gitarre. Überall, aus allen Radios, Musicboxen, Diskotheken, auf Parkplätzen, in Supermärkten – ihr Hochzeitslied.
Bis sie von ihrer langen Reise durch den Westen und Süden zurückkamen – waren sie dann vielleicht reich?
»How much is anyone worth? How much is anyone worth?
Is it measured at the moment of our birth?
Are we still nothing more than slaves on this earth?
How much is anyone worth? How much is anyone worth?«
»Was ist der Mensch wert, so in Dollar und Cent?
Wenn er sein Leben versäuft und verpennt?
Sich verkauft für Geld – was bleibt ihm am End?
Was nimmt er denn mit, so in Dollar und Cent?«
Und wenn das nicht klappt, mit Victor Young und seiner kleinen Radiostation, dachte Monica, können wir immer noch den freundlichen Reverend, dessen Namen sie vergessen hatte und der ihnen den Termin für die Trauung in der Princeton-Baptist-Church reserviert hatte, überreden, den Song zur Trauung abzuspielen.
3
Weit außerhalb der Stadt, inmitten einer geradezu englischen Parklandschaft, liegt der kleine, weiße Holzbau der Princeton-Baptist-Church mit seinem niedrigen Stummelturm.
Seit der Highway Number 1, der Philadelphia mit New York verbindet, die malerische New-Jersey- Landschaft gerade an dieser Stelle brutal durchschnitt, war die kleine Kirche, an der nun in nur wenigen Metern Abstand Tag und Nacht der Verkehr auf sechs Fahrbahnen vorbeibrandete, kein sehr lukratives Unternehmen mehr.
Andere Kirchen in und außerhalb der Stadt florierten da wesentlich besser.
Trotzdem hatte Reverend Markovicz eine Marktlücke entdeckt, die in einer Universitätsstadt wie Princeton einigen Profit versprach, ohne den amerikanische Kirchen nicht existieren können: Studentenpaaren räumte er bei Trauungen und Taufen einen großzügigen Nachlass ein und machte so die miserable Lage über den Umsatz wieder wett. Discount-wedding hieß das in den Anzeigen. Besonders sein light-&-sound-service war ein durchschlagender Erfolg. Zu wechselnden Farbspielen beschallte Markovicz den kleinen Kirchenraum mit etwa 120 Phon quadrophonischer Musik aus sechzehn Lautsprechern. Die Anlage hatte er billig aus der Konkursmasse des Trenton-Kongress-Zentrums aufgekauft. Der Saal, in dem sie ursprünglich installiert gewesen war, fasste über dreitausend Besucher – Princeton-Baptist-Church verfügte über zweiundzwanzig Bänke zu je fünf Sitzen.
Wenn Markovicz voll aufdrehte, konnte man die Riesenlaster, die vor der Kirche vorbeidonnerten, schlicht vergessen.
Jetzt stand der Reverend in der offenen Kirchentür und wartete auf die angekündigte Kundschaft, die von jenseits der Schnellstraße, mit geraumer Verspätung, auf dem alten Weg von Princeton herüberkam.
Die kleine Kolonne von sieben Autos hatte den Park verlassen, der den campus umgab, und war unter rhythmischem Hupen den sanften Hügel hinunter in das breite Wiesental des Millstone-Rivers gefahren, vorbei an den beiden aufgelassenen Farmen mit ihren öden, leeren Fensterhöhlen und den halb zusammengestürzten Scheunen.
Das Echo des Hupkonzerts kam vervielfacht von den weißgestrichenen, morschen Holzwänden zurück, eins-eins-eins-zwei-drei … , hallte über Wiesen, auf denen hohes, herbstliches Gras, ungemäht und struppig, von Wind und Regen zu Wirbeln und Wellen gepeitscht worden war, und über die brachliegenden Felder: eins-eins-eins-zwei-drei …
Von den Antennenstummeln der Wagen wehten bunte Papierschlangen. Wilde Herbstblumen steckten unter den Scheibenwischern und im Kühlergrill von Mikes altem Chevi.
Keiner dieser Wagen, die nun über den Hintereingang in die Gulf-Tankstelle von Roy Fletcher fuhren und auf dem verdreckten Hof zwischen Schrott und Autowracks und billigen second-hand-Angeboten abgestellt wurden, war jünger als acht Jahre.
Man konnte in Princeton über zwei Dutzend Stipendien-Systeme auch mit wenig Geld studieren – aber nicht ohne eigenen Wagen.
Fletcher warf schon mal zwanzig Flaschen coke in die Eisbox und taute ebenso viele tiefgefrorene Hamburger auf.
Er kannte das Ritual, und alle kannten Fletcher, bei dem man gas für ein ganzes Semester anschreiben lassen konnte.
Die Hochzeitsgesellschaft versammelte sich zwischen Öl- und Wasserlachen – denn nun war eine gefährliche gemeinsame Unternehmung fällig, die absolute Solidarität verlangte: Die Überquerung der Number 1 bei dichtestem Verkehr – zu Fuß! Denn der Umweg über die nächste Anschlussstelle dieser Autobahn bis hin zur Kirche brachte gute neun Meilen auf den Tacho.
Ein ganzer Konvoi von Riesenlastern, Vierzig-Tonner, die mit Tiefkühltrailern, reefern, New York mit Fleisch und Gemüse aus dem Süden und Westen versorgten, verhinderte vorläufig jede Überquerung.
Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Trenton – Philadelphia kam ein Ambulanzwagen mit jaulender Sirene und Rotlicht angerast, schlängelte sich über die drei Fahrbahnen zwischen den einzelnen Wagen hindurch und fegte dicht an der wartenden Hochzeitsgesellschaft vorüber.
Zufall? dachte Monica, oder böses Omen? Sie sah dem Wagen noch eine Weile nach. Das rote Blinklicht spiegelte sich im Lack der überholten Wagen, an den glänzenden Aluminiumflächen der Kühltransporter. Mit schwarzen Katzen wusste man einigermaßen Bescheid, mit Schafen zur Linken, zur Rechten, aber mit jaulenden, blinkenden Ambulanzen am Hochzeitstag …?
Da packte sie Mike schon an der Hand, zog sie hinter sich her. Zwei Freunde sperrten den Verkehr mit großen Gesten und hoch erhobenen Blumensträußen. Und die Gruppe dieser fröhlichen und total veralberten Studenten lief quer über die Number 1 auf die kleine weiße Holzkirche zu.
Monica hatte große Mühe mit dem ungewohnten langen Kleid – nach zehn Jahren Jeans. Sie hielt mit der freien Hand den breitrandigen Blumenhut, stolperte, verlor einen Schuh.
Mike hob ihn auf – und bei dieser Gelegenheit auch gleich das ganze Mädchen.
Unter Jubel und Applaus der Freunde trug er sie über die drei Fahrbahnen, stieg über Leitplanken, Gräben, Müll und die Böschung und schleppte sie auch noch, und zwar keineswegs mit letzter Kraft, über die Schwelle der Princeton-Baptist-Church mit ihren fünf abgetretenen Holzstufen.
Für den erstaunten Markovicz hatte Mike nur ein atemloses »Hallo, Reverend …!«, dann lief er weiter, und erst vor dem Altar setzte er sie ab.
Aber Monica, die sich angstvoll an ihm festgekrallt hatte, das Gesicht tief zwischen seinen Armen und seiner Schulter versteckt, ließ nicht los.
Er kniete sich hin. »Hallo, Monica! Ms. Muller-Meier-Schmitz! Wir sind da!«
Aber Ms. Muller-Meier-Schmitz, wie Mike seine deutsche Braut bei offiziellen Anlässen nannte, blickte nicht auf, hielt das Gesicht an ihrem Mike fest und tief vergraben und rührte sich nicht.
Mike spürte ihren heißen Atem am Hals. Gott sei Dank, sie lebt noch, dachte er, hörte ein Schluchzen – oder war es ein Lachen? Nur der Teufel kannte sich bei diesen Europäerinnen und ihren Emotionen aus.
Laut und polternd, schwatzend und lachend waren die anderen in die Kirche getreten.
Aber dann hatten sie Mike gesehen mit seiner Monica, vorne an den Stufen des Altars, waren näher gekommen und still geworden, und ohne das Geringste zu verstehen, standen sie nun um die beiden herum und schwiegen.
Monica hob den Kopf, schaute vorsichtig über Arm und Schulter auf die verstörte Runde der Freunde und versuchte zu lächeln. Aber es misslang.
Das kunstvoll-bunte Augen-Make-up, das ihr die Zimmerkollegin Betty eingeredet hatte, war zerflossen. Blauschwarze Tuschetränen liefen ihr über die Backen.
Mike war ein wenig fassungslos: »Hast du irgendwo Kleenex?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Hat denn keiner ein Kleenex da?« fragte Mike in die Runde. Keiner hatte.
Nur Donald Arthur opferte ein altmodisches Spitzentuch, das er in der Brusttasche seines Blazers stecken hatte.
»Bei uns in den Staaten weinen die Mädchen immer erst hinterher, ich meine – nach der Zeremonie, verstehst du?« flüsterte Mike, als er Monica die Farbspuren aus dem Gesicht tupfte.
Sie nickte ganz ernsthaft: »Ich werd's versuchen – vielleicht schaff ich's dann noch mal …!« Sie schnäuzte sich in Donalds Spitzentuch. Und damit fand sie auch ihr Lachen wieder.
Es wurde eine schöne Zeremonie – und Monica schaffte das mit den Tränen tatsächlich noch ein- oder zweimal.
Victor Young vom Radio traf ein – mit noch größerer Verspätung, und Reverend Markovicz legte das mitgebrachte Band ein und fuhr full speed auf sechzehn Lautsprechern mit hundertzwanzig Phon: »How much is anyone worth?« – »Was ist der Mensch wert – so in Dollar und Cent?« …
Alle waren hingerissen von dem ungeheuren sound, ganz besonders Victor Young. Und Reverend Markovicz benutzte den Text, sozusagen in Abänderung seiner vorbereiteten Predigt, für eine improvisierte Ansprache an diese junge Gemeinde.
Irgendwann war es dann soweit: Monica hauchte das verabredete »Ja« – oder vielmehr »Yes – I will« – und aus Ms. Muller-Meier-Schmitz, aus dem deutschen Fräulein Monika Meier-Reinsberg war Mrs. Mike Shepard geworden – mit allen Konsequenzen.
4
Die Zeiten, da deutsche »Fräuleins«, unfreiwillig rank und schlank, an der Seite eines GI das verwüstete Europa in Richtung Neue Welt verließen, sind längst vergessen. Und auch für Mrs. Muller-Meier-Schmitz, verehelichte Shepard, war das verstaubte Historie.
Dennoch: Manchmal trifft man sie noch, die »Fräuleins« von ehedem, im Südwesten, in Texas und New Mexico. Sie sind rund geworden und mütterlich und schrecklich amerikanisch. Sie arbeiten an Tankstellen und Supermärkten, in motels und coffee shops, halten eisern fest an ihrem teutonischen Akzent, wie dieser legendäre secretary of state, Henry Kissinger, und fragen den fremden Gast oder Kunden in einem nahezu verlernten Deutsch unvermittelt und überrascht: »Sie kommen aus Deutschland? Ja?« Und dann fügen sie meist die doch so schwer zu beantwortende Frage hinzu: »Sagen Sie, wie ist es denn dort so – ich meine – heute?!…« Sie alle sind tüchtig und fleißig wie eh und je und haben den reichen Onkel im Goldenen Westen nicht getroffen.
Eine ganze Generation später, genau vor zwei Jahren, vier Monaten und drei Tagen, war Monika Meier-Reinsberg nach einem akzeptablen Abitur, einer permanenten Eins in Englisch über fünf Jahre hinweg und einem Stipendium für die Universität von Princeton in der Tasche auf dem John-F.-Kennedy-Airport von New York gelandet. Nach einer randvollen Woche New York an der Hand einer entfernten Cousine war sie schließlich nach knapp zweistündiger Omnibusfahrt in Princeton gelandet.
Eine Kleinstadt in Holz- und Ziegelbau gruppierte sich malerisch um den gigantischen Komplex der Universität: Gotische Türme und Zinnen, Giebel und Fassaden zogen sich, mit Erkern und Butzenscheiben, mit Statuen, Wappenreliefs und sehr viel Efeu garniert, durch zahlreiche Hektar Park und englischen Rasen. Das atmete britannische Tradition, roch streng nach Oxford und Cambridge, und doch war kein Stein älter als siebzig Jahre. Im Institute for Advanced Studies hatten berühmte Gelehrte gewirkt, und das rote »P« auf T-Shirt oder Pullover war auch heute noch unter Studenten mehr als ein Statussymbol.
Der junge, sportliche Typ mit der dunklen Mähne trug so ein ›P‹ auf dem Pullover. Er stand hinter Monica in der Reihe vor der Theke der Selbstbedienung im coffee shop der Universität und hatte wohl indiskreterweise zugehört. Monica war in ›Schwätz-Stimmung‹ gewesen, hatte tausenderlei Fragen an Betty gestellt, die mit ihr das Zimmer in einem der sechsundzwanzig dormitories, den Wohn- und Schlafgebäuden, teilte. Es war ihr dritter Tag in Princeton. Alles war noch neu und verwirrend, und Bettys Auskünfte waren so herrlich unpräzise und beunruhigend!
Da sagte der Typ hinter Monica ganz plötzlich und unvermittelt: »Oh, Lord! Schon wieder so ein Kraut, ein Fritz, ein Fraullein! Da muss irgendwo ein Nest sein …!«
Monica drehte sich um: »Woher, zum Teufel, willst du das wissen, he? Ich mein', woher ich komm'?«
»Dein Akzent! Dein verdammter Akzent!«
Da schmetterte Monica ihm ebenso plötzlich und unvermittelt das Plastiktablett auf die kluge Birne.
Ganz spontan, ohne nachzudenken. Ein Reflex, weiter nichts. Der erste unbeherrschte, aggressive Reflex ihres jungen Lebens.
Doch dieser Typ mit dem roten »P« auf der Brust verzog keine Miene, spielte weiter den sunny boy und lächelte sie an. Voll Charme und Herzlichkeit. Es war furchtbar.
Monica ließ das Tablett sinken. Irgendwann lag es auf dem Boden – dann stürzte sie davon.
»Verdammter Akzent!« – bei einer permanenten Eins in Englisch, fünf Jahre lang! Mit einem Princeton- Stipendium! Da versuchte man, seine neue Identität zu finden, sich einer neuen Gruppe anzuschließen, unterzutauchen in einer Herde, die einen, bitte!, akzeptieren möge, schrieb seinen Namen – Monica – bereits mit »c«. Und jetzt das. Verdammter Akzent. Kraut. Fritz. Fraullein … ! Am zweiten Tag schon wieder draußen, zum Außenseiter erklärt, als auffälliger, unangepasster Fremdling abgestempelt.
Ein Busticket kaufen und zurück nach New York … Und dann ein Flugticket … nach Europa … Ja, dieser idiotische Flugschein, das war wohl das Hindernis für die Flucht. Das Retourbillet über den Atlantik war jeweils am Ende eines Semesters zu beantragen. Ein Rückflug aus Jux und schlechter Laune war bei diesem Stipendium nicht vorgesehen.
Dass man Flugtickets auch so kaufen konnte, fiel Monica gar nicht erst ein. Und kaufen – wovon?
Monica hatte sich irgendwo eine Tasse Kaffee besorgt, Betty brachte french fries mit Erbsen und chopped steak, was ein Hacksteak war, das nach Plastik und Sägemehl schmeckte.
Sie sprach kein Wort mehr, weder mit Betty noch mit irgendwem sonst. Und das würde bestimmt die nächsten Tage so bleiben. Als sie das leere Geschirr auf das Fließband stellte, das hinunterführte in die Geschirrspülerei – wo dem Gerücht zufolge alle großen Karrieren dieses Kontinents ihren Anfang nahmen – , stand der Typ mit dem roten »P« wieder hinter ihr. Abermals ganz plötzlich und unvermittelt.
Doch diesmal war er ernst, erschreckend ernst.
Er griff nach Monicas Hand und sagte nur: »Komm mit!« und zog sie einfach hinter sich her durch den ganzen coffee shop. Sie wehrte sich nicht. Kein bisschen! Und darüber wunderte sie sich eigentlich den ganzen Weg über.
Er verließ mit ihr, immer noch Hand in Hand, das gotische Gebäude und führte sie quer über den gepflegten Rasen. Die Blätter der hundertjährigen Ulmen bildeten ein hohes, grünes Dach über ihnen. Verirrte Sonnenstrahlen fielen auf die bemoosten Statuen verblichener Gelehrter. Und vom Cleveland-Memorial-Tower mit seinem Zuckerbäcker-Filigran drang der schüchterne, metallische Schlag der Uhr herüber. Ein dünnes Plagiat des Londoner Big Ben.
Vor der ehrwürdigen Nassau-Hall hatten sich Männer und Frauen im Talar und mit viereckigen Baretten eingefunden und standen, in kleinen Gruppen wartend und ein wenig verloren, herum.
Monica und dieser Typ mit dem roten »P« verließen den campus – immer noch Hand in Hand –, überquerten die Hauptstraße der kleinen Stadt mit ihren niedrigen Häusern. Die lag ausgestorben da, mittäglich, sommerlich.
Eine Politesse malte Kreidestriche an die Reifen der abgestellten Wagen und steckte Strafzettel für zu langes Parken unter die Scheibenwischer. An den Straßenecken dösten überzeugte Gläubige und hielten träge ihre Zeitschrift, den watchtower, den »Wachturm«, nichtvorhandenen Passanten entgegen.
Princeton hielt Siesta.
Immer noch lief Monica hinter diesem fremden Menschen her, wusste nicht wohin, wagte nicht zu fragen – verdammter Akzent -, stumm und gefügig.
Sie bogen in eine kleine, schmale Seitenstraße ein.
Es war die Straße der Buchhändler. In den Fenstern der kleinen, weißgestrichenen Holzhäuser türmten sich die hardcovers und paperbacks, die Taschenbücher und antiquarischen Schwarten aller Fakultäten, in allen Sprachen.
Exakte Naturwissenschaften standen neben der Theologie, Psychologie und Soziologie gab es am laufenden Meter.
Der Typ mit dem roten »P« zeigte, ohne sein Tempo zu vermindern, auf die andere Straßenseite. Dort lag hinter einem hohen, schmiedeeisernen Gitter mit goldenen Spitzen der Friedhof des Ortes.
»Du weißt es hoffentlich!« Er sah sich kurz zu Monica um.
Aber sie wusste es nicht, schüttelte nur stumm den Kopf.
»Was denn – nein?« Er schien es nicht zu fassen.
»Nein!«
»Dort drüben liegt euer Einstein begraben!«
Ach so, dachte Monica. Richtig. Der Einstein. Der hat hier gelebt und gelehrt und ist hier gestorben. Dann hat man ihn wunschgemäß verbrannt – mit Ausnahme des Gehirns. Das landete zur weiteren Untersuchung in einem Glas mit Formalin. Einstein. Auch so ein Kraut, ein Fritz, na ja, wie man's nimmt. Aber sicher und hoffentlich auch mit so einem verdammten Akzent …
Aber schon blieb ihr Begleiter wieder plötzlich und unvermittelt stehen: »Wir sind da!«
Ein kleines Ladengeschäft, halb Bäckerei, halb Käseladen, aber andererseits auch wieder Drogerie und coffee shop in einem. Das Fenster hing voll mit heiteren Reklamesprüchen, und vor der Theke drängten sich die Studenten aller Semester.
»Hier gibt's frozenyoghurt.«
»Was bitte?«
»Frozen yoghurt! Ist zurzeit wahnsinnig ›in‹. Schmeckt ähnlich wie Softeis, nur viel gesünder.«
Sie reihten sich in die Schlange ein, und dann schmiss dieser Typ mit dem roten »P« auf der Brust, dieser sunny boy mit seinem unverschämten Charme, eine Runde.
5
In den nun folgenden Wochen und Monaten erhielt das Ehepaar Meier-Reinsberg, das eine kleine Buchhandlung in Gauting bei München betrieb, in den spärlich eintreffenden Briefen der Tochter Monica nur ungenaue Informationen über Studienerfolge und den American Way of Life im allgemeinen, über das miserable Mensaessen, das die einheimischen Kommilitonen als gar nicht ungewöhnlich in Kauf zu nehmen schienen, über sporadische Partys bei coke und candle-light, über gelegentliche Ausflüge nach New York, zu Broadway-Aufführungen und Besuchen in der Met, nach Philadelphia und in das zerfallende Seebad Atlantic-City. Aber immer und mit penetranter Ausführlichkeit wurde über einen gewissen Mike Shepard geschrieben, der Astrophysik studierte, aber kaum Zeit dafür hatte, denn er war Vize-Kapitän der Universitäts-Football-Mannschaft, was ihm ein dickes Stipendium einbrachte. Noch immer galt im Land der Pioniere Sport wesentlich mehr als trockene Wissenschaft.
Er war zwei Jahre älter als Monica und offenbar immer für sie verfügbar.
Er wohnte am anderen Ende des campus in einem neuerbauten dormitory, zusammen mit zwei anderen Sportskameraden.
Die puritanische Tradition erlebte in einer maximalen geographischen Trennung der Geschlechter – zumindest bei Nacht in den universitätseigenen Schlafstätten – eine gewisse Befriedigung.
So konnte man, wie schon gesagt, in Princeton auch mit wenig Geld studieren – aber nicht ohne Wagen. Aber das stand natürlich in keinem der Briefe.
Erwähnt wurde, allerdings, das Schicksal von Mikes Vater. Der war ebenfalls Wissenschaftler und als gesuchter Mathematiker in den fünfziger Jahren bereits zur NASA nach Huntsville/Alabama an das Marshall-Space-Flight-Center gegangen und an den Reisen zum Mond im Jahre '68 namhaft beteiligt. Als er fünfzig geworden war, hatte man ihn im Zuge einer »Umstrukturierung« schlichtweg gefeuert. Jetzt gab er aushilfsweise Unterricht an einer Grundschule in Boston – nach vier arbeitslosen Jahren.
Das Schicksal des Vaters hatte Mikes Liebe zur Wissenschaft merklich gebremst. Sport zahlte sich offenbar aus, und das Studium als Basis für ein ganzes Leben, das war offensichtlich eine Illusion in dieser Zeit.
»Und du, mit angelsächsischer Literatur, was soll das, was nutzt dir das?« wollte Mike von Monica wissen. »Oh, 'ne ganze Menge. Ich weiß immerhin, was Hemingway sich bei seinen Geschichten gedacht hat!« »Weiß ich auch – ich habe ihn einfach gelesen!«
»Nein«, entgegnete Monica, »ich meine ›wirklich‹ gedacht hat. Das erfährt man erst, wenn man die ›Sekundär-Literatur‹ über ihn studiert. Man muss wissen, was Leute, die kompetent sind, denken, was er sich gedacht hat!«
»Fabelhaft!« sagte Mike. »Aber wenn diese kompetenten Schwachköpfe, denen einfach das Hirn und der Schwanz dieses Hemingway fehlen – sonst würden sie doch schreiben, was sie sich selber denken –, wenn diese Fachidioten sich nun einfach täuschen, wenn er sich das, was sie glauben, dass er sich gedacht haben könnte, eben nicht gedacht hat? Was dann?«
Ja, was dann?
»Du, Mike, also so kann man Wissenschaft nicht betreiben …« Monica seufzte. Es war schwierig, gegen Mike und seine Sportlerlogik, die immer so einfach und vernünftig schien, zu argumentieren.
Aber sie versuchte es trotzdem, immer und immer wieder: »Ohne Theorie, verstehst du, keine Hypothese. Und ohne Hypothese, ohne den Versuch der Wahrheitsfindung …«
Weiter kam sie nicht.
Weiter kam sie selten.
Mike brauchte sie in solchen Fällen nur anzulächeln – und Monicas Logik war blockiert.
Der Rest des Abends endete stets unwissenschaftlich.
So lernte sie, zumindest im Dämmerlicht der langen Herbst- und Wintertage, die sanft geschwungene Parklandschaft New Jerseys aus der Sicht von Mikes altem Chevi kennen.
Dass sie die Zwischenexamen alle schaffte, erschien ihr manchmal als Wunder. Und in den entscheidenden Phasen war Betty, die Zimmerkollegin aus Massachusetts, gut genug, mit ihr nächtelang die geheimen Hintergedanken der angelsächsischen Literaten zu büffeln.
Der Sommer kam, und mit ihm das Trainingscamp der football-champions mit dem roten »P« auf Cape May, das weit hinaus in den Atlantik reichte.
Nächte am Strand, ein Lagerfeuer, Mike sang zur Gitarre, irgendwann sang sie mit, denn der »verdammte Akzent« war fast völlig verschwunden. Ihr ordentliches Schulenglisch war unmerklich und nahtlos in einen perfekten Ostküsten-Slang übergewechselt.
Als ständige Begleiterin des vice-captain hatte sie Privilegien. Aber abgesehen davon, der Liebling der Gruppe war sie schon lange. Sie wurde eingeweiht in die komplizierten taktischen Regeln und Absprachen der »P«-Offensiven, die in allen Colleges der Ostküste gefürchtet waren. Wenn »ihre« gepanzerten Männer unter Sturzhelm, mit Schulter- und Nierenschutz, mit Stahlbügeln vor Nase und Kinn auf die gegnerische Mannschaft prallten, dass die Funken flogen, rannte sie am Rand des Spielfeldes mit von Angriff zu Angriff. Mike war stolz auf Monica. Nicht nur, weil sie hübsch war und ein fabelhafter Kumpel, sie war auch die erste Europäerin, die football nicht brutal oder einfach nur komisch fand, sondern die sich ernsthaft bemühte, die verschlungenen rules zu begreifen.
So begann das zweite Jahr in Princeton, das zweite Jahr einer Romanze, die den beiden so intensiv, so selbstverständlich und auch so absolut ungefährdet erschien, wie das heutzutage nur noch selten bei partnerschaftlichen Bindungen unter Studenten möglich scheint.
»Wo ist dein Pass?«
Mike war überraschend auf Monicas Bude gekommen und stand nun hinter ihr.
»Mein Pass?«
»Ja, dein Pass!« Mike lächelte verschmitzt, blieb an der Tür stehen und wartete.
»Such deinen Pass und komm mit!«
Sie suchte ihn, fand ihn auch sofort und sah Mike neugierig an: »Wir wollen verreisen?«
»Dazu brauchst du in diesem Land keinen Pass – nicht mal rüber nach Kanada – nicht mal nach Mexiko. Komm!«
Er ging schon voraus in das düstere, neugotische Treppenhaus mit seinen geschmacklosen, bunten Fenstern. »Wozu dann den Pass?«
Monica war hinterhergekommen, zögernd, misstrauisch, das grüne Dokument ihrer Nationalität in der Hand – Kraut, Fritz, Fraullein –, und blieb nun abwartend stehen.
Eine halbe Treppe tiefer standen Donald Arthur, Sidney, Philip Jordan, Richard C. Sperling, standen Harold und Betty, William und Maude, Irving und Phil Russel und noch einige andere, die komplette Clique stand da herum und starrte hoch zu Monica, und alle wussten etwas und grinsten und schienen etwas zu verbergen. »Na, los, red schon: wozu der Pass?«
»Ach, nichts – nur, Markovicz möchte dich kennenlernen.«
»Wer ist Markovicz?«
»Markovicz. Reverend Markovicz von der Baptist Church, draußen am Highway Number1. Der Pope, dessen Namen du immer vergisst. Der will Ms. Muller-Meier-Schmitz kennenlernen. Das ist alles!«
Monica biss sich auf die Lippen – sollte sie weinen oder lachen …
»Mike … !?«
»Ja?«
»Was will der Reverend mit meinem Pass?«
Mike sah sich um, lächelte zu seinen Freunden hinüber, zuckte die Schultern: »Keine Ahnung. Wahrscheinlich will er sehen, wie lange er noch gültig ist, und dann das übliche: Name, Geburtstag, Geburtsort. Ich habe ihm das zwar alles schon durchgegeben, aber der Reverend ist sehr gewissenhaft und arbeitet streng nach dem Gesetz, dem state-law. Verstehst du?«
»Nein!«
»Hm. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Du brauchst auch einen Zeugen. Du kannst wählen. Alle sind mitgekommen. Aber einer genügt. Mein Zeuge ist Donald.«
Monica war immer noch etwas sprachlos. Aber dann dachte sie, wenn das alles ohnehin völlig anders zu laufen scheint, als sie sich das in ihren Mädchenträumen gedacht hatte, dann war's wohl das Beste mitzuspielen.
»Mike …«
»Ja?«
»Ich hoffe, du hast mit Papa gesprochen!«
»Natürlich! Gestern Abend!«
»Ich meine meinen Papa, nicht deinen. Deiner hat ohnehin nicht viel zu sagen.«
Mike winkte ab: »Mit deinem Papa, natürlich, mit Mister Muller-Meier-Schmitz in Munich, Bavaria.
Gestern Abend um zehn. Ich habe leider vergessen, das mit der Zeit in Europa. Bei ihm war es morgens um vier. Er war sehr überrascht und sehr schnell wach. Ich glaube, er hat nichts dagegen. Familie Muller-Meier-Schmitz ist sehr glücklich, glaube ich.«
»Glaubst du?«
»Ja. Er hat gesagt, er weiß schon alles über mich, und er wartet eigentlich schon lange auf den Anruf. Und er findet das sehr anständig von mir. Und mit Mrs. Muller-Meier-Schmitz senior habe ich auch kurz gesprochen, sehr kurz. Ihr Englisch ist miserabel, und ich glaube, sie hat geheult. Sie hat irgendwas gesagt, du wärst katholisch oder so …«
»Stimmt. Aber nicht sehr.«
»Ja, das habe ich auch gesagt. Und dass das mit Markovicz schon gebongt ist. Und dass es eine Hochzeit wird in Weiß!«
Monica kam vor an das reichgeschnitzte Treppengeländer, schaute hinunter auf die fröhliche Clique, auf Mike …
»Alle haben es gewusst. Allen hast du es erzählt. Und mich hast du nicht gefragt …«
»Ja, stimmt. Ich hab' immer so Angst, dass du heulst!«
Monica schluckte tapfer sämtliche Klöße runter, die in ihrem Hals saßen.
»Ich heul' …« Sie schluckte noch mal, bevor sie weitersprechen konnte: »Ich heul' bestimmt nicht! Verlass dich drauf!«
»Okay …!« Mike kam die Stufen wieder hoch, die er vorhin hinuntergeflüchtet war.
»Okay – Ms. Muller-Meier-Schmitz: Willst du Mrs. Mike Shepard werden?«
Monica wartete zehn lange Sekunden. Da war man nun modern und emanzipiert, und jetzt hatte man Angst, dass einem die Stimme wegblieb – einfach nur so. Und vorher räuspern gilt nicht. Und die Zeugen auf dem Treppenabsatz starrten sie alle erwartungsvoll an. Aber überraschenderweise ging alles glatt, laut und deutlich und fast ein wenig zu selbstsicher kam es: »Ja …! Ja, sicher … natürlich … warum denn nicht?«
6
Als Mr. und Mrs. Mike Shepard durch das große Tor des Blair-Tower in den campus zurückkehrten und langsam die große Treppe hinunterschritten, schallten ihnen Applaus und Hochrufe entgegen. Eine stattliche Anzahl von Kommilitonen, Dozenten und Professoren hatte sich eingefunden. Einige warfen Reis, andere Konfetti, ohne über den tieferen Sinn dieser Rituale groß nachzudenken.
Die Blätter sind ja fort … dachte Monica, die Blätter der hundertjährigen Ulmen, der Platanen und Linden. Kahl und starr standen die Bäume vor den bizarren Fassaden dieser neugotischen Kulisse. Nichts war mehr hinter dem Blattwerk des Sommers verborgen. Kalt und grafisch ragten Giebel, Zinnen und Türmchen in den grauen Novemberhimmel.
Seit ein oder zwei Wochen mussten sie schon kahl sein, die Bäume. Und Monica hatte es nicht bemerkt.
Aber warum, dachte sie, sehe ich es jetzt?
Plötzlich war dieser lange Sommer vorbei und dieser kurze, bunte Herbst, den sie Indiansummer nannten, mit seinem für Europäer geradezu unglaublichen Farbenspiel.
Monica stand ganz ernst am Fuße der Treppe, schüttelte Hände, wurde umarmt, gab Wangenküsse – und war plötzlich weit weg.
»Was ist – he?« Mike schaute herüber zu ihr.
Sie schüttelte den Kopf, versuchte diesen Anflug einer düsteren Ahnung loszuwerden: »Nichts ist, Mike, nichts …!«
Aber dann spielte die Musik, Ronnie und seine Band produzierten countrymusic par excellence, und auf dem Rasen vor der »Holder-Hall« begann ein improvisierter squaredance, dem sich immer mehr Paare anschlossen. Von allen Seiten strömten Neugierige aus den dormitories und Seminaren, angelockt von der Musik und dem rhythmischen Klatschen der Umstehenden.
Da träumt man zehn Jahre lang oder noch länger von diesem Tag, und plötzlich ist er da – und in ein paar Stunden ist er schon wieder vorbei, dachte Monica, während sie in die Hände klatschte, sich drehte, fünf Schritte vor, fünf zurück, zwei nach links, zwei nach rechts, Partnerwechsel, Drehung und so weiter.
Alles war ganz anders gekommen. Ich bin hier, bin hier, bin hier, und ringsherum ist das riesige Amerika.
An der linken Hand blinkte ein Ring – aber die Hände waren immer noch ihre Hände, waren immer noch die gleichen.
Bin ich denn glücklich? fragte sich Monica, richtig glücklich, nicht nur einfach happy oder so – und auf einmal wusste sie's nicht mehr.
»How much is anyone worth? …«
Um 7.35 p.m., pünktlich nach den ersten Abendnachrichten, kam im Radio ihr Lied.
»Was ist der Mensch wert? …«
Sie saßen alle in der Tischtennishalle, waren vor dem plötzlich einsetzenden Nieselregen dorthin geflüchtet und hörten es sich an. Großer Jubel, große Rührung.
»What is the value of a life …«
»Was ist so ein Leben denn wert?
Egal ob's Glück oder Ärger beschert, das in Geld zu messen ist sicher verkehrt, aber was war's am Ende denn wert?«
Victor Young vom Radio kam persönlich herüber und brachte einen Scheck. 250 Dollar. Unfasslich! So viel Geld für ein Lied. Allerdings kaufte er damit alle Rechte für alle Zeit.
Auch gut. Eine gemästete Taube in der Hand – statt einem bunten Fasan, von dem man nur träumt, auf dem Dach. Wer weiß, ob er es je weiterverkaufen kann. Das war nun sein Risiko.
Und Donald Arthur lud daraufhin alle in den Victoria-Pub ein zu SirloinSteak mit gebackenen Idaho-Kartoffeln und mit »beer as much as you can drink«, Bier, so viel in dich reingeht. Das war das neueste Werbeangebot dieses Lokals zum Kampfpreis von 3.95. Wenn nicht allzu viele mitkamen, blieb ihm sogar noch etwas übrig von seinem Scheck.
Mehr als ein Liter ging in keinen von ihnen rein. Und bei diesem dünnen Gebräu blieben sie alle nüchtern.
Auch Monica und Mike. Die waren plötzlich verschwunden, hatten sich in den alten Chevi gesetzt und waren hinausgefahren in die nächtliche, herbstliche Parklandschaft, um allein zu sein, um sich zu lieben. Denn die dormitories blieben getrennt.
Die Universitätsverwaltung machte keine Ausnahme bei jung verheirateten Paaren.
Sie hätten sich ein Zimmer nehmen können in einem der motels entlang der Number 1. Aber diese Idee war ihnen zu spät gekommen. Ab morgen dann, ab morgen, jede Nacht, auf der langen Reise, die nun vor ihnen lag, und jede weitere Nacht ihres langen Lebens …
»Mike, du, ich hab' Angst …!«
»Wovor?«
Der Scheibenwischer schlug hin und her in seinem stereotypen Takt. Mike hatte vergessen, ihn abzuschalten, und war jetzt zu träge, um nach vorn zu klettern.
»Wovor hast du Angst?«
Der Regen pladderte auf das Blech der alten Karosserie, Windböen brachten das Gefährt zum Schaukeln. »Hast du Angst vor der Zukunft – unserer Zukunft?«
Monica schwieg immer noch.
Wie Gespenster ragten die kahlen Büsche und Weidenstrünke am Ufer des Millstone-River in den Himmel. Die tiefhängenden Wolken schimmerten im Lichtreflex der kleinen Stadt, die hinter Wald und Hügeln verborgen blieb.
»Du, mein Stipendium läuft noch zwei Jahre. Ich hoffe, dass die boys in guter Form bleiben. Vielleicht wird es auch verlängert. Und die professionellen Vereine suchen laufend Trainer für ihre Junioren-Mannschaft. An der Westküste zum Beispiel …«
Aber da brach er ab.
Die Scheinwerfer der Wagen, drüben auf der Number 1, geisterten über die Landschaft. Die weißgestrichenen Ruinen der leerstehenden Farmen leuchteten kurz auf, versanken wieder, tauchten unter in dieser Nacht.
»Ich könnte auch vorbeischauen, sie liegen am Weg – ich meine die großen Observatorien. Die suchen Praktikanten zur Auswertung ihrer Serienfotos und der Computerausdrucke. Lick-Observatory, zum Beispiel, bei San Francisco. Gehört zur Stanford-University. Mount-Palomar ist sicher zu überlaufen. Aber Kitt-Peak bei Tucson, Arizona. Da ist ein neuer Schwerpunkt entstanden. Vier Observatorien. Es ist nur ein kleiner Umweg von unserer Route. Was meinst du?«
Doch Monica schwieg immer noch.
Sie fasste seinen Nacken, zog ihn herunter zu sich, presste ihn an sich, spürte seine Nähe, seine Wärme, seine Haut auf der ihren, seinen Atem.
»Du verstehst mich nicht.« Sie sprach leise und dicht an seinem Ohr. »Ich hab' einfach Angst – und wenn ich wüsste wovor, wär' sie weg!«
Er verstand sie wirklich nicht.
Er ahnte nicht mal, was sie fühlte oder meinen konnte.
Er liebte sie, er war trainiert und kräftig und optimistisch, es gab nichts, was er nicht schaffte, wenn er es nur richtig anpackte. Er konnte für sie beide sorgen, wenn sie nicht plötzlich unangemessene Ansprüche stellte. Sie hatten eine große Reise vor sich: Ich zeig' dir mein Land, hatte er gesagt. Einen ganzen Monat lang oder auch zwei. Denn dieses Land war ein Kontinent, fünftausend Kilometer breit und zweieinhalbtausend lang – oder wenigstens fast. Und es gab mehr zu sehen als auf jedem anderen Kontinent dieses Planeten. Er war bereit, es ihr zu zeigen – solange der alte Chevi ebenfalls dazu bereit war.
»Also, was ist?«
»Was soll sein?«
»Immer noch Angst?«
»Ich weiß nicht.«
Sie tastete über seinen Rücken, über seinen Nacken, spürte die Muskeln – football verlangt ganze Kerle, das war er nun wirklich, ein ganzer Kerl. Sie war bereit, ihm die Astrophysik bei Gelegenheit auszureden, nein, nicht jetzt, irgendwann. Aber bestimmt rechtzeitig, bevor er hinter Schreibtischen, Computer-Terminals und den Okularen irgendwelcher Fernrohre verkümmerte.
Immer noch tickte der Scheibenwischer, fauchte der warme Luftstrom der Heizung gegen die Decke. Die Scheiben waren inzwischen völlig beschlagen. Mit dem nackten Fuß wischte sie sich ein Guckloch frei und sah die Lichter der Fahrzeuge drüben auf dem highway vorüberziehen. Unablässig strömte der Verkehr vom Süden hinauf nach New York. Die Aluminiumflächen der Vierzig-Tonnen-Riesenmonster glänzten auf in den Lichtern der Gegenfahrbahn.
Das brummte und dröhnte eine halbe Meile weit oder noch mehr in das Land.
Vom Armaturenbrett her leuchteten schwach und grün die Ziffern der Uhr: es war kurz nach zwölf. Mitternacht.
Das also war dein Hochzeitstag, dachte Monica. Der erste Tag ihrer Ehe hatte begonnen, ganz undramatisch und leise – und fast hätte sie es übersehen. Der erste Tag vom Rest deines Lebens – wie es in diesem Werbespruch hieß.
Und dann war die Angst plötzlich weg.
Ganz einfach weg.
Was sollte passieren, sie hatte ja ihn – ihn, ihn! Er war da, ganz nah, ganz dicht. Und so nah und dicht würde sie immer bei ihm bleiben, immer. Und sie reckte sich ihm entgegen und presste sich an ihn und spürte ihn überall, über sich, um sich herum, in sich. Spürte seinen Atem, der immer heftiger wurde, den Schweiß seiner Stirn, seiner Haut. Nichts konnte sie mehr trennen, nichts, weder jetzt noch irgendwann.
Nichts, nie, nichts. Sie war ein Teil von ihm und er von ihr.
Irgendwann fuhr ein Wagen vorbei, sehr nah und ganz langsam. Das Licht flutete herein, erfüllte diesen Raum um sie mit gleißender, blendender Helle. Sie schloss die Augen, spürte es wie Wellen über sich kommen. Sah nicht, wie dieses Licht wieder hinausgesogen wurde in die Schwärze der Nacht. Fiel, fiel mit ihm, mit ihm, irgendwohin, irgendwoher und kam nicht mehr an, blieb schweben, an seinen Nacken geklammert, die Lippen festgesogen an seinem Mund, atemlos, traumlos – und sie wusste, dass sie jetzt und immer glücklich sein würde.