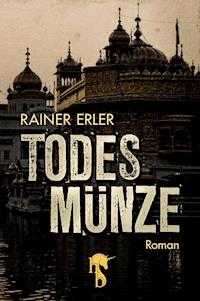3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Liebe vermag es nicht nur, im richtigen Augenblick die richtigen Menschen zueinander zu führen. Wenn man Rainer Erlers dreizehn fantastischen und gleichzeitig erotischen Geschichten Glauben schenken will, dann ist die Liebe auch eine Kraft, die es schafft, jenseits von Zeit und Raum, Verstand und Vernunft zu wirken. Und so sind auch die erotischen Geschichten allesamt ein wenig unwahrscheinlich und absurd, teilweise auch unwirklich, voll Poesie, Gefühl oder Komik – aber dabei immer magisch …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Rainer Erler
Die Orchidee der Nacht
Dreizehn fantastische Liebesgeschichten
Erzählungen
DIE ORCHIDEE DER NACHT
Der erste Verdacht kam mir bereits in der Hochzeitsnacht. Kim-Lan war von einer Sinnlichkeit, die mir den Atem raubte. Ihre raffinierte Verspieltheit und ihr Ungestüm versetzten mich in helles Entzücken – allerdings nährten sie in mir auch den Argwohn, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Am Abend, noch bevor wir beide die kleine, festliche Runde in ›Tegtmeyer's Steakhouse‹ diskret verließen, hatte mich Bob Rendall, mein Schwiegervater, beiseite genommen: »Geh zart mit ihr um, alter Junge, hörst du! Kim-Lan ist noch so unerfahren und so jung!«
Ich nickte nur, war todmüde, ziemlich angesoffen und erwartete also eine eher ruhige Nacht. Mein Gott, ich war ja nicht mehr zwanzig, hatte drei zermürbende Ehen bereits hinter mir, und eine Flasche mit kalifornischem Burgunder und ein Fernsehempfänger mit sechzehn Kanälen wären zur Not auch ein hübsches Abendpläsier, zumindest sehr erholsam nach so einem Tag. Und eine Defloration so auf Befehl ist ohnehin nicht mein Fall.
Als aber dann dieser kleine, achtzehnjährige, schwarze Teufel in meinem Schlafzimmer erschien, mit einem Nichts aus gerüschter, weißer Honan-Seide um den zierlichen Leib und mit einem verführerischen Lächeln in den großen, dunklen Augen, war ich innerhalb von Sekunden nüchtern und wach wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
Am nächsten Mittag, viel zu früh, wie ich fand, und total ermattet, gaben wir einen Empfang für Freunde und die leitenden Mitarbeiter meines Betriebs. Und wieder tauchte mein Schwiegervater wie ein Verschwörer hinter mir auf, grinste und schlug mir vertraulich auf die Schulter: »Du siehst verdammt blass aus um die Nase, alter Junge!«
»Alter Junge!« – Bob Rendall ist knapp zwei Jahre älter als ich, allerdings Texaner und ein ebenso brillanter Geschäftsmann wie Erfinder. Eine seltene Mischung.
Er nahm mich am Arm, drängte mich ziemlich auffällig aus dem Kreis der Gäste und zwinkerte mir zu: »Na, hab' ich zu viel versprochen?« Er drohte mit dem Finger. »Gib acht auf dein Herz!« Dann lachte er noch ziemlich unpassend und verschwand auf die Terrasse, bevor ich entsprechend reagieren konnte. »Zu viel versprochen?« – Nichts hatte Bob Rendall versprochen, rein gar nichts. Und mein Herz war okay! Schließlich leistete ich mir einen eigenen Betriebsarzt und ließ mir alle drei Monate vorsorglich und unter extremer Belastung ein EKG erstellen. Außerdem joggte ich täglich drei Meilen. Ich musste es also wissen. Aber dann betrachtete ich meine reizende Neuerwerbung, Kim-Lan, wie sie geschickt und artig mit den Gästen parlierte und dank ihres Charmes und ihrer exotischen Schönheit zum Mittelpunkt des Interesses wurde, – und machte mir so meine Gedanken.
›Kim-Lan‹ ist ein vietnamesischer Mädchenname und heißt ziemlich frei übersetzt: ›Silberne Blume der Nacht‹. Oder auch ›Orchidee‹. Und diese ›Orchidee der Nacht‹ war also nun mein rechtlich angetrautes, viertes Weib, und ich habe in unserer Neu-Presbyterianischen Kirche feierlich die rechte Hand erhoben und die linke aufs Herz gelegt und versprochen, »sie zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod uns scheidet«! Das Gleiche hatte ich allerdings bereits einer gewissen Nancy, einer Patricia und einer Cynthia gelobt, ohne dass ich diesen Schwur jeweils länger als vier Jahre halten musste.
Diesmal jedoch schien der Fall etwas anders und wesentlich komplizierter zu liegen. Und das beruhte nicht zuletzt auf meinem etwas absurden Zweifel, über den noch zu reden sein wird.
Kim-Lan, meine nächtliche Orchidee, ist Eurasierin. Ein atemberaubend schönes Mädchen. Als ich ihr zum ersten Mal begegnete, bei einer Party im Hause von Bob Rendall, traf es mich wie ein Hammer, trotz meiner, na ja, fast fünf Jahrzehnte auf meinem durchaus sportlichen Buckel. Aber das lag nicht nur an dem Liebreiz dieses Mädchens, an ihren hüftlangen, lackschwarzen Haaren, an diesen sanften Mandelaugen mit den langen Wimpern, an dieser bronzefarbenen Haut, die durch das schmalgeschnittene, weiße Seidenkleid hindurchschimmerte.
Was mich förmlich aus den Schuhen kippte, was mir den Atem nahm, das war die Eröffnung von Bob Rendall. Der schlug mir, wie üblich, auf seine burschikose Art auf die Schulter, schob mich zu diesem Zauberwesen hin und rief: »Hier, alter Junge! Darf ich dir meine jüngste Tochter Kim-Lan vorstellen?«
Er lachte über mein dämliches Gesicht und über das ungläubige Erstaunen der Umstehenden. Klar hatte Bob Rendall Kinder, sogar vier oder fünf, soviel man wusste. Aber die waren alle längst aus dem Haus. Auch Bob Rendall hatte schließlich eine mindestens ebenso ausgefranste Biographie hinter sich wie ich. Doch dass dieses exotische Wesen seine leibliche Tochter sei, das nahm ich ihm einfach nicht ab. Damals nicht, und heute noch viel weniger, aber aus völlig anderen Gründen.
Später an diesem denkwürdigen Tag wurde er dann vertraulich und packte aus. »Kriegsbeute!« sagte er lachend, obwohl er eigentlich spüren musste, dass ich diese Formulierung ziemlich unpassend und gar nicht komisch fand.
Bob Rendall war Mitte der sechziger Jahre als einer der ersten Militärberater des Pentagon in Vietnam gelandet. Aus dem Dozenten für Kybernetik an der Stanford University machten die Vereinigten Staaten eine Art ›Elektronik-Offizier‹ bei einer Raketen-Einheit.
Kim-Lans Mutter, sagte er, sei die Besitzerin des feinsten Etablissements der Stadt gewesen. Und wenn ich Bob Rendalls ebenso blumiger wie offenherziger Schilderung Glauben schenken darf, dann verkehrten dort außer ihm selbst nur noch Offiziere vom Zwei-Sterne-General an aufwärts.
Das alles geschah, lange bevor dieses Saigon zu einem einzigen schmierigen Bordell geworden war. Und mit dieser Zeit der Korruption und der anschließenden Katastrophe unserer Kapitulation hatte Bob Rendall, wie er mir versicherte, nicht das Geringste mehr zu tun. Er war ja nur knappe fünf Jahre in Asien gewesen. Aber diese knappen fünf Jahre hatten sich offensichtlich gelohnt: Die schöne Frucht dieser Zeit, die Silberblume Kim-Lan, diese Orchidee der Nacht, war der bewundernswerte Beweis!
Kaum dass sie laufen konnte, war das kleine Mädchen zu den Englischen Fräulein nach Paris gekommen, wo auch ihre Mutter angeblich schon die Herzensbildung der feinen Welt erworben hatte. Und auf einem altehrwürdigen, englischen Internat hatte man, so hieß es, den Teenager mit humanistischem Geistesgut und abendländischer Kultur vertraut gemacht. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika waren für dieses Kind der Liebe einfach nicht fein genug. Zumindest damals noch nicht. Jetzt, allerdings, war das Mädchen hier in Bay City, Michigan, gelandet, um ihrem Vaterhaus exotischen Glanz zu verleihen. Und es hatte den Anschein, als bliebe sie uns eine Weile erhalten. Oder hatte Bob Rendall etwas anderes mit ihr im Sinn?
Bob Rendall ist Fabrikant. Er produziert sogenannte Robbies nach eigener Konstruktion, also Fertigungsautomaten, die Karosserieteile ausstanzen, formen, zusammenschweißen und schließlich lackieren. Das bringt die Gewerkschaftsbosse der Automobilwerke zwischen Detroit und Cleveland, zwischen Atlantik und Pazifik ganz gehörig um ihren Schlaf. Denn wo einer von Bob Rendalls Robbies auftaucht, gehen mindestens fünfzehn Arbeitsplätze vor die Hunde. Manchmal auch mehr. Denn Bob Rendalls Robbies feiern nie krank, beanspruchen weder Urlaub noch ein soziales Netz, arbeiten vierundzwanzig Stunden rund um die Uhr, ohne an Streik oder Weiber, Mittags- oder Zigarettenpause zu denken, sind immerzu nüchtern und auch montags in bester Verfassung. Logisch, dass Bob Rendalls Auftragsbücher für das nächste halbe Jahrzehnt voll sind.
Bob Rendalls Robbies sind kleine Kunstwerke mit stählernen, nach allen Seiten drehbaren Greifarmen, stehen auf einem wuchtigen Sockel und sind mit einem hochkomplizierten, individuellen und vom Einsatzzweck her konzipierten Programm ausgestattet.
Ihr Gehirn ist nicht größer als eine Zündholzschachtel. Und das Herzstück des Gehirns, der ›chip‹, ist von mir.
Auch insofern fällt es mir schwer, an Zufall zu glauben. Schon meine erste Begegnung mit dieser nächtlichen Orchidee erscheint mir als Teil eines strategisch ausgeklügelten Plans. Wer mit einer Tochter wie Kim-Lan aufwarten kann, weiß dieses Kapital auch richtig einzusetzen. Denn wie Männer in den allerbesten Jahren auf so ein Mandelaugenwesen reagieren, ist kalkulierbar.
Bob Rendall und ich, wir kennen uns leidlich gut, wie sich Geschäftspartner eben so kennen, die bei jeder Gelegenheit versuchen, sich gegenseitig aufs Kreuz zu legen.
Natürlich bemühte sich Bob Rendall seit Jahren ebenso erfolglos wie verzweifelt, an meine Chips um 7,5 bis 8 Prozent billiger ranzukommen oder, noch besser, meinen ganzen Laden einfach aufzukaufen. Andererseits fragte ich mich bisher: Was hat Bob Rendall letzten Endes schon zu bieten – bis ich Kim-Lan gegenüberstand. Da sagte mir mein Instinkt, dass er gewonnen hatte.
Schließlich waren seit meiner Scheidung von Cynthia, die mich endgültig ruiniert hatte, bereits drei volle Monate vergangen.
Bob Rendall gab sich maßlos überrascht, als ich am Tag nach der Party wieder bei ihm erschien, in der Absicht, mit Kim-Lan auszugehen. Ich hatte in Tegtmeyer's Steakhouse vorsorglich drei Plätze bestellt. Drei, nicht zwei. Für den Fall, dass es mir nicht gelingen sollte, den ebenso fürsorglichen wie misstrauischen Vater abzuschütteln. Ich war überzeugt, dass er nur schlechtes Theater spielte, als er mir mit feuchten Augen und tragisch umflorter Stimme seine Skrupel anvertraute: Dieses unerfahrene Kind einem so schlitzohrigen Wüstling wie mir anzuvertrauen, wäre eine grobe Verletzung seiner väterlichen Aufsichtspflicht. Während wir noch diskutierten, hatte sich die Tochter bereits fertig aufgeputzt, und dann zogen wir also los. Zu zweit, natürlich, nicht zu dritt. Und es wurde ein unvergesslicher Abend.
Ich hatte mich auf leichte Konversation eingestellt, ganz der routinierte Charmeur, Smalltalk auf dem zweituntersten Level. Mein Gott, achtzehn Jahre, ›Englische Fräulein‹, frisch aus dem Internat. Aber es kam alles völlig anders als erwartet!
Noch vor dem Menü verwickelte mich Kim-Lan in eine anregende Fachdiskussion über die Vorteile von Praseodym-Einschmelzungen beim Herstellen von integrierten Schaltkreisen auf Siliziumbasis. Und sie stellte mir die durchaus berechtigte Frage, weshalb wir zum Ausstanzen der Chips nicht einen Neodym-Laser verwendeten.
Natürlich hatte ich zuerst Bob Rendall im Verdacht, dem Fachwissen dieses Kindes kräftig nachgeholfen zu haben. Okay, das wäre sein gutes Recht gewesen. Aber als Kim-Lan jede meiner Gegenfragen geschickt parierte und ich auf keinerlei Lücken stieß, wurde mir die Sache im höchsten Grade unheimlich.
Wir wechselten also das Thema, und nach dem dritten Martini begann das Kind in aller Unschuld hübsch pointierte Herrenwitze zu erzählen. Und das in ihrem so exotisch klingenden, gutturalen Singsang, den ich ihrer vietnamesischen Mutter, den Englischen Fräulein in Paris und dem britischen College gleichermaßen anlastete.
Ihr Akzent war für mich ebenso aufregend wie ihr Dekolleté, und ich bemerkte, wie unser Tisch zum heimlichen Zentrum des Lokals geworden war. Von allen Seiten erntete Kim-Lan begehrliche Blicke, hauptsächlich von den anwesenden Herren.
Beim ortsüblichen Sirloinsteak mit Baked Potatoes mokierte sie sich über die angelsächsische Küche, bewies Kennerschaft bei einem 79er Burgunder, der ihr im Geschmack zwar samtig wie ein Persianerfell, im Bouquet kräftig bis elegant, aber doch eine winzige Spur zu kühl erschien, kritisierte die Wirtschaftspolitik der Republikaner mit ihrer Geldmengenideologie und begann beim Dessert plötzlich und ohne Übergang genüsslich zu schnurren. Sie machte – sehr leise – äußerst zweideutige Bemerkungen, presste ihr Knie gegen das meine und griff nach meiner Hand.
Ich war ebenso erregt wie perplex. Diese Mischung aus sinnlichem Kindweib, intelligenter Lady und kollegialem Kumpel konnte keine Laune der Natur geschaffen haben. Kim-Lan war schlicht und einfach das, was Männer sich erträumten, sofern sie bereits genügend schlechte Erfahrungen mit Frauen hinter sich hatten, was man von einem rüstigen Endvierziger in diesem Land doch wohl mit Fug und Recht annehmen konnte.
Mein Entschluss stand fest, lange bevor sie im Taxi an meine Schulter sank und ihre schmale, braune Hand, ganz zufällig, hinter meiner Krawatte und zwischen zwei Oberhemdenknöpfen auf meiner angegrauten Sportlerbrust gelandet war. Dort kraulte sie mit scharfen Nägeln genau die richtige Stelle.
Dass ich die Situation an diesem ersten Abend mit Kim-Lan nicht schamlos ausgenutzt habe, ließ den Respekt, den ich vor meinem guten Charakter habe, wieder einmal gewaltig wachsen. Ein paar Tage später, es war gleich im Anschluss an die Unterzeichnung des neuen Vertrags über künftige Chips-Lieferungen, der Bob Rendall mit allergrößter Genugtuung erfüllte, weil er ihm gleichzeitig das Vorkaufsrecht auf meinen Betrieb sicherte, kam ich wie beiläufig auf seine Tochter Kim-Lan und auf mich und auf eine eventuelle gemeinsame Zukunft zu sprechen. Und ich bat Bob Rendall um ihre Hand. Bob Rendall reagierte wieder einmal überaus erstaunt, was ungeheuer verlogen wirkte, sah mich lange und sehr abschätzend an und fragte schließlich taktlos: »Wie viele Jahre hast du eigentlich schon auf deinem Buckel?« Als ob er es nicht wüsste.
Wir änderten also ein paar Passagen in dem Chips-Vertrag zu Bob Rendalls Gunsten, dann umarmte er mich, und wir waren uns einig.
Und seither geht mir ein bestimmter Verdacht nicht mehr aus dem Kopf, auch wenn es mir bis heute nicht gelungen ist, eindeutige Beweise oder zumindest Indizien aufzuspüren.
Ich weiß, ich bin undankbar, sowohl dem Schicksal gegenüber wie auch Kim-Lan, die ich über alles liebe, als auch Bob Rendall, dem ich Genialität nie abgesprochen habe. Und vermutlich stehe ich allein mit meiner fixen Idee!
Die Verlobung wurde ganz offiziell in Bob Rendalls Haus gefeiert. Im engsten Familienkreis. Seine vierte oder fünfte geschiedene Frau war angereist, eine gewisse Abigail Forrester, inzwischen in Baltimore wieder verheiratet.
Bob Rendall fand es wohl stilvoller, wenn bei der offiziellen Verschacherung seiner illegitimen Tochter eine der offiziell zuständigen Mütter mit anwesend war. Auch wenn diese Abigail Forrester, geschiedene Rendall, glaubhaft versicherte, von der Existenz dieses Kindes weder damals noch später unterrichtet worden zu sein.
Kim-Lan sah wieder einmal entzückend aus. Sie trug ein enges, hochgeschlitztes Kleid aus türkisschimmernder Thai-Seide und eine Blüte aus silbergefasster Jade im Haar: eine Orchidee der Nacht! Nach dem obligatorischen Schlag auf meine Schulter flüsterte Bob Rendall mir zu: »Pass bloß auf, alter Junge. Ich fürchte Kim-Lan wird ihrer Mutter immer ähnlicher!«
Was gab es da zu befürchten! Ich konnte schließlich zu Recht annehmen, dass er weniger auf diese anwesende Abigail Forrester, als auf diese legendäre Madame in Saigon anspielte, und machte mir deshalb in dieser Richtung durchaus schon gewisse Hoffnungen.
Diese Hoffnungen haben mich bis heute nicht getrogen. Im Gegenteil. Seit meinem feierlichen Schwur vor dem Priester der Neu-Presbyterianischen Kirche, den wir in allem Respekt vor den puritanischen Sitten unserer Vorväter in keuscher Zurückhaltung abgewartet hatten, habe ich bereits mehr als sechzehn Pfund abgenommen. Auf Frühsport und Jogging kann ich seither dankend verzichten. Die langen Tage in meinem Office verbringe ich in erster Linie mit der Betrachtung von Kim-Lans Farbporträt, das meinen Schreibtisch ziert, und in der Vorfreude auf den gemeinsamen Abend – oder besser: die Nacht.
Nachdem ich es mir angewöhnt habe, mein Büro erst gegen Mittag, statt wie bisher üblich um acht Uhr dreißig zu betreten, gingen auch die Umsatzzahlen, zum ersten Mal seit der Rezession von 82, leicht zurück. Ein Grund mehr, den ganzen Laden lieber heute als morgen an Bob Rendall abzugeben, der auf diesen Augenblick ohnehin sehnlichst zu warten schien.
Andererseits erscheint es mir inzwischen reichlich naiv, Bob Rendall ausschließlich kommerzielle Überlegungen bei seiner Kuppelei zu unterstellen. Ebenso wenig lag ihm an meinem persönlichen Glück. Nein, der Verdacht, der in mir nagt und der mich bisweilen kaum noch schlafen lässt, ist so unglaublich absurd, ist von einer solch wahnwitzigen Perversität, dass ich es nicht wage, ihn bereits jetzt, an dieser Stelle, auch nur auszusprechen.
Wenn meine Vermutung zutreffen sollte, dann müsste ich Bob Rendall als Unternehmer wie als Mann eine derart teuflische Absicht unterstellen, dass dies eine völlige Umkrempelung unserer Gesellschaftsordnung, eine Auflösung des gesamten ›American-Way-of-Life‹ zur Folge hätte.
Lassen Sie mich daher, zumindest vorerst noch, lieber abschweifen und von meiner Vergangenheit erzählen.
Meine drei Jahre mit Nancy waren die Hölle. Allerdings war ich damals zu unerfahren, um das voll zu begreifen, und zu jung, um daran Schaden zu nehmen. Wir ›gingen zusammen‹, ein oder zwei Jahre lang auf dem College, und in allen Ehren, wie das damals, Anfang der fünfziger Jahre, bei uns üblich war. Das Äußerste an Leidenschaft, zu dem wir uns verbotenerweise hinreißen ließen, waren die intensiven Fingerspiele auf dem Rücksitz eines geliehenen Wagens.
Und da sich diese Form der Intimität irgendwann erschöpft, heirateten wir als ›Graduates‹ am Tag nach dem Abschlussexamen.
Ein überaus wichtiger Grund für mich, ausgerechnet Nancy zu heiraten, war der, dass meine Mutter sie hasste. Die beiden waren sich einfach zu ähnlich, hatten beide den gleichen miesen, herrschsüchtigen Charakter. Und meine Opposition gegen diese ständige und frustrierende, mütterliche Bevormundung erschöpfte sich nun in dieser schwachsinnigen Trotz-Ehe, die keinerlei Zukunft hatte.
»Na, alter Junge«, sagte mein Vater in dem gleichen herablassenden Tonfall, in dem auch Bob Rendall das heute noch tut, »na, alter Junge, ich hoffe, du weißt, was du tust!«
Ich wusste es nicht. Woher auch?!
Nancy war eines dieser ›dominierenden Weiber‹, die damals wie heute unsere amerikanische Gesellschaft beherrschten. Bis zu meinem Eintritt in die Universität war ich ausschließlich auf jene Spezies gestoßen, die in unserer ach so freien Welt‹ das alleinige Sagen zu haben schien.
Als mich meine Mutter in den Kindergarten abschob, kam ich vom Regen in die Traufe. Auf der Public- School war es nicht besser. Und auch später, auf der High-School und am College, wurde ich ausschließlich von Frauen unterrichtet. Sie standen alle samt und sonders ihren ›Mann‹. Und die eigentlichen Männer jobbten irgendwo schweigend vor sich hin, schafften das nötige Kleingeld herbei, starben heldenhaft in Korea oder durch Herzinfarkt an der Wirtschaftsfront, hinterließen großzügige Lebensversicherungs-Policen und fehlten daher eigentlich keinem. Und wir, die Überlebenden, die unter dem Daumen dieser Mütter heranwuchsen und unsere Persönlichkeit entwickeln wollten, wir litten ohne zu leiden! Keiner von uns fühlte sich unterdrückt! Weil wir es einfach nicht anders kannten. So waren sie eben, die Sitten und die Zeiten. In diesem unserem Land. Wir hatten uns mit dieser Form des Daseins abgefunden. Eine andere kannten wir nicht.
Daher überraschte es mich einigermaßen, als ich auf der Universität, und zwar schon im ersten Semester, Männern begegnete, die es wagten, offen und ehrlich ihre Meinung zu sagen, ohne dafür von den Weibern gesteinigt zu werden. Männer, denen es offiziell gestattet war, ihr Wissen an die nächste Generation weiterzugeben. Männer, die den ganzen Laden leiten und organisieren durften! Und die bereit waren, Verantwortung zu übernehmen.
Dieses nachhaltige Erlebnis war der Anfang vom Ende meiner Ehe mit Nancy. Ich begann, ihr zu widersprechen. Erst unsicher und zögernd, schließlich, zu Testzwecken, auch aus Prinzip.
Nancy war fassungslos! Irgendwann drehte sie durch. Wir prügelten uns ein ganzes langes Wochenende.
Anschließend rannte Nancy heulend zu meiner Mama und verstand die Welt nicht mehr.
Ich floh nach Berkeley ins zweite Semester und schwor reumütig, diesen Fehler nicht zu wiederholen. Denn so viel Kraft, einen Kampf gegen die Rachegöttinnen der amerikanischen Mütter-Welt zu führen und sieghaft zu bestehen, so viel Kraft und so viel Mut hat hierzulande kein einziger Mann!
Das Leben mit Kim-Lan verläuft dagegen in paradiesischer Harmonie. Dabei hat sie durchaus ihre eigene Meinung. Sie benutzt ihren wachen Verstand, um den Dingen auf den Grund zu gehen, aber nicht, um einen Partner fertigzumachen und an die Wand zu drängen. Sie informiert sich gründlich und vertritt dann ihren Standpunkt, ohne den meinen aus Prinzip in Frage zu stellen, und es hat den Anschein, dass wir uns beide bei diesen Diskussionen intellektuell durchaus weiterentwickeln.
Kim-Lan verblüffte mich immer wieder mit ebenso originellen wie eigenwilligen Gedanken, die ebenso überraschend neu wie kreativ waren, und das bestätigt in gewisser Weise meinen absurden Verdacht. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf eine Arbeit von Bob Rendall, abgefasst in seinen Jahren auf der Stanford University, über ›Sich selbst programmierende Intelligenz bei Feedback-Schaltungen von Analog-Rechnern‹. Wenn Sie meine vorsichtige Andeutung richtig verstehen, werden Sie jetzt wissen, was ich damit meine. Wobei ich einräumen muss, dass Kim-Lans Intellekt nur einen Teilaspekt des Gesamtphänomens darstellt.
Ein weiterer, sehr wichtiger Faktor ist ihre ebenso raffinierte wie kunstvolle Art zu kochen. Die vietnamesische Küche ist dreitausend Jahre älter als die angelsächsische. Diesen Vorsprung einzuholen, ist sicher unmöglich, besteht doch die Mehrzahl meiner Landsleute immer noch, wie eh und je, aus heimlichen und verkappten Puritanern!
Für diese Leute ist Lust einfach Sünde. Sie fühlen sich schuldig, wenn der Geschmacksnerv sie kitzelt. Man isst, um hinterher wieder in der Lage zu sein, gottgefällige Werke zu tun, zum Beispiel, das Kapital anderer Leute zu mehren. Oder – im Glücksfall – das eigene!
Daher sind unsere Hamburger ebenso ungewürzt wie die angekohlten Steaks. Und die Getränke, inklusive altem Cognac oder Beaujolais, werden tiefgekühlt serviert oder gar ›on the rocks‹! Es könnte sich ja ein lusterzeugendes Bouquet entwickeln.
Von Bob Rendall wusste ich, dass er diesbezüglich aus der nationalen Art geschlagen war. Er hatte sich in Asien zum Feinschmecker entwickelt. Für ihn war die Zubereitung von Speisen ein Teil der Kultur. Und dass er mir zusammen mit der schönen Tochter seine Sammlung vietnamesischer Kochbücher quasi als Mitgift in die Ehe gab, rechne ich ihm wirklich hoch an. Nun habe ich die perfekte Hexenköchin im Haus!
Wenn ich in diesem Zusammenhang an Patricia denke, kommen mir fast die Tränen. Ich war damals Chef-Systemanalytiker in einer Filiale von Rockwell International in Denver, Colorado. Wir arbeiteten hart – zehn, zwölf Stunden täglich – an den Navigationsautomaten für Interkontinentalraketen.
Wenn ich dann erschöpft nach Hause kam, fand ich Patricia träge hingegossen auf einer Couch in ihrer Ganztages-Uniform: rosa Pantöffelchen, rosa Morgenmantel über rosa Nachthemd, ein rosa Chiffontuch über riesigen rosa Lockenwicklern, eine Zigarettenspitze in der blassrosa Hand, und sie sah sich nicht einmal nach mir um.
Die Stereoanlage dröhnte mit 120 Phon immerzu die gleichen abgedroschenen Hits der Woche. Das Haus war unaufgeräumt und verqualmt. Mein Frühstücksgeschirr – ich hatte, wie üblich, alles selbst zubereitet, denn Patricia ruhte bis gegen zwölf – stand noch irgendwo herum und war angefüllt mit Patricias Zigarettenstummeln. Rings um sich her hatte sie Modezeitungen aufgetürmt, denen es aber leider Gottes nicht gelang, Patricia zu einem akzeptablen Äußeren zu inspirieren.
Ihr Blick, sofern er jemals von den Magazinen abirrte und mich dann wie zufällig traf, war stets ein einziger, stummer Vorwurf, noch nicht die Karriere gemacht zu haben, die sie sich für mich erträumte. Dabei interessierte sie sich nicht im Geringsten für das, was ich tagsüber tat.
Auf meine schüchterne Frage, ob sich irgendwo im Haus etwas zum Essen fände, denn der Kühlschrank war todsicher leer, entgegnete sie sanft, es sei ja wohl anzunehmen, dass ich um diese Zeit bereits gegessen hätte. So blieb mir meist nichts außer Erdnüssen, einem dreistöckigen Scotch und einer chronischen Gastritis. Auch sonst war Patricia zu nichts zu gebrauchen – außer zu Bridge. An Wochenenden war es das Klügste für mich, das Haus ihren Bridge-Freundinnen zu überlassen. So mähte ich also im Sommer regelmäßig und stundenlang unseren kleinen Rasen. Nur die Winterwochenenden waren manchmal verdammt lang und hart.
Ganz anders Cynthia, die sich ›Cindy‹ nannte. Sie war ein wahres Wunder an Aktivität. Ein Energiebündel ohnegleichen! Sie wirbelte durch das Haus, das ich auch heute noch bewohne, und hielt sämtliche Staubflocken permanent in Bewegung.
Die Ordnung, in die sie unseren Traum vom schönen Wohnen presste, war ihr heilig. Ein Buch aus dem Regal zu nehmen war bereits ein Sakrileg. Und damit die Küche nicht in einem Anflug von Chaos versank, gingen wir regelmäßig zum Essen. In Tegtmeyer's Steakhouse, natürlich. Es ist, wie Sie sicher bereits erraten haben, das einzige akzeptable Haus hier am Ort, das mehr als Pizza, Kentucky Fried-Chicken oder Hamburger offeriert.
Aber reden wird nicht immer vom Essen: Auch im Bett war Cindy eine Riesen-Niete. Es machte ihr einfach keinen rechten Spaß. Stattdessen liebte sie das Spiel mit den sechzehn Fernsehkanälen. Mit einer automatischen Fernbedienung schaffte sie das gesamte Programmangebot des Abends, erhaschte von jeder Sendung einen Happen und war doch in steter Sorge, etwas versäumt zu haben. Nach Null Uhr dreißig, dem Ende der täglichen ›Soap-operas‹ und Serien, natürlich zu müde, hatte sie Migräne, keine Verdauung, oder bis zu sechzehn Mal im Monat ihre Tage. Ihr Psychotherapeut empfahl ihr schließlich absolute sexuelle Abstinenz – während ich mich gerade um einen Termin bei ihm bemühte. Ich zweifelte nämlich bereits an meiner Potenz.
So vergingen die besten Jahre unseres Lebens. Und wenn Cindy nicht zufällig in die segnenden Hände eines indischen Heiligen gefallen wäre, wer weiß, vielleicht würde sie hier immer noch für Ordnung sorgen, und ich wäre tatsächlich auf der Couch gelandet.
Der Rechtsanwalt Seiner Göttlichkeit vertrat Cindy persönlich im Scheidungsprozess, vermutlich war die Sekte am Erfolg beteiligt. Ich aber war ruiniert. Sie schaffte ein letztes Mal Ordnung, kassierte die halbe Million, die ich eigentlich gar nicht hatte, und zog davon, ohne ›Bye-bye‹ und ohne ein einziges Danke.
Das viele Geld, genauer gesagt, die vielen Schulden, habe ich schnell verschmerzt, als Kim-Lan zu mir in dieses Haus gezogen war. Es gab plötzlich wichtigeres: ein ausgefülltes, sattes, glückliches, sinnenfrohes Leben zu zweit! Ein Leben voller Freude. Mit einer Gefährtin, wie sie uns in den Tagen des Paradieses einstmals verheißen wurde. Mit einer zärtlichen und liebevollen Frau.
Und wenn ich jetzt, an dieser Stelle bereits, meinen bösen Verdacht äußern würde, wäre das wirklich voreilig und infam. Sie hätten aus gutem Grund das Recht, an meinem Verstand zu zweifeln. Aber andererseits müssen Sie auch verstehen, dass mich gewisse Indizien über alle Maßen zu irritieren beginnen. Diese Art von Vollkommenheit, von perfektem Glück, von idealer Partnerschaft, ist absolut unwahrscheinlich. Sie ist im Schöpfungsplan einfach nicht vorgesehen. Hier hat ein Mann sich einen Traum erfüllt! Und damit komme ich nun zur Sache.
Mein Schwiegervater hatte mir abgeraten. Es klang sogar wie eine ernste Warnung! Aber als ich Kim-Lan eröffnete, dass wir auf unserer längst überfälligen Hochzeitsreise nun endlich nach Florida fliegen würden, klatschte sie in die Hände und lief jubelnd wie ein Kind durch das Haus. Während hier oben im Norden noch die heftigsten Schneestürme tobten, blühten dort unten bereits Mandelbäume und Magnolien. Das Meer hatte eine angenehm erfrischende Temperatur. Ein azurblauer Himmel wölbte sich über der Skyline von Hotel-Palästen und Apartmentburgen und über einem schneeweißen, teerverseuchten, übervölkerten Strand.
Kim-Lan genoss die Wärme und die Sonne und das Aufsehen, das sie erregte, in vollen Zügen. Denn der olivgetönte Bronzeteint ihrer zarten Haut wurde von Tag zu Tag schöner.
Wir fuhren über Land, durchstreiften die Everglades-Sümpfe auf einer Alligator-Foto-Safari, besichtigten Flipper und seine Gespielen im Seeaquarium von Miami, fuhren hinunter zum südlichsten und heitersten Ende der USA, nach Key West, und hatten eine glückliche Zeit.
Natürlich lagen auch die relativ friedlichen Raketen-Abschussbasen von Cape Canaveral auf unserem Weg und schließlich Disney-World, die Heimat der Mickey-Mouse.
Es war der heitere Auftakt zu einem Vorfall, der mir eine Entscheidung abverlangte: Wir schoben uns durch das dichte Gedränge zigtausend kinderreicher Familien von Attraktion zu Attraktion, tauchten mit Kapitän Nemo 20.000 Meilen unter den Meeresspiegel, besuchten Cinderellas Schloss und das verwunschene Haus mit seinen 999 Gespenstern, vorbei an wild trompetenden Elefanten, an zischenden Kobras und hungrigen Tigern. Piraten kämpften in Höhlen um kostbare Schätze, tausend Puppen sangen ein niemals endendes Lied und Grizzlybären spielten Banjo und tanzten dazu tollpatschig im Kreis.
Es war die Welt der liebenswerten Automaten und der kindlichen Phantasie, die in uns allen steckt. Und mitten darin begegneten wir jetzt einer zweiten Kim-Lan!
Es war im ›Karussell des Fortschritts‹, eine Werbeveranstaltung der Firma ›General Electric‹: Lebensechte Figuren, die von Menschen aus Fleisch und Blut kaum zu unterscheiden waren, stellten in sprechenden Bildern, in typischen, heiteren, charakteristischen Szenen, den nicht zu übersehenden Anstieg der Lebensqualität im Alltag einer amerikanischen Durchschnittsfamilie in den vergangenen einhundert Jahren dar, soweit dieser den genialen ›General-Electric-Haushaltsmaschinen‹ zu verdanken war. Im letzten Bild servierte ein asiatisches Au-pair-Mädchen seinen Gastgebern artig den Kaffee aus einer neuartigen Kaffeemaschine dieser Firma. Sie trug ein enges, hochgeschlitztes, türkisfarbenes Kleid aus schimmernder Thai-Seide, blickte mit großen, dunklen Mandelaugen ins Publikum, strich mit graziler Anmut ihr hüftlanges, lackschwarzes Haar zur Seite und sprach schließlich zwei, drei Sätze in jenem mir so vertrauten, melodisch gutturalen Ton.
Ich war sprachlos. Dieses Duplikat von Kim-Lan raubte mir für Sekunden den Verstand. Es schien, als hätte ich hier endlich das Ende des Knotens meiner Zweifel erwischt. Nur Kim-Lan selbst schien nichts zu bemerken.
Dreimal stellten wir uns noch in die Schlange der Wartenden vor den Eingang. Dreimal schwebten wir im Karussell langsam an den lebenden Bildern vorbei. Dreimal noch bewegte sich dieses Double von Kim-Lan auf der Bühne in ihren stereotypen, grazilen Bewegungen und sprach noch dreimal die gleichen drei Sätze. »Du bist nicht erstaunt, Kim-Lan?« wollte ich wissen.
»Worüber?« Sie schaute mich amüsiert und fragend an.
»Das asiatische Mädchen dort auf der Bühne! Es sieht aus wie du, spricht wie du, bewegt sich wie du …« Kim-Lan zuckte die Schultern. »Es ist eine Puppe!«
»Ich weiß das, Kim-Lan. Natürlich ist es eine Puppe. Aber sie ist dir so verblüffend ähnlich …!«
»Alle vietnamesischen Mädchen sehen so aus!«
Der Fall war für sie erledigt. Für mich allerdings noch lange nicht! Ich befragte einen Uniformierten am Eingang. Der schickte uns weiter zu einem Techniker-Team hinter der Bühne. Schließlich landeten wir in einem riesigen Keller. Dort standen diese lebensechten Puppen zuhauf. Menschen und Tiere stumm und mit offenen, starren Augen. Es war unheimlich und grotesk. Sie wurden repariert, geölt, getestet und neu eingekleidet.
Eine Art ›Puppenwärter‹, ein junger Mann im weißen Mantel, mit randloser Brille und Ingenieurdiplom, war mir behilflich.
»Alles uralte Modelle, schon fünf Jahre oder noch länger im Einsatz. Aber sie funktionieren noch einwandfrei.« Er begann sie liebevoll vorzuführen, ließ sie sprechen, die Augen bewegen, lachen und weinen. Es war eine makabre Demonstration. Und das alles in Gegenwart von Kim-Lan. »Leider hängen sie an endlosen Kabelsträngen«, beschwerte er sich. »Drahtlos, das wäre die Lösung. Der Computer eingebaut und mit einer Dauerbatterie bestückt wie bei einem Herzschrittmacher.« Fünf Jahre bereits im Einsatz. Fünf Jahre! Das Karussell unseres Fortschritts hat sich seither unaufhörlich weiter gedreht. Vielleicht gibt es sie längst schon – die Erfüllung des geheimen Puppenwärtertraums. Aber wo kamen sie her, diese Kunstwerke, die uns so listig täuschten, bis wir Schein und Wirklichkeit nicht mehr zu unterscheiden wussten?
Der Puppenwärter blätterte in den Betriebs- und Reparaturanleitungen, suchte nach Stempeln und Firmenzeichen. »Die kamen damals alle aus Bay City, Michigan, wenn ich mich recht erinnere. Das war eine Firma, die auch Industrieroboter baut.« Und schließlich fand er auch, was er suchte: »Hier!« Er deutete mit dem Finger auf das mir wohlbekannte Signet: »Bob Rendall Factory Inc.«
Begreifen Sie jetzt, was ich meine? Können Sie jetzt den Verdacht, den ich seit Monaten in mir hege, nachvollziehen? Bei der Geschwindigkeit des Fortschritts ist ein halbes Jahrzehnt eine verdammt lange Zeit. Und warum hatte Bob Rendall mir nie von diesem höchst absonderlichen Zweig seines Geschäfts erzählt? Produzierte er weiter? Was hatte er vor? War er vielleicht bereits im Begriff, den ganz großen Coup zu landen? Einen Coup, der die Welt verändern könnte?
Kein Wort sprach ich zu Kim-Lan von meinen Ahnungen und Zweifeln. Sie lief lachend und ausgelassen an meiner Seite durch die Gegend und freute sich über Walt Disneys Zauberwelt.
Wir rasten auf Westernloks durch einstürzende Tunnel, flogen zum Mars und fuhren den Mississippi hinunter. Singende Mäuse begegneten uns, sprechende Walfische und lachende Löwen. Es war eine heitere Kunstwelt, harmlos und gefällig, und sie machte die Menschen glücklich. Denn die Roboter und Puppen waren ganz auf den Geschmack und die Erwartungen der Konsumenten hin konstruiert. Und ihren realen Vorbildern hatten sie eines voraus: sie waren ungefährlich und einfach um Klassen besser!
Hoch über dem Rummel schwebten wir in einer Gondel durch die anbrechende Nacht. Neben mir saß Kim-Lan, dieses Zaubergeschöpf, und fasste glücklich nach meiner Hand. Was für eine Frau! Das Ende aller Nancys, Patricias und Cynthias war nah.
Wenn Bob Rendall seine Traumwesen zu Zigtausenden auf den Markt werfen würde, wäre das Amerikas zweite Revolution! Und für uns amerikanische Männer das Ende einer zweihundertjährigen Unterdrückung! Und ich – ausgerechnet ich! – war auserwählt, dieses Wunderwerk als Erster zu testen!
Als unsere Vorväter dieses Land eroberten und besiedelten, waren Frauen rar und kostbar. Sie haben sich, obwohl inzwischen im Überfluss verfügbar, bis heute diesen Status erhalten. Okay, bis heute! Aber ab morgen wird die ›Bob Rendall Factory Inc.‹ in Bay City, Michigan, das ändern. Und diese Nation wird endlich sein, was sie seit über zweihundert Jahren erträumt und was uns die Verfassung ausdrücklich versprochen hat: ein Land des Glücks!
Wir wohnten drüben im polynesischen Dorf. Von der Lichterwelt des ›Magischen Königreichs‹ trennte uns der Spiegel eines Sees. Wir standen nackt am offenen Fenster und schwiegen. Der laue Nachtwind trug ein dumpfes Brodeln herüber: zehntausend Stimmen entzückter Besucher und aus einem Heer von Lautsprechern einen Cocktail aus Musik. Dann stieg knatternd ein gigantisches Feuerwerk in den nächtlichen Himmel und tauchte die Landschaft in purpurnes Licht.
Kim-Lan lehnte sich an mich, und ich nahm sie in meine Arme. Ich spürte die Wärme ihres Körpers und die Geschmeidigkeit ihrer Haut. Verdammt noch mal, das musste man Bob Rendall lassen: Was immer er machte, er machte es perfekt. Nichts an ihr, aber auch nichts bestätigte meinen Verdacht. Ich hob sie hoch, trug sie hinüber zu dem superbreiten Kingsize-Bett, und wir liebten uns leidenschaftlich für den Rest dieser langen Nacht.
Kim-Lan, mein Zauberwesen, meine nächtliche Orchidee, ich liebe dich! Ich liebe dich, wenn du dich zärtlich an mich schmiegst und ich den seltsam fremden Geruch deines Haares, deiner Haut, den erregenden Duft deines Schoßes in mich aufsauge wie ein Geheimnis. Ich will die chemischen Formeln dieser Aerosole gar nicht wissen.
Ich liebe deine spitzen Schreie, dein wollüstiges Gurren bei unserer Umarmung, auch wenn das alles nur das Produkt eines ausgeklügelten Programms raffinierter Schaltkreise und meiner eigenen Chips sein sollte. Mich fasziniert die samtene Weichheit deiner Haut, die Straffheit deiner Brüste, gleichgültig, welches synthetische Material auch immer dazu verwendet worden ist.
Deine Stimme betört mich, was du auch sagst, ob du lachst oder singst, wie auch immer diese sanft schwingenden Modulationen und Töne entstehen.
Mich interessiert es nicht, wie du funktionierst. Denn ich liebe dich so wie du bist. Du hast mein Leben verzaubert, wirst ewig jung bleiben und schön, während ich langsam verfalle. Aber ich werde dir treu bleiben, werde dich immer lieben und ehren, wie ich es gelobte. Bis dass mein Tod uns scheidet!
DIE FLASCHENPOST
Es geschah in jener Zeit, als es noch Muscheln gab am Strand. Als sich nach einem Sturm Treibholz und Algen am Flutsaum häuften und nicht nur Plastikfetzen und Öl. Da wanderte Rüdiger Kienholz, Junglehrer aus Emden, über das weitausladende Westkap der Nordsee-Insel Juist und ließ sich den Herbstwind um die Nase wehen. Es war Reformationstag. Der einunddreißigste Oktober also. Ein grauer Tag mit tiefhängenden Wolken. Und von draußen her, über das schwarzgrüne Wasser mit den weißgischtigen Wellenkämmen, zog ein Regenschauer wie ein grauer Vorhang gegen das Land und verhüllte den Horizont. Rüdiger Kienholz fröstelte. Er hatte den Kragen seines Jacketts hochgeschlagen und hielt in seinen Händen, die vor Kälte klamm und fast abgestorben waren, unzählige, hübsche Exemplare von ›mactra solida‹ und ›elliptica‹ sowie ›litoris litoralis‹, eine kleine Seeschneckenart der Uferzone, die in verschiedenen zarten Pastelltönen zu finden war. Er hatte beschlossen, seine Schüler an einem der nächsten Tage Muscheln zeichnen zu lassen, um sie dann schrittweise in die Technik der Aquarellmalerei einzuführen. Denn Rüdiger Kienholz unterrichtete seit zweieinhalb Monaten Zeichnen, neben Deutsch und Geschichte. Hin und wieder hockte er sich hin, durchwühlte den angeschwemmten Tang nach noch schöneren, größeren, bunteren Muscheln, sah, wie seine Fußspuren rasch verwehten und der Sand wie ein Schleier über den Boden trieb, bis hinüber zum Watt. Mit der Zunge fuhr er sich über die Lippen, die salzig schmeckten. Und hatte schließlich keine Hand mehr frei, sich die Augen zu wischen.
Da sah er die Flasche. Sie war grün und weißkalkig verkrustet. Winzige Muscheln hatten sich daran festgesetzt, und die Gänge und Röhren der Würmer bedeckten sie mit einem dichten Netz sich überschneidender, seltsamer Muster. Ausgebleichter Fadentang hatte das Ganze schließlich filzig eingesponnen und hing daran wie eine Schleppe.
Die Flasche war säuberlich verkorkt und offensichtlich leer. So hatte die Flut sie weit landeinwärts gespült. Rüdiger hob sie aus ihrer Sandverwehung, entfernte den brüchigen, weißen Bart der Algen, betastete das verkrustete Glas mit seinen klammen Fingern und betrachtete die eigenartig verwundene, bauchige Form, die in einem dicken, stumpfen Hals endete, und die skurrilen, phantastischen Zeichnungen und Ornamente der Kruste mit den Augen des Künstlers.
Hübsche Flasche, dachte er. Sie würde sich gut machen auf seinem Bücherregal, zwischen Muscheln und bizarr zugeschliffenen Treibholzstücken, die er dort von früheren Inselbesuchen her verwahrte. Er ließ also die aufgesammelte ›litoris litoralis‹, die ›mactra solida‹ und ›elliptica‹ in die Taschen seines Jacketts gleiten, die dadurch feucht und sandig wurden, und machte sich, die Flasche in der Hand, auf den Heimweg.
In diesem Jahr hatten die zwei kirchlichen Feiertage der beiden Konfessionen das davorliegende Wochenende angenehm verlängert.
Daher war Rüdiger vom Festland herübergekommen und wohnte nun bei seinem Onkel, dem Insel-Pastor Schmoll, draußen im Loog, im einzigen strohgedeckten Haus, das im einsamen Westteil der Insel zu finden war. Pastor Schmoll war pensioniert und daher verlief der Reformationstag für ihn und seinen Gast entsprechend ruhig und ohne nennenswerte Verpflichtungen. Er erwartete seinen Neffen bereits ungeduldig an der offenen Tür, denn die Regenfront hatte inzwischen die Insel erreicht und Rüdiger Kienholz durchnässt.
»Hübsche Flasche«, sagte auch der Pastor. »Aber du musst alles abkratzen und sie ordentlich schrubben, mit Sand. Denn wenn die Algen trocknen und die winzigen Muscheln und Würmer sterben, dann fängt das Ganze gottserbärmlich an zu stinken und vertreibt uns beide aus dem Haus.«
Das klang vernünftig. Aber eine gestrandete Flasche, blankpoliert und ohne ihre Muschelkruste, die war als Beute nicht mehr viel wert.
Rüdiger roch an seinem Fund, und was ihm draußen am Strand noch als der würzige Duft der weiten, unendlichen See erschienen war, Tang, Algen und Salz, entpuppte sich im Inneren des Hauses nun tatsächlich als der süßliche Geruch beginnender Fäulnis. Ein Hauch von Tod und Verwesung umgab die Flasche.
So legte er sie also draußen vor dem Haus ins schüttere Gras zwischen Ginsterbusch und wilden Sanddorn. Und dort hätte er sie fast vergessen, als ihn das Fuhrwerk von Nachbar Bröseke am nächsten Nachmittag abholte, um ihn zum Inselbahnhof zu bringen. Es gab tatsächlich eine Eisenbahn auf dieser Insel. Denn der Anleger der Fähre, mit der Rüdiger zum Festland zurückreisen musste, lag weit draußen im Watt und der Fahrplan richtete sich nach der Tide.
»Deine Flasche!« Pastor Schmoll erschien am Zaun, als die Pferde gerade antraben wollten. »Ich will so Kram nicht im Garten herumliegen haben.« Er wickelte sie sorgfältig in eine alte Zeitung. »Alle sammeln sie Strandgut, Muscheln und Treibholz, die Sommergäste und ihre Kinder. Und wenn's ans Heimreisen geht, bleibt der verdammte Schitt bei mir hinterm Haus. Und da liegt er dann den ganzen Winter über.«
Pastor Schmoll war ein streitbarer Mann. Selbst jetzt noch, nach seiner Pensionierung. Und was er meinte, sagte er immer deutlich und laut.
So reiste Rüdiger mit seiner eingepackten, diskret vor sich hin stinkenden Flasche, zuerst mit der Kutsche, dann mit der Bahn, der Fähre und dem Bus, zurück in die kleine Stadt an der Ems mit ihrem großen Hafen. Dort unterrichtete er die Kinder im Zeichnen von Muscheln, von Eisblumen und von Schneekristallen. Denn es war Winter geworden.
Die Flasche war in einem Blumenkasten gelandet. Lag dort versteckt zwischen den Stängeln abgestorbener Primeln vor einem Fenster im ersten Stock eines Hauses, das einer gewissen Witwe Ellguth gehörte, die an Studenten und Junglehrer ihre Dachzimmer vermietete.
Da lag sie also, die Flasche, im Regen, der stetig und ständig zu fallen schien, im Schnee, der seltener war und grau. Sie lag im matten Glanz einer müden, gelben Wintersonne. Im Frost und im Nebel. Und als es Frühling geworden war und neben den abgestorbenen Stängeln der Primeln das Unkraut zu sprießen begann, da war Rüdiger der Meinung, nun sei es genug, und die Flasche hätte ihren penetranten Geruch nach Verwesung und Fäulnis sicher endgültig verloren. Aber dem war nicht so.
Da begann Rüdiger eines Abends, mit einem derben Küchenmesser, die Muscheln und Krusten vorsichtig zu entfernen.
Das Licht der Tischlampe fiel durch das dicke, matte Glas, und Rüdiger drehte die Flasche hin und her und spähte hinein in das so unheimlich schimmernde, grüne Dunkel. Eine gewaltige Höhle aus Eis hatte sich vor ihm aufgetan, sog ihn in sich hinein in ihre weite und leere Unendlichkeit, in der er sich zu verlieren drohte. Da schob sich, ganz plötzlich und überraschend, eine grauweiße Wand zwischen ihn und die grüne Unendlichkeit, flatterte wie aus dem Nichts auf ihn und riss ihn aus seinen phantastischen Träumen: Die Flasche enthielt ein Geheimnis. Und nun gab sie es preis!
Da sprang Rüdiger Kienholz auf, lief hinunter in die Küche der Witwe Ellguth, holte sich einen Korkenzieher aus der Schublade und machte sich eilig daran, das Geheimnis zu ergründen.
»Mein Geliebter!
Nur noch wenige Minuten trennen mich vom sicheren Tod. Die Felsen des Riffs, auf das unsere ›Patricia‹ geschmettert wurde, und die haushohen Brecher, die über uns zusammenschlagen, lassen die Planken bersten. Das Wasser füllt schon knietief die kleine Kajüte, in die ich eingeschlossen bin. Denn das Schiff liegt schräg, die Tür ist nicht mehr zu öffnen. Ich bin zu schwach dazu, klammere mich an die Platte eines Tisches, der mit der Bordwand verschraubt ist. Die Lampe über mir schwankt. Und ich schreibe Dir ein letztes Lebewohl!
Mein Vater ist zu den Männern hinauf an Deck gegangen. Vor einer Stunde schon. Nach dem Tod von Kapitän Sterlink wollten sie retten, was noch zu retten ist. Aber ihre Rufe sind längst verstummt. Ich höre nur noch das Brausen des Sturms und das Donnern der Brecher gegen den Rumpf unseres Schiffes und das Bersten von Holz. Und ich bin allein. So warte ich auf den Untergang. Aber das kann nicht das Ende sein. Denn ich hoffe, ja, ich weiß, dass diese meine Zeilen Dich erreichen werden. Irgendwann einmal, irgendwo. Und dann wirst Du wissen, dass ich Dich liebe! Dass ich Dich stets geliebt habe und immer lieben werde! Immerdar und über den Tod hinaus!
Ich weiß auch, dass der Tag kommt, wo uns nichts mehr trennt. Für immer Dein! Annamaria.«
Da saß er nun, der Junglehrer Rüdiger Kienholz, in seiner Kammer im Obergeschoß des Hauses der Witwe Ellguth zu Emden, in dieser kleinen Stadt mit ihrem großen Hafen. Und er hielt plötzlich ein Stück Schicksal in seinen Händen. Der Hauch einer Tragödie wehte ihn an. Es war ihm, als hörte er den Sturm toben und die Planken brechen. Und in diesem Inferno spürte er deutlich die unendliche Kraft einer Liebenden, im Angesicht des Todes. Und das erschütterte ihn zutiefst.
Eine Stunde saß er da. Vielleicht auch länger. Unbeweglich, wie gelähmt. Und er starrte auf diese allerletzten Zeilen, die ein Mensch sich abgerungen hatte, bevor er ausgelöscht wurde. Sein Innerstes war erfüllt von diesem erschreckenden Erlebnis, als würde er es selbst am eigenen Leibe erfahren. Und seine Gedanken kreisten um ein schier unlösbares Rätsel:
Ein Brief. Ein Liebesbrief. An wen war er gerichtet? Da war keine Anrede, kein Name, nur dieses ›Mein Geliebter‹. Und dann diese naive, geradezu unfassbare Gewissheit, dass dieser geliebte Mensch diesen Brief eines Tages in Händen halten würde – so, wie er ihn jetzt in Händen hielt.
Ein Schiff war gestrandet und zerschellt. Wann? Und wo? War aufgelaufen auf ein Riff und geborsten im Sturm. Aber da war kein Datum erwähnt und kein Ort. Nur der Name des Schiffes: Patricia.
Der Vater war vermutlich von einem der Brecher von Deck gerissen worden. Mitsamt der restlichen Besatzung. Ein Kapitän Sterlink, der es wert war, in dieser letzten Nachricht noch erwähnt zu werden, war allem Anschein nach schon vorher zu Tode gekommen. Jetzt war wohl keine lebende Seele mehr an Bord. Außer diesem Mädchen Annamaria.
Einen Augenblick lang dachte Rüdiger an einen makabren Scherz, eine skurrile Erfindung. Aber da war diese Schrift. Kindlich noch und zierlich und doch kräftig und mutig zugleich. Schwarze Tinte auf vergilbtem, hartem Papier. Ein paar verwischte Spuren, Wasserflecke. Ansonsten war Buchstabe ordentlich neben Buchstabe gesetzt. Ohne ein Zeichen von Hast oder Panik:
›Annamaria‹
›Mein Geliebter!‹
›Für immer Dein!‹
Ein Mädchen stirbt. Eingesperrt in eine winzige Schiffskajüte. Das Wasser steigt und steigt, und Brecher donnern gegen die Bordwand, die langsam zerbirst. Planke um Planke. Und sie verliert nicht ihren Mut, nicht ihre Zuversicht. Sie beklagt nicht ihr Schicksal. Ruft nicht Gott an, sondern ihren Geliebten. Der – und ihre grenzenlose Liebe – geben ihr die Kraft, das Verhängnis, dem sie nicht entrinnen kann, anzunehmen. Und der einzige Zeuge dieser Katastrophe, der war nun er, der Junglehrer Rüdiger Kienholz. Er fühlte sich mit einem Mal unendlich hilflos und mutlos. Er spürte in sich den Drang, in das Geschehen einzugreifen, irgendetwas Sinnvolles zu tun, um das Unheil abzuwenden. Aber da war nichts zu tun, nichts mehr zu helfen, nichts mehr abzuwenden. Und diese Untätigkeit, zu der er verdammt war, machte ihm schwer zu schaffen.
Der Name des Mädchens ging ihm nicht mehr aus dem Kopf: ›Annamaria‹! Und fünf weitere Worte dieses Briefes, die ihn am meisten berührten. Die er deutlich vor sich sah, in dieser zierlichen, kräftigen Schrift, den restlichen Abend und die ganze Nacht. Auch wenn er die Augen schloss. Und die er immerzu hörte, wie von einer inneren Stimme gesprochen, den ganzen nächsten Tag und die folgenden Wochen. Wie eine Beschwörung: »Mein Geliebter … Für immer Dein!«
Es gab nicht den geringsten Grund für den Junglehrer Rüdiger Kienholz aus Emden, nicht den geringsten Hinweis anzunehmen, dass dieser Abschiedsbrief wirklich an ihn gerichtet war. Aber irgendeine unergründliche Fügung hatte gerade ihn und keinen anderen auserwählt, an einem trüben, grauen, regnerischen Reformationstag am abgelegensten, einsamsten Strand einer Insel diese letzte Botschaft zu finden. Irgendeine Art seltsamer Verkettung oder auch Vorsehung hatte just ihn und keinen anderen zu der Flasche geführt. Und dann hatte er viele Monate ahnungslos vergeudet. Einen ganzen, langen Winter hatte er das tragische Schicksal, das dieser Fund in sich barg, achtlos ignoriert.
Und wieder verstrich nun die Zeit, und Rüdiger Kienholz blieb mit seinem Wissen um eine Tragödie, fürs erste, allein. Er schwieg. Keinem Menschen vertraute er sich an, denn er wusste nicht, was zu tun sei. Er unterrichtete weiter, als sei nichts geschehen. Ließ Muscheln zeichnen und Frühlingsblumen. Und Abend für Abend zog er sich zurück, in die Kammer im Obergeschoß des Hauses der Witwe Ellguth, und las dort ›seinen Brief‹. Er las ihn immer wieder. Bis er aufhörte zu grübeln, an wen er gerichtet sein könnte. Bis er schließlich überzeugt war, dass er dieser Adressat, dieser ›Geliebte‹ sei. Er und kein anderer. Und diese ›Annamaria‹ – seine Geliebte.
Ostern war ein Traum. Ein zartblauer Himmel spannte sich von Horizont zu Horizont, und ein frischer, kühler Seewind trieb weiße Schäfchenwolken über die blankgeputzte Frühlingslandschaft der Küste. Rüdiger Kienholz hatte das Nötigste zusammengepackt, wozu diesmal auch der Brief und die Flasche gehörten und war zu Pastor Schmoll auf die Insel gereist. Mit Bus und Fähre, Eisenbahn und Kutsche, wie die vielen Male in all den Jahren auch. Nichts schien sich verändert zu haben. Nur er war innerlich ein anderer geworden. Und dort auf der Insel, auf einem Spaziergang am Watt entlang, brach Rüdiger sein Schweigen und eröffnete seinem Onkel: »Ich liebe eine Tote!«
Der Pastor war sich der Tragweite dieses Geständnisses natürlich nicht bewusst. »Wir alle lieben unsere Toten. Sie sind von uns gegangen, und ihr Hinscheiden bleibt für uns unverständlich und fremd. Sie leben ja weiter mit uns, in unserer Erinnerung, in unseren Gedanken, in unseren Gesprächen. Und es wird dereinst ein Wiedersehen geben, denn die Auferstehung ist uns gewiss.«
»So lange werde ich nicht warten!« Das klang trotzig und drohend, und der Pastor wurde aufmerksam. »Du sprichst von einem Verlust, der Dich erst vor kurzem betroffen hat?« Rüdiger nickte nur und senkte den Kopf. Und der Pastor reichte ihm schweigend die Hand, ohne stehenzubleiben. Und erst nach vielen Schritten, als sie das Sanddorngehölz am kleinen Binnensee erreichten, hakte er nach: »Du hast mir nichts davon berichtet.«
»Ich konnte nicht. Nicht darüber schreiben. Nicht darüber sprechen. Bis heute. Du bist der erste Mensch, dem ich mich anvertraue.«
Der Pastor reagierte voller Verständnis. Sein Beruf hatte ihn weise gemacht, was Geständnisse betraf. Er erwartete keinerlei Überraschungen mehr. Daher war es auch mehr eine Feststellung und weniger eine Frage: »Ich nehme an, es handelte sich um eine junge Frau.«
Rüdiger antwortete nicht. Er hielt immer noch den Blick gesenkt, und der Pastor deutete dies zu Recht als einen Ausdruck tiefster Trauer. Die verschämte Handbewegung zu den Augen, dieses diskrete Sichabwenden, das galt sicher nicht nur dem Wind.
»Wann?« fragte der Pastor. Und als er keine Antwort erhielt, fragte er ein weiteres Mal: »Wann geschah es?«
Rüdiger Kienholz zuckte die Schultern. Und erst nach einer Weile bekannte er: »Ich weiß es nicht.« Und nach einer weiteren Weile, in der er sich wohl oder übel eine plausible Erklärung zurechtlegen musste, gab er zu: »Es ist lange her. Ein Unglück …«
Der Pastor ahnte den Zusammenhang. Nur, das fahlblasse Aussehen seines Neffen, die eingefallenen Wangen, die abgemagerte Gestalt, irritierten ihn. »Du hast erst jetzt davon erfahren?«
»Ein Abschiedsbrief.« Rüdiger hatte keine Chance mehr, etwas zu verschweigen. Und keine andere Wahl. Ein halbes Geständnis brachte nichts ein. Er hatte begonnen, sein Geheimnis preiszugeben. Und nun gab es keinen Weg mehr zurück.
»Ein Brief? Ein Abschiedsbrief?« Der Pastor ahnte Übles. Ihm schwante etwas von Selbstmord oder ähnlich sündigem Tun. »Kurz vor ihrem Tod …?«
Es dauerte wiederum verhältnismäßig lang, bis Rüdiger sich dazu durchgerungen hatte: »Ich werde ihn dir gleich zeigen!«