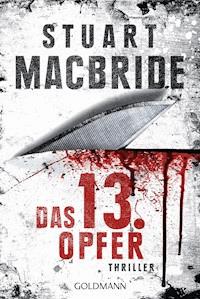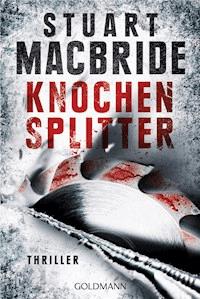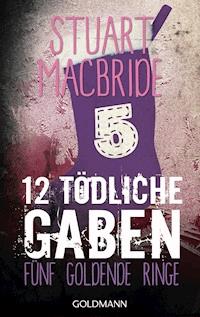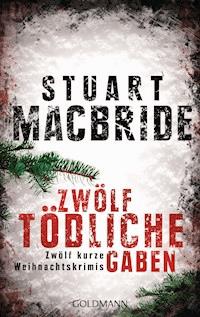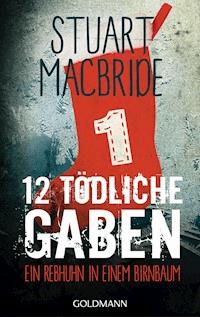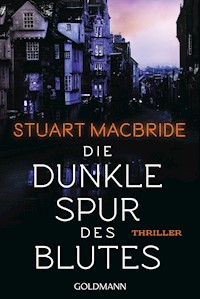9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Stuart MacBride ist mit jedem Thriller ein Lektüre-Muss für mich. Immer schnell, hart, authentisch – und anders.« Lee Chid
»Helft mir!« Diese Worte hinterlässt ein brutaler Serienkiller an jedem Tatort, geschrieben mit dem Blut der Opfer. Die Medien nennen ihn den Bloodsmith. Vergleiche mit Jack the Ripper machen im schottischen Oldcastle die Runde, und selbst nach Monaten hat die Polizei noch keine Spur. Detective Sergeant Lucy McVeigh sucht verzweifelt nach Gemeinsamkeiten zwischen den Opfern, nach einem Muster oder übersehenen Hinweisen. Da schlägt der Bloodsmith erneut zu.
Es scheint aber noch eine zweite Bedrohung in der Stadt zu geben – davon ist ein junger Mann überzeugt, der um sein Leben fürchtet und Lucy um Hilfe bittet.
»Kein Zweifel: Stuart MacBride ist einer der besten Thrillerautoren des Landes.« Daily Mail
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 829
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Siebzehn Monate sind vergangen, seit der »Bloodsmith« seinen ersten brutalen Mord im schottischen Oldcastle begangen hat. Doch bislang gibt es keine Spur. Die Medien laufen Sturm, die Polizeichefs fordern Ergebnisse, aber die Erfolgschancen schwinden mit jedem Tag. Der Fall hat für Detective Sergeant Lucy McVeigh höchste Priorität, dennoch geht sie noch einem zweiten nach: Benedict Strachan war erst elf, als er einen Obdachlosen tötete. Niemand fand je heraus, warum. Jetzt, nach sechzehn Jahren, ist Benedict wieder frei – und in Todesangst. Er fühlt sich verfolgt und bittet Lucy verzweifelt um Hilfe. Die Gefahr existiert wohl nur in seiner Einbildung. Aber was, wenn er wirklich in etwas zutiefst Böses verstrickt ist? Wenn der »Bloodsmith« nicht das einzige Monster da draußen ist? Und was, wenn Lucy dem Bösen zu nahe kommt?
Weitere Informationen zu Stuart MacBride sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Stuart MacBride
Das Blut der Opfer
Thriller
Aus dem Englischen von Andreas Jäger
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »No Less the Devil« by Bantam Press, an imprint of Transworld Publishers, part of the Penguin Random House group of companies.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe Oktober 2023
Copyright © der Originalausgabe
2022 by Stuart MacBride
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagfoto: FinePic®, München
Redaktion: Eva Wagner
AB · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30066-1V001
www.goldmann-verlag.de
In liebevoller Erinnerung an Grendel MacBride, meine stete Begleiterin, meine Muse und meine ganz persönliche flauschige kleine Serienkillerin.2004 –2021
– die Wölfe im Wald –
0
Malcolm rannte. Eine Hand an die Brust gepresst, das Handgelenk geschwollen und schmerzend, die gekrümmten Finger taub und fast schwarz im schwachen Schein der Straßenbeleuchtung. Die andere Hand um den Riemen seines zerschlissenen alten Rucksacks geklammert. Im prasselnden Regen quietschten seine ausgelatschten Turnschuhe über das rutschige Pflaster.
Schwer atmend.
Die Zähne gefletscht.
Hinter einem Tränenschleier die verrammelten Läden und parkenden Autos in der Archers Lane.
Die Worte mit Schluchzern vermischt, während er so viel Abstand wie möglich zwischen sich und die Wölfe zu bekommen versuchte. »Bitte, lieber Gott. Lieber Gott, nein. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte …«
Hinter ihm hallte ein schrilles Heulen durch die Nacht.
»Bittebittebittebittebitte …«
Am Ende der Straße bog er in vollem Tempo um die Ecke in die Chanonry, die Füße rutschten unter ihm weg, und er krachte in das Heck eines rostbraunen Kleinwagens, so heftig, dass die Alarmanlage des Autos losging. Grellorange Lichter blinkten, während er sich aufrappelte und weiterwankte. Drei Uhr morgens, und die Häuser auf beiden Seiten der Straße waren dunkel. Niemand spähte aus dem Fenster, um zu schauen, was das für ein Lärm war. Keine Zeugen des Geschehens. Niemand, der ihn retten konnte.
Wozu hatte man denn die verdammten Autoalarmanlagen, wenn alle sie einfach ignorierten?
Er holte tief Luft und brüllte noch einmal aus voller Kehle: »HILFTMIRDENNNIEMAND?«
Auf der anderen Straßenseite bewegte sich eine Gardine.
Malcolm winkte mit seinem heilen Arm, der baumelnde Rucksack wie ein schmuddeliges Metronom, aber wer immer da hinter dem Vorhang stand, ließ ihn einfach wieder zufallen.
»HELFTMIR, VERDAMMTNOCHMAL!«
Ein neuerliches Geheul vermischte sich mit dem Getöse des Alarms.
O Gott – sie kamen näher.
Er wich von dem Auto zurück. »Bittebittebittebitte …«
Da – direkt vor ihm kam ein großer Range Rover auf ihn zu, die Scheinwerfer pflügten durch den Regen. Der Fahrer würde ihm helfen. Er musste ihm helfen.
»STOPP!« Malcolm torkelte in die Mitte der Fahrbahn. »BITTE! HELFENSIEMIR!«
Der Fahrer des Geländewagens bremste nicht mal ab, sondern drückte nur auf die Hupe.
»NEIN!« Malcolm brachte sich mit einem Satz in Sicherheit, aber um ein Haar nicht schnell genug. Die Frontscheibe erwischte seinen Rucksack, der ihm aus der Hand flog und gegen das Dach eines parkenden Volvos knallte.
Der Range Rover legte eine Vollbremsung hin, das Fenster surrte herunter, laute Bmmmmm-tsch-bmmmmm-tsch-bmmmmm-tsch-Musik dröhnte in die Nacht, und eine glubschäugige Frau schaute heraus. »WEHE, DUHASTMEINAUTOZERKRATZT, DANNKANNSTDUABERWASERLEBEN, MANN!«
»Bitte, Sie müssen mir helfen! Sie kommen!« Malcolm wankte auf das Auto zu, den heilen Arm ausgestreckt, die Finger gereckt. »Bitte – die werden mich umbringen!«
»Iiiihh …« Sie schürzte die Oberlippe und wich von ihm zurück. »KOMMMIRNICHTZUNAHE, DUPERVERSERPENNER!« Und das Fenster surrte wieder hoch.
Malcolm war nur Zentimeter vom Türgriff entfernt, als der Wagen einen Satz nach vorne machte und in einer Wolke aus erstickenden Dieselabgasen die Chanonry hinauf davonraste.
»DIEBRINGENMICHUM!«
Die orange blinkenden Lichter erloschen, und die Alarmanlage des Kleinwagens verstummte.
Jetzt waren die einzigen Geräusche das Pfeifen aus seiner Lunge, das Pochen seines Herzens und das unaufhörliche Klapperschlangen-Zischen des Regens.
Ein schrilles Lachen zerriss die Nacht. Es wurde erwidert von einem abermaligen Heulen – diesmal von der anderen Straßenseite, hinter dem Volvo, wo Malcolms Rucksack verschwunden war.
Sie waren nicht mehr dicht hinter ihm her – sie waren hier.
Und jetzt hatten sie seinen Rucksack.
Er wich zurück von allem, was er auf der Welt besaß.
Schluckte, als das Knurren der Wölfe aus dem Dunkel drang.
LAUF!
Malcolm wankte zum Ende der Straße, wo der Asphalt an einer Reihe von Pollern endete und eine einsame Straßenlaterne Wache hielt gegen die düstere Schwärze von Camburn Woods.
Der Wald.
Dort könnte er sie abhängen.
Meilen über Meilen von verschlungenen Pfaden und leer stehenden Gebäuden und Bäumen, Bäumen, Bäumen.
Seine Turnschuhe platschten durch eine Pfütze, die sich quer über die Straße zog. Schneller. Vorbei an den Pollern und hinein in den Wald, unter das dichte, dunkle Dach aus Nadeln, Ästen, Zweigen und Blättern, immer dem geteerten Weg nach.
Die Bäume dämpften das Klapperschlangen-Zischen, die Luft war gesättigt vom schweren braunen Modergeruch des Waldbodens.
Hinter ihm das Klatschen kleiner Füße auf dem Weg. Lachen. Fauchen.
Malcolm biss die Zähne zusammen und rannte. Schwang die Beine und ruderte mit den Armen, sein Atem keuchend und rasselnd, begleitet vom Klatsch-klatsch-klatsch seiner Turnschuhe auf dem Weg. Der Schweiß klamm und kalt zwischen seinen Schulterblättern. Rasierklingen schnitten in seine ruinierte Hand und in das Handgelenk.
Vor ihm tauchte eine Kreuzung auf. Die Wegweiser zeigten nach links zum Castle Hill Infirmary, nach rechts zum Studentenwohnheim Saxon Hall, aber Malcolm lief geradeaus, folgte dem Pfeil nach Rushworth House. Zählte fünf, vier, drei, zwei …
Er schlug einen Haken nach rechts, bog vom Weg ab und rauschte in ein hüfthohes Meer von Brennnesseln. Rannte strauchelnd durch das Unterholz, während die Dunkelheit ihre Arme um ihn schlang.
Das Getrappel der kleinen Füße auf dem Pfad stoppte plötzlich, und ein einsames Heulen ertönte.
Eine hohe Stimme schloss sich an. »DUKANNSTNICHTEWIGDAVONRENNEN, KLEINESSCHWEINCHEN!«
Und sie waren ihm wieder auf den Fersen.
Keine Ahnung, was da früher mal drin war, aber jetzt war das Gebäude bloß noch eine schattenhafte Ruine, tief in den Camburn Woods versteckt – das halbe Dach fehlte, das Obergeschoss wölbte sich über der Tür nach außen, aufgequollen wie der Bauch eines Ertrunkenen, kurz vorm Platzen.
Die Lichtung war nicht besonders groß – gerade mal genug Platz zwischen den Bäumen, dass der Regen auf das verfallene Schindeldach klatschen und im Brombeergestrüpp zischeln konnte. Der Farn griff mit feuchten grünen Tentakeln nach ihm, das kleine Fleckchen Himmel über ihm schimmerte in schmutzigem Orangebraun und spendete gerade genug Licht, um Formen und Umrisse ausmachen zu können.
In der Ferne raschelte etwas, und Malcolm erstarrte, duckte sich unter die ausgreifenden Äste einer knorrigen Eiche. War vielleicht nur ein Dachs oder ein Fuchs? Oder vielleicht waren es die Wölfe …
Das Rascheln wurde leiser und leiser, dann war er wieder allein.
Gott sei Dank.
Malcolm hielt sich mit der heilen Hand das Knie und ließ den Atem in einem gewaltigen Schnaufer entweichen. Spürte die Tränen warm auf seinen Wangen, während er schauderte und leise wimmerte. Er biss sich auf die Unterlippe, um das Geräusch zu unterdrücken. Schwer zu sagen, wie spät es war, nachdem er gefühlte Stunden durch Büsche und Brombeergestrüppe und Ginster gestapft war, bis das Geheul der Wölfe in seinem Rücken leiser wurde. Und dann war er im Dunkeln umhergekrochen und hatte kaum zu atmen gewagt, aus Angst, er könnte sich verraten. Und jetzt war er hier angekommen. Durchnässt und erschöpft, aber noch am Leben.
Es verging eine Weile, ehe er sich aufrichtete, sich mit dem Ärmel seiner neuen Jacke die Augen wischte und über die winzige Lichtung zu dem Haus humpelte. Alles, was er brauchte, war eine ruhige Ecke, wo er vor dem Regen geschützt bis zum Morgen ausharren konnte. Irgendwo, wo die Wölfe ihn nicht finden würden. Und dann, sobald die Luft rein war, ab in die Notaufnahme. Und dann vielleicht einfach die Fliege machen, mit geklauten Drogen in der Tasche und Sonne im Herzen. Ab in den Süden, in wärmere Gefilde, vielleicht nach Dundee, oder sogar nach Edinburgh. Wenn man Platte machte, war schließlich ein Ladeneingang mehr oder weniger wie der andere. Oldcastle konnte ihn mal kreuzweise.
Holzdielen knarrten unter seinen zerschlissenen, durchnässten Turnschuhen, als er in die dunkle Diele schlurfte.
Denn die Stadt war ja nicht gerade nett zu ihm gewesen, oder? Vierunddreißig Jahre alt, und was hatte er vorzuweisen? Ein zerschmettertes Handgelenk, einen beschissenen Schlafsack aus dem Army Surplus Store in der Weaver Street und einen versifften Rucksack …
Nee. Nicht mal den hatte er mehr.
Die Wölfe hatten ihm alles genommen.
Alles bis auf die 35-cl-Flasche Asda-Hausmarke-Whisky in seiner Jackentasche. Dem er jetzt gleich ernsthaft zusprechen würde.
»Wmmmmmmpffaaaarrgh!« In der Dunkelheit riss Malcolm die Augen auf. Sein Gesicht war nass, Wasser lief ihm in die Ohren und tränkte sein T-Shirt.
Ein kleines Mädchen schaute auf ihn herab, ihr Gesicht von unten beleuchtet, als ob sie eine Gruselgeschichte erzählen wollte. Sie sprach deutlich und mit vornehmem Akzent – wie polierter Marmor und geschliffenes Glas. »Na also. Wusste ich’s doch, dass du irgendwo hier drin bist.« Sie konnte kaum älter als zehn oder elf sein. Große blaue Augen starrten ihn über ihrer Stoffmaske mit Schottenkaro an, während sie eine fast leere Wasserflasche in der behandschuhten Hand schwenkte. »Wir wollen doch nicht, dass du das große Finale verpasst, oder?« Sie war leger gekleidet, mit Baseballkappe und Hoodie – beides mit Werbung für rivalisierende miese Popbands. Dazu Jogginghose und schlammverschmierte Nikes. Sie hatte die Haare unter die Kappe gesteckt, doch die Sommersprossen, die über ihrer Maske zu sehen waren, und die hellorangefarbenen Augenbrauen verrieten, dass sie in Wirklichkeit ein Rotschopf war. Handschuhe und Maske – als ob die Pandemie nie zu Ende gegangen wäre.
»Gah …« Malcolm schob sich rückwärts gegen die Wand und stemmte sich hoch, bis er aufrecht saß. Wischte sich mit der heilen Hand das Wasser aus dem Gesicht. Die Wärme des Whiskys verdunstete aus seinen Knochen und ließ dieses altbekannte durstige Zittern zurück. »Du kannst nicht einfach hier reinkommen …«
»Halt den Mund.« Sie blickte sich um. »Nimmst du auf?«
Ein dicker Junge trat aus dem Dunkel heran. Ungefähr das Format eines Verkaufsautomaten, breite Schultern, tonnenförmiger Brustkorb, ein iPhone in der Pranke, die in einem blauen Nitrilhandschuh steckte. Sein Mund war hinter einer Maske mit Totenschädel-Aufdruck verborgen, aber das Lächeln in seinen Augen war nicht zu übersehen. Er klang sogar noch vornehmer als sie. »Aber selbstverständlich.« Die Sorte Akzent, die zehn Meilen gegen den Wind nach Privilegien, Privatschulerziehung und behüteter Kindheit stank. »Keine Sorge, meine liebe Allegra – Hugo hat alles im Griff.«
Das Mädchen – Allegra – starrte ihn wütend an. »Sag nicht unsere Namen, du totale Dumpfbacke!«
»Oh.« Hugo zog die Schultern hoch und setzte einen Dackelblick auf. »Aber es ist doch sonst niemand hier, und dieser bedauernswerte Herr wird bald tot sein, also …«
»Du nimmst das hier auf! Jetzt sind unsere Namen in dem Video!«
»Ach so. Ja. Verstehe.« Er nickte. »Ganz recht. Mea culpa. Dummer Hugo.« Er hantierte an seinem Smartphone herum. »Okay, das ist jetzt definitiv gelöscht. Versuchen wir’s noch einmal, immer schön anonym und so weiter.«
Malcolm starrte die beiden an. »Moment mal, was soll das heißen – ›dieser bedauernswerte Herr wird …‹«
Es war nicht die heftigste Ohrfeige, die er je kassiert hatte, aber sie kam vollkommen aus dem Nichts. Sein Kopf schnellte zur Seite, und sofort brannte sein Mundwinkel.
Das Nitril quietschte, als Allegra sich die Schlaghand rieb. »Habe ich gesagt, dass du reden darfst?«
»Ihr seid bloß Kinder, verdammt! Ihr macht mir keine Angst!«
»Oje. Das ist aber bedauerlich, nicht wahr?«
»Aha! Ja.« Hugo trat noch etwas näher. »Äußerst bedauerlich.« Er griff in die Tasche seines Hoodies und zog einen langen, dünnen, in Zeitungspapier eingeschlagenen Gegenstand hervor. Gut vierzig Zentimeter lang. »Aber wie meine liebe Großmama immer sagt: ›Die Ziege meckert, bis man ihr die Kehle durchschneidet.‹« Er wickelte den Gegenstand mit einer Hand aus dem Zeitungspapier aus, und die lange, gebogene Klinge eines Küchenmessers schimmerte im Licht seines Smartphones.
Malcolm drückte sich noch weiter in die Wand. »Ihr … ihr könnt mir keine Angst machen. Ich bin Polizist!«
Allegra schüttelte den Kopf und griff in die Tasche ihres Hoodies. »Nicht mehr, nein – sie haben dich schon vor Jahren gefeuert.« Die Hand kam wieder heraus, die Finger um den Griff eines Klauenhammers geschlungen. Es war derselbe, den sie vor zwei Stunden benutzt hatte, um Malcolm zu wecken, als er im Eingang von McCartney’s Haarstudio geschlafen hatte, ganz friedlich und ohne irgendwen zu stören.
Schon bei dem Anblick fing sein geschwollenes Handgelenk an zu brennen und zu schmerzen. »Das kannst du nicht machen, es ist …«
»Denkst du vielleicht, wir hätten dich zufällig ausgesucht, Malcolm? Haben wir nämlich nicht.«
»Das Glück ist mit den Vorbereiteten, alter Mann.«
»Wir sind dir den ganzen Tag gefolgt.« Sie packte den Hammerstiel fester mit ihren behandschuhten Fingern. »Willst du wissen, wie wir dich heute Abend gefunden haben? Hier, im tiefen, dunklen Wald? Wo du dich versteckt hattest wie ein verschrecktes kleines Mäuschen?«
»Wenn … wenn ihr jetzt geht, kriegt ihr keinen Ärger. Versprochen.«
Ihre Stimme hüpfte ein wenig in die Höhe, wurde zu einem zuckersüßen Lispeln. »Oh, Sie armer Mann, Sie sehen aus, als wäre Ihnen furchtbar kalt in dieser schäbigen alten Jacke! Daddy sagt, ich darf mit meinem Geburtstagsgeld machen, was immer ich möchte, und ich möchte Ihnen helfen!«
Es ist ein saukalter Montagmittag, und Malcolm ist an seinem Stammplatz vor dem Bahnhof, hockt im Schneidersitz auf seinem Pappkarton-Quadrat und seinem Schlafsack, eine ramponierte Baseballkappe vor sich auf dem Pflaster. Haucht sich den dampfenden Atem in die hohlen Hände, um seine halb erfrorenen Finger wieder zum Leben zu erwecken. Hüllt sich enger in die zerschlissene Jacke, die er »geerbt« hat, als Sparky Steve an Corona krepiert ist. Die Jacke mit den ausgefransten Manschetten, den Löchern in den Ellbogen und dem großen Fleck auf dem Rücken.
War wohl nichts mit dem superheißen schottischen Sommer, den die Boulevardblätter versprochen haben. Seit wann ist der August kälter als der Februar? Und da behaupten die Leute immer noch, der Klimawandel wäre eine einzige …
»Verzeihung?«
Er blickt auf, und da steht ein hübsches rothaariges Mädchen vor ihm, in der Hand eine Tüte von Primark, die fast so groß ist wie sie selbst. Zöpfe. Sommersprossen. Tartan-Röckchen. Blauer Schulblazer mit einer Art Wappen auf der Brusttasche, was darauf schließen lässt, dass ihre Eltern ordentlich Schotter haben.
Er schenkt ihr sein bestes Ich-bin-so-eine-arme-Sau-Lächeln. »Hast du mal ’n Pfund?«
»Oh, Sie armer Mann, Sie sehen aus, als wäre Ihnen furchtbar kalt in dieser schäbigen alten Jacke! Daddy sagt, ich darf mit meinem Geburtstagsgeld machen, was immer ich möchte, und ich möchte Ihnen helfen!« Sie hält ihm die Tüte hin. »Hier – damit Sie sich nicht den Tod holen.«
Er zieht das Kinn ein und beäugt sie einen Moment lang skeptisch. Will sie ihn verarschen? Sich über den armen Penner lustig machen? Wird sie »Pädo!« kreischen, sobald er ihr ein bisschen zu nahe kommt?
Sie stellt die Tüte vor ihm auf den Gehsteig, dann greift sie in die Tasche und zieht einen Zehnpfundschein hervor. Wirft ihn in seine leere Kappe. »Und jetzt können Sie sich auch noch was Leckeres zum Essen kaufen!« Sie sprudelt geradezu über vor Hilfsbereitschaft.
Also öffnet Malcolm die Tüte und zieht eine schöne neue Steppjacke heraus – eine von diesen dunkelrot glänzenden, die so ein bisschen wie eine Daunendecke mit Ärmeln aussehen. Er starrt sie an. Dann das Mädchen. Dann wieder die Jacke.
Leckt sich die Lippen.
Und merkt doch glatt, dass ihm die Tränen kommen. Er würgt den Frosch in seinem Hals lange genug runter, um murmeln zu können: »Danke. Das ist … Danke.«
»Ziehen Sie sie an! Los, ziehen Sie sie an!«
Und Malcolm schält sich aus Sparky Steves versiffter Jacke und schlüpft in die nagelneue, wattierte. Sie ist mollig warm und das Netteste, was irgendjemand seit Jahren für ihn getan hat. »Danke!«
»Ich habe einen GPS-Sender ins Futter eingenäht. Mein Begleiter hier hat dich auf seinem Handy verfolgt.«
»Wie ein wahrhaftiger Bluthund. Mit Adleraugen und feiner Nase.« Hugo hob die Klinge. »Und mit Messer, natürlich. Darf das Messer nicht vergessen.«
Malcolm presste den Rücken mit aller Kraft gegen die Wand. Seine Stimme bebte. »Bitte, ich will nicht sterben …«
»Ich weiß.« Allegra klopfte ihm auf die Schulter, ihre Stimme sanft und freundlich. »Aber so ist es halt manchmal im Leben – manche Leute leben glücklich und zufrieden bis an ihr seliges Ende, und manche Leute werden erstochen. Oder erdrosselt. Oder mit einem Hammer erschlagen.« Sie schlug den Kopf des Klauenhammers leicht gegen ihre behandschuhte Handfläche. »Oder aufgerissen wie ein verdammter Briefumschlag.«
»Bitte, ihr müsst das nicht tun!« Tränen ließen das dunkle kleine Zimmer verschwimmen.
»Oder, in deinem Fall, eine bedauernswerte Kombination von allem oben Genannten.«
»Reiß dich zusammen, alter Mann.« Hugo streckte die Hand mit dem Smartphone aus, um eine Nahaufnahme zu machen. »Niemand mag eine Heulsuse.«
»Bitte! Ich will nicht …«
Dann sauste der Hammer nieder, und die Welt schrie ihren allerletzten Atemzug hinaus.
– vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt –
1
So.
Michelle warf noch einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel: das Make-up perfekt, die rotbraunen Haare mit Haarspray gebändigt, strahlendes Lächeln ohne eine Spur Lippenstift auf den Zähnen. Und als sie sich in die hohle Hand hauchte, stellte sie beruhigt fest, dass auch ihr Atem pfefferminzfrisch duftete.
Der erste Arbeitstag, und sie war startbereit.
Jetzt brauchte sie nur noch eine Kundin.
Da – die hagere Frau im mittleren Alter, die mit finsterer Miene die Regale mit den Schmerztabletten studierte. Schwarzer Mantel über einem rot-weiß gestreiften Top, die mausblonden Haare viel zu lang für eine Frau ihres Alters, Haut wie blanchierte Milch und ein markantes Kinn mit einem Grübchen an der Spitze. Sie hatte offensichtlich einen »natürlichen« Look angestrebt, und er stand ihr ganz und gar nicht. Und diese Brille mit dem dicken schwarzen Gestell machte es auch nicht gerade besser. Aber es war doch verblüffend, was ein bisschen Make-up – richtig aufgetragen von einer frischgebackenen Fachkraft wie Michelle – ausrichten konnte.
Die Frau zog eine Packung Paracetamol aus dem Regal und klackerte auf ihren Stiefeln mit Blockabsätzen auf die Kassen zu. Was bedeutete, dass sie direkt an Michelles Stand vorbeikommen musste, ohne auch nur im Geringsten zu ahnen, dass ihre Welt gleich ein bisschen heller werden würde.
Michelle nickte sich selbst zu und hielt ihre Stimme gedämpft. »Denk dran, was du gelernt hast, Michelle – du kannst das!« Dann drehte sie ihr Lächeln noch eine Stufe höher.
Jetzt würde sie es allen zeigen!
Lucy kniff ein Auge zu, als die messerscharfe Sonne durch das Schaufenster hereinstach und auf den grellweißen Fliesen funkelte, auf Glasflaschen und Flakons, als ob sie sich direkt in ihr ohnehin schon pochendes Hirn bohren wollte.
Zu heiß war es auch hier drin – die Heizung aufgedreht wie im tiefsten Winter, obwohl es erst Anfang September war, was den Mantel, den sie an diesem Morgen angezogen hatte, in ein Folterinstrument verwandelte. Sie war erst fünfzehn Minuten im Laden, und schon klebte ihr das Top am Rücken.
»Verzeihung, Madam? Hallo?« Eine groteske Erscheinung mit zu viel Rouge im orangefarbenen Gesicht, aufgemalten Augenbrauen und einer weißen Kittelbluse schoss hinter einem der Kosmetiktresen hervor und stellte sich Lucy in den Weg. Sie hielt eine handtellergroße Dose mit irgendeinem Fettzeug hoch. »Ich weiß, Krähenfüße können wirklich ein Riesenproblem für ältere Damen sein, aber das Tolle ist: Es gibt jetzt eine biologische Alternative zu Botox!«
»Ältere Damen?« Lucy funkelte sie an. »Ich bin sechsundzwanzig!«
»Ah.« Die Idiotin ließ die Dose hinter ihrem Rücken verschwinden und schnappte sich stattdessen ein paar Lippenstifte. »Nun, dann könnte ich Sie, mit Ihrem klassischen blassen Teint, vielleicht von einem etwas kräftigeren Lippenstift überzeugen? ›Bewitching Coral‹? Oder ›Pink Brandy‹?« Sie zeigte mit den Lippenstiften auf Lucys Mund. »Denn dieser Ton ist wirklich viel zu bieder für Sie.«
»Ich trage kein Make-up!«
Das falsche Lächeln verflog. »Dann … wäre jetzt vielleicht die Gelegenheit, damit anzufangen?«
»Arrr …« Lucy schob sich an ihr vorbei und stapfte auf die Schlange an den Kassen zu.
Die Selbstbedienungskassen waren natürlich alle außer Betrieb, also blieb ihr nichts anderes übrig, als sich quälend langsam Zentimeter für Zentimeter vorzuarbeiten, vorbei an den Zeitungen, Zeitschriften und zuckerarmen Süßigkeiten – alles mit Bedacht arrangiert, um die Kunden auf ihrem elenden Todesmarsch zur Kasse einzupferchen. Bei dieser Schlange hätten definitiv drei Kassen besetzt sein müssen, aber stattdessen hatte man alles einer blutjungen Frau überlassen, die permanent die Nase hochzog und die Einkäufe der Leute scannte, als ob sie ihnen damit einen riesigen persönlichen Gefallen täte.
Bieder? Krähenfüße? Ältere Dame?
Als ob dieser Troll von der Kosmetikabteilung ein verdammtes Ölgemälde wäre, mit ihrem Gesicht wie ein Umpa Lumpa mit Verstopfung.
Unverschämte Tusse.
Lucy hielt den Kopf gesenkt, um das tückische Sonnenlicht zu meiden, während sie mit dem einen offenen Auge die Presseerzeugnisse überflog: »LOVEISLAND: TRIPPER-SCHOCKNACHFLOTTEMDREIER!«, »DROGENRAZZIABEILET’S DANCE«, »MEINEHEIMLICHEDIÄT-HÖLLE!«, »SEXGIERIGERBRIEFTRÄGERSTAHLMEINHERZUNDMEINEKATZE!« Die billigen Revolverblätter waren genauso schlimm: »RAMMEL-RHYNIE: GERÜCHTEUM›RUSSEN-AFFÄRE‹«, »ASYLANTEN›ÜBERSCHWEMMENGESUNDHEITSSYSTEM‹, SAGTMUTIGERSTADTRAT« und »SCHOTTEN-COPSKRIEGENUNHEIMLICHENKILLERNICHTZUFASSEN«.
Was ein wenig unfair war.
Auch wenn es stimmte.
Diese letzte Schlagzeile prangte über einem unscharfen Foto, das ein leeres, verfallenes Zimmer zeigte – klaffende Löcher in den Bodendielen, die bröckelnden Wände mit hellen Bleicheflecken überzogen.
Ein kleineres Foto war darin einmontiert: Abby Geddes, wie sie mit müden Augen in die Welt hinausschaute, die Mundwinkel nach unten gebogen, die kurzen braunen Haare zerzaust und ungepflegt. Fast, als ob sie …
»Hallo?« Eine herrische Männerstimme blaffte das Wort heraus, direkt hinter Lucy, gefolgt von einem genervten Zungenschnalzen. »Stehen Sie hier eigentlich an oder schauen Sie bloß?«
Arschloch.
Lucy drehte sich um, schön langsam, rückte ihre Brille zurecht und ließ den schlaksigen Blödmann im Nadelstreifenanzug ihren einäugigen bösen Blick spüren, die Zähne gefletscht. »Wollen Sie das vielleicht wiederholen, Freundchen?«
Die Röte schoss von seinem Hemdkragen hoch und flutete seine Wangen – es sah aus, als ob er seine Krawatte viel zu fest gebunden hätte. Er trat einen Schritt zurück. »Ich … äh …« Plötzlich schien er sich brennend für seine auf Hochglanz polierten Oxfords zu interessieren. »Ich war … Sie sind dran.« Er hob eine zitternde Hand und deutete auf das Band.
Sie nickte, dann schlenderte sie betont langsam auf den gelangweilten pickligen Teenager zu und warf ihre Packung Paracetamol auf den Edelstahl-Wiegeteller an der Kasse.
Eine Pause. Die Kassiererin kaute eine Weile schweigend vor sich hin, dann purzelten die Worte heraus, begleitet von einer Spearmint-Fahne, bei der sich einem der Magen umdrehte, und verformt zu einem erstickten Kingsmeath-Akzent. »Wollen Sie ’ne Schoko-Orange? Ist im Angebot. Sie zahlen eine und kriegen eine zum halben Preis und so.«
»Nein.«
Die Kasse piepste, als die Tabletten gescannt wurden.
Und dann blühte ein strahlendes Lächeln im Gesicht der jungen Dame auf, bei dem sich die ganzen Pickel und Mitesser neu arrangierten. »Ey, Sie sind doch diese Frau, oder?«
Lucy zog ihre Bankkarte aus dem Geldbeutel. »Nein.«
»Doch, Sie sind’s – Sie sind diese Detective-Sergeant-Frau. Wir hatten Sie als Thema in Medienkunde! Sie und diesen Typ, wie heißt er noch, Nigel oder so ähnlich. Black. Neil Black! Genau, so heißt er.«
Das Kartenlesegerät bestätigte die Transaktion mit einem Glockenton, und Lucy schnappte sich ihre Tabletten. »Nein, die bin ich nicht!« Sie marschierte davon, stampfte mit klackernden Absätzen über den Fliesenboden hinaus auf die Jessop Street und in die frische Morgenluft. Auch wenn die mit dem bläulichen Dunst der Abgase von den vorbeirumpelnden Autos und Lieferwagen geschwängert war.
Der Dunk zog eine Augenbraue hoch, als sie die Paracetamol-Packung aufriss. Er war kaum größer als der Briefkasten, an dem er lehnte, mit einem rundlichen kleinen Gesicht, verunstaltet durch eine schüttere Schnurrbart-Kinnbart-Soulpatch-Kombi, die ihm bei Weitem nicht so viel Ähnlichkeit mit Tony Stark verlieh, wie er ganz offensichtlich glaubte. Er hatte sich in seinen obligatorischen schwarzen Rollkragenpulli gezwängt, dazu trug er schwarze Jeans, eine dunkle Sonnenbrille und eine dunkelgraue Lederjacke. Und eine Zigarette, lässig in den Mundwinkel geklemmt.
Ehrlich gesagt fehlten da nur noch eine Baskenmütze und ein Paar Bongos, und der Kerl hätte einen astreinen Beatnik abgegeben. Aber immerhin hatte er Kaffee besorgt, das musste man ihm lassen.
Der Dunk hielt ihr einen der zwei großen Pappbecher hin. »Latte macchiato mit Karamell und Schokostreuseln.«
»Geht doch nichts über ein gesundes Frühstück.« Sie warf zwei Tabletten ein und spülte sie mit einem Schluck heißem, süßem Kaffeegenuss runter.
Er schürzte die wulstigen Lippen. »Haben Sie immer noch diese Kopfschmerzen?«
»Wir sind spät dran.« Sie schritt zügig die Straße hinunter, und der Dunk hatte Mühe, mit seinen kurzen Beinchen Schritt zu halten.
Er fiel in einen leichten Trab und schloss zu ihr auf. »Ich meine nur, weil ich ziemlich sicher bin, dass man zum Arzt gehen sollte, wenn so ein Kater länger als zwei Monate anhält.« Er schüttelte den Kopf. Hinten lichteten sich seine Haare schon ein wenig. Auch nicht sehr Tony-Stark-mäßig. »Oder wenigstens nicht ganz so viel trinken.«
»Sehr witzig. Sie klingen wie eine Neuauflage von Bernard Manning. Und nur dass Sie’s wissen: Das hier« – sie tippte sich an die Stirn – »kommt wahrscheinlich vom Stress. Weil ich mich den ganzen Tag mit so komischen Typen wie Ihnen herumärgern muss.«
An der Ecke, gleich bei der Ampel, hatte ein Straßenmusiker Stellung bezogen, gekleidet in Hawaiihemd, Shorts und Flip-Flops – eine mutige Modewahl für Schottland im September. Er trällerte eine fade Reggae-Coverversion von einem Song, hinter der man das Original gerade noch erkennen konnte:
»Your love’s got me shivering, like a disease,
I splutter and sweat, I go weak at the knees,
Your love, it’s infectious, and I’m just defenceless,
I’m burnin’ up, baby, don’t need no vaccines …«
Nicht besonders geschmackvoll.
Sie eilten die St Jasper’s Lane entlang, schlüpften zwischen einem Gelenkbus und einem schmutzig braunen Renault-Lieferwagen durch und kamen vor dem King James Theatre mit seiner kunstvollen Fassade aus gelbem Backstein und rosa Granit heraus, wo reißerische Plakate die nächsten Veranstaltungen ankündigten: »WEIHNACHTSSPIEL: SKELETONBOBUNDDIEKOBOLDE, DIESANTAENTFÜHRTEN, Vorverkauf STARTETJETZT!«, »DIECASTLEHILLOPERASOCIETYPRÄSENTIERT: DASSCHWEIGENDERLÄMMER« sowie »JETZTANMELDENFÜRDENSUPER-MEGA-FANTASTISCHENBINGO-MITTWOCH! – WERTVOLLEGEWINNEJEDEWOCHE!!!« Na ja, warum stilvoll, wenn’s auch prollig geht, und …
Lucy blieb vor einem kleinen Zeitungsladen stehen, mit einer Anschlagtafel an der Wand neben dem Eingang, auf der stand: »CASTLENEWS & POST:FIASKOBEIFAHNDUNGNACH ›BLOODSMITH‹ – FAMILIENINANGST«.
»Sarge?«
Eine Hitzewallung breitete sich von ihrem Halsansatz aus, kroch langsam höher und verwandelte sich in dieses entsetzliche, wohlbekannte Kribbeln – als ob jemand sie beobachtete. Es würgte den Atem in ihrer Kehle ab und ließ ihr Herz rattern. Doch als sie herumfuhr, die Fäuste geballt, war da nur die übliche bunte Mischung von Passanten und Geschäftsleuten, die passierten oder ihren Geschäften nachgingen. Den legalen und den nicht ganz so legalen.
Aber Moment mal – da war doch jemand, der sie von der anderen Straßenseite beobachtete: ein groß gewachsener, dünner Mann mit hoher, von lockigen braunen Haaren gesäumter Stirn. Vollbart, Cordjacke – wie ein Aushilfslehrer. Kleine, runde Brillengläser, die seine Augen verdeckten, aber nicht die Tränensäcke darunter. Und er stand einfach nur da und glotzte.
Wie ein kranker Spinner.
Ein großer weißer Lieferwagen fuhr langsam vorüber und verdeckte den Mann. »HABENSIESCHONCHICKENMACSPORRANSVONSCOTIABRANDPROBIERT? HUHNHEIMLICHLECKER!« prangte in knalligen Lettern auf der Seitenwand, mit dem Bild einer strahlenden Mutter, die ihren kleinen Jungen mit etwas Ekligem in Form eines gestauchten Daleks fütterte. Und als der Lieferwagen vorbei war, war der Mann verschwunden.
»Sarge?« Der Dunk stupste sie in den Arm. »Alles in Ordnung, Sarge? Ich meine nur, weil Sie aussehen, als ob gerade jemand auf Ihr Grab geschissen hätte.«
»Vergessen Sie’s.« War wahrscheinlich eh nur ein Perverser. Davon gab’s in der Stadt ja weiß Gott genug. Und solange er nur glotzte, war es ja nicht weiter schlimm. Irgendwie unheimlich, aber auf jeden Fall besser als die Alternative. Lucy ging weiter, noch ein bisschen schneller als vorher, sodass der Dunk mit Traben nicht mehr nachkam und sich zu einem regelrechten Sprint aufschwingen musste.
Der kleine Kerl schnaufte und keuchte an ihrer Seite, von der wippenden Zigarette in seinem Mundwinkel rieselte Asche auf sein Revers. »Aber jetzt mal im Ernst: Wer ist Bernard Manning?«
»Herrgott noch mal, ich bin gerade mal drei Jahre älter als Sie – ich bin nicht Ihre Großmutter. Denn seien wir ehrlich: Wenn ich tatsächlich mit Ihnen verwandt wäre, dann wären Sie nicht so abstoßend hässlich.«
»Schon gut, schon gut. Vielen Dank auch, Sergeant Sarkastisch.« Der Dunk wich zwei Schulkindern aus, die um Viertel nach zehn an einem Mittwochvormittag eigentlich in der Schule hätten sein sollen, anstatt rauchend vor einem geschlossenen Off-Licence rumzuhängen. »Also, was glauben Sie, worum es bei der großen Dienstbesprechung gehen wird?«
»Wahrscheinlich verleihen sie uns allen Orden für unsere hervorragende Arbeit bei der Ergreifung des Bloodsmiths.«
»Oh …« Er wirkte ein wenig enttäuscht. »Na ja … vielleicht hat es ja einen Durchbruch gegeben oder so was in der Art?«
»Da haben Sie wahrscheinlich recht. Wir stehen schließlich noch am Anfang, nicht wahr? Sind ja erst seit gerade mal siebzehn Monaten hinter dem Dreckskerl her.« Sie bog nach links in die Peel Place ein. »Was sind schon anderthalb Jahre unter Freunden?«
Auf halbem Weg die Straße hinunter erhob sich das Präsidium der O-Division in seiner ganzen brutalistischen Pracht. Die viktorianische Monstrosität aus rotem Backstein quoll aus der pittoresken Häuserreihe mit Fassaden aus elfenbeinfarbenem Sandstein hervor wie ein architektonischer Leistenbruch.
»Schon, aber es ist ja nicht so, als ob wir uns nicht bemüht hätten.«
»Siebzehn Monate, Dunk. Und wir sind noch keinen Schritt weiter als am ersten Tag.«
Lucy schlich sich aus dem Besprechungsraum und machte die Tür hinter sich zu, womit sie das gelangweilte Geschwätz von zwei Dutzend Polizisten in Zivil und in Uniform schlagartig zum Verstummen brachte.
DI Tudor ging auf dem Flur auf und ab, das Gesicht verkniffen und straff gespannt zugleich, einen Stoß Papiere mit einem Arm an die Brust gedrückt wie einen Teddybären, wodurch er die andere Hand frei hatte, um an seinen Fingernägeln zu kauen. Groß und breitschultrig, das rabenschwarze Haar hinten und an den Seiten im Peaky-Blinders-Stil ausrasiert, was irgendwie gar nicht so lächerlich aussah in Kombination mit den ernsten Augen und dem grau melierten Dreitagebart. In einem anderen Leben hätte er vielleicht ein Model für Modekataloge sein können – ein Mann in den besten Jahren mit markanten Zügen, der irgendwo an einem kühl aussehenden Strand steht, mit seiner aschblond gefärbten Gattin an der Seite, beide im Partnerlook mit Chinos und Polohemden: »2 GEKAUFT, £ 10 GESPART!«
»Alles okay, Chef?«
Er ging weiter auf und ab. »Sind alle startbereit?«
»Stimmt irgendwas nicht?«
Seine Mundwinkel zogen sich nach außen und unten. »Man hat mir die Leitung der Ermittlung übertragen. Die alleinige Leitung.«
»Oh.« Lucy runzelte die Stirn. Biss sich auf die Oberlippe. Nickte. »Das ist nicht gut.«
»Na, vielen Dank für diesen Vertrauensbeweis, DS McVeigh!«
»Sie wissen, dass ich das nicht so gemeint habe, Chef.«
»Angeblich hat DCI Ross mehr aktive Fälle, die seine Aufsicht erfordern, aber – ich zitiere –: ›Unsere Obersten haben vollstes Vertrauen in Ihre Fähigkeit, die Operation Maypole zu einem schnellen und zufriedenstellenden Abschluss zu bringen.‹« Tudor blieb stehen und schlug sich die Hand mit den abgekauten Nägeln vors Gesicht. »Ich bin so was von geliefert.«
War schwer, kein Mitleid mit dem armen Kerl zu haben. »Das heißt, zuerst kneift Superintendent Spence und drückt DCI Ross den Fall aufs Auge, und jetzt reicht DCI Ross das Baby mit der vollgeschissenen Windel an Sie weiter und verdrückt sich.«
»Ist so schon schlimm genug, da müssen Sie nicht noch drauf rumreiten.« Tudor sank mit dem Rücken gegen die Wand. »Ob es wohl zu spät ist, mich noch schnell krankschreiben zu lassen?«
Lucy zuckte mit den Schultern. »Vielleicht haben wir ja Glück und knacken den Fall?«
Seine Miene verfinsterte sich. »Träumen Sie weiter.« Dann schien er sich einen Ruck zu geben und setzte ein Lächeln auf, das wohl Aufrichtigkeit und Mitgefühl ausstrahlen sollte. »Aber was jammere ich hier die ganze Zeit, wo ich doch zuerst hätte fragen müssen, wie es Ihnen geht.«
Sie erstarrte ein paar Atemzüge lang, dann spiegelte sie sein aufgesetztes Lächeln. »Danke, bestens.«
»Ich meine nur, falls Sie das Bedürfnis haben, zu reden oder so …? Meine … also, meine Tür ist immer offen, ja?«
Du lieber Gott, ging es vielleicht noch ein bisschen verkrampfter?
»Mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen – und den Dreckskerl zu schnappen.«
»Ja.« Tudor schniefte, dann schüttelte er sich wie ein alter Spaniel, der aus dem Regen reinkommt. »Nur keine Furcht zeigen.« Er richtete sich zu seiner vollen Größe von eins neunzig auf und nickte ihr zu. »Na, dann kommen Sie.«
Lucy öffnete die Tür, und er schritt hindurch, als ob ihm die ganze Welt zu Füßen läge.
Erstaunlich, was so ein bisschen Selbsttäuschung bewirken konnte.
Sie folgte ihm.
Die Operation Maypole hatte das große Besprechungszimmer im dritten Stock in Beschlag genommen. Vier mickrige, schmale Fenster durchbrachen die gegenüberliegende Wand – getrennt durch Pinnwände mit Memos und Fahndungsfotos und Aufnahmen von den Tatorten –, mit Blick über den holprigen Parkplatz hinter dem Präsidium der O-Division hinweg auf die Rückseite eines aufgelassenen Teppichlagers. Über den Dächern in der Ferne konnte man gerade so die Baumwipfel von Camburn Woods erahnen. Digitale Whiteboards nahmen die ganze Seitenwand ein, bedeckt mit Notizen und Pfeilen und Kästchen und Ablaufdiagrammen. Eine kleine Küchenecke war in die graue Phalanx von Aktenschränken gegenüber den Whiteboards eingepasst, und so blieb nur noch die vierte Wand für Dienstpläne und die Art von Postern, die Police Scotland irrtümlich für motivierend hielt, während sie in Wirklichkeit einfach nur deprimierend waren.
Der Rest des Raums war vollgepackt mit Schreibtischen, Trennwänden, Bürostühlen und DI Tudors Team – in voller Stärke von zwei Dutzend. Sie hatten sogar Schilder an der Decke aufgehängt, um die verschiedenen Spezialeinheiten zu kennzeichnen: »HOLMES-RECHERCHE«, »OPFERSCHUTZ«, »SUCHTRUPPS«, »ANWOHNERBEFRAGUNG«, »VERNEHMUNGEN«, »BEWEISMITTEL« und »KOMMANDO«. Damals schien das eine gute Idee zu sein, obwohl es wenig bis gar nichts damit zu tun hatte, wie die Dinge wirklich liefen.
»So, Leute!« Tudor warf seinen Papierstapel auf den Tisch am vorderen Ende des Raums, und das Stimmengewirr verstummte nach und nach. »Danke. Sicherlich haben Sie alle heute Morgen die Zeitungen gesehen.« Er nahm mit der einen Hand ein Exemplar der Glasgow Tribune und mit der anderen einen Daily Standard und hielt beide hoch, sodass alle die Titelseiten sehen konnten. »OLDCASTLEPOLICE ›UNFÄHIGUNDÜBERFORDERT‹, SAGENTRAUERNDEANGEHÖRIGE« sowie jedermanns Lieblings-Schlagzeile: »SCHOTTEN-COPSKRIEGENUNHEIMLICHENKILLERNICHTZUFASSEN«.
Von irgendwo am anderen Ende des Raums kam ein Buhruf.
»Ganz meine Meinung.« Die Zeitungen landeten auf dem Boden. »Mit Wirkung von heute ist mir die alleinige Leitung der Operation Maypole übertragen worden.«
Ein paar der älteren Officers nahmen Blickkontakt mit Lucy auf und verzogen das Gesicht, sagten aber nichts.
»Ich weiß, es kann einem so vorkommen, als hätten wir in den letzten siebzehn Monaten kaum Fortschritte gemacht, aber das wird sich jetzt ändern. Angus?«
Einer der Kollegen, die die Ankündigung mimisch kommentiert hatten, hielt einen Kuli in seiner speckigen, behaarten Hand hoch. Er war zu Beginn der Schicht vermutlich glatt rasiert gewesen, jetzt aber zeigten seine Hängebacken einen deutlichen blaugrauen Schleier. Schwarze Haarbüschel schauten aus seinem Hemdkragen hervor. Schade nur, dass auf seinem großen, glänzenden Eierkopf keine wachsen wollten. »Chef.«
»Ihr Team geht die Vernehmungsprotokolle und Zeugenaussagen durch. Ich will, dass alles noch einmal überprüft wird.«
Angus ließ kurz eine schmerzverzerrte Grimasse sehen, doch seiner Stimme merkte man nichts an. »Wird gemacht.«
»Emma? Ihr Team macht das Gleiche mit unseren sechsundzwanzig Ex-Verdächtigen. Nehmen Sie sich ihre Alibis noch einmal vor – mal sehen, ob wir nicht den einen oder anderen wieder in die Kategorie ›Könnte unser Mörder sein‹ verschieben können.«
Eine Frau mittleren Alters mit einem wilden rostroten Lockenschopf und hartem Highlands-Akzent nickte. »Chef.« Aber man konnte sehen, dass sie gerade innerlich ein kleines bisschen gestorben war.
Und so bekam der Reihe nach jede Einheit ihren eigenen »Zurück-auf-Null«-Auftrag von Tudor zugeteilt – der es so darstellte, als ob es eine echte Chance für einen Durchbruch wäre und nicht etwa ein gewaltiger Rückschlag. Schließlich schickte er sie alle ihrer Wege, bis nur noch er, Lucy und der Dunk zurückblieben.
Sie deutete mit dem Kopf zum Whiteboard mit der Liste der abgehakten Aufgaben. »Und was ist mit uns, Chef?«
»Sie und DC Fraser müssen sich noch einmal sämtliche Tatorte anschauen. Sozusagen mit frischem Blick. Fangen Sie ganz am Anfang an und arbeiten Sie sich von dort vor.« Sein Lächeln verrutschte ein wenig. »Irgendetwas müssen wir doch übersehen haben. Etwas, das …«
Ein Klopfen am Türrahmen, und eine pummelige Constable steckte den Kopf herein. »Entschuldigen Sie, Chef, aber unten ist ein Besucher für DS McVeigh. Will mit niemandem sonst reden. Ist dringend, sagt er.«
Tudor leckte sich die Lippen. »Geht es um den Bloodsmith?«
Schulterzucken. »Wie gesagt – er will mit niemandem sonst reden.«
»Verstehe …« Tudor rückte sein Lächeln wieder gerade. »Vielleicht haben wir ja zur Abwechslung mal Glück?«
Oder vielleicht würde alles nur noch viel schlimmer?
2
Lucy folgte der Constable die Treppen hinunter ins Erdgeschoss. »Dieser Besucher – hat der auch einen Namen?«
»Lucas Weir.«
Nie gehört.
Ihr Getrappel hallte von den Wänden wider, als sie um den Treppenabsatz bogen. »Und er hat nicht gesagt, worum es geht?«
»Nee. Nur dass es dringend ist. Ach so, und irgendjemand hat ihn ganz übel in die Mangel …« Sie räusperte sich, als sie die nächste Treppe hinunterliefen. »Tut mir leid, Sarge. Ich wollte sagen: Jemand hat ihn tätlich angegriffen.« Ein Lächeln verzog ihre Wangen, in denen Grübchen erschienen. »Das hat er allerdings nicht gesagt – ich habe es aus den ganzen Blutergüssen und so geschlossen.«
Eine richtige Sherlockine Holmes.
Am Fuß der Treppe hielt sie die Tür auf und folgte Lucy in einen Flur mit noch mehr »Motivationspostern« und ein paar Aushängen zur Arbeitssicherheit. Wie etwa dem in heiterem Schwarz und Rot gehaltenen Plakat »ALLGEMEINEVORSICHTSMASSNAHMENIMUMGANGMITBLUTUNDKÖRPERFLÜSSIGKEITEN«. So etwas musste einen doch unweigerlich beflügeln.
Die Constable deutete mit einem Wurstfinger nach vorne. »Er wartet im Besucherzimmer. Soll ich mitkommen, für den Fall, dass er um sich schlägt?«
Ja, weil sie da bestimmt eine große Hilfe sein würde.
»Danke, aber ich komme schon klar.« Lucy ging weiter zum letzten Zimmer auf der linken Seite, das gerade noch innerhalb des für Unbefugte verbotenen Bereichs des Präsidiums lag.
Sie zupfte die Ärmel ihres gestreiften Tops zurecht, klopfte zweimal an die Tür und trat ein, ohne auf eine Antwort zu warten.
Und dann blieb sie abrupt stehen. Blinzelte. Der Geruch war – oh verdammt … es war, als würde man mit einer tödlichen Waffe angegriffen. Die erste Attacke kam von dem scharfen Pissegestank von Kleidern, die nicht richtig getrocknet waren, gefolgt von einer schnellen Rechts-Links-Kombination aus ungewaschenen Haaren und ranzigem Schweiß. Aber der K.-o.-Schlag war die beißende, säuerliche Alkoholfahne, die ihr ins Gesicht wehte, begleitet von einem Uppercut aus Mundgeruch.
Der Mann, der für diesen Überfall verantwortlich war, rutschte unruhig auf seinem quietschenden und ächzenden Plastikstuhl auf der anderen Seite des zerkratzten Resopaltischs herum. Zaundürr, das war das erste Wort, das einem einfiel. Zaundürr, stinkend und übelst zugerichtet. Schmuddeliger brauner Hoodie, der linke Arm vom Ellbogen bis zu den Fingerspitzen in einen strahlend weißen Gipsverband gesperrt. Eine Seite seines Munds war angeschwollen wie von einem Bienenstich. Das Auge darüber sah auch nicht besser aus, die Haut in dunklen Blau- und Lilatönen verfärbt. Das andere Auge blutunterlaufen, die Pupille geweitet und glänzend. Die Nase krumm und verfärbt, mit Pflastern quer über den Nasenrücken. Weitere Blutergüsse auf den messerscharf vorstehenden Wangenknochen und dem spitzen Kinn. Mit der rechten Hand spielte er mit den Kordelenden seines Hoodies herum. Oder vielmehr mit zwei Fingern und dem Daumen – der kleine Finger und sein Nachbar waren mit Tapeverband zusammengebunden, sodass es aussah, als ob er den Vulkaniergruß üben wollte.
Aber so übel zugerichtet, wie er war, hatte Lucy ihn doch sofort wiedererkannt.
Sie zog den Stuhl gegenüber heraus und ließ sich darauf niedersinken, die Miene hart wie Granit. »Sie haben der Constable gesagt, Ihr Name wäre ›Lucas Weir‹. Wollen Sie mir verraten, wieso?«
Ein Schniefen. »So heiß ich jetzt.« Er hatte sich den vornehmen Castleview-Akzent bewahrt, aber die Worte kamen leise, undeutlich und verwaschen durch die Lücke, wo seine unteren Schneidezähne gewesen waren. »Den Namen hat das Gericht mir verpasst, damit Die nicht … nicht rausfinden, wo ich wohne.«
Eindeutig bekifft. Entweder hatte er sich aus seinem eigenen Vorrat bedient, oder sie hatten ihm im Krankenhaus irgendein superstarkes Schmerzmittel verpasst, als sie ihn zusammengeflickt hatten. Zu schade, dass sie ihn nicht auch gleich gebadet hatten.
Lucy lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. »Dann erzählen Sie mal, wie ist es Ihnen so ergangen?«
Er griff in den Kängurubeutel seines Hoodies, zog eine zerknitterte Zeitungsseite hervor und warf sie auf den Tisch. Mit seinem Gips klemmte er eine Ecke fest, um das Papier mit dem Daumen und den zwei nicht gebrochenen Fingern glattstreichen zu können. Die Zungenspitze aus dem Mundwinkel geschoben, während er unbeholfen herumfuhrwerkte. War ja auch nicht einfach, wenn man Linkshänder war und zum Herumfuhrwerken nur drei Finger auf der falschen Seite zur Verfügung hatte.
Es war die Titelseite des Daily Standard von gestern: Die Schlagzeile »PERVERSERKILLER-KNABEWOHNTNEBENSPIELPLATZ«, mit einem fetten »EXKLUSIV!«-Stempel, das Ganze über einem Foto des Mannes, der ihr gegenübersaß. Es war offenkundig aus großer Entfernung aufgenommen. Das verpixelte, körnige Bild zeigte ihn, wie er gerade aus einem Eckladen trat. Lächelnd, ohne zu ahnen, dass er erwischt worden war.
»Oh.« Das war gar nicht gut.
Ein kleineres Foto war in das große einmontiert. Es war das Foto, das sie damals in allen Zeitungsberichten verwendet hatten, und in der BBC-Doku, in den Zeugenaufrufen und dann einmal jedes Jahr am Jahrestag des Mordes. Das Foto eines lächelnden Jungen, der sein ganzes Leben noch vor sich hatte. Brille, rotblonde Haare, Sommersprossen auf Nase und Wangen. Herausgeputzt zur Feier des Grundschulabschlusses, mit weißem Hemd und der blau-rot gestreiften Marshal-School-Krawatte. Die Bildunterschrift lautete »BENEDICTSTRACHAN (11), ZWEIMONATEVORDEMMORD«.
Eine Träne ploppte auf den Zeitungsausschnitt und wurde vom Papier aufgesogen, das sich dunkelgrau verfärbte. »Sehen Sie?«
»Es tut mir so leid, Benedict.« Lucy beugte sich vor und legte die Hand auf seinen heilen Arm. »Das haben Sie nicht verdient.«
Er nickte, und eine weitere Träne landete mitten auf dem Foto.
»Wissen Sie, wie sie Sie gefunden haben?«
Er schüttelte den Kopf und zog seine Hand weg, um sich die Tränen abzuwischen. Seine Stimme wurde rau und brüchig, und jetzt weinte er ganz hemmungslos. »Ich bin … Ich bin erst vor drei … vor drei Wochen rausgekommen!«
Verdammter Mist.
Lucy drehte den Zeitungsausschnitt um und begann mit finsterer Miene zu lesen.
Der Daily Standard kann exklusiv berichten, dass der berüchtigte Killer Benedict Strachan (27) aus dem Gefängnis entlassen wurde und jetzt gegenüber einem Spielplatz wohnt, der von Kindern schon ab drei Jahren benutzt wird. Die Anwohner im ruhigen Oldcastler Stadtviertel Shortstaine waren entsetzt, als sie erfuhren, dass ihr neuer Nachbar ein berüchtigter Mörder ist. »Ich kann nicht glauben, dass so jemand aus dem Gefängnis entlassen wird«, sagt die dreifache Mutter Angel Gardiner (25) und fügt hinzu: »Lebenslänglich sollte auch lebenslänglich sein!« Karen Johnson (54) besucht den Spielplatz dreimal die Woche mit ihren Enkelkindern. »Ich bin für die Wiedereinführung der Todesstrafe«, sagt sie. »Wer einen Menschen tötet, hat sein Leben verwirkt. Auge um Auge, wie es in der Bibel steht.«
Der perverse Benedict erlangte seinen zweifelhaften Ruhm vor sechzehn Jahren, als er und ein nicht namentlich genannter Komplize den Obdachlosen Liam Hay (31) brutal ermordeten, als dieser unter freiem Himmel …
»Sie … sie haben meine Adresse gedruckt!« Benedict wischte sich wieder die Augen. »Ich kann … Ich kann nicht dahin zurück. Was ist, wenn Die mich finden?«
»Wer sind ›die‹, Benedict?« Sie faltete das Blatt zusammen und schob es zur Seite. »Die Leute, die Ihnen das angetan haben?« Sie wies auf seinen Gips und die Blutergüsse. »Haben die nicht schon …«
»Nein – Die!« Er schaukelte noch heftiger vor und zurück, was dem Plastikstuhl ein gequältes Quieeek-whonng-quieeeek-whonng entlockte. »Die. Ich meine Die, Die im Schatten lauern und alles kontrollieren!«
Ah.
»Bekifft« erfasste es wohl noch nicht einmal annähernd.
Lucy ließ ihre Stimme so sanft wie nur irgend möglich klingen, als ob sie mit einem kleinen Kind redete, das mit dem Fuß in einem Eimer voller Glasscherben feststeckt. »Benedict, Sie müssen mir sagen, was Sie genommen haben, okay? Wissen Sie noch, wie viel es war?«
Er beugte sich vor, wobei sich sein Gesicht zu einer zähnefletschenden Grimasse verzerrte. Wahrscheinlich verbargen sich auch ein paar angeknackste Rippen unter seinem schmuddeligen Hoodie. »Die sind überall, und sie beobachten einen immer. Sie können alles sehen, was man macht, egal wohin man geht.«
»Haben die Ärzte Ihnen etwas gegen die Schmerzen gegeben? Haben Sie noch irgendwas anderes dazu genommen? Etwas von Ihrem eigenen Stoff?«
»Niemand ahnt etwas von ihnen, aber Die sind immer da. Immer.«
»Ich glaube, dass Sie Hilfe brauchen, Benedict.« Sie streckte wieder die Hand nach seinem Arm aus.
»WASGLAUBENSIE, WARUMICHHIERBIN?« Das eine blutunterlaufene Auge, weit aufgerissen und feucht von Tränen, starrte sie an, sein Gesicht lief rot an, wo es nicht von Blutergüssen verfärbt war, und kleine rosa Spucketröpfchen landeten zwischen ihnen auf der Tischplatte. Dann wich er zurück. »Tut mir leid. Tut mir leid. Die … Ich will nicht, dass Die …«
Sie versuchte es mit einem beschwichtigenden Lächeln. »Manchmal können Medikamente einen ein wenig paranoid machen, vor allem, wenn man sie mit Alkohol und beispielsweise Kokain mischt. Heroin? Temazepam?«
»Ich bin nicht auf Benzos, okay? Ich … versuche, Sie zu warnen. Die wollen nicht, dass ich irgendwem erzähle, was ich weiß.« Er begann jetzt etwas schneller zu reden, die Worte purzelten nur so ineinander. »Aber Die wissen, dass Sie im Gefängnis mit mir geredet haben. Ich wette, Die haben Ihre Masterarbeit gelesen. Ich wette, Die wissen alles über Sie.«
Vielleicht war es Zeit für ein Gespräch mit Benedicts Bewährungshelfer? Um ihm einen Platz in einem Rehabilitationsprogramm zu verschaffen. Falls es überhaupt noch welche gab nach den jüngsten Kürzungen im Sozialbereich.
»Haben Sie mit irgendjemanden über dieses Gefühl gesprochen, dass Sie …«
»HÖRENSIEMIRZU!« Und wieder flossen die Tränen. »Warum hört mir nie jemand zu?«
»Okay, okay.« Sie hob die Hände. »Warum interessieren ›Die‹ sich so für Sie? Helfen Sie mir, das zu verstehen.«
»Warum?« Er senkte die Stimme zu einem vernuschelten Flüstern. »Wegen dem, was damals passiert ist, als ich klein war. Wegen dem, was ich getan habe.« Eine schmutzige Fingerkuppe, die aus seinem Gips hervorschaute, landete auf dem zusammengefalteten Zeitungsartikel. »Sie wissen alles.«
Oder vielleicht hatte er ja ein Anstaltssyndrom entwickelt? Schließlich hatte Benedict sein halbes Leben hinter Gittern verbracht – er wäre nicht der Erste, der nach einer Haftstrafe mit dem Leben in Freiheit nicht zurechtkam. Vielleicht hatte sein Unterbewusstsein entschieden, dass es besser wäre, wenn er stattdessen wegen paranoider Wahnvorstellungen eingesperrt würde?
Und auch wenn es vielleicht ethisch fragwürdig war, seinen gegenwärtigen Zustand auszunutzen, war doch nach dieser Blutnacht vor sechzehn Jahren eine Frage nach wie vor offen.
Lucy verharrte vollkommen reglos. »Dann wissen Die also, mit wem Sie an jenem Abend zusammen waren? Wer der andere Junge auf dem Überwachungsvideo ist?«
»Natürlich wissen Die das! Wie könnte es anders sein? Sind Sie wahnsinnig?« Benedict warf sich auf seinem Stuhl herum, dass die Gummifüße kreischend über den grauen Terrazzoboden scharrten. Als ob er fürchtete, dass jemand hinter ihm stand. »Die wissen alles.«
»Ich könnte Ihnen besser helfen, wenn Sie mir sagen würden, wer Ihr Freund war, Benedict.« Sie versuchte, nicht den Atem anzuhalten, während das Schweigen sich hinzog.
Sein Mund stand offen. Wie ein lädierter Wasserspeier sah er aus, das Zahnfleisch blutig, wo sie ihm die Zähne rausgetreten hatten.
Na los, komm schon.
Sag mir einfach den Namen des anderen Jungen.
Du kannst das, Benedict.
Bitte …
Dann verengte sich Benedicts funktionsfähiges Auge, sein Mund klappte mit einem Klicken zu. Und er stand auf. Versuchte die Seite, die er aus der Zeitung herausgerissen hatte, mit den Fingerspitzen seines gebrochenen Arms aufzulesen. Schaffte es nicht. Und schob stattdessen seinen Gipsarm in die Tasche des Hoodies. »Ich muss los. Ich … Ja.«
»Es ist nur ein Name, Benedict, was kann es schon schaden nach all den Jahren?«
»Ich – muss – jetzt – los.«
Mist.
Lucy unterdrückte ein Seufzen. Sie nickte. »Können Sie mir wenigstens sagen, wer Sie zusammengeschlagen hat, damit wir denjenigen festnehmen können?«
»Ja. Nein. Niemand. Ich … Ich bin die Treppe runtergefallen.«
»Benedict, Sie müssen nicht …«
»ICHBINDIETREPPERUNTERGEFALLEN!« Dann zog er die Schultern ein und senkte den Kopf, wich ihrem Blick aus. »Kann ich jetzt gehen? Ich muss jetzt gehen.« Er klang eher wie ein verängstigter elfjähriger Junge und nicht wie ein Mann von siebenundzwanzig.
Wieder spielte er mit den Kordelenden seines Hoodies herum.
Zappelte herum.
Biss sich auf die Unterlippe.
Sein linkes Bein begann zu zittern, bis er mit dem Absatz einen ratternden Stakkato-Rhythmus auf dem Boden trommelte.
Sie hatte ihn verloren.
Lucy schob ihren Stuhl zurück. »Okay, Benedict, ich bringe Sie raus.«
Und dabei war sie so dicht dran gewesen …
Kaum war Benedict zum Haupteingang hinaus, da rannte er auch schon los. Nun ja, es war eher irgendetwas zwischen einem Humpeln und einem eiernden Traben, aber er bemühte sich jedenfalls, so schnell wie möglich möglichst viel Abstand zwischen sich und das Polizeipräsidium zu bringen.
Lucy stand da und schirmte ihre Augen mit einer Hand vor der Sonne ab, während sie ihm nachsah, bis er um die Ecke in die Camburn Road humpelte und verschwand.
Angesichts seines Zustands würde es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis er wieder entweder in einer Gewahrsamszelle oder im Krankenhaus landete. Man konnte nur hoffen, dass es nicht wegen einer Überdosis sein würde … Immerhin würde er sich mit seinem Gipsarm nicht so bald wieder einen Schuss setzen können. Es sei denn, er wäre in der Haft zum Beidhänder geworden.
Als sie sich umdrehte, um wieder hineinzugehen, stand da der Dunk, lässig an eine niedrige Betonmauer gelehnt, die Nase in der aktuellen Castle News & Post vergraben, eine glimmende Zigarette zwischen zwei vergilbten Fingern. Er blickte nicht auf von dem Artikel, in den er vertieft war. »Hier steht, dass Paul Rhynie Regierungsaufträge an Firmen vergeben hat, die Kumpels von ihm gehören. Keine Ausschreibungen, keine Strafklauseln, keine kritischen Fragen. Er ist der Wirtschaftsminister, verdammt noch mal – ist so was überhaupt legal?«
»Besorgen Sie einen Wagen. Ich muss noch telefonieren.«
»Millionen über Millionen von Steuergeldern verpulvert, die in den Taschen seiner Amigos gelandet sind.« Noch ein letzter Zug, dann schnippte er seine Kippe weg. »Da muss man doch allmählich glauben, dass wir hinter der falschen Sorte von Kriminellen her sind, nicht wahr?«
»Einen Wagen besorgen, Dunk. Organisieren, holen, herbringen.« Sie ging zurück durch den Empfangsbereich.
Der Dunk eilte ihr hinterher, während er über die Schulter in die Richtung schielte, in die Benedict Strachan verschwunden war. »Ihr neuer Freund scheint ja ganz … nett zu sein. Bloß sein Aftershave finde ich ein bisschen streng – Eau de Poubelle?«
»Und wenn Sie schon dabei sind: Ich brauche Kopien von sämtlichen Tatortberichten und Opferprofilen vom Bloodsmith-Fall.«
»Ich meine, mir ist schon klar, dass man es in Ihrem Alter auf dem Dating-Markt nicht so leicht hat, aber Sie können es sich doch wohl leisten, Ihre Ansprüche ein bisschen höherzuschrauben.«
»Auto und Berichte. Und zwar bis spätestens vorgestern.« Sie marschierte auf die Sicherheitstür zu, so schnell, dass der freche kleine Mistkerl wieder in Laufschritt fallen musste.
»Verstehen Sie mich nicht falsch, ich weiß, dass ihr Ladys es ab und zu gerne ein bisschen wild und schmutzig mögt, aber der Schmuddelknabe da war doch nicht gerade …«
»Wissen Sie was«, sie hielt inne, eine Hand auf dem Tastenfeld, »ich kann mir auch jederzeit einen anderen Partner besorgen, Dunk.«
»Kein Grund, gleich so verschnupft zu reagieren, Sarge.« Ein anzügliches Grinsen schlich sich in seine Züge. »Obwohl eine verstopfte Nase wahrscheinlich hilfreich ist, wenn einer so riecht wie Ihr neuer Freund.«
»Das ist mein Ernst. Mags ist wahrscheinlich frei, oder PC Gilbert. Sogar Urpeth würde es zur Not tun.« Lucy tippte den Code ein und zog die Tür auf. »Ich habe gehört, dass in DS Smiths Team noch ein Platz frei ist – Sie könnten in Zukunft für ihn arbeiten.«
Der Dunk wurde blass. »Ich bitte Sie, Sarge, man wird doch wohl noch einen Witz machen dürfen.« Er schauderte, als die Tür hinter ihnen zufiel. »So etwas Schreckliches darf man niemandem wünschen!« Er trabte neben ihr her den Flur entlang und ins Treppenhaus. »Also, wollen Sie mir jetzt verraten, wer Ihr stinkiger Loverboy ist, oder wollen Sie das Geheimnis für sich behalten, bis die Kirche gebucht ist?« Er begann den Hochzeitsmarsch aus Lohengrin zu trällern: »Dam-daa–da-daa, dam daa-da-daa …«
Lucy blieb auf dem ersten Treppenabsatz stehen. »Und dann dürfen Sie mir gleich noch alles raussuchen, was wir über Benedict Strachan haben.«
»Benedict Strachan?« Der Dunk zog das Kinn ein und die Augenbrauen zusammen. »Wieso wollen Sie …« Dann schien jemand hinter seinen Augen einen Lichtschalter zu betätigen. »Sie machen Witze! Das war Benedict Strachan? Der Benedict Strachan? Wow!« Er blickte die Treppe hinunter, als ob er durch die Wände des Präsidiums sehen könnte, wie ihr Besucher in die Ferne davonhumpelte. »Benedict Strachan. Leck mich!«
»Nicht rumstehen und glotzen. An die Arbeit. Los, Abmarsch!«
Ein leiser Pfiff. »Ich hätte gedacht, dass er in echt größer wäre.«
Zu nichts zu gebrauchen, der Kerl.
Lucy ging weiter die Treppe hinauf. »Sie arbeiten nicht, Dunk.«
»Und wieso kommt der Benedict Strachan Sie besuchen, und nur Sie, und es ist dringend, und er will mit niemandem sonst sprechen?«
Gute Frage.
Sie runzelte die Stirn, während sie die Stufen zum nächsten Stockwerk erklomm. »Das Thema meiner Masterarbeit war ›Wenn Kinder zu Mördern werden – Die Rolle von dissoziativen Persönlichkeitsstörungen bei nicht genetisch bedingten Psychopathien als Ursache von Tötungsdelikten Minderjähriger‹.«
»Einprägsamer Titel. Ich glaube, ich habe den Film gesehen.«
»Ich habe Benedict ein paarmal interviewt, während ich die Arbeit schrieb. Er hatte … Schwierigkeiten.« Eine ziemliche Untertreibung. »Können Sie sich vorstellen, wie es ist, im Gefängnis aufzuwachsen? Mit elf Jahren hinter Gittern, und dann durch das System durchgereicht, bis man alt genug ist, um mit all den anderen Mördern eingesperrt zu werden.«
»Ah, verstehe.« Der Dunk nickte. »Also, weil Sie ein kleines bisschen nett zu ihm waren, nachdem er bis dahin nichts als Brutalität und Angst erlebt hatte, ist er jetzt auf Sie fixiert. Sie sind seine gute Samariterin. Sein allerbester Buddy. Seine Vertraute. Seine Busenfreundin. Seine …«
»Los, ab ins Archiv mit Ihnen. Und dann besorgen Sie uns einen Wagen.«
Der Dunk zog ein Gesicht. »Sarge.« Er drehte sich um und trottete wieder die Stufen hinunter.
Sie lehnte sich übers Geländer und hob die Stimme, um ihm nachzurufen: »Und schauen Sie, dass es diesmal ein anständiges Auto ist, und nicht so ein fahrender Abfalleimer voller Dreck und Fastfood-Verpackungen. Eins, das in den letzten drei Jahren mal gereinigt worden ist!«
So.
Und jetzt zu diesem Anruf.
3
»Also, eins versteh ich nicht ganz.« Der Dunk steuerte ihren beinahe sauberen Poolwagen durch den Logansferry-Kreisverkehr und auf den Robinson Drive. »Wenn Sie Ihre Masterarbeit über Benedict Strachan geschrieben haben, wieso haben Sie dann nie seine Akte gelesen?«
Draußen wurden die Industriegebäude auf der linken Seite von Reihen über Reihen von Bungalows abgelöst, hinter denen schon wieder das nächste Gewerbegebiet hochgezogen wurde. Die Häuser hatten vielleicht mal ganz einladend ausgesehen, als sie neu waren, aber die schätzungsweise sieben Jahrzehnte hatten ihre Spuren an den flechtenbewachsenen Dachpfannen und den schmutzverschmierten Fassaden hinterlassen.
»Hmmm?« Lucy blätterte zur nächsten Seite um – eine Aussage des Bäckereifahrers, der Liam Hays Leiche gefunden hatte, versteckt in einer Seitengasse der Brokemere Street, wo er mit dem Gesicht nach unten lag, teilweise mit Pappkarton zugedeckt, vor dem Seiteneingang eines versifften kleinen Ladens namens »ANGUSMACBARGAIN’S FAMILYSTORE«.
»Und sollten wir nicht eigentlich einen Durchbruch im Bloodsmith-Fall erzielen?« Rechts ab in die Morrissey Street, wo statt der Bungalows dicht gepackte zweigeschossige Reihenhäuschen die Straße säumten. Ein Seufzer. »Wobei wir auch davon noch weit entfernt sind.«
»Ich habe meine Masterarbeit geschrieben, bevor ich zur Polizei gegangen bin, Dunk – da waren die offiziellen Akten tabu für mich. Ich musste mit dem arbeiten, was öffentlich zugänglich war. Und natürlich mit dem, was Benedict mir erzählt hat.«
Die nächste Seite zeigte ein Foto von Liam Hay, wie er in der Gasse auf dem Rücken lag, nachdem die Sanitäter den Tod festgestellt hatten. Dürfte ihnen nicht schwergefallen sein.
Der Tatortfotograf hatte die Leiche in all ihrer blutigen Pracht eingefangen. Liams fleckige Cordjacke war an mindestens zwei Dutzend Stellen durchlöchert, das Futter aus synthetischem Lammfell dunkelrot verfärbt. Sein Fleecepulli, das schwarze Hemd und das braune T-Shirt waren hochgezogen, sodass man die bläuliche Bauchhaut sehen konnte, auch sie mit Blut verschmiert. Der Schnitt quer durch seine Kehle war so tief, dass man in den blutigen Fleischfetzen hier und da Knochen aufblitzen sah. Ein Gesicht mit eingefallenen Wangen, umrahmt von einem Flickenteppich angegrauter Bartstoppeln. Die aufgerissenen Augen starrten auf einen Punkt über der Schulter des Fotografen. Die Baseballkappe war ihm vom Kopf gerollt.
Armes Schwein.
Lucy ließ einen langgezogenen, rasselnden Atemzug entweichen.
Was Benedict Strachan und sein unbekannter Komplize Liam Hay angetan hatten, war mit »wütende Attacke« nicht einmal annähernd angemessen beschrieben. Das nächste Foto war sogar noch schlimmer – eine Nahaufnahme der Stichwunden. Insgesamt neunundachtzig, die meisten davon so tief, dass ein Abdruck des Hefts auf der Haut zurückgeblieben war.
Sie drehte das Foto um, sodass sie das grausame Bild nicht länger ansehen musste. »Wobei man nicht den Fehler machen darf, Benedicts Aussagen für bare Münze zu nehmen.«
Der Dunk brummte nur. An der Kreuzung mit der North Moncuir Road hielt er an, um zwei Kleinwagen mit aufgemotzten Auspuffen vorbeizulassen. »Es wundert mich ehrlich gesagt, dass niemand ihn im Gefängnis abgestochen hat. Wer so einen berüchtigten Insassen abmurkst, steigt normalerweise gewaltig in der Achtung seiner Mitgefangenen und wird in der rechten Presse gefeiert. Für einen Lebenslänglichen eine Win-win-Situation.«