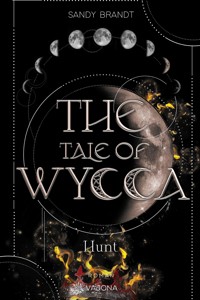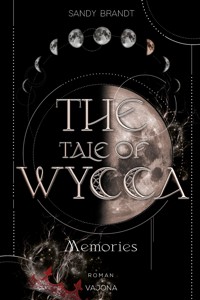4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vajona Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
*Früher hätte sich die Menschheit durch ihre Lügen fast ausgerottet – die Überlebenden haben geschworen, dass es nie wieder so weit kommt. Heute erscheint jedes gesprochene Wort narbenähnlich auf der Haut. Die Elite herrscht stumm, während die sprechende Bevölkerung als Abschaum gilt.* Olive und Kyle kommen aus zwei verschiedenen Welten. Die achtzehnjährige Olive lebt in einer Welt, die von absoluter Stille und Reinheit geprägt ist. Selbst unter der stummen Oberschicht gilt sie als Juwel. Kyle dagegen trägt tausende Wörter auf der Haut und ein gefährliches Geheimnis im Herzen. Als sie gemeinsam entführt werden, sind sie überzeugt, der andere sei der Feind. Sie ahnen nicht, dass dunklere Intrigen gesponnen werden. Olive will ihr Schweigen wahren, um nicht der geglaubten Sünde zu verfallen. Und Kyle weiß, dass es für ihn tödlich enden wird, wenn das stumme Mädchen hinter sein Geheimnis kommt. Beide müssen entscheiden, welchen Preis sie für ihre Freiheit zahlen wollen – und ob sie einander vertrauen können …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sandy Brandt
DAS BRENNEN DER STILLE
Goldenes Schweigen
(Band 1)
ROMAN
VAJONA
Dieser Artikel ist auch als Taschenbuch erschienen.
DAS BRENNEN DER STILLE – Goldenes Schweigen
Copyright
© 2022 VAJONA Verlag
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Lektorat und Korrektorat: Larissa Eliasch
Umschlaggestaltung: Julia Gröchel,
unter Verwendung von Motiven von Pexels und Rawpixel
Satz: VAJONA Verlag, Oelsnitz
ISBN: 9783757991425
VAJONA Verlag Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3
08606 Oelsnitz
www.vajona.de
Für alle Bibliophile da draußen – wir wissen, dass jedes Wort zählt.
Die Freunde
Wenn du in einer Kutsche gefahren kämst
Und ich trüge eines Bauern Rock
Und wir träfen uns eines Tags so auf der Straße
Würdest du aussteigen und dich verbeugen.
Und wenn du Wasser verkauftest
Und ich käme spazieren geritten auf einem Pferd
Und wir träfen uns eines Tags so auf der Straße
Würde ich absteigen vor dir.
- Bertolt Brecht
Um zu überleben, musst du schweigen – oder für dein Recht auf Freiheit kämpfen.
Jedes Wort bleibt für immer als Narbe. Jedes Wort ist eine unauslöschliche Sünde.
Eine Hitzewelle hat Nordamerika in eine lebensfeindliche Wüste verwandelt. Nur wenige Städte wurden wieder aufgebaut: Über sie herrscht die Elite stumm, während die sprechende Bevölkerung als Abschaum gilt.
Wirst du gemeinsam mit den Schweigenden Tudor vor den Lügen und dem Zerfall der Menschheit beschützen?
Oder schließt du dich den Rebellen an, um gegen die Elite in den Kampf zu ziehen, die jeden vernichtet, der ihren Glauben nicht teilt?
Trau dich und öffne die nächsten Seiten, um vollends der Macht in Tudor zu verfallen.
Auf welcher Seite stehst du?
Kapitel 1
Nach einiger Zeit bemerkte Gott, dass die Menschen ihre eigenen Worte nicht mehr achteten. Sie benutzten sie ungeachtet aller Konsequenzen, verletzten ihren Nächsten und belogen ihre eigenen Familien. Da beschloss Gott, dass es an der Zeit war, den Menschen zu bestrafen.
Von nun an erschien jedes gesagte Wort unwiderruflich auf der Haut der Menschen, um sie daran zu erinnern, ihre Worte mit Bedacht zu wählen. Diejenigen, die trotz dessen logen, wurden mit der ewigen Sichtbarkeit dieser Lüge als unauslöschliche Sünde bestraft.
Ehrliche Worte dienten den Menschen als Zierde. Doch mit der Zeit brüsteten sie sich damit, achteten nicht mehr das einzelne Wort, bis jedes die Bedeutung verlor. Und so wurde das Schweigen zum einzigen Weg, seine Makellosigkeit vor Gott zu wahren.
Aus: Das Heilige Wort.
Kapitel 1: DieSchöpfungsgeschichte des Menschen.
Olive
Wenn niemand ein Wort sagt, gilt die Verhandlung heute als gelungen.
Bis jetzt unterlief keinem von uns ein Fehler. Die Köchin, die Mutter extra für diesen Abend engagiert hat, servierte die Gänge in einem Abstand von zwölf Minuten. Die Musik, die Vater schon drei Tage vorher ausgesucht hat, plätschert in genau der richtigen Lautstärke vor sich hin. Draußen streicht der Wind über die Wüste und die seit Stunden gleichklingende Pianomusik vermischt sich mit dem Klang des Wüstensandes, der gegen die Fensterscheiben prasselt.
Wenn ich mich konzentriere, höre ich die einzelnen Sandkörner, die in wilder Choreografie auf das Glas treffen. Es klingt wie ein Flüstern, ein gewisperter Lockruf, der in den Ohren kitzelt und meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich stelle mir vor, wie ich das Fenster öffne und der Wind durchs Esszimmer peitscht, mein Kleid anhebt und über meine Haut fährt – als würde er mir Leben einhauchen.
Mein Vater stellt seine Teetasse aufs Service und das Klingen des Porzellans reißt mich aus meinen Gedanken. Mit klopfendem Herzen greife ich nach meiner eigenen Tasse. Der Tee darin bebt leicht und ich gebe mir Mühe, meine Hand stillzuhalten.
Mit aller Willenskraft zwinge ich mich zu lächeln, ohne Zähne zu zeigen, sobald unsere Gäste in meine Richtung sehen.
Nicht, dass das häufig geschieht. Als Mr und Mrs Seymour mit ihrem Sohn unser Haus betraten, musterten sie mich kurz. Ihr Blick glitt von meinem Gesicht zu meinen Schultern und Armen – die dank des schulterfreien Kleides nackt waren – und schlängelte sich an meinen Beinen hinab, sodass ich eine Gänsehaut bekam.
Sie sahen zufrieden aus. Kein einziges Wort prangt auf den sichtbaren Teilen meines Körpers. Genauso, wie meine Eltern es ihnen vor etwa zwei Jahren versprochen hatten, als die Ehe zwischen mir und ihrem Sohn vereinbart wurde.
Das war das einzige Mal, dass Mrs und Mr Seymour mich richtig angesehen haben. Mr Seymour hatte ein Lächeln aufgesetzt, das er so selbstverständlich anlegt wie seine Schuhe, wenn er das Haus verlässt. Es war das gleiche Lächeln, das er auch trägt, wenn er in der Kirche die Hände hebt, um den Gottesdienst einzuleiten oder wenn Fotos von ihm in der Zeitung abgedruckt sind.
Ob er schon immer so lächelte? Oder brachte es ihm jemand bei, als er zum Presider ernannt wurde? Ich kann es nicht sagen. Seit ich denken kann, ist Graham Seymour Herrscher von Tudor. Früher fiel mir jedoch nie auf, wie die Mimik um seine grünen Augen herum erstarrt, obwohl er lächelt.
Isolde Seymour spart sich das Lächeln gänzlich. Vielleicht muss man nicht freundlich aussehen, wenn man die Frau des Presiders ist; oder sie weiß, dass ihre feinen Gesichtszüge ohne Regung besser zur Geltung kommen. Als die Primera zur Begrüßung meine Hand schüttelte, weiteten sich ihre Augen nur für eine Sekunde vor ungewollter Anerkennung meiner reinen Haut.
Am Esstisch studiert Mrs Seymour mit zusammengekniffenen Augen die Ölgemälde und Urkunden an den Wänden oder beäugt das Teeservice. Alle paar Minuten streift mich ihr Blick, tastet meine Schultern, meine Arme ab, auf der Suche nach Wörtern, die nicht da sind. Als sie einen winzigen Sprung in ihrer Teetasse entdeckt, verzieht sich ihr Mund. Jetzt lächelt sie mich doch an: Ihre Lippen sind zusammengekniffen, während ihr Mundwinkel zuckt. Bedauernd legt sie den Kopf schräg, als wäre der Sprung in dem Porzellan mein persönlicher Makel.
Graham Seymours Lächeln hingegen schwankt nicht einmal, während er seine Suppe löffelt. Er lässt meinen Eltern ein anerkennendes Nicken zukommen, als sein Blick über mich hinweggleitet.
Ich fühle mich wie ein Klavier, das elegant in der Ecke steht, aber auf dem niemand spielen kann.
Ihr Sohn Raphael sieht mich gar nicht an. Nicht einmal beim Händeschütteln in der Diele. Beim Eintreten richtete er den Blick auf den Boden, als hätte er etwas verloren. Seine hellbraunen Locken sind so streng zurückgekämmt, dass meine Kopfhaut bei dem Anblick schmerzt.
Während des Essens bemühe ich mich, ihn ebenfalls nicht anzustarren, aber es ist, als wären meine Augen ein Kompass und Raphael der Norden. So als wüssten sie Bescheid, dass dies der Mann ist, den ich in Zukunft jeden Morgen und jeden Abend vor dem Schlafengehen zu Gesicht bekommen werde. Ob er die Haare immer so streng zurückkämmt?
Selbst während ich die Zucchinisuppe löffle, sehe ich heimlich auf, um einen Blick zu erhaschen. Ich traue mich nicht, zu beurteilen, ob er attraktiv aussieht. Die Presse schreibt, er sehe aus, als sei er den Aufgaben eines zukünftigen Presiders – das Oberhaupt der Stadt Tudor – gewachsen. Immer wieder schreiben sie von seinen wachsamen grünen Augen – was auch immer das heißen mag. Seitdem er am Tisch sitzt, starrt er die meiste Zeit auf seinen Teller, sodass ich nicht sagen kann, ob es der Wahrheit entspricht. Was soll das überhaupt heißen – wachsame Augen? Raphael wirkt abwesend und ich bezweifle, dass er mitbekommen würde, wenn ein wildes Tier auf den Tisch springt. Ich verkneife mir ein Lachen und sehe schnell wieder auf meine Suppe.
Meine Eltern sagen, Raphael sei ein stattlicher junger Mann. Die Bediensteten in unserem Haus dagegen flüstern nur, er habe eine große Nase.
Letzteres stimmt auf jeden Fall. Schnell senke ich den Blick. Es nützt mir nichts, über sein Äußeres nachzudenken. Nur die reine Haut zählt und dass ich in einer Woche seine Ehefrau sein werde. Er könnte aussehen wie eine Hyäne, es würde keine Rolle spielen.
Denkt er, ich sehe aus wie eine Hyäne? Auch das wäre egal, denn er hat genauso wenig darüber zu bestimmen, wen er heiratet, wie ich. Trotzdem wurmt mich der Gedanke und ich lasse die Suppe vom Löffel zurück in die Schüssel tröpfeln.
Raphaels Vater, Graham Seymour, winkt den Sprecher zu sich, den meine Mutter extra für unsere Gäste gebucht hat. Der Mann tritt sofort an den Tisch und nimmt den Schreibblock entgegen, den Mr Seymour in den letzten fünf Minuten gefüllt hat. Am rechten unteren Rand der Blätter ist die Tudor-Rose eingestanzt. Natürlich hängt auch in unserem Wohnzimmer das Stadtwappen, aber ich hege den Verdacht, dass Graham Seymour selbst seine Unterhosen mit der rot-weißen Rose bestickt.
Hitze steigt mir ins Gesicht und ich stütze den Kopf auf den Händen ab, um die roten Flecken zu verbergen, die mit Sicherheit auf meinen Wangen prangen. Meine Mutter wirft mir einen warnenden Blick zu. Schnell falte ich die Hände auf dem Schoß und sehe zum Sprecher, der sich noch immer Graham Seymours Worte durchliest.
Mit der Technik, die noch vor der großen Hitze existiert hatte, wäre unser Leben sicher einfacher. Doch die Hitze hat den größten Teil der Technologie ebenso zerstört wie die Menschen, die das Wissen darüber in ihren Köpfen trugen.
Im Gegensatz zu der Haut aller Anwesenden am Tisch ist die des Sprechers mit Wörtern übersät. Die Narben heben sich vom dunklen Teint seiner Haut ab wie Blitze vom Nachthimmel. Auch meine Eltern tragen ein paar Wörter. Auf ihrer hellen Haut hingegen stechen sie nicht sofort ins Auge. Dasselbe gilt für Raphaels Eltern, bei denen ich schon zu Beginn vereinzelte Narben auf den Unterarmen sah.
Raphael selbst trägt einige Wörter auf seinem Rücken – nicht, dass ich den gesehen hätte, das ist jedoch allgemein bekannt – und sogar welche auf den Beinen. Ich erinnere mich, dass in einem Zeitungsartikel stand, die Wörter stammen aus der Zeit, als Raphael in die Pubertät kam. Der Artikel hatte eine Diskussion ausgelöst: Der Prior der Kirchen, Pharrell Bosworth, hatte dafür plädiert, Kindern ab zehn Jahren das Sprechen zu verbieten, damit sie sich nicht durch Unwissenheit die Haut ruinierten. Ärzte hatten jedoch dagegen gestimmt. Man könne nicht vorhersehen, wann das erste Wort als Narbe bleibe, und es wäre ungesund für die geistige Entwicklung, so früh das Sprechen einzuschränken. Mein Vater nahm das zum Anlass für eine neue Geschäftsidee. Der Trank, der kurzzeitig die Stimmbänder lähmt, kam für seine eigene Tochter jedoch zu spät auf den Markt, sodass er trotz der Warnungen auf Bosworths Methode zurückgriff.
Mit einem hohlen Gefühl in der Brust starre ich auf meine nackten Beine. Ich sollte dankbar dafür sein, dass mein Vater solche radikalen Maßnahmen anwandte. Nur aus diesem Grund sitzen wir heute hier. Dennoch ballt sich eine Faust in meinem Magen zusammen.
Der Sprecher räuspert sich, um die Worte auf dem Notizblock vorzutragen.
»Mr Seymour denkt, dass die Hochzeit mit einem Spaziergang des Bräutigams und der Braut auf dem großen Marktplatz in Hever enden sollte. Die sechs Prioren werden ebenfalls anwesend sein. Somit stellen wir die größtmögliche Aufmerksamkeit sicher.«
Die Stimme des Sprechers klingt geübt emotionslos. Er hat keine eigene Meinung; er ist das Sprachrohr von Mr Seymour, zumindest für den heutigen Abend.
Dagegen spannt sich mein gesamter Körper an und ich schiebe die Suppenschüssel endgültig von mir weg. Wann war ich das letzte Mal im Stadtviertel Hever? Es muss Jahre her sein. Alles, woran ich mich erinnern kann, sind enge Gassen und der Geruch nach faulem Obst. Dabei ist Hever nicht einmal das ärmste Viertel Tudors.
Mein Vater scheint meine Nervosität nicht zu bemerken, obwohl er direkt neben mir sitzt. Er nickt und nimmt seinen eigenen Schreibblock zur Hand. Dann winkt er den zweiten Sprecher zu sich.
»Jeder soll sehen, wie glücklich sie sind«, liest der Sprecher die Worte meines Vaters vor, »und wie rein. Niemand darf an diesem Tag daran erinnert werden, dass es draußen Ungeziefer gibt, das am Glauben zweifelt.« Der Mund des Sprechers verzieht sich am Ende zu einer Grimasse. Wir anderen zucken zusammen. Niemand wird gerne an die Ungläubigen erinnert. Die Erwähnung derer, die darauf aus sind, unsere Lebensweise zu vernichten, indem sie Tudor terrorisieren, wirkt wie eine kalte Dusche für mich. Das Bild eines zerbombten Gebäudes vermischt sich in meinen Gedanken mit einem ohrenbetäubenden Schrei und dem Knall einer zugeschlagenen Autotür.
Die Erinnerung krallt sich mit scharfen Nägeln in mein Innerstes. Ich presse die Fäuste unterm Tisch zusammen und konzentriere mich auf dieses neue Gefühl, das heiß in meinen Adern lodert und von den Bildern in meinem Kopf befeuert wird.
Raphaels und meine Hochzeit wird ein Symbol dessen sein, was wir versprochen haben, zu schützen: ein Leben ohne Lügen. Kein Mädchen aus Tudor hat eine so reine Haut wie ich. Nur ein einziges Wort prangt auf meinem Rücken; dort, wo es niemand sieht. Raphael wird mich heiraten, und wenn sein Vater abdankt, wird er der Presider und somit Herrscher der Stadt und ich werde die Primera an seiner Seite sein.
Mutter und Vater lächeln zufrieden. Vielleicht denken sie dasselbe wie ich. Nichts macht sie glücklicher als die blendende Zukunft ihrer einzigen Tochter.
Ich sehe Raphael an und in diesem Moment hebt er ebenfalls den Kopf und unsere Blicke treffen sich. Er hat wirklich grüne Augen. Ein wohliges Gefühl breitet sich in mir aus, als hätte sein Blick warmes Wasser in meiner Brust ausgegossen. Ich will ihm zulächeln, ihm zu verstehen geben, dass ich der Meinung unserer Eltern bin. Gemeinsam können wir es schaffen, Tudor durch unsichere Zeiten zu führen. Doch ehe ich auch nur einen Mundwinkel heben kann, sieht Raphael schon wieder weg. Das warme Gefühl in meinem Inneren schwindet und wird durch eine Leere ersetzt, in der mein Herzschlag als hohles Echo widerhallt.
Das wird meine Zukunft: in Stille und Frieden, im Einklang mit dem Heiligen Wort.
Kapitel 2
Heute gelang es uns, die St. Henry’s Church zu erobern und die dort tagenden kirchlichen Anführer als Geiseln zu nehmen. Die Geiselnahme dauerte höchstens dreißig Minuten, dann stürmte die Rosenwache das Gebäude und eröffnete das Feuer. Xav, Gyllan, Freddy und Martha wurden getroffen. Wir neun anderen schafften es im letzten Moment, zu flüchten.
Wir haben sie begraben, auf dem Friedhof in Nonsuch. Die stummen Fische – diese selbst ernannten Aristokraten – haben die Kreuze bereits in der folgenden Nacht abgerissen, doch sie werden die Geiselnahme nicht verschweigen können.
Der nächste Schlag wird folgen, lauter als je zuvor. Wir brauchen die Aufmerksamkeit. Irgendwann werden sich immer mehr Menschen unserer Sache anschließen. Gemeinsam werden wir den stummen Fischen zeigen, was ihre Unterdrückung anrichtet.
Dann stoßen wir sie nieder und reißen sie in Stücke. Ich kann es kaum erwarten. Der 2. September 313 wird in die Geschichte eingehen.
Gezeichnet: Jefferson,
Tagebuch eines Rebellen
Kyle
Nichts ist verlässlicher als Eisen. Immer wieder tauche ich das Hufeisen in kaltes Wasser und genieße das Geräusch, das es von sich gibt. Bei dem leisen Zischen bekomme ich eine Gänsehaut. Ich lege das Hufeisen zu den drei anderen auf die Werkbank und lasse mich auf dem Stuhl daneben nieder. Schweiß rinnt über meine Stirn und ich wische ihn schnell mit dem Handrücken ab, bevor er mir ins Auge läuft.
Alle meine Arbeiten liegen ausgebreitet vor mir und warten darauf, verkauft zu werden. Von oben aus dem Wohnbereich ertönt Utahs Fluchen und ich rolle mit den Augen. Wahrscheinlich hat er wieder mal etwas fallengelassen. Seine schweren Schritte lassen die Holzdecke über mir beben; ich kann ihn fast vor mir sehen, wie er grummelnd über die Dielen poltert, und muss lächeln. Das Fluchen meines Meisters ist wie ein bekanntes Lied, das zum Hintergrund meiner Arbeit gehört. Ebenso wie das Klingeln der Glocke, das soeben einen Kunden ankündigt. Beim Aufstehen streiche ich mir die Eisenspäne von der Kleidung, ehe ich zur Tür gehe.
»Ich komme!«
Meister Utah verzieht jedes Mal die Mundwinkel, wenn die Kunden in die Arbeitsräume spazieren. Die Ungeduldigen führt es oft hierher, wenn nicht schnell genug jemand im vorderen Lagerraum erscheint, der als Verkaufsfläche fungiert.
»Kein Stress, ich bin’s nur.«
Lonnys Stimme. Er besucht mich so häufig bei der Arbeit, dass sein sommersprossiges Gesicht ebenso zum Inventar gehört, wie der Wetzstein in der Ecke.
»Na dann ist ja – gut.« Ich verschlucke mich fast an dem letzten Wort, als ich in den Verkaufsraum komme. Denn dort steht nicht nur Lonny. Gleich hinter ihm füllt Masons gewaltige Statur den ganzen Türrahmen aus, sodass ich unweigerlich einen Schritt zurücktrete.
Wie selbstverständlich betritt Mason mein Zuhause und mit ihm dringt staubige, trockene Wüstenluft in den kühlen Raum. Masons Schulter streift das Regal mit meinen Werkzeugen und anstatt mich zu beachten, nimmt er ein Messer – eine meiner besten Arbeiten – in die Hand. Seine Finger hinterlassen schweißfeuchte Abdrücke auf dem Griff, als er es prüfend von einer Hand zur anderen reicht und so vor sein Gesicht hält, als hätte er Ahnung davon.
Ich bleibe im Durchgang zum Verkaufsraum stehen und wippe auf den Fußballen hin und her. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Niemand zwingt mich, vor Mason zu kuschen, so wie Lonny um ihn herumwuselt. Ich bin kein Teil seines Gefolges. Er ist nicht mein Anführer.
Ich strecke den Rücken durch, um gegen das unangenehme Gefühl anzukämpfen, das mich in Masons Gegenwart überkommt. So als wäre ich ein kleines Kind. Mit zusammengepressten Lippen balle ich die Hände zu Fäusten. Ich dachte, ich hätte mich die letzten Male klar ausgedrückt.
Bevor ich meinem Ärger Luft machen kann, hebt Mason den Blick vom Messer und sieht mich an. »Kyle«, sagt er und sogleich erscheint mein Name in kratzigen, blutigen Buchstaben auf seinem Hals, als würde ein unsichtbarer Tintenhalter die Worte dort eingravieren. In wenigen Stunden wird die blutige Schrift zu einer hellen Narbe verblassen und diese bleibt wie ein geisterhafter Kuss ewig auf der Haut. »Schön, dich wiederzusehen.«
Masons Stimme ist ein durchdringender Bass, der den Körper in Schwingungen versetzt und mich dazu drängt, zu rennen, zu schreien oder etwas zu zerreißen. Aber nur, wenn ich sie draußen auf dem Platz höre. In meinem kleinen Zuhause klingt Masons Stimme einfach nur zu laut und ich werde daran erinnert, dass er hier nichts verloren hat.
»Kann ich nicht behaupten«, erwidere ich. »Warum muss ich das gleiche Gespräch jede Woche wieder führen, Mason?« Ebenso wie mein Name steht jetzt seiner auf meiner Haut, zusammen mit den anderen Worten. Ich spüre das kleine Kratzen an meinem unteren Rücken und verkneife mir ein Grinsen: Was er sagt, geht mir wortwörtlich am Arsch vorbei.
Ich starre zu Lonny und will seinen Blick einfangen, doch er sieht mich nicht an. Seine Schuhe scheinen ihn zu faszinieren, denn sein Blick bleibt daran kleben.
Mason legt das Messer zurück aufs Regal – aufs falsche, wohlgemerkt – und macht einen Schritt auf mich zu. Er bewegt sich langsam, als sei ich ein wildes Tier und er hätte Angst, dass ich weglaufe. Mason streckt die Hände aus, mit den Handflächen nach oben, wie zum Beweis, dass er unbewaffnet ist. »Lonny meinte, dass wir dich vielleicht noch überzeugen können.«
Wieder sehe ich Lonny an. Würde man das Gift aus meinen Gedanken extrahieren und ins Meer kippen, würden die Fische schnell mit dem Bauch nach oben schwimmen. Aber Lonny bemerkt das gar nicht. Er fährt sich mit der Hand durch die roten Haare und sieht sich die Decke an, als wäre sie ein Kunstwerk.
»Hier ist viel zu tun.« Ich deute mit einem Kopfnicken zur Werkstatt. »Also wenn ihr nichts anderes wollt, dann …« Ich sehe demonstrativ zur Tür. Wenn Mason nicht verschwindet, schmeiße ich ihn höchstpersönlich raus.
Lonny macht einen Schritt zurück, Mason hingegen bleibt mitten im Raum stehen. Ich verstehe, weshalb die Leute ihn zum Anführer dieser selbsternannten Rebellion gewählt haben. Mit dem gemeißelten Gesichtsausdruck und den breiten Schultern nimmt er den ganzen Raum ein, wie ich es noch bei keiner anderen Person erlebt habe. Mason hat Lonny mit diesem Auftreten eingefangen und ihn dazu gebracht, jedes Wort sofort in einen Befehl umzuwandeln.
Ich bin kein Fan von Befehlen.
»Die Rebellion wird stärker, Kyle«, fährt Mason fort und bei seiner Stimme denke ich an aufziehende Gewitterwolken. »Die Bewohner Tudors werden unruhig. Wir schaffen eine neue Welt, ohne die Kirche. Menschen in Machtpositionen, die sich nicht vom Heiligen Wort einschränken lassen – stell es dir nur einmal vor! Der Angriff auf die Kirche war ein Erfolg. Wer jetzt auf unserer Seite steht, wird auch siegen, wenn wir die stummen Fische gestürzt haben. Hilf uns dabei.«
»Da sind keine Seiten – zumindest nicht für mich.« Ich kratze mich demonstrativ hinterm Ohr, sodass mein Ärmel hinunterrutscht und Mason meinen vollgeschriebenen Unterarm zu sehen bekommt. »Das, was ihr als Erfolg bezeichnet, nenne ich Mord. Zumal das Ganze schon fast zwei Jahre her ist, und seitdem hat sich nicht das Geringste getan. Ich arbeite und lebe hier. Und daran wird sich auch nichts ändern, wenn ihr die stummen Fische da oben stürzt. Mir ist es scheißegal.«
Mason nickt, macht jedoch keine Anstalten, zu verschwinden. Er fährt sich durch seinen braunen Dreitagebart und sieht sich im Raum um. »Dir geht’s gut, das sehe ich. Ich frag mich nur, was passiert, wenn sie deinem Ziehvater die Schmiede wegnehmen?«
»Halt Utah da verdammt noch mal raus!« Hitze klettert meine Wirbelsäule hoch. Gleichzeitig zieht ein unangenehmes Kratzen über meine Stirn bis zur Schläfe, als die Wörter dort eingeritzt werden. Im Gesicht spüre ich die winzigen Schnitte intensiver als überall sonst.
Mason hebt abwehrend die Hände. »Gib mir nicht die Schuld.« Seine grauen Augen weiten sich. »Du weißt selbst, wie dicht ihr an der Grenze zu Whitehall liegt. Was, wenn jemand von den stummen Fischen beschließt, hierherzukommen, weil sein Pferd lahmt? Dann sieht er dieses nette Schimpfwort da oben auf deiner Stirn.«
Automatisch taste ich mit meinen Fingern nach den Wörtern, die gerade dort erschienen sind. Die stummen Fische reagieren auf Flüche noch abwertender als auf alles andere.
»Ganz genau«, sagt Mason und beißt sich auf die Unterlippe. »Und dann beschließt der stumme Fisch, dass die Schmiede jemanden mit reiner Haut gehören sollte. Denkst du, Utah oder du habt eine Chance, euch dagegen zu wehren? Wird sich jemand für Kyle Otega einsetzen, weil er so ein netter Kerl ist?«
Ich stelle mir vor, was passieren würde, wenn Utah die Schmiede verliert. Nicht nur das Geschäft – das gesamte Gebäude, unser Zuhause. Erneut vertrieben, nachdem ich mich in den letzten Jahren zum ersten Mal seit Langem wieder sicher gefühlt habe. Mason nickt, als könnte er meine Gedanken lesen.
Mein Körper versteift sich. Unwillkürlich werde ich an die Geschichten über Sirenen erinnert, die Seemänner mit ihrem Gesang hypnotisieren, bis ihre Schiffe an Felsen zertrümmern. Nur dass Mason nicht singt – seine Worte sind Waffen, von denen er ganz genau weiß, wie er sie einsetzen muss. Wenn er spricht, lässt er die Menschen glauben, seine Worte entsprächen den eigenen. Beinahe hätte er mich eingelullt und ich wäre gegen den Felsen gedonnert.
»Das ist Ruyas und deine Geschichte«, sage ich abwehrend. »Nicht meine.«
Masons graue Augen verdunkeln sich, als ich seine verstorbene Frau erwähne. Sein Kiefer zuckt. »Geschichten wiederholen sich.«
»So wie diese hier?« Erschöpft hole ich Luft. »Hör zu. Was damals mit Ruya passiert ist, tut mir leid. Sie hätte nicht sterben dürfen. Aber einen Krieg anzuzetteln, weil du glaubst, dass es kein Unfall war …«
»So wie mit deiner Mutter?«
Masons Worte treffen mich wie spitze Pfeile in der Brust und setzen ein Feuer in meinem Körper frei. »Lass meine Mutter da raus!« Mein Ruf zerreißt die Luft zwischen uns. Für einen Moment herrscht Stille.
»Kyle?« Utahs besorgte Stimme dringt von oben zu uns. »Alles in Ordnung?«
Ich schließe die Augen, um den roten Schleier zu verbannen, der sich auf meine Sicht gelegt hat. »Schon gut!«, rufe ich zurück. Utah hat genug Ärger. Er soll sich nicht auch noch um meinen Mist kümmern müssen.
Mit geschlossenen Augen atme ich tief ein und schmecke Metall auf der Zunge. Meine Fäuste zittern. Einatmen. Ausatmen. »Ruya wurde von der Rosenwache ermordet«, sagt Mason.
Ich kneife die Augen fester zusammen. Sieht er nicht, dass ich kurz davor bin, ihm eine zu verpassen, wenn er nicht die Klappe hält? Vielleicht legt er es auch drauf an.
»Deine Mutter wurde ermordet.«
Der Schmerz seiner Worte zerreißt meine Konzentration. Meine Muskeln spannen sich an.
»Ermordet, weil …«
»Lass gut sein, Mason.« Lonnys Stimme wirkt wie ein Dämpfer.
Ich öffne die Augen und atme aus.
Lonny nickt mir zu. »Tut uns leid, Alter.« Unter seinen Sommersprossen wirkt er blass. Er sieht zu Mason. Obwohl er fast ebenso groß ist und der Altersunterschied der beiden nur ein paar Jahre beträgt, wirkt er deutlich jünger.
Vielleicht, weil der Schmerz auf Masons Gesicht Jahre braucht, um sich auf solche Weise abzuzeichnen.
Er richtet seine grauen Augen auf mich und das Glühen darin lässt nach. »Ich war der Meinung, wir kennen uns lange genug für die Wahrheit.«
Meine Selbstbeherrschung spannt sich wie ein dünnes Gummiband über einen Abgrund voll Zorn. »Verschwindet. Sofort.«
Mason sieht mich einen Moment lang an, ehe er nickt. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob er verstanden hat. Mit Lonnys Hilfe steht er morgen wieder vor meiner Tür. Doch fürs Erste scheint es zu reichen, denn er tritt den Rückzug an.
Lonny zieht den Kopf ein und dackelt ihm hinterher. »Mach’s gut«, murmelt er beim Rausgehen.
»Ich würde dasselbe sagen«, rufe ich ihm hinterher, »aber ihr wollt ja immer gleich alles besser machen!«
Lonny lässt die Tür offenstehen, sodass der Wüstensand, der jede Falte der Stadt ausfüllt, hineingeweht wird. Das werde ich später alles wieder ausfegen müssen. Ich schmecke den Sand bereits auf der Zunge und verziehe den Mund. Meine Finger kribbeln und ich presse die Fäuste aneinander, um nicht gegen die Wand zu schlagen – sie trägt schon genug Spuren vergangener Wutausbrüche. Aber das Kribbeln lässt nicht nach. Meine Schritte poltern über den Holzboden und ich knalle die Tür zu.
Kapitel 3
Forscher kamen zu der Erkenntnis, dass sich die Wörter auf der Haut nicht allein durch Wissenschaft erklären lassen. Zwar handelt es sich um echte Verletzungen, die der Haut zugefügt werden, doch woher die millimetertiefen Einritzungen stammen, kann nicht mit letzter Gültigkeit bewiesen werden.
Gottes Wille ist hierauf die Antwort. Es ist Gottes Fluch und Segen zugleich, dass die Wörter irgendwann verblassen. Sie erscheinen nicht mehr blutrot, allerdings bleibt eine feine Narbe zurück, die an das Gesagte erinnert.
Seit über dreihundert Jahren straft Gott die Menschen mit der Sichtbarkeit ihrer Sünden. Von einer vorübergehenden Erscheinung auszugehen, wäre also naiv.
Zu Beginn noch war es ausschließlich die Lüge, die mit Verachtung gestraft wurde. Da sich im Laufe eines Lebens jedoch zu viele Worte ansammelten, um eine Lüge ausfindig zu machen, zog man die einzig praktikable Konsequenz: Es ist nur noch den Leuten zu trauen, die gar nicht sprechen und deshalb frei von Worten und Lügen sind.
Aus: Die Reinheit des Menschen.
Kapitel 2, Abschnitt: Warum Sprechen wehtut.
Olive
Die Absätze meiner Schuhe klackern auf dem Marmorboden. Mein Vater hält meinen Unterarm fest und führt mich das Mittelschiff der Kirche entlang, vorbei an den festlich gekleideten Gästen, die aufstehen, als ich sie passiere. Durch die Buntglasfenster hinter dem Altar wirft das Sonnenlicht grüne, rote und blaue Punkte auf den Gang vor mir. Alles leuchtet in Regenbogenfarben und ein Teil von mir weiß, dass alle Frauen Tudors davon träumen.
Ein anderer Teil von mir kann nur daran denken, dass die buntesten Tiere der Wüste immer die giftigsten sind.
Meine Atmung ist flach und als sich Raphael am Altar zu uns umdreht, stolpere ich leicht, ehe mein Vater seinen Griff verstärkt und mich aufrechthält.
Raphael trägt einen schwarzen Anzug und darunter eine cremefarbene Weste, bestickt mit der Tudor-Rose. Als er mich sieht, strafft er die Schultern und ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Erleichtert stelle ich fest, dass es ein ganz anderes Lächeln ist als das seines Vaters.
Die Presse hat recht, denke ich, er sieht wirklich aus wie der geborene Herrscher. Als ich Raphael erreiche und mein letzter Schritt verklingt, bin ich mir sicher, jeder kann mein Herz hören, das gegen meinen Brustkorb hämmert, als wolle es ausbrechen.
Mein Vater legt meine Hand in die von Raphael. Eine angenehme Wärme geht von seiner Haut aus und anstatt mich gleich wieder loszulassen, drückt er meine Hand kurz. Ich bin zu überrascht, um den Händedruck zu erwidern.
Unsere Blicke treffen sich – seine grünen Augen leuchten und aus der Nähe kann ich die Sommersprossen auf seiner Nase sehen, die überhaupt nicht zu seinen zurückgekämmten Haaren und den Worten zukünftiger Presider passen. Das beruhigt mich. Raphael atmet tief ein und seine Schultern straffen sich, als müsse er sich wappnen.
Der Priester beginnt zu sprechen und ich zucke zusammen. Die Kirche ist einer der wenigen Orte, an dem ich die Stimmen anderer Menschen höre, aber dabei komme ich den Priestern nie so nahe wie jetzt. Ich kann meinen Blick nicht von seiner mit Narben bedeckten Haut abwenden. Narben, die weiß wie der Mond am Nachthimmel schimmern.
Zu den Gelegenheiten, bei denen wir Sprecher im Haus haben, halten sie einen gebührenden Abstand. Es ist ewig her, dass ich jemandem so nahe war, bei dem man nicht erkennen kann, wo ein Wort endet und das andere beginnt. Damals habe ich nicht darauf geachtet, wie dicht ich den Menschen komme – ich bin einfach gerannt, angetrieben von dem heißen Wunsch, so viel Entfernung zwischen mich und meine Eltern zu bringen, wie nur möglich.
Ich verbanne den Gedanken. Das ist Vergangenheit. Dies hier wird meine Zukunft.
Zudem ist es unsinnig, Abstand zwischen mich und den Priester bringen zu wollen. Jeder einzelne Buchstabe auf seiner Haut stammt aus dem Heiligen Wort, der Schrift unseres Glaubens. Diejenigen, die sich für den Beruf des Priesters entscheiden, legen ein Gelübde ab: Sie dürfen kein Wort sprechen, das nicht in der Glaubensschrift steht. Selbst unser Ehegelöbnis entspringt eins zu eins dem Heiligen Wort, lediglich ergänzt durch unsere Namen. Das Gelübde der Priester ist jedoch reine Formsache. Niemand, der an das Heilige Wort glaubt, würde freiwillig sprechen.
Trotzdem kribbelt meine Haut, während ich vor dem Mann stehe. Gebannt beobachte ich, wie jedes Wort hellrot auf seiner Haut erscheint, sobald er es ausspricht.
Alle Blicke sind auf mich gerichtet und meine Muskeln vibrieren vor Aufregung. Niemand soll denken, dass ich nervös bin, weshalb ich die Hände vor dem Oberkörper verschränke und die Fingernägel in meine Haut bohre, bis der Schmerz so stark wird, dass ich mich darauf konzentrieren kann. Raphael neben mir hat sich gänzlich dem Priester zugewandt. Im Gegensatz zu mir zittert er nicht.
Ich spüre die Blicke der Gäste auf meinem Rücken. Nur vier von ihnen wissen, dass die Spitze dort – kunstvoll zur Tudor-Rose drapiert, so wie alles an diesem Tag – das einzige Wort auf meinem Körper verdeckt. Bei dem Gedanken daran kribbelt mein Körper und ich schaue über die Schulter.
Graham Seymour zieht die Augenbrauen hoch, als ich seinem Blick begegne. Sofort werden meine Wangen heiß und ich schaue wieder zum Priester. Ob Mr Seymour daran denkt, dass in einem besseren Leben nicht ich hier stehen würde, sondern ein anderes Mädchen? Oder ist es ihm egal, solange seine Schwiegertochter eine reine Haut besitzt?
Meine Knie zittern und der Gedanke droht jegliche Selbstbeherrschung in mir zu benebeln.
Erneut werfe ich einen Blick über meine Schulter, dieses Mal jedoch zu meinen Eltern. Meine Mutter lächelt mir aufmunternd zu und in den Augen meines Vaters glitzern sogar Tränen. Wacklig lächle ich zurück und straffe die Schultern. Keine Fehler, rede ich mir ein. Ich darf keine Fehler machen.
Die Worte des Priesters, die jetzt lauter werden und die gesamte Kirche erfüllen, zerren mich aus meinen Gedanken und ich sehe rechtzeitig zu Raphael, der sich zweimal räuspert.
»Ja, ich will«, krächzt er schließlich.
Meine Augen suchen die sichtbaren Flächen seines Körpers ab, ich entdecke jedoch nichts. Die Worte müssen vom Anzug verdeckt sein.
Der Priester wendet sich an mich. »Olive Sophia Carey, nimmst du Raphael Seymour zu deinem rechtmäßigen Ehemann und beherzigst mit ihm die Lehren des Heiligen Wortes, auf dass eure Körper immer rein von Lügen und Sünden bleiben?«
Das ist der Moment, in dem ich besonders darauf achten muss, keinen Fehler zu begehen. Die einzigen Worte, die rechtmäßig auf meiner Haut stehen dürfen, die niemand verurteilen kann, weil sie direkt aus dem Heiligen Wort stammen, gesandt von Gott. Ich spüre die Blicke meiner Eltern auf meinem Rücken. Sie halten mich hier in diesem Moment gefangen, fesseln mich an diesen Boden und bringen mich dazu, die entscheidenden Worte auszusprechen: »Ja, ich will.«
Sofort spüre ich ein leichtes Brennen auf meinem linken Zeigefinger und balle die Hand zur Faust. Als ich sehe, wie Raphael auf meine Hand starrt, kriecht Hitze meine Wirbelsäule hinauf. Warum sind seine Worte versteckt, während meine sichtbar auf der Hand leuchten? Die Hitze brennt in meinem Körper. Um das Gefühl zu unterdrücken, beiße ich mir auf die Wange.
Ein Räuspern hinter mir reißt mich aus meinen Gedanken. Ich sehe aus dem Augenwinkel, wie mein Vater das rechte Bein über das linke schlägt und versucht, eine bequeme Position auf der schlichten Holzbank zu finden. Sein Räuspern – die Erinnerungen an die Gegenwart meiner Eltern – legt sich wie eine Löschdecke auf meine Wut und erstickt sie sogleich. Es sind heilige Worte. Außerdem kann Raphael nichts dafür – er kann nicht bestimmen, wo die Wörter auf seiner Haut erscheinen, genauso wenig wie ich. So etwas geschieht willkürlich, das weiß jeder.
Raphael nimmt meine Hand in seine – sie ist ganz nass vom Schweiß – und wir drehen uns zur Menge, die schweigend aufsteht, um uns ihren Respekt zu zollen. Doch sie kümmern mich nicht. Ich sehe sofort zu meinen Eltern: Sie stehen vor ihrer Bank, die Hände ordentlich zusammengefaltet, mit einem Lächeln im Gesicht. Mehr brauche ich nicht als Bestätigung, das Richtige getan zu haben.
Raphael führt mich hinaus auf den großen Platz vor der Kirche, von wo aus wir unseren Gang durch die Stadt beginnen. Um die Absperrungen herum stehen weitere Bewohner Tudors, um uns zu empfangen.
Die Hitze schlägt mir wie ein Kissen ins Gesicht. Die dicken Steinmauern der Kirche haben die Wärme der Sonnenstrahlen gedämpft, hier auf dem Platz hingegen sind wir ihnen ausgeliefert. Der Kirchplatz wurde heute Morgen mit Sicherheit gefegt, trotzdem hat der Wüstensand einen Weg um die Häuser gefunden und knirscht unter den Absätzen meiner Schuhe. Ich muss aufpassen, auf dem Sand nicht auszurutschen. Niemals hätte ich mir solch hohe Stilettos ausgesucht, doch die Schuhe standen bereits fest, bevor mein Name auf die Hochzeitseinladungen gedruckt wurde. Bei dem Gedanken wird mir leicht schwindelig und ich schaue mich zur Ablenkung schnell um.
Die Menschen auf dem Platz durften nicht mit in die Kirche, da nur die hochrangigen Bewohner der Stadt eingeladen worden waren. Die Menge, die sich jetzt hier versammelt hat, gehört eindeutig nicht dazu. Ihre Leinenhosen und -oberteile entblößen nackte Haut, die in den meisten Fällen voller Narben und Wörter ist. Sie stehen so eng gedrängt, dass ich sehen kann, wie ihre verschwitzte Haut aneinanderklebt, und ein Schauer überkommt mich. Ich kann erst freier atmen, als ich das Absperrseil entdecke, das uns voneinander trennt.
In der Ferne, hinter den flachen Sandsteinhäusern, flimmern die roten Berge der Wüste. Ich stelle mir vor, wie ich über den Berg renne, weg von der Menschenmasse um mich herum. Eine Sekunde lang höre ich nur meinen Herzschlag, der von Sonnenuntergängen erzählt, die nicht durch Häuser verdeckt werden. Von unendlicher Weite, die nicht von Mauern begrenzt wird. Von ungepflasterten Wegen, auf denen kaum ein Mensch zuvor lief.
Raphael drückt meine Hand und die Geräusche um mich herum kehren zurück. Der Atem der Menschenmenge vermischt sich wie zu einem einzelnen gigantischen Biest und rollt über den Platz.
Mit einem Ruck an meinem Arm zieht Raphael mich zur Mitte des Kirchplatzes, sodass uns jeder ansehen kann, bevor wir gemeinsam mit den Rosenwächtern der Stadt unseren Rundgang über den Marktplatz in Hever starten.
Die Blicke der Menge haften an mir wie Insekten an Zuckersirup und ich spüre, wie sie meine Haut förmlich abtasten. Gleichzeitig muss ich beim Anblick ihrer mit Worten übersäten Körper an die vielen Male denken, an denen sie die Kontrolle über sich verloren haben und unbedacht sprachen. Ein Kloß bildet sich in meinem Hals. Wenn diese Menschen schon nicht kontrollieren können, was sie sagen, was unterscheidet sie dann noch von Tieren?
Zeitungsartikel kommen mir in den Sinn, in denen von Geiselnahmen, Gewalt und Terror geschrieben wurde. Ich beiße mir auf die Innenseite meiner Wange, trete einen Schritt zurück und schaue über die Schulter.
Die St. Henry’s Church baut sich palastartig hinter uns auf. Nachdem das alte Gebäude durch eine Explosion vor zwei Jahren zerstört wurde, hat man die Ruine abgerissen und einen neuen Kirchturm errichtet. Anders als zuvor besteht diese Kirche nicht aus dem Sandstein, der das Stadtbild Tudors prägt, sondern aus grauen Backsteinen. Einige ausgeblichene Buntglasfenster wurden durch grelle Mosaikmuster ersetzt. Nun wirkt die Kirche auf mich wie ein Fremdkörper.
Der Gedanke stimmt mich traurig. Die Explosion und alles, was damit zusammenhängt, hätte nicht geschehen dürfen. Wenn ich mit meiner Hochzeit dafür sorgen kann, dass diese Taten ein Ende haben, dann ertrage ich das aufgesetzte Grinsen Graham Seymours freudig für den Rest meines Lebens.
Aus der Kirche strömen Verwandte, Bekannte und Regierungsmitarbeiter. Ihre Schritte und das Schnaufen und Rascheln der Menge vor uns sind die einzigen Geräusche. Kein Auto fährt heute in der Stadt, denn jeder, der sich eines leisten kann, ist in diesem Moment in der Kirche hinter mir versammelt. Keiner der anderen Menschen würde es wagen, in unserer Gegenwart zu sprechen, auch wenn sie es zu Hause vielleicht tun.
Während ich darauf warte, dass meine Eltern die Kirche verlassen, werden die Geräusche um mich herum lauter. Die Härchen an meinen Armen stellen sich auf. Ich suche in der Menge nach der Gefahr, die mein Körper registriert hat, bevor mein Verstand richtig arbeitet. Zunächst entdecke ich nichts, doch dann begegne ich dem Blick einer Frau, die sich gegen das Absperrseil presst, das ihre Hände umklammern. Die Menschen drängen immer dichter, ihr Schnaufen wird lauter, die Schritte dunkler. Ihre Füße suchen Halt auf dem Sandboden, während sie weiter nach vorne geschoben werden. Dreck wirbelt durch die Luft und lässt mich alles wie durch einen Schleier sehen. Die Stimmung hat sich gewandelt. Elektrisiert, wie vor einem Gewitter. Die Spannung kribbelt auf meiner Haut.
Als ich meine Lippen ablecke, schmecke ich Sand.
Die Menschen fangen an zu brüllen.
Ich weiß, dass es Orte in der Stadt gibt, an denen Lärm alltäglich herrscht. Sie sind unrein und in ihnen wird das Heilige Wort mit Füßen getreten. Aber diese Teile der Stadt habe ich seit Jahren nicht mehr betreten. Bei der Erinnerung juckt die Narbe auf meinem Rücken, als wäre das Wort dort gerade erst entstanden.
Das Brüllen schwillt an und wird zu einem Kreischen. Hilfesuchend sehe ich zu Raphael. Sein Gesicht ist blass und seine grünen Augen zucken hin und her. Er zieht mich zurück zur Kirche, aus der unsere Familien und hohe Würdenträger strömen. Die Rosenwache als Sicherheitspersonal wurde direkt vor der Kirche positioniert, damit nur auserlesene Gäste das Gebäude betreten. Doch genau diese Gäste verhindern nun, dass die Wachen zu Raphael und mir durchdringen können.
In der Menge kann ich Raphaels Vater erkennen, der sich einen Weg zu uns bahnt. Hinter ihm folgt mein eigener Vater. Graham Seymours Lächeln ist verschwunden. Stattdessen ist sein Mund verzerrt, während er die Menschen zur Seite schiebt. Die Augen meines Vaters sind weit aufgerissen.
Uns trennen nur wenige Schritte von ihnen – gut zwanzig Fuß von Wüstensand bedeckte Fläche, die noch niemand betreten hat.
Sie kommen, um uns zu retten.
Doch zu spät.
Die Menschenmenge hat die Absperrseile niedergetrampelt. Eine kleine Frau mit vollgeschriebenen Armen schlängelt sich durch die aneinandergedrängten Körper und rennt in die Kirche.
Das ist verboten, hallt es in meinem Kopf.
Ein breitschultriger Mann hat die Frau auch erblickt und eilt ihr nach. An der Tudor-Rose auf seinem weißen Hemd erkenne ihn als ein Mitglied der Rosenwache.
Ich hätte wissen müssen, dass nicht ich die oberste Priorität der Rosenwache bin, sondern die Kirche und der Presider. Enttäuschung quetscht meine Lunge zusammen.
Ein kräftiger Mann stößt mich zur Seite. Ich lande auf dem Boden und scheuere mir die Handgelenke auf. Füße trampeln neben meinem Kopf. Über mir steht ein Kerl, dessen Waden voll mit Wörtern bedeckt sind. Kleine Steine bohren sich in meine Knie. Mein Herz donnert wie verrückt und Blut pocht in meinen Ohren. Raphael kann ich nirgends entdecken.
Das Brüllen wird unerträglich. Um mich herum herrscht eine Welle aus Wut, die an mir zerrt. Ich muss aufstehen – sie werden mich niedertrampeln. Ich greife nach dem Erstbesten, was ich finden kann, um mich daran hochzuziehen.
Ein Arm, bemerke ich einen Moment später. Auf jedem Millimeter prangen Narben verblasster Wörter, sodass ich keinen Fleck reine Haut erkennen kann. Vor Schreck lasse ich los und falle rückwärts in die Menge, die mich umzingelt.
Die Menschen drängen sich an mich und ich japse nach Luft. Raphael ist verschwunden. Ich greife nach dem Rucksack einer Frau, um wieder auf die Beine zu kommen. Das Meer von Menschen raubt mir jegliche Orientierung. Vor mir zerren zwei Mädchen an der Goldkette einer Frau im blassblauen Kleid. Einer meiner Hochzeitsgäste. Übelkeit steigt in mir auf. Ehe ich der Frau helfen kann, werden die drei von einer Gruppe Männern zur Seite geworfen, die sich mit verzerrten Mienen einen Weg mit den Ellenbogen freikämpfen.
»Reißt die Kirche nieder!«, brüllt einer von ihnen. Weitere schließen sich seinem Ruf an.
Wenn diese Männer zur Kirche wollen, weiß ich, wohin mich mein Weg führt: in die entgegengesetzte Richtung. Ich ziehe den Kopf ein und drängle mich durch die Menge. Sie schubst mich hin und her und immer wieder komme ich vom Kurs ab.
In meiner Panik nehme ich einzelne Bilder wie aus einem Albtraum wahr: Ein Mann mit kahl rasiertem Kopf reißt den Mund zu einem Schrei auf. Eine Frau mit einer blutbedeckten Gesichtshälfte. Sie muss gestürzt sein. Meine Gedanken sind von Adrenalin getränkt; sie rasen wie Blitze hin und her und lassen sich nicht greifen. Ich weiß nur, dass ich meine Eltern finden muss. Sie werden mir sagen, was ich zu tun habe. Sie werden mir helfen.
Jemand tritt auf den Saum meines Kleides und trotz des Lärms höre ich, wie es reißt. Ich nehme es als Startsignal, loszurennen. Mit den Ellenbogen kämpfe ich mir einen Weg durch die Menschen, doch immer wieder tritt jemand auf mein Kleid und hält mich auf.
Eine Hand packt mich an der Schulter. Die Hitze, die von der fremden Haut ausgeht, frisst sich durch meinen ganzen Körper. Ich werfe mich in die entgegengesetzte Richtung, um mich loszureißen, doch eine große, schwielige Hand greift nach meinem Arm und zerrt mich zurück. Weiß schimmernde Narben kreuzen sich auf jedem Fleckchen Haut.
Mir wird übel.
Der Mann umklammert mich, hebt mich hoch und wirft mich über seine Schulter, den Blick nach vorne gerichtet, sodass ich sein Gesicht nicht sehe.
Ich kann nichts tun, außer zu strampeln und um mich zu schlagen, aber das ist sinnlos. Er läuft durch die Menge und trägt mich mit sich.
Ich kann nicht einmal um Hilfe rufen.
Kapitel 4
Sie nennen uns Terroristen.
Das ist die offizielle Bezeichnung der stummen Fische für uns und es steht überall in den Zeitungen.
Wenn sie auch nichts vom gesprochenen Wort verstehen – in geschriebener Propaganda sind sie offensichtlich geübt. Wir können nicht zulassen, dass sie uns auf diese Weise in der Öffentlichkeit darstellen.
Unser nächster Schritt muss sein, ihre Überheblichkeit zu schwächen. Olek ist aufgebracht; er glaubt nicht, dass eine weitere Aktion wie die Sache mit der Kirche irgendetwas bewirken wird.
Die anderen brachten ihn mit der Erinnerung an unsere Toten zum Schweigen.
Ohne Gewalt werden wir untergehen und niemals etwas erreichen.
Ich weiß nicht, auf wessen Seite ich mich stellen soll. Bisher waren Olek und ich immer derselben Meinung.
Hat er recht, wenn er behauptet, dieser Weg würde in einer Sackgasse enden? Unser Ziel, Aufmerksamkeit zu erregen, hat funktioniert. Doch zu welchem Preis?
Gezeichnet: Jefferson,
Tagebuch eines Rebellen
Kyle
Begeistert bin ich nicht, als Lonny nach einigen Tagen wieder bei mir auftaucht und mich um Entschuldigung bittet. Er bleibt jedoch mein einzig echter Freund und Schmollen ist reine Zeitverschwendung.
»Außerdem«, sagt er und klopft mir auf die Schulter, »muss ich dir noch etwas zeigen. Ich weiß doch, wie du auf diesen Zaun mit den Rosen aus Eisen abgefahren bist. Das Tor, das ich entdeckt habe, stellt dieses Unkraut zehnmal in den Schatten. Sowas hast du noch nicht gesehen.«
Seine Worte lösen etwas in mir aus: ein leichtes Stechen in der Magengegend. Ich bin der beste Schmied in Tudor. Widerwillig lasse ich mich von Lonny nach draußen ziehen. Auch, wenn ich ihm verziehen habe, kann er ruhig arbeiten. Er grinst begeistert, als wir durch die Straßen laufen, auf dem Weg zu dem sagenumwobenen Tor.
»Eine Meisterarbeit«, schwärmt Lonny und drückt seinem gespitzten Daumen und Zeigefinger einen Kuss auf.
Ich rolle mit den Augen. Er hat es tatsächlich geschafft, mich wegen eines lächerlichen neuen Tors von der Arbeit abzuhalten. Aber meine Neugierde drängt mich weiter und ich bleibe ihm dicht auf den Fersen. Neugierde oder Hochmut?, flüstert eine Stimme in meinem Kopf, die stark nach Utah klingt. Ich schüttle sie schnell ab.
»Guck lieber nach vorne.« Ich deute mit dem Kinn in seine Richtung, während er rückwärts vor mir herläuft.
Lonny schnaubt. »Ich kann am Knirschen des Sandes unter meinen Füßen erkennen, durch welche Straße ich gehe.« Er stolpert zum Beweis gleich einmal über einen losen Stein. »Zufall«, behauptet Lonny, dreht sich aber trotzdem um.
Die Sonne steht direkt über uns und die Häuser in dieser Gegend sind zu niedrig, um Schatten zu spenden. Ich wische mir mit der Schulter den Schweiß von der Stirn, denn an meiner Hand klebt der Wüstensand. »Wie weit ist es noch?«
»Wir müssen einen Umweg gehen. Wegen der Hochzeit.«
»Ich pfeif auf die Hochzeit«, sage ich mehr zu mir selbst als zu Lonny, der nun zehn Schritte vor mir läuft.
»Sag doch sowas nicht!« Lonnys Tonfall ist gespielt empört. »Die ganze Stadt flippt aus. Vorhin hab‘ ich erst gehört, dass Justine ihre Hochzeit jetzt auch auf den 5. August legen will – nächstes Jahr dann.«
Ich spucke den Wüstensand. »Als ob es nichts Wichtigeres gibt als zwei stumme Fische, die sich in einer langweiligen Zeremonie aneinanderketten und den Rest ihres abgestumpften Lebens miteinander verbringen.«
Lonny wirft mir einen Kussmund über die Schulter zu. »Du kleiner Romantiker. Wusstest du, dass ihr Daddy Zacharias Carey ist?«
»Nicht du auch noch«, stöhne ich. »Reicht es nicht, wenn die gesamte Stadt darüber spricht? Gibt es kein anderes Thema?«
»Alle tun so, als wäre er ein Held«, fährt Lonny ungehindert fort, als hätte ich gar nichts gesagt. »Uuuh, er hat einen Trank erfunden, der es den stummen Fischen ermöglicht, jahrelang nicht zu sprechen und trotzdem die Stimmbänder nicht zu zerstören – warum spricht niemand über meine Erfindung?« Ich schnaube. »Du meinst hoffentlich nicht deine Eiscreme-Soße.«
»Eiscreme-Soße zum Fast Food.« Lonny lehnt sich kurz mit der Schulter gegen eine Häuserwand und grinst mir zu, ehe er um die Ecke verschwindet. Ich beeile mich, ihm zu folgen, und höre gerade noch, wie er sagt: »Und jetzt ist noch ein neuer Trank auf dem Markt, der soll die Stimmbänder lähmen – krank, oder?«
Ich denke wieder an Masons Worte und an das, was er erreichen will. Eine Trennung von Kirche und Regierung. Kein Wunder, dass Mason sich ein solches Machtverhältnis wünscht. Seine Herkunft verhindert, dass er jemals von den stummen Fischen als ebenbürtig angesehen wird. Wer wie wir in Nonsuch, dem ärmsten Viertel in Tudor, aufwächst, hatte nie die Chance, eine reine Haut zu behalten. Es gibt keine Gelegenheit, an eine Position zu gelangen, auf der man etwas bewirken könnte. Diese sind den Gläubigen aus den Stadtvierteln Whitehall und Hampton Court vorbehalten.
Jemand wie Mason, der die bewundernden Blicke anderer wie Wasser in der Kehle braucht, kann das nicht hinnehmen. Für ihn muss es immer mehr sein, immer höher und immer besser.
»Nun komm!«, ruft Lonny mir über die Schulter zu und verschwindet hinter der nächsten Ecke. Mit seinen langen Beinen ist er fast doppelt so schnell wie ich. »Wir sind gleich da.«
Ich folge ihm und schüttle im Vorbeigehen den Kopf über ein Banner mit der Tudor-Rose, das aus einem der Fenster hängt. So dreckig es in den Straßen Nonsuchs auch sein mag – wenigstens wird man nicht überall mit diesem weiß-roten Unkraut bombardiert. Ein Rufen, das direkt hinter den nächsten Häusern hervorschallt, erregt meine Aufmerksamkeit. Die Häuserreihe versperrt die Sicht, aber hinter den Dächern erspähe ich den Kirchturm. Eine Demonstration ihrer Erhabenheit, der Neubau der St. Henry’s Church mit seinem alles überragenden Turm und den bunten Mosaikfenstern, die sich vom braunen Einerlei der Stadt so dermaßen auffällig abheben, dass ich jedes Mal bei ihrem Anblick den Kopf schütteln muss. Einfach nur widerlich.
Aber nicht die Kirche fesselt meine Aufmerksamkeit – viel eher das Rufen, das nicht nur ein Rufen ist. In den Straßen von Nonsuch ist Krawall und Geschrei keine Seltenheit. Doch direkt am Platz vor der St. Henry’s Church? Von dort hört man nie auch nur ein Furzen.
»Was glaubst du, ist da los?«, frage ich Lonny, als ich um die Ecke biege.
Doch anstelle einer Antwort bekomme ich etwas Hartes gegen meinen Kopf geschlagen. Schwarze Punkte erscheinen vor meinen Augen, bedecken den Boden, der immer näherkommt, bis ich plötzlich einen stechenden Schmerz fühle, der von meinem Hinterkopf ausgeht und sich im ganzen Körper ausbreitet.
Dann herrscht wieder Stille.
Als ich aufwache, knirscht Dreck zwischen meinen Zähnen. Ich liege mit dem Gesicht flach auf dem Boden und beim Versuch, mich aufzusetzen, erfasst mich Schwindel.
Jemand hat mir etwas auf den Kopf geschlagen. Hoffent- lich haben sie nicht auch Lonny erwischt.
Vorsichtig untersuche ich im Liegen meinen Hinterkopf und ertaste blutverkrustete Haare dort, wo der Schmerz am stärksten pocht.
Die Ellenbogen auf den Boden gestemmt, schaffe ich es gerade so, mich hinzusetzen, und selbst dann muss ich mich an die Wand hinter mir lehnen. Nackte Betonwände umgeben mich und formen einen länglichen Raum, der weiter hinten eine Abzweigung nach links macht. Sand und Dreck bedecken den Boden. Alles hier zeugt von Leerstand, bis auf eine summende Leuchtstoffröhre über mir, die den Raum in ein gelbliches Licht taucht.
»So eine Scheiße.« Ich spucke neben mich, um den Dreck aus meinem Mund loszuwerden.
Ein Geräusch am anderen Ende des Raumes, hinter der Kurve, erregt meine Aufmerksamkeit. Ich will aufstehen, um wenigstens fluchtbereit zu sein, aber sobald ich mich in die Höhe stemme, fühlt es sich an, als würde mir jemand ein Brett vor den Kopf schlagen.
Einen Moment lang stehe ich schwankend da, dann stütze ich mich mit den Händen an der Betonwand ab und schiebe mich an ihr entlang, um hinter die Ecke sehen zu können. Meine Füße hinterlassen eine Spur im Dreck.
Nach ein paar Schritten erkenne ich, dass kein Grund zur Panik besteht. An der Wand sitzt kein Zwei-Meter-Typ mit Baseballschläger, der mich erneut k. o. schlagen will – da sitzt ein Mädchen.
Sie hat sich zusammengekauert, die Knie dicht an den Körper gezogen und die Arme um sie geschlungen. Ihr Kopf ist gesenkt, sodass ich ihr Gesicht nicht erkennen kann.
Ein paar Strähnen blonder Locken haben sich aus einer Hochsteckfrisur gelöst.
Sie wirkt so fehl am Platz, dass ich an eine Fata Morgana denken muss. Doch sie ist real.
»Hey!«, rufe ich. Ich bin noch gute zehn Schritte von ihr entfernt und habe keine Kraft mehr, weiterzugehen. Meine Stimme hallt von den Wänden zurück. »Alles in Ordnung mit dir?«
Anstatt zu antworten, zuckt sie zusammen und drängt sich dichter an die Wand, als hoffe sie, darin zu verschwinden. Ihre Hände krallen sich in den sandigen Boden. Erst da wird mir bewusst, was sie trägt. Kein gewöhnliches Kleid, sondern ein zerrissenes, vor Dreck strotzendes Brautkleid. Ich bin mir sicher, es liegt nicht an dem schummrigen Licht, dass ich keine Wörter auf ihren Armen erkennen kann.
Vor mir sitzt kein armes Mädchen, das wie ich niedergeschlagen und verschleppt wurde. Die reine Haut und das Brautkleid … Lonnys Worte klingeln in meinem Kopf. Die ganze Stadt redet über sie.
Das ist Olive Carey, das Mädchen, das den Erben geheiratet hat.
Mein Körper spannt sich an und das Klingeln in meinem Kopf nimmt zu.
Sie haben es herausgefunden.
Die Regierung weiß über meine Fähigkeit Bescheid und sie haben mich entführt, um irgendwelche Experimente an mir durchzuführen. So wie es meine Mutter seit meiner Kindheit befürchtet hat.
Wut legt sich wie ein Mantel um meinen Brustkorb und drückt ihn zusammen. Mal sehen, ob meine Fähigkeit noch funktioniert, wenn sie meinen leblosen Körper untersuchen. Niemals würde ich etwas anderes zulassen. Meine Finger krallen sich in die Steinwand. Ich schaue zu dem Mädchen. Sie hat noch immer den Kopf auf die Knie gesenkt und zittert.
Wenn es die stummen Fische waren, die mich verschleppt haben, welche Rolle spielt dann Olive Carey in diesem Plan? Die Priorin der Justiz würde sie nicht einsperren. Nicht, nachdem sie gerade den Sohn des Presiders geheiratet hat. Er steht über den sechs Prioren – sie können nicht gegen seinen Willen handeln. Über alles, was in Tudor geschieht, wird der Presider informiert. Das Mädchen muss hier sein, um mich auf deren Befehl hin zu bewachen.
Der Gedanke ist dennoch absurd. Utah hat ein Faible für Tratsch und legt außerdem im Verkaufsraum gerne Zeitungen aus, damit die Kunden beschäftigt sind, während sie warten. Von den Titelseiten starrte mich Olive Careys Gesicht in letzter Zeit oft an. Selbst auf diesen Bildern war zu erkennen, wie schmächtig sie ist. Sie hätte keine Chance gegen mich. Die Arbeit in der Schmiede hat sich bezahlt gemacht und aus Erfahrung weiß ich, dass ich die meisten Kämpfe gewinnen kann. Außerdem scheint das Mädchen eine Heidenangst vor mir zu haben. Das sollte mir Mut machen, aber stattdessen verwirrt es mich. Bin ich in einen Hinterhalt geraten?
Ich wage es nicht, meinen Blick von ihr zu nehmen, während ich mich weiter an der Wand entlangschleppe, um etwas mehr Klarheit zu erlangen. Als ich um die Ecke biege, verlässt mich das letzte Quäntchen Kraft – ich rutsche mit den Händen ab und stoße hart mit der Schulter gegen die Wand. Der Schmerz zieht bis in meinen Nacken.
Das Mädchen sieht zum ersten Mal auf. Ihre Augen weiten sich, als sie mich nur wenige Schritte von sich entfernt sieht. Sie krabbelt auf die andere Seite, um meinen Weg nicht zu kreuzen, doch das wäre gar nicht nötig. Ich müsste nicht weitergehen, um zu erkennen, dass es keinen Zweck hat, einen Fluchtweg zu suchen.
Anstelle einer Tür mündet der Raum hinter der Einbiegung in Gitterstäben, die oben in der Betondecke verankert sind und unten im Boden verschwinden. In der Mitte ist ein Tor eingelassen, um das sich eine dicke Kette mit einem Schloss windet. Hinter den Gitterstäben führt ein breiter, langer Gang weiter, den die Dunkelheit verschluckt.
Mein Atem beschleunigt sich und obwohl ich weiß, dass es sinnlos ist, stoße ich mich von der Wand ab und wanke aufs Gitter zu, auf der Suche nach einem Ausweg.
Das Mädchen presst sich dichter an die Wand, die Augen weit aufgerissen, die Fäuste an die Brust gepresst, doch ich ignoriere sie.
Ich knalle gegen das Metall und es scheppert, als ich mich daran festklammere. Mit den Fingern fahre ich über das Gitter, taste jede Stelle ab, an der die Stäbe in den Boden übergehen. Ich ziehe mich hoch und suche dort nach Schwachstellen in der Verarbeitung, wo das Tor eingelassen wurde. Als ich bei der Kette ankomme, die das Tor verschließt, sind meine Hände rutschig vom Schweiß.
Es gibt keine Schwachstellen.
Schließlich zerre ich nur noch an der Kette, obwohl es keinen Zweck hat. Wenn das Metall gut verarbeitet wurde, gibt es keinen Weg, diese Kette ohne Werkzeug oder Schlüssel zu öffnen.
»Scheiße, Scheiße, Scheiße!« Bei jedem Wort rüttle ich fest an dem Tor, was einen höllischen Lärm verursacht. Mit Wucht trete ich gegen das Gitter, sodass es laut scheppert. Trotzdem löst sich nichts.
Ich bin ihnen ausgeliefert. Irgendwie haben sie es rausgekriegt. Jemand muss mich dabei beobachtet haben, wie ich meine Fähigkeit eingesetzt habe, und hat das Geheimnis an die Regierung verkauft. Und die haben ihre Chance genutzt. Ich kann nur hoffen, dass sie Lonny nicht erwischt haben. Er wäre wertlos für sie – und ich weiß, was sie mit Leuten anstellen, die in ihren Augen keinen Wert haben. Das Bild meiner Mutter taucht in meinem Kopf auf – ihre glasigen braunen Augen, die zwar offen sind, aber nichts mehr sehen, weil das Leben daraus verschwunden ist. Hastig schüttle ich den Kopf, um das Bild wieder zu vertreiben. Trauer macht blind, und das kann ich mir in diesem Moment nicht erlauben.
Erschöpft lehne ich die Stirn an die Gitterstäbe. Sie kühlen meinen erhitzten Kopf und der Geruch von Eisen beruhigt mich. Wenn ich die Augen schließe, kann ich mir vorstellen, ich wäre zu Hause in der Werkstatt.
Das Knirschen von Schuhen auf sandigem Boden reißt mich aus der Erinnerung. Ich stoße mich vom Gitter ab, um wegzulaufen, ehe mir einfällt, dass ich nicht entkommen kann. Lieber stehe ich ihnen hier gegenüber, als mich in der Ecke zu verkriechen wie ein Insekt. Außerdem brummt mein Schädel noch immer.
Im Gang erscheinen zwei Männer. Es sind schlaksige Kerle, die zielsicher aufs Gatter zugehen. Der rechte trägt seine schwarzen Haare zu einem kurzen Pferdeschwanz zusammengebunden, der kleinere Blonde hat einen Sonnenbrand auf den Armen und sofort durchzuckt Hoffnung meinen Verstand und verdrängt alles andere. Wenn ich es geschickt anstelle, kann ich den Blonden vielleicht überwältigen. Ich stelle mir vor, wie sich meine Finger in seinen Sonnenbrand krallen, sobald einer von ihnen das Tor aufschließt, und er vor Schmerz aufschreit. Dann aber erkenne ich, was der Kerl mit dem Zopf in den Händen hält, und all meine Hoffnung schwindet. Eine Pistole.
Als sie mich sehen, bleiben sie stehen. Der größere Kerl richtet seine Waffe auf meinen Kopf, während der Blonde seine Finger in die Hosentasche steckt und einen Schlüssel hervorzieht.
»Beweg dich«, sagt er, während er den Schlüssel ins Schloss steckt. Als ich mich nicht rühre, sieht er auf. »Ich sagte, du sollst deinen Arsch bewegen. Jetzt. Geh zum Mädchen und setz dich an die Wand.«
Er wartet, bis ich einen Schritt zurücktrete, und dreht den Schlüssel im Schloss um. Es öffnet sich mit einem Klicken, das durch den ganzen Raum hallt.
Ich gehe rückwärts, um die Männer nicht aus den Augen zu lassen. Sie betreten beide die Zelle, ehe der Kerl das Schloss wieder schließt und den Schlüssel in seine vordere rechte Hosentasche steckt. Der andere zielt mit der Waffe auf meinen Kopf und das Wissen darum verursacht ein nervöses Kribbeln auf meiner Haut, als würden zehntausend Ameisen zwischen meinen Haaren krabbeln.
Als könnte er meine Gedanken lesen, zieht der Kerl mit dem Zopf die Lippen hoch. Vielleicht soll es ein sarkastisches Grinsen sein, doch es sieht eher so aus, als würde er die Zähne blecken. Mit der Waffe deutet er auf die Zelle hinter mir, um mich dazu zu bringen, weiterzugehen.
Ich lasse die beiden nicht aus den Augen und biege rückwärts um die Ecke. Mit einem schnellen Blick über die Schulter sehe ich mich nach Olive Carey um. Sie hockt in der hintersten Ecke des Raumes und hat sich wieder zu einer Kugel zusammengerollt. Als Olive die Männer mit der Pistole sieht, reißt sie die Augen auf und drückt ihre Faust auf den Mund, um nicht loszuschreien. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum sollte sie Angst vor ihren eigenen Leuten haben?
Die Männer treten in das Licht der Leuchtstoffröhre.