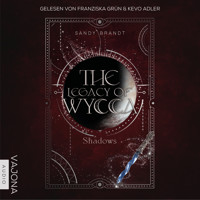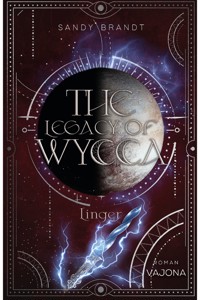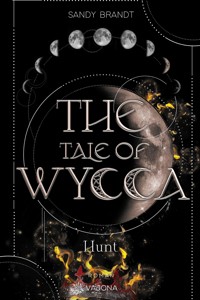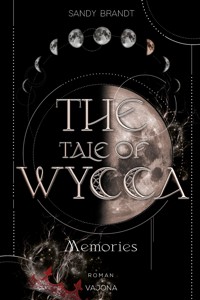9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: VAJONA Verlag GmbH
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
"Aber ich will nicht unter Mördern leben." „Das kannst du nicht ändern. Wir sind hier alle Mörder." Die Stadt Helena wird von Mördern regiert. Ich beobachte sie schon seit Wochen, diese verdammten selbsternannten Beschützer, die 7-2-o. Sie sind Mörder. Allesamt. Und ich werde alles tun, um zu ihnen zu gehören. Sie haben meinen Bruder getötet, und ich will Rache. Ich werde nicht aufhören, bis ich bekomme, was ich will. Auch, wenn das bedeuten würde, den zu töten, den ich liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sandy Brandt
Hunt Your Darlings
HUNT YOUR DARLINGS
© 2025 VAJONA Verlag GmbH
Lektorat: Lara Gathmann
Korrektorat: Désirée Kläschen und Susann Chemnitzer
Umschlaggestaltung: Stefanie Saw
Satz: VAJONA Verlag GmbH, Oelsnitz, unter Verwendung von Canva
VAJONA Verlag GmbH
Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3
08606 Oelsnitz
Für Chris.
Weil alle unsere Freunde dich auf die
Sex-Szenen ansprechen werden.
#sorrynotsorry
Die eine Seite der Münze
Zu einer tödlichen Abstimmung strömen die Bewohner durch die Tür wie Ameisen zu einer heruntergefallenen Eiskugel. Sie schlagen die Fäuste zur Begrüßung gegeneinander und klopfen sich auf die Schultern. Die Luft füllt sich mit verschiedenen Düften – dem Vanilleparfüm einer blonden Schönheit, ebenso mit dem Axe-Bodyspray eines jungen Mannes, der trotz der späten Stunde eine Sonnenbrille trägt. Eine rothaarige Frau zieht die Nase kraus. Sie marschiert zum Fenster und schiebt es hoch. Die Nachtluft legt sich prickelnd auf ihre entblößten Schultern, doch sie lehnt sich an die Fensterbank und reibt sich mit den Händen über die Oberarme, um die Gänsehaut zu vertreiben. Dunkelheit schleicht sich durchs Fenster und vermischt sich mit dem künstlichen Licht des Kronleuchters, dessen Kristalle zittern.
Aus dem Nebenzimmer dringen Schreie in den Raum, doch niemand lässt sich davon beirren. Die Teilnehmer setzen sich auf die Sofas oder die Ledersessel, erzählen sich von ihrem Tag.
»Ich weiß es nicht!« Das Flehen in der Stimme sickert durch die Wände und geht in ein lautes Brüllen über. »Ich habe keine Ahnung, wo er ist!« Der nächste Schrei hallt über den Flur zu den Anwesenden herüber, gefolgt von einem Wimmern. »Bitte, bitte, hör auf, ich sag euch alles, was ihr wissen wollt.« Ein Schluchzen begleitet die Worte und für einen Moment ersetzt Stille die Schmerzensschreie des Mannes.
Ungeduldig trommelt die Blondine mit den Fingern auf einen Tisch und der junge Mann neben ihr rollt mit den Augen.
Endlich öffnet sich die Tür zum Raum und alle richten ihre Blicke auf den Mann, der eintritt. Den Blick auf seine Hände gesenkt, fallen ihm dunkle Locken in die Stirn. Nacheinander wischt er seine Finger mit einem Tuch ab, bis der weiße Stoff mit roten Flecken übersät ist. Dann hebt er den Kopf.
Eine groteske schwarze Maske bedeckt sein Gesicht. Spitze Zähne formen ein breites Grinsen und dort, wo sich die Augen befinden, legt sich ein weißer Film über die Höhlen.
Aus dem Schein des Kronleuchters tritt ein blonder Mann dichter an die durchs Fenster strömende Dunkelheit heran. Den Blick auf den Neuankömmling gerichtet, stützt er sich mit einer Hand am Rahmen ab. Sie nicken sich zu.
»Ich weiß, wo er ist.« Der Dunkelhaarige nimmt die Maske ab und wischt beinahe liebevoll mit dem Zeigefinger einen Blutspritzer vom schwarzen Plastik. Er betrachtet ihn kurz, ehe er ihn mit dem Tuch säubert. »Wir können anfangen.«
»Danke.« Die tiefe Stimme des blonden Mannes vermischt sich mit der Nacht und ebenso wie sie, bringt er die Menschen zum Schweigen. Er neigt den Kopf, die Schatten umschmeicheln seine Wangenknochen. Eine Strähne fällt ihm in die Stirn und er streicht sie zurück. »Es ist dringend. Wir sollten schnell abstimmen. Möchte jemand etwas vorbringen?«
Stille füllt den Raum. Erinnerungen an Leben, Atmen und die Melodie von Worten, die bald verstummen würden, schwingen in dem Schweigen mit.
Jeder weiß, dass es so enden muss.
Der Mann nickt bedächtig. Mit dem Daumen streicht er sich über die Unterlippe. »Gut.« Er begegnet dem Blick jedes Einzelnen. »Hebt bitte die Hand. Wer ist dafür?«
Finger strecken sich in die Luft, Augen huschen zu Boden. Obwohl es unausweichlich ist, liegen bei dieser Art von Abstimmungen unausgesprochene Worte in der Kehle der Anwesenden.
»Einstimmig«, stellt der Mann fest und lässt die Hand sinken. Die anderen tun es ihm gleich. »Damit ist es beschlossen. Er wird sterben.«
Mini-Wiener
Das Schicksal hasst die Darlings.
Anders kann ich mir nicht erklären, weshalb es mich, Maisie Darling, dazu zwingt, Essensreste von Fremden aus der Spüle zu fischen.
»Maisie, wenn du damit fertig bist«, sagt Micah, deutet aus sicherer Entfernung auf mein verzogenes Gesicht und dann auf die verstopfte Spüle, »wartet Tisch fünf auf dich.«
Ehe ich fragen kann, ob er mit damit meinen angewiderten Gesichtsausdruck oder die eklige Plörre meint, in der meine Haut aufweicht, verschwindet er aus der Küche. Sofort ziehe ich meine Hände aus der Spüle und schüttle erst sie, dann meine Arme und zum Schluss meinen gesamten Körper. »Ugh. Fick die Henne.«
James schnalzt mit der Zunge und nimmt eine Pfanne vom Herd. »Reiß dich zusammen. Das habe ich immerhin mit Liebe gekocht.«
Ich trockne meine Hände an einem der Tücher und sehe ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Die Liebe wurde gründlich rausgekaut, Bruderherz. Sobald das Essen aus dem Gästeraum zurückkommt, ist es nur noch eklig.«
»Beim Kauen von Essen werden Enzyme wie Amylase –«
Ich halte eine Hand hoch. »Reiß dich zusammen, ja? Ich kann dein Nerdwissen gerade echt nicht gebrauchen.«
Er schnalzt mit der Zunge und streicht sich mit der Schulter die braunen Haarsträhnen zurück, weil seine Hände mit dem Risotto vor ihm beschäftigt sind. »Gibt es eigentlich irgendetwas am Kellnern, das dir gefällt?«
Gute Frage. Ich verabscheue es, anderen beim Essen zuzusehen. Ich hasse die schlechten Dad-Jokes der Boomer, deren Hemden sich über den Bäuchen spannen. Und Teller spülen ist auf jeden Fall die Beschäftigung, die in der Hölle auf mich wartet.
»Mir gefällt’s, dass ich schwarze T-Shirts umsonst bekomme.« Ich zupfe grinsend am Saum des Poloshirts und kratze dann an dem weißen Aufdruck über meiner linken Brust. »Nur das Logo stört.«
»Ich wusste, dass niemand so viele davon verlieren kann«, sagt Micah, der wieder in der Tür aufgetaucht ist und mich finster anstarrt. »Die sind nicht umsonst. Das ist Arbeitskleidung, Maisie.«
»Für mich ist das hier keine Arbeit, sondern ein Hobby«, sage ich ernst.
»James, bitte«, wendet Micah sich an meinen Bruder. »Bring sie dazu, die T-Shirts wieder mitzubringen. Ansonsten wird hier bald nackt gekellnert.«
Ich schüttle den Kopf, bevor James antworten kann. »Er will sie auch behalten. Wir legen unser Badezimmer damit aus.«
Micah stöhnt und James sagt: »Gib ihr endlich Arbeit, damit sie den Mund hält.«
»Tisch fünf, Maisie. Los.« Er deutet mit dem Kopf zum Gästeraum und ich verschwinde, ehe er mich fragen kann, ob die Spüle wieder frei ist. Hinter mir höre ich, wie James »Hast du schon mal ein wahres Wort aus ihrem Mund gehört?« fragt.
Sobald ich aus der Tür trete, ertönt ein Ruf.
»Hey, Maisie, kriegen wir heute noch was zu trinken?«
Bei der Stimme überlege ich kurz, ob ich nicht lieber angekautes Essen aus dem trüben Wasser fischen will. Aber ich reiße mich zusammen, schnappe mir den Notizblock vom Tresen und marschiere auf Tisch fünf zu.
»Was wollt ihr?« Ich tippe mit dem Kugelschreiber auf dem Papier herum und hinterlasse blaue Punkte.
»Dich«, kommt prompt die Antwort des Mannes, der eben nach mir gerufen hat. »Gern mit Schlagsahne, so wie beim letzten Mal.«
Ich stöhne innerlich auf, verkneife mir jedoch ein Augenrollen. Immer ans beschissene Trinkgeld denken, rede ich mir selbst gut zu und schaue vom Block auf. Russell, der Kerl, der gesprochen hat, erwidert meinen Blick zwinkernd. Die anderen Männer am Tisch lachen verhalten, aber niemand traut sich, mir in die Augen zu sehen.
»Ich frage noch einmal lieb und ihr antwortet genauso freundlich, alles klar?«, versuche ich es erneut und straffe die Schultern. »Was möchtet ihr bestellen?«
Russell tut, als würde er die Karte studieren, aber wir beide wissen, dass er sich erstens nichts außer Pommes und Burger in diesem Restaurant leisten kann und zweitens die Karte in- und auswendig kennt. So wie jeder Einheimische. Die Karte ist lediglich für die Touristen interessant.
Mein Blick fällt auf seine breiten Hände, die mich in erster Linie vor zwei Tagen dazu gebracht haben, meine Vorbehalte ihm gegenüber über Bord zu werfen. Sie sind wirklich schön – gebräunt und stark mit …
Schluss.
Ich schüttle den Kopf und trete meinen Gedanken gegens Schienbein. Seine Hände sind auch das einzig Gute an ihm, erinnere ich mich und reiße meinen Blick von ihm los. Da immer noch niemand bestellt, schnalze ich mit der Zunge und schlucke die Beleidigung runter, die gerade meine Lippen verlassen will. »Also? Was möchtet ihr?«
»Ich weiß, was du möchtest«, sagt Russell und erntet dafür wieder unterdrückte Lacher von seinen Freunden. »Ein langes, dickes Würstchen, richtig?«
Oh. Mein. Gott. Mit dem hattest du Sex, verdammte Scheiße? Ich verfluche meine innere Stimme dafür, dass sie nicht schweigt. Und dass ich es nicht leugnen kann.
Ich bin schwach, okay? Dieser Ort hält verdammt wenig Auswahl bereit und die reichen Touristen, die einfallen wie die Barbaren, die Preise in die Höhe schnellen lassen und alles aufkaufen, was nicht niet- und nagelfest ist, sind tabu. Zumindest daran halte ich mich.
Russell war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und er hat wirklich, wirklich schöne Hände. Für eine Nacht konnte ich seine beschissene Persönlichkeit ignorieren.
Aber heute nicht.
Ich atme tief durch, stecke meinen Notizblock in die Tasche der Schürze und stütze mich mit beiden Händen auf den Tisch, wobei ich mich dicht an Russells Ohr lehne. Überrascht zieht er die Luft ein.
»Das wäre ein Traum«, hauche ich, senke meine Stimme allerdings nicht. Mit Genugtuung beobachte ich, wie sich die Härchen auf seinen Unterarmen aufstellen. Meine Nase streift seine Wange. »Aber soweit ich gesehen habe, steht auf der Karte nur ein Mini-Wiener.« Mein Blick fällt auf seinen Schritt.
»Was zum …« Russells Kopf läuft rot an und seine Freunde prusten los.
Ehe er sich wieder gefangen hat, nehme ich ihm die Karte aus der Hand und marschiere davon. »Wenn ihr bestellen wollt, geht zum Tresen.« Ohne mich umzusehen, laufe ich in Richtung Küche.
»Nette Retourkutsche«, sagt jemand hinter mir. Bei dem warmen Klang der Stimme drehe ich mich um. Grüne Augen blicken mir entgegen.
Sofort zücke ich meinen Notizblock wie ein Schwert und halte ihn schützend vor mich. »Kann ich dir etwas bringen?«
Der Mann lächelt. Er trägt ein veilchenblaues Hemd, dessen obere Knöpfe offen stehen. Automatisch schaue ich zu einem der Fenster. Schnee sammelt sich an der Scheibe.
Diese verdammten Touristen. Nie können sie sich dem Wetter entsprechend anziehen.
Noch vor ein paar Jahren beschränkten sich die Urlauber auf die Sommermonate, wenn es in Fort Benton warm und sonnig ist. Doch mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass die Landschaft auch im Winter einiges zu bieten hat. Gepaart mit günstigen Grundstückspreisen hat das dafür gesorgt, dass meine Heimat zu achtzig Prozent aus Menschen besteht, die Dinge sagen wie: Diesen Sommer verbringe ich auf der Jacht eines Freundes und keine Sorge, eines meiner Häuser hat auch keinen Whirlpool.
Im Grunde wäre es mir egal. Doch der Einzug dieser Leute ist gleichbedeutend mit steigenden Kosten für einfach alles. Bei dem Gedanken beiße ich die Zähne zusammen, was mein Trinkgeldlächeln härter ausfallen lässt als gewohnt.
»Bring mir doch bitte einen Scotch«, antwortet der Fremde mit dem unpassenden Klamottengeschmack und lächelt. Er sieht nett aus. Die Haut vielleicht etwas zu gebräunt für die Jahreszeit und die blonden Haare zu hell für seinen Teint, aber ansonsten wirkt er normal. Freundlich. Ein Mann Ende zwanzig, ein paar Jahre älter als ich, der einfach nur etwas trinken will.
Mein angespannter Kiefer erholt sich.
»Und bring dir mit, was immer du möchtest, Süße.«
Und zack – Kieferstarre.
Meine Finger um den Stift verkrampfen sich. »Ich möchte«, sage ich und betone jede Silbe, die ich zwischen meinen zusammengebissenen Zähnen herauspresse, »dass du dein verfluchtes Knie nimmst und dich damit –«
»Bitte ans andere Ende des Raumes begibst«, beendet jemand meinen Satz und legt einen Arm um meine Schulter. Kurz erstarre ich, aber dann strömt mir der vertraute Geruch von frisch gebackenem Brot in die Nase und meine Muskeln entspannen sich. »Denn die Dame möchte bei der Arbeit nicht angeflirtet werden.«
Das Lächeln des Fremden verhärtet sich, aber er geht ohne zu murren zu einem der Tische am anderen Ende des Restaurants.
Sofort befreie ich mich aus der halben Umarmung. »Was die Dame eigentlich möchte, ist, dass die Kerle endlich mal ihr beschissenes Benehmen auspacken.«
Tom lässt seinen Arm sinken und grinst mich an. Seine blauen Augen hinter der schwarz umrandeten Brille funkeln. »Weil dein beschissenes Benehmen so tadellos ist?« Fragend legt er den Kopf schräg.
Sanft boxe ich ihm gegen die Schulter und lehne mich an den Tresen. Er hat ja recht. Sobald ich aufgebracht bin, neige ich dazu, ein klitzekleines bisschen zu fluchen.
»Was tust du hier?« Ich schaue über die Schulter auf die Wanduhr über dem Spirituosenregal und runzle die Stirn. »Wieso hast du schon Feierabend?«
»Darf ich nicht meine Geschwister bei der Arbeit besuchen?« Tom schaut kurz in Richtung Küche und greift dann hinter den Tresen, um sich eine Flasche Cola aus dem Kasten zu nehmen, der noch nicht eingeräumt wurde. »Und ein paar Freigetränke abstauben?«
Ich schnaube. »Stehlen ist nicht frei.« Auch ich werfe einen Blick zur Küche, aber Micah ist nirgends zu sehen, also reiche ich Tom einen Flaschenöffner. Er löst den Kronkorken und nimmt einen Schluck.
»Nein, ehrlich«, beharre ich. »Warum bist du schon hier? Der Laden schließt doch erst in zwei Stunden.«
Tom zuckt mit den Schultern. »Wir mussten Schichten ändern. Lyo ist noch immer nicht wieder aufgetaucht.« Er trinkt einen weiteren Schluck.
Stirnrunzelnd betrachte ich ihn. Vereinzelte Schneeflocken, die langsam tauen, hängen in seinen braunen Locken und seine braunen Winterstiefel hinterlassen Schlammspuren auf dem Holzfußboden.
»Denkst du noch immer, dass etwas nicht stimmt?«
Er stellt die Flasche auf den Tresen und öffnet seinen Mantel. Die Ärmel seines Pullovers sind nass, weil der Stoff der Jacke seit Jahren keinen Regen und Schnee mehr abhält. Mich fröstelt es schon jetzt bei dem Gedanken an den Heimweg.
»Lyo hätte mir gesagt, wenn er plant, abzuhauen. Er wäre nicht einfach so gegangen.«
»Du hast selbst gesagt, dass ihr nicht die Art von Freunde seid. Vielleicht hatte er einfach die Schnauze voll und ist nach Great Falls, um sich einen Job zu suchen, der nicht zu neunzig Prozent daraus besteht, ausgelaufene Dosenravioli aufzuwischen.«
Mit verzogenem Mundwinkel wischt Tom seine Brille am Saum seines Pullovers ab. »Danke für diese liebevolle Beschreibung der Tätigkeit, mit der ich meinen Lebensunterhalt verdiene.«
Ich zucke mit den Schultern und fahre mit einem Finger über den Tresen. »Wenn es wahr ist, ist es nicht gemein.«
Seufzend schüttelt er den Kopf und lässt den Blick durchs Restaurant schweifen. »Weshalb hast du den Kerl so abblitzen lassen?« Anstatt mich anzusehen, zupft er an einem losen Faden seines Ärmels.
Bei dem plötzlichen Themenwechsel furche ich die Stirn und blinzle ihn an. »Was?«
»Der da.« Tom deutet mit dem Daumen zu dem blonden Mann, der angestrengt die Karte studiert und mit aller Mühe nicht in unsere Richtung zu schauen scheint. »Er wirkt doch nett.«
Die Furchen in meiner Stirn vertiefen sich. »Er ist reich.«
»Und?«
»Was und? Er ist reich und eingebildet und –«
»Das weißt du doch gar nicht.«
Schnaubend schüttle ich den Kopf. »Ich arbeite hier seit fünf Jahren. Ich kenne diese Leute.« Direkt nach meinem Schulabschluss mit achtzehn habe ich angefangen, im Restaurant »Restaurant« zu kellnern. Genauso lange versuche ich schon, Micah davon zu überzeugen, den Namen zu ändern. Doch es gibt nicht viele Jobs für jemanden, der gerade die High School beendet hat, und gemeinsam mit Tom im Supermarkt anzufangen, kam nicht infrage. Im Gegensatz zu James kann mein anderer Bruder ziemlich belehrend sein. Also blieb für mich nur das Restaurant, in dem James bereits – ebenfalls direkt nach seinem Abschluss – als Koch arbeitete.
Tom zuckt mit den Schultern. »Ich mein ja nur«, murmelt er und fährt sich durch die braunen Locken. »Du könntest überrascht werden, wenn du deine Vorurteile ablegst. Und seien wir mal ehrlich – jemand mit Geld könnte unserer Familie nicht schaden. Vielleicht hätte dann auch mal jemand meine Sorge um Lyos Verschwinden ernstgenommen – wenn wir Geld hätten, um die Polizisten zu bezahlen.«
Kopfschüttelnd stoße ich mich vom Tresen ab und verschränke die Arme vor der Brust. Hitze strömt durch meine Adern. »Spinnst du? Willst du mich jetzt an den Höchstbietenden verkaufen? Was soll der Scheiß?« Es ist wahr, dass meine Familie wenig Geld besitzt, aber damit sind wir nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Seit der Großen Rezession 2025 vor zehn Jahren geht es vielen so wie uns.
Tom rollt mit den Augen. »Ja. Genau das habe ich gerade gesagt. Und du hast gar nichts in meine Worte hineininterpretiert.« Er seufzt, trinkt den letzten Schluck seiner Cola und schließt seinen Mantel. »Ich sag’s ja nur. Würden wir zu denen gehören, würde man uns sicher zuhören. Grüß James von mir. Wir sehen uns zu Hause.«
Mit verschränkten Armen schaue ich zu, wie er das Restaurant durchquert und die Tür öffnet. Draußen schneit es so stark, dass die weißen Flocken den Abend erhellen. Sobald er weg ist, stampfe ich in die Küche.
»Du glaubst nicht, was dein Bruder getan hat«, stoße ich hervor, noch ehe sich die Tür hinter mir geschlossen hat. Das ist ein Witz von uns dreien – wann immer einer etwas tut, was die anderen nicht gutheißen, ist er nur noch der Bruder oder die Schwester des jeweils anderen.
Deine Schwester hat schon wieder das gesamte warme Wasser aufgebraucht.
Dein Bruder hat jeglichen Schmutz von draußen ins Haus getragen.
Suchend blicke ich mich um, doch James ist nirgends zu sehen. Stattdessen sitzt Micah auf einem der wackligen blauen Plastikstühle und dreht sich eine Zigarette. Sehr hygienisch.
»Was?«, fragt er und leckt an dem Blättchen entlang. Vor ihm liegen Tabakkrümel.
»Mein Bruder«, sage ich, mit weniger Nachdruck als eben und wedle mit der Hand. »Was er getan hat.« James muss in die Pause gegangen sein und seine halbe Stunde in dem Nebenraum verbringen, in dem ein Sofa und eine alte Playstation aufgebaut sind.
Micah drückt das Blättchen mit der einen Hand zusammen und fegt mit der anderen die Tabakkrümel vom Tisch. »Ich find es ganz cool, muss ich zugeben.«
»Was?«, frage nun ich, bereits halb wieder aus der Küche. Wir reden heute wohl aneinander vorbei.
»Das Stipendium ist heiß begehrt und er hatte echt große Sorgen, dass er keine Chance hat. Aber siehe da – alles wendet sich zum Guten. Na ja, für ihn. Ich muss mir einen neuen Koch suchen.«
Mitten in der Tür bleibe ich stehen. Kälte breitet sich in meinem Brustkorb aus. Langsam drehe ich mich zu Micah um, der zufrieden seine Zigarette betrachtet und sich auf dem Stuhl zurücklehnt.
»Wovon redest du?«
»James wird wohl kaum weiter hier arbeiten, wenn er in Kalifornien studiert«, sagt Micah, als wäre ich dämlich. Vielleicht bin ich das auch. Anders kann ich mir dieses Gespräch nicht erklären.
»Wieso sollte James in Kalifornien studieren?«
Er betrachtet mich mit hochgezogenen Augenbrauen. »Hast du schon wieder während der Arbeit getrunken?«
»Das war ein einziges Mal und du hast mich abgefüllt«, erwidere ich abgelenkt. »Jetzt erklär mir, wovon du redest.«
»Na, das Stipendium, auf das dein Bruder sich beworben hat.« Mit der gedrehten Zigarette klopft Micah auf den befleckten Küchentisch. »Er hat die Zusage wohl schon eine Weile, aber mir erst heute Bescheid gegeben, dass er zum Jahresende – hey, wo willst du hin?«
Ich beachte ihn gar nicht, sondern stürme durch den engen Flur zum Pausenraum. Kraftvoll reiße ich die Tür auf. James liegt auf dem grünen Sofa, hat die Hände hinter dem Kopf verschränkt und starrt an die Decke. Als die Tür gegen die Wand kracht, dreht er den Kopf und hebt im Liegen eine Augenbraue.
»Ich hab Pause.« Er reibt sich die Augen. »Sag Micah, er soll –«
»Was ist das für ein Stipendium?« Die Worte verlassen atemlos meinen Mund.
James leckt sich über die Lippen und mein Magen verknotet sich. Seine braunen Augen huschen von mir zum Boden und dann an die Decke. »Micah sollte dir nichts sagen.«
»Micah sollte … Sind wir im Kindergarten, oder was?« Die Kälte von eben bahnt sich ihren Weg von meinen Brustkorb in meinen Magen. Ich verschränke die Arme, kralle die Finger in die dünne Haut in der Ellenbeuge.
»So, wie du dich aufführst, offensichtlich ja.« Mit beiden Händen fährt er sich übers Gesicht, als wollte er seine Haut glätten. Ächzend setzt er sich auf. Seine braunen Haare stehen wild in alle Richtungen ab. »Ich hab dir nichts gesagt, weil ich nicht wollte, dass du ausflippst.«
»Tja.« Ich schnalze mit der Zunge. »Ging wohl gründlich daneben.«
»Maisie …«
»Wann hast du dich dafür beworben?«
Er kaut auf seiner Wange. »Anfang Juni.«
Ich presse die Lippen aufeinander. Wir haben November. »Und die Zusage?«
Er reibt sich über die Nase. »Spielt das eine Rolle?« Ich starre ihn nur weiter stumm an, bis er angestrengt den Atem ausstößt. »Vor vier Wochen.«
Meine Eingeweide wandeln sich zu Eis. »Weiß Dad es? Und Tom?«
James schüttelt den Kopf. »Ich wollte mich entscheiden, ob ich es annehme, ohne dass jemand mir reinredet.«
»Und da dachtest du, es wäre schlau, es als Erstes Micah zu erzählen«, sage ich trocken und balle die Hände zu Fäusten, damit er nicht sieht, dass sie zittern.
»Er braucht Zeit, um Ersatz für mich zu finden. Er ist immerhin mein Boss.«
»Micah ist der Sohn vom Boss und ein verdammter Junkie.«
»Wenigstens urteilt er nicht voreilig.«
Ich schnaube. Ein Pochen breitet sich hinter meinen Augen aus. »Dann ist es beschlossen?« Meine Kehle schnürt sich zu. »Du verlässt uns?«
Seufzend steht James vom Sofa auf und hebt die Hände, als würde er sich einem wilden Tier nähern, obwohl er keinen Schritt auf mich zu macht. »Ich verlasse niemanden. Ich gehe studieren. Etwas, was ich schon vor Jahren hätte tun sollen. Ebenso wie du.«
Kopfschüttelnd bohre ich meine Fingernägel tiefer in die empfindliche Haut. »Und von welchem Geld soll Dad das Haus bezahlen? Tom und er können das unmöglich allein stemmen. Scheiße, ohne dich können wir selbst zu dritt niemals die Hypothek bezahlen.« In meinem Kopf reiht sich eine rote Zahl an die nächste.
»Vielleicht ist das gut so.«
Die Worte sickern durch die Ziffern in meinen Verstand. »Wie bitte?«
»Maisie, wir sind mit die Letzten, die noch nicht verkauft haben. Es gibt gute Angebote. Dad könnte nach Geraldine ziehen, dort sind die Mieten billiger und Tom könnte zurück nach Helena, so wie er es immer wollte, und du –«
»Ich gehe nicht weg.«
Er sieht zur Seite. Sein Unterkiefer zuckt. »Ich verstehe dich nicht.« Er wird lauter, und als er mich wieder ansieht, blitzt Wut in seinen braunen Augen auf. »Du bist offensichtlich unglücklich hier.« Er hebt einen Finger. »Du verabscheust deinen Job«, sagt er und zählt an einer Hand weiter ab. »Deine Freunde sind alle weggezogen. Du bist sogar aus der Theatergruppe ausgestiegen, weil, und ich zitiere: Du nicht so tun kannst, als wärst du ein Gorilla, während du dich in einem Raum befindest, in dem du mit der einen Hälfte geschlafen hast und mit der anderen Hälfte zur Schule gegangen bist. Oder beides.«
Ich sollte wirklich aufhören, meinem Bruder jede Kleinigkeit aus meinem Leben zu erzählen. Meine Wangen prickeln. »Das tut doch überhaupt nichts zur Sache.«
»Und ob es das tut. Du bist dreiundzwanzig Jahre alt. Wenn du dein Leben hier verbringen willst – bitte! Aber mir reicht das nicht.«
Ich beiße mir auf die Unterlippe, damit sie nicht zittert. »Und unser Zuhause?« Die Worte verlassen erstickt meinen Mund. »Moms Haus?«
James’ Gesichtszüge werden weicher. »Es ist nur ein Haus.«
Ich blinzle die Tränen weg, die drohen überzulaufen. Er hat unrecht. In dem Haus ist Mom aufgewachsen. Dort haben Dad und sie geheiratet und anschließend Tom, dann James und dann mich bekommen. Wir alle haben unsere ersten Schritte dort gemacht. Auf dem umliegenden Feld haben wir Verstecken gespielt.
Im Wohnzimmer hat Mom mir versprochen, auf mich aufzupassen. Sie hat mir mit zittrigen Fingern das Haar aus der Stirn gestrichen. Ihre Haut war bereits rau – eine Nebenwirkung der Chemotherapie – und ihre Berührung so sanft wie Schmetterlingsflügel. Ich saß neben ihr auf dem Sofa, weil ihre Knochen schmerzten, wenn ich auf ihrem Schoß saß, und sie lullte mich in Versprechen ein, von denen wir beide wussten, dass sie sie nicht würde halten können.
Ich habe immer ein Auge auf dich.
Ich werde zusehen, wenn du deinen Abschluss machst.
Ich werde aufpassen, dass dein erster Freund dir nicht wehtut.
All das war damals noch so weit weg gewesen, aber ich hatte genickt und die Tränen zurückgehalten. Auch als sie am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht war.
Es ist nicht nur ein Haus. Es ist ein Teil von mir.
Aber keiner dieser Gedanken schafft es an dem Kloß in meiner Kehle vorbei. »Wann gehst du?«, presse ich stattdessen hervor.
James kneift die Lippen zusammen und schüttelt den Kopf. »Merkst du eigentlich noch was?«
»Wie bitte?«
»Anstatt mich zu fragen, wo ich studieren werde oder was oder wenigstens ein Glückwunsch zu heucheln, geht es dir nur um dich.«
»Es geht nicht um mich! Es geht um Dad. Du nimmst ihm sein Zuhause.«
Er streicht über sein T-Shirt und anschließend über seine Haare. »Wir drehen uns im Kreis. Ich werde Micah sagen, dass ich früher nach Hause gehe. Die Küche schließt ohnehin bald.«
Ich beiße die Zähne zusammen. »Tu das.«
»Wir sehen uns zu Hause.« Im Vorbeigehen hebt er eine Hand, als wollte er sie mir auf die Schulter legen, doch ich drehe mich weg.
»Sicher.«
Ich höre noch, wie er tief einatmet. Dann ist er verschwunden.
Und lässt mich allein zurück.
Zertrümmert
In meinem Kopf wirbeln James’ Worte umher wie ein Schneesturm, weshalb ich die Orangenscheiben für die Cocktails mit mehr Kraft als nötig schneide.
Ich kann nicht glauben, dass er wirklich fortgehen will. Nach Moms Tod hatten wir uns geschworen, alles dafür zu tun, ihre Erinnerung in dem Haus ihrer Kindheit aufrechtzuerhalten. Ja, das ist zehn Jahre her, aber seitdem hat dieses Versprechen nur noch mehr Relevanz für mich bekommen. Denn vor zehn Jahren war unser altes Farmgrundstück mit dem vom Wetter gezeichneten Holzhaus nur eines von vielen in Fort Benton gewesen. Aber kurz darauf begann die große Rezession von 2025 in den USA und es dauerte nicht lange, bis wir die Auswirkungen spürten. Die Armen wurden ärmer und die Reichen reicher.
Unsere Nachbarn verkauften ihre Grundstücke an Leute, die nur saisonal hierblieben. Diejenigen, die in Fort Benton arbeiteten, mussten sich Wohnungen in den billigeren Orten außerhalb suchen. Und das Grundstück, auf dem unser Haus stand, wurde immer teurer, während die Lebenshaltungskosten stiegen.
Tom war der Erste von uns, der nach seinem Schulabschluss beschloss, zu bleiben, um mit Dad zusammen alles zu finanzieren. Er nahm einen Job im örtlichen Supermarkt an und arbeitet seitdem dort – mit Ausnahme des einen Jahres, das er für eine Fortbildung im knapp hundertdreißig Meilen entfernten Helena verbracht hat. Durch die Fortbildung bekommt er mehr Geld und finanziert sich damit sein Fernstudium.
Und Tom könnte zurück nach Helena, so wie er es immer wollte … James’ Worte wühlen wie Klauen in meinem Magen. Tom hat mir nie erzählt, dass er den Wunsch hegt, zurückzugehen. Er ist erst seit einem halben Jahr wieder hier und spricht nicht viel über die Zeit in Montanas Hauptstadt. Bisher dachte ich, die zwölf Monate wären ein hinnehmbares Übel für ihn gewesen. Weiß James mehr? Haben die beiden in meiner Abwesenheit darüber geredet?
»Hey, hey.« Micah greift nach meinem Unterarm. »Die Orangen wachsen nicht auf Bäumen, okay?«
Ich starre von seiner sommersprossigen Hand auf meinem Arm zu dem Brett vor mir, das von Orangensaft und -stückchen überflutet wird. Statt Scheiben ist es eher ein Brei.
»Okay, doch tun sie«, gibt Micah zu und lässt mich los. »Aber nicht auf unseren und ich muss dafür bezahlen. Also reiß dich zusammen.«
»Sorry.« Ich lasse das Messer liegen und wasche mir die klebrigen Hände.
»Weißt du was, du kannst nach Hause gehen. Hier ist ohnehin nicht mehr viel los, den Rest schaff ich allein.«
Normalerweise würde ich mich weigern. Weniger Stunden bedeuten weniger Geld. Aber James ist bereits zu Hause und ich will die Sache zwischen uns klären. Außerdem hat der Schneefall zugenommen und ich habe einen anstrengenden Marsch vor mir. Seufzend binde ich meine Schürze auf.
»Alles klar. Wir sehen uns morgen.«
Micah nickt mir im Vorbeigehen zu und ich spüre seinen besorgten Blick auf mir, als ich meine Jacke und die Mütze überziehe. Hat James ihm erzählt, dass wir uns gestritten haben? Mit wie vielen Leuten spricht mein Bruder über seine Sorgen, ohne dass ich es weiß?
Als ich aus der Tür trete, kneife ich die Augen zusammen. Die Schneeflocken brennen auf meinen Wangen und ich ziehe die Jacke höher und senke den Kopf, doch der Wind findet seinen Weg durch den dünnen Stoff und nach nur wenigen Schritten läuft meine Nase.
Ein paar der Gäste haben ihre Spuren im Schnee hinterlassen und eine Zeit lang kann ich ihnen folgen, doch schon zu bald verlasse ich die belebteren Straßen von Fort Benton und bin auf mich allein gestellt. Graue Wolken türmen sich im dunklen Nachthimmel und das Licht der wenigen Straßenlaternen erhellt nur wenige Meter des Weges.
Der Wind nimmt zu, zerrt an meiner Jacke und innerhalb von Minuten sind meine Finger taub. Ich lege die Hände an den Mund und hauche hinein, als ich auf den schmalen Feldweg abbiege. Der Schnee verschluckt jegliche Geräusche und alles – die Felder, der Wald, die spärlichen Elektrozäune – sieht so gleich aus, dass ich zwischenzeitlich nicht genau weiß, an welcher Stelle ich mich überhaupt befinde. Ich ziehe mir die Mütze tiefer ins Gesicht und kneife die Augen zusammen. Meine Finger kribbeln und ich stecke sie wieder in die Manteltaschen. Doch es nützt nichts – der Schnee fällt so stark, dass er mir die Sicht raubt und ich die Hände abwechselnd schützend vors Gesicht halten muss, um etwas zu erkennen. Die Welt um mich herum ist ein Blatt Papier, das jemand zusammengeknüllt und wieder entfaltet hat – weiß, mit undefinierbaren Schatten. Ich stampfe dennoch weiter und bin mir sicher, dass ich schon irgendwo ankommen werde.
Bis ich fast gegen einen Baum laufe. Ich trete einen Schritt zurück und reibe mir den Schnee aus den Wimpern. Ich bin direkt zum Waldrand gelaufen. Wenn ich mich anstrenge, erkenne ich durch die weißen Flocken hindurch die Bäume.
Seufzend drehe ich mich um – unser Haus liegt in der entgegengesetzten Richtung des Waldes – und stolpere prompt.
»Blöder Wald«, murmle ich und trete gegen den Übeltäter. Ein zugeschneiter Ast.
Nur ist es kein Ast.
Es ist ein brauner Winterstiefel.
Ich könnte weitergehen. Nach Hause, wo ein warmer Kamin und Essen auf mich warten.
Viele Leute tragen braune Winterstiefel.
Viele Leute tragen genau diese Winterstiefel. Die Einkaufsmöglichkeiten in einem so kleinen Ort sind begrenzt. Ich sollte einfach nach Hause …
Tom trägt diese Stiefel.
Ich berühre das Leder mit meinem eigenen Schuh, kratze den Schnee ab. Vielleicht irre ich mich. Männerschuhe sehen ohnehin fast alle gleich aus.
Worte schleichen sich in meinen Kopf und bohren sich wie Krallen in meinen Schädel: Was ist, wenn das hier wirklich Toms Stiefel ist?
Verblüffend, wie ein einziger Gedanke die Art von Folgen nach sich ziehen kann, die den Brustkorb zusammenquetschen, bis man das Gefühl hat, keine Luft zu bekommen. Mir fällt etwas ein, was James einmal zu mir gesagt hat: »Wenn man einen Schuh verliert, hat man eigentlich beide verloren.«
Das letzte Wort hallt in meinem Kopf nach, drängt mich dazu, mich umzusehen. Sind das Fußspuren da vorne im Schnee oder bilde ich mir das nur ein?
Warum sollte Tom in den Wald gegangen sein – mit nur einem Schuh?
Aus dem Augenwinkel glaube ich, einen Schatten zu sehen, und drehe mich ruckartig um. Da ist jedoch nichts als Bäume, Stille und die Gewissheit, dass etwas brutal falsch ist. Diese Gewissheit drängt mich dazu, in den Wald zu stolpern. Ich schlinge die Arme um meinen Brustkorb. Mein Herz schlägt schmerzhaft gegen meine Rippen. Mein Nacken kribbelt, doch meine Augen können den Grund für meine Angst nicht ausmachen. Ich laufe weiter, mit einem Gefühl im Magen, als hätte mir jemand in den Bauch geboxt.
Nach ein paar Metern schaue ich mich erneut um und entdecke kleine Löcher im Schnee, als hätte jemand Tropfen von heißem Wasser verteilt.
Oder eine andere, warme Flüssigkeit.
Ich kralle die Finger in meine Oberarme. Der Stoff meines Mantels ist so dünn, dass ich den Schmerz spüre und mich darauf fokussiere. Einzelne Gedanken stoßen in meinem Kopf aneinander, aber sie sind so abstrakt, dass ich sie nicht verbinden kann.
Bis ich direkt vor ihm stehe. Er liegt auf der Seite und sein Körper ist mit einer dünnen Schicht Pulverschnee bedeckt.
In dem Moment ist mein Körper nicht mehr mein Körper. Mein Bewusstsein steckt in etwas Fremden, über das ich keine Kontrolle habe. Meine Muskeln zittern und ich sinke auf die Knie; die kalte Luft durchschneidet meine Kehle und schwarze Punkte tanzen vor meinen Augen, als würde ich unter Sauerstoffmangel leiden.
Ein unerträglicher Druck baut sich in mir auf, hält mich gefangen. Tief in mir muss ein Teil existieren, der sich der Realität widersetzt. Ein Teil, der seine scharfen Klauen in meinen Verstand bohrt und törichte Worte der Hoffnung brüllt. Doch all das wird gedämpft von dem Anblick vor mir: Toms offene Augen, die noch vor wenigen Stunden amüsiert geglänzt hatten. Der geschmolzene Schnee um ihn herum, der unter der frischen Pulverschicht rot schimmert. Das Brüllen verstummt, als ich meine zitternde Hand vor Toms Mund führe.
Kein heißer Atem.
Mit den Knöcheln berühre ich seine Lippen.
Eiskalt.
Dieser Moment wird nie enden.
Ich werde den Rest meines Lebens hier knien, vor dem reglosen Körper meines Bruders. Niemals in der Lage, den Augenblick abzuschütteln. Ewig diesem Druck ausgeliefert sein, der meinen Brustkorb zusammenpresst.
Ich rutsche dichter an ihn heran. Das Brüllen hat ein Echo hinterlassen – keine vollständigen Worte der Hoffnung, aber einen kümmerlichen Nachhall, der in meinem Blut pulsiert. Er drängt mich, Tom auf meinen Schoß zu ziehen und meine nackte Hand an seine Wangen, seinen Hals, selbst seine Handgelenke zu pressen.
Kein Puls.
Das Echo verschwindet und in mir herrscht vollkommene Leere, genau wie in Tom. Mein Blick fällt auf seinen Brustkorb. Da ist nicht nur Blut. Er ist verformt, als wäre jemand mit voller Wucht darauf getreten.
Ohne Vorwarnung drängt sich mein Herz gegen meine Rippen und Übelkeit steigt in mir auf. Dort, wo ich Tom berührt habe, erscheinen rote Tupfer auf seiner Haut. Entsetzt starre ich auf meine Hände. An beiden klebt Blut.
Ich streiche über Toms Körper. Nass. Wie in Trance führe ich meine Finger vors Gesicht. Meine ganze Hand glänzt rot, als hätte ich sie in einen Farbeimer getaucht.
Ich bestehe nur noch aus diesen zwei Dingen: meinem bebenden Herzschlag und dem Blut an meinen Händen.
Frischer Schnee legt sich auf uns und Toms Haare fallen ihm in die Augen. Automatisch streiche ich die Locken aus seinem Gesicht und hinterlasse blutige Schlieren. Die Flocken werden dicker und drohen, uns unter sich zu begraben, doch ich wische den Schnee immer wieder von Toms Gesicht. Vielleicht bleibe ich hier sitzen und verschwinde gemeinsam mit ihm unter der Kälte, bis auch mein Atem verstummt. Wenn ich aufstehe, bin ich allein. Ich werde ihn hier zurücklassen müssen, werde durch den Wald irren, bis ich jemanden finde, der mir hilft.
Ein Name durchbricht das taube Gefühl. James. Sobald ich bei meinem Bruder bin, wird alles gut. Irgendwie schaffe ich es, mich davon zu überzeugen: Wenn ich ihn finde, verschwindet dieser alles verzehrende Druck von mir, der meine Muskeln zittern lässt und die Übelkeit in meine Kehle hochjagt.
Der Schneesturm wird stärker und meine Finger verfärben sich unter dem Blut bläulich. Mit steifen Händen packe ich Tom unter den Armen und ziehe ihn ein Stück seitwärts, in den Schutz der Büsche. Wieder streiche ich ihm die Locken aus dem Gesicht.
»Ich bin gleich zurück«, flüstere ich. Seine farblosen Lippen bewegen sich nicht. Ich versuche, seine Augen zu schließen. Die Lider öffnen sich immer wieder einen Spaltbreit, was so unnatürlich aussieht, dass ich eine Gänsehaut bekomme. Ich presse die Faust gegen den Mund und beiße mir auf die Knöchel, um nicht zu schreien. Etwas Scharfkantiges durchschneidet die Taubheit in mir und bringt mich dazu, meine Beine zu bewegen und Tom zurückzulassen.
Die schwarze Dunkelheit und der weiße Schnee sollten alles sein, was ich sehe.
Doch dem ist nicht so.
Rote Tupfer bedecken den Boden, tropfen von den Ästen, mischen sich in den grauen Himmel, der über meinem Kopf auftaucht, als ich den Wald verlasse.
Überall ist Blut. Das Rot hat sich in meine Netzhaut gebrannt.
Wut
Mein Bruder ist tot.
Ich habe keine Ahnung, wie dieser Gedanke in meine Welt passen soll. In eine Welt, in der ich atme, denke, auf dem Sessel sitze und in die Flammen des Kamins starre – wie kann dort der Gedanke real sein, dass Tom all das nicht mehr tut?
Dad und James waren zu Hause, als ich ankam. Sie sind sofort los, nachdem ich die Wörter über die Lippen bekommen hatte. Sie waren blass, doch auf keinem ihrer Gesichter konnte ich das Entsetzen entdecken, das ich in diesem Moment verspürte. Sie glaubten mir, aber sie begriffen nicht.
Wahrscheinlich kann man den Tod nicht aus Erzählungen begreifen. So wie man sich nicht vorstellen kann, dass eine Herdplatte heiß ist, ehe man sie angefasst hat. Um zu verstehen, muss man den Tod erleben – und wenn es nur die Enttäuschung ist, über die Schulter zu sehen, um jemandem einen Witz zu erzählen und dann festzustellen, dass dieser Jemand nicht da ist.
Ich merke gar nicht, wie die Zeit vergeht, aber in diesem Moment wird die Tür geöffnet.
Automatisch stehe ich auf. James läuft direkt zu mir und schließt mich in die Arme. Ich erwidere seine Umarmung, sehe aber gleichzeitig an ihm vorbei. Dad kommt ins Haus, die Augen verquollen und gerötet. Er scheint nicht wirklich anwesend zu sein – sein Blick huscht durch den Raum, bleibt jedoch nirgendwo hängen. Er hält die Tür auf und nach ihm tritt ein Polizist ein. Sofort straffe ich die Schultern und James lässt mich los. Gemeinsam wenden wir uns dem Polizisten zu.
Er trägt eine Marke an seinem schneebedeckten Mantel und die graue Wollmütze auf seinem Kopf passt nicht recht zur Gesamterscheinung. Mein Schädel dröhnt. Ich fühle mich wie ein Würfel, den man zusammen mit den anderen in einem Becher kräftig durchgeschüttelt und anschließend ausgekippt hat.
»Kann ich Ihnen den Mantel abnehmen, Officer?«, frage ich. Meine kratzige Stimme schmerzt in meiner Kehle und ich räuspere mich. James legt einen Arm um meine Schultern.
»Detective«, korrigiert der Polizist und kommt ein paar Schritte von der Tür in den Raum. Seine breiten Schultern nehmen unser gesamtes Wohnzimmer ein. »Nein, danke. Ich bleibe nicht lange. Ich wollte nur sichergehen, dass alle heil nach Hause kommen.«
Etwas regt sich in meinem Brustkorb und ich bin überrascht, als ich bemerke, dass ich vorhin unrecht hatte. Ich bestehe aus mehr als meinem Herzschlag und dem Blut an meinen Händen. Etwas Drittes hatte bisher geschlafen und öffnet nun bei den Worten des Detectives die Augen. Ich sehe hoch zu James, aber sein Blick ruht auf einem Punkt an der Wand hinter dem Detective.
»Vielen Dank«, sagt James und nickt der Wand zu.
Ich runzle die Stirn. »Und nun?«, frage ich, weil ansonsten niemand das Wort ergreift. James drückt meine Schulter. Ich bin mir nicht sicher, ob zum Trost oder weil er die Spitzen hört, die sich zusammen mit meinem wummernden Herzen in meine Stimme geschlichen haben.
Der Detective setzt ein Lächeln auf. Es soll sicher mitfühlend wirken. Doch stattdessen erinnert es mich an meine ehemalige Mathelehrerin, als sie mich nach meinem Abschluss im Restaurant hat kellnern sehen.
Mitleid.
Der Blick des Detectives huscht über meinen Körper und mir fällt wieder ein, wie winzig ich neben James aussehen muss und dass meine Augen vor Tränen glänzen. Ich hebe das Kinn und erwidere seinen Blick.
»Ich habe schon mit deinem Vater gesprochen«, sagt er und deutet auf Dad, als wüsste ich nicht, wen er meint. »Und mit deinem Bruder«, fügt er hinzu, als ihm bewusst wird, dass mein Dad gar nicht zuhört. Er schaut noch immer die Wand an. »Ihr könnt die Beerdigung planen, sobald der Körper freigegeben ist. Das sollte morgen der Fall sein.«
»Morgen schon?«, frage ich. »Aber … wie können Sie dann ermitteln?«
Der Blick des Detectives huscht zu meinem Vater und dann – als er zum zweiten Mal keine Reaktion bekommt – zu James. Wieder drückt mein Bruder meine Schulter und dieses Mal bin ich mir sicher, dass es nicht zum Trost ist. Ich schüttle seinen Arm ab.
»Wie ich deinem Bruder schon mitgeteilt habe –«, beginnt der Detective.
»Ich habe selbst Ohren«, unterbreche ich ihn und verschränke die Arme vor der Brust. Aber er sieht noch immer nicht mich, sondern James an, auch als ich hinzufüge: »Sie können mit mir sprechen.«
Das Lächeln des Detectives sieht nun eher nach einer Grimasse aus. Er hat die Hände vor dem Bauch verschränkt und seine Daumen kreisen umeinander. »Nun gut«, sagt er, aber es klingt alles andere als gut. »Es scheint ein Raubüberfall gewesen zu sein. Der Junge hatte eine Schusswunde in der Brust. Die Wahrscheinlichkeit, den Täter zu finden, ist verschwindend gering.«
»Ein Raubüberfall?«, wiederhole ich und fixiere den Detective. »Wie kommen Sie darauf?«
»Nun, Mädchen«, sagt er und verzieht den Mund, als hätte ich ihn gefragt, ob ich mal mit seiner Waffe schießen dürfte, weil ich selbst eine Spielzeugpistole in meinem Zimmer hätte. »Dein Bruder hatte kein Portemonnaie bei sich.«
»Was sicher daran liegt«, erwidere ich und kralle meine Finger in die Oberarme, »dass Tom kein Portemonnaie besitzt. Er steckt sein Geld immer in die Hosentasche.«
Der Detective lächelt wieder und zeigt mir dabei seine Zähne. »Wir haben deinen Bruder durchsucht und keine Wertsachen bei ihm gefunden.«
»Ach, Sie meinen, die drei Dollar Kleingeld sind dem Raubmörder zum Opfer gefallen?«
»Maisie«, murmelt James und legt eine Hand auf meinen Unterarm. Ich schüttle ihn ab.
»Wir nehmen an, dass dein Bruder mehr Bargeld bei sich hatte. Soweit ich weiß, arbeitet er im Supermarkt an der Kasse?« Der Detective schaut zu James und dann zu Dad. Ersterer nickt. »Uns ist zu Ohren gekommen, dass sein Arbeitskollege schon vor Wochen verschwunden ist. Und in der Kasse fehlte Geld.«
Eine kalte Hand packt mich und quetscht meinen Brustkorb so eng zusammen, dass ich kaum Luft bekomme. Gleichzeitig bohrt sich etwas Spitzes in meine Eingeweide. »Sie denken, Tom hat gestohlen«, spreche ich aus, was er andeutet. Ich sehe zu James, der die blassen Lippen aufeinandergepresst hat und zur Seite schaut.
»Danach sieht es aus«, sagt der Detective. »Erst Lyonel Hernandez und nun dein Bruder. Anscheinend hat Hernandez ihn auf die Idee gebracht. Und jemand muss deinen Bruder beobachtet und ihn im Wald abgepasst haben.«
Ich lecke mir über die Lippen und schaue zu James. Seine braunen Augen glitzern. »Das ist doch Schwachsinn«, sage ich. »Das würde er nicht tun. Außerdem hat Tom schon seit Wochen gesagt, dass mit Lyos Verschwinden etwas nicht stimmt. Haben Sie Earl schon befragt? Er ist der Besitzer des Supermarkts und Toms Boss. Er kennt ihn.«
Der Brustkorb des Detectives hebt sich angestrengt und er macht einen Schritt auf mich zu. »Mädchen«, sagt er und legt den Kopf schräg. Meine Hand zittert. Ich bin dreiundzwanzig Jahre alt – wenn er mich noch einmal Mädchen nennt, springe ich ihm ins Gesicht. »Ist es das, was du willst? Wenn wir Ermittlungen anstellen, wird jeder wissen, was dein Bruder getan hat. Und«, fügt er hinzu und lässt seinen Blick durch unser Wohnzimmer schweifen, »dann ist es wahrscheinlich, dass ihr als Familie für den Diebstahl aufkommen müsst. Ich denke, das ist etwas, was es zu vermeiden gilt.« Sein Blick bleibt an der Wolldecke hängen, die wir vor einigen Tagen provisorisch vors Fenster gehängt haben, weil es dort zieht. Mein Gesicht wird heiß und ich bohre meine Fingernägel tiefer ins Fleisch. Scham verknotet meine Zunge und ich finde keine weiteren Worte.
Gleichzeitig fällt mir wieder ein, was Tom im Restaurant gesagt hatte. Dass die Polizei ihn ernst nehmen würde, wenn er Geld hätte. Ich weiß, dass es früher anders gewesen sein muss. Dass es so etwas wie Recht gab und die Polizei es durchgesetzt hat – für jeden, egal, wie reich er war.
Doch das ist heute anders. Und Tom wusste das.
Kann es wirklich stimmen? Hat Tom Geld gestohlen? Vielleicht, um Lyos Verschwinden untersuchen zu lassen?
James nutzt meine Sprachlosigkeit. »Danke, Detective.« Er streckt dem Mann die Hand entgegen und der Polizist schüttelt sie einmal. »Wir hoffen, dass wir unseren Bruder so schnell wie möglich beerdigen können.«
Der Detective nickt und dreht sich zu Dad. Auch ihm streckt er die Hand entgegen und mein Vater schüttelt sie ruckartig. Sein Adamsapfel zuckt.
»Das sollte kein Problem sein«, sagt der Detective und sieht uns nacheinander an. »Mein herzliches Beileid, euch allen.«
Dad nickt, entgegnet aber nichts. Der Detective steht da und tritt von einem Fuß auf den anderen. »Nun gut«, wiederholt er. Es scheint keine richtige Bedeutung für ihn zu haben. »Auf Wiedersehen, nehme ich an.«
Er geht zur Haustür und öffnet sie.
»Sie melden sich?«, rufe ich ihm hinterher. Er dreht sich um, eine Hand an der Türklinke. »Wenn Sie etwas rausfinden?«
Er kneift die Lippen zusammen, bevor er mir ein Lächeln zeigt, das mich an einen Hai erinnert. »Natürlich.«
Damit verschwindet er in der Nacht.
Für einen Moment denke ich darüber nach, die Tür zu öffnen, ihm nachzulaufen und ihn solange zu verfolgen, bis er gezwungen ist, etwas zu tun. Nicht nur zu lächeln und uns mit indirekten Drohungen zu überhäufen. Ich bin kurz davor, loszurennen, als ich James’ Stimme höre.
»Dad!«
Ich drehe mich um, doch James ist schneller und bereits bei unserem Vater. Er hält die Hände an seinen Rücken, stützt ihn. Dads Knie zittern.
»Ich muss mich nur hinsetzen«, sagt mein Vater und will James abschütteln. Doch mein Bruder verstärkt seinen Griff.
»Du solltest etwas schlafen«, sagt er und legt sich Dads Arm über die Schulter. »Du kannst mein Bett haben.« Normalerweise schläft Dad auf dem Sofa im Wohnzimmer, weil wir nur zweieinhalb Schlafzimmer besitzen. Er widerspricht nicht und daran erkenne ich, wie benommen er ist. James bringt ihn zur Treppe und gemeinsam gehen sie nach oben. Ungläubig stehe ich da, zähle das Ticken der Uhrzeiger hinter mir und warte, bis James wiederkommt. Erschöpft lässt er sich aufs Sofa fallen und vergräbt das Gesicht in den Händen.
Ich kann mich nicht setzen. Meine Muskeln stehen unter Strom und ich weiß, sobald ich zur Ruhe komme, wird dieses Etwas in meiner Kehle die Chance nutzen und sich seinen Weg nach oben bahnen. Außerdem ist da noch immer das unbekannte Biest in meiner Brust, das bei den Worten des Detectives geweckt wurde. Es frisst die Trauer und hinterlässt stattdessen nur eine nagende Hitze, die durch meinen Körper gepumpt wird wie Lava.
»Wir werden es doch nicht dabei belassen, oder?«, frage ich.
James sieht auf, seine Hände noch immer in den braunen Haaren vergraben. In seinem blassen Gesicht stechen seine dunkelbraunen Augen stärker hervor. Die gleichen Augen, die auch Dad besitzt. Tom und ich haben die blauen Augen unserer Mutter geerbt.
Nun bin nur noch ich übrig.
»Du hast ihn gehört, Maisie«, sagt James und lässt die Hände vors Gesicht sinken. »Es ist vorbei.«
»Das ist nicht dein Ernst«, entgegne ich. James sieht zur Treppe und ich fahre leiser fort: »Du glaubst doch nicht wirklich, dass Tom Geld von Earl gestohlen hat?«
James legt den Kopf gegen die Rückenlehne und schaut an die Decke. »Wir wissen es nicht.«
»Aber dann –«
»Maisie«, unterbricht James. »Lass gut sein.«
»Tom würde niemals stehlen.«
»Die Menschen tun manchmal Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Auch die, die uns nahestehen.«
Entsetzt starre ich ihn an. Gleichzeitig muss ich an den Moment heute Abend denken, als Tom sich die Flasche Cola genommen hat. Aber das ist nicht zu vergleichen. Oder? Nein, auf keinen Fall.
Ich schüttle den Kopf. »Das kannst du nicht glauben.«
James seufzt. »Nein. Ich … nein.«
»Dann müssen wir mit dem Detective sprechen!«
James beißt sich auf die Unterlippe. »Und was glaubst du, passiert dann?«
»Sie werden ermitteln.« Ich runzle die Stirn. »Was sonst?«
»Und von welchem Geld?«
»Was meinst du?«, will ich wissen.
»Mann, Maisie.« James hebt die Hände. »Glaubst du wirklich, die Polizei gibt sich Mühe, wenn sie nicht bezahlt wird? So war es vielleicht früher. Heute rührt keiner von ihnen einen Finger, wenn nichts dabei rausspringt. Selbst wenn Tom das Geld nicht genommen hat –«
»Hat er nicht!«
»Selbst dann«, fährt James fort, »hat es keinen Sinn, zu versuchen, den Detective umzustimmen. Wir haben kein Geld, um ihn zu bezahlen.«
»Und damit ist es erledigt?« Ich balle die Hände so fest zu Fäusten, dass meine Knöchel knacken. »Wir beerdigen Tom und tun so, als wäre alles in Ordnung?«
»Natürlich ist nichts in Ordnung«, widerspricht James. »Aber wir können es nicht ändern.«
»Irgendjemand hat ihn ermordet!« Mein Puls dröhnt in meinen Ohren. »Und nicht wegen des Geldes, erzähl mir keinen Scheiß! Wir müssen herausfinden, wer zum Teufel es war!«
James springt vom Sofa auf und tritt einen Schritt auf mich zu. Röte steigt in sein Gesicht und seine Hände zittern. »So läuft es aber nicht«, sagt er und presst den Kiefer aufeinander.
»Wir müssen –«
»Wir können nichts tun!« James’ Trauer mischt sich mit Wut und trifft mich wie eine Hitzewelle.
»Du willst nur nicht.« Immer wieder balle ich die Hände zu Fäusten. Am liebsten würde ich in mein Zimmer gehen und mich der Trauer und Wut hingeben, aber das geht nicht. Dad liegt in James’ Bett und unsere Zimmer sind nur durch einen Paravent voneinander getrennt.
Das einzig freie Bett wäre Toms, und das kommt nicht infrage.
Mein ganzer Körper zittert.
»Hey.« James tritt dichter an mich heran und nimmt mich in den Arm. Sanft streicht er über meinen Rücken. »Alles wird gut.«
Aber wir wissen beide, dass das nicht wahr ist.
Geheimnisse
Eine Art Kuppel hat sich über unser Haus gelegt. Am nächsten Morgen habe ich nicht das Gefühl, als wäre die Sonne wirklich aufgegangen. Dunkle Wolken hängen am Himmel, während sich Schneeflocken in der Größe von Golfbällen ununterbrochen gegen die Fensterscheiben drängen. Eigentlich müsste im ganzen Haus das Licht brennen, doch niemand aus meiner Familie scheint das Verlangen zu haben, die Dunkelheit zu vertreiben.
James hat auf dem Sessel im Wohnzimmer geschlafen, während ich auf dem Sofa lag. Irgendwann in den frühen Morgenstunden bin ich eingeschlafen. Als ich aufgewacht bin, war er verschwunden.
Umso besser. Ich habe keine Lust auf Diskussionen und das, was ich vorhabe, würde nur für Streit sorgen. Schnell schlüpfe ich an meinem schlafenden Vater vorbei, um meine Klamotten aus dem Schrank zu holen. Auf dem Rückweg sehe ich zu Toms geschlossener Zimmertür. Schnell wende ich den Blick ab. Ich habe Angst, dass ich dem Drang nachgebe, die Tür zu öffnen und hineinzusehen. Ich weiß nicht, was schlimmer wäre: Sein Zimmer so vorzufinden, als würde er jeden Moment reinkommen, oder das Gefühl zu haben, als wäre der Raum schon seit Wochen unbewohnt.
Ich laufe die Treppe hinunter. Mein Mantel hängt neben dem Kamin. Er ist noch klamm, ebenso wie meine Stiefel. Leise drücke ich die Türklinke runter und schlüpfe nach draußen.
Meine Zehen sind bereits nach ein paar Schritten eingefroren, und als ich den kleinen Supermarkt erreiche, schmerzen meine Ohren vor Kälte. Sobald ich durch die automatischen Schiebetüren gehe, strömen mir warme Luft und der Geruch von frischem Brot entgegen. Für einen Moment glaube ich, braune Locken zu sehen, und das Echo von Toms Lachen hallt durch die Luft. Benommen bleibe ich stehen, blinzle.
An der Kasse sitzt nicht Tom, sondern Earl, der Besitzer des Supermarkts, und füllt mit seinem umfangreichen Bauch den gesamten Bereich dahinter aus. Das Piepen der Registrierkasse und das Klirren der Münzen ertönen und bohren sich mit scharfer Präzision in meinen Kopf. Die Schlange reicht bis zu dem Schild, das verkündet: »Wenn sie hier stehen, fragen sie nach einer weiteren Kasse.«
Ich hatte gehofft, dass Earl irgendwo im Laden ist und nicht hinter der Kasse sitzt. Das, was ich von ihm will, würde ich eher bei einem ruhigen Gespräch erreichen und nicht gehetzt von einer Kleinfamilie hinter mir, die darauf wartet, dass ich mein Kaugummi bezahle. Aber ich tropfe nur den Boden voll, während ich hier stehe, also gehe ich zur Kasse. Earl sieht mich von Weitem und seine kleinen Glupschaugen werden rund.
»Maisie, mein Mädchen«, sagt er und hält einen Salatkopf in der Hand, ohne ihn abzuscannen. Schweißperlen glänzen auf seiner Stirn und der Halbglatze. »Ich habe es vorhin gehört. Es – es tut mir so leid … Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.« Er erhebt sich ein Stückchen vom Stuhl, als wollte er zu mir kommen, den Salat noch immer in der Hand. Die Frau vor ihm wirft mir einen Blick zu und sieht demonstrativ auf ihre Armbanduhr.
»Danke, Earl«, sage ich und wedle mit der Hand, um ihm zu bedeuten, dass er sich setzen kann. Er wischt sich mit dem Unterarm über die Stirn und scannt endlich den Salat und danach das abgepackte Brot.
»Earl, ich –«
»Das war Brot vom Vortag«, unterbricht mich die Frau an der Kasse. »Gibt es da nicht dreißig Prozent Rabatt drauf?«
Earls Blick huscht von mir zum Brot in seiner Hand und ich kann ihm ansehen, dass er hin- und hergerissen ist. Der Laden ist unterbesetzt und gleichzeitig würde er gerne mit mir reden. Hätte ich Zeit, würde ich ihm zulächeln und fragen, ob wir uns in seiner Mittagspause in Ruhe unterhalten können. Aber ich kann nicht warten.
Doch ehe ich etwas sagen kann, kommt Earl mir zuvor: »Maisie, Marcus ist im Laden und füllt die Regale auf. Er bringt dich zu – zu Toms Spind«, sagt er und stolpert leicht über den Namen meines Bruders. Sofort zieht sich meine Kehle zusammen.
»To– Sein Spind?«, frage ich.
»Du willst doch sicher seine Sachen holen«, sagt Earl.
Daran hatte ich gar nicht gedacht. Eigentlich bin ich hier, um nach dem vermeintlich verschwundenen Geld zu fragen. Fieberhaft kaue ich auf meiner Wange, gehe in Gedanken alle Optionen durch. »Natürlich«, sage ich. »Und, Earl, wenn du später noch Zeit hast –«
»Entschuldigung«, unterbricht die blonde Frau an der Kasse mich. »Ich habe Termine.«
Earl wird knallrot und zieht in einer Geschwindigkeit, die ich ihm gar nicht zugetraut hätte, Cornflakes übers Band. Er wirft mir einen entschuldigenden Blick zu. Mit dem Finger deutet er auf den Laden und formt mit den Lippen »Marcus«. Ich nicke und mache mich auf die Suche.
Marcus ist bei den Konserven, und als er mich sieht, stößt er eine ganze Reihe davon um. Ich zucke bei dem Geräusch zusammen, aber er ignoriert die kullernden Dosen und kommt mit ausgebreiteten Armen auf mich zu.
»Ich hab’s schon gehört«, murmelt er in meine Haare und drückt mich fest. »Vorhin war ein Polizist hier. Es tut mir so leid, Maisie.«
Ich nutze den Moment, um das Brennen in meinen Augen zu unterdrücken und einmal tief durchzuatmen. Dann löse ich mich aus seiner Umarmung.
»Danke, Marcus.«
Er lässt die Hände auf meinen Schultern liegen und sieht mich an. Die schwarzen Locken fallen ihm ins Gesicht und er pustet sie weg. »Komm mit.« Er drückt meine Schultern. »Wir gehen in den Pausenraum.« Mit sanftem Blick schiebt er mich durch den Gang.
»Willst du die Konserven nicht aufheben?«, frage ich, während wir im Slalom drum herumlaufen.
»Später.«
Er gibt den Code an der Tür ein und sie öffnet sich mit einem Piepen. Der Pausenraum besteht nur aus einem Tisch, vier verschiedenen Stühlen und verbeulten Spinden. Es riecht nach Kaffee, obwohl es keine Kaffeemaschine gibt. Mein Blick fällt sofort auf den Spind meines Bruders – der zweite von rechts – und wie auch schon bei seinem Zimmer muss ich den Blick abwenden.
Marcus schenkt mir ein Glas Wasser ein und drückt es mir in die Hand. Ich bin mir sicher, nichts runterzubekommen, lächle aber dankbar. Marcus dunkle Augen leuchten. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass er hier ist und nicht Earl.
»Ich wollte Toms Sachen abholen«, sage ich, obwohl ich wegen etwas anderem hier bin. Doch dieser Vorwand macht es einfacher. Meine Stimme bricht bei Toms Namen und Marcus’ Ausdruck wird weich.
»Ich glaube, viel ist da nicht drin.« Er nickt und klopft mit den Knöcheln gegen das grüne Metall des Spindes. »Wenn du willst, kann ich dir helfen.«
Ich runzle die Stirn. »Musst du nicht arbeiten?«
Sein Lächeln schwankt kurz, aber dann winkt er ab. »Earl versteht das schon.«
Ich denke an Earl, der mit hochrotem Kopf an der Kasse sitzt, während die Leute in der Schlange ungeduldig mit der Fußspitze auf den Boden tippen.
»Ich schaff das schon«, sage ich. »Wie du selbst gesagt hast: Viel kann es nicht sein.«
»Kennst du seine Kombination?«, fragt Marcus, als ich das Zahlenschloss zwischen zwei Finger nehme.
»Klar«, lüge ich. Es sind vier Zahlen – so schwer kann das nicht sein.
Marcus räuspert sich. »Ich räume mal eben die Dosen weg.« Sicher interpretiert er mein Zögern als Wunsch, allein zu sein. »Bin gleich wieder da.«
Sobald er weg ist, probiere ich Toms Geburtstag, den 22. November, doch das Schloss öffnet sich nicht. Ich wünschte, ich würde das Geburtsdatum seiner letzten Freundin kennen, aber er hat nur selten von ihr gesprochen. Ich weiß nur, dass er sie in Helena kennengelernt hatte. Nicht mal ihren Namen hat er uns verraten.
Der Gedanke an diese zwölf Monate, die mein Bruder weg war, reißt mir ein Loch in den Brustkorb. Diese Zeit damals war begrenzt. Aber jetzt …
Tom hat mich immer verstanden. Auch wenn James und ich uns ein Zimmer, unsere Freunde und die gleichen Interessen teilen, war es immer Tom, der all meine Gefühle in meinem Gesicht ablesen konnte, so wie ich seine.
Mit zitternden Fingern drehe ich die kleinen Zahlenrädchen. 0602 – mein Geburtstag. Das Schloss klickt und geht auf. Meine Nase kribbelt und Tränen schießen mir in die Augen. Ich rechne damit, ein altes Namensschild, eine Ersatzjacke und leere Getränkeflaschen zu finden, als ich die Tür öffne.
Stattdessen liegt im Spind meines Bruders eine Waffe.
Mein Kopf huscht so schnell zur Tür, dass ich mir den Hals verrenke, aber Marcus ist noch nicht zurück. Der Puls hämmert gegen meine Schädeldecke und Schwindel packt mich mit kalten Händen. Ich will nach der silbernen Waffe greifen, kneife aber im letzten Moment. Fingerabdrücke, schießt es mir durch den Kopf. Wenn ich die Waffe anfasse, hinterlasse ich Abdrücke.
Aber was macht das für einen Unterschied? Sicher hat mein Bruder mit dieser Waffe nichts getan, was ihn – oder mich, sollte ich die Waffe anfassen – in Schwierigkeiten bringen könnte.
Sobald ich den Gedanken zugelassen habe, tritt ihn ein anderer nieder: Mein Bruder ist tot – wie wahrscheinlich ist es da, dass diese Waffe nur zufällig hier liegt?
Gänsehaut krabbelt von meinen Oberarmen über meinen Rücken. Was soll ich tun? Wenn ich sie hierlasse, wird sie jemand finden. Ich denke an die Worte des Detectives. Er verdächtigt Tom des Diebstahls. Sollte er herausfinden, dass in seinem Spind eine Waffe liegt …
Mir bleibt keine Wahl. Ich ziehe den Ärmel meines Mantels über meine Hand und greife nach der Waffe. Es ist ein silberner Revolver. Ich habe keine Ahnung von so etwas und weiß nicht, ob er gesichert ist oder nicht und wie ich das herausfinden soll. Was, wenn ich den Revolver in die Jackentasche stecke und mir aus Versehen in den Fuß schieße? Die Waffe baumelt zwischen meinen Fingern wie ein Schlüsselanhänger. Ich muss sie verstecken, bevor Marcus zurückkommt. Mit der freien Hand greife ich nach der grünen Ersatzjacke, die zusammengeknüllt hinten im Spind liegt und wickle die Waffe darin ein. Unter der Jacke kommt ein dünner Stapel Briefe zum Vorschein, den ich mir ebenfalls schnappe. Keine Sekunde zu früh schlendert Marcus wieder in den Raum. Ich drücke das Bündel aus Toms Jacke an meine Seite und mein Herz hämmert gegen meine Rippen. Die Aufregung hinterlässt einen bitteren Geschmack in meinem Mund.
»Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat.« Marcus sieht mich an. Ich zwinge mich zu einem kleinen Lächeln und hoffe, dass man mir mein bebendes Herz nicht ansieht. Er lächelt zurück. James hat wohl recht, wenn er behauptet, ich wäre »eine verdammt scheißgute Lügnerin«. Aber irgendeinen Nutzen muss der jahrelange Schauspielunterricht ja haben.
»Ich habe alles.« Wie zum Beweis halte ich die Briefe und die Jacke hoch.
»Willst du, dass ich mitkomme?«