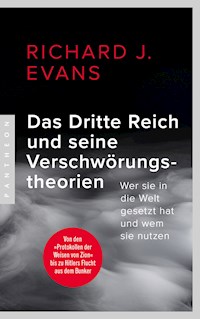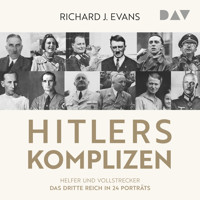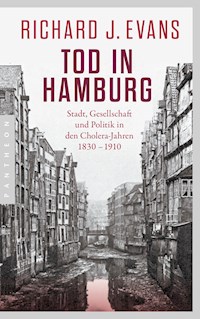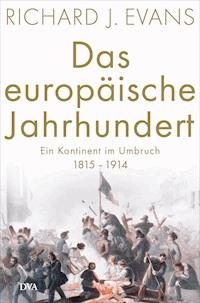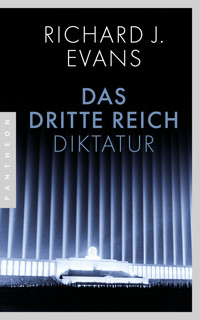
22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Beeindruckend und scharfsinnig: Die umfassendste Geschichte der verhängnisvollen Epoche des Dritten Reiches, die jemals geschrieben wurde« Ian Kershaw
Im zweiten Band seiner monumentalen Trilogie zum Aufstieg und Fall des Dritten Reiches widmet sich Richard J. Evans den Anfangsjahren der Diktatur 1933 bis 1939. Vermeintlichen Erfolgen wie dem Rückgang der Arbeitslosigkeit, erkauft durch eine massive Aufrüstung, einem erstarkten nationalen Selbstbewusstsein und der gigantischen Selbstdarstellung des Dritten Reiches während der Olympischen Spiele 1936, steht eine Bilanz des Terrors gegenüber. Mit der Machtergreifung 1933 setzt ein gnadenloser innerer Krieg gegen Regimegegner, Randgruppen und Juden ein. Das System der Konzentrationslager wird errichtet, die Nürnberger Gesetze erlassen, und der Novemberpogrom 1938 ist ein Vorbote des Holocausts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1783
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Die zwölf Jahre des Dritten Reiches zerfallen, stark vereinfacht, in die Jahre des Krieges und des Holocausts und die vorangegangenen Jahre eines außenpolitischen Friedens. Vermeintlichen Erfolgen wie dem Rückgang der Arbeitslosigkeit, erkauft durch eine verhängnisvolle Aufrüstung, einem erstarkten nationalen Selbstbewusstsein und der gigantischen Selbstdarstellung des Dritten Reiches während der Olympischen Spiele 1936 steht eine Bilanz des Terrors der NS-Diktatur gegenüber. Mit der Machtergreifung 1933 setzte ein gnadenloser innerer Krieg gegen Regimegegner, Randgruppen und Juden ein. Das System der Konzentrationslager wurde aufgebaut, die Nürnberger Gesetze erlassen, und der Novemberpogrom 1938 war bereits ein Vorbote des Holocausts.
Autor
Richard J. Evans, geboren 1947, war Professor of Modern History von 1998 bis 2008 und Regius Professor of History von 2008 bis 2014 an der Cambridge University. Seine Publikationen zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und zum Nationalsozialismus waren bahnbrechend. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Wolfson Literary Award for History und die Medaille für Kunst und Wissenschaft der Hansestadt Hamburg. 2012 wurde Evans von Queen Elizabeth II. zum Ritter ernannt. Zuletzt sind von ihm erschienen »Das europäische Jahrhundert. Ein Kontinent im Umbruch – 1815–1914« (DVA 2018), »Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830–1910« und »Das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien. Wer sie in die Welt gesetzt hat und wem sie nutzen« (beide Pantheon 2022).
Richard J. Evans
Das Dritte Reich
Band II
DIKTATUR
Aus dem Englischen von UDO RENNERT
Deutsche Verlags-AnstaltMünchen
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel The Third Reich in Power. 1933 -1939 bei Allen Lane in London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Pantheon Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © Richard J. Evans 2005
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2006
by Deutsche Verlags-Anstalt, München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Karten: András Bereznay, www.historyonmaps.com
ISBN 978-3-641-30695-3V002
www.pantheon-verlag.de
Für Matthew und Nicholas
Inhalt
Vorwort
Prolog
1. Der Polizeistaat
»Die Nacht der langen Messer«
Unterdrückung und Widerstand
»Volksfeinde«
Instrumente des Terrors
2. Geistige Mobilisierung
Volksaufklärung und Propaganda
Schreiben für Deutschland
Kunst und Architektur
Kampf um die Musik
3. Bekehrung der Seele
Glaubensfragen
Katholiken und Heiden
Die Eroberung der Jugend
»Kampf gegen den Intellekt«
4. Wohlstand und Korruption
Die »Arbeitsschlacht«
Wirtschaft, Politik und Krieg
Die »Arisierung« der Wirtschaft
Die Teilung der Beute
5. Aufbau der Volksgemeinschaft
Blut und Boden
Das Schicksal der Mittelschichten
Die Zähmung des Proletariats
Soziale Verheißung und soziale Wirklichkeit
6. Auf der Suche nach der rassischen Utopie
Im Geist der Wissenschaft
Die Nürnberger Gesetze
»Die Juden müssen aus ganz Europa heraus«
Die »Reichskristallnacht«
7. Der Weg in den Krieg
Von der Schwäche zur Stärke
Die Schaffung eines Großdeutschlands
Die Zerschlagung der Tschechoslowakei
Einmarsch in den Osten
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Landkartenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Sachregister
Personenregister
Vorwort
In diesem Buch wird die Geschichte des Dritten Reiches erzählt, des Regimes, das von Hitler und seinen Nationalsozialisten geschaffen wurde, von dem Zeitpunkt an, als es seine Machtübernahme im Sommer 1933 abgeschlossen hatte, bis zu dem Tag, an dem es Anfang September 1939 Europa in den Zweiten Weltkrieg stürzte. Ihm geht ein bereits früher erschienener Band voraus, Das Dritte Reich. Aufstieg, in dem die Anfänge des Nationalsozialismus geschildert, die Entwicklung seiner Ideen untersucht und sein Aufstieg zur Macht in den Jahren der glücklosen Weimarer Republik nachgezeichnet wurden. Ein dritter Band, Das Dritte Reich. Krieg, wird demnächst folgen und die Periode vom September 1939 bis zum Mai 1945 behandeln und dem Erbe des Nationalsozialismus in Europa und der Welt während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und bis in die Gegenwart nachgehen. Der allgemeine Ansatz aller drei Bände wurde im Vorwort zum ersten Band dargelegt und braucht hier nicht ausführlich wiederholt zu werden. Diejenigen, die dieses Buch bereits gelesen haben, können sofort zum Anfang des ersten Kapitels des vorliegenden Bandes übergehen; doch mag es dem einen oder anderen Leser wünschenswert erscheinen, daß ihm die zentralen Argumente dieses früheren Bandes in Erinnerung gerufen werden, und jene, die ihn noch nicht gelesen haben, können sich dem Prolog zuwenden, der die Hauptlinien der Ereignisse bis Ende Juni 1933 rekapituliert, mit denen die Geschichte auf den folgenden Seiten beginnt.
Der in dem vorliegenden Buch gewählte Ansatz ist zwangsläufig thematisch, doch in jedem einzelnen Kapitel habe ich mich wie im ersten Band bemüht, Erzählung, Beschreibung und Analyse miteinander zu verbinden und die sich im Lauf der Zeit ständig ändernde Lage zu verfolgen. Das Dritte Reich war keine statische oder monolithische Diktatur; es war dynamisch und überaus beweglich, von Anfang an besessen von grenzenlosen Haßgefühlen und Ambitionen. Alles andere beherrschend war jedoch der Wille zu einem Krieg, in dem Hitler und die Nationalsozialisten das Mittel zu einer rassischen Neuordnung Mittel- und Osteuropas durch die Deutschen sahen und zu einem Wiedererstarken Deutschlands als die vorherrschende Macht auf dem europäischen Kontinent und überhaupt der ganzen Welt. In jedem der folgenden Kapitel, in denen es um Überwachung und Unterdrückung, Kultur und Propaganda, Religion und Bildung, die Wirtschaft, Gesellschaft und das Alltagsleben, Rassenpolitik, Antisemitismus und Außenpolitik geht, zeigt sich der überragende Imperativ, Deutschland und seine Bevölkerung auf einen großen Krieg vorzubereiten, deutlich als der rote Faden. Doch dieser Imperativ war weder als solcher rational, noch wurde er in einer kohärenten Weise verfolgt. In einem Bereich nach dem anderen begegnen uns die Widersprüche und immanenten Irrationalitäten des Regimes; der blindwütige Drang der Nationalsozialisten zu einem Krieg enthielt bereits den Keim der schließlichen Vernichtung des Dritten Reiches. Auf welche Weise und warum es so kam, ist eine der Hauptfragen, die dieses Buch durchziehen und seine einzelnen Teile miteinander verbinden. Weitere Fragen betreffen das Ausmaß, in dem das Regime die Bevölkerung für sich gewinnen konnte; die Art und Weise, wie es funktionierte; das Ausmaß, in dem Hitler persönlich und nicht allgemeinere systematische Faktoren, die der Struktur des Dritten Reiches insgesamt eigentümlich waren, die treibende Kraft hinter den politischen Programmen war; die Möglichkeiten einer Opposition, des Widerstands, der Kritik oder gar eines Dissidententums unter einer Diktatur, die von allen ihren Bürgern eine totale Ergebenheit forderte; die Natur der Beziehung zwischen dem Dritten Reich und der Moderne; die Aspekte, unter denen seine Politik in verschiedenen Bereichen in den dreißiger Jahren Ähnlichkeiten oder Unterschiede gegenüber der Politik in anderen Ländern Europas und der übrigen Welt aufwiesen, und noch manches andere. Der innere Zusammenhang der einzelnen Kapitel ergibt sich aus der zeitlichen Abfolge der behandelten Ereignisse.
Während jedoch die Trennung der vielen Einzelaspekte des Dritten Reiches und ihre Zusammenfassung zu einzelnen Themen ihre kohärente Darstellung ermöglicht, hat sie zwangsläufig einen gewissen Informationsverlust zur Folge, da diese Aspekte sich in vielfältiger Weise gegenseitig beeinflußt haben. So wirkte sich etwa die Außenpolitik auf die Rassenpolitik und diese wiederum auf die Bildungspolitik aus, oder die Propaganda ging Hand in Hand mit der Unterdrückung. Deshalb ist die Behandlung eines Themas in einem bestimmten Kapitel notgedrungen unvollständig, und die einzelnen Kapitel sollten nicht als umfassende Darstellungen ihres Themas betrachtet werden. So wird beispielsweise die Verdrängung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben in dem Kapitel über die Wirtschaft und nicht in dem Kapitel über die Rassenpolitik behandelt; Hitlers Formulierung seiner Kriegsziele in dem sogenannten Hoßbach-Protokoll von 1937 ist dem Zusammenhang der Aufrüstung und nicht dem Kapitel über Außenpolitik zugeordnet worden, und die Auswirkung der Einverleibung Österreichs durch das Dritte Reich auf dessen Antisemitismus wird im Schlußkapitel und nicht im Zusammenhang mit dem Antisemitismus 1938 behandelt. Ich hoffe, daß diese Entscheidungen über den Aufbau des Buchs ihren Sinn haben, doch ihre Logik wird sich nur denen erschließen, die das Buch von Anfang bis Ende lesen. Wer das Buch einfach nur als Nachschlagewerk benutzen möchte, wird auf das Register verwiesen, wo die Stellen der wichtigsten Themen, Personen und Ereignisse angegeben sind.
Während der Arbeit an dem vorliegenden Buch habe ich einmal mehr von den unvergleichlichen Ressourcen der Cambridge University Library, der Wiener Library und des German Historical Institute in London profitiert. Das Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg und die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg ermöglichten mir freundlicherweise den Einblick in die Tagebücher von Luise Solmitz, und Bernhard Fulda besorgte mir großzügigerweise Kopien wichtiger Artikel aus deutschen Zeitungen. Der Rat und die Unterstützung vieler meiner Freunde und Kollegen waren für mich besonders wertvoll. Mein Agent Andrew Wylie und seine Mitarbeiter, insbesondere Christopher Oram und Michal Shavit, haben das Projekt in unterschiedlicher Weise gefördert und unterstützt. Stephanie Chan, Christopher Clark, Bernhard Fulda, Christian Goeschel, Victoria Harris, Robin Holloway, Max Horster, Valeska Huber, Sir Ian Kershaw, Scott Moyers, Jonathan Petropoulos, David Reynolds, Kristin Semmens, Adam Tooze, Nikolaus Wachsmann und Simon Winder lasen frühe Entwürfe, bewahrten mich vor manchen Irrtümern und gaben mir viele nützliche Anregungen: Ihnen allen bin ich zu Dank verpflichtet. Christian Goeschel übernahm zudem das Korrekturlesen der Anmerkungen und der Bibliographie. Simon Winder und Scott Moyers waren vorbildliche Lektoren, und ihr Rat und ihre Begeisterung trugen wesentlich zum Gelingen des Werks bei. Diskussionen mit Norbert Frei, Gavin Stamp, Riccarda Tomani, David Welch und vielen anderen waren ebenso hilfreich wie ihre Anregungen. David Watson hat seine Aufgabe als Redakteur hervorragend erledigt; Allison Hennessy nahm enorme Mühen auf sich bei der Suche nach geeigneten Bildern, und ich habe viel von der Zusammenarbeit mit András Bereznáy bei der Erstellung der Karten gelernt. Christine L. Corton hat das gesamte Manuskript durchgesehen, und über ihr berufliches Fachwissen hinaus war ihre praktische Unterstützung im Lauf der Jahre aus dem gesamten Projekt nicht wegzudenken. Unsere Söhne Matthew und Nicholas, denen dieses Buch wie bereits der erste Band gewidmet ist, waren eine willkommene Erholung von seinem grausamen Thema. Ihnen allen gilt mein Dank.
Cambridge, im Mai 2005
Prolog
I
Die Nationalsozialisten kamen in der ersten Jahreshälfte 1933 an die Macht, das Dritte Reich entstand auf den Trümmern des ersten Versuchs einer Demokratie in Deutschland, der unglücklichen Weimarer Republik. Bis zum Juli hatten die Nationalsozialisten praktisch alle wesentlichen Bestandteile des Regimes geschaffen, das Deutschland bis zu seinem Zusammenbruch fast zwölf Jahre später, 1945, beherrschen sollte. Sie hatten die offene Opposition auf allen Ebenen ausgeschaltet, einen Einparteienstaat ins Leben gerufen und alle wichtigen Institutionen der deutschen Gesellschaft mit Ausnahme der Reichswehr und der Kirchen »gleichgeschaltet«. Viele haben versucht zu erklären, wie es den Nationalsozialisten gelungen ist, innerhalb so kurzer Zeit eine solche Position der totalen Herrschaft über die deutsche Politik und Gesellschaft zu erringen. Ein Erklärungsmuster verweist auf seit langem bestehende Schwächen im deutschen Nationalcharakter, die dafür verantwortlich gemacht werden, daß die Deutschen der Demokratie ablehnend gegenüberstanden, bereitwillig rücksichtslosen Führern folgten und für die Parolen der Militaristen und Demagogen empfänglich waren. Doch wenn man auf das 19. Jahrhundert blickt, findet man hierfür kaum Belege. Liberale und demokratische Bewegungen waren nicht schwächer als in vielen anderen Ländern. Bedeutsamer war dagegen vielleicht die relativ spät erfolgte Schaffung eines deutschen Nationalstaats. Deutschland war, vor allem nach dem Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reiches 1806, das tausend Jahre zuvor von Karl dem Großen ins Leben gerufen worden war – das berühmte tausendjährige Reich, das Hitler nachahmen wollte – zersplittert bis zu den von Bismarck provozierten Kriegen zwischen 1864 und 1871, die zur Bildung des später sogenannten Zweiten Reichs führten, an dessen Spitze der Kaiser stand. In vieler Hinsicht war dieses Deutsche Reich ein moderner Staat: Es hatte ein nationales Parlament, das im Unterschied etwa zu seinem Gegenstück in England nach einem allgemeinen Männerwahlrecht gewählt worden war; die Wahlbeteiligung lag bei über 80 Prozent, und die politischen Parteien waren gut organisiert und ein akzeptierter Bestandteil des politischen Systems. Die größte von ihnen am Vorabend des Krieges, die Sozialdemokratische Partei, zählte über eine Million Mitglieder und hatte sich der Demokratie, der Gleichheit, der Frauenemanzipation sowie der Bekämpfung der Rassendiskriminierung und -vorurteile einschließlich des Antisemitismus verschrieben. Die deutsche Wirtschaft war die dynamischste Europas und hatte die britische um die Jahrhundertwende eingeholt, und in den fortschrittlichsten Sektoren wie der Elektro- und der Chemieindustrie lag sie sogar fast mit den Amerikanern gleichauf. Um die Jahrhundertwende waren in Deutschland die Werte, die Kultur und der Lebensstil des Bürgertums tonangebend. Moderne Kunst und Kultur machten sich in den Bildern von Expressionisten wie Max Beckmann und Ernst Ludwig Kirchner, den Bühnenstücken von Frank Wedekind und den Romanen Thomas Manns bemerkbar.
Natürlich hatte das Kaiserreich auch seine Schattenseite. In manchen Bereichen blieben die Privilegien des Adels erhalten, die Befugnisse des Reichstags waren eingeschränkt, und die großen Industriellen standen ebenso wie ihre Pendants in den Vereinigten Staaten den Gewerkschaften der Arbeiter feindselig gegenüber. Bismarcks Verfolgung zunächst der Katholiken in den Jahren nach 1870 und dann der jungen Sozialdemokratischen Partei in den achtziger Jahren gewöhnte die Deutschen an die Vorstellung, daß die Regierung ganze Teile der Bevölkerung zu »Reichsfeinden« erklären und ihre bürgerlichen Freiheiten drastisch beschneiden konnte. Die Katholiken reagierten darauf, indem sie sich bemühten, sich stärker in das soziale und politische System zu integrieren, die Sozialdemokraten, indem sie sich strikt an das Gesetz hielten und die Idee eines gewaltsamen Widerstandes oder einer gewaltsamen Revolution verwarfen, beides Verhaltensweisen, an die 1933 mit katastrophalen Folgen wieder angeknüpft werden sollte. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts kamen auch extremistische Parteien und Bewegungen auf, die behaupteten, das Reichseinigungswerk Bismarcks sei unvollständig, da Millionen ethnischer Deutscher noch immer außerhalb des Reiches lebten, vor allem in Österreich, aber auch in vielen anderen Teilen Mittel- und Osteuropas. Während einige Politiker forderten, Deutschland brauche ein großes Kolonialreich in Übersee wie die Engländer, begannen andere, aus den Ressentiments des Kleinbürgertums Kapital zu schlagen: die Angst der kleinen Ladenbesitzer vor den Warenhäusern, die Befürchtungen der männlichen Angestellten angesichts der zunehmenden Zahl weiblicher Angestellter oder die Verstörung von Bürgerlichen gegenüber expressionistischer und abstrakter Kunst sowie anderer beunruhigender Wirkungen der stürmischen sozialen, ökonomischen und kulturellen Modernisierung Deutschlands. Solche Gruppen fanden ein leichtes Ziel in der winzigen jüdischen Minderheit Deutschlands. Die deutschen Juden konstituierten nicht mehr als 1 Prozent der Bevölkerung, und viele von ihnen waren in der deutschen Gesellschaft und Kultur seit ihrer Emanzipation von den gesetzlichen Beschränkungen im Lauf des 19. Jahrhunderts erstaunlich erfolgreich. Für die Antisemiten waren die Juden die Ursache aller ihrer Probleme. Sie verlangten, die bürgerlichen Freiheiten für die Juden einzuschränken und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten zu beschneiden. Sehr bald verloren bürgerliche Parteien wie das Zentrum und die Konservativen Stimmen an antisemitische Splitterparteien. Sie reagierten darauf, indem sie in ihre Programme das Versprechen aufnahmen, den angeblich zersetzenden Einfluß der Juden in der deutschen Gesellschaft und Kultur einzudämmen. Zur gleichen Zeit verbreiteten in anderen Bereichen der Gesellschaft Sozialdarwinisten und Eugeniker die Behauptung, die deutsche »Rasse« müsse gestärkt werden, indem man die christliche Achtung vor dem Leben aufgebe und die Schwachen, die Behinderten, die Kriminellen und die Geisteskranken sterilisiere oder töte.
Solcherlei Ideen und Denkweisen hegte vor 1914 nur eine kleine Minderheit, und es gab auch noch niemanden, der sie in einem kohärenten System zusammengefaßt hätte. Der Antisemitismus war in der deutschen Gesellschaft zwar weitverbreitet, aber offene Gewalt gegen Juden war die Ausnahme. Der Erste Weltkrieg änderte das. Im August 1914 begrüßten jubelnde Menschenmengen den Kriegsausbruch auf den zentralen Plätzen der deutschen Großstädte, so wie sie es auch in anderen Ländern taten. Der Kaiser erklärte, von nun an kenne er keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche. Das Augusterlebnis wurde zu einem mythischen Symbol der deutschen Einheit, so wie das Bild Bismarcks eine mythische Sehnsucht nach einem starken und entschlossenen Führer heraufbeschwor. Die militärische Pattsituation, zu der es 1916 gekommen war, hatte zur Folge, daß die weitere Führung des Kriegs in die Hände von zwei Generälen gelegt wurde, die bedeutende Siege an der Ostfront errungen hatten, Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff. Es herrschte von da an quasi eine Militärdiktatur der Obersten Heeresleitung. Doch trotz ihrer straffen Organisation der Kriegsanstrengungen und ihrer Ausübung einer quasi-diktatorischen politischen Macht hatte das Kaiserreich den mächtigen Vereinigten Staaten, die 1917 in den Krieg eingetreten waren, nichts mehr entgegenzusetzen, und Anfang November 1918 war der Krieg verloren.
Die Niederlage im Ersten Weltkrieg hatte für Deutschland verheerende Folgen. Die Friedensbedingungen, die freilich kaum härter waren als die Bedingungen, die Deutschland im Fall seines Sieges seinen Gegnern auferlegen wollte, wurden von fast allen Deutschen mit Erbitterung aufgenommen. Zu den Forderungen gehörten umfangreiche finanzielle Reparationen für die Schäden durch die deutsche Besetzung Belgiens und Nordfrankreichs, die Zerstörung der deutschen Kriegsmarine und Luftwaffe, die Beschränkung des stehenden Heeres auf 100000 Mann und das Verbot moderner Waffen wie Panzer, die Abtretung von Territorium an Frankreich und vor allem an Polen. Der Krieg hatte auch die internationalen Wirtschaftsbeziehungen zerstört, und die Weltwirtschaft sollte sich in den folgenden 30 Jahren davon nicht mehr erholen. Nicht nur daß enorme Summen bezahlt werden mußten, der Zusammenbruch des Habsburgerreiches und die Schaffung neuer, unabhängiger Staaten in Mittel- und Osteuropa leisteten nationalen Egoismen Vorschub und machten eine internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit unmöglich. Insbesondere Deutschland hatte den Krieg mit gedruckten Banknoten und Kriegsanleihen bezahlt in der Erwartung, die Schulden durch die Annexion belgischer und französischer Industriegebiete sowie durch Reparationen zurückzahlen zu können. Die geforderten Reparationen konnten ohne Steuererhöhung nicht bezahlt werden, und keine deutsche Regierung war hierzu bereit, weil sie sonst von ihren Gegnern beschuldigt worden wäre, sie wolle mit deutschen Steuergeldern die Franzosen bezahlen. Das Ergebnis war eine Inflation. 1913 stand der Dollar bei 4 Papiermark; Ende 1919 stand er bei 47, im Juli 1922 bei 493 und im Dezember 1922 bei 7000 Mark. Die Reparationen mußten in Gold und Handelsgütern bezahlt werden, und bei dieser Inflationsrate waren die Deutschen weder willens noch in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Im Januar 1923 besetzten belgische und französische Truppen das Ruhrgebiet und begannen mit der Demontage und dem Abtransport von Industrieanlagen. Die deutsche Regierung stellte daraufhin alle Reparationszahlungen ein und forderte die Bevölkerung zu passivem Widerstand auf. Jetzt begann, mit ausgelöst durch die Finanzierung des passiven Widerstands, ein Prozeß der Entwertung der Mark gegenüber dem Dollar in einem beispiellosen Ausmaß. Im Juli kostete der US-Dollar 353 000 Mark, im August 4,5 Millionen, im Oktober 25 260 Millionen, im Dezember vier Millionen Millionen oder vier Billionen, eine Vier mit zwölf Nullen. Damit stand Deutschland vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch.
Schließlich wurde die Inflation gestoppt. Eine neue Währung wurde eingeführt, der passive Widerstand gegen die belgisch-französischen Truppen beendet und die Reparationszahlungen wurden wieder aufgenommen. Die Inflation spaltete die Mittelschichten in unterschiedliche Interessengruppen, die von keiner Partei wieder zusammengeführt werden konnten. Die Stabilisierung nach der Inflation, die Gehaltskürzungen und Rationalisierungen bedeuteten massive Arbeitsplatzverluste unter den Industriearbeitern wie den Beamten. Nach 1924 gab es Millionen Arbeitslose. Die kleinen Gewerbetreibenden fühlten sich in dieser Situation von der Regierung im Stich gelassen und sahen sich nach Alternativen um. Für die Mittelschichten insgesamt bedeutete die Inflation eine moralische und kulturelle Desorientierung, die sich für viele nur noch vertiefte angesichts der, wie sie es sahen, Exzesse der modernen Kultur in den zwanziger Jahren, von der Jazzmusik und dem Kabarett in Berlin bis zur abstrakten Kunst, der atonalen Musik und der experimentellen Literatur wie der konkreten Poesie der Dadaisten. Dieses Gefühl einer Orientierungslosigkeit war auch in der Politik gegenwärtig, nachdem auf die Niederlage im Krieg der Zusammenbruch des Reiches, die Flucht des Kaisers ins Exil und die Gründung der Republik in der Revolution vom November 1918 gefolgt war. Diese später so genannte Weimarer Republik hatte eine moderne Verfassung mit einem allgemeinen Wahlrecht ohne Ausschluß der Frauen, doch diese Neuerungen waren es nicht, was zu ihrem späteren Untergang führte. Das eigentliche Problem der Verfassung war der vom Volk gewählte Reichspräsident, der weitreichende Notstandsbefugnisse nach Art. 48 WRV hatte und mit Notverordnungen regieren konnte. Von dieser Möglichkeit machte bereits der erste Reichspräsident der Republik, der Sozialdemokrat Friedrich Ebert, ausgiebig Gebrauch. Als er 1925 starb, war sein gewählter Nachfolger Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, ein strammer Monarchist, der sich der Verfassung nicht besonders verpflichtet fühlte. In seinen Händen sollte sich Artikel 48 für das Schicksal der Republik als verhängnisvoll erweisen.
Das Vermächtnis des Ersten Weltkriegs war ein Kult der Gewalt, nicht nur in den Händen der Veteranen wie den rechtsradikalen Stahlhelmern, sondern vor allem innerhalb der jüngeren Generation der Männer, die nicht im Krieg gewesen waren und jetzt versuchten, den heroischen Taten ihrer Väter nachzueifern, indem sie an der Heimatfront kämpften. Der Krieg hatte die Politik polarisiert, mit kommunistischen Revolutionären auf der Linken und verschiedenen radikalen Gruppen auf der Rechten. Die berüchtigtsten von ihnen waren die Freikorps, bewaffnete Trupps, die von der Regierung eingesetzt wurden, um im Winter 1918/19 kommunistische und linksextreme revolutionäre Aufstände in Berlin und München niederzuschlagen. Im Frühjahr 1920 versuchten die Freikorps in Berlin einen gewaltsamen Putsch, der einen bewaffneten Aufstand der Linken im Ruhrgebiet auslöste, während es 1923 zu weiteren Aufständen von rechts und von links kam. Selbst in den vergleichsweise stabilen Jahren von 1924 bis 1929 wurden mindestens 170 Mitglieder verschiedener politischer paramilitärischer Gruppen bei Straßenkämpfen getötet; in den ersten Jahren nach 1930 ging die Zahl der Getöteten und Verletzten dramatisch in die Höhe, wobei allein zwischen März 1930 und März 1931 bei Zusammenstößen auf der Straße und in Versammlungsräumen 300 Tote zu beklagen waren. An die Stelle politischer Toleranz war endgültig ein gewalttätiger Extremismus getreten. Die liberalen Parteien und die gemäßigte Linke erlitten dramatische Stimmenverluste in der Mitte der zwanziger Jahre, als das Gespenst einer kommunistischen Revolution verblaßte und die bürgerlichen Schichten zunehmend für rechte Parteien stimmten. Die Parteien, welche die Weimarer Republik aktiv unterstützten, hatten nach 1920 zu keiner Zeit eine parlamentarische Mehrheit hinter sich. Schließlich wurde die Legitimität der Republik noch weiter ausgehöhlt durch die Einäugigkeit der Justiz zugunsten von Attentätern und Regimegegnern aus den Reihen der Rechten, die für ihre Taten patriotische Motive geltend machten, und durch die neutrale Haltung der Reichswehr, die der Republik mit wachsendem Groll gegenüberstand, weil es dieser nicht gelang, die internationale Gemeinschaft dazu zu bewegen, die Bestimmungen des Versailler Vertrags im Hinblick auf die Höchststärke des deutschen Heeres und das Verbot bestimmter Waffengattungen aufzuheben. Die deutsche Demokratie, nach der militärischen Niederlage in aller Eile improvisiert, war keineswegs von Anfang an zum Scheitern verurteilt, doch die Ereignisse der zwanziger Jahre bedeuteten, daß ihre Chancen nie sehr groß waren, sich auf einem festen Fundament zu entwickeln.
II
1919 gab es eine breite Palette von extremistischen antisemitischen Gruppen auf der äußersten Rechten, vor allem in München, doch 1923 ragte eine aus allen anderen hervor: die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei unter der Führung von Adolf Hitler. Über die Macht und den Einfluß von Hitler und der Nationalsozialisten ist so viel geschrieben worden, daß es wichtig ist festzuhalten, daß seine Partei bis ganz zum Ende der zwanziger Jahre an den äußersten Rändern der Politik operierte. Mit anderen Worten, Hitler war kein politisches Genie, das ganz allein die Unterstützung der Massen für sich und seine Partei mobilisierte. 1889 in Österreich geboren, war er ein gescheiterter Künstler mit einem unbürgerlichen Lebensstil, der ein großes Talent besaß: Die Fähigkeit, ein großes Publikum mit seiner Rhetorik zu bewegen. Seine 1919 gegründete Partei war dynamischer, rücksichtsloser und gewalttätiger als andere Splittergruppen der extremen Rechten. 1923 fühlte er sich stark genug, um in München einen gewaltsamen Putsch zu versuchen als ein Vorspiel zu einem Marsch auf Berlin nach dem Vorbild von Mussolinis »Marsch auf Rom« im Jahr zuvor. Doch es gelang ihm nicht, die Reichswehr oder die Kräfte des politischen Konservatismus in Bayern auf seine Seite zu ziehen, und die Putschisten wurden von einem Kugelhagel der Polizei auseinandergejagt. Hitler kam vor Gericht und mußte eine Haftstrafe in der Festung Landsberg antreten, wo er seinem Faktotum Rudolf Heß sein autobiographisches politisches Traktat Mein Kampf diktierte: es handelte sich allerdings nicht um einen Entwurf für die Zukunft, sondern war ein Kompendium der Ideen Hitlers, vor allem seines Antisemitismus und der Idee eines »rassischen« Krieges für »Lebensraum« in Osteuropa für alle, die sich die Mühe machen würden, es zu lesen.
Als er aus der Haft entlassen wurde, hatte Hitler die Ideologie des Nationalsozialismus aus verschiedenen Versatzstücken des Antisemitismus, des Pangermanismus, der Eugenik und der sogenannten »Rassenhygiene«, des geopolitischen Expansionismus, einer Feindschaft gegenüber der Demokratie und eines kulturellen Antimodernismus zusammengebastelt, die allesamt seit einiger Zeit im Schwange, doch bislang noch nicht in einem auch nur halbwegs kohärenten System integriert waren. Er sammelte eine Gruppe von unmittelbaren Untergebenen um sich – den talentierten Propagandisten Joseph Goebbels, den entschlossenen Mann des Handelns Hermann Göring und andere –, die sein Bild als Führer aufbauten und sein Gefühl einer Sendung bekräftigten. Doch trotz alledem und trotz des gewalttätigen Aktivismus seiner Braunhemden auf der Straße blieb er bis zum Ende der zwanziger Jahre politisch ein Niemand. Im Mai 1928 errangen die Nationalsozialisten nur 2,6 Prozent der abgegebenen Stimmen, und eine »große Koalition« aus Parteien der Mitte und der Linken übernahm unter der Führung der Sozialdemokraten die Regierung in Berlin. Im Oktober 1929 jedoch zog der große Börsenkrach an der Wall Street die deutsche Wirtschaft mit in den Strudel. Amerikas Banken zogen die Kredite wieder ab, mit denen die deutsche Wirtschaft seit 1924 finanziert worden war. Die deutschen Banken mußten daraufhin ihre Kredite an deutsche Unternehmen zurückfordern, und diesen blieb nichts anderes übrig, als ihre Arbeiter und Angestellten zu entlassen oder ihren Bankrott zu erklären, was viele von ihnen auch taten. Innerhalb von kaum mehr als zwei Jahren war über ein Drittel der deutschen Arbeiter arbeitslos, und Millionen weitere waren auf Kurzarbeit oder mußten Lohnkürzungen hinnehmen. Das System der Arbeitslosenversicherung brach vollkommen zusammen, so daß eine wachsende Zahl von Arbeitslosen keinerlei Unterstützung mehr hatte. Auch die Landwirtschaft, die wegen der sinkenden Nachfrage auf den Weltmärkten schon längst unter Druck geraten war, brach zusammen.
Die politischen Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf Deutschland waren verheerend. Die große Koalition brach auseinander; die Gegensätze zwischen den Parteien im Hinblick auf die zu treffenden Gegenmaßnahmen waren so groß, daß sich für keine entschlossene Aktion eine parlamentarische Mehrheit fand. Reichspräsident Hindenburg ernannte ein Kabinett von Fachleuten unter dem katholischen Politiker Heinrich Brüning, einem konservativen Monarchisten. Sein Rezept bestand aus einer Reihe von deflationären Kürzungen, was die Lage nur noch schlimmer machte. Dabei nahm das Kabinett Zuflucht zum Artikel 48 der Verfassung, so daß die politische Macht unter fast völliger Umgehung des Reichstags zum einen nach oben, zum Reichspräsidenten und dessen Beratern verlagert wurde, und zum anderen nach unten auf die Straße, wo die Gewalt immer drastischer um sich griff, angeheizt von Hitlers SA, deren Mitglieder inzwischen nach Hunderttausenden zählten. Für die Tausende junger Männer, die den Braunhemden zuströmten, wurde die Gewalt sehr bald eine Lebensform und fast eine Droge, während sie ihre Wut an den Kommunisten und Sozialdemokraten ausließen, so wie ihre Väter sie 1914–1918 am Feind ausgelassen hatten.
Viele SA-Männer waren zu Beginn der dreißiger Jahre ohne Arbeit. Dennoch war es nicht die Arbeitslosigkeit, die die Menschen bewog, sich den Nationalsozialisten anzuschließen. Die große Mehrheit der Arbeitslosen trieb es zu den Kommunisten, deren Stimmenanteil bei den Wahlen ständig anstieg, bis die KPD im November 1932 17 Prozent der Wählerstimmen und 100 Abgeordnetensitze im Reichstag errang. Ihre gewalttätige revolutionäre Rhetorik, mit der sie die Vernichtung des Kapitalismus und die Schaffung eines Rätedeutschlands androhten, erschreckte die bürgerlichen Schichten Deutschlands, die nur zu gut wußten, wie es dem russischen Bürgertum nach 1918 ergangen war. Entsetzt über die Unfähigkeit ihrer Regierung, die Krise zu bewältigen, und durch den Aufstieg der Kommunisten verängstigt, kehrten sie zunehmend den zerstrittenen kleinen Fraktionen der Rechten den Rücken und liefen zu den Nationalsozialisten über. Andere Gruppen folgten, darunter viele protestantische Kleinbauern und Arbeiter in Regionen, in denen die Kultur und die Traditionen der Sozialdemokraten bislang kaum Fuß gefaßt hatten. Während alle Parteien der bürgerlichen Mitte massive Verluste erlitten, konnten die SPD und das Zentrum ihre Verluste begrenzen. Doch 1932 waren sie die einzigen, die von der gemäßigten Mitte übriggeblieben waren, hilflos eingekeilt zwischen 100 kommunistischen und 196 nationalsozialistischen Abgeordneten in Braunhemden im Reichstag. Die Polarisierung der Politik hätte nicht dramatischer sein können.
Wie die Wahlen im September 1930 und im Juli 1932 zeigten, war die NSDAP somit ein Sammelbecken des sozialen Protests mit besonders starkem Wähleranhang in den bürgerlichen Schichten und einer relativ schwachen, wenn auch keineswegs unbedeutenden Anhängerschaft in der Arbeiterklasse. Sie waren nicht länger nur die Partei der protestantischen unteren Mittelschichten und der Bauern. Die verhaßte, unselige Weimarer Republik müsse weg, so verkündeten die Nationalsozialisten, und die Menschen müßten sich einmal mehr zu einer nationalen Gemeinschaft zusammenschließen, die keine Parteien oder Klassen kannte, so wie sie es schon 1914 getan hatten; Deutschland müsse sich wieder auf der internationalen Bühne behaupten und wieder zu einer führenden Macht werden: Mehr oder weniger darauf lief das Programm der Nationalsozialisten hinaus. Sie modifizierten ihr spezifisches Programm je nach dem Publikum, mit dem sie es zu tun hatten, spielten beispielsweise ihren Antisemitismus herunter, wo dieser keine Resonanz fand, nämlich in den meisten Teilen ihrer potentiellen Wählerschaft nach 1928. Neben den Nationalsozialisten und den Kommunisten, die die Sache auf der Straße ausfochten, und den Intriganten in der Umgebung von Reichspräsident Hindenburg, die um das Ohr des alten Mannes wetteiferten, betrat jetzt ein weiterer bedeutender Mitspieler die politische Bühne: die Reichswehr. Zunehmend beunruhigt über den Aufstieg des Kommunismus und das wachsende Chaos auf den Straßen, sah auch die Reichswehr in der politischen Lage eine Chance, sich der Weimarer Demokratie zu entledigen und eine autoritäre Militärdiktatur zu errichten, die den Vertrag von Versailles verwerfen und das Land für eine Rückeroberung der verlorenen Gebiete Deutschlands und eventuell auch eine Ausdehnung darüber hinaus wiederbewaffnen würde.
Die Macht der Reichswehr beruhte auf dem Umstand, daß sie die einzige Kraft war, welche, so schien es zumindest, die Ordnung in dem zerrütteten Land wirksam wiederherstellen konnte. Als Hindenburg im Frühjahr 1932 erneut zum Reichspräsidenten gewählt wurde, und zwar dank der Unterstützung der Sozialdemokraten, die in ihm das geringere Übel sahen als in seinem Gegenkandidaten Adolf Hitler, waren die Tage von Reichskanzler Brüning gezählt. Ihm war fast alles fehlgeschlagen, was er unternommen hatte, von dem Versuch, die wirtschaftliche Krise in den Griff zu bekommen, bis zur Wiederherstellung der Ordnung in deutschen Städten, und jetzt hatte er Hindenburg brüskiert, weil es ihm nicht gelungen war, dessen Wiederwahl ohne Opposition zu sichern, und weil das Kabinett vorgeschlagen hatte, das Reich solle nicht entschuldungsfähige Güter des ostpreußischen Adels etwa durch Zwangsversteigerung erwerben und an mittellose Bauern verteilen. Hindenburg war selbst Gutsbesitzer. Die Reichswehr wollte Brüning stürzen, weil er mit seiner deflationären Politik eine Wiederbewaffnung verhinderte. Wie viele konservative Gruppen hoffte sie, die Nationalsozialisten, nunmehr die größte Partei, als Legitimation und Unterstützung für die Zerstörung der Weimarer Demokratie einspannen zu können. Im Mai 1932 wurde Brüning zum Rücktritt gezwungen und durch den katholischen Landadligen Franz von Papen ersetzt, einen persönlichen Freund Hindenburgs.
Mit der Ernennung Franz von Papens zum Reichskanzler ertönte die Totenglocke der Weimarer Demokratie. Er benutzte die Reichswehr, um die sozialdemokratisch geführte Regierung in Preußen abzusetzen, und traf Vorbereitungen zu einer »Reform« der Weimarer Verfassung mit der Absicht, das Stimmrecht einzuschränken und die gesetzgeberischen Befugnisse des Reichstags drastisch zu beschneiden. Er ließ Zeitungen mit kritischen Artikeln verbieten und setzte bestimmte bürgerliche Freiheiten außer Kraft. Doch die Wahlen, die er im Juli 1932 ansetzte, ergaben nur einen weiteren Anstieg der Stimmen für die NSDAP, auf die jetzt 37,4 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen. Papens Versuch, Hitler und die Nationalsozialisten für die Unterstützung seiner Regierung zu gewinnen, schlugen fehl, als Hitler darauf bestand, er und nicht Papen müsse an der Spitze der Regierung stehen. Da ihm fast jede Unterstützung im Land fehlte, mußte Papen zurücktreten, als die Reichswehr die Geduld mit ihm verlor und ihren eigenen Mann in das Amt des Reichskanzlers bugsierte. Dem neuen Reichskanzler, General Kurt von Schleicher, gelang es ebensowenig, die Ordnung wiederherzustellen oder die Nationalsozialisten an der Regierung zu beteiligen, um seiner Politik der Errichtung eines autoritären Staates den Anschein einer Unterstützung durch das Volk zu geben. Nachdem die NSDAP bei den Reichstagswahlen im November 1932 zwei Millionen Stimmen verloren hatte, führten ihr augenscheinlicher Niedergang und ihr Mangel an finanziellen Mitteln zu einer ernsten Spaltung in ihren Reihen. Der Organisator der Partei und praktisch der zweite Mann hinter Hitler, Gregor Strasser, erklärte seinen Rücktritt aus seinen Parteiämtern, da Hitler nicht mit Papen und Hindenburg verhandeln wollte. Der Zeitpunkt schien günstig, um die Schwäche der Nationalsozialisten auszunützen. Am 30. Januar 1933 ernannte Hindenburg mit Zustimmung der Reichswehr Hitler zum Kanzler einer neuen Regierung, in deren Kabinett alle Posten bis auf zwei von Konservativen mit Franz von Papen als Vizekanzler besetzt waren.
III
In Wirklichkeit bezeichnete der 30. Januar 1933 den Anfang der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten und nicht eine konservative Konterrevolution. Hitler hatte die Fehler vermieden, die er zehn Jahre zuvor gemacht hatte: Er war in das Amt gelangt, ohne formal die Verfassung zu brechen, und zudem mit der Unterstützung des konservativen Establishments und der Reichswehr. Die Frage war jetzt, wie er seine Stellung in einem weiteren Koalitionskabinett der Weimarer Republik in eine Diktatur in einem Einparteienstaat überführen konnte. Zunächst fiel ihm nichts anderes ein als die Gewalt auf den Straßen zu verstärken. Er überredete Papen, Göring zum Innenminister Preußens zu ernennen, und in dieser Eigenschaft verpflichtete dieser sogleich die SA als Hilfspolizisten. Diese wiederum entledigte sich aller Hemmungen, verwüstete die Büros der Gewerkschaften, verprügelte Kommunisten und sprengte Versammlungen der Sozialdemokraten. In der Nacht vom 27. zum 28. Februar kam der Zufall den Nationalsozialisten zu Hilfe: Ein einzelner holländischer Anarchosyndikalist, Marinus van der Lubbe, zündete das Reichstagsgebäude an aus Protest gegen die Ungerechtigkeiten der Arbeitslosigkeit. Hitler und Göring bewogen ein bereitwilliges Kabinett, faktisch die Kommunistische Partei zu unterdrücken. 4000 Kommunisten, darunter fast die gesamte Parteiführung, wurden unverzüglich verhaftet, mißhandelt, gefoltert und in neu geschaffene Konzentrationslager gebracht. In den folgenden Wochen hielt die Welle der Gewalttaten und der Brutalität ungebrochen an. Ende März meldete die preußische Polizei, es befänden sich 20000 Kommunisten in Haft. Bis zum Sommer waren über 100 000 Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaftsfunktionäre und andere inhaftiert worden, und selbst nach amtlichen Schätzungen waren bis dahin rund 600 Personen in der »Schutzhaft« umgekommen. Das alles wurde durch eine Notverordnung gedeckt, die Hindenburg in der Nacht nach dem Reichstagsbrand unterschrieben hatte und mit der bestimmte Bürgerrechte außer Kraft gesetzt wurden und dem Kabinett erlaubt wurde, alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Die Brandstiftung des Einzeltäters van der Lubbe wurde von Joseph Goebbels, der bald zum Reichspropagandaminister aufsteigen sollte, als das Werk einer kommunistischen Verschwörung dargestellt, als das Signal zu einem bewaffneten Aufstand. Das überzeugte viele bürgerliche Wähler von der Berechtigung der Notverordnung.
Doch die Regierung sprach gegen die Kommunisten kein formelles, rechtsgültiges Verbot aus, da sie befürchtete, die KPD-Wähler würden dann bei den Wahlen, die Hitler für den 5. März angesetzt hatte, alle zu den Sozialdemokraten überlaufen. Trotz einer massiven Wahlpropaganda, die durch Spenden der deutschen Industrie bezahlt wurde, und einer massiven Einschüchterung der Wähler – so wurden Versammlungen der übrigen Parteien verboten oder gewaltsam aufgelöst – erreichte die NSDAP mit einem Stimmenanteil von 44 Prozent keine absolute Mehrheit. Die Regierung konnte sie nur durch eine Koalition mit der DNVP bilden. Die KPD errang trotz der Repressionsmaßnahmen noch 12 und die SPD 18 Prozent der Stimmen, während sich das Zentrum mit 11 Prozent behauptete. Damit waren Hitler und seine Kabinettskollegen noch immer ein ganzes Stück von einer Zweidrittelmehrheit entfernt, die sie für eine Verfassungsänderung benötigten. Mit der feierlichen Eröffnung des neugewählten Reichstags am »Tag von Potsdam« versuchten die Nationalsozialisten eine symbolische Versöhnung mit den konservativen politischen Kräften, die eine Rückkehr des Bismarckschen Kaiserreichs ersehnten. Am 23. März 1933 drohte Hitler im Reichstag mit einem Bürgerkrieg, wenn sein Antrag nicht durchgehen sollte. Außerdem gelang es den Nationalsozialisten, die Zentrumsabgeordneten mit dem Versprechen auf ihre Seite zu ziehen, mit dem Papst ein Konkordat zu schließen, mit dem die Rechte der deutschen Katholiken garantiert würden. Das sogenannte Ermächtigungsgesetz, das an diesem Tag von einer Zweidrittelmehrheit im Reichstag verabschiedet wurde, gab dem Kabinett das Recht, mit Verordnungen zu regieren, ohne den Reichstag oder den Reichspräsidenten einzuschalten. Zusammen mit der »Reichstagsbrandverordnung« lieferte dies den legalen Vorwand für die Errichtung einer Diktatur. Nur die 94 anwesenden Abgeordneten der SPD stimmten gegen das Gesetz.
Die Sozialdemokraten und die Kommunisten hatten bei den Reichstagswahlen im November 1932 zusammen 221 Mandate errungen, die NSDAP dagegen 196 und die DNVP 51. Trotzdem waren sie in keiner Weise in der Lage, der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten einen koordinierten Widerstand entgegenzusetzen. Diese beiden Linksparteien waren unter sich tief zerstritten. Die Kommunisten bezeichneten die Sozialdemokraten auf Anweisung Moskaus als »Sozialfaschisten« und behaupteten, sie seien schlimmer als die Nationalsozialisten. Die Sozialdemokraten ihrerseits sträubten sich dagegen, mit einer Partei zusammenzugehen, deren Unaufrichtigkeit und Skrupellosigkeit sie mit Recht fürchteten. Ihre paramilitärischen Organisationen kämpften entschlossen gegen die SA auf der Straße, doch gegen die Reichswehr, von der Hitler während des ganzen Jahres 1933 unterstützt wurde, hätten sie nichts ausrichten können, und der SA, deren Mitgliederzahl sich im Februar 1933 auf eine Dreiviertel Million belief, waren sie zahlenmäßig weit unterlegen. Die SPD wollte in dieser Lage ein Blutbad vermeiden und hielt an ihrem traditionellen Legalismus fest. Die Kommunisten glaubten, die Hitlerregierung sei der letzte Atemzug eines zum Tod verurteilten kapitalistischen Systems, das in Bälde zusammenbrechen und damit den Weg zu einer Revolution freimachen werde, so daß sie keine Notwendigkeit sahen, sich auf einen Aufstand vorzubereiten. Schließlich kam auch ein Generalstreik nicht in Frage, da über ein Drittel der Arbeiter arbeitslos waren; streikende Arbeiter würden mühelos durch arbeitslose Arbeiter ersetzt werden können, die alles tun würden, um sich und ihre Familien aus ihrem Elend zu befreien.
Goebbels erhielt die Zustimmung der Gewerkschaftsführer, die Einführung eines neuen öffentlichen Feiertags am 1. Mai 1933, eine langjährige Forderung der Gewerkschaften, zu unterstützen. Er machte daraus einen »Tag der nationalen Arbeit«, an dem die Arbeiter zu Hunderttausenden in ganz Deutschland unter Hakenkreuzfahnen zusammenkamen, um den Reden Hitlers und der übrigen Parteiführer, die über Lautsprecher auf öffentlichen Plätzen übertragen wurden, zuzuhören. Am nächsten Tag überfielen SA-Kommandos überall in Deutschland die Räumlichkeiten der SPD und der Gewerkschaften, plünderten sie, ließen das vorgefundene Bargeld mitgehen und schlossen die Büros. Innerhalb weniger Wochen hatten Massenverhaftungen von Gewerkschafts- und SPD-Funktionären, von denen viele in improvisierten Konzentrationslagern mißhandelt und gefoltert wurden, der Arbeiterbewegung das Rückgrat gebrochen. Danach waren die anderen Parteien an der Reihe. Die liberalen und die Splitterparteien wurden gezwungen, sich aufzulösen. Es begann eine Flüsterkampagne gegen Hitlers Koalitionspartner, die DNVP, verbunden mit der Schikanierung und Verhaftung ihrer Funktionäre und Abgeordneten. Hitlers wichtigster Verbündeter, der Vorsitzende der DNVP, Alfred Hugenberg, wurde gezwungen, aus dem Kabinett auszuscheiden, während der Fraktionsvorsitzende der Partei im Reichstag unter dubiosen Umständen tot in seinem Büro aufgefunden wurde. Proteste Hugenbergs wurden von Hitler mit einem hysterischen Ausbruch beantwortet, in dem er mit einem Blutbad drohte, falls die DNVP noch weiter Widerstand leistete. Bis Ende Juni war auch die DNVP aufgelöst. Die letzte große noch unabhängige Partei, das Zentrum, erlitt ein ähnliches Schicksal. Drohungen der Nationalsozialisten, katholische Beamte zu entlassen und katholische Laienorganisationen zu schließen, in Verbindung mit Papens panischer Angst vor dem Kommunismus führten zu einer Vereinbarung in Rom. Die Partei erklärte sich bereit, sich aufzulösen, wenn ein Konkordat geschlossen würde, das bereits am Tag des Ermächtigungsgesetzes zugesagt worden war. Das schien die Unantastbarkeit der katholischen Kirche in Deutschland samt ihren Vermögenswerten und Organisationen zu garantieren. Doch die Zeit sollte zeigen, daß die Vereinbarung nicht das Papier wert war, auf das sie geschrieben wurde. In der Zwischenzeit jedoch gehörte das Zentrum wie die übrigen Parteien der Vergangenheit an. Mitte Juli 1933 war Deutschland ein Einparteienstaat, eine Situation, die durch ein Gesetz besiegelt wurde, das alle Parteien außer der NSDAP verbot.
Es waren jedoch nicht nur die Parteien und Gewerkschaften, die verboten wurden. Der Angriff der Nationalsozialisten auf die Institutionen betraf die Gesellschaft insgesamt. Jede Länderregierung, jedes Länderparlament im föderalen politischen System Deutschlands, jeder Land-, Kreis- und Stadtrat wurde rücksichtslos »gesäubert«; die Reichstagsbrandverordnung und das Ermächtigungsgesetz wurden dazu benutzt, angebliche Staatsfeinde, sprich Gegner des Nationalsozialismus zu entlassen. Jeder Verband auf nationaler Ebene, jeder lokale Verein wurde der Kontrolle durch die Partei unterstellt, von den industriellen und agrarischen Interessengruppen bis hin zu Sportvereinen, Fußballklubs, Männerchören und Frauenorganisationen – kurzum, das gesamte Vereinsleben wurde »gleichgeschaltet«. Rivalisierende, politisch ausgerichtete Vereine oder Klubs gingen in einer einzigen NS-Masse auf. Bisherige Vorsitzende von Vereinen wurden entweder formlos entlassen oder sie unterwarfen sich freiwillig. Viele Organisationen schlossen politisch linksstehende oder liberale Mitglieder aus und legten ein Bekenntnis zum neuen Staat und dessen Institutionen ab. Dieser ganze Prozeß der »Gleichschaltung« überall in Deutschland dauerte vom März bis zum Juli 1933. Am Ende waren als einzige nicht gleichgeschaltete Organisationen die Reichswehr und die christlichen Kirchen übriggeblieben. Während dieser Zeit erließ die Regierung ein Gesetz, das es erlaubte, den Beamtenapparat zu »säubern«. Dies betraf auch Lehrer, Professoren und Dozenten, Richter und andere akademische Berufe. Sozialdemokraten, Liberale und nicht wenige Katholiken und Konservative wurden in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Um ihre Arbeitsplätze zu sichern, traten zwischen dem 30. Januar und dem 1. Mai 1933 1,6 Millionen Menschen in die NSDAP ein; danach verfügte die Parteiführung eine Aufnahmesperre. Die Zahl der SA-Männer war bis zum Sommer 1933 auf über 2 Millionen angewachsen.
Der Anteil der Beamten, die tatsächlich aus politischen Gründen aus dem Dienst entfernt wurden, war allerdings sehr gering. Dagegen wurden zahllose Beamte in den Ruhestand versetzt, weil sie »nichtarischer« Abstammung waren. Ein am 7. April 1933 verabschiedetes Gesetz ermöglichte die Versetzung jüdischer Beamter in den Ruhestand, auch wenn Hindenburg eine Ausnahmeklausel durchgesetzt hatte für alle vor dem 1. August 1914 Verbeamtete, Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs und die Söhne oder Väter von Kriegsgefallenen. Die Juden, so Hitlers Behauptung, seien ein zersetzendes, parasitäres Element, dessen man sich entledigen müsse. Tatsächlich gehörten die meisten Juden in Deutschland der bürgerlichen Schicht an und waren in ihrer politischen Überzeugung – soweit sie eine hatten – liberal bis konservativ. Dennoch war Hitler überzeugt, daß sie Deutschland während des Ersten Weltkriegs bewußt geschadet und die Revolution ausgelöst hätten, aus der die Weimarer Republik hervorgegangen war. Zweifellos waren einige führende Funktionäre der KPD und der SPD Juden, jedoch längst nicht alle. Aber die Nationalsozialisten hielten sich nicht lange mit Differenzierungen auf. Einen Tag nach den Märzwahlen randalierten SA-Männer auf dem Berliner Kurfürstendamm, machten Jagd auf Juden und mißhandelten sie schwer. Sie verwüsteten Synagogen, und überall in Deutschland drangen Horden von Braunhemden in die Gerichte ein, zerrten jüdische Richter und Anwälte ins Freie, verprügelten sie mit Gummiknüppeln und drohten, sie sollten die Gerichte nie wieder betreten. Stellte sich heraus, daß einer der verhafteten Kommunisten oder Sozialdemokraten jüdisch war, wurde dieser besonders brutal behandelt. Bis Ende Juni waren über 40 Juden von SA-Männern ermordet worden.
Über solche Zwischenfälle wurde in der Auslandspresse ausführlich berichtet. Das nahmen Hitler, Goebbels und die anderen Parteiführer zum Vorwand, einen seit langem erwogenen Plan in die Tat umzusetzen, einen landesweiten Boykott jüdischer Geschäfte, Arztpraxen und Anwaltskanzleien durchzuführen. Am 1. April 1933 standen SA-Männer drohend vor den Schaufenstern von Läden und Warenhäusern jüdischer Inhaber und trugen Schilder mit der Aufschrift: »Deutsche, kauft nicht bei Juden!« Die meisten nichtjüdischen Deutschen befolgten die Aufforderung, allerdings ohne besondere Begeisterung. Die größten jüdischen Firmen blieben von dem Boykott ausgenommen, da sie für die Wirtschaft zu wichtig waren. Als sich zeigte, daß der Boykott bei der Bevölkerung keine enthusiastischen Reaktionen auslöste, blies Goebbels ihn nach wenigen Tagen wieder ab. Doch die Mißhandlungen von Juden auf der Straße, die Schändung von Synagogen und der Boykott zeigten bei der jüdischen Gemeinde in Deutschland Wirkung: Bis zum Jahresende waren 37000 ihrer Mitglieder ausgewandert. Die Vertreibung der Juden, die von den Nationalsozialisten nicht wegen ihrer Religionszugehörigkeit, sondern aufgrund »rassischer« Kriterien verfolgt wurden, machte sich auf besondere Weise in den Naturwissenschaften, im kulturellen Leben und in den Künsten bemerkbar. Jüdische Dirigenten und Musiker wie Bruno Walter und Otto Klemperer wurden kurzerhand entlassen oder am Auftreten gehindert. Film und Funk wurden innerhalb kurzer Zeit von Juden und Regimegegnern »gesäubert«. Tageszeitungen, die nicht auf der Parteilinie lagen, wurden verboten oder unter die Kontrolle der Partei gebracht, während der Reichsverband der deutschen Presse und der Reichsverband der deutschen Zeitungsverleger sich der Parteiführung unterstellten. Linke und liberale Schriftsteller wie Bertolt Brecht, Thomas Mann und zahllose andere durften nicht mehr publizieren; viele verließen das Land. Hitlers ganz besondere Feindseligkeit galt modernen Malern wie Paul Klee, Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner und Wassily Kandinsky. Vor 1914 hatten Hitlers peinlich genaue gegenständliche Zeichnungen von Gebäuden ihm nicht die ersehnte Aufnahme an der Wiener Akademie verschafft. Man hatte befunden, daß sein Talent nicht ausreiche. In der Weimarer Republik waren abstrakte und expressionistische Künstler zu Wohlstand und Ruhm gelangt mit Bildern, die in den Augen Hitlers nur häßliche und bedeutungslose Klecksereien waren. Während er in seinen Reden gegen die moderne Kunst vom Leder zog, wurden die Direktoren von Galerien und Kunstmuseen entlassen und durch Männer ersetzt, die begeistert alle modernistischen Arbeiten aus Ausstellungen entfernten. Die vielen modernistischen Künstler und Komponisten, die wie Klee oder Schönberg eine Stellung in staatlichen Bildungsanstalten bekleideten, mußten allesamt den Hut nehmen.
Insgesamt emigrierten mindestens 2000 Kunstschaffende in den Jahren nach 1932 aus Deutschland. Unter ihnen befanden sich praktisch alle, die einen internationalen Ruf genossen. Der Antiintellektualismus der Nationalsozialisten manifestierte sich auch an den Universitäten. Auch hier wurden jüdische Professoren aller Fakultäten entlassen. Viele von ihnen wie Albert Einstein, Gustav Hertz, Erwin Schrödinger, Max Born sowie zwanzig gegenwärtige oder zukünftige Nobelpreisträger verließen das Land. Bis 1934 hatte man rund 1600 von 5000 Universitätslehrern davongejagt, ein Drittel, weil sie Juden, die übrigen, weil sie politische Gegner der Nationalsozialisten waren. 16 Prozent der Physikprofessoren und -assistenten wanderten aus. An den Universitäten waren es vor allem die Studenten, unterstützt von einer kleinen Zahl nationalsozialistischer Professoren wie dem Philosophen Martin Heidegger, die die »Säuberungen« fortsetzten. Sie zwangen jüdische und linke Professoren durch gewalttätige Demonstrationen aus den Universitäten, und am 10. Mai 1933 organisierte die Deutsche Studentenschaft Demonstrationen in 19 Universitätsstädten, bei denen zahllose Bücher jüdischer und linksstehender Schriftsteller auf brennende Scheiterhaufen geworfen wurden. Was die Nationalsozialisten erreichen wollten, war eine Kulturrevolution, bei der angeblich fremde kulturelle Einflüsse – insbesondere die von Juden und allgemein die der modernistischen Kultur – eliminiert und der deutsche Geist wiedergeboren werden sollte. Die Deutschen sollten sich nicht einfach nur in das Dritte Reich fügen, sie sollten es aus ganzem Herzen unterstützen, und die Errichtung des Reichspropagandaministeriums unter Joseph Goebbels, das sehr bald die ganze Sphäre der Kultur und der Künste kontrollierte, war das hauptsächliche Instrument zur Verwirklichung dieses Ziels. Dessenungeachtet war der Nationalsozialismus in vieler Hinsicht ein durchaus modernes Phänomen, daran interessiert, die neueste Technik einzusetzen, die neuesten Waffen und die wissenschaftlichsten Mittel zur Umgestaltung der deutschen Gesellschaft nach seinem Willen. »Rasse« war für die Nationalsozialisten eine wissenschaftliche Kategorie, und indem sie diese zur Grundlage ihrer gesamten Politik machten, stützten sie sich auf das, was sie als die Anwendung einer wissenschaftlichen Methode auf die Gesellschaft ansahen. Nichts, weder religiöse Überzeugungen noch moralische Skrupel noch eine altehrwürdige Tradition sollte ihre Revolution aufhalten. Doch im Sommer 1933 sah Hitler sich gezwungen, seinen Anhängern zu sagen, daß es Zeit sei für die Revolution, zu einem Ende zu kommen. Deutschland brauche eine Periode der Stabilität. Dieses Buch beginnt mit diesem Augenblick, dem Augenblick, als die Vernichtung der Überreste der Weimarer Republik vollendet worden und das Dritte Reich endgültig an die Macht gelangte.
1. KAPITEL
Der Polizeistaat
»Die Nacht der langen Messer«
I
Am 6. Juli 1933 lud Hitler die Reichsstatthalter der Länder zu einer Konferenz ein, um eine Bestandsaufnahme der allgemeinen Lage zu machen und Fragen der zukünftigen Politik zu erörtern. Die nationalsozialistische Revolution habe Erfolg gehabt, sagte er, sie hätten die Macht, und sie hätten sie allein. Der Zeitpunkt sei gekommen, das Regime zu stabilisieren. Es müsse jetzt Schluß sein mit dem Gerede, wie man es unter den ranghohen Mitgliedern der SA hören könne, daß nämlich auf die »Machteroberung« nunmehr eine »zweite Revolution« folgen müsse:
»Die Revolution ist kein permanenter Zustand, sie darf sich nicht zu einem Dauerzustand ausbilden; man muß den frei gewordenen Strom der Revolution in das sichere Bett der Evolution hinüberleiten … Das Schlagwort von der zweiten Revolution war so lange berechtigt, als in Deutschland noch Positionen vorhanden waren, die als Kristallisationspunkt für eine Gegenrevolution gelten könnten. Dies ist nicht der Fall. Wir lassen keinen Zweifel darüber, daß wir einen solchen Versuch, wenn nötig, in Blut ertränken würden. Eine zweite Revolution könnte sich also nur gegen die erste richten.«1
Dieser Erklärung folgten in den Wochen danach noch zahlreiche ähnliche, wenngleich weniger offen drohende Äußerungen anderer nationalsozialistischer Führer. Das Reichsjustiz- und das Reichsinnenministerium drängten zunehmend darauf, daß keine willkürliche Gewalt mehr geduldet werden dürfe, und das Reichswirtschaftsministerium war besorgt, daß eine weitere Unruhe bei der internationalen Finanzgemeinde den Eindruck einer anhaltenden Instabilität in Deutschland erwecken, daß sie vor Investitionen zurückschrecken und dies die wirtschaftliche Erholung gefährden könnte. Das Reichsinnenministerium beklagte sich über die Verhaftung von Beamten, das Reichsjustizministerium über die Verhaftung von Rechtsanwälten. Die Gewalttaten der SA gingen überall in Deutschland weiter, wobei die »Köpenicker Blutwoche« im Juni 1933 traurige Berühmtheit erlangte. Ein Rollkommando der SA in Berlin-Köpenick war auf den Widerstand eines jungen Sozialdemokraten gestoßen. Nachdem der Sozialdemokrat drei SA-Männer erschossen hatte, rotteten sich SA-Männer in großer Zahl zusammen, verhafteten über 500 Männer des Viertels und folterten sie so brutal, daß 91 von ihnen starben.2 Gewalttaten dieser Art wollte man nun unterbinden: Es war nicht mehr nötig, die Gegner des Regimes durch Mißhandlungen gefügig zu machen. Außerdem war Hitler mittlerweile beunruhigt über die zunehmende Machtposition, die dem Führer der SA, Ernst Röhm, aufgrund der wachsenden Mitgliederzahl zufiel. Dieser hatte am 30. Mai 1933 in einer Verfügung im Hinblick auf die SA erklärt, »die Aufgabe, die nationalsozialistische Revolution zu vollenden …, liegt … noch vor ihr«. »Entscheidend ist nicht«, setzte er hinzu, »daß täglich ein ›gleichgeschalteter‹ Bienenzucht- oder Kegelverein Treueerklärungen beschließt oder daß Straßen der Städte zeitgenössische Namen erhalten.« Mochten andere den Sieg des Nationalsozialismus feiern, doch die politischen Soldaten, die ihn erkämpft hatten, müßten jetzt die Sache in die Hand nehmen und voranbringen.3
Am 2. August 1933 hob Hermann Göring, über solche Erklärungen beunruhigt, in seiner Eigenschaft als preußischer Ministerpräsident eine Anordnung vom Februar auf, mit der die Braunhemden als Hilfspolizisten der preußischen Polizei eingestellt worden waren. Die Innenministerien anderer Länder folgten seinem Beispiel. Die reguläre Polizei hatte jetzt einen größeren Spielraum im Umgang mit den SA-Exzessen. Das preußische Justizministerium richtete eine »Zentralstaatsanwaltschaft« ein, die alle strafwürdigen Ausschreitungen von SA- und SS-Männern in den Konzentrationslagern untersuchen und unter Umständen gerichtlich verfolgen sollte, ordnete jedoch zugleich am 25. Juli die Einstellung von laufenden Verfahren gegen SA- und SS-Männer wegen Gewaltverbrechen und die Amnestierung der wenigen bislang Verurteilten an. Strenge Bestimmungen wurden im Hinblick darauf erlassen, wer berechtigt war, Personen in »Schutzhaft« zu nehmen, und welches Verfahren dabei eingehalten werden mußte. Ein Hinweis darauf, was bis dahin gängige Praxis war, wurde durch die Verbote geliefert, die in den im April 1934 gemeinsam erlassenen Vorschriften enthalten waren: Niemand durfte aus persönlichen Gründen wie etwa Verleumdung in »Schutzhaft« genommen werden, weil er Angestellte entlassen hatte, als Rechtsvertreter von Personen aufgetreten war, die anschließend inhaftiert wurden, oder weil er eine unerwünschte Klage bei Gericht eingereicht hatte. Ihres ursprünglichen Daseinszwecks als der Arm der nationalsozialistischen Bewegung beraubt, der Straßenkämpfe ausfocht und politische Versammlungen sprengte, und ihrer Position als Aufseher über zahlreiche improvisierte Schutzhaftlager und Folterkeller enthoben, sah sich die SA unvermittelt ohne eine echte Aufgabe.4
Da es jetzt keine freien Wahlen mehr gab, hatte die SA keine Gelegenheit mehr, auf den Straßen zu marschieren und in die Versammlungen anderer Parteien einzudringen. Enttäuschung machte sich bemerkbar. Die SA hatte im Frühjahr einen enormen Zulauf von Sympathisanten und Trittbrettfahrern verzeichnet. Im März 1933 hatte Röhm verkündet, jeder »patriotisch gesinnte« Deutsche könne eintreten. Nachdem im Mai keine neuen Mitglieder mehr in die NSDAP aufgenommen wurden, da die Parteiführung befürchtete, unter den Bewerbern befänden sich zu viele Opportunisten und ihre Bewegung werde von Menschen überschwemmt, die sich der Sache nicht wirklich verschrieben hatten, sahen viele im Eintritt in die SA eine Alternative und schwächten damit die Verbindungen zwischen der Partei und ihrem paramilitärischen Flügel. Die zwangsweise Eingliederung der Veteranenorganisation »Stahlhelm« in die SA in der zweiten Jahreshälfte 1933 bedeutete eine weitere zahlenmäßige Stärkung der Braunhemden. Anfang 1934 gab es sechsmal so viele SA-Männer wie zu Beginn des Vorjahres. Die Gesamtstärke der Sturmabteilung betrug inzwischen knapp drei Millionen Mann; rechnete man noch den Stahlhelm und andere in der SA aufgegangene Wehrverbände hinzu, waren es viereinhalb Millionen. Das mußte die Größe der Reichswehr lächerlich klein erscheinen lassen, deren Höchststärke durch den Versailler Vertrag auf 100 000 Mann begrenzt war. Andererseits war die Reichswehr trotz der Einschränkungen durch Versailles weitaus besser ausgerüstet und ausgebildet als die SA. Das Gespenst eines Bürgerkriegs, das sich Anfang 1933 so drohend gezeigt hatte, schien erneut umzugehen.5
Die Unzufriedenheit der SA-Männer rührte nicht nur aus dem Neid auf die Reichswehr und dem Unwillen gegenüber einer Politik der Stabilisierung nach dem Juli 1933. Viele »alte Kämpfer« grollten den Neuzugängen, die im Frühjahr 1933 noch schnell auf das Trittbrett aufgesprungen waren. Besonders stark waren die Ressentiments gegenüber den Stahlhelmern. Sie führten in den ersten Monaten 1934 zunehmend zu Raufereien und Kämpfen. In Pommern verbot die Polizei ehemalige Stahlhelmformationen (die sich in »NS-Frontkämpferbund« umbenannt hatten), nachdem ein SA-Führer von einem ehemaligen Stahlhelmer ermordet worden war.6 Doch der Unmut der alten Braunhemden richtete sich auch gegen Personen außerhalb ihrer Organisation. Viele hatten sich von der Ausschaltung der Gegner der Partei reiche Belohnung versprochen und wurden enttäuscht, als bewährte Lokalpolitiker und konservative Partner der Nationalsozialisten die fettesten Brocken bekamen. Ein SA-Mann, Jahrgang 1897, schrieb 1934:
»Nach der Machtergreifung änderte sich die Lage dramatisch. Menschen, die mich bisher verspottet hatten, waren nunmehr voll des Lobes. In meiner Familie und unter allen Verwandten war ich auf einmal die Nummer Eins, nach Jahren einer erbitterten Fehde. Meine Sturmabteilung wuchs sprunghaft von Monat zu Monat an, so daß ich (vom Januar mit 250) bis zum 1. Oktober 1933 2200 Mitglieder hatte – so daß ich um Weihnachten zum Obersturmbannführer befördert wurde. Doch je mehr die Spießer mich über den grünen Klee lobten, desto mißtrauischer wurde ich, daß diese Schufte glaubten, sie hätten mich im Sack… Nach der Aufnahme der Stahlhelmer, als die Sache ein Ende hatte, zahlte ich es der reaktionären Clique heim, die hinter meinem Rükken versuchte, mich vor meinen Vorgesetzten lächerlich zu machen. Es gab die unterschiedlichsten Denunziationen gegen mich bei höheren SA-Stellen und den Behörden… Schließlich schaffte ich es, zum Bürgermeister am Ort ernannt zu werden…, so daß ich allen prominenten Spießern und den reaktionären Überresten der alten Zeit das Genick brechen konnte…«7
Solche Empfindungen waren sogar noch stärker unter den vielen Veteranen in der SA, die es nicht geschafft hatten, in eine solche Machtposition zu gelangen.
Da es für die gewalttätigen Energien der jungen SA-Männer keine klaren politischen Zielgruppen mehr gab, wurden sie zunehmend überall in Deutschland in Händel und Raufereien verwickelt, häufig ohne erkennbares politisches Motiv. Horden von SA-Männern betranken sich, verursachten nächtliche Ruhestörungen, verprügelten grundlos harmlose Passanten und griffen die Polizei an, wenn diese versuchte, ihrer Herr zu werden. Die Sache wurde noch schlimmer durch den Versuch Röhms im Dezember 1933, die Braunhemden der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu entziehen. Von da an wurde den SA-Männern gesagt, Disziplinprobleme würden innerhalb der Organisation selbst geregelt. Das war ein Freibrief für Untätigkeit, auch wenn es immer noch zu polizeilichen und juristischen Verfolgungen von Straftaten kam. Noch schwieriger war es für Röhm, eine eigene SA-Justiz einzuführen, die nachträglich mehr als 4000 Verfahren gegen SA- und SS-Angehörige wegen verschiedener Vergehen aufarbeiten sollte, die in den ersten Monaten des Jahres 1933 verübt worden und im Mai 1934 noch vor einem Gericht anhängig waren. Viele Verfahren wurden eingestellt, und in zahlreichen weiteren Fällen waren die Vergehen gar nicht erst verfolgt worden, aber trotzdem war noch eine beträchtliche Zahl übriggeblieben. Die Reichswehr hatte außerdem ihre eigene Militärgerichtsbarkeit; indem Röhm ein paralleles Rechtssystem innerhalb der SA errichtete, konnte er die Stellung seiner Organisation ein ganzes Stück der Reichswehr annähern. In einem Runderlaß erklärte er im Juli 1933, »daß als Sühne für den Mord an einem SA-Mann durch den zuständigen SA-Führer bis zu 12 Angehörige von der feindlichen Organisation, von der der Mord vorbereitet wurde, gerichtet werden dürfen«.8 Zweifellos mußte eine Möglichkeit gefunden werden, all diese überschüssige Energie in nützliche Kanäle zu leiten. Doch die Führung der SA machte die Sache noch schlimmer, indem sie den gewalttätigen Aktivismus der Bewegung auf »die Fortsetzung der deutschen Revolution« richtete.9 Röhm sprach in den ersten Monaten des Jahres 1934 auf zahlreichen Kundgebungen und Aufmärschen, betonte das revolutionäre Wesen des Nationalsozialismus und führte offene Angriffe auf die Parteiführung und vor allem die Reichswehr, deren Führung die SA die Schuld daran gab, daß sie 1932 durch Reichskanzler Brüning vorübergehend verboten worden war. Röhm sorgte für beträchtliche Unruhe in den höheren Rängen der Reichswehr, als er erklärte, er wolle aus der SA die Basis für eine nationale Miliz machen, was praktisch die Umgehung und vielleicht am Ende sogar die Ersetzung der Reichswehr bedeutete. Hitler versuchte, ihn abzuspeisen, indem er ihn im Dezember 1933 zum Minister ohne Geschäftsbereich mit einem Sitz im Kabinett machte, doch angesichts der zunehmenden Entbehrlichkeit des Kabinetts in dieser Phase war dies nur von geringer praktischer Bedeutung und kein Ersatz für Röhms eigentliche Ambition, nämlich die Übernahme des Reichswehrministeriums, das General Werner von Blomberg unterstand.10
Ohne wirkliche Macht im Zentrum begann Röhm mit der Schaffung eines Kults seiner eigenen Führung innerhalb der SA und betonte auch weiterhin die Notwendigkeit einer zweiten Revolution.11 Im Januar 1934 bewiesen SA-Männer ihren Radikalismus, als sie in das Hotel Kaiserhof in Berlin eindrangen und die Feier einiger Reichswehroffiziere anläßlich des Geburtstags des ehemaligen Kaisers Wilhelm II. störten.12 Am nächsten Tag schickte Röhm an Blomberg eine Denkschrift über die künftige Rolle der Reichswehr. Diese forderte, so Blomberg, der möglicherweise absichtlich etwas übertrieb, daß die SA die Rolle der Reichswehr übernehmen müsse, während die Reichswehr nur noch als Ausbildungsheer für die SA fungieren sollte.13 Für die Spitzen der Reichswehr stellten die Braunhemden nunmehr eine ernste Bedrohung dar. Seit dem Sommer 1933 hatte Blomberg darauf hingewirkt, daß die Reichswehr ihren Standpunkt einer formalen politischen Neutralität aufgab und das Regime mehr und mehr unterstützte. Blomberg und seine Verbündeten waren durch Hitlers Versprechen einer massiven Erweiterung der deutschen militärischen Stärke durch die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht geködert worden. Des weiteren versicherte Hitler ihnen, er werde eine aggressive Außenpolitik betreiben mit dem Ziel, die durch den Vertrag von Versailles verlorengegangenen Gebiete zurückzugewinnen, und einen Eroberungskrieg im Osten führen. Blomberg bekundete seinerseits ostentativ seine Loyalität gegenüber dem Dritten Reich durch die Übernahme des »Arierparagraphen« (d.h. Juden waren fortan vom Dienst in der Reichswehr ausgeschlossen) und die Aufnahme des Hakenkreuzes in den Insignienbestand der Reichswehr. Auch wenn dies weitgehend symbolische Gesten waren – auf eine Intervention von Reichspräsident Hindenburg hin beispielsweise konnten jüdische Kriegsveteranen nicht aus der Reichswehr entlassen werden, und tatsächlich waren nur rund 70 Soldaten betroffen –, so waren sie doch wichtige Konzessionen an die nationalsozialistische Weltanschauung, die zeigten, wie weit die Reichswehr sich mit der neuen Ordnung arrangiert hatte.14
Gleichzeitig war das Heer jedoch keineswegs eine gleichgeschaltete Institution. Seine relative Unabhängigkeit wurde untermauert durch das starke Interesse, das der formelle Oberbefehlshaber, Reichspräsident Paul von Hindenburg, für die Armee hegte. Hindenburg hatte sich sogar geweigert, Walther von Reichenau, den Hitler und Blomberg als Nachfolger des konservativen und NS-feindlichen Kurt von Hammerstein vorgeschlagen hatten, zum Chef der Heeresleitung zu ernennen, als Hammerstein aus dem aktiven Dienst ausschied. Statt dessen hatte er die Ernennung von Generaloberst Werner von Fritsch durchgesetzt, einem beliebten Stabsoffizier mit starken konservativen Überzeugungen, einer Leidenschaft für das Reiten und einer streng protestantischen Weltanschauung. Unverheiratet, ein besessener Arbeiter und Militär mit Leib und Seele, besaß Fritsch die arrogante Verachtung des preußischen Offiziers für die Vulgarität der Nationalsozialisten. Sein konservativer Einfluß wurde unterstützt vom Chef des Truppenamts, General Ludwig Beck, der Ende 1933 ernannt wurde. Beck war ein zurückhaltender, in sich gekehrter Mann, ein Witwer, der seine Freizeit ebenfalls am liebsten auf dem Pferderücken verbrachte. Mit Männern wie Fritsch und Beck auf zwei der höchsten Positionen der Reichswehr bestand keine Aussicht, daß das Heer dem Druck der SA nachgeben würde. Am 28. Februar 1934 kam es zu einem Treffen zwischen Hitler und den Spitzen von SA und SS und der Reichswehr, bei dem Röhm gezwungen wurde, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, daß er jeden Versuch unterlassen werde, die Reichswehr durch eine Miliz aus Braunhemden zu ersetzen. Deutschlands militärische Macht der Zukunft, erklärte Hitler emphatisch, würde ein hervorragend ausgebildetes und ausgerüstetes Heer sein, für das die SA lediglich unterstützende Aufgaben wahrnehmen