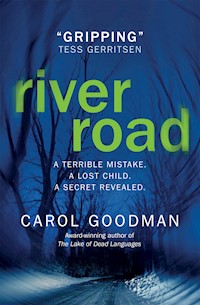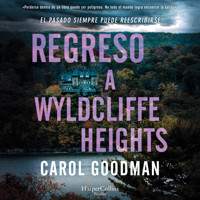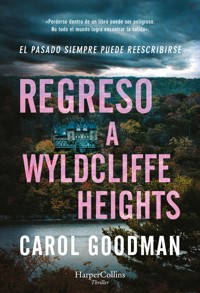Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein altes College – ein eiskalter Killer: Der fesselnde Spannungsroman »Das dunkle Geheimnis von Penrose« von Carol Goodman als eBook bei dotbooks. Ein Ort, der voll von dunklen Erinnerungen ist … Niemals wollte Juno McKay hierher zurückkehren: Vor zehn Jahren musste sie die altehrwürdige Universität Penrose schwanger und in Schande verlassen. Nur ihrer besten Freundin zuliebe kommt sie nun auf die Jubiläumsfeier des Colleges. Aber plötzlich ist es nicht mehr Juno, über die getuschelt wird, denn Christine stellt in einer Rede die Gründer der Universität öffentlich bloß und deckt einen großen Skandal auf. Nur wenige Stunden später wird ihre Leiche in den berühmten Wassergärten von Penrose gefunden. Hat der Leiter des Colleges Rache geübt? Doch schon bald hat Juno einen schrecklichen Verdacht: Könnte einer ihrer alten Freunde etwas mit Christines Tod zu tun haben – und ihr näher sein, als sie glaubt? »Liebe, Freundschaft, Geheimnisse aus der Vergangenheit und ein Verbrechen – eine wohlige Mischung.« Der Tagesspiegel Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Spannungsroman »Das dunkle Geheimnis von Penrose« der mehrfach preisgekrönten Bestsellerautorin Carol Goodman bietet psychologische Spannung für Genießer. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Ort, der voll von dunklen Erinnerungen ist … Niemals wollte Juno McKay hierher zurückkehren: Vor zehn Jahren musste sie die altehrwürdige Universität Penrose schwanger und in Schande verlassen. Nur ihrer besten Freundin zuliebe kommt sie nun auf die Jubiläumsfeier des Colleges. Aber plötzlich ist es nicht mehr Juno, über die getuschelt wird, denn Christine stellt in einer Rede die Gründer der Universität öffentlich bloß und deckt einen großen Skandal auf. Nur wenige Stunden später wird ihre Leiche in den berühmten Wassergärten von Penrose gefunden. Hat der Leiter des Colleges Rache geübt? Doch schon bald hat Juno einen schrecklichen Verdacht: Könnte einer ihrer alten Freunde etwas mit Christines Tod zu tun haben – und ihr näher sein, als sie glaubt?
»Liebe, Freundschaft, Geheimnisse aus der Vergangenheit und ein Verbrechen – eine wohlige Mischung.« Der Tagesspiegel
Über die Autorin:
Carol Goodman ist eine amerikanische Schriftstellerin und Dozentin für Creative Writing. Schon vor ihrem Abschluss am renommierten Vassar College wurde sie mit 17 Jahren als Young Poet of Long Island ausgezeichnet. Für ihre vielschichtigen Spannungsromane erhielt Carol Goodman bereits zweimal den Mary Higgins Clark Award. Sie lebt auf Long Island.
Von Carol Goodman erscheinen bei dotbooks die psychologischen Spannungsromane »Die Schatten von Bosco Manor«, »Das dunkle Geheimnis von Penrose« und »Das kalte Herz von Heart Lake«.
***
eBook-Neuausgabe August 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2004 unter dem Originaltitel »The Drowning Tree« bei Ballantine Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Wenn alles schläft« im Diana Verlag.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2004 by Carol Goodman
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 by Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-275-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das dunkle Geheimnis von Penrose« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Carol Goodman
Das dunkle Geheimnis von Penrose
Roman
Aus dem Amerikanischen von Adelheid Zöfel
dotbooks.
Für Lee, in Liebe
Prolog
Von dem schmalen Boot aus erscheint der Fluss viel breiter. Drohend erheben sich die buckligen Berge der Hudson Highlands, massiv und klobig wie die riesigen holländischen Matrosen, die angeblich dort gelebt haben.
»Du musst das Wasser einfach hinter dir lassen«, sagt er.
Ich kann den Mann im Boot hinter mir nicht sehen, aber umdrehen will ich mich nicht, weil ich sonst womöglich das Gleichgewicht verliere.
»Das hast du doch alles geübt«, sagt er.
Stimmt. Sechs Wochen Training in einem Innenbecken habe ich hinter mir, unter dem wachsamen Auge meines Kajaklehrers: Immer wieder habe ich tief Luft geholt und mich ins türkisfarbene Chlorwasser kippen lassen, um dann japsend wieder nach oben zu kommen. Ich habe so lange geübt, bis mir die Eskimorolle in Fleisch und Blut überging, aber sich ins lauwarme Wasser des Übungsbeckens fallen zu lassen ist etwas völlig anderes, als kopfüber in die kalten grauen Fluten des Hudson zu stürzen und vom Strudel mitgerissen zu werden …
»Hier ist die Strömung am gefährlichsten«, sagt die Stimme jetzt. »Bei den Holländern hieß diese Stelle ›das Ende der Welt‹.«
»Ich weiß.«
Irgendetwas stimmt nicht. Seine Stimme klingt anders als sonst, mir sträuben sich die Nackenhaare, und als ich mich schließlich doch umdrehe, sehe ich nicht Kyle, meinen Kajaklehrer ‒ den dunkelhaarigen jungen Mann, der auch das Ruderteam meiner Tochter trainiert. Nein, es ist jemand mit blonden Haaren, einen Moment nur erfasst ihn mein Blick, zwischen dem bleigrauen Himmel und der schimmernden Wasseroberfläche, aber seltsamerweise erschrecke ich nicht, ich freue mich: Er ist wieder da. Nacht für Nacht erscheint er mir im Traum, und jetzt ist er tatsächlich zurückgekommen … Doch schon tauschen Himmel und Fluss blitzschnell die Plätze, ich verschwinde im Wasser, mit dem Kopf nach unten.
Panisch taste ich nach der Schlaufe, die meine Spritzdecke mit dem Rand des Kajaks verbindet. An dieser Schnur muss ich ziehen, um mich zu befreien, aber meine Hand erwischt etwas Glitschiges, Schleimiges ‒ lange, dünne Tentakel, die vom Grund des Flusses nach meinem kleinen Boot grapschen. Es sind die Hände unzähliger ertrunkener Seeleute, aus ihren Wracks greifen sie nach den schiffbrüchigen Seelen, um sie zu sich in den Schlund zu zerren. Ich reiße die Augen auf und merke, dass es nur die breiten Zebragras-Halme sind, die hier unten im Hudson wachsen. Doch zwischen dem grünen Geflecht taucht plötzlich etwas auf ‒ ein bleiches Gesicht, von hellem Haar umrahmt wie von einem Heiligenschein.
Ich wache auf und schnappe verzweifelt nach Luft, wie eine Ertrinkende. Die Sonne scheint durch das Oberlicht auf mein Bett. Das grüne Rankenmuster, das ich in die Glasscheibe eingesetzt habe, filtert ihre Strahlen und lässt auf meinem Bettzeug ein grünes Muster entstehen. Aus dem Nebenzimmer dringen Geräusche zu mir: Meine Tochter packt ihre Sachen zusammen, sie hat heute früh ein Treffen mit dem Ruderteam. Und ich höre das Klicken der Hundekrallen auf den Fliesen meines Loft. Da fällt es mir wieder ein: Heute hält Christine ihren Vortrag! Hatte ich deshalb diesen schrecklichen Albtraum? Er war eine neue, schlimmere Variante des Traums, den ich seit Jahren jede Nacht träume ‒ bisher bin ich noch nie mit dem Kopf nach unten im Hudson getrieben. Vielleicht kommt diese Steigerung ja daher, dass ich mir solche Sorgen um Bea mache, die demnächst zu einer großen Rafting-Tour an der Westküste aufbricht.
Ich schwinge die Beine über den Bettrand, werfe die zerwühlten Laken zurück und versuche, den Traum abzuschütteln. Wie lange soll das noch so weitergehen? Dreizehn Jahre ist es jetzt her, dass ich Neil das letzte Mal gesehen habe, und vierzehn Jahre, dass wir beide fast im Fluss ertrunken wären ‒ aber ich träume ständig von ihm. Und weil er früher einmal zu mir gesagt hat, er glaube fest daran, dass wir uns in unseren Träumen besuchen können, habe ich immer das Gefühl, dass er genau das tut: Er besucht mich in meinen Träumen, Nacht für Nacht. Während ich die grünen Lichttupfer auf meinen Armen und Beinen betrachte, denke ich ‒ und dieser Gedanke ängstigt mich noch mehr als alles Übrige ‒, dass ein Teil von uns beiden damals auf dem Grund des Flusses zurückgeblieben ist. Dort, wo über den Gebeinen der ertrunkenen Matrosen das Zebragras wuchert, am Ende der Welt.
Kapitel eins
Ich bin zu spät dran für Christines Vortrag.
Eigentlich wollte ich gar nicht hingehen. Wenn Christine mich nicht extra gebeten hätte zu kommen, wäre ich garantiert zu Hause geblieben. Aber sie hat mich persönlich aufgefordert, und da war sie unwiderstehlich, genau wie vor fast zwanzig Jahren, als sie unter all den Studentinnen am Penrose College ausgerechnet mich als Freundin auserwählte. Eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, während des Jahrgangstreffens den Campus zu meiden, was mir bisher auch gelungen war, aber von ihr hatte ich mich dann doch überreden lassen.
So kommt es, dass ich am späten Sonntagnachmittag durch die länger werdenden Schatten zur College-Bibliothek eile, ganz ähnlich wie an vielen, vielen Sonntagabenden während des Studiums, wenn ich in letzter Minute alles nachholen wollte, was ich während des Wochenendes vertrödelt hatte.
Meistens war es Christine gewesen, die mich vom Lernen abhielt und mich aus der Höhle herauslockte, in die ich mich verkrochen hatte. »Das Mittelalter kann warten«, sagte sie beispielsweise, »aber die Sargent-Ausstellung im Whitney Museum geht nur noch bis zum Wochenende.« Sie wusste immer von irgendwelchen Kunstausstellungen, die demnächst zu Ende gingen. Ich ließ mich gern von ihrem Enthusiasmus anstecken und rannte hinter ihr her zum Bahnhof, konnte aber immer nur mühsam mit ihrem Tempo Schritt halten.
Als ich jetzt die Tür zur Bibliothek öffne, glaube ich plötzlich im Schein der Abendsonne Christines wehende Blondmähne zu sehen, aber das ist natürlich nur Einbildung. Christine ist längst im Saal, sie steht vorn am Rednerpult. Auf wundersame Weise hat sie sich in eine ältere, disziplinierte Frau ‒ eine Dozentin ‒ verwandelt, und ihre langen Haare hat sie zu einem eleganten Knoten gebändigt.
»Hier war ich immer anzutreffen«, sagt sie gerade in feierlichem Ton. Das Publikum lauscht gebannt, und ich versuche, möglichst unauffällig auf einem der Klappstühle in der hintersten Reihe Platz zu nehmen. Der Saal ist voll, selbst auf der Galerie drängen sich die Studentinnen, manche sitzen zwischen den Bücherregalen auf dem Fußboden. »Jeden Sonntagabend nach dem Essen. Spätestens dann konnte ich mich nicht länger vor den Aufgaben drücken, die ich das ganze Wochenende nur zu gern vor mir hergeschoben hatte.«
Verständnisvolle Seufzer sind zu hören. Offensichtlich bin ich nicht die Einzige, die sich bei dem Gang zur Bibliothek daran erinnerte, wie oft sie damals auf den letzten Drücker hierher pilgerte. Und es stimmt, ich habe Christine tatsächlich immer hier vorgefunden, wie sie an einem Referat oder etwas Ähnlichem für den nächsten Tag arbeitete. Irgendwie schaffte sie es jedes Mal, vor mir hier zu sein. Dabei behauptete sie immer, wenn wir von unseren New-York-Ausflügen wieder im Wohnheim landeten, sie sei zu müde und gehe erst mal in ihr Zimmer. Während ich von den Eskapaden, zu denen sie mich verleitete, erschöpft und mit roten Augen nach Hause kam, wirkte Christine erfrischt und beflügelt. Sie konnte anschließend die ganze Nacht durcharbeiten und wurde regelmäßig von den Professoren für ihre genialen Einfälle gelobt.
»Wenn ich mich damals dem Tisch hier unter dem Fenster näherte, dachte ich immer, die Lady würde mich mit strengem Blick mustern«, fährt Christine fort. »›Ach, lässt du dich endlich dazu herab, wie alle anderen zu lernen?‹, hörte ich sie in Gedanken sagen. Ich glaube, ich ließ sie mit der Stimme von Miss Colclough sprechen, der Professorin, bei der ich im zweiten Studienjahr eine Vorlesung über Chaucer besucht habe.« Christine macht eine kurze Kunstpause, weil sich wissendes Gelächter erhebt. Miss Coldclaw, wie wir sie nannten, war berühmtberüchtigt für ihre vernichtenden Kommentare und ihre rigorosen Lehrmethoden. »Im Laufe der vier Jahre, die ich unter diesem Fenster verbrachte, habe ich der hier dargestellten Lady verschiedene Rollen zugewiesen ‒ Muse, Begleiterin, Richterin. Das waren selbstverständlich nur meine privaten Projektionen. Doch heute sind wir zusammengekommen, um darüber zu sprechen, wer sie wirklich ist, was sie uns, den Studentinnen, die 1987 hier am College Examen gemacht haben, über uns selbst mitzuteilen hat und warum es so wichtig ist, sie vor dem Untergang zu retten.«
Christine dreht sich zur Seite und legt den Kopf zurück, sodass ihr Blick dem der Gestalt im Glasfenster begegnet, als würde sie an einem Haus vorbeigehen und oben im ersten Stock jemanden entdecken, den sie kennt. Diese Pose nimmt sie während ihres Vortrags immer wieder ein. Sie spricht die Lady an wie eine Schwester. Und es stimmt: Christine trägt zwar ein knappes, ärmelloses schwarzes Kleid (Prada, vermute ich), während die Dame in ein mittelalterliches Gewand aus besticktem Damast gehüllt ist (rubinrot überfangenes Weißglas, mit einem eingeätzten Millefleur-Muster), aber trotzdem sind sich die beiden Frauen verblüffend ähnlich, angefangen bei ihrer Körperhaltung: Christine lehnt sich zurück, um zum Fenster hinaufzuschauen, die Lady wendet sich von ihrem Webstuhl ab, blickt von ihrer Arbeit hoch. Sie haben beide goldblondes Haar. Die Lady verdankt ihre Farbe einem mittelalterlichen metallurgischen Prozess, genannt Silberlotfärbung, Christine hingegen war bei einer teuren Friseurin in der New Yorker Upper East Side. Die dichten Präraffaelitenlocken fallen der Lady offen über die Schultern, wohingegen Christine, wie schon erwähnt, ihre Haare zu einem Knoten geschlungen hat, der so schwer zu sein scheint, dass sie immer die Halsmuskulatur anspannen muss, wenn sie auf ihre Notizen blickt. Aus dieser Anspannung und daraus, dass sie unglaublich abgenommen hat, schließe ich, dass die Vorbereitungen für diesen Vortrag sie sehr mitgenommen haben, und ich verzeihe ihr augenblicklich, dass sie sich in den letzten sechs, sieben Monaten kein einziges Mal mit mir getroffen hat. Seit dem Studium ist das die längste Zeitspanne, in der wir uns nicht gesehen haben.
»Ich nehme an, wir alle haben bei unserer ersten Campus-Begehung dieselbe Geschichte gehört: Das Fenster wurde von Augustus Penrose entworfen, dem Gründer der Rose Glass Works und des Penrose College. Er entwarf es 1922, für das zwanzigjährige Jubiläum des Collegess. Die Lady stellt die Frau des Gründers dar, Eugenie Penrose. Wie wir wissen, entstand unsere Hochschule aus dem Kunsthandwerksbund für Frauen, den Eugenie für die Ehefrauen und Töchter der in der Fabrik ihres Mannes arbeitenden Männer ins Leben gerufen hatte.«
Das College ist ja aus einem besseren Nähzirkel entstanden, hatte Christine einmal etwas vorlaut bemerkt, als die Studentinnen des ersten Semesters von der College-Leitung zu einem Nachmittagstee eingeladen waren. Für die hier versammelten Frauen in ihren maßgeschneiderten Leinenkostümen und den pastellfarbenen Blusen, mit den Handtaschen von Coach und den Ferragamo-Schuhen würde sie diese Formulierung natürlich nicht mehr verwenden. Penrose College mag aus einem sozialistischen Traum entstanden sein und sollte Frauen aus der Unterschicht beste Bildungsmöglichkeiten bieten, aber es hat sich längst in eine Bastion der privilegierten Ostküsten-Schickeria verwandelt.
»Ehe wir jedoch fraglos akzeptieren, dass die Lady im Fenster nichts anderes ist als eine Verneigung vor einer mittelalterlichen Weberin, sollten wir einen Blick auf Augustus Penroses gesellschaftlichen und künstlerischen Hintergrund werfen«, fährt Christine fort. »Seine Familie besaß eine Glasfabrik in England. Sie hieß Penrose & Sons und befand sich in Kelmscott, einem kleinen Ort an der Themse, unweit von Oxford. Diese Fabrik stellte im mittelalterlichen Stil Glas her und lieferte es an Künstler, die Glasfenster entwarfen. Unter ihnen war auch der ebenfalls in Kelmscott lebende präraffaelitische Maler William Morris, von dessen Theorien Augustus in seiner Jugend stark beeinflusst wurde. Morris vertrat die These, man müsse den dekorativen Künsten ihre Integrität wiedergeben, ihren Wert und ihre Würde. Als Simon Barovier, ein reicher Unternehmer aus Nordengland, Penrose & Sons aufkaufte, ermutigte er den jungen Augustus, seinen künstlerischen Ambitionen nachzugehen. Das Gleiche tat auch Baroviers Tochter Eugenie, die sich in Augustus verliebte. Und wie wir alle wissen, haben die beiden wenig später geheiratet und wurden in den Neunzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts von dem alten Simon Barovier hierher geschickt, um eine amerikanische Filiale der Glasfabrik zu gründen. Augustus und Eugenie hatten jedoch große Pläne. Sie wollten nicht nur eine Glasfabrik leiten, sondern übernahmen schon bald eine führende Rolle in der Arts & Crafts-Bewegung. Dabei orientierten sie sich immer an den Ideen von William Morris.«
Jetzt ist Christine bei der Kunstgeschichte angekommen. Das ist ein Terrain, auf dem sie sich sicher fühlt, weil sie sich dort bestens auskennt.
Erleichtert atme ich auf. Mir war gar nicht bewusst gewesen, dass ich vor lauter Nervosität die Luft angehalten habe, weil ich mir so sehnlich wünsche, dass dieser Vortrag für Christine ein Erfolg wird, sozusagen ihr Comeback.
Früher, auf dem College, ging von ihr geradezu ein Leuchten aus. Sie verbreitete eine Energie, die alle Menschen anzog. Wir glaubten, dass sie es weit bringen würde ‒ selbst als sie sich entschied, nicht zu promovieren, sondern lieber einen Job in einer New Yorker Galerie anzunehmen und als freie Journalistin über Kunst zu schreiben. Damals dachten wir, sie würde bestimmt ein geniales Buch verfassen, oder wenigstens einen der berühmten Künstler heiraten, mit denen sie bei Vernissagen gesehen wurde. Aber bei unserem zehnjährigen Treffen war immer noch nichts davon zu sehen, und Christine betrank sich so sinnlos, dass sie beim Abschiedsessen umkippte. Nach und nach verblasste der verheißungsvolle Glanz, ihr Name verschwand aus den Ehemaligen-Mitteilungen des Colleges. Und wenn ich Leuten begegnete, die sie vom Studium kannten, erkundigten sie sich immer mit besorgter Miene nach ihr, als wären sie auf das Schlimmste gefasst. Manche hofften das Schlimmste, vermute ich.
Als die Programme für unser fünfzehnjähriges Jubiläum verschickt wurden und darin die Mitteilung stand, dass ausgerechnet Christine den Vortrag über das Lady-Fenster halten würde, dessen Restaurierung sich der Examensjahrgang 1987 zur Aufgabe gemacht hatte, staunten alle. Nur ich war nicht besonders überrascht. Ich hatte Christine vier Jahre vorher während ihrer Entziehungskur beigestanden und sie immer wieder gedrängt, sich doch für ein Penrose-Stipendium zu bewerben und wieder an die Uni zurückzugehen. Dieses Stipendium ist speziell für ehemalige Studentinnen gedacht, die sich zehn oder zwanzig Jahre nach ihrem College-Abschluss neu orientieren wollen. Wir nannten es früher immer »die zweite Chance« ‒ also genau das Richtige für Christine, die es bisher immer geschafft hatte, in letzter Minute all ihre Kräfte zu bündeln und eine erstklassige Leistung zu erbringen. Ich hatte ihr sogar vorgeschlagen, das Lady-Fenster als Thema für ihre Doktorarbeit zu nehmen. Und dann bekam McKay Glass den Auftrag, das Fenster zu restaurieren. Es war unser erstes wirklich großes Projekt dieser Art, nachdem ich meinen Vater überzeugt hatte, das Service-Angebot zu erweitern und die Restaurierung von Glasfenstern mit in unser Programm aufzunehmen. Also schlug ich dem College vor, Christine den Vortrag halten zu lassen.
Deshalb bin ich jetzt so aufgeregt ‒ in gewisser Weise fühle ich mich verantwortlich.
Während Christine über die Präraffaeliten und die Arts & Crafts-Bewegung spricht, lasse ich meine Gedanken schweifen (ihre Thesen zu diesem Thema kenne ich schon lange). Mein Blick fällt auf das Fenster. Wie wunderbar es in der frühen Abendsonne leuchtet! Die obere Hälfte wird von einem großen Rundfenster beherrscht, von einem Fenster im Fenster. Es umrahmt einen grünen Seerosenteich, an dessen Ufer eine Trauerbuche steht. Der Blick auf die Berge in der Ferne ist derselbe wie der, den wir hätten, wenn wir durch das Fenster nach draußen blicken könnten: Es ist die dicht bewaldete Kette der Hudson Highlands am Westufer ‒ immer noch waldreich, da Augustus Penrose das gesamte Gelände gekauft und dort einen riesigen Landsitz angelegt hatte, dem er den Namen Astolat gab. Als die große Villa in den Dreißigerjahren abbrannte, zogen er und Eugenie wieder nach Forest Hall, ihr Haus auf dieser Seite des Flusses. Von Astolat sind nur noch die Gärten erhalten, die von Penrose selbst entworfen wurden. Ihren Mittelpunkt bildete ein Seerosenteich, ganz ähnlich wie der hier im Fenster.
Obwohl das Fenster aus Opalglas besteht und dabei Techniken verwendet wurden, die Tiffany und LaFarge in den Achtzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts populär gemacht hatten, könnte die Lady selbst aus einem mittelalterlichen Fenster stammen. Die Präraffaeliten liebten das Mittelalter, wie Christine gerade erläutert, und sie liebten schöne Frauen mit langen, wehenden Haaren und hingebungsvoll schmachtenden Gesichtern. Unsere Lady blickt von ihrer Arbeit hoch, und an der Art, wie sie den Rücken dehnt, kann man ablesen, wie strapaziös die vielen Stunden gewesen sein müssen, die sie am Webstuhl verbracht hat. Eine sanfte Rötung ‒ sehr geschickt hervorgerufen durch Rötel, einer auf Hämatit basierenden Farbe, die seit dem sechzehnten Jahrhundert für Hauttöne verwendet wird ‒ zieht sich von ihrem tief ausgeschnittenen Mieder über den langen Hals bis hinauf zu ihren hohen Wangenknochen. Man fragt sich, wovon sie wohl geträumt haben mag, während sie an ihrem Webstuhl arbeitete.
»Wissen Sie, was ich mir schon oft überlegt habe?«, sagt Christine jetzt. »Weshalb wendet sie den Blick vom Fenster ab, und woher rührt dieser verzückte Gesichtsausdruck? Man hat fast den Eindruck, als wäre ihr gerade eine Erleuchtung gekommen. Aber wer ist diese Weberin? Vergessen wird nicht, dass Augustus seine geliebte Eugenie nie einfach nur als ›Eugenie‹ malte. Ganz wie die präraffaelitischen Maler, die er so bewunderte, zeigte er sein Modell meistens in Gestalt einer literarischen Figur.«
Christine drückt einen Knopf am Rednerpult, und an der Wand rechts vom Fenster entrollt sich eine Dia-Leinwand. Gleich darauf erscheint dort das Bild eines jungen Mädchens, das sich über einen Seerosenteich beugt. Ihre langen Haare verwandeln sich in Zweige, die ins Wasser hängen, ein Stück Baumrinde beginnt ihr schlankes Bein hinaufzuwachsen. »Das einzige andere Werk ohne eindeutigen mythologischen Bezug ist dieses Bild, Der ertrinkende Baum. Aber auch hier klingen die Metamorphosen des Ovid an, die Penrose so liebte. Er malte Eugenie unter anderem als Daphne, die sich auf der Flucht vor dem Gott Apollo in einen Lorbeerbaum verwandelt ‒« Der ertrinkende Baum verschwindet, und wir sehen das vertrautere Bild einer davoneilenden jungen Frau, aus deren Fingerspitzen Blätter sprießen »‒ und als die Quellnymphe Salmakis, die mit Hermaphroditos zu einem Wesen verschmilzt. Oder als Alkyone, die sich in einen Eisvogel verwandelt, als ihr Mann ertrinkt.«
Christine lässt ein Bild nach dem anderen durchklicken und beschreibt die jeweils dargestellte mythologische oder literarische Figur. Sie macht so schnell, dass die Gesichter ineinander übergehen und man das Gefühl bekommt, als wäre es im Grunde immer dasselbe Gesicht, nur in verschiedenen Variationen. Genau diese Wirkung hat sie natürlich beabsichtigt. Es ist immer wieder Eugenie ‒ ob verängstigt wie Daphne, voller Begehren wie Salmakis oder im Prozess der Verwandlung begriffen wie Alkyone. Dann ist die Leinwand leer. Einen Moment lang scheint dieses Gesicht noch nachzuklingen, strahlend, umrahmt von rotgolden schimmernden Haaren und von einem inneren Leuchten erfüllt. Wie das Gesicht im Fenster.
»Wer also ist sie, unsere Lady im Fenster? Warum hat sich Augustus nach all den Verwandlungsgeschichten entschlossen, seine Frau Eugenie im letzten uns bekannten Porträt als namenlose Weberin darzustellen?
Um diese Frage beantworten zu können, möchte ich Sie bitten, Ihre Aufmerksamkeit jetzt dem ›Fenster‹ hinter der Figur zuzuwenden. Viele Leute glauben, die Szenerie, die wir durch dieses Fenster im Fenster sehen, sei ein Ausblick auf die Hudson Highlands, wo Penrose seine große Villa erbaute. Aber wenn Sie sich die Formation der Berge genau anschauen« ‒ der flackernde rote Pfeil von Christines Laserpointer folgt der Linie im Fenster ‒ »und wenn Sie diese mit der Bergformation in der Wirklichkeit vergleichen« ‒ auf der Leinwand erscheint jetzt ein Foto der Landschaft am anderen Flussufer ‒ »dann werden Sie feststellen, dass die Abfolge der Gipfel seitenverkehrt ist. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem Fenster zu tun, sondern mit einem Spiegel, der ein Fenster reflektiert. Und in welcher Geschichte aus dem Mittelalter kommt eine wunderschöne junge Frau vor, die dazu verdammt ist, das Leben nur im Spiegel zu betrachten? Natürlich, Sie haben es gleich erraten ‒ ich meine »Die Lady von Shalott«, Tennysons Version eines Teils der Artus-Sage. Bestimmt erinnern sich alle hier im Saal an Miss Ramseys Vorlesung über die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts.«
Ich erinnere mich eigentlich nur noch daran, wie wir bei Miss Ramsey »In Memoriam« auswendig lernen mussten, Tennysons endlose Ode auf die Freundschaft. Aber als Christine das andere Gedicht kurz zusammenfasst, fällt mir die Handlung wieder ein: Die Lady von Shalott sitzt verzaubert in ihrem Turm auf einer Insel und darf nicht direkt auf die Welt blicken. Verzweifelt webt sie das, was sie in dem Spiegel sieht, der sich gegenüber von ihrem Fenster befindet, in ein Tuch …
Ich betrachte die Flusslandschaft im Fenster, dann wandert mein Blick zu dem Tuch im Webstuhl. Wenn es sich wirklich um die Lady von Shalott handeln würde, müsste dort die Bergkette angedeutet sein. Aber auf dem Tuch ist überhaupt nichts Besonderes zu sehen! Die Lady webt nur ein einfaches Muster, keine Landschaft, kein Bild.
Christine untermauert ihre Theorie, dass es sich bei der Dame im Fenster um Tennysons Lady von Shalott handelt, mit überzeugenden Argumenten: Der Name, den Augustus Penrose seinem Anwesen gab ‒ Astolat ‒, ist nur ein anderer Titel der Lady von Shalott, sie war eigentlich die Fee Elaine von Astolat. Die Pose unserer Dame gleicht der Haltung zahlreicher Lady-von-Shalott-Darstellungen auf präraffaelitischen Gemälden, wie Christine mit einer ganzen Serie von Dias beweist. Sie hat selbstverständlich auch eine Erklärung dafür, wieso die Szene im Fenster nicht auf dem gewobenen Tuch erscheint. In ihren Tagebuchaufzeichnungen zur Entstehung des Fensters erwähnt Eugenie Penrose nämlich, dass die Glasteile, die ursprünglich für diesen Abschnitt des Fensters gedacht gewesen waren, beim Brennen zersprangen und durch schlichte Buntglaselemente ersetzt werden mussten, weil das Kunstwerk sonst nicht rechtzeitig zur Einweihung der Bibliothek fertig geworden wäre.
Ich nehme mir vor, Christine um eine Kopie von Eugenies Tagebuch zu bitten ‒ bei den Restaurierungsarbeiten können wir die Informationen sicher gut brauchen. Dann höre ich ihr mit neuer Konzentration zu.
»Wenn wir es akzeptieren, dass die Dame im Fenster die Lady von Shalott repräsentiert, stellt sich als Nächstes die Frage nach dem Warum. Wie kommt jemand auf die Idee, für das Bibliotheksfenster in einem Frauen-College die Abbildung einer unglücklichen jungen Frau aus dem Mittelalter zu wählen? In Vassar gibt es ein Fenster, das Elena Cornaro darstellt, die erste Frau, die dort promovierte. Warum haben wir hier eine junge Frau, die buchstäblich in einem Elfenbeinturm gefangen ist? Was hat sich Augustus Penrose dabei gedacht?
Eugenie Penrose gibt uns in ihrem Tagebuch nur einen einzigen Hinweis. Sie sah sich selbst vor allem als Kunsthandwerkerin und weniger als Künstlerin, aber sie setzte ihre immense Begabung dafür ein, ›Augustus‹-Gemälde in Skizzen umzuarbeiten, die dann für Glasfenster verwendet werden konnten. Unter ihren Entwurf für das Lady-Fenster schrieb sie: ›Hier sitzt mit ihrem Antlitz die Erinnerung.‹ Diese Zeile ist ein Zitat von Dante Gabriel Rossetti ‒ einem weiteren präraffaelitischen Maler, den Penrose sehr bewunderte. Doch warum sollte sie so etwas über ihr eigenes Porträt sagen? Es klingt eher so, als wollte sie andeuten, dass die Gestalt der Dame sie an jemanden erinnert, und ich glaube, bei diesem Jemand handelt es sich um ihre Schwester Clare.«
Christine verstummt und holt tief Luft, ehe sie fortfährt:
»Vielleicht wissen manche von Ihnen gar nicht, dass Eugenie eine Schwester hatte. Kaum jemand kennt ihre Geschichte. Clare war Eugenies Halbschwester, ein uneheliches Kind, das Eugenies Mutter zur Welt brachte, nachdem sie sich von Simon Barovier getrennt hatte. Nach dem frühen Tod der Mutter wurde dieses Mädchen in die Familie aufgenommen. Clare war acht Jahre jünger als Eugenie und scheint sowohl körperlich als auch psychisch immer sehr zart und anfällig gewesen zu sein.«
Auf der Leinwand rechts vom Fenster erscheint ein sepiabraunes Foto: Zwei Mädchen stehen am Ufer eines Flusses, unter einem riesigen Baum mit ausladenden Zweigen. Eine Trauerbuche, vermute ich. Die Größere der beiden muss Eugenie sein. Ich erkenne sie allerdings nur daran, dass sie dieselbe strenge Frisur hat wie auf allen Bildern unseres berühmten Gründers. Das andere Mädchen sieht ihr auffallend ähnlich, bis auf die Haare, die ihr offen über die Schultern fallen. Irgendetwas an dem Foto scheint mir sehr vertraut. Kommt es daher, dass ich die Szenerie von dem Gemälde Der ertrinkende Baum kenne? Ja, vielleicht ‒ aber da ist noch etwas anderes. Plötzlich wird mir klar: Es sind die beiden Mädchen, die mir so bekannt vorkommen, die eine streng und reserviert, die andere ätherisch, verträumt, mit wehendem Haar. Hier spiegeln sich die zwei Seiten, die ich von Christine kenne ‒ die verspielte Studentin, wie ich sie in der College-Zeit erlebt habe, und die disziplinierte Frau, die diesen Vortrag hält. Aber während Christine jetzt erzählt, wie Clare gemeinsam mit Eugenie und Augustus nach Amerika aufbrach und wie die drei in New York eintrafen und Clare an wahnhafter Hysterie erkrankte, kann ich genau sehen, was passiert: Sie genießt den Schock, den ihre Geschichte auslöst, genau wie es die Christine von damals getan hätte.
»Clare wurde bald nach ihrer Ankunft in New York in die Anstalt Briarwood gebracht, die ein kleines Stück flussaufwärts von hier liegt. Dort verbrachte sie den Rest ihres Lebens.«
Vielleicht bilde ich es mir ja nur ein, aber ich habe den Eindruck, dass Christine meinen Blick sucht, als sie Briarwood erwähnt. Wir haben beide eine persönliche Verbindung zu dieser Institution: Christine ist ganz in der Nähe aufgewachsen, in derselben Straße, und viele ihrer Verwandten arbeiten dort, seit Generationen. Mein Kontakt zu Briarwood ist jüngeren Datums: Vor vierzehn Jahren ist mein Exmann dort eingewiesen worden. Ich wüsste gern, ob sie darauf angespielt hat, als sie vor ein paar Wochen am Telefon zu mir sagte, bei ihren Recherchen habe sie etwas herausgefunden, was mich garantiert interessieren würde. Im Augenblick mache ich mir jedoch vor allem Gedanken darüber, welchen Effekt Christines Enthüllungen auf die Zuhörerinnen haben werden. Eugenie Penrose ist schließlich unser großes Vorbild ‒ die weltliche Heilige des Colleges.
»Man kann sich vorstellen, wie schrecklich das für Eugenie gewesen sein muss ‒ immer daran denken zu müssen, dass ihre Schwester nicht weit von ihr in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist. Hatte sie Angst vor einem ähnlichen Schicksal? Oder befürchtete sie vielleicht, ihre Kinder könnten an einer Erbkrankheit leiden? Wir dürfen nicht vergessen, dass man im viktorianischen Zeitalter noch glaubte, psychische Erkrankungen seien erblich …«
Christine senkt den Blick, studiert ihre Notizen. Im Gegensatz zu ihren bisherigen Kunstpausen scheint diese Unterbrechung nicht auf Wirkung abzuzielen. Täusche ich mich, oder huscht da kurz ein Schatten der Verwirrung über ihr Gesicht? Sie blättert rasch ihre Karteikarten durch, als hätte sie gerade gemerkt, dass sie zu viel Material vorbereitet hat und deshalb etwas überspringen muss. Oder gibt es einen anderen Grund dafür, dass sie ein Stück ihres Vortrags auslassen will?
Sie räuspert sich. »Kehren wir zu Tennysons Gedicht zurück. In dem Moment, als die Lady von Shalott in ihrem Spiegel Lancelot erblickt, verstößt sie gegen die Zaubervorschrift und wendet sich der Welt zu. Damit verurteilt sie sich selbst zum Tode. Sie gibt sich jedoch nicht damit zufrieden, allein in ihrem Turm zu sterben. Sie sucht sich ein Boot und fährt den Fluss hinunter, dem Tod entgegen: Wenn sie stirbt, wird sie in Camelot angekommen sein, und Lancelot, das Objekt ihrer Begierde, wird erkennen, was die Liebe bewirken kann. Sie erleidet keinen passiven Tod. Die Lady von Shalott ist die zurückgewiesene Frau, die sich rächt, indem sie stirbt. Sie ist die verlassene Frau, die ihren treulosen Geliebten am Horizont entschwinden sieht, sie ist Dido, die den Nachthimmel mit den Flammen ihres eigenen Scheiterhaufens erhellt ‒ ein Leuchtfeuer, das die Flotte des Aeneas verfolgt. Sie ist Madame Butterfly, die ihre letzte Arie singt.
Diese Rolle passt nicht zu Eugenie. Wenn wir allerdings unterstellen, dass die Lady im Fenster nicht Eugenie, sondern ihre Schwester Clare ist, leuchtet die Gleichsetzung ein. Clare sah Eugenie so ähnlich, dass die meisten Leute ihr Abbild für Eugenies Porträt hielten. Nur Augustus und seine Frau kannten die Wahrheit.«
Christine spricht nicht weiter, sie will ihre These auf das Publikum wirken lassen. Im Saal herrscht betroffene Stille, alle wirken verkrampft, aber ich wage nicht zu entscheiden, ob die Zuhörerinnen erschüttert sind, weil das Fenster nicht unsere geliebte Gründerin zeigt, sondern ihre verrückte Schwester, oder ob Christines kriminalistische Enthüllungen sie so tief beeindrucken. Ich habe schon öfter erlebt, dass meine Freundin ambivalente Reaktionen hervorruft, zum Beispiel, wenn sie in Seminaren oder auf Partys mit irgendwelchen wilden Theorien daherkam, bei denen die Anwesenden nicht wussten, ob sie peinlich berührt wegschauen oder in Bewunderung erstarren sollten.
»Wenn wir die Figur im Fenster als Clare deuten, wird klar, welche Botschaft Augustus vermitteln wollte. Das Fenster zeigt den Augenblick, als sich die Lady von ihrem Webstuhl abwendet, um Lancelot direkt anzuschauen, den Augenblick, der ihr Schicksal besiegelt. Sie gibt sich nicht mit der abgeschiedenen Welt der Frauenarbeit zufrieden, und für ihre Rebellion bezahlt sie einen hohen Preis. Sie ist die Künstlerin zwischen Reflexion und Realität, wie Tennyson sagt, die nun, angetrieben von der Macht der Liebe, aus dem Schatten ins Licht der Wirklichkeit tritt. Ich glaube, Augustus sah in dieser Gestalt seine Schwägerin, die endlich den Krallen des Wahnsinns entkommt, und er entwarf dieses Fenster als eine Verneigung vor ihr.
Ich glaube, dass Augustus Penrose dabei auch an die Generationen junger Frauen dachte, die unter diesem Fenster sitzen würden. Und genau deshalb müssen wir fragen, welche Botschaft die Lady uns vermitteln möchte. Ich glaube, sie ist die Studentin, die aus der Isolation der akademischen Welt ausbricht und sich den Anforderungen der Wirklichkeit stellt. Mit anderen Worten, sie ist wie du und ich.«
Im Saal herrscht immer noch Totenstille. Kein nervöses Hüsteln, kein leises Gelächter. Die Frauen sitzen vorgebeugt auf ihren Stühlen, ihre hellen Kleider bestrahlt von den kräftigen Farben des Fensters. Später werden sie vermutlich über Christines unorthodoxe Interpretation des Bildes herziehen, doch jetzt lauschen sie ihr gebannt.
»Wenn ich auf meine Jahre hier am Penrose College zurückblicke, habe ich durchaus das Gefühl, in einem versiegelten Turm gelebt zu haben, weit weg von der realen Welt. Manche mögen sagen, wir waren zu behütet. Haben wir in einer Schattenwelt gelebt? War für viele das helle Sonnenlicht der Wirklichkeit eine Überforderung?«
Sie hebt die Hand. Ein goldener Sonnenstrahl fällt durch das Haar der Lady und trifft auf Christines Hand. Sie beugt spielerisch die Finger, als wollte sie nach ihm greifen. Wie in aller Welt konnte sie das vorausahnen?, frage ich mich.
»Manche mögen sagen, dass sich die Reise von hier fort allzu oft in eine langsame Todesfahrt verwandelt ‒ wie bei der Lady von Shalott.« Christine öffnet die Hand, und es sieht aus, als würde sie den goldenen Lichtstrahl wieder loslassen und in den Raum schicken. Eine Zauberin, die eine Taube fliegen lässt. Sie schweigt, und die Stille wächst. Alle wissen genau, dass sie von sich selbst spricht, von ihren eigenen Enttäuschungen und Fehlschlägen, aber ich spüre trotzdem, dass jede hier im Raum sich angesprochen fühlt. Wie viele von uns haben genau das Leben verwirklicht, das sie sich ausgemalt haben, als sie von hier weggegangen sind?
»Doch ich bin fest davon überzeugt, Augustus Penrose wollte nicht, dass wir uns vor der Reise in die wirkliche Welt fürchten ‒ gleichgültig, wohin sie uns führen mag. Er wollte vielmehr, dass wir bereit sind zu erwachen, von unseren Büchern aufzublicken und uns von den Schatten abzuwenden. Meiner Meinung nach hat er diese Botschaft durch seine Darstellung des Gesichts der Lady vermittelt. Sehen wir uns dieses Gesicht genauer an, die intensiven Farben, den lebhaften Glanz. Zum ersten Mal in ihrem Leben scheint ihr die Sonne ins Gesicht. Mag sein, dass der Tod ihre Bestimmung ist, doch sie entscheidet sich für das Leben und gegen die Schattenwelt, und sie ist lebendiger als je zuvor.
Vergessen wir nicht, dass es sich bei dem Fenster hinter ihr gar nicht um ein Fenster, sondern um einen Spiegel handelt, von dem sie sich abwendet. Jetzt erst schaut sie aus dem Fenster ‒ und sie blickt auf uns, auf die Frauen des Penrose College, die sich hier vor ihr versammelt haben. Wir sind ihr Spiegelbild, wir sind ihre Zukunft. Sie hat den Bann gebrochen, der uns versklavt. Nun ist es an uns zu entscheiden, was wir mit dieser Freiheit anfangen.«
Der Schlusssatz ist perfekt getimt: Die im Spiegel dargestellte Flusslandschaft, die während des ersten Teils von Christines Vortrag erhellt war, ist jetzt kühl und dunkel. Die Sonnenstrahlen sind durch das goldblonde Haar, über das Gesicht und den Hals der Lady gewandert und scheinen nun durch das Mieder ihres Brokatkleides. Ich möchte wetten, dass jede Frau im Saal den dazugehörigen Aberglauben kennt. Es ist eine dieser albernen Campus-Legenden, für die alle Frauen-Colleges berühmt sind. Die Legende besagt: Wenn die Sonne das rote Kleid der Lady trifft, scheint sie durch ihr Herz, und wer von diesem roten Strahl berührt wird, stirbt jung. Reglos steht Christine da, und die Strahlen der untergehenden Sonne hüllen sie in rubinrotes Licht.
Kapitel zwei
Beim anschließenden Empfang in Forest Hall, dem Haus des Präsidenten, gibt es ein kleines Büffet. Die Atmosphäre ist nicht annähernd so erdrückend, wie ich befürchtet hatte. Essen und Getränke sind im Speisesaal aufgebaut, dessen Wände mit Augustus’ Sammlung europäischer Meister geschmückt sind. Zwar handelt es sich bei den meisten Gemälden nur um Kopien aus dem neunzehnten Jahrhundert, aber schön sind sie trotzdem, die reinste Augenweide. Christine ist von College-Würdenträgern umlagert, weshalb sie sich nicht mit mir unterhalten kann, aber sie signalisiert mir durch Zeichensprache, dass ich doch bitte auf sie warten und sie nachher zum Bahnhof bringen soll.
Falls sich irgendjemand über den Inhalt ihrer Rede geärgert hat, ist davon nichts zu merken. Die Leute um sie herum lächeln alle freundlich, als Gavin Penrose, der jetzige Präsident des Colleges und Enkel von Augustus und Eugenie, sein Champagnerglas erhebt, um einen Toast auf Christine auszubringen. Die beiden sind ein tolles Paar, stelle ich verdutzt fest. Früher war Gavin der Schwarm aller Penrose-Mädchen, und obwohl er inzwischen schon fünfundvierzig ist, hat er weder seinen knabenhaften Charme noch sein gutes Aussehen verloren. Als wir im zweiten Studienjahr waren, ging er mit einem Mädchen aus, das in unserem Studentenwohnheim wohnte. Und immer, wenn er aus Wharton hierher gefahren kam, um sie zu besuchen, lungerten wir ganz zufällig unten im Gemeinschaftsraum herum, weil wir nichts verpassen wollten. Seine dunklen Locken und die olivfarbene Haut bilden einen attraktiven Kontrast zu Christines goldblonden Haaren und ihrem blassen Teint.
Der gleiche farbliche Gegensatz findet sich auch in Tizians Gemälde mit der blonden Venus und dem dunklen, athletischen Mars, unter dem die beiden stehen. Nach Gavins Toast deutet Christine auf dieses Bild und macht irgendeine Bemerkung, die ich nicht hören kann, die aber mit allgemeinem Gelächter belohnt wird. Alle scheinen belustigt, außer Gavin, der ganz empört dreinschaut. Wie ich Christine kenne, hat sie ihm gerade erklärt, woran Augustus Penrose beim Kauf des Bildes hätte erkennen müssen, dass es sich nicht um einen echten Tizian handelt. Da Augustus sowohl das Haus als auch seine gesamte Kunstsammlung dem College vermacht hat, könnte es Gavin eigentlich egal sein, ob das Werk ein Original ist oder nicht. Aber wer hört schon gern, dass der eigene Großvater auf eine Fälschung reingefallen ist? Ich fürchte, Christine war mal wieder taktlos ‒ nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil sie die Angewohnheit hat, immer genau das zu sagen, was ihr gerade in den Sinn kommt. Aber Gavin scheint seinen Ärger schnell zu vergessen und sich stärker für die blonde Venus zu interessieren, die vor ihm steht, als für die auf dem Gemälde über ihm. Ja, er widmet sich Christine so hingebungsvoll, dass Fay, seine Assistentin, ein paarmal Anlauf nehmen muss, um ihn endlich zu einer zarten, aber schon etwas verblühten Blondine führen zu können. Ich kenne sie aus der Alumnae-Zeitschrift als Joan Shelley, eine Frau, die 1977 hier Examen machte und zu den wohlhabendsten Gönnerinnen des Colleges gehört.
Als Gavin mit Joan spricht, fange ich Christines Blick auf. Sie grinst verschwörerisch, denn es ist nicht zu übersehen, dass Joan sauer ist, weil sie warten musste. Ich will zu Christine gehen, werde aber unterwegs von Robin Lindley abgefangen, neben der ich im Anfängerkurs Latein saß.
»Du bist June, stimmt’s?«
»Fast«, antworte ich. »Ich heiße …«
»Nein, warte. Jetzt weiß ich’s wieder. Juno. Juno McKay! Wie die Göttin. Unsere Lateindozentin fand das damals toll. Deine Mutter war Griechin oder so was, stimmt’s?«
»Nein«, entgegne ich. »Italienerin. Wenn sie Griechin gewesen wäre, hieße ich Hera.«
Robin mustert mich verblüfft. Da fällt mir ein, dass sie zu den Studentinnen gehörte, die ständig fragten, wieso wir eigentlich eine tote Sprache lernen müssten. Sie hatte sogar bei der College-Leitung einen Antrag eingereicht, man solle Latein als Pflichtfach abschaffen. Aber sie guckt nicht halb so konsterniert wie DeeDee Smith, unsere Jahrgangssprecherin, als ich ihr sage, ich hätte zum offiziellen Treffen nicht kommen können, weil meine Tochter Bea in Poughkeepsie bei einem Ruderwettbewerb mitgemacht habe.
»Du hast eine Tochter, die alt genug ist für so einen Wettbewerb? Da muss sie ja mindestens …«
Rechne doch mal nach!, würde ich am liebsten rufen. Meine Tochter ist eine Woche vor unserem Abschlussexamen auf die Welt gekommen ‒ oder besser gesagt, eine Woche vor eurem Abschlussexamen. Deshalb habe ich, statt mein fünfzehnjähriges College-Examen zu feiern, zugeschaut, wie meine fünfzehnjährige Tochter beim Poughkeepsie Country Day rudert. Gute Alternative, habe ich mir heute Morgen gesagt, als mein Blick auf Beas rotblonden Zopf zwischen ihren straffen Schulterblättern fiel. An der Spannung in ihrer Rückenmuskulatur konnte ich ihre Energie und ihren Enthusiasmus ablesen. Bea wendet sich dem Leben zu, sie schaut nicht weg. Gute Alternative, sage ich mir auch jetzt, als DeeDee die Hand mit dem teuren Goldarmband hebt, um ihre ohnehin makellose Frisur zurechtzutätscheln.
»Beatrice«, murmelt sie. »Hübscher Name, Beatrice McKay.«
»Beatrice Buchwald«, verbessere ich sie. »Meine Tochter trägt den Nachnamen ihres Vaters. Wir haben geheiratet ‒«
»Ja, stimmt, jetzt weiß ich es wieder, im Rosengarten, am ersten Mai … Hat dein Mann nicht an der Columbia University studiert?«
»‒ und haben uns zwei Jahre später wieder scheiden lassen.«
»Ach, Schätzchen«, sagt DeeDee und legt ihre perfekt manikürte Hand auf meinen Arm. »Die Hälfte der Mädels hier lässt sich dieses Jahr scheiden. Der Mann von Elyse, meiner besten Freundin, hat sie gerade verlassen ‒ wegen seiner zweiundzwanzigjährigen Laborassistentin. Die Männer sind einfach nur schwanzgesteuert.« Beim letzten Wort senkt sie die Stimme, aber für den Fall, dass ich nicht verstehen könnte, was sie meint, krümmt sie den kleinen Finger, um das verachtenswerte männliche Organ zu imitieren.
»Nun, das war bei Neil nicht das Problem.« Ich blicke über DeeDees Schulter und suche nach jemandem, irgendjemandem, der mich von ihr befreien könnte, aber ich sehe nur die lüsternen Augen eines Triton im Stile Raffaels, der eine nackte Quellnymphe verfolgt. Ich rede nicht besonders gern über Beas Vater und sein Schicksal. Um Bea zu schützen, habe ich auch schon öfter gelogen, wenn ich gefragt wurde, wo er jetzt lebt. Aber als ich DeeDee wieder ansehe, bemerke ich die Rötung in ihrem Gesicht, ähnlich wie bei der Lady im Fenster, und ich weiß, dass ihr eingefallen ist, was mit Neil los war.
»Ach, Gott«, seufzt sie dramatisch und drückt meinen Arm. »Ich hatte es ganz vergessen. Bei unserem fünfjährigen Treffen habe ich gehört, dass er in eine Klinik eingewiesen wurde. War es nicht die Institution, die Christine gerade in ihrem Vortrag erwähnt hat ‒ die Irrenanstalt Briarwood? In die auch Eugenie Penroses bedauernswerte Schwester gegangen ist?«
In die sie gegangen ist? Das klingt ja, als würden wir uns darüber unterhalten, welches College die beiden besucht haben! In gewisser Weise stimmt es sogar, denn Briarwood ist, ähnlich wie MacLean oder Austin-Riggs, eine dieser exklusiven Einrichtungen, die fast die gleiche Aura haben wie eine Elite-Universität oder wie ein Rotarier-Club.
»Ja, genau«, sage ich und versuche verzweifelt, Christine zu bedeuten, dass sie mich erlösen soll. »Nur sagt man jetzt offiziell Psychiatrische Klinik Briarwood. Den Begriff Irrenanstalt verwendet man schon lange nicht mehr. Aber soviel ich weiß, ist Neil immer noch dort.«
DeeDee schaut sich kurz um, als hätte sie Angst, jemand könnte sich von hinten anschleichen und sie in die Psychiatrie zerren. Dann kommt sie einen Schritt näher. »Im Grunde ist das gar nicht so übel«, flüstert sie und tätschelt dabei meinen Arm. »Dann brauchst du dich wenigstens nicht mit irgendwelchen nächtlichen Heimsuchungen abzugeben.«
»Nein, das kann doch nicht wahr sein! Hat sie das wirklich gesagt?«
»Ich schwör’s bei meiner Ehre als Penrose-Studentin. Genau das waren ihre Worte. Ich hätte fast gesagt, so verrückt wie Neil war, müsste ich angesichts seiner Wahnvorstellungen vielleicht mit astralen Heimsuchungen rechnen.«
Christine bleibt abrupt stehen ‒ wir sind auf dem Weg von der Bibliothek zu meinem Wagen ‒, stellt ihre voll gepackte Reisetasche ab und nimmt meine Hand. Die letzten Sonnenstrahlen malen ein Muster auf den kurz geschorenen College-Rasen. Man ahnt zwar schon die abendliche Kühle, aber mir wird ganz warm von Christines Händedruck. Die Distanz, die ich im letzten halben Jahr immer wieder zwischen uns gespürt habe, löst sich auf wie Nebel in der Morgensonne.
»Entschuldige, Juno, das ist alles meine Schuld. Sie hätte das doch nie gesagt, wenn ich Briarwood nicht in meinem Vortrag erwähnt hätte.«
»Ach, Unsinn! Was denkst du denn, warum ich das Jahrgangstreffen gemieden habe? Bei unserem fünfjährigen Treffen wurde doch über nichts anderes getratscht, und ich habe genau gewusst, dass auch jetzt wieder jemand davon anfangen wird. Mir persönlich würde das ja nichts ausmachen. Aber es ist so: Hier in der Stadt hat man die Sache inzwischen weitgehend vergessen, und Bea wird nur noch ganz selten darauf angesprochen. Deshalb wollte ich nicht, dass durch meine Anwesenheit die alten Geschichten hochkochen.«
Christine hängt ihre Tasche wieder über die Schulter und schlägt fröstelnd den Kragen ihrer dünnen Lederjacke hoch. »Ich hätte dir trotzdem vorher erzählen sollen, was ich über Clare Barovier herausgefunden habe. Ich wollte es nicht aufbauschen.«
»Ja, ich habe gemerkt, dass du den Absatz über den Erbfaktor bei Geisteskrankheiten gekürzt hast. Aber ganz ehrlich, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich glaube, es gibt keinen gesünderen Menschen als Beatrice.«
»Das weiß ich doch, Juno.«
»Glaub mir, es ist echt kein Problem für mich. Aber ich finde, du solltest noch eine Kleinigkeit essen, bevor du nach New York zurückfährst. Wir könnten ins Gal’s fahren, da gibt’s immer noch diesen superguten Cappuccino Amaretto.«
Christine lächelt. Ich glaube, sie freut sich, dass ich mich an ihr Lieblingsgetränk aus der College-Zeit erinnere. Doch plötzlich verschwindet das Lächeln aus ihrem Gesicht. »Nein, lieber nicht. Da begegnen wir nur den anderen, und ich möchte mich mit dir allein unterhalten. Außerdem würde ich schrecklich gern sehen, was du aus der Glasfabrik gemacht hast. Ich finde es klasse, dass du jetzt dort wohnst.«
Jeder andere Mensch findet es absurd, dass ich mit meiner halbwüchsigen Tochter in einer alten Fabrik lebe ‒ wie oft habe ich das schon zu hören bekommen! Aber ich merke an Christines Tonfall, dass es ihr wirklich gefällt. Mein Wagen steht im kühlen Schatten, aber ich fühle immer noch eine innere Wärme, die jetzt daher kommt, dass mich ihre Anerkennung so glücklich macht.
Als wir den Uferbezirk erreichen, in dem ich wohne, ist die Sonne schon hinter den Bergen am anderen Flussufer verschwunden. Ich schließe die Fabriktür auf, und zum Glück dringt immer noch genug Helligkeit durch die Fenster und das Oberlicht im Westflügel, dass ich die Deckenbeleuchtung nicht einzuschalten brauche. Es ist hier drin fast heller als draußen.
»Was für ein magisches Licht!«, ruft Christine und durchquert den Raum mit ausgebreiteten Armen, als wollte sie alles an sich drücken. Ihre Stiefelabsätze klacken laut auf den breiten Holzbohlen. Die hohe Decke wirft den Widerhall zurück. »Sind das noch die ursprünglichen Fenster?«
»Bis auf ein paar Scheiben, die ich ersetzen musste. Die meisten kaputten Fenster waren auf der Nordseite. Von dort blickt man auf den Bahnhofsparkplatz, und früher hat es zu den Initiationsriten der Rosedale-Highschool gehört, rauszufinden, wer die höchsten Scheiben einwerfen kann. Zum Glück sind da die Gleise der Metro-North-Linie, und nur die allerblödesten Kids haben von dort aus Steine geworfen, ohne Rücksicht auf Verluste.«
Christine dreht sich um und sieht mich fragend an. »Und das weißt du so genau, weil …«
»Sagen wir mal so: Ich habe Mr Penrose mitgeteilt, dass ich die Kosten für die neuen Fensterscheiben übernehme.«
»Heißt das, du mietest das Gebäude von Gavin?«
»Mhm. Die Fabrik gehört zu den wenigen Immobilien, die Augustus Penrose nicht dem College oder irgendeiner wohltätigen Institution vermacht hat. Ich glaube allerdings nicht, dass Industriebauten Gavins Spezialiät sind. Er hätte diese Fabrik schon vor Jahren abgestoßen, wenn er einen Käufer gefunden hätte. Inzwischen kommt es ja öfter vor, dass Leute alte Fabriken in Künstlerprojekte umgestalten.«
»Wie zum Beispiel das MASSMoCA in North Adams, unser hoch verehrtes Massachusetts Museum of Contemporary Art?«
»Genau. Und in Beacon baut die Dia Art Foundation eine Fabrik in ein modernes Museum um. Das gehört sich ja eigentlich auch für so eine Stiftung, die zeitgenössische Künstler unterstützt. Na, egal, jedenfalls interessiert sich Gavin plötzlich wieder für das Gebäude. Ich hoffe nur, dass er es nicht in eine Käsekuchenfabrik mit lauter billigen Souvenirläden verwandeln will. Ich hätte schrecklich gern eine Galerie und günstige Ateliers für Künstler. Vielleicht könntest du mir ja helfen, bei ArtHudson einen Finanzierungsantrag einzureichen. Gavin sitzt doch im Vorstand, und so wie’s aussieht, hört er auf dich.«
Christine wendet sich wieder zu den Fenstern um. »Ehrlich gesagt ‒ ich könnte im Moment ein Stück Käsekuchen gut vertragen«, sagt sie. »Was ist mit der ›Kleinigkeit zu essen‹, von der du vorhin geredet hast?«
»Hier entlang.«
Kaum öffne ich die Tür zum Innenhof, da kommen auch schon die beiden Hunde angerannt. Ihre Pfoten scharren über den polierten Holzfußboden. Sie rennen durch den Raum, schnuppern mit gereckten Hälsen, und dann schmiegen sie sich an meine Hüfte und beäugen Christine misstrauisch.
»Hey, du hast mir ja gar nichts von diesen Hunden erzählt!«
Ich habe es ihr gesagt, das weiß ich ganz genau, aber ich beharre lieber nicht darauf. Offenbar konnte sie sich in den letzten Monaten nur noch auf die Dame im Fenster konzentrieren und auf nichts anderes.
»Bea hat mir keine Ruhe gelassen. Seit sie sprechen kann, liegt sie mir damit in den Ohren. Sie wollte unbedingt einen Hund, aber als wir noch in dem Apartment über Dads Garage gewohnt haben, ging das natürlich nicht. Die beiden hier haben wir erst vor drei Monaten aus dem Tierheim geholt.«
»Sehr schöne Tiere. Wie heißen sie?«
»Paolo und Francesca.«
»Ach ‒ zwei kleine Italiener?« Christine grinst.
»Nein, ganz normale Greyhounds, Rennhunde, die ihre besten Zeiten hinter sich haben. Sieh sie dir genauer an, dann weißt du gleich, woher sie ihre Namen haben.« Ich schubse die Hunde von meiner Hüfte weg, und sie drehen noch eine Runde im Raum. Francesca rennt außen, Paolo nimmt die Innenbahn und lehnt sich dabei an sie.
Christine zögert einen Moment, doch dann fällt ihr das Dante-Zitat ein, das wir im ersten Studienjahr in unserem Italienisch-Seminar auswendig lernen mussten: »Stimmt! Ich sagte: Dichter, gerne möchte ich sprechen / Mit jenen zwein, die dort zusammen kommen / Und die so leicht vom Wind getragen scheinen. So beschreibt Dante Paolo und Francesca, als er ihnen das erste Mal im zweiten Kreis der Hölle begegnet, stimmt’s?«
»Brava! Professor Da Silva wäre stolz auf dich. Weißt du noch? Er hielt diese Zeile für die Krönung der Weltliteratur.«
Christine legt den Kopf in den Nacken. Wie sehr sie mit ihrem hellen Teint und dem langen Hals den Greyhounds gleicht! »Wenn ich mich recht entsinne, war es doch auch Neils Lieblingszitat, oder?«
Penrose ist zwar ein Frauen-College, aber Neil, der eigentlich in New York an der Columbia University studierte, hatte einen Antrag gestellt, Umberto Da Silvas berühmtes Dante-Seminar als Gasthörer besuchen zu dürfen.
Ich wende mich ab, weil ich Christines forschendem Blick ausweichen will, und schaue lieber in Francescas zärtliche Augen. Paolo hat die Augen geschlossen, sein Kopf ruht auf Francescas Hals.
»Die Frau vom Tierheim hat uns erklärt, die beiden würden immer so dicht beieinander bleiben, weil sie in einem winzigen Käfig eingesperrt waren und sich nicht beide gleichzeitig hinlegen konnten. Also haben sie sich immer aneinander geschmiegt, wenn sie sich ausruhen wollten. Ich hatte keine Wahl ‒ ich musste entweder beide nehmen oder keinen. Aber nachdem die Frau uns diese Geschichte erzählt hat, war ich schon froh, dass ich Bea mit nur zwei geretteten Greyhounds wieder aus dem Tierheim rausbekam.«
»Das klingt ja wie der neunte Kreis der Hölle.« Christine mustert mich immer noch prüfend. Ich tue so, als würde ich es nicht merken, und führe sie über den Innenhof. Dann versuche ich, das Eisentor zum Nordflügel der Fabrik zu öffnen. Christine wandert inzwischen durch das Unkraut und bleibt vor der Tür zum Ostflügel stehen.
»Was ist das für ein Geräusch? Hört sich an wie ein Windtunnel«, sagt sie, während ich noch mit dem verrosteten Schloss kämpfe.
»Das sind die Glasöfen«, erkläre ich ihr. »Zwei Glasbläser haben hier einen Platz zum Arbeiten gemietet. Ernesto Marquez, der auch für mich Fenster aus- und einbaut, und eine Frau namens Marina, die am Corning Museum gelernt hat und zur Zeit eine Ausstellung in Venice hat. Sie macht fantastische Sachen.«
»Ist es nicht gefährlich, wenn man so einen Ofen anlässt?«
»Ja, klar, und wegen der Brandgefahr werden die ganzen Arbeiten mit heißem Glas in diesem Flügel abgewickelt. Du siehst ja, er ist mit keinem der anderen Gebäudeteile verbunden. Und er ist absolut brandsicher, nur Beton und Stahl. Hier haben die Penrose Studios das Glas für Augustus’ Fenster hergestellt.«
»Stimmt ‒ jetzt erinnere ich mich, ich habe nämlich in Eugenies Tagebüchern etwas über diese Öfen gelesen. Sie vergleicht sie mit den Höllenfeuern. Ich glaube, dieser Teil von Augustus’ Arbeit hat ihr insgesamt nicht besonders behagt. Sie fand die Weberei und die Töpferwerkstatt besser.«
»Die waren auch hier untergebracht, wie in mittelalterlichen Handwerkerstätten. Das entsprach Augustus Penroses Idealvorstellung. Es ist ziemlich selten, dass ein Buntglasstudio sein eigenes Glas produziert, aber bei Tiffany war das auch so, nicht nur bei Penrose. Da habe ich mir gedacht, warum nicht auch McKay Glass?«
Endlich habe ich die Tür aufbekommen und winke Christine in mein Atelier. »Unsere Wohnung ist oben«, erkläre ich und gehe zu der schmiedeeisernen Wendeltreppe. Aber Christine ist stehen geblieben und betrachtet die Zeichnung auf weißem Pauspapier, die sich an der zwei Stockwerke hohen Wand gegenüber von der Treppe befindet. Es ist ein Wachskreideabrieb des Lady-Fensters. Wir brauchen ihn, um das Fenster wieder zu verbleien, nachdem es auseinander genommen wurde.
»Sind diese Risse die Stellen, wo die Bleiruten gebrochen sind?«
»Ja, genau«, sage ich, während ich die Stufen hinaufgehe. »Die Restaurierung kommt keine Minute zu früh. Normalerweise bröckelt Blei schon nach siebzig Jahren, und das Fenster ist achtzig Jahre alt.« Oben angekommen, hole ich schnell aus der Küche die Flasche Pellegrino-Wasser, einen halben Laib Sauerteigbrot, den frischen Mozzarella, den Vater mir vergangene Woche aus Poughkeepsie mitgebracht hat, sowie ein Glas Oliven.
Christine zögert noch, ist auf halber Treppe stehen geblieben und blickt hinunter ins Studio. »Aber jetzt bist ja du die Fensterexpertin!«, rufe ich zu ihr hinunter. »Ich möchte wetten, dein Vortrag hat die Leute motiviert, großzügig für die Restaurierung zu spenden.«
»Ohne dich hätte ich ihn gar nicht gehalten. Du hast mich überhaupt erst darauf gebracht, das Fenster zu studieren. Und wenn du mich nicht überredet hättest, das Stipendium zu beantragen …«
Sie ist jetzt oben angekommen und sieht mich an. Wahrscheinlich mache ich ein ähnliches Gesicht wie sie sonst, wenn ich mich bei ihr dafür bedanke, dass sie mir so oft das Leben gerettet hat. »Na, egal ‒ ich habe unsere lieben Kommilitoninnen ja nur daran erinnert, dass sich in der Bibliothek ein bedeutendes Kunstwerk befindet, das sie verkommen lassen, während du ihnen sagen kannst, was sie konkret tun müssen, um es zu retten. Und du bist diejenige, die es retten wird. Sieh dir doch nur dieses Studio an!« Mit einer ausholenden Handbewegung deutet sie auf den Raum unter uns. »Ich bin echt beeindruckt, Juno. Du hast Augustus Penroses Traum von einer mittelalterlichen Werkstatt wieder auferstehen lassen.«
Ich muss zugeben, dass das Studio von hier oben wirklich imposant aussieht. Ich habe die Männer dazu gebracht, die kleineren Restaurierungsaufträge aus dem Weg zu räumen, die Lünetten für Häuser oben in den Heights, verschiedene Spitzbogenfenster für eine Presbyterkirche in Tarrytown. Wir brauchen jetzt Platz für das Lady-Fenster. Mein Dad hat einen neuen Leuchttisch gebaut und eine Wand mit lauter vertikalen Regalbrettern ausgestattet, in die die Glasplatten gestellt werden, die Ernesto und mein Vater so gewissenhaft geblasen haben. Genau in den Farben des ursprünglichen Fensters, damit wir eventuell beschädigte Teile ersetzen können.
»Ich weiß nicht, ob das mit der mittelalterlichen Werkstatt nicht ein bisschen übertrieben ist. Im Grunde habe ich doch nur den Betrieb meines Vaters etwas ausgedehnt, sonst nichts.«
»Nichts gegen deinen Dad, Juno, aber er hat die kaputten Ladenfenster in der Main Street repariert und oben in den Heights Sturmfenster installiert. Was du hier machst, ist Kunst… Ist das von dir?« Sie steht vor der Verandatür und bestaunt die Glasscheiben. Ich nutze die Gelegenheit, um die Tür zu öffnen, und versuche Christine nach draußen zu locken. Aber nur Paolo und Francesca folgen meiner Aufforderung und wandern Seite an Seite hinaus auf die mit Teerpappe gedeckte Dachterrasse.
»Das war ein Projekt, das ich gemeinsam mit Bea gemacht habe ‒ bevor ich die Hoffnung aufgab, sie könnte vielleicht auch mit Glas arbeiten wollen.« Wehmütig betrachte ich die Tür. Ich musste sie schließlich allein fertig machen, weil Bea dauernd mit neuen Ausreden daherkam, weshalb sie unbedingt hinaus auf den Fluss müsse.
»Sehr schön.« Mit dem Zeigefinger fährt Christine das Rankenmuster nach. »Sieht aus wie eine echte Weinranke, die an der Wand hochwächst.« Ihre Augen folgen dem Muster, wandern bis hinauf zum Oberlicht. Sie schaut weg, schaut wieder hin. Ihr fällt etwas auf, was andere Leute erst beim dritten oder vierten Mal merken: Auf den ersten Blick sieht es nämlich so aus, als würden die Ranken über den Metallrahmen des Oberlichts wachsen, aber in Wirklichkeit habe ich das Muster ins Glas eingesetzt.
»Wow! Ist das da oben auch dein Werk? Das gefällt mir ja noch besser als das Fenster, das du letztes Jahr bei Urban Glass ausgestellt hast!« Da erst registriert sie, dass ich immer noch die Wasserflasche und die Gläser in der rechten und Brot und Käse in der linken Hand halte. »Komm, lass dir die Sachen abnehmen!«
Wir stellen alles auf einen alten Rohrtisch, und ich kippe den Stuhl zur Seite, um den Ruß abzuschütteln, der von den Metro-North-Gleisen immer hier herauffliegt. Ich will für Christine ein Handtuch als Unterlage holen, damit ihr Prada-Kleid nicht leidet, aber sie winkt ab, nimmt ohne weitere Umstände Platz und stellt ihre teure Ledertasche auf die rußige Teerpappe. Als ich die Tasche ergreife, um sie zur Sicherheit hineinzubringen ‒ ich weiß noch genau, wie Christine mir das elegante Seidenfutter und das Logo des edlen italienischen Lederwarendesigners gezeigt hat ‒, hält sie mich zurück. »Da drin ist was, was ich dir zeigen möchte.« Statt das Versprochene herauszuholen, schlägt sie die langen, schlanken Beine übereinander, wobei ihre Stiefel ein leises Quietschgeräusch von sich geben, als würde man ein Stück Klebeband von einer Glasscheibe abziehen. Mit einem wehmütigen Seufzer schaut sie hinaus auf die Landschaft.
»Sagenhaft ‒ in Manhattan würdest du für so eine Aussicht gut und gern eine Million Dollar bezahlen.«
Das ist meine liebste Tageszeit. Es ist die Stunde der Glasfenster, sage ich immer, besser kann ich die Beleuchtung nicht beschreiben: wenn der Himmel abkühlt zu einem Opalglaston und sich die Bäume zu einem Maßwerk aus Blei verdunkeln. Ich nehme auf einem verrosteten Metallstuhl Platz, gieße das perlende Wasser in langstielige Gläser und sehe zu, wie die Bläschen den rubinroten Kelch in ein facettenreiches Juwel verwandeln. Ich kenne niemanden, der aus Glas so wunderschöne Produkte herstellen kann wie Ernesto. Die Kelche sind so kunstvoll, als wären sie von Waterford, aber gleichzeitig so filigran wie von Orrefors. In ihnen verwandelt sich selbst Wasser in ein exotisches Elixier ‒ und genau das will ich erreichen. Seit Christine nicht mehr trinkt, achte ich immer darauf, ihr die nichtalkoholischen Getränke besonders stilvoll zu servieren.
Christine hebt ihr Glas zur dunklen Linie der Berge am anderen Flussufer, als würde sie den letzten Lichtspuren drüben über den fernen Catskills zuprosten. Ein Strahl fällt durch das rubinrote Glas und wirft rote Flecken auf Christines Hand, wie ein Armband aus Rubinen, das von ihrem zarten Handgelenk nach oben verrutscht ist.
»Auf die Lady im Fenster«, sage ich und stoße mit ihr an. Das Klirren der Gläser klingt noch nach, als ich den ersten Schluck Wasser trinke. »Der Vortrag war ein Erfolg, und jetzt können wir das Fenster rechtzeitig zur Hundertjahrfeier im Herbst restaurieren. Da kommst du doch auch, oder?«
Christine stellt ihr Glas auf den Tisch und bricht sich ein Stück Brot ab. »Wenn sie mich haben wollen. Ich hatte den Eindruck, dass Gavin Penrose nicht ganz zufrieden war. Er hat im Voraus gewusst, dass ich die Figur im Fenster als ›Lady von Shalott‹ beschreiben würde. Aber dass ich auf Eugenies Schwester Clare zu sprechen gekommen bin, hat ihm gar nicht gepasst.«
»Was du da recherchiert hast, ist wirklich spannend. Ich gehöre zum Beispiel auch zu den Leuten, die gar nichts von Eugenies Schwester wussten. Wie hast du das eigentlich herausgefunden?«
»Meine Tante Amy hat mir mal von einer Clare Barovier erzählt, die ihr ganzes Leben in Briarwood verbracht hat. Ich wusste, dass Eugenie mit Mädchennamen Barovier hieß, deshalb bin ich nach Briarwood gefahren und habe ein bisschen herumgeschnüffelt.« Christine lächelt verschmitzt.
»Ich habe erwartet, dass sich Gavin für meine Entdeckungen interessiert«, fährt sie dann fort. »Aber wahrscheinlich wird kein Mensch gern an seine verrückten Verwandten erinnert. Ach, Mist ‒ entschuldige, ich wollte nicht…«