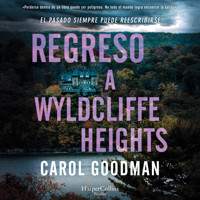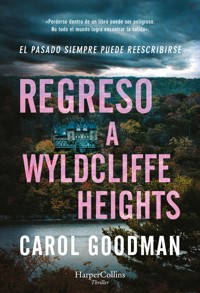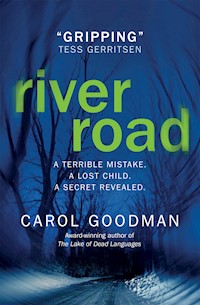4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Von der Vergangenheit eingeholt … Der fesselnde Spannungsroman »Das kalte Herz von Heart Lake« von Carol Goodman jetzt als eBook bei dotbooks. Ein frostüberzogener See, über dem ein großes Anwesen drohend aufragt … Das altehrwürdige Mädcheninternat Heart Lake war einst Jane Hudsons zweite Heimat, bis der rätselhafte Tod einer Mitschülerin es zu ihrem Albtraum werden ließ. Und trotzdem will sie hier 20 Jahre später einen Neuanfang als Lehrerin wagen. Doch dann beginnen all die Erinnerungen, die sie tief in sich begraben hatte, Schlag um Schlag zurückzukehren, als die Ereignisse von damals sich plötzlich zu wiederholen scheinen. Jane wird klar, dass ihre Schülerinnen in höchster Gefahr schweben. Wird es ihr gelingen, sie zu retten – und so auch sich selbst? »Dieser Story kann sich niemand entziehen!« Für Sie Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Roman »Das kalte Herz von Heart Lake« von Carol Goodman. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein frostüberzogener See, über dem ein großes Anwesen drohend aufragt … Das altehrwürdige Mädcheninternat Heart Lake war einst Jane Hudsons zweite Heimat, bis der rätselhafte Tod einer Mitschülerin es zu ihrem Albtraum werden ließ. Und trotzdem will sie hier 20 Jahre später einen Neuanfang als Lehrerin wagen. Doch dann beginnen all die Erinnerungen, die sie tief in sich begraben hatte, Schlag um Schlag zurückzukehren, als die Ereignisse von damals sich plötzlich zu wiederholen scheinen. Jane wird klar, dass ihre Schülerinnen in höchster Gefahr schweben. Wird es ihr gelingen, sie zu retten – und so auch sich selbst?
»Dieser Story kann sich niemand entziehen!« Für Sie
Über die Autorin:
Carol Goodman ist eine amerikanische Schriftstellerin und Dozentin für Creative Writing. Schon vor ihrem Abschluss am renommierten Vassar College wurde sie mit 17 Jahren als Young Poet of Long Island ausgezeichnet. Für ihre vielschichtigen Spannungsromane erhielt Carol Goodman bereits zweimal den Mary Higgins Clark Award. Sie lebt auf Long Island.
Von Carol Goodman erscheinen bei dotbooks die psychologischen Spannungsromane »Die Schatten von Bosco Manor«, »Das dunkle Geheimnis von Penrose« und »Das kalte Herz von Heart Lake«.
***
eBook-Neuausgabe August 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2002 unter dem Originaltitel »The Lake of Dead Languages« bei bei Ballantine, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Das Gesicht unter dem Eis« im Wilhelm Heyne Verlag.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2002 by Carol Goodman
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2003 der deutschsprachigen Ausgabe by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-245-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das kalte Herz von Heart Lake« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Carol Goodman
Das kalte Herz von Heart Lake
Roman
Aus dem Amerikanischen von Christine Strüh und Adelheid Zöfel
dotbooks.
Für meine Mutter, Margaret Goodman,und in Erinnerung an meinen Vater,Walter Goodman
1924–1999
Prolog
Der See meiner Träume ist immer gefroren. Nie ist es ein sommerlicher See, dessen Wasser schwarz gefleckt ist von den Schatten der Fichten, oder ein herbstlicher, wenn die Oberfläche einem rotgoldenen Patchworkquilt gleicht, und auch kein See an einem Frühlingsabend im Perlenglanz des Mondlichts. Der See meiner Träume spiegelt nichts wider: Er ist leblos, weiß, eine geschlossene Tür, versiegelt von dem Eis, das achtzehn Meter in die Tiefe reicht, bis hinunter zu seinem kalksteinernen Gletscherbett.
Lautlos gleite ich auf meinen Schlittschuhen über die gefrorene Tiefe; die graue Decke des Himmels verschluckt das Scharren der Kufen. Ich spüre in meinen Fußsohlen, wie gut das Eis trägt, und ich laufe, wie ich in meinem Leben noch nie gelaufen bin. Keine müden Gelenke, keine schmerzenden Schenkel, leicht und frei schwebe ich dahin, als würde ich fliegen.
Ich lehne mich weit in runde, ausladende Achten hinein, drehe mich mit kerzengeradem Rücken, den Kopf in den Nacken gelegt, meine langen Haare fliegen durch die kalte, trockene Luft. Meine Sprünge tragen mich hoch in die Luft, und ich lande sicher auf dem silbernen Eis, wie ein zielgenauer Pfeil. Jede Linie ist klar und perfekt und kreuzt die vorherige, und ein sprühender Eisgischtschleier folgt mir.
Dann kommt der Moment, in dem mich die Angst packt: Ich wage es nicht mehr, nach unten zu schauen, denn ich fürchte mich vor dem, was ich unter der Oberfläche sehen werde. Und wenn ich den Blick dann doch senke, ist das Eis dick und undurchsichtig, und schon wird mir wieder leichter ums Herz. Die Angst fällt von mir ab, schwerelos tanze ich meine Pirouetten, leicht wie ein Blatt im Wind; die feinen, eleganten Linien, die meine Kufen ins Eis ritzen, gleichen einer Kalligraphie. Erst als ich, am Ufer angekommen, zurückblicke, sehe ich, dass ich ein Bild ins Eis geritzt habe, ein Gesicht, vertraut und längst entschwunden, und wieder sehe ich, wie es im schwarzen Wasser versinkt.
Teil 1:Umwälzung
Kapitel 1
Man hat mich gebeten, den Lateinunterricht so zu gestalten, dass er einen Bezug zum Leben meiner Schülerinnen herstellt. Aber ich merke, dass die älteren Mädchen am Heart-Lake-Internat gerade deswegen Latein wählen, weil es mit ihrem sonstigen Leben absolut nichts zu tun hat. Am meisten Spaß macht es ihnen, eine neue, schwierige Deklination auswendig zu lernen. Mit blauem Kugelschreiber schreiben sie sich die Endungen des Nomens auf die Handfläche und leiern die Formen herunter: »Puella, puellae, puellae, puellam, puella ...«, wie Nonnen, die den Rosenkranz beten.
Wenn ein Test ansteht, treten sie gehorsam im Waschraum an, um sich die Hände zu waschen. An die kühle Kachelwand gelehnt, beaufsichtige ich sie und sehe, wie die Waschbecken sich mit blassblauem Schaum füllen und die archaischen Wörter den Abfluss hinuntergespült werden. Wenn sie mir die Innenseite ihrer Hände zeigen, damit ich sie auf Spuren von Buchstaben überprüfen kann, weiß ich nicht, ob ich wirklich hinsehen soll. Wenn ich sie kontrolliere, ist es dann nicht ein Beweis dafür, dass ich ihnen misstraue? Und wenn ich nicht hinsehe, halten sie mich dann nicht für naiv? Wenn sie ihre Hände in meine legen – so feingliedrig, so zart –, ist es, als hätte sich ein flügge gewordenes Vögelchen auf meinem Schoß niedergelassen. Ich wage nicht, mich zu rühren.
Im Unterricht sehe ich meistens nur die andere Seite ihrer Hände – den schwarzen Nagellack und die silbernen Totenkopfringe. Ein Mädchen hat sogar ein Tattoo auf dem rechten Handrücken – ein verschlungenes blaues Muster, das einen keltischen Knoten darstellt, wie sie mir erklärt hat. Drei der Mädchen haben sich mit Nadeln oder Rasierklingen die Innenseite ihrer Handgelenke geritzt. Am liebsten würde ich diese Narben mit den Fingerspitzen nachfahren und fragen: Warum? Aber ich drücke ihnen nur die Hand und fordere sie auf, ins Klassenzimmer zurückzugehen. »Bona fortuna«, sage ich. »Viel Glück beim Test.«
Als ich nach Heart Lake gekommen bin, habe ich mich über die neuen Mädchen gewundert, aber mir wurde sehr schnell klar, dass sich das Internat seit meiner eigenen Schulzeit in eine Art letzte Zuflucht für eine bestimmte Sorte von Mädchen verwandelt hat. Von außen wirkt die Heart Lake School for Girls noch immer wie ein renommiertes Internat, aber das stimmt längst nicht mehr. In Wirklichkeit kommen hierher Mädchen, die schon aus zwei oder drei guten Schulen hinausgeworfen wurden. Mädchen, deren Eltern die ständigen Szenen satt haben, das Blut auf dem Badezimmerfußboden, die Polizei an der Tür.
Athena (sie heißt eigentlich Ellen Craven, aber ich nenne die Mädchen in Gedanken immer mit dem antiken Namen, den sie sich für den Lateinunterricht ausgesucht haben) ist als Letzte mit dem Händewaschen fertig. Sie will auch die Extraaufgaben machen, zusätzliche Deklinationen und Konjugationen, und deshalb hatte sie sich bis zu den Ellbogen mit blauem Kuli voll gekritzelt. Jetzt streckt sie mir ihre Unterarme zur Inspektion hin, und ich sehe wohl oder übel die Narbe, die sich an ihrem rechten Arm von der Handwurzel zum Ellbogen hinaufschlängelt. Athena merkt, dass ich zusammenfahre.
Sie zuckt die Achseln. »Das war ziemlich blöd von mir«, sagt sie. »Aber letztes Jahr war ich wegen einem Jungen völlig fertig, wissen Sie.«
Ich versuche, mich daran zu erinnern, wie es sich angefühlt hat, als ein Junge für mich so wichtig gewesen war – fast kann ich sein Gesicht vor mir sehen –, aber es ist ähnlich wie mit den Wehen: Man kann sich die Symptome ins Gedächtnis rufen – wie alles verschwimmt, die Wahrnehmung sich immer mehr verengt, bis sie nur noch um ein inneres Zentrum kreist, und schließlich sogar die Schwerkraft aufgehoben scheint –, aber der eigentlichen Schmerzen kann man sich nicht entsinnen.
»Deshalb hat meine Tante mich jetzt auf ein Mädcheninternat geschickt«, fährt Athena fort. »Damit ich mich nicht wieder mit irgendwelchen Jungs rumtreibe. Wie meine Mutter – sie muss immer in dieses Center bei New York, wenn sie auf Entzug ist – na ja, Sie wissen schon, wegen Alkohol und Tabletten und so. Ich bin hier sozusagen auf Entzug, nur eben von Jungs.«
Ich blicke von ihren Händen in ihr blasses Gesicht – die Blässe wird durch die blauschwarz gefärbten Haare und die Ringe unter den Augen noch verstärkt. Ich bilde mir ein, Tränen in ihrer Stimme zu hören, aber sie lacht. Ehe ich mich’s versehe, lache ich auch. Dann wende ich mich ab und ziehe ein paar Papierhandtücher aus dem Spender, damit sie sich die Arme abtrocknen kann.
Nach dem Test entlasse ich die Mädchen etwas früher als sonst. Sie jubeln und drängen sich durch die Tür. Ich bin nicht gekränkt. Das gehört zu dem Spiel, das wir spielen. Sie mögen es, wenn ich streng bin. Bis zu einem gewissen Grad. Es gefällt ihnen, dass der Unterricht schwierig ist. Sie mögen mich, glaube ich. Anfangs habe ich mir geschmeichelt, es könnte daran liegen, dass ich sie verstehe, aber eines Tages fand ich einen Zettel auf dem Boden.
»Wie findest du sie?«, hatte eins der Mädchen geschrieben.
»Ich finde, wir sollten nett zu ihr sein«, hatte ein anderes geantwortet – später konnte ich die Handschrift Athena zuordnen.
Da begriff ich, dass der gute Wille der Mädchen nichts mit meinem Unterricht oder meinem Verhalten zu tun hatte. Es gab einen ganz anderen Grund: Mit dem untrüglichen Instinkt der Jugend spürten meine Schülerinnen, dass ich genauso viel Mist gebaut haben muss wie sie, um hier zu landen.
Beim Verlassen des Klassenzimmers schütteln sie die verkrampften Hände aus und vergleichen ihre Antworten. Vesta – die dünne, fleißige Vesta, die sich am meisten Mühe gibt – hält das Lehrbuch in der Hand und liest die Deklinationen und die Konjugationsformen laut vor. Manche stöhnen, andere stoßen Triumphschreie aus. Octavia und Flavia, die beiden vietnamesischen Schwestern, die auf ein College-Stipendium für klassische Philologie hoffen, nicken bei jeder Antwort mit der für Streberinnen typischen Gelassenheit. Wenn ich genau zuhören würde, müsste ich die Arbeiten gar nicht mehr korrigieren, sondern wüsste schon jetzt die jeweiligen Noten, aber ich lasse die Äußerungen der Freude und der Enttäuschung ungefiltert an mir vorüberziehen. Die Mädchen gehen lärmend den Flur hinunter, bis Myra Todd den Kopf zur Tür herausstreckt und schimpft, weil sie ihren Biologieunterricht stören.
Eine weitere Tür öffnet sich, und eins der Mädchen ruft: »Hallo, Miss Marshmallow!« Darauf folgt ein hohes, nervöses Lachen: Es gehört zu Gwendoline Marsh, der Englischlehrerin. Nicht Gwen wird sich nachher bei mir beschweren, nein, Myra wird mir die Hölle heiß machen, weil ich die Mädchen vor dem Klingeln entlassen habe. Aber das ist mir gleichgültig. Es hat sich gelohnt, denn jetzt legt sich eine wunderbare Stille über das leere Klassenzimmer, und ich habe ein paar Minuten Ruhe, ehe die nächste Stunde beginnt.
Ich drehe meinen Stuhl so, dass ich zum Fenster hinausschauen kann. Auf dem Rasen vor der Villa sehe ich meine Mädchen, die sich im Kreis auf dem Boden niedergelassen haben. Mit ihren dunklen Klamotten und den gefärbten Haaren – Athenas Haare sind blauschwarz, Aphrodites platinblond und Vestas lilarot, genau wie die Nylonmähne der Kleinen-Meerjungfrau-Puppe meiner Tochter – sehen sie von hier oben aus wie Blumenzüchtungen in unnatürlichen Farbtönen. Schwarze Dahlien, schwarze Tulpen. Blüten in düsteren Leichenfarben.
Hinter den Mädchen liegt, blaugrün und reglos, der Heart Lake in seinem Gletscherbett aus Kalkstein. Auf dieser Seite des Sees leuchtet das Wasser so hell, dass mir die Augen schmerzen. Ich blicke hinüber zum dunkleren Ostufer, wo sich die Fichten schwarz im Wasser spiegeln. Dann nehme ich den Hausaufgaben-Ordner vom Schreibtisch, um die Arbeiten abzulegen, die ich heute eingesammelt habe. Ich ordne bei allen Schülerinnen die neuesten Arbeitsblätter hinter den älteren ein (wie üblich bin ich mit meinen Korrekturen etwa eine Woche hinterher). Das Sortieren fällt mir nicht schwer, weil fast jedes Mädchen anderes Papier benutzt, und ich kenne inzwischen ihre jeweiligen Vorlieben: Vesta nimmt lilafarbenes Briefpapier, Aphrodite gelbe Briefblöcke, Athena liefert linierte Seiten ab, die sie aus ihren Heften mit dem schwarzweißen Einband herausreißt.
Bei Athena steht hin und wieder auf der Rückseite des Blattes etwas, was nicht zur Aufgabe gehört. Die wenigen Zeilen am oberen Rand sehen aus wie der Schluss eines Tagebucheintrags. Den Satzfragmenten nach zu urteilen, die ich gelesen habe, schreibt sie offenbar so, als würde sie einen Brief an sich selbst verfassen; und manchmal scheint ihr das Tagebuch als Brieffreundin zu dienen. »Vergiss nicht«, habe ich auf einem dieser Blätter gelesen, »du brauchst niemanden außer dir selbst.« Und ein anderes Mal: »Ich verspreche, dir öfter zu schreiben. Ich habe ja nur dich.« Bisweilen finde ich auch eine Zeichnung. Die Hälfte eines Frauengesichts, das in einer Welle verschwimmt. Ein Regenbogen, der von einer geflügelten Rasierklinge in zwei Teile zertrennt wird. Ein Herz, von einem Dolch durchbohrt. Billige Teenager-Symbole. Die Bilder könnten ohne weiteres aus dem Tagebuch stammen, das ich in ihrem Alter geführt habe.
Ihre Zettel erkenne ich an den unregelmäßigen Rändern, die beim Herausreißen aus den Schulheften entstehen. Wenn sie nicht aufpasst, fallen bald auch die übrigen Blätter aus dem Heft! Ich weiß das so genau, weil ich dieselbe Art von gehefteten Kladden benutzt habe, als ich so alt war wie sie, diese Hefte mit dem schwarzweiß marmorierten Umschlag. Auf den ersten Blick denke ich, dass ich wieder eine Seite ihres Tagebuchs in der Hand halte, aber als ich das Blatt umdrehe, sehe ich, dass die andere Seite leer ist. Athenas Hausaufgabe steht auf einem anderen Zettel, ganz unten im Stapel. Ich habe den Überblick verloren. Ist die Seite, die ich jetzt in der Hand halte, gerade erst abgegeben worden, oder lag sie schon im Ordner? Ich sehe sie mir genauer an. Oben steht in winziger, gedrängter Schrift eine einzige Zeile. Die Tinte ist so blass, dass ich das Blatt ans Licht halten muss, um das Geschriebene überhaupt lesen zu können.
Du bist die Einzige, der ich es sagen kann.
Ich starre wie gebannt auf die Wörter, bis sich eine Art verschwommene Aura um sie bildet und ich blinzeln muss, damit ich wieder richtig sehen kann. Später werde ich mich fragen, was ich zuerst wieder erkannt habe: den Satz, den ich vor fast zwanzig Jahren in mein Tagebuch geschrieben habe, oder meine Handschrift.
In der nächsten Stunde lasse ich die Schülerinnen so lange Deklinationen aufsagen, bis alle anderen Wörter in meinem Kopf zu einem kaum hörbaren Flüstern verhallen, aber auf dem Weg zum Speisesaal melden sie sich wieder. Du bist die Einzige, der ich es sagen kann. Der Satz ist typisch für das Tagebuch eines jungen Mädchens. Wenn ich nicht meine eigene Handschrift erkannt hätte, gäbe es überhaupt keinen Anlass zur Beunruhigung. Der Satz könnte sich auf alles Mögliche beziehen, aber da ich genau weiß, was damit gemeint ist, muss ich mich zwangsläufig fragen, wer mein altes Tagebuch in die Hände bekommen und eine Seite daraus in meinen Ordner gelegt hat. Zuerst bin ich davon überzeugt, dass es Athena war, aber je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass jede meiner Schülerinnen in Frage kommt – jede kann mir den Zettel zusammen mit ihrem Arbeitsblatt in die Hand gedrückt haben. Es gibt sogar noch eine weitere Möglichkeit: Da ich den Ordner über Nacht auf meinem Schreibtisch habe liegen lassen und die Klassenzimmer nicht abgeschlossen werden, kann irgendjemand das Blatt in meinen Ordner gelegt haben.
Diese Seite stammt aus dem Tagebuch, das ich während meines letzten Schuljahrs geführt und dann im Frühjahr, kurz vor Schulschluss, verloren habe. Könnte es sein, dass sich das Heft die ganze Zeit auf dem Schulgelände befunden hat – vielleicht unter einer der lockeren Holzdielen in meinem alten Zimmer? Hat Athena oder eine ihrer Freundinnen es dort gefunden? Beim Gedanken daran, was sonst noch alles in diesem Tagebuch steht, muss ich im Herrenhaus am Fuß der Treppe stehen bleiben und mich eine Weile am Geländer festhalten, ehe ich die Stufen hinaufgehen kann.
Mädchen in Schottenröcken und weißen Blusen drängeln sich an mir vorbei, während ich die Stufen zu der massiven Eichentür emporsteige. Mit ihrer Überlebensgröße soll die Tür den Besucher einschüchtern. Der Familie Crevecoeur, die der Schule das Herrenhaus gestiftet hat, gehörte auch die Papierfabrik in Corinth, nicht weit von hier. India Crevecoeur organisierte für die Fabrikarbeiterinnen regelmäßig einen »Bildungs-Nachmittag«. Ich stelle mir vor, wie die jungen Frauen hier vor dieser Tür warteten, dicht aneinander gedrängt, um sich gegenseitig zu wärmen und sich Mut zuzusprechen. Wer weiß, womöglich war auch meine Großmutter dabei, die in der Fabrik arbeitete, ehe sie Hausmädchen bei den Crevecoeurs wurde.
Als ich das Stipendium für Heart Lake bekam, hatte ich mir oft überlegt, wie die Crevecoeurs sich wohl verhalten hätten, wenn sie wüssten, dass die Enkelin eines ihrer Hausmädchen jetzt ihre Schule besuchte. Ich glaube nicht, dass sie es besonders amüsant gefunden hätten. Auf dem Familienporträt im Musiksaal wirken sie allesamt ziemlich mürrisch und unglücklich. Ihre Vorfahren waren Hugenotten, die im siebzehnten Jahrhundert aus Frankreich geflohen waren und sich schließlich an diesem entlegenen Ort im Staat New York niedergelassen haben. Garantiert war vieles hier ein Schock für sie – die Wildnis, die gnadenlos harten Wintermonate, die Abgeschiedenheit. Das fächerförmige Fenster über der Tür ist heute aus normalem Glas, aber als ich zur Schule ging, befand sich dort ein buntes Bleiglasfenster: Es stellte ein rotes Herz dar, das von einem grünen Dolch mit lilienverziertem Griff in zwei Teile gespalten wurde, und in gelben Lettern prangte das Familienmotto darauf: Cor te reducet. Das Herz wird dich zurückführen. Wahrscheinlich hegten sie die Hoffnung, von diesem unzivilisierten Ort erlöst zu werden und nach Frankreich heimkehren zu können – oder zu Gott. Aber seit ich selbst an den Heart Lake zurückgekommen bin – an diesen Ort, den ich nie wieder sehen wollte, das hatte ich mir geschworen –, denke ich oft, dass mit dem Herz der See selbst gemeint sein könnte, der auf alle, die an seinem Ufer gelebt und in seinem eisig grünen Wasser gebadet haben, eine ganz besondere Anziehungskraft ausübt.
Der Speisesaal des Lehrkörpers befindet sich im früheren Musiksaal. Als ich Schülerin war, mussten die Stipendiatinnen in der Küche arbeiten und den Lehrern das Essen servieren. Diese Sitte wurde vor ein paar Jahren abgeschafft, weil man einsah, dass sie für die Stipendiatinnen eine Erniedrigung bedeutete. Mich hat es allerdings nie gestört, denn Nancy Ames, die Köchin, versorgte uns immer mit leckeren Mahlzeiten. Rinderbraten und Kartoffeln, Gemüse in Sahnesauce und gedünsteter Fisch. So gut hatte ich noch nie gegessen. Auch bewahrte sie uns stets ein paar der für jede Mahlzeit frisch gebackenen Brötchen auf, die sie in dicke, mit dem Heart-Lake-Wappen bestickte Leinenservietten wickelte. Wenn ich dann durch die kalte Abenddämmerung zum Wohnheim ging – in meiner Erinnerung ist dieses letzte Jahr in Heart Lake ein einziger endloser Winterabend –, spürte ich das Brötchen warm in meiner Tasche, wie ein kleines Tierchen, das sich Schutz suchend an meinen Körper schmiegte.
Inzwischen verwendet die Schule Papierservietten, und die Lehrer bedienen sich an einem Büfett: Tunfischsalat und abgepackte Brote, Karottensticks und hart gekochte Eier. Allerdings sind die Lehrer weiterhin verpflichtet, zum Essen zu erscheinen. Diese Vorschrift geht auf India Crevecoeur, die Gründerin von Heart Lake, zurück: Sie wollte, dass die Lehrer eine Gemeinschaft bildeten. Ein lobenswerter Grundsatz, aber an Tagen wie heute hätte ich viel darum gegeben, wenn ich mich einfach mit einem Sandwich am See auf einen Felsen setzen könnte, nur in der Gesellschaft von Ovid. Beim Betreten des Speisesaals werfe ich India auf dem Familienporträt einen vorwurfsvollen Blick zu, den sie, wohl behütet im Schoß ihrer großen Familie, verächtlich erwidert.
Der einzige freie Platz ist neben Myra Todd. Ich hole ein paar Klassenarbeiten aus meiner Tasche, um sie während des Essens zu korrigieren. Vielleicht kann ich auf diese Weise Myra daran hindern, eine Bemerkung über mein verfrühtes Unterrichtsende zu machen. Die meisten Lehrer an dem langen Tisch haben neben sich einen ähnlichen Stapel liegen, den sie mit dem Rotstift bearbeiten, während sie an ihrem Tunfischsandwich kauen. Als ich meine Arbeiten auspacke, springt mir sogleich die Seite aus meinem Tagebuch ins Auge. Hastig falte ich sie zusammen und stecke sie in die Tasche meines karierten Wollrocks. Genau in dem Moment beugt sich Myra zu mir, um sich den Salzstreuer zu holen. Aber selbst wenn sie den Zettel liest, kann sie mit diesen kryptischen Worten nichts anfangen, sage ich mir. Es sei denn, sie ist diejenige, die mein altes Tagebuch gefunden hat.
Ich mustere sie verstohlen, um herauszufinden, ob sie meinen Stapel Blätter mit besonderem Interesse studiert, aber sie isst zufrieden ihr Sandwich und starrt dabei ins Leere. Neben dem Geruch von Tunfisch und abgestandenem Kaffee steigt mir der spezifische Duft in die Nase, der ihr anhaftet – ein Hauch von Moder, als wäre sie selbst eins ihrer chemischen Experimente und hätte während der Weihnachtsferien zu lange im Schrank gestanden. Ich habe mich schon oft gefragt, ob dieser Geruch von einer seltenen Krankheit oder vom unzulänglichen Wäschewaschen kommt, aber eine Frau wie Myra kann man so etwas unmöglich fragen. Ich versuche mir vorzustellen, was sie tun würde, wenn sie mein altes Tagebuch fände. Garantiert würde sie es unverzüglich bei der Direktorin abgeben.
Und was würde Direktorin Buehl mit meinem alten Tagebuch anfangen? Zu meiner Zeit war Celeste Buehl noch Biologielehrerin. Sie war damals immer nett zu mir – und es war mehr als nett von ihr, mir diesen Job zu geben –, aber ich glaube nicht, dass sie immer noch so freundlich zu mir wäre, wenn sie mein Tagebuch lesen würde.
Als sie jetzt den Speisesaal betritt, fällt mir auf, wie stark sie sich in den zwanzig Jahren, seit sie meine Lehrerin war, verändert hat. In meiner Erinnerung führt sie – schlank und athletisch – ihre Schülerinnen auf Naturlehrpfaden durch den Wald, und im Winter läuft sie Schlittschuh auf dem See. Jetzt lässt sie die Schultern hängen, und ihre kurzen, stufig geschnittenen Haare, die früher dunkel und kräftig waren, wirken matt und glanzlos. Als sie hereinkommt, entschließt sich Myra Todd, mir lauthals vorzuhalten, dass ich die Schülerinnen nach der dritten Stunde schon vor dem Klingeln entlassen habe.
»Jane«, sagt sie laut, »Ihre Schülerinnen haben uns während der dritten Stunde im Labor gestört. Wir waren gerade an einem sehr schwierigen Punkt beim Sezieren. Mallory Martin ist die Hand ausgerutscht und hat ihre Partnerin mit dem Skalpell verletzt.«
Ich weiß, was über Mallory Martin geredet wird. Meine Mädchen nennen sie nur Malefiz. Deshalb erscheint es mir eher unwahrscheinlich, dass die Sache mit dem Skalpell ein Unfall war.
»Es tut mir Leid, Myra, nächstes Mal werde ich ihnen einschärfen, dass sie leise sein müssen. Nach einer Klassenarbeit sind sie immer so überdreht.«
»Am besten hält man ein paar Zusatzaufgaben bereit, falls sie mit dem Test früher fertig sind. Dann sind sie nicht so erpicht darauf, möglichst schnell abzugeben.« Es ist Simon Ross, der Mathematiklehrer, der ungefragt diesen pädagogischen Rat gibt. Dann fährt er fort, mit einem dicken Rotstift seinen Stapel zu korrigieren. Seine Fingerspitzen sind rot verschmiert, und ich sehe, dass die Farbe bereits sein Sandwich befleckt hat.
»Ich lasse die Mädchen in ihre Tagebücher schreiben«, meldet sich Gwendoline Marsh mit piepsiger Stimme. »Auf die Weise haben sie ein Ventil, und es wird auch benotet.«
»Und wie bewerten Sie diese Tagebücher?«, erkundigt sich Meryl North – die Geschichtslehrerin, die schon zu meiner Schulzeit so alt zu sein schien wie ihr Fach. »Lesen Sie ihre intimen Gedanken?«
»O nein – ich lese nur die Einträge, die für mich bestimmt sind. Was ich nicht lesen soll, markieren sie mit einem Kreis und schreiben ›persönlich‹ an den Rand.«
Meryl North gibt ein Geräusch von sich, bei dem man nicht weiß, ob sie lacht oder hustet, und Gwendolines blasses Gesicht rötet sich. Ich versuche, mich mit ihr durch Blicke zu verständigen – hier in Heart Lake ist sie für mich noch am ehesten eine Art Freundin –, aber sie starrt stur in einen zerfledderten Band mit Gedichten von Emily Dickinson.
»Die Mädchen scheinen ziemlich unter Stress zu stehen«, sage ich – mehr, um Gwens Verlegenheit zu überbrücken, als weil ich das Thema unbedingt anschneiden möchte. Letztes Jahr gab es zwei Selbstmordversuche. In Reaktion darauf hat die Verwaltung für das Lehrpersonal ein wöchentliches Seminar über Depressionen in der Adoleszenz eingerichtet, unter dem Thema: »Wie entdecke ich die zehn wichtigsten Warnsignale für suizidales Verhalten?«
»Meinen Sie eine bestimmte Schülerin?« Diese Frage kommt von Dr. Candace Lockhart. Im Gegensatz zu uns übrigen hier am Tisch hat sie keine Klassenarbeiten neben sich liegen, die sie korrigieren muss, und auch keinen Text, den sie für die nächste Stunde vorbereitet. Ihre Finger sind nie tintenverschmiert, nie haben ihre makellos geschnittenen taubengrauen Kostüme diese hässlichen gelblichen Kreideflecken, die uns andere verfolgen wie eine ansteckende Krankheit. Sie ist die Schulpsychologin – etwas, was es zu meiner Zeit noch nicht gab. Bei ihrer Anstellung gab es irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Ich habe gehört, wie sich verschiedene Lehrer darüber beschwert haben, Direktorin Buehl habe sich bei der Ausschreibung nicht an das korrekte Verfahren gehalten. Mit anderen Worten, die Lehrer hatten nicht die Möglichkeit, über sie herzufallen. Die Schimpfereien sind von einem gewissen Neid gefärbt, gegen den auch ich nicht gefeit bin. Es geht das Gerücht, dass Candace eine bahnbrechende Studie über die Psychologie adoleszenter Mädchen durchführt. Wir hegen alle den Verdacht, dass sie uns nach Abschluss ihrer Untersuchungen verlassen wird, um eine eigene Praxis aufzumachen, um Aufsehen erregende Vorträge zu halten und in Oprah Winfreys Talkshow aufzutreten. Vielleicht strebt sie auch eine Professur an einer der Elite-Universitäten an? Jedenfalls wird es ein Lebensstil sein, der ihrer Kleidung eher entspricht. Aber in der Zwischenzeit sitzt sie hier bei uns, mit ihren hellen – fast weißen – Haaren, den blauen Augen und der schlanken, eleganten Figur, eine edle Siamkatze unter lauter unscheinbaren Hauskatzen.
Die arme Gwen in ihrem verwaschenen abgetragenen Kleiderrock mit dem indischen Muster und der altmodischen weißen Stehkragenbluse sieht neben Candace erst recht ungepflegt aus. Obwohl beide Anfang dreißig sind, kann man Gwen schon ansehen, wie anstrengend es ist, jeden Tag fünf verschiedene Klassen zu unterrichten, ganz zu schweigen von dem halben Dutzend Arbeitsgemeinschaften, die sie leitet. Ihr Teint ist teigig, ihre Haare sind glanzlos und werden an den Wurzeln schon grau, ihre blauen Augen sind müde und gerötet. Candace hingegen hat offensichtlich genug Zeit, sich um ihre Frisur zu kümmern (dieses Platinblond kann auf keinen Fall echt sein), und ihre blauen Augen sind so klar und kühl wie ein Bergsee.
Diese blauen Augen verunsichern mich so, dass ich einen Fehler mache. Natürlich hätte ich auf ihre Frage »Meinen Sie eine bestimmte Schülerin?« antworten müssen: »Nein, ich meine keine bestimmte Schülerin.« Aber stattdessen nenne ich einen Namen. »Athena ... ich meine, Ellen ... Craven. Ich habe heute gesehen, dass sie eine schlimme Narbe am Arm hat.«
»Ach so – ja, darüber bin ich selbstverständlich informiert. Das ist nichts Neues. Und wenn man Ellens Vergangenheit betrachtet, braucht man sich nicht darüber zu wundern.«
Eigentlich hätte ich froh sein müssen, dass sie nicht weiter auf den Fall eingeht, aber es irritiert mich, wie sich ihr Blick verschleiert, wie ihre blauen Augen an mir vorbeiblicken. Wahrscheinlich denkt sie längst schon wieder an die brillante Karriere, die die Zukunft für sie parat hält. Sosehr ich mir auch einrede, über solche Eitelkeiten erhaben zu sein, merke ich doch, dass das keineswegs stimmt.
»Manchmal zeichnet sie etwas auf die Rückseite ihrer Hausaufgaben, und diese Bilder sind ... na ja, etwas beunruhigend.«
»Sie lassen zu, dass die Mädchen ihre Hausaufgabenblätter bekritzeln?« Myra Todd blickt entsetzt von ihrem Stapel auf. Aber Dr. Lockhart wirft ihr einen strengen Blick zu. Ich bin froh, dass zur Abwechslung jemand anders durch diese Augen zum Schweigen gebracht wird, und rede weiter, jetzt sicherer als zuvor. Als Athenas Lehrerin – zumal als die Lehrerin, der das Mädchen sich anvertraut hat – habe ich schließlich die Aufgabe, ihr bei ihren emotionalen Problemen zu helfen. Und an wen soll ich mich wenden, wenn nicht an die Schulpsychologin?
»Sie zeichnet körperlose Augen mit Tränen, die sich wiederum in Rasierklingen verwandeln. Oder Ähnliches. Ich nehme an, solche Symbole sind nicht ungewöhnlich ...«
Ich merke, dass alle am Tisch still geworden sind. Vielleicht hätte ich doch nicht vor allen Lehrern über meine Schülerin sprechen dürfen. Offenbar findet Dr. Lockhart das auch.
»Vielleicht sollten wir uns bei Gelegenheit einmal in meinem Büro über Athena unterhalten? Ich bin ab sieben Uhr zu sprechen. Wie wär’s gleich morgen vor der ersten Stunde?«, schlägt sie vor.
Sie merkt wahrscheinlich, dass ich keine große Lust habe, mich auf diesen frühen Termin einzulassen – ich habe mir angewöhnt, jeden Morgen vor dem Unterricht im See schwimmen zu gehen. Jedenfalls glaubt sie, mich ermahnen zu müssen. »Es ist sehr wichtig, dass wir sofort nachhaken, wenn wir merken, dass ein Mädchen sich intensiv mit dem Tod oder Selbstmord beschäftigt. Das kann dann schnell eine ungewollte Entwicklung nehmen, wie Sie wohl aus eigener Erfahrung wissen, Miss Hudson. Sie würden mir da doch sicher zustimmen, nicht wahr, Miss Buehl?«
Die Direktorin seufzt. »Der Himmel möge uns davor bewahren, dass so etwas noch mal passiert.«
Ich spüre, wie mir das Blut in die Wangen schießt, als hätte mir jemand eine Ohrfeige verpasst. Jetzt wage ich es nicht mehr, etwas gegen den Termin einzuwenden, und Dr. Lockhart scheint das genau zu spüren. Ohne meine Antwort abzuwarten, erhebt sie sich von ihrem Stuhl und legt einen blassblauen Schal über ihre Kostümjacke.
»Mich interessiert vor allem, ob die Legende von den Schwestern Crevecoeur ...« Der Rest ihres Satzes wird vom Schrillen der Klingel und vom Scharren der Stühle übertönt. Die Mittagspause ist zu Ende.
Unbelastet wie sie ist, schwebt Dr. Lockhart aus dem Speisesaal, während wir anderen unsere Bücher und Papiere zusammenpacken und unsere Leinentaschen über die Schulter hängen. Vor allem Gwen scheint von ihrer schweren Büchertasche schier erdrückt zu werden. Ich frage sie, ob ich ihr helfen kann, und sie reicht mir dankbar einen dicken Ordner.
»Oh, vielen Dank, Jane. Dann wollte ich auch fragen, ob jemand die Schülerinnengedichte für unsere Literaturzeitschrift abtippen kann. Ich würde es ja selbst machen, aber mein Karpaltunnelsyndrom ist wieder ganz schlimm.« Sie hebt die Arme, und ich sehe, dass beide Handgelenke mit elastischen Binden verbunden sind. Eigentlich wollte ich ihr ja nur die Tasche abnehmen, aber jetzt kann ich nicht mehr Nein sagen.
Also packe ich den schweren Ordner in meine Tasche. Jetzt bin ich diejenige, die völlig windschief daherkommt, während wir das Hauptgebäude verlassen. Gwen, von ihrer Last befreit, eilt voraus in ihr Klassenzimmer. Ich trotte hinter den anderen Lehrern her und denke über das nach, was die Psychologin gesagt hat. Intensive Beschäftigung mit dem Tod. Die Neigung zum Selbstmord. Ich sehe meine Schülerinnen vor mir, mit ihrem Totenkopfschmuck und den schwarz umrandeten Augen.
Die Nasenringe, die Totenköpfe, die violetten Haare – die Symptome mögen neu sein, aber die Beschäftigung mit dem Tod ist es nicht. Wie viele andere Mädcheninternate hat auch Heart Lake seine Selbstmordlegende. Als ich hier zur Schule ging, erzählte man sich – meist an Halloween, im Flammenschein des großen Feuers unten am Badestrand – die Geschichte der Familie Crevecoeur: Bei der Grippeepidemie 1918 verlor die Mutter drei ihrer Töchter. Angeblich waren die Mädchen in ihrem Fieberwahn eines Abends hinunter zum See gegangen, um sich im Wasser abzukühlen, und dabei ertrunken. An dieser Stelle der Geschichte deutete dann immer jemand hinaus auf die drei Felsen, die unweit des Strandes aus dem Wasser ragen, und verkündete feierlich: »Ihre Leichen wurden nie gefunden, aber am nächsten Tag tauchten im See drei mysteriöse Felsen auf, und diese Felsen nennt man seither die ›drei Schwestern‹.«
Stets fand sich eine ältere Schülerin, die dann noch mit Einzelheiten aufwartete, während wir jüngeren Mädchen nervös unsere Marshmallows ins Feuer hielten: India Crevecoeur, die Mutter der Mädchen, sei fortan so verzweifelt gewesen, dass sie nicht mehr am Heart Lake wohnen konnte. Deshalb ließ sie ihr Herrenhaus in ein Mädcheninternat umbauen. Doch vom ersten Jahr an habe es in dieser Schule rätselhafte Selbstmorde gegeben. Das Geräusch des Wassers, das gegen die drei Felsen schlägt (hier verstummte die Erzählerin immer, damit wir alle horchen konnten, wie die Wellen rastlos gegen den Stein schwappten), wecke in manchen Mädchen den Wunsch, sich im See zu ertränken. Wenn der See dann zufriert, könne man unter dem Eis die Gesichter dieser Mädchen erkennen. Und jedes Mal, wenn ein Mädchen im See ertrinkt, folgen ihm, so hieß es, zwangsläufig zwei weitere.
Wenn diese Legende immer noch im Umlauf ist, wie Dr. Lockhart befürchtet, dann könnte ich meinen Schülerinnen einiges dazu erzählen. Etwa dass die Familie Crevecoeur nur Iris, die jüngste Tochter, verloren hat. Und Iris ist nicht ertrunken. Bei einer Bootsfahrt mit ihren beiden Schwestern fiel Iris ins Wasser und erkältete sich schwer. Sie starb im eigenen Bett an der Grippe. Ich könnte ihnen außerdem erzählen, dass es Zeichnungen aus dem neunzehnten Jahrhundert gibt, auf denen die drei Felsen im See deutlich zu sehen sind, und dass sie von den frühen Siedlern »die drei Grazien« genannt wurden. Aber ich weiß genau: Je mehr man versucht, gegen eine Legende anzugehen, desto hartnäckiger setzt sie sich durch. Es ist wie bei Ödipus, der versucht, seinem Schicksal zu entrinnen, und gerade dadurch schuldig wird. Und wenn ich anfange, über die Legende zu sprechen, dann fragen mich die Mädchen vielleicht, ob es in meiner Schulzeit auch Selbstmorde gab. Dann müsste ich entweder lügen oder ihnen sagen, dass während meines letzten Schuljahrs meine beiden Zimmergenossinnen im See ertranken.
Vielleicht würde ich ihnen sogar sagen, dass ich seither das Gefühl habe, als ob der See auf das dritte Mädchen wartet.
Kapitel 2
Solange ich unterrichte und mich anschließend um Olivia kümmere, tritt die Frage, wer mein altes Tagebuch gefunden haben könnte, ganz in den Hintergrund. Am Rand meines Bewusstseins nehme ich sie zwar noch als unruhiges Gewisper wahr, aber ich schiebe sie weg, bis ich mich richtig darauf konzentrieren kann.
Abends mache ich für Olivia und mich Rührei. Nach dem Essen waschen wir die Eierschalen aus, weil Olivia sie für ein Bastelprojekt in der Vorschule braucht. Sie hält die Schalen unters laufende Wasser und reicht sie dann mir. Heimlich entferne ich den Glibber, der noch innen in den Schalen klebt, und setze sie in einen leeren Eierkarton. Olivia erklärt mir, dass nicht nur Vögel aus Eiern schlüpfen, sondern auch Schlangen und Alligatoren und Schildkröten. Und Spinnen auch.
»Charlotte hat für ihre Eier ein Netz gesponnen, und Wilbur hat es mit seinem Maul vom Markt nach Hause getragen«, erzählt sie mir. Ich weiß, dass Mrs. Crane, die Vorschullehrerin, den Kindern gerade Wilbur und Charlotte vorliest, dieses wunderbare Kinderbuch von der Freundschaft zwischen der Spinne Charlotte und dem Schwein Wilbur. Aus diesem Anlass lernen die Kinder etwas über Spinnen und Eier und besuchen eine Farm hier in der Gegend, um sich die Schweine anzusehen. Das Vorschulprogramm ist erstklassig – einer der Vorzüge dieses Internats.
Ich stelle den Karton auf die Arbeitsplatte, damit die Eierschalen trocknen können.
»Und dann ist Charlotte gestorben«, erzählt Olivia abschließend.
»Das ist traurig, stimmt’s?«
»Find ich nicht. Kann ich noch fernsehen, bevor ich ins Bett gehe?«
»Nein, du musst unter die Dusche.«
Olivia beschwert sich bitterlich, denn sie will lieber baden, aber das Cottage, das die Schulleitung uns zugewiesen hat, hat keine Badewanne. Zu guter Letzt beklagt sie sich noch darüber, dass ihr Vater nicht hier ist, um ihr vorzulesen. Mir liegt es auf der Zunge zu sagen, dass er ihr sowieso nie vorgelesen hat, weil er ständig arbeitete und erst heimkam, wenn sie schon längst im Bett war, aber diese Bemerkung verkneife ich mir natürlich. Aber ich sage ihr, dass ihr Vater ihr bestimmt ganz viel vorliest, wenn sie ihn übernächstes Wochenende besucht – was ein längeres Studium des Kalenders erfordert, bis Olivia einigermaßen begriffen hat, was »Besuch jedes zweite Wochenende« bedeutet.
Als sie fertig geduscht hat, ist es schon nach neun, und ich bin richtig heiser, weil ich den ganzen Tag unterrichtet und dann ständig auf eine Vierjährige eingeredet habe. Trotzdem komme ich nach der Bemerkung über ihren Vater nicht drum herum, ihr auch noch vorzulesen. Ich gehe in unser Gästezimmer, wo ich die Kartons mit Büchern, Papieren und sonstigen Unterlagen gestapelt habe, und finde eins meiner alten Kinderbücher, eine Geschichtensammlung mit dem Titel Ballettmärchen.
Olivia findet es hoch interessant, dass ich dieses Buch als Kind schon hatte.
»Hat deine Mommy es dir geschenkt?«, will sie wissen.
»Nein«, antworte ich. Wie soll ich ihr erklären, dass meine Mutter für so etwas Frivoles wie ein Buch niemals Geld ausgegeben hätte? »Eine meiner Lehrerinnen. Hier, sie hat sogar was für mich reingeschrieben.«
Auf die erste Seite hat meine Vorschullehrerin geschrieben: »Für Jane, die auf dem Eis tanzt.«
»Was heißt das, auf dem Eis tanzen?«
»Schlittschuh laufen. Mommy war früher eine ziemlich gute Schlittschuhläuferin. Ich bin immer hier über den See gesaust, wenn er im Winter zugefroren war.«
»Kann ich auch auf dem See Schlittschuh laufen, wenn er Eis hat?«, fragt Olivia.
»Vielleicht«, sage ich. »Mal sehen.«
Ich blättere in dem Buch und suche eine Geschichte, die sie kennt – »Aschenputtel« vielleicht oder »Dornröschen« –, aber dann schlägt sich eine Seite auf, in der ein getrocknetes Ahornblatt liegt, das früher einmal feuerrot war, inzwischen aber zu einem hellen Rostbraun verblasst ist. »Die Geschichte hier!«, befiehlt Olivia mit der eigentümlichen Bestimmtheit einer Vierjährigen.
Es ist »Giselle«. Das war früher meine Lieblingsgeschichte, aber für Olivia hätte ich sie nicht ausgesucht.
»Die ist aber ziemlich gruselig«, gebe ich zu bedenken.
»Gut«, entgegnet Olivia. »Gruselig gefällt mir.«
Die allerschlimmsten Stellen kann ich ja weglassen, denke ich mir. Ich erkläre Olivia, warum Giselles Mutter ihr das Tanzen verbietet, und dann muss ich erläutern, was es heißt, wenn jemand ein schwaches Herz hat. Olivia findet es toll, dass sich der Prinz als Bauer verkleidet, und als Giselle stirbt, ist sie ganz betrübt. Den ganzen Teil mit den Wilis will ich weglassen – die Wilis sind die Geister der jungfräulich gestorbenen Bräute, die von ihren Liebsten betrogen wurden und nun durch ihr verführerisches Verhalten junge Männer zwingen, so lange zu tanzen, bis sie tot umfallen. Aber als ich umblättere, sieht Olivia das Bild mit den elfenhaften Mädchen in ihren Brautkleidern und ist sofort Feuer und Flamme. Genau wie ich damals. Das war mein Lieblingsbild, als ich so alt war wie sie.
Also lese ich weiter. Ich lese ihr vor, wie die Mädchen mit dem Wildhüter Hilarion tanzen und ihn in den See locken, wo er ertrinkt, bis zu der Stelle, wo die Königin der Wilis Giselle eröffnet, dass sie Albrecht, ihren treulosen Liebhaber, dazu bringen müsse, in den Tod zu tanzen.
»Tut sie das?«, fragt Olivia mit sorgenvoller Miene.
»Was denkst du?«, frage ich sie.
»Na ja, er hat sie sehr traurig gemacht«, antwortet sie.
»Aber sie liebt ihn, also, hör zu ...«
Giselle sagt zu Albrecht, er soll sich an dem Kreuz auf ihrem Grab festhalten, aber er ist von ihrem Tanz so verzaubert, dass er ihr folgt. Weil Giselle zögert, lebt er noch, als die Kirchuhr vier schlägt und die Wilis in ihre Gräber zurückkehren müssen. »Und so rettet sie ihn«, sage ich und klappe das Buch zu. Die beiden letzten Sätze der Geschichte habe ich ausgelassen. Sie lauten: »Sein Leben war gerettet worden, aber sein Herz hatte er verloren. Giselle war mit ihm davongetanzt.«
Als Olivia eingeschlafen ist, hole ich die Tagebuchseite aus meiner Rocktasche. Beim Auseinanderfalten denke ich, dass es doch Athenas Handschrift ist – oder Vestas oder Aphrodites – und nicht meine eigene. Aber es hilft nichts: Ich erkenne nicht nur meine Handschrift, sondern auch die Tinte – ein eigenwilliges Pfauenblau. Lucy Toller hat mir diese Tinte zu meinem fünfzehnten Geburtstag geschenkt, zusammen mit einem Füllfederhalter in der gleichen Farbe.
Den Zettel in der Hand, gehe ich ins Gästezimmer und suche nach der Kiste mit der Aufschrift »Heart Lake«. Ich reiße das Packband ab und öffne den Karton so hastig, dass mir die Pappe mit ihrer scharfen Kante ins Handgelenk schneidet. Ohne auf den Schmerz zu achten, hole ich einen Stapel schwarzweißer Hefte heraus.
Es sind drei. Begonnen habe ich mit diesen Heften im neunten Schuljahr, als ich Matt und Lucy Toller kennen lernte, und jedes Jahr habe ich ein neues angefangen, bis zur letzten Klasse.
Ich zähle sie, in der trügerischen Hoffnung, dass sich das vierte wie durch ein Wunder wieder eingefunden hat. Aber das ist natürlich Unsinn. Seit es während meines letzten Jahrs als Schülerin hier aus meinem Zimmer verschwunden ist, habe ich das vierte Heft nicht mehr gesehen.
Damals dachte ich, jemand von der Schulleitung hätte es konfisziert. Das ganze letzte Halbjahr in Heart Lake war ich der festen Überzeugung, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bis man mich ins Rektorat rufen und mit der Wahrheit konfrontieren würde: mit der Wahrheit über die Ereignisse dieses Jahres und meinen widersprüchlichen Aussagen beim Verhör. Aber nichts dergleichen geschah. Wahrscheinlich war mein Tagebuch einfach verloren gegangen. Ich malte mir aus, dass es aus meiner Büchertasche gerutscht und in den See gefallen war – und der See hatte die blaugrüne Tinte weggewaschen, bis die Seiten wieder blütenweiß waren, wie am ersten Tag meines letzten Schuljahrs, als ich das Heft eingeweiht hatte.
Jetzt schlage ich das erste Tagebuch auf und lese den allerersten Eintrag.
»Lucy hat mir diesen Füller und die wunderschöne Tinte zum Geburtstag geschenkt, und von Matt habe ich das Heft bekommen«, hatte ich in einer schnörkeligen Schrift geschrieben, die dem eleganten Füller und der Tinte Ehre machen sollte. Aber zwischendurch zeigten sich unschöne Kleckse, wo sich die Federspitze im Papier verhakt hatte. »So gute Freunde wie sie werde ich nie wieder finden.«
Bei diesem Satz hätte ich fast laut gelacht. So gute Freunde. Als ich Matt und Lucy Toller kennen lernte, hatte ich überhaupt keine Freunde.
Wieder hole ich den Zettel hervor, streiche ihn glatt und lege ihn neben das Tagebuch. Die Handschrift ist klarer, keine Kleckse, aber der Satz ist mit der gleichen blaugrünen Tinte geschrieben.
Ich gehe nach draußen, um zu sehen, wie der Mond über dem Heart Lake aufgeht. Nicht zum ersten Mal denke ich, wie verrückt es ist, dass ich hierher zurückgekommen bin. Aber andererseits – wohin hätte ich gehen sollen?
Als ich Mitch eröffnete, dass ich mich scheiden lassen wolle, hat er mich ausgelacht. »Wo willst du hingehen? Wovon willst du leben?«, fragte er. »Mein Gott, Jane – du hast Latein studiert. Wenn du diese Wohnung verlässt, bist du völlig aufgeschmissen.«
Und ich hatte an Elektra gedacht, die sagt: »Wie sollen wir Herren sein im eigenen Hause? Verkauft wurden wir und gehen als Pilger.« Und in diesem Moment war mir schlagartig klar geworden, dass ich an den einzigen Ort zurückkehren würde, an dem ich mich je zu Hause gefühlt habe: nach Heart Lake.
Also begann ich, mein Latein aufzupolieren. Zwei Jahre lang hatte ich mich nicht mehr damit beschäftigt. Jetzt lernte ich jeden Abend nach meinem alten Lehrbuch, paukte Deklinationen und Konjugationen, bis sich das undurchschaubare Satzgewirr allmählich von selbst ordnete. Die einzelnen Wörter fanden sich zusammen, wie Schlittschuhläufer, die sich unterhaken, Adjektive gesellten sich zu Substantiven, Prädikate zu Subjekten, und gemeinsam ließen sie auf dem spiegelglatten Eis der archaischen Grammatik präzise Muster entstehen.
Und immer waren die Stimmen, mit denen ich die Deklinationen und Konjugationen vorgetragen hörte, die Stimmen von Matt und Lucy.
Nachdem ich das Lehrbuch zweimal durchgearbeitet hatte, bewarb ich mich um die Stelle in Heart Lake und erfuhr, dass meine ehemalige Biologielehrerin, Celeste Buehl, inzwischen Direktorin war. »Es ist uns nie gelungen, Helen Chambers zu ersetzen«, sagte sie zu mir. Ich konnte mich gut erinnern, dass Miss Buehl mit meiner Lateinlehrerin eng befreundet gewesen war. Niemand war so traurig gewesen wie sie, als Helen Chambers gehen musste. »Aber wir haben natürlich auch nie ein ›Old Girl‹ für diese Stelle gefunden.« Ehemalige Schülerinnen, die als Lehrerinnen nach Heart Lake zurückkehrten, wurden als »Old Girls« bezeichnet. Celeste Buehl war selbst ein »Old Girl«, genau wie Meryl North, die Geschichtslehrerin, und Tacy Beade, die Kunstlehrerin. »Eure Generation scheint kein besonders großes Interesse am Lehrberuf zu haben. Zwar habe ich noch kein Vorstellungsgespräch mit einer Ehemaligen geführt, seit ich Direktorin geworden bin, aber ich kann mir für die Stelle keine bessere Besetzung vorstellen als eine von Helen Chambers’ Schülerinnen. Glücklicherweise steht mein altes Cottage leer. Das wäre ideal für Sie und Ihre Tochter. Sie können sich bestimmt erinnern – das kleine Haus oberhalb des Badestrandes.« Ich konnte mich nur zu gut daran erinnern.
Und obwohl der Gedanke, dort zu wohnen, anfangs ziemlich beklemmend war, habe ich inzwischen den Blick auf den See schätzen gelernt. Von meiner Haustür bis zum »Point« sind es nur ein paar Schritte. Der Point ist der Felsvorsprung, der auf halber Strecke das Ufer zerschneidet und dem See seine herzförmige Gestalt verleiht. Von meiner Warte aus kann ich die Bucht des Badestrands sehen, weiß im Schimmer des Mondlichts, sowie die Felsen, die wir »die drei Schwestern« nannten und die stumm aus dem ruhigen, mondhellen Wasser ragen.
Ich gehe zurück ins Haus und betrachte die schlafende Olivia. Der Mond scheint durchs Fenster auf ihre zerzausten Haare. Ich streiche ihr die Strähnen aus der Stirn und ziehe die zerwühlten Laken zurecht, damit ihr ein bisschen kühler ist. Sie dreht sich um und stöhnt leise im Schlaf. Ich weiß, dass sie später irgendwann aufwacht, aber wohl erst zwischen zwei und vier. Jetzt kann ich mich darauf verlassen, dass sie die nächsten Stunden ungestört schläft.
Anschließend gehe ich wieder hinaus und die Steinstufen hinunter, die von unserem Haus zum See führen – wie jeden Abend –, und wie jeden Abend staune ich über mich selbst, dass ich dieses Risiko eingehe. Natürlich sollte ich Olivia nicht allein lassen, es könnte alles Mögliche passieren: Feuer, Einbrecher, Olivia könnte aufwachen und Angst bekommen, wenn ich nicht auf ihr Rufen reagiere, sie könnte aufstehen und hinaus ins Freie, in den Wald laufen ... Mein Herz klopft heftig beim Gedanken an all diese Katastrophen, deren Bilder ich so mühelos heraufbeschwören kann. Aber ich gehe trotzdem die Stufen hinunter, barfuß, und ich spüre, wie die Steine, je weiter nach unten ich komme, von der Gischt des Sees erst feucht und dann glitschig werden, weil sie mit Moos überwachsen sind.
Unten an der Treppe ist der Boden hart und lehmig. Ich kann hören, wie die Wellen ruhelos gegen die Felsen schwappen. Ich wate durchs kalte, knapp knietiefe Wasser, bis zum ersten der Drei-Schwestern-Felsen. Mit der Schulter lehne ich mich gegen den Stein, spüre seine Wärme. Warm wie ein Mensch, denke ich, doch ist es nur die Hitze, die er während eines für die Jahreszeit viel zu milden Tages gespeichert hat und nun abstrahlt. Die drei Felsen sind aus hartem, gleißendem Basalt, im Gegensatz zu dem Kalkstein der Umgebung. Lucy meinte, sie seien wie die Findlinge in England und von weither angeschleppt und im See aufgestellt worden, aber Miss Buehl hat uns erklärt, sie seien vermutlich von einem zurückweichenden Gletscher hinterlassen worden und dann zu ihrer gegenwärtigen Gestalt erodiert. Jeder der drei sieht anders aus; das Wasser und die Zeit, das Gefrieren und Auftauen des Sees haben sie unterschiedlich geformt. Der erste Fels, der, bei dem ich jetzt stehe, ist eine Art Säule, die zwei Meter aus dem Wasser ragt, der zweite ist ebenfalls säulenförmig, neigt sich aber leicht in Richtung Südufer. Der dritte Fels ist wie eine Kuppel, die sanft geschwungen aus dem tiefen Wasser emporsteigt.
Wenn man die Felsen als Bewegungsabfolge sieht – bei der richtigen Beleuchtung oder durch diesigen Nebel wie heute Abend –, könnte man sich einbilden, dass der erste ein Mädchen ist, das in den See watet, der zweite stellt das Mädchen dar, wie es sich ins Wasser beugt, und der dritte ist der aus dem Wasser herausragende Rücken des Mädchens, das wie ein Delphin untertaucht.
Der See fühlt sich herrlich kühl an. Zur Zeit ist es viel zu warm für Oktober, aber der Altweibersommer wird sich nicht mehr lange halten. Jeden Tag kann eine Kaltfront von Kanada zu uns herunterkommen, und dann ist Schluss mit dem täglichen Schwimmen. Plötzlich merke ich, wie klebrig und verschwitzt ich mich fühle und dass mir Nacken und Rücken wehtun, weil ich den ganzen Tag an der Tafel gestanden oder Aufgaben korrigiert habe. Der Gedanke, dass ich morgen früh nicht wie sonst den See genießen kann, ist fast ein körperlicher Schmerz. Ich könnte meine Kleider auf den Felsen legen und ein paar Minuten schwimmen. Dann würde das kalte Wasser den Gedanken an das verlorene Tagebuch wegwaschen.
Gerade will ich meine Bluse ausziehen, als ich in den Büschen hinter mir ein Rascheln höre. Instinktiv trete ich in den Schatten des zweiten Felsens. Von hier aus kann ich drei weiße Gestalten sehen, die an mir vorbei in den See waten. Leicht und behende bewegen sie sich im Wasser, wie Geister, und mit leisem Schaudern fühle ich mich an die Wilis erinnert, an die Geschichte, die ich Olivia gerade vorgelesen habe. Weiße Laken bauschen sich um die drei Figuren, wie die Brautkleider der Wilis, und dann legen sie die Laken ab und schwimmen nackt hinaus zum dritten Felsen.
Ein weißes Bündel treibt an mir vorbei, ich packe einen Zipfel und sehe das Wäschezeichen, das die Laken als Eigentum der Schule ausweist.
Das erste Mädchen ist schon auf den dritten Felsen geklettert. Sie steht auf und streckt die Arme, als wollte sie nach dem Mond greifen. »Wir rufen die Göttin des Sees und bringen ihr eine Gabe dar, um sie zu ehren, sie, die über die heiligen Wasser wacht.«
Die beiden anderen Mädchen, die noch im Wasser sind, kichern. Die zweite versucht jetzt, ebenfalls auf den Felsen zu klettern, und klatscht mit der Brust gegen den Stein, was ziemlich schmerzhaft sein muss.
»Verdammt, ich hab mir die Titten gequetscht!«
»Viel flacher als jetzt können die ja nicht werden.«
»Vielen Dank, Melissa!«
Durch ihr Gekicher und Gezänk verwandeln sich die drei Mädchen aus geheimnisvollen Wilis in drei alltägliche Teenager: meine Schülerinnen Athena (Ellen Craven), Vesta (Sandy James) und Aphrodite (Melissa Randall).
»Hört doch auf!«, ruft Athena, die Hände in die nackten Hüften gestützt. »Wie soll die Göttin des Sees unser Opfer ernst nehmen, wenn ihr zwei euch so aufführt? Ich hab euch doch gleich gesagt, wir hätten uns nicht vorher zudröhnen sollen.«
Auf Grund dieser letzten Bemerkung bin ich plötzlich mehr als nur eine harmlose Beobachterin – eine amüsierte Voyeurin –, jetzt bin ich die verantwortliche Lehrerin, wenn auch nur vor meinem Gewissen, denn ich zeige mich immer noch nicht. Dabei müsste ich – bei dem, was ich gerade gehört habe – eigentlich einschreiten: Die Mädchen haben gekifft. Aber der Anblick meiner nächtlich nackt badenden Schülerinnen versetzt mich nicht in Alarmbereitschaft. Vielleicht, weil es zu den alten Traditionen von Heart Lake gehört, dass man nackt badet und der Göttin des Sees ein Opfer bringt. Schon zu meiner Zeit pflegten die Schülerinnen der Gottheit des Sees etwas zu opfern. Eine Zeit lang nannten wir diesen Geist »Die Frau vom See« (das war, als wir Tennyson lasen), woraus wir später »Domina Lacunae« machten, und im letzten Jahr nannten wir sie »Die weiße Göttin«. Im Verlauf der Jahre opferten wir ihr alles Mögliche: halb gegessene Cracker, Perlen von kaputten Halsketten, Haarsträhnen. Lucy sagte, wenn man der Göttin zu Beginn des Schuljahrs etwas darbringe, dann würde man in diesem Jahr nichts im See verlieren. Die Mädchen verlieren nämlich ständig irgendetwas im Wasser, und ich vermute, dass auf dem dunklen Boden des Sees unzählige zerbrochene Namenskettchen, trüb gewordene Haarspangen und Ohrringe schimmern.
Beim Gedanken an den Grund des Sees überläuft es mich auf einmal eiskalt. Olivia ist immer noch allein zu Hause! Wie lange bin ich schon weg? Ich will sofort zurück, aber wenn die Mädchen merken, dass ich sie gesehen habe, muss ich sie der Direktorin melden. Celeste Buehls Gesichtsausdruck, als Dr. Lockhart die Crevecoeur-Legende erwähnte, drängt sich mir auf. Auf keinen Fall will ich sie darauf stoßen, dass es noch immer Mädchen gibt, die dem See Opfer bringen. Außerdem habe ich Angst, die Mädchen hier allein zu lassen. Was wäre, wenn eine vom Felsen rutscht oder beim Zurückschwimmen einen Krampf bekommt? Ich habe sie gesehen und fühle mich für sie verantwortlich. Also warte ich ab, bis sie ihr »Ritual« beendet haben. Allmählich wird ihnen offenbar kalt; im Mondlicht ahnt man die Gänsehaut. Sie wollen die Sache schnell hinter sich bringen, doch kann ich nicht sehen, was für Gaben sie in den Händen halten, ich höre lediglich ihre »Gebete«.
»Lass mich in diesem Schuljahr lauter gute Noten schreiben, damit meine Mom endlich aufhört, mich ständig zu nerven«, sagt Vesta.
»Sorg dafür, dass Brian sich nicht in eine andere verliebt, solange er in Exeter ist«, bittet Aphrodite.
Nur Athena spricht ihr Gebet so leise, dass ich nichts verstehe. Sie hebt den linken Arm und biegt die Hand nach hinten, sodass sich ihre Handfläche dem Nachthimmel zuwendet und die lange Narbe an ihrem Unterarm im Mondlicht bläulich leuchtet. Es ist fast so, als brächte sie diese Narbe als Opfergabe dar.
Kapitel 3
»Anorexie, Selbstverstümmelung, Selbstmord ... das gehört alles zum selben Syndrom. Teenagerschwangerschaften, Geschlechtskrankheiten, Drogenmissbrauch – und so weiter und so fort. Es beginnt mit der Pubertät. Als Zehnjährige sind die Mädchen intelligent und selbstbewusst. Aber sehen Sie sich die Fünfzehn- und Sechzehnjährigen an. Bei Mädchen ist in der Pubertät ein signifikanter Rückgang des IQ zu beobachten. Und es wird immer schlimmer. Wussten Sie, dass die Selbstmordrate bei zehn- bis vierzehnjährigen Mädchen zwischen 1979 und 1988 um fünfundsiebzig Prozent gestiegen ist?«
Dr. Lockhart lehnt sich in ihrem Schreibtischstuhl zurück und erwartet eine Reaktion von mir. Ich kann ihren Gesichtsausdruck nicht richtig erkennen. Sie sitzt mit dem Rücken zum Fenster, ein Schattenriss vor dem silbernen Hintergrund des Sees. Nachdem ich gestern Abend heimgekommen war, fing es ziemlich bald zu nieseln an, und es regnete bis zum Morgen durch, was mich einigermaßen darüber hinwegtröstete, dass ich nicht schwimmen gehen konnte. Jetzt hat es aufgehört, und der Himmel ist zwar noch bedeckt, aber hell wie poliertes Zinn. Von Dr. Lockharts Büro im ersten Stock des Herrenhauses kann man weder den Badestrand noch die ersten beiden »Schwestern« sehen, weil sie durch die steile Felswand des Points verdeckt sind, der den See in seine zwei Herzkammern aufteilt. Aber den dritten Felsen, auf dem Athena gestern Abend stand, kann ich deutlich erkennen.
Ich antworte, mir sei nicht bekannt gewesen, dass die Selbstmordrate seit 1979 dermaßen angestiegen ist. Ich erwähne nicht, dass ich mich 1979 in die Bibliothek von Vassar verkrochen hatte und bis Mitternacht Latein büffelte. Die anderen Mädchen betranken sich währenddessen in der Campus-Bar, im Wohnheim roch es penetrant nach Marihuana, im Badezimmer auf dem Flur gingen junge Männer ein und aus, Mädchen chauffierten sich gegenseitig zur Klinik in Dobbs-Ferry, um Abtreibungen vornehmen zu lassen. Im Gesundheitszentrum auf dem Campus konnte man ein Rezept für die Pille bekommen, und man ahnte noch nichts von Aids. Ich jedoch saß da, lernte Horaz auswendig und kämpfte mit lateinischen Stilübungen.
»Diderot sagte einmal zu einem jungen Mädchen:‹ Ihr sterbt alle mit fünfzehn.‹«
Ich zucke zusammen, aber mir wird schnell klar, dass sie es nicht wörtlich meint. Die Theorie kenne ich natürlich – dass Mädchen mit Beginn der Pubertät ihr Selbstbewusstsein einbüßen. Ich kenne auch die Buchtitel in Dr. Lockharts Regal. Die verlorene Stimme – Wendepunkte in der Entwicklung von Frauen und Mädchen; Pubertätskrisen junger Mädchen – und wie Eltern helfen können. Ich denke daran, was ich mir mit vierzehn für mein Leben erträumt habe. Eigentlich war es nicht so, als wäre ich gestorben – nein, ich bin eher in einen tiefen Schlaf versunken, wie im Märchen. Aber ich hatte angenommen, das sei nur bei mir so gewesen.
»Ein Mädchen wie Ellen ist besonders gefährdet«, sagt Dr. Lockhart.
»Wieso ein Mädchen wie Ellen?«
Dr. Lockhart rollt mit ihrem Schreibtischstuhl zu dem graublauen Aktenschrank und holt aus der mittleren Schublade einen hellgrünen Ordner hervor. Sie wirft einen kurzen Blick hinein und legt ihn wieder zurück.
»Ihre Eltern sind geschieden – der Vater hat so gut wie keinen Kontakt mehr zu der Familie, die Mutter ist Alkoholikerin und verbringt den größten Teil ihrer Zeit in Entzugskliniken.« Jetzt erinnere ich mich wieder, dass Athena mir erzählt hat, ihre Mutter sei ständig auf Entzug. »Es gibt eine Tante, die als Vormund fungiert, aber ihre Lösung des Problems sieht so aus, dass sie das Mädchen von einem Internat zum nächsten schickt.«
»Das ist schrecklich«, sagte ich. »Als ich hier zur Schule ging, habe ich auch solche Mädchen gekannt ...«
»Ach, wirklich?« Dr. Lockhart mustert mich einen Moment, dann lächelt sie. »Vielleicht haben Sie die Mädchen in den Ferien zu sich nach Hause eingeladen.«
Bei dem Gedanken muss ich lachen. Diese Mädchen aus Albany und Saratoga in ihren Shetlandpullis und ihren Perlenketten mochten zwar von ihren reichen Familien vernachlässigt worden sein, aber bei mir zu Hause hätte ich sie mir beim besten Willen nicht vorstellen können. Was hätten sie zu den Dosengerichten gesagt, die meine Mutter immer servierte, zu der Plastikdecke auf dem einzigen guten Sofa, zu der Fabrik vor dem Wohnzimmerfenster? Ich schaue Dr. Lockhart an. Sie lächelt nicht mehr. »Nein«, gestehe ich. »Ich bin nie auf die Idee gekommen, sie einzuladen. Aber bestimmt haben sich manche von ihnen hier sehr einsam gefühlt ...«
»Ja, man stelle sich vor – jedes Mal, wenn man sich an einer Schule einigermaßen zurechtfindet und Freundschaften geschlossen hat, wird man herausgerissen und muss wieder ganz von vorn anfangen. Mit der Zeit gibt man einfach auf.«
Der nüchterne Tonfall ist verschwunden. Dr. Lockhart interessiert sich wirklich für die Schülerinnen, das merke ich jetzt. »Waren Sie auch im Internat?«, frage ich sie.
»In mehreren«, antwortet sie. »Deshalb kann ich nachempfinden, wie einsam Ellen sich fühlen muss, nachdem sie so oft die Schule gewechselt hat. Diese Art von Einsamkeit macht Jugendliche anfällig für Depressionen und Selbstmordgedanken. Unsere Aufgabe ist es, solchen Entwicklungen gegenzusteuern. Wenn die Selbstmordidee erst einmal grassiert ...«
»So wie Sie das sagen, klingt es wie eine ansteckende Krankheit.«
»Selbstmord ist auch eine ansteckende Krankheit, Jane. Ich habe es selbst miterlebt. Ein Mädchen spielt beispielsweise mit dem Gedanken, sich umzubringen – vielleicht fügt es sich auch selbst Verletzungen zu, um mit den emotionalen Qualen besser umgehen zu können –, und dann will eine ihrer Freundinnen gleichziehen, und ihr gelingt es womöglich, sich zu töten. Die Dramatik, die solchen Tragödien innewohnt, übt auf die Mädchen eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Man muss sich ja nur ansehen, wie sehr der Tod sie fasziniert – Schmuckstücke mit Totenköpfen und schwarze Kleidung, diese ganze ›gruftige‹ Mode.«
»Ja, meine Schülerinnen im letzten Jahr Latein sehen samt und sonders aus wie Gestalten aus dem Mittelalter, und fast alle haben Narben an den Armen ...«
»Sie kennen doch sicher das Stück Hexenjagd?«
»Von Arthur Miller? Ja, natürlich, aber warum ...?«
»Erinnern Sie sich an die Stelle, wo Mädchen in der Stadt Salem aussagen, sie seien mit Nadelstichen gefoltert worden? Als die Richter die Mädchen untersuchen, entdecken sie tatsächlich Kratzer und Schnitte, Bisswunden und Nadeln in der Haut ...«
Ich zucke wieder zusammen, und Dr. Lockhart schweigt einen Moment. »Ich weiß, das ist kein erfreuliches Thema, Jane«, sagt sie dann, »aber wir dürfen nicht wegschauen. Viele unserer Mädchen fügen sich Schnitte zu oder verstümmeln sich in irgendeiner Weise. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie lange es diese Phänomene schon gibt.«
»Ich hatte auch keine Ahnung«, sage ich. »Wie kommt es, dass Sie ...«
»Das ist das Thema meiner Dissertation«, erklärt sie. »Selbstverstümmelung und Hexenwahn im puritanischen Neuengland.« Sie lehnt sich zurück und schaut hinaus auf den silbernen See.