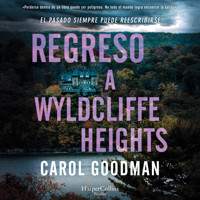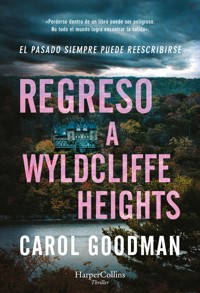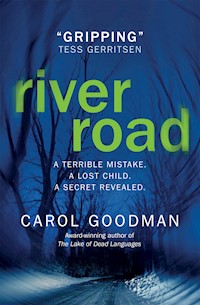4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf der Spur eines dunklen Familiengeheimnisses: Der fesselnde Spannungsroman »Die Schatten von Bosco Manor« von Carol Goodman als eBook bei dotbooks. Die junge Schriftstellerin Ellis ist begeistert, als sie ein Stipendium in einer Künstlerkolonie gewinnt. Und tatsächlich scheint schon die Atmosphäre des altehrwürdigen Herrenhauses Bosco Manor und der umliegenden Wälder genug Inspiration für ein ganzes Lebenswerk zu bieten. Doch schon bald häufen sich ungewöhnliche Ereignisse und Ellis spürt, dass ein dunkles Geheimnis tief verborgen in diesem alten Anwesen schlummert. Als sie von mysteriösen Todesfällen erfährt, die mehr als ein Jahrhundert zurückliegen, beginnt Ellis, in den unterirdischen Labyrinthen von Bosco nachzuforschen – und begibt sich mit jedem Schritt weiter in Gefahr … »Eine einzigartige Atmosphäre, ein absolut spannender Roman!« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Spannungsroman »Die Schatten von Bosco Manor« von Carol Goodman. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die junge Schriftstellerin Ellis ist begeistert, als sie ein Stipendium in einer Künstlerkolonie gewinnt. Und tatsächlich scheint schon die Atmosphäre des altehrwürdigen Herrenhauses Bosco Manor und der umliegenden Wälder genug Inspiration für ein ganzes Lebenswerk zu bieten. Doch schon bald häufen sich ungewöhnliche Ereignisse und Ellis spürt, dass ein dunkles Geheimnis tief verborgen in diesem alten Anwesen schlummert. Als sie von mysteriösen Todesfällen erfährt, die mehr als ein Jahrhundert zurückliegen, beginnt Ellis, in den unterirdischen Labyrinthen von Bosco nachzuforschen – und begibt sich mit jedem Schritt weiter in Gefahr …
»Eine einzigartige Atmosphäre, ein absolut spannender Roman!« Publishers Weekly
Über die Autorin:
Carol Goodman ist eine amerikanische Schriftstellerin und Dozentin für Creative Writing. Schon vor ihrem Abschluss am renommierten Vassar College wurde sie mit 17 Jahren als Young Poet of Long Island ausgezeichnet. Für ihre vielschichtigen Spannungsromane erhielt Carol Goodman bereits zweimal den Mary Higgins Clark Award. Sie lebt auf Long Island.
Von Carol Goodman erscheinen bei dotbooks die psychologischen Spannungsromane »Die Schatten von Bosco Manor«, »Das dunkle Geheimnis von Penrose« und »Das kalte Herz von Heart Lake«.
***
eBook-Neuausgabe August 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2006 unter dem Originaltitel »The Ghost Orchid« bei Ballantine Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Was niemand wissen darf« im Diana Verlag.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2006 by Carol Goodman
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2007 by Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-274-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Schatten von Bosco Manor« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Carol Goodman
Die Schatten von Bosco Manor
Roman
Aus dem Amerikanischen von Karin Diemerling
dotbooks.
Für Larry und Bob, meine Brüder
Teil 1:Die Grotte
Kapitel eins
Ich bin der Ruhe wegen nach Bosco gekommen.
Dafür ist es berühmt.
Jeden Tag zwischen neun Uhr morgens und fünf Uhr nachmittags herrscht hier gemäß einer hundert Jahre alten Vorschrift, die von einer tot unter den Rosensträuchern liegenden Frau erlassen wurde, Stille. Diese Ruhe wird von vierhundert Morgen Land behütet, über die der Wind durch die Kiefern streicht. Die Stille erstreckt sich bis in den milden, warmen Nachmittag hinein und verschmilzt schließlich mit dem dunkelsten Teil des Parks, wo die Spinnen ihre Netze in ein Labyrinth aus kastenartig beschnittenen Hecken weben. Kurz vor Einbruch der Dämmerung bläst der Wind in die trockenen Rohre des Marmorbrunnens, wirbelt durch die Grotte und kriecht den Hügel hinauf in die weit geöffneten Münder der Satyrn. Er streichelt die Brüste der Sphinxen, windet sich die Brunnenkaskaden hinauf und trifft auf die Terrasse, wo auf der Balustrade Gläser und Kristallkaraffen angerichtet sind.
Sogar noch wenn wir zum Aperitif auf der Terrasse zusammenkommen, gibt es einen Moment – während das Eis sich in den Silberkühlern setzt und wir die Kiefernnadeln von den Rattanstühlen fegen –, in dem die Stille unaufhebbar scheint. In dem es scheint, als würde sie sich ansammeln wie diese langen Nadeln, die auf den Wegen durch das Heckenlabyrinth und den bröckelnden Marmorstufen liegen und die Münder der Satyrn und die Brunnenleitungen verstopfen.
Dann lacht jemand, stößt mit einem Kollegen an und sagt ...
»Prost! Auf Aurora Latham und Bosco.«
»Prost, Prost«, stimmen wir alle in der Abendluft mit ein und lassen das Echo unserer Stimmen die Rasenterrassen hinunterrollen.
»Du meine Güte, ich habe noch nie so viel zustande gebracht wie hier«, sagt Bethesda Graham gedehnt, als wolle sie ausprobieren, ob die Luft einen längeren Satz oder auch zwei tragen kann.
Wir sehen sie alle neiderfüllt an. Vielleicht bin auch nur ich es, die neidisch ist, nicht nur, weil ich heute nichts geschafft habe, sondern weil einfach alles an Bethesda von Selbstvertrauen zeugt. Angefangen bei ihren schlanken, präzisen Biografien und bissigen Literaturkritiken bis hin zu ihrem glänzenden schwarzen Pagenkopf mit dem Pony, der genau über ihren schön geschwungenen Augenbrauen endet – die sie jetzt in Richtung von Nat Loomis hochzieht, wie um auf einen gemeinsamen Scherz anzuspielen – und ihre milchweiße Haut und die feinen Gesichtszüge betont. Sogar Bethesdas geringe Körpergröße – sie kann nicht größer als eins fünfundfünfzig sein – wirkt irgendwie einschüchternd, so als wäre alles Überflüssige auf das Wesentliche reduziert worden. Aber auch das liegt vermutlich nur an meinen Komplexen, weil ich sie mit meinen eins fünfundsiebzig deutlich überrage und meine an sich schon widerspenstigen Haare in der feuchten Luft von Bosco noch schwieriger zu bändigen geworden sind und von den Kupferleitungen rote Reflexe bekommen haben. Neben ihr fühle ich mich wie eine wutentbrannte Walküre.
»Das ist die Magie des Ortes«, sagt der Dichter Zalman Bronsky und schlürft seinen Campari Soda. »Ein Traum. Vollkommenheit.« Er gibt die Worte von sich, als wären es kleine Vögel, die er tagsüber schützend in den hohlen Händen gehalten hat.
»Ich habe heute einen Scheiß zustande gebracht«, beklagt sich der Romanautor Nat Loomis. Der berühmte Romanautor. Ich musste einen Schrei der Überraschung unterdrücken, als ich ihn an meinem ersten Tag in Bosco erkannte – und wer würde dieses markante Profil nicht wiedererkennen: diese Kinnlinie, die nur ein bisschen weniger ausgeprägt ist, als sein Foto auf dem Schutzumschlag vermuten lässt, die charakteristische Brille mit den rechteckigen Gläsern, die hellbraunen Augen, die je nach Stimmung blau oder grün schimmern können (wie er mal in einem Interview verriet), die wirren Haare und das süffisante Lächeln. Ebenso wie der Rest der Welt (zumindest die Welt der Seminare für kreatives Schreiben und des lesewütigen Manhattan) hatte ich vor zehn Jahren seinen ersten Roman gelesen und mich verliebt – in das Buch, seinen jungen, harten, aber verletzlichen Helden und den Autor selbst. Und gemeinsam mit dem Rest dieser kleinen Welt, in der ich während der letzten zehn Jahre gelebt habe, frage ich mich seitdem, wo sein zweiter Roman bleibt. Doch die Tatsache, dass er sich hier aufhält, ist gewiss ein positives Zeichen und bedeutet, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis sein zweites, lang erwartetes Werk das Licht der Welt erblickt.
»Es ist einfach zu ruhig«, sagt Nat und nimmt einen Schluck von dem Single Malt Scotch, den die Direktorin der Künstlerkolonie, Diana Tate, jeden Abend in einer Glaskaraffe kredenzt.
David Fox, ein Landschaftsarchitekt, der, wie es heißt, einen Bericht über die Gartenanlage für die Gesellschaft zur Instandhaltung von Parks schreibt, hebt sein Glas mit Whisky, wobei die goldbraune Flüssigkeit einen letzten rötlichen Lichtstrahl der untergehenden Sonne einfängt, und bringt einen Trinkspruch aus: »Auf Aurora Lathams Sacro Bosco – in der Tat ein heiliger Wald.«
»Ist das die Bedeutung des Namens?«, fragt einer der Maler, die sich gerade zu uns gesellt haben. »Ich fand ihn immer ziemlich komisch für eine Künstlerkolonie. Klingt wie ein Kakaogetränk, das die Hausfrauen in den Fünfzigerjahren gemixt haben.«
Die anderen bildenden Künstler, die nach und nach von ihren weiter abseits gelegenen Ateliers herbeigetrottet kommen, lachen über den Scherz ihres Kollegen und meckern, weil die Schriftsteller wie üblich schon alle Stühle besetzt haben und sie sich mit der kalten Steinbalustrade begnügen müssen. Es ist kaum zu übersehen, dass hier so etwas wie eine Zweiklassengesellschaft existiert. Die Schriftsteller, die im Herrenhaus wohnen, dürfen die Rolle des Landadels spielen. Nat Loomis und Bethesda Graham gelingt es sogar, ihre Partnerlook-Bekleidung aus schwarzen Jeans und weißen T-Shirts wie ein exklusives englisches Jagdkostüm aussehen zu lassen. Selbst der unscheinbare Zalman Bronsky erinnert in seiner zerknitterten Leinenhose und dem aus der Hose hängenden vergilbten Anzughemd ohne Manschettenknöpfe an den exzentrischen Onkel in einem Tschechow-Stück.
»Sie hat das Anwesen nach einem Park namens Sacro Bosco in Bomarzo bei Rom benannt«, erkläre ich und sage zum ersten Mal an diesem Tag etwas. Ich wundere mich, dass meine Stimmbänder noch funktionieren, aber ich muss mich einmischen. Mein Buch – mein erster Roman – ist schließlich hier in Bosco angesiedelt, weshalb ich weiß, dass es nicht nach einem Schlummertrunk benannt wurde. Ich richte meine Bemerkung an David Fox, denn die anderen Schriftsteller, vor allem Bethesda Graham und Nat Loomis, jagen mir nach wie vor Angst ein.
Denken Sie bitte daran, hatte mir die Leiterin der Kolonie am ersten Tag eingeschärft, Nat niemals Nathaniel und Bethesda nicht Beth zu nennen. Ich musste über diese kleinen Eitelkeiten lächeln, bis mir einfiel, dass auch ich beim Erscheinen meiner ersten Kurzgeschichte meinen Vornamen zu Ellis geändert hatte. Wer würde schon eine Autorin mit dem Namen Ellie ernst nehmen?
»Sie besuchte den Park auf einer der Reisen, die sie mit Milo Latham nach Italien machte«, füge ich hinzu. »Dort ließ sie sich dazu inspirieren, ihre eigene Version eines italienischen Renaissancegartens hier am Ufer des Hudson zu erschaffen.«
Wir blicken alle nach Süden, wo der Hudson fließt, der jedoch von den hohen, stämmigen Kiefern verdeckt wird. Was wir stattdessen sehen, sind verfallende Marmorterrassen und zerbrochene Skulpturen. Die Hecken und Sträucher, einst gepflegt und ordentlich beschnitten, sind ihrer geometrischen Anordnung entwachsen und breiten sich nun als wirres Dickicht über den Hügel aus. Die lange Brunnenallee mit ihren Satyrn und Sphinxen, aus deren Mündern und Brüsten früher Wasser quoll, führt zur Skulptur eines sprungbereiten Pferdes, das aussieht, als wolle es sich in das dunkle, überwucherte Buchsbaumlabyrinth am Fuß des Hügels stürzen – Aurora Lathams Giardino segreto. Irgendwo im Zentrum des Labyrinths befindet sich ein weiterer Brunnen, aber die Hecken sind mittlerweile zu hoch, um ihn von hier aus erkennen zu können.
»Eigentlich entspricht die Gestaltung des Parks eher der Villa d’Este in Tivoli«, meint Bethesda Graham und nippt an ihrem Mineralwasser. »Diese Idee mit all den Brunnen und Quellen, deren Wasser den Hügel hinunter in eine Grotte strömt, dann wieder hinaus in den Hauptbrunnen, von dort in den Fluss und schließlich ins Meer ... Aurora schreibt in ihrem italienischen Tagebuch, dass sie einen Garten anlegen will, der der Quell eines Musenbrunnens sein soll, ähnlich der heiligen Quelle auf dem Parnass.« Bethesda spricht über Aurora, als wäre sie eine Zeitgenossin, die gerade eben die Terrasse verlassen hat. Aber natürlich, sie schreibt ja eine Biografie über Aurora Latham, errinnere ich mich. Das macht sie zur Expertin auf diesem Gebiet.
»Der ganze Hügel ist praktisch ein Brunnen«, bemerkt David Fox. »Man könnte sogar sagen, das ganze Anwesen. Mehrere Pumpen förderten früher das Wasser aus der Quelle am Fuß des Hügels hier herauf, um es durch zahllose Rohre wieder hinunterzuleiten. An einem Abend wie diesem hätten wir das Wasser über die Kaskaden rauschen hören so laut wie tausend Stimmen.«
Zalman Bronsky murmelt etwas. Ich beuge mich vor und will ihn bitten, es zu wiederholen, doch dann erklingen die halb gehörten Worte, die immer noch in der fast greifbaren Stille von Bosco schweben, klar und deutlich in meinem Kopf.
»Das plaudernde Wasser überströmt den Hang«, spreche ich nach. »Wie schön. Das ist ein fünffüßiger Jambus, oder?«
Der Dichter sieht mich verblüfft an, aber dann lächelt er, holt ein gefaltetes Blatt Papier aus der Tasche und schreibt die Zeile auf. Als er merkt, dass es inzwischen zu dunkel zum Schreiben ist, steht er auf und geht hinein. Die Maler und Bildhauer sind schon zum Abendessen im Haus, offenbar hungriger durch ihre körperliche Arbeit als wir.
»Was geschah mit den Brunnen?«, frage ich David Fox, doch Bethesda antwortet.
»Die Quelle versiegte«, sagt sie und nimmt noch einen Schluck aus ihrem Glas.
»Kein besonders gutes Omen für Kunstschaffende, die hierhergekommen sind, um am Musenquell zu trinken«, kommentiert Nat, bevor er den Rest von seinem Scotch hinunterkippt. »Deshalb können wir jetzt genauso gut zum Essen reingehen.« Er starrt in sein leeres Glas, als wäre es sein Symbol für die ausgetrockneten Brunnen. Bethesda nimmt ihm den Whisky-Tumbler ab, als er aufsteht, und folgt ihm durch die Terrassentür ins Esszimmer.
David Fox und ich bleiben allein zurück und blicken hinunter in den verwucherten Garten.
»Wenn Sie mit Ihrer Erforschung des Parks fertig sind, wird er dann restauriert?«, erkundige ich mich.
»Vielleicht, falls wir die Gelder von der Gesellschaft zur Instandhaltung bekommen«, antwortet er und leert seinen Scotch bis auf den letzten Tropfen. Ich stehe auf, worauf er eine Hand ausstreckt, um mir mein Weinglas abzunehmen. Als unsere Hände sich berühren, spüre ich ein leichtes Beben, als wären die alten Brunnenrohre unter uns zum Leben erwacht, als würden gleich Wasserfontänen in das verbliebene Leuchten des Sonnenuntergangs schießen. Der Garten schwankt und zittert wie eine Widerspiegelung in einem Teich, und ich sehe in seiner Mitte eine schlanke weiße Gestalt schweben. Ich zwinge mich, die Augen zu schließen und den süßlich-würzigen Duft zu ignorieren, der plötzlich über die Terrasse weht, und zähle bis zehn. Als ich die Augen wieder öffne, liegt der Park ruhig da, und ich sehe, dass die schlanke weiße Gestalt nur eine Statue ist, die rechts unterhalb der Terrasse steht. Der Vanilleduft ist verschwunden.
»Sie haben recht«, sage ich, »als Ruine ist er tatsächlich schöner.«
Er lacht. »Da stimme ich Ihnen zu, aber so etwas habe ich nie gesagt. Die Parkgesellschaft würde mich feuern.«
Beim Essen sitze ich zwischen Zalman Bronsky und Diana Tate. Ich bin froh, nicht David Fox als Tischnachbarn zu haben, weil mir der Zwischenfall auf der Terrasse immer noch peinlich ist. Natürlich hat er nicht gesagt, der Park sei als Ruine schöner. Das habe ich mir eingebildet. Manchmal, wenn ich den ganzen Tag geschrieben und den Stimmen der Figuren in meinem Kopf gelauscht habe, kommt es mir so vor, als könnte ich sie wirklich hören.
Neben Diana Tate zu sitzen, gibt mir allerdings dieses unangenehme Gefühl, das ich an der Uni hatte, wenn sich ein Professor in der Cafeteria neben mir niederließ. Ich fürchte, Diana könnte mich fragen, wie viele Seiten ich schon geschrieben habe, oder einen ausführlichen Entwurf des Romans verlangen (der nicht existiert) oder, was am schlimmsten wäre, wissen wollen, warum ich das verflixte Ding überhaupt schreibe. Ich könnte es nicht erklären, denn was ich gerade zu Papier bringe, ist nicht das Buch, das ich schreiben sollte. In den letzten Jahren habe ich Kurzgeschichten über Bewohner von Manhattan zwischen zwanzig und dreißig geschrieben – schlichte, nüchterne Erzählungen, die von den anderen Teilnehmern meines Schreibworkshops und den Lehrern gelobt wurden und die ich nach und nach in kleinen, aber angesehenen Literaturzeitschriften veröffentlichen konnte. Dann bin ich im vergangenen Jahr zu Weihnachten nach Hause gefahren (beziehungsweise »um die Wintersonnenwende zu begehen«, wie meine Mutter es nennt), wo mir ein Heftchen über den Blackwell-Fall in den Schoß fiel, und zwar buchstäblich. Ich hatte auf dem alten, zerschlissenen Sofa im Wintergarten gelesen, als eines der Bretter in dem Bücherregal über meinem Kopf sich dem Holzschwamm ergab und mit den gesammelten Abhandlungen meiner Mutter über Göttinnenverehrung und Naturheilmittel herunterkrachte. Darunter bemerkte ich ein altes, vergilbtes Dokument mit dem Titel Ein wahrer und umfassender Bericht über die Blackwell-Affäre.
Nachdem ich es gelesen hatte, blieb ich die ganze Nacht auf und schrieb wie im Fieber, und als es Morgen wurde, hatte ich eine Geschichte verfasst, die ich »Trance« nannte. Sie schien von Anfang an ein Eigenleben zu führen, obwohl man nicht sagen kann, dass sie allen gefiel. Die eine Hälfte meiner Mitstudenten fand sie zu spektakulär, und die andere fühlte sich vom Charakter des Mediums abgestoßen. Die Geschichte rief in dem Seminar jedoch mehr Debatten hervor als irgendeine andere. Richard Scully, der Dozent, meinte, die Geschichte habe einen interessanten ironischen Ton, und wenn ich ein paar von den »schwülstigeren« Metaphern wegstreichen würde, könne ich sie bei einem Kurzgeschichtenwettbewerb unter der Rubrik »Andere Zustände« einreichen. »Trance« gewann nicht nur den Wettbewerb – einer der Juroren machte obendrein einen Literaturagenten auf die Geschichte aufmerksam, der Kontakt zu mir aufnahm und mir vorschlug, daraus einen Roman zu machen.
»Hat dieses Medium nicht einen Sommer auf dem Bosco-Anwesen verbracht?«, fragte der Agent. »Bewerben Sie sich doch um ein Aufenthaltsstipendium dort. Das wäre genau der richtige Ort, um den Roman zu schreiben.«
Als ich Richard Scully die Neuigkeit erzählte, riet er mir, mich vor solch melodramatischen Stoffen zu hüten. Sollte ich mich nicht lieber an realistische Themen halten? Trotzdem erklärte er sich bereit, mir eine Empfehlung zu schreiben, ohne die ich niemals in die für ihre strenge Auswahl berühmte Künstlerkolonie eingeladen worden wäre. Zwar weiß ich, dass das Entscheidungskomitee von den Gästen nicht verlangt, sich an einen vorgegebenen Arbeitsplan zu halten, aber ich vermute, es erwartet, am Ende meines Aufenthalts das Buch »über das Medium« zu sehen oder zumindest Teile davon. Und deshalb fürchte ich mich vor dem Moment, in dem Diana Tate mich nach dem Roman fragt.
Zum Glück ist Zalman Bronsky nur allzu gern bereit, über seine Arbeit zu sprechen. Er berichtet Diana und mir, dass der Sonettzyklus, den er über Bosco schreiben will, von einem Buch aus der Renaissance angeregt wurde. Ich muss ihn dreimal nach dem Titel fragen, bis er wieder ein zusammengefaltetes Stück Papier aus der Hosentasche zieht und ihn aufschreibt: Hypnerotomachia Poliphili.
»Man könnte ihn mit Poliphilos Kampf mit der Liebe in einem Traum übersetzen«, sagt er. »Der Held Poliphilo reist träumend mit seiner Geliebten auf die Insel Kythera, wo sie durch einen aufwendig angelegten Garten voller Haine und Grotten, Irrgärten und Brunnen spazieren, bis sie den ... äh ... Höhepunkt ihrer Liebe erreichen.«
»Sie meinen, sie treiben es im Park?«, fragt das junge Mädchen, das Bronsky gegenübersitzt.
»Daria!«, tadelt Diana Tate und schließt kurz die Augen, als wolle sie auf einen Vorrat an Geduld im Umgang mit ihrer Nichte zurückgreifen. Die Direktorin hatte mir am ersten Tag erklärt, dass Daria das College abgebrochen habe und nun als Sekretärin von Bosco einspringe, bis ein Ersatz gefunden worden sei. »Worüber haben wir gesprochen?«
»Was denn, er hat doch mit Leuten angefangen, die im Garten bumsen! Ist ja auch nicht gerade eine neue Idee. Als ich zwölf war, hab ich mal diesen superberühmten Maler beim Vögeln mit einer halb so alten jugoslawischen Dichterin in der Grotte erwischt ...«
»Entschuldigen Sie bitte meine Nichte«, sagt Diana zu uns anderen. »Ihre Vorstellung von einem passenden Tischgespräch ist im Loft meiner Schwester in SoHo geprägt worden.«
Bei der Erwähnung ihrer Mutter wird Daria rot. Sie lässt ihre Gabel auf den Teller fallen, schiebt abrupt den Stuhl zurück – was genug Lärm macht, um die Aufmerksamkeit aller zu erregen – und geht durch die hohe Glastür hinaus auf die Terrasse. Dort zündet sie sich eine Zigarette an und hockt sich so auf die Marmorbalustrade, dass der Mond ihr enges, weißes T-Shirt beleuchtet. Ich bemerke, dass die meisten Männer im Raum unwillkürlich in ihre Richtung blicken, besonders Nat Loomis, der am anderen Ende des Tisches neben Bethesda Graham sitzt.
»Gehen wir doch in die Bibliothek«, höre ich Bethesda in schmeichelndem Ton und mit einem leichten Südstaatenakzent sagen, der mir vorher nicht aufgefallen war, »und suchen uns einen Platz am Kamin, bevor das ungehobelte Gesocks uns zuvorkommt.«
Nat sieht sich am Tisch um, als würde er die anderen Möglichkeiten abwägen. Die Künstler organisieren gerade einen Ausflug zum Tumble Inn, einem Lokal auf halber Strecke zwischen Bosco und der Stadt. Einer von ihnen fragt mich, ob ich mitkommen möchte, aber ich sehe, wie Nat und Bethesda aufstehen und in Richtung Bibliothek schlendern. Vielleicht gehört das zu der stillschweigenden Abgrenzung zwischen bildenden Künstlern und Schriftstellern. Ich möchte nicht auf der falschen Seite der Kluft landen, deshalb lehne ich höflich ab und nehme stattdessen Zalman Bronskys galantes Angebot an, mich in die Bibliothek zu begleiten.
»Es ist komisch mit dieser Zeile, die Sie mir eingegeben haben«, bemerkt er, als wir durch den Hauptflur gehen.
»Eingegeben? Ich habe doch nur etwas wiederholt, das Sie gesagt haben.«
Zalman bleibt an der Tür stehen und sieht mich mit seinen freundlichen braunen Augen an. »Das glaube ich nicht«, widerspricht er.
»Aber so muss es gewesen sein«, beharre ich und versuche, mit einem Lachen darüber hinwegzugehen. »Ich könnte mir keine Zeile im Versmaß ausdenken, selbst wenn mein Leben davon abhinge.« Bevor er dazu kommt, mir weitere Fragen zu stellen, betrete ich die Bibliothek.
Nat und Bethesda haben es sich schon in den Sesseln vorm Kamin bequem gemacht. David Fox steht neben Bethesda, einen Arm auf den breiten Kaminsims aus Eiche gestützt und neben seinem Ellbogen ein weiteres Glas Scotch. Nat mustert den Architekten finster. Vielleicht ist er eifersüchtig oder auch nur sauer, weil David ihm den ganzen Single Malt wegtrinkt.
»Wir haben gerade über Aurora Latham gesprochen«, sagt David und deutet auf das Bild der früheren Hausherrin über dem Kamin. Darauf lehnt sie an einer Marmorsäule, und ihre bloßen Schultern haben fast den gleichen cremeweißen Farbton wie der Marmor. Beides hebt sich vor dem samtig-schwarzen Hintergrund eines nächtlichen Gartens ab, in dem helle Statuen undeutlich in der Ferne schimmern. Ihr Standort ist das obere Ende der Brunnenkaskaden, und sie zeigt mit einer schlanken Hand auf eine Wasserfontäne, die unter dem Huf des Pegasus hervorbricht, als hätte sie dem Wasser gerade zu strömen befohlen. Der Künstler hat sie als eine griechischrömische Göttin dargestellt, die die heilige Quelle der Musen bewacht.
»Das ist das Porträt von Frank Campbell, nicht wahr?«, frage ich. »Er konnte es nicht beenden, weil er während der Arbeit daran an einem Herzinfarkt starb.«
»Sie scheinen recht viel über Aurora Latham zu wissen«, sagt Bethesda. »Schreiben Sie über sie?«
»Ich schreibe einen Roman, der auf bestimmten Ereignissen in ihrem Leben beruht«, antworte ich.
»Eine Historienschmonzette?«, erkundigt sich Bethesda und lächelt dabei Nat Loomis zu. Ich merke, wie ich rot werde, weiß aber nicht, wie ich darauf reagieren soll.
»Es herrscht ja auch wirklich kein Mangel an dramatischen Elementen in Auroras Leben«, fährt Bethesda fort. »Es ist sicher schwer, der Versuchung zu widerstehen, das auszuschlachten.«
»Darum geht es mir nicht ...«
»Ihr beide könntet doch Material austauschen«, schlägt Nat vor. »Bethesda hat nämlich die Unterstützung des Bosco-Komitees und der Latham-Erben zugesagt bekommen.«
»Ja«, sagt Bethesda, die Nat böse anfunkelt, ehe sie sich wieder mir zuwendet. »Sie auch?«
»Na ja, sie wissen, dass ich einen Roman schreibe, der hier in Bosco spielt, im Jahr 1893«, sage ich und schlucke schwer. Zum ersten Mal spreche ich mit Nat und Bethesda über meine Arbeit, und schon greifen sie mich an – zumindest Bethesda. Ob Nat neutral ist oder sie sogar anstachelt, ist mir nicht ganz klar. »Aurora war schließlich berühmt dafür, dass sie Künstler inspirierte, nicht wahr? Wie hat Frank Campbell sie doch gleich genannt?« Ich stocke und versuche, mich an den Ausdruck zu erinnern, den ich irgendwo gelesen habe ... oder doch nicht? Dann fällt er mir wieder ein.
»Meine Wassermuse. So hat er sie genannt.«
Bethesda wird leichenblass, als hätte ich ihr einen Schlag versetzt. »Ich vermute, Sie sind an dem Blackwell-Skandal interessiert«, erwidert sie verärgert. »Darauf stürzen sie sich alle. Auroras Vision als Mäzenin hingegen, dieses Refugium, das sie für die freie künstlerische Arbeit geschaffen hat ...« Bethesda breitet die Arme aus, als wolle sie nicht nur die Bibliothek umfassen, sondern das ganze Haus, den verfallenden Park und die vierhundert Morgen Kiefernwald, die ihn umgeben. »Sie wird immer nur mit diesem gemeinen Verbrechen gegen sie in Verbindung gebracht statt mit all dem Guten, das sie getan hat.«
»Also, da muss ich widersprechen«, sagt David Fox. »Ich will lediglich herausfinden, ob sie ihre Hecken nach dem Vorbild von Francesco Colonna oder Donato Bramante angepflanzt hat.« Er will Bethesda ablenken, um mich vor ihrer Tirade zu retten, merke ich. »Was ist das überhaupt für eine Geschichte mit diesem Blackwell?«
»Es ist eine Frau, Corinth Blackwell«, erkläre ich, ermutigt von seiner Aufmerksamkeit. Davon wird zwar Bethesdas Kritik nicht wettgemacht, aber sie ist zumindest tröstlich. »Milo Latham hatte sie im Sommer 1893 auf Auroras Bitte nach Bosco eingeladen, weil sie Kontakt zu den drei Kindern der Lathams aufnehmen sollte, die im Jahr zuvor während einer Diphtherie-Epidemie gestorben waren. Sie war ein Medium.«
»Aha, eine Spiritistin«, sagt Bronsky, »so wie Madame Blavatsky. Sie wissen sicher, dass Yeats an ihren Séancen teilgenommen hat ...«
»Corinth Blackwell war ein Scharlatan und eine Betrügerin«, sagt Bethesda. »Sie und ihr Komplize, ein Mann namens Tom Quinn, der sich in jenem Sommer als Sekretär von Violet Ramsdale auf dem Anwesen eingeschlichen hatte, einer Verfasserin abscheulicher Herzschmerzromane, wie sie für das neunzehnte Jahrhundert typisch waren« – hier legt Bethesda eine Pause ein und sieht mich an, um deutlich zu machen, zu welcher literarischen Tradition ich gehöre – »entführten die kleine Alice Latham, das einzige Kind der Familie, das die Diphtherie überlebt hatte.«
»Es ist nie bewiesen worden, dass Corinth Blackwell dafür verantwortlich war«, betone ich. »Sie und Quinn verschwanden beide damals. Manche glauben, dass Quinn der Entführer war und Corinth die Schuld anhängte.«
»Ach, das ist also Ihr Ansatz«, sagt Bethesda mit einem spöttischen Lächeln zu Nat, der es jedoch nicht erwidert. »Das Medium als Heldin. Lassen Sie mich raten – Sie nennen Ihren Roman Die Spur des Kidnappers.«
Ich will gerade entgegnen, dass es bereits einen Roman von Nora Roberts mit diesem Titel gibt, doch damit würde ich zugeben, Nora Roberts zu lesen oder eine Internetrecherche nach dem Titel durchgeführt zu haben, denn ich hatte wirklich daran gedacht, ihn zu verwenden. Dann aber mischt sich Nat ein.
»Hey ... Die Wassermuse – ist das nicht der Titel, den du deinem Buch geben willst, Bethesda?«
Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch bleicher werden könnte, doch Bethesda sieht Nat mit einem Gesicht an, aus dem jegliche Farbe gewichen ist, weshalb sie für einen Augenblick eher den steinkalten Statuen draußen im Park ähnelt als einer lebendigen Person. Ohne ein weiteres Wort steht sie auf und verlässt das Zimmer.
»Was hat sie denn?«, fragt David. »Warum war sie so giftig zu Ellis?« Er nähert sich der Scotchkaraffe, aber Nat erreicht sie vor ihm und gießt den letzten Fingerbreit in sein Glas.
»Sie haben ihren Titel geklaut«, sagt Nat und hebt sein Glas in meine Richtung, wie um mir für den gelungenen Streich zuzuprosten. »Die Wassermuse – sie hat diesen Ausdruck im letzten Sommer in einem Brief von Frank Campbell an Aurora gefunden und ihn seitdem gehütet wie einen Schatz. Da Campbell den Brief an seinem Todestag geschrieben hat, dachte Bethesda, dass es sich um die einzige Stelle handelt, an der die Bezeichnung auftaucht. Wo um alles in der Welt sind Sie darauf gestoßen?«
»Ich weiß es nicht. Ich muss sie irgendwo gelesen haben«, sage ich, obwohl ich nicht die geringste Ahnung habe, wo sie mir begegnet sein könnte.
Später liege ich wach in meinem Zimmer und verfluche mich dafür, Bethesda Grahams Zorn herausgefordert zu haben. Sie ist immerhin eine renommierte Kritikerin und berühmt-berüchtigt für ihre gnadenlosen Verrisse von Veröffentlichungen hoffnungsvoller Nachwuchsautoren. Ich hätte wissen sollen, dass die Bezeichnung Wassermuse von ihr kam. Nachdem ich meine Notizen noch einmal durchgegangen bin, steht fest, dass ich sie noch nie zuvor gelesen oder gehört habe. Nein, ich habe den Ausdruck zum ersten Mal heute Abend in der Bibliothek aufgeschnappt, als hätte ihn mir jemand ins Ohr geflüstert. Auf die gleiche Weise, wie ich die erste Zeile von Zalmans Gedicht gehört habe und David Fox’ geheimen Wunsch, den Park in seinem jetzigen Zustand zu belassen. So wie ich schon mein ganzes Leben lang Stimmen höre, ohne dass jemand etwas zu mir gesagt hätte. Gewiss reden auch andere Schriftsteller davon, ihre Figuren sprechen zu hören und ihnen eine Stimme zu geben, aber mir kommt langsam der Verdacht, dass es sich nicht um die gleiche Art von Stimmen handelt, die ich wahrnehme.
Wie zum Spott über meine Niedergeschlagenheit dringt plötzlich das Lachen eines Mädchens vom Garten zu mir herauf. Ich schlüpfe aus dem Bett und ziehe mein T-Shirt herunter, als ich über den kalten Fußboden zum halb geöffneten Fenster gehe. Im ersten Moment blendet mich das Mondlicht auf all dem weißen Marmor, und ich erkenne nur die Terrasse, die das Erdgeschoss umschließt. Die Wege, die in den Park und den Hügel hinunterführen, die zerbröckelnden Kaskadentreppen und die Statuen auf den Stufen verschwimmen in den Schatten der Zypressen, der dicken überwachsenen Buchsbaumhecken und in der tieferen Schwärze des Kiefernwaldes. Als ich in die Dunkelheit spähe, um festzustellen, woher das Lachen kam, streicht ein Windhauch durch die Baumwipfel und bringt neben dem Geruch von Pinien und Kupfer auch diesen süßen Duft nach Vanille und Nelken mit sich, den ich schon am frühen Abend auf der Terrasse bemerkt habe. Etwas Weißes bewegt sich am westlichen Terrassenrand, und ich sehe, dass es dieselbe Statue ist, die mir schon am Abend aufgefallen ist, nur hat ihr jemand offenbar einen Schal um den Hals gebunden, denn der Stoff flattert im leichten Wind. Gott sei Dank, denke ich erleichtert, denn das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, sind irgendwelche Visionen zusätzlich zu meinen Stimmen. Ich will mich gerade vom Fenster wegdrehen, als ich eine weiße Hand nach dem wehenden Schal greifen und ihn um die Gestalt legen sehe. Ein Geschmack nach Eisen sammelt sich in meinem Mund wie Blut, und ich husche zurück ins Bett, bevor ich noch mehr sehen könnte.
Ich ziehe die Decke über meinen Kopf, kann aber immer noch den Wind hören, der den Hügel hinabbläst und in der Grotte am Hang zur Ruhe kommt.
Morgen wird er sich jedoch wieder erheben und neue Stimmen herbeitragen, und noch nicht einmal die legendäre Stille von Bosco wird diese Stimmen in meinem Kopf zum Schweigen bringen können.
Kapitel zwei
»Es ist ein langer Weg nach oben, Miss. Ich habe Anweisung, Sie bis zur Haustür zu fahren.«
»Ich möchte zuerst den Brunnen sehen«, sagt Corinth bestimmt zu dem Kutscher. »Für ihn ist die Villa doch berühmt, oder?«
Ein Laut kommt aus der Kehle des Kutschers, doch ob es ein Husten oder ein Lachen ist, könnte Corinth nicht sagen. Ein breitkrempiger Hut beschattet sein Gesicht, sodass sie noch nichts von seinen Zügen erkennen konnte, seit er sie vom Bahnhof abgeholt hat. »Unter anderem«, sagt er und knallt mit der Peitsche über die schweißnassen Rücken der Pferde. Dann lässt er Corinth am Eingang des Parks zurück.
Der Brunnen befindet sich hinter einer dichten Hecke. Corinth hört, wie er ihr zumurmelt und sie durch den Torbogen, der in den Buchsbaum geschnitten ist, lockt. Dieses Geräusch war es, das sie dazu gebracht hat, den Kutscher anhalten zu lassen, während ihr Herz gegen ihr eng geschnürtes Mieder schlug, denn es ist das Geräusch, das sie schon seit Wochen hört, seit sie sich bereit erklärt hat herzukommen – eine Stimme, die neben dem Geplapper in den Salons, den Geschäften und sogar neben dem Geschrei auf den Straßen der Stadt noch wahrzunehmen war, die ihr hartnäckig ins Ohr flüsterte und sie warnte, nicht zu fahren.
Doch wenn sie auf all die Stimmen hören würde, die ihr etwas einflüstern, würde sie morgens nicht mehr aus dem Bett kommen. Eine andere Stimme nämlich – dieselbe, die ständig das Geld in ihrem Portemonnaie zählt, die Rechnungen addiert, den Tee und den Zucker in den Säcken abwiegt und die Entfernung von ihrem gemütlichen, gut geheizten Hotelzimmer zur Straße misst – sagte ihr, dass es um zu viel Geld ginge, um abzulehnen. Außerdem, wann hätte sie je zu einer angebotenen Geldsumme Nein gesagt?
Es war ihr gelungen, den Murmler, wie sie diese neue Stimme getauft hatte, zu ignorieren, bis sie ihn eben am Tor von Bosco erneut gehört hatte. Diesmal erklang die Stimme zweifelsfrei außerhalb ihres Kopfes.
»Was ist das?«, hatte sie den Kutscher gefragt.
Er antwortete, es sei der Brunnen, worauf ihr einfiel, dass es sich laut Milo Latham um die berühmteste Attraktion des Besitzes handelte.
Es ist nur Wasser, dachte sie, diese Stimme, die mir seit Wochen ins Ohr raunt und meinen Schlaf stört. Es ist nur Wasser. Sie war so erleichtert, dass sie beschloss, auszusteigen und sich die Ursache des Geräuschs mit eigenen Augen anzusehen.
Doch als sie nun vor der Heckenmauer steht und dem Brunnen lauscht, merkt sie auf einmal, dass sie Angst hat. Sie, die berühmte Corinth Blackwell, die Geister aus dem Schlund der Hölle herbeigerufen hat zur Unterhaltung und Belehrung gekrönter Häupter in Europa und angesehener Persönlichkeiten von Verstand und Urteilskraft überall auf der Welt! Angst vor einem bisschen Wasser!
Gut, aber nicht für lange. Corinth tritt durch den Torbogen und sieht sich einer zehn Fuß hohen Wand aus Grün gegenüber. Sie ist in ein Labyrinth geraten.
Meine Frau Aurora hat Freude an Rätseln, hatte Milo Latham gesagt, als er ihr vorschlug, den Sommer in Bosco zu verbringen. Ich bemühe mich, ihr möglichst viel Unterhaltung zu bieten, aber meine Möglichkeiten sind begrenzt. Sie hat ausdrücklich um dein Kommen gebeten.
Ich soll also eine Art Unterhaltung sein?
Betrachte dich eher als Ablenkung.
Sie schließt die Augen, horcht auf das Wasser und wendet sich nach links.
Im vergangenen Sommer, in der Villa eines Prinzen in Viterbo, hatten die Gäste sich eine amüsante Prüfung für sie ausgedacht – einen Spaß für einen Sommerabend. Sie verbanden ihr die Augen und schickten sie in das dortige Heckenlabyrinth. Sie hätte sie darauf hinweisen können, dass ihre Fähigkeiten als Medium wenig mit dem Bewältigen eines Irrgartens zu tun hatten, aber dann wäre sie eine Spielverderberin gewesen. Also hatte sie einen kurzen Plausch mit dem Obergärtner gehalten, bei dem mehrere Münzen von dem kleinen Taschenbeutel in ihrem Ärmel in seinen groben Handschuh wanderten, und erfahren, dass die meisten Labyrinthe ein paar einfachen Regeln folgen.
Innerhalb von fünf Minuten hat sie sich in diesem zurechtgefunden und steht nun im Herzen des Labyrinths: einem ebenen Rosengarten, dessen Sträucher in voller, purpurroter Blüte stehen und in dessen Mitte sich ein runder Springbrunnen befindet.
Das ist es also, was mir wochenlang ins Ohr geraunt hat. Nach den Brunnen, die sie in Europa gesehen hat – Berninis muskulöse Flussgötter auf der Piazza Navona, die Allee der hundert Brunnen im Park der Villa d’Este in Tivoli, den Sintflutbrunnen der Villa Lante –, hatte sie etwas Imposanteres erwartet. Schließlich hat Aurora Latham diese Orte auch alle besucht und verfügt über genug Geld, um sich ein paar echte italienische Brunnen zu leisten, denkt Corinth. Man sagt, sie habe sogar Bildhauer und Landschaftsarchitekten »eingekauft«. Einer von ihnen, ein Meister des Brunnenbaus und Spezialist für Wasserspiele, soll sich sogar gerade in Bosco aufhalten.
Corinth hatte mehr erwartet als diese einsame Figur eines Mädchens, das inmitten des schalenförmigen Brunnenbeckens kniet und mit seinen hohlen Händen die Gischt eines einzelnen Wasserstrahls auffängt. Das Gesicht der Figur wird halb von ihrem herabhängenden Haar verborgen, sodass Corinth um den Brunnen herumgeht und erschrickt, als sie dem Blick des Mädchens begegnet. Unter einem gemusterten Stirnband sieht es zum Betrachter auf wie ein wildes Tier, das gerade gefangen wurde. Seine Kleidung, die auf den ersten Blick ein kurzes griechisches Gewand zu sein schien, besteht aus angedeuteten, in Stein gemeißelten Tierhäuten, die mit Fransen und Perlen versehen sind und eng an seinem Körper anliegen. Das Mädchen erinnert Corinth an eine Statue, die sie im vergangenen Herbst im Metropolitan Museum of Art gesehen hat, jedoch nicht an die echten Indianer, die sie von der Siedlung im Sacandaga-Tal kennt.
Beeindruckender ist da schon die Skulptur, die in einer Buchsbaumnische hinter dem Brunnen steht und einen Jüngling von königlicher Haltung und leicht femininen Gesichtszügen darstellt, der eine Art Toga mit Fransen trägt. In den Sockel ist der Name Jacynta eingemeißelt.
Meine Frau denkt sich Geschichten für die Kinder aus, hatte Milo Latham gesagt, in denen es um einen mythischen Helden namens Jacynta und ein schönes Indianermädchen namens Ne’Moss-i-Ne geht.
Corinth sucht den Marmorrand des Brunnens nach dem Namen des Mädchens ab – vergeblich. Dafür fallen ihr die niedrigen Büsche mit den dunklen Blättern auf, die um das Brunnenbecken herumwachsen. Sie pflückt ein Blatt ab, riecht daran, gräbt dann in der lockeren Erde, bis sie die Wurzeln freigelegt hat, und schiebt ein Stück davon in den Ärmel ihres Kleides. Dabei trägt sie immer noch ihre Handschuhe, die aus so feinem, weichem Leder sind, dass ihre Finger darin genauso beweglich sind, als hätte sie keine Handschuhe an. Als sie fertig ist, sieht sie sich hastig im Garten um, aber die einzigen Augen, die auf sie gerichtet sind, sind die blinden Steinaugen des Indianermädchens im Brunnen, das, wie sie jetzt erst bemerkt, an die grobe Fußplatte, auf der es kniet, gefesselt ist. Die Riemen sind derart kunstvoll gemeißelt, dass sie wie Leder aussehen und in die weichen, weißen Brüste des Mädchens zu schneiden scheinen, eine Wirkung, die so realistisch ist, dass Corinth das Gefühl hat, als würde ihr etwas die Brust einschnüren. Sie wendet sich mit dem Gedanken von der Skulptur ab, dass die Person, die diese in Marmor gehauenen Fesseln in Auftrag gegeben hat, mehr Befriedigung aus der Fesselung als aus der Befreiung zog. Auch wird sie beim Verlassen des Rosengartens den Eindruck nicht los, geradewegs in ein Netz zu laufen, das aus noch stärkeren Schnüren geknüpft ist als die Lederriemen, die die arme Ne’Moss-i-Ne festbinden.
Als sie durch die bogenförmige Öffnung in der Hecke tritt, die aus dem Irrgarten hinaus auf den Weg zum Haus führt, spürt sie, wie etwas sie streift und festhält. Diese Fäden sind dünner und durchsichtiger als die Lederbänder um das Indianermädchen, aber nicht weniger fest. Sogar durch den dicken Sergestoff ihres hochgeschlossenen Kleides fühlt sie, wie sie sich über ihre Brust legen und um ihren linken Arm wickeln. Ein weiterer Faden berührt ihre Wange, und einer hängt sich an ihren Mund.
Als würde man durch einen Geist gehen.
Corinth bleibt abrupt stehen und verfolgt den hauchdünnen Spinnfaden zurück zu der Stelle, wo die Spinne ein Netz tief in die Zweige des Buchsbaums geknüpft hat. Dann schaut sie sich um, ob sie vom Haus aus schon gesehen werden kann. Direkt vor ihr stürzt ein Wasserfall in ein ovales Becken. Ein geflügeltes Pferd erhebt sich über den Kaskaden, den einen Huf wie zum Abstoß erhoben, die Flügel zum Flug ausgebreitet. Zu beiden Seiten des Brunnens ruhen zwei männliche Akte, deren kräftige, ausgestreckte Gliedmaßen die geschwungene Form der Marmortreppe aufnehmen, die zur nächsten Terrasse hinaufführt. Corinth kann hinter den Flügeln des Pferdes den Weg erkennen, aber nicht die Villa, weshalb sie davon ausgeht, dass auch sie nicht gesehen werden kann. Die einzigen Gestalten auf dem Parkweg über dem Wasserfall sind die weißen Statuen, die die Marmorterrassen bewachen.
Trotzdem fühlt sie sich beobachtet. Vielleicht liegt es auch an den Statuen der Flussgötter oder der Satyrn, die entlang der Terrassen aufgestellt sind und Wasser aus ihren weit geöffneten Mündern speien, oder auch an der Spinne, die sich tiefer in ihren seidigen Tunnel zurückzieht, als Corinth dichter an die Hecke herantritt. Aber es ist ein anderes Gefühl; sie kennt es, sie hat es schon früher gehabt.
Sie sieht sich noch einmal um, wie um sicherzugehen, dass die hockende Indianerin sich nicht von ihren Fesseln befreit hat und dem Brunnen entsprungen ist, und bohrt dann einen behandschuhten Finger in das Spinnennetz hinein. Vorsichtig stopft sie die Spinnfäden ebenfalls in ihren Ärmel und steigt anschließend, ohne sich noch einmal umzudrehen, die Stufen über den liegenden Flussgöttern hinauf und schlägt den Weg zum Haus ein.
Es ist ein langer, steiler Aufstieg über drei Terrassen, ohne die Hauptterrasse, die das Haus umgibt, mitzuzählen. Zuerst lässt Corinth sich Zeit. Sie bemerkt die hufeisenförmigen Steine um den Brunnen mit dem geflügelten Pferd herum und erkennt sie als Giochi d’acqua, scherzhafte Wasserspiele, die sie achtsam umgeht. Sie hat keine Zeit für solche Scherze und will sich nicht völlig durchnässt oben im Haus präsentieren. Interessiert betrachtet sie die Skulpturen. Auf jeder Terrasse stehen drei weibliche Statuen in antiken Gewändern, die die neun Musen darstellen. Eine trägt einen Sextanten in der Hand, eine andere hält eine lächelnde Maske vor ihr weinendes Gesicht. Wieder eine andere wird von einem Pfau und einer Schildkröte flankiert. Mehrere sind mit Musikinstrumenten ausgestattet. Mitten im Weg fließt ein Wasserlauf durch eine marmorne Rinne ähnlich der Kaskade des Palazzo Farnese, doch statt Delfinen säumen hier springende Forellen den Rand – eines von mehreren Zugeständnissen an die einheimische Umgebung. Biber und Bärenjunge aus Stein tummeln sich zwischen den lüsternen Satyrn und vollbusigen Sphinxen. Ein Puma kauert unter einer Kiefer, und der ganze bewaldete Teil des Hangs ist mit derartigen Tierfiguren bevölkert, die alle mit derselben Stimme sprechen, nämlich dem Rauschen des Wassers, das in hundert Bächen und Rinnsalen den Hügel hinunterströmt. Eine Wirkung, die Corinth allmählich ermüdend findet, als sie die zweite Terrasse hinaufsteigt. Sie biegt in den Waldpfad ein und überlegt, sich für einen Moment auf der kleinen Bank in dem Stechpalmenhain am Ende des Weges auszuruhen, hält aber inne, als sie sieht, dass dort bereits jemand sitzt. Mehr verärgert als erleichtert stellt sie fest, dass es nur eine weitere Skulptur ist, eine weitere Muse, wie sie aus dem kastenförmigen Instrument in ihrem Schoß schließt. Sie geht auf den Hauptweg zurück und bleibt einen Augenblick stehen, um zum Haus hinaufzuschauen, das jetzt in Sicht ist.
Milo Latham hatte gesagt, dass er seiner Frau zwar freie Hand bei der Gestaltung des Parks lasse, er aber die Kontrolle über die Architektur des Hauses behalten habe. Die Verschiedenheit ihrer Vorlieben lässt sich deutlich in dem starken Gegensatz zwischen Haus und Garten ablesen. Während Aurora Italien liebt, bewundert Milo offensichtlich die Schweiz und England. Das stattliche Herrenhaus, das sich über dem Park erhebt, ist denn auch eine eklektische Mischung aus Tudorfachwerk und Schweizer Chalet, wobei die groben Lärchenbalken von Milo Lathams Zugehörigkeit zu einer Holzdynastie zeugen. Die steinerne Balustrade, die die Hauptterrasse einfasst, wirkt wie die Grenze zwischen den beiden Bereichen und wird obendrein von einem matronenhaften Grenzposten bewacht. Zuerst glaubt Corinth, sich erneut einer Statue gegenüberzusehen, denn die Gestalt hält sich sehr steif, und ihre grauen Haare haben die Farbe von Stein, doch dann löst sie die verschränkten Arme, und ihre Augen werden groß, als ihr Blick auf Corinth fällt.
Corinth ist ebenfalls überrascht, aber bevor sie etwas sagen kann, dreht die Frau sich um – oder kreist vielmehr um die eigene Achse wie einer dieser Automaten zum Aufziehen, die sie in deutschen Städten gesehen hat – und geht ihr durch eine offene Flügeltür aus Glas voraus.
Es dauert eine Weile, bis ihre Augen sich nach dem blendend hellen Sonnenlicht auf der Marmorterrasse an das dämmerige Zimmer gewöhnt haben. Am anderen Ende des langen, schmalen Raums kann sie undeutlich jemanden auf einem Stuhl am Kamin ausmachen. Corinth wundert sich, dass an einem warmen Tag wie diesem ein Feuer darin brennt, doch als sie näher kommt, sieht sie, dass sie sich getäuscht hat. Was sie für Flammen hielt, ist das offene, fließende Haar eines kleinen Mädchens – sieben oder acht Jahre alt, schätzt sie –, das im Schneidersitz auf einem Läufer vor dem kalten Kamin sitzt und sich über einen Zeichenblock beugt, sodass die langen Strähnen das Gesicht verdecken. Als Corinth einen weiteren Schritt nach vorn macht, sieht das Mädchen unter seinem Haarvorhang auf, und sie ist verblüfft, weil die Kleine ihr irgendwie bekannt vorkommt, aber dann merkt sie, dass ihre Kopfhaltung einfach nur der des Indianermädchens im Brunnen gleicht. Sie hat sogar die gleichen schräg geschnittenen Augen und den gleichen listigen Blick.
»Danke, das ist alles, Norris«, sagt die Frau auf dem Stuhl. Corinth wartet auf das Geräusch sich entfernender Schritte, hört aber nichts. Dass die Haushälterin gegangen ist, erkennt sie nur am Verstummen des Brunnengurgelns, nachdem die Glastür geschlossen ist.
»Kommen Sie, setzen Sie sich zu mir«, fordert die Frau am Kamin sie auf und weist auf eine Ottomane zu ihren Füßen, »damit ich Sie besser sehen kann. Ich bin gespannt, ob die Beschreibungen von Ihnen zutreffen.«
Corinth rafft ihre Röcke, als sie an dem hockenden Kind vorbeikommt, das keine Anstalten macht, beiseitezurücken, und setzt sich auf die Ottomane, wo sie in die blassblauen Augen der Hausherrin blickt. Aurora Latham betrachtet sie eingehend und in aller Ruhe, und obwohl Corinth weiß, dass es höflicher wäre, den Blick abzuwenden, nutzt sie die Gelegenheit, um ihrerseits ihre Gastgeberin zu mustern. Deren Augen fallen ihr als Erstes auf. Sie sind von einem derart hellen Blau, dass sie weniger an die Farbe des Himmels als an eine Spiegelung des Himmels in einer Wasseroberfläche erinnern – weniger eine Farbe als der Geist einer Farbe. Ihre Haare haben eine hellere Schattierung als der rotbraune Schopf des Kindes, und ihre Haut schimmert wie Alabaster.
Man erzählt sich in der Stadt, dass Aurora Latham krank sei und der Tod ihrer drei Kinder im vergangenen Jahr ihrer schon vorher schwachen Konstitution den letzten Schlag versetzt habe. Doch obwohl sie sehr blass und mager ist, sieht sie nicht krank aus. Sie sieht aus wie eine Frau, die von etwas verfolgt wird, denkt Corinth.
»Sie ist viel hübscher als die Letzte«, sagt das kleine Mädchen. »Kann sie auch Geräusche mit ihren Knien und Zehen machen wie ...«
»Still, Alice. Geh und setz dich ein Weilchen zu Mrs. Ramsdale hinüber.«
Corinth dreht sich um und entdeckt in einem schwach beleuchteten Alkoven eine Frau in einem amethystfarbenen Seidenkleid, die an einem Sekretär sitzt und schreibt. Vielmehr hält sie den Füller über ein Blatt Papier, neigt dabei den Kopf etwas schräg, um ihr feines klassisches Profil zur Geltung zu bringen, und senkt bescheiden die Augen, sodass die dichten schwarzen Wimpern einen Schatten auf ihre hellen Wangen werfen. Eine Pose, die eine gesellschaftlich hochgestellte Frau bei ihrer literarischen Tätigkeit zeigen soll, denn Corinth merkt genau, dass die andere sich ihrer Anwesenheit sehr bewusst ist, während sie selbst sie bis jetzt nicht bemerkt hatte. Das muss an all diesen Statuen im Garten liegen, an denen sie vorbeigekommen ist; sie haben ihren Sinn für Wirkliches und Unwirkliches verwirrt. Sie wird aufmerksamer sein müssen.
»Aber sie ist wirklich hübscher«, beharrt Alice schmollend, während sie ihre Stifte und den Zeichenblock einsammelt.
Aurora Latham wendet sich wieder Corinth zu. »Ja, das kommt hin«, sagt sie gedehnt, »nur Ihr Haar wurde mir als kastanienbraun beschrieben, obwohl es eigentlich eher mahagonifarben ist.« Aurora kneift die Augen zusammen, wodurch die Haut darunter, die blauer ist als die Iris, kleine Fältchen bekommt. Als hätte sie einen Satz Esszimmerstühle bestellt und müsste nun feststellen, dass sie aus dem falschen Holz gezimmert sind. »Aber vielleicht haben die Leute, die Sie beschrieben haben, Sie nicht bei ausreichend Licht gesehen.«
Corinth reagiert mit einem Lächeln, das, wie sie hofft, kühl und gelassen wirkt, und sagt: »Grelles Licht ist nicht förderlich für den Kontakt mit der Geisterwelt. Besonders von elektrischem Licht nimmt man an, dass es die atmosphärischen Strömungen stört, auf denen die Geister der Toten reisen.«
»Sie werden also eine Séance abhalten? Und James und Cynthia und Tam zurückbringen?«, fragt das Mädchen.
»Alice, habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich zu Mrs. Ramsdale setzen?«
»Kann ich ihr bitte erst noch mein Bild zeigen?«
»Na schön«, sagt Aurora und sieht Corinth mit ihren durchsichtigen Augen an. »Sie hat große Fortschritte gemacht unter Mr. Campbells Anleitung. Würden Sie ihr den Gefallen tun?«
Corinth lächelt wortlos, weil die Frage natürlich rhetorisch ist. Es steht ihr nicht zu, der Tochter ihrer Gastgeberin etwas zu gewähren oder zu versagen. Alice steht auf und hält ihr den Block hin.
Die Bleistiftzeichnung ist erstaunlich gut. Ein schneidig aussehender junger Mann in Wildlederkleidung mit Fransen kämpft gegen irgendeine Bestie mit großen Flügeln, während ein verängstigt aussehendes Mädchen, das an einen Baum gefesselt ist, zusieht. Corinth erkennt sogleich die Indianerin aus dem Brunnen im Labyrinth, die auch hier ein eng anliegendes Kleid aus Tierhäuten trägt, von dem ein Ärmel zerrissen ist und eine runde Schulter und den nackten Busen freigibt. Sie blickt von dem Bild auf und versucht, das Alter der Kleinen neu einzuschätzen. Aufgrund ihrer geringen Größe hat sie sie für jünger gehalten, denn sie ist bestimmt eher neun oder zehn als sieben.
»Wird der tapfere junge Krieger das Fräulein retten?«, fragt Corinth.
»Sie ist kein Fräulein, sie ist nur eine stinkende Wilde ...«
»Das reicht, Alice. Lass mich jetzt mit Miss Blackwell allein. Bitte entschuldigen Sie meine Tochter«, sagt Mrs. Latham, als Alice sich mit einem übertriebenen Seufzer in den dunklen Alkoven trollt und sich in eine schmale Nische des bis zur Decke reichenden Bücherregals kauert. »Seit ihre Geschwister uns verlassen haben, ist sie der Liebling meines Mannes, der einen großen Teil seiner Jugend in den nördlichen Wäldern des Staates New York verbracht hat – eine prachtvolle Wildnis, der Mr. Latham die Grundlage seines Wohlstands verdankt, aber leider keine Umgebung, die einer kultivierten Lebensweise zuträglich wäre.«
Aurora hebt eine lange, blasse Hand und deutete damit über ihre Schulter auf das Land im Norden des Anwesens, das ausgedehnte Wald- und Seengebiet der Adirondacks, das sich bis zur kanadischen Grenze erstreckt. Das Haus kehrt den Wäldern den Rücken zu, während die terrassierten Gärten in südlicher Richtung zum Hudson River abfallen und sich damit der Stadt und der Zivilisation zuneigen. Trotzdem spürt man noch die tiefen Schatten dieses Waldlandes, das die sonnenbeschienene Terrasse bedrängt, und obwohl Corinth mit dem Rücken zur Verandatür sitzt, überkommt sie plötzlich eine ungebetene Vision von den Gärten in verfallenem Zustand: die Statuen zerstört, die Marmorterrassen zerbröckelt, die Hecken des Labyrinths befreit aus ihrer ordentlich beschnittenen Form und in gewaltige zottelige Bestien verwandelt wie die auf Alices Zeichnung.
Sie holt tief Luft, vertreibt die Vision und bemerkt höflich: »Ja, ich habe gehört, dass Mr. Latham im Holzgeschäft tätig ist.«
»Damit hat er sein Vermögen gemacht, mit der Holzfällerei und den Handschuhfabriken westlich von hier in Fulton County. Auch mit einigen anderen Investitionen, von denen ich noch nicht einmal annähernd etwas verstehe. Seine Interessen sind ... vielfältig. Leider zwingen ihn seine Geschäfte, immer mehr Zeit in der Stadt zu verbringen, aber er nimmt nach wie vor gern am großen Flößen im Frühjahr teil und sieht zu, wie seine Baumstämme unten in Glen Falls ankommen. Oft hat er die Jungen zu Jagdausflügen mit hinauf in seine Hütte genommen ...«
»Wird er denn in diesem Sommer an der Hausgesellschaft teilnehmen?«, erkundigt sich Corinth, auch wenn sie weiß, dass es riskant ist, eine derart direkte Frage zu stellen. Auroras Beschreibung von Lathams Holzgeschäften hat ihre Ahnung von einem verwüsteten Garten noch verstärkt, nur dass sie jetzt einen von Baumstämmen verstopften Fluss sieht, der von Norden über den Hügelkamm bricht und die lächelnden Nymphen und gierigen Satyrn mit sich reißt. »Ich frage, weil ich gern wissen möchte, wer bei unserem Zirkel dabei sein wird.«
»Ich fürchte, mein Mann glaubt nicht an Spiritismus, Miss Blackwell. Er war nur mir zuliebe bereit, Sie zu uns einzuladen.« Aurora senkt kurz die Augen, als wolle sie kein Aufhebens um einen so fürsorglichen Ehemann machen. »Er hat erklärt, nicht an Ihren Séancen teilnehmen zu wollen, aber er wird uns heute beim Abendessen Gesellschaft leisten. Vermutlich ist er in der Stadt aufgehalten worden ... ah ...«
Aurora hebt den Kopf, gerade als Corinth hört, wie hinter ihr die Tür geöffnet wird. Ein nach Kiefern und Sägemehl riechender Windstoß fährt über ihren Nacken und kühlt die verschwitzten Stellen, die immer noch unter der Knopfleiste am Rücken ihres Kleides trocknen. Sie spürt den Druck der Beinknöpfe, die wie Finger auf ihrer Wirbelsäule liegen, und bringt es zuerst nicht fertig, sich umzudrehen. Was wäre, wenn die Vision von dem zerstörten Garten, dem gebrochenen Damm und der Lawine von splitterndem Holz sich nicht nur in ihrem Kopf abspielte?
Doch als sie dem Blick ihrer Gastgeberin folgt, sieht sie, dass der Park hinter der dunklen Silhouette in der Tür ruhig und friedlich im abnehmenden Licht des Sommernachmittags liegt. Corinth setzt einen angemessenen Gesichtsausdruck für die Begegnung mit ihrem Gastgeber auf, aber als der Mann ins Zimmer tritt, merkt sie, dass er zu jung und zu schlank für Milo Latham ist. Es dauert nur einen kurzen Augenblick, dann erkennt sie ihn.
Kapitel drei
Corinth sah auf und erkannte in der Silhouette, die sich vor der Verandatür abzeichnete, überrascht ihren alten Freund Tom Quinn.
Zum dritten Mal lese ich mir den Satz laut vor, dann schiebe ich meinen Stuhl zurück, lege die Füße auf den Schreibtisch und starre zum Fenster hinaus. An dieser Stelle bleibe ich bei jedem Entwurf hängen. Das Problem ist, dass ich mich nicht entscheiden kann, ob Corinth Blackwell tatsächlich erstaunt war, Tom Quinn in Bosco zu sehen, oder ob sie über seine Anwesenheit dort Bescheid wusste.
Der anonyme Verfasser des Pamphlets, das ich im Haus meiner Mutter fand, berichtet (aufgrund der Aussagen diverser Gäste, die in jenem Sommer an den Séancen teilgenommen hatten), dass Tom Quinn und Corinth Blackwell vorgaben, sich nicht zu kennen, als sie sich 1893 in Bosco begegneten, es jedoch Grund zu der Annahme gab, dass sie früher sehr vertraut miteinander waren. Ich weiß nicht, was der Verfasser, der sich manchmal zum Verzweifeln vage ausdrückt, meint oder worauf er seine Schlussfolgerung gründet, vermute jedoch, dass Corinth zwar nicht erwartet hatte, Tom Quinn in Bosco zu treffen, die beiden aber irgendwann vor diesem Sommer einmal ein Liebespaar gewesen waren. Ob sein Anblick ihre alten Gefühle für ihn wiedererweckte? Diese Situation ist schwer zu beschreiben, und ich zweifle langsam daran, ob ich sie je hinbekommen werde.
Nicht zum ersten Mal erwäge ich, das Buchprojekt ganz aufzugeben. Mein alter Lehrer Richard Scully hatte recht. Das Thema ist wirklich zu schwer und zu komplex für einen Erstlingsroman. Unter anderem muss man viele historische Einzelheiten beachten – die Kleidung von damals, die Speisen, die Alltagsgepflogenheiten –, und dann besteht trotzdem die Gefahr, dass solche Details aufgesetzt wirken und das Buch zu einem dieser schlüpfrig-schwülstigen Skandalromane gerät, die Bethesda Graham gestern Abend mit Verachtung überhäuft hat.
Ich hatte die Hoffnung, dass mein Aufenthalt in Bosco mir Anregungen für die Gestaltung der Szenen liefern würde, die sich hier im neunzehnten Jahrhundert abgespielt haben. Denn auch dafür ist Bosco schließlich berühmt: für die Inspiration. Von meinem Fenster an der Westseite des Hauses kann ich eine der übrig gebliebenen Musenstatuen auf der obersten Terrasse sehen. Eine regelrechte Phalanx von ursprünglich drei Musen auf jeder der drei Gartenterrassen sollte wohl den Quell der Inspiration, der hier sprudeln sollte, bewachen. Zalman Bronsky jedenfalls scheint es heute Morgen nicht an Inspiration zu mangeln. Dort unten ist er und erinnert in seinem Leinenkittel und dem Schlapphut sehr an Monet in Giverny, als er die alte Brunnenallee hinuntergeht und eine der Musen grüßt, die er beschwingten Schrittes passiert. Beim Frühstück hat er angekündigt, heute Vormittag einen »Sonettspaziergang« machen zu wollen. Und mir noch einmal für die Zeile über das plaudernde Wasser gedankt.
Während sein grüner Hut in dem dichten Gestrüpp unterhalb der zweiten Terrasse verschwindet, überlege ich, ob ich ebenfalls versuchen sollte, draußen zu arbeiten. Gestern ging es ganz gut, zumindest eine Zeit lang. In dem Stechpalmenhain bei der ersten Terrasse konnte ich mir für einen Moment sogar vorstellen, wie der Hügel ausgesehen haben muss, als die Gärten noch unversehrt waren, die Hecken akkurat geschnitten waren, die Statuen alle an ihren Plätzen standen und das Wasser von Terrasse zu Terrasse floss. Ich malte mir aus, wie Corinth Blackwell gegen die Strömung den Hang hinaufstieg und auf das Haus zuging, das ihr Verderben sein sollte. Ich fing an zu schreiben, doch dann überkam mich das Gefühl, dass ich beobachtet wurde, als hätte ich durch die Kraft meiner Fantasie den Geist Corinth Blackwells heraufbeschworen, der sich jeden Augenblick vor mir materialisieren konnte. Schnell schloss ich die Augen und verbannte das Bild aus meinen Gedanken. Die Idee war sowieso absurd, denn Corinth hatte beim ersten Mal zweifellos denselben Weg wie alle anderen zum Haus genommen, nämlich durch die Toreinfahrt am Haupteingang. Nach ein paar Minuten hatte sich mein Herzschlag wieder beruhigt, und meine Furcht war verflogen, aber leider auch das Fünkchen Inspiration.
Nat Loomis hat recht gehabt mit dem, was er gestern Abend über die ausgetrockneten Quellen gesagt hat: Kein besonders gutes Omen für Kunstschaffende, die hierhergekommen sind, um am Musenquell zu trinken. Oder es liegt daran, wie Bethesda spötteln würde, dass es auf dem Gelände keine Muse für Historienschmonzetten gibt. Nats Muse dagegen scheint ihm heute Morgen beizustehen, denn ich höre das Klappern seiner Schreibmaschine von nebenan. In einem Interview mit ihm habe ich einmal gelesen, dass er eine mechanische Schreibmaschine dem Computer vorziehe, um einen körperlichen Kontakt zu den Worten herzustellen. Schon den ganzen Morgen ruft das Geräusch eine sehr konkrete Vorstellung von Nat in mir hervor, wie er in seinem Flanellhemd am Schreibtisch sitzt, die Ärmel bis zu den Ellbogen hochgekrempelt, während das Sonnenlicht aus dem Park die rötlichen Reflexe in seinen wirren braunen Haaren aufschimmern lässt. Dieses Bild, beschließe ich, als ich meinen Laptop unter den Arm klemme, ist mir ein bisschen zu körperlich. Kein Wunder, dass es mich von der Arbeit abhält.
Als ich an seinem Zimmer vorbeikomme, fliegt seine Tür auf, und er steckt den Kopf heraus, auf dem die ungekämmten Haare in alle Richtungen abstehen. »Ach so«, sagt er und klingt enttäuscht, »ich dachte, Sie bringen das Mittagessen.«
»Tut mir leid«, erwidere ich, »aber ich will gerade hinuntergehen und meines holen, um es mit hinauszunehmen. Soll ich ... äh ... Ihres mitbringen?« Die Gepflogenheiten in Bosco sehen vor, dass die Lunchboxen aus Weißblech irgendwann nach dem Frühstück im Esszimmer bereitgestellt werden, damit die Gäste sie abholen können. Mir ist allerdings schon aufgefallen, dass Nat offenbar eine andere Vereinbarung getroffen hat.
»Nein«, sagt er, »Daria wird es vorbeibringen, wenn es fertig ist. Meines dauert ein bisschen länger, weil ich einen bestimmten Ernährungsplan einhalten muss ...« Er beugt sich vor und flüstert: »Ehrlich gesagt, konnte ich diese Schulpausenbrote nicht mehr ertragen und habe Diana erzählt, mein ayurvedischer Ernährungsberater hätte gesagt, ich müsse warmes Essen bekommen.« Er zwinkert mir zu, und ich nicke, beeindruckt von seiner vertraulichen Mitteilung, obwohl ich persönlich die Lunchpakete hier sehr mag – die diagonal geschnittenen Thunfischsandwiches, die geschälten Karottenstifte und die selbst gebackenen Zuckerplätzchen. Dazu die Thermosflasche mit Limonade oder heißem Kakao. Um einen solchen Pausensnack habe ich als Kind meine Mutter immer angebettelt, doch ich musste mit dicken, unförmigen Stullen aus selbst gebackenem Brot mit klebriger Sesampaste vorliebnehmen.
»Also dann ...«, sage ich und trete einen Schritt zurück, »ich will Sie nicht von Ihrer Arbeit abhalten.« Außerdem, denke ich im Stillen, übertreten wir das von neun bis fünf geltende Schweigegebot.
Nat nickt. »Ja, ich habe einen ganz guten Morgen ...« Er schließt langsam die Tür, doch ich kann noch einen Blick in sein Zimmer werfen und bemerke, dass die Seite in seiner Schreibmaschine ein Blatt Bosco-Briefpapier ist. Ich erkenne die eingeprägte Insignie einer griechischen Muse, die unter einer Pinie Wasser aus einer Amphore gießt. Schreibt er seinen Roman etwa auf Bosco-Papier, frage ich mich, oder ist dieses eifrige Getippe bloß Briefkorrespondenz gewesen?
»Viel Glück«, sage ich. Er sieht noch einmal auf, bevor die Tür zugeht, und wirft mir einen seltsamen Blick zu. Wer bin ich schon, um Nat Loomis Glück für seinen Roman zu wünschen? Doch dann grinst er und dankt mir, und auf einmal habe ich eine deutliche Ahnung, was der Zweck dieses Briefes ist. Er bittet seinen Verlag um einen Vorschuss auf seinen Vorschuss.
»Das kann ich gebrauchen. Ah, und nun bekomme ich auch stoffliche Unterstützung«, fügt er hinzu und späht über meine Schulter. Ich drehe mich um und sehe Daria Tate auf uns zukommen, die Nats Lunchbox an einem Band um ihren Zeigefinger schwingt.
»Ja, Stoff