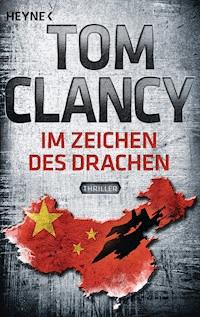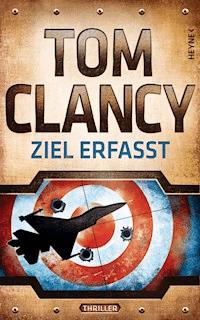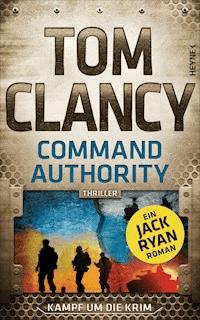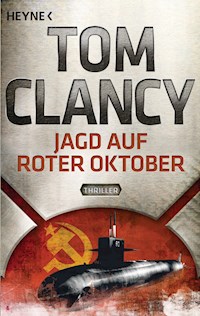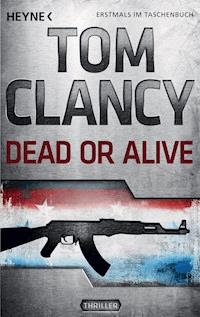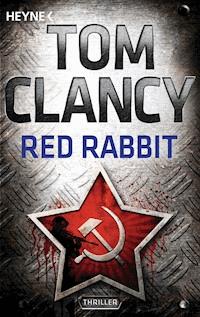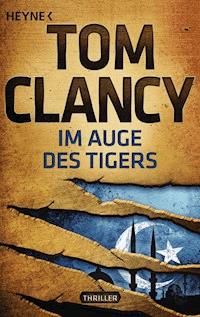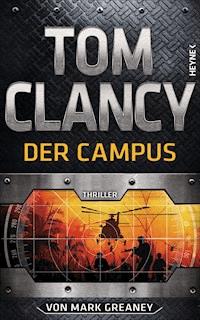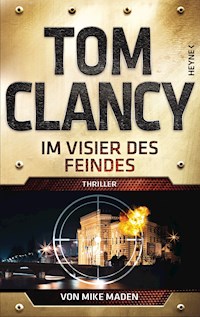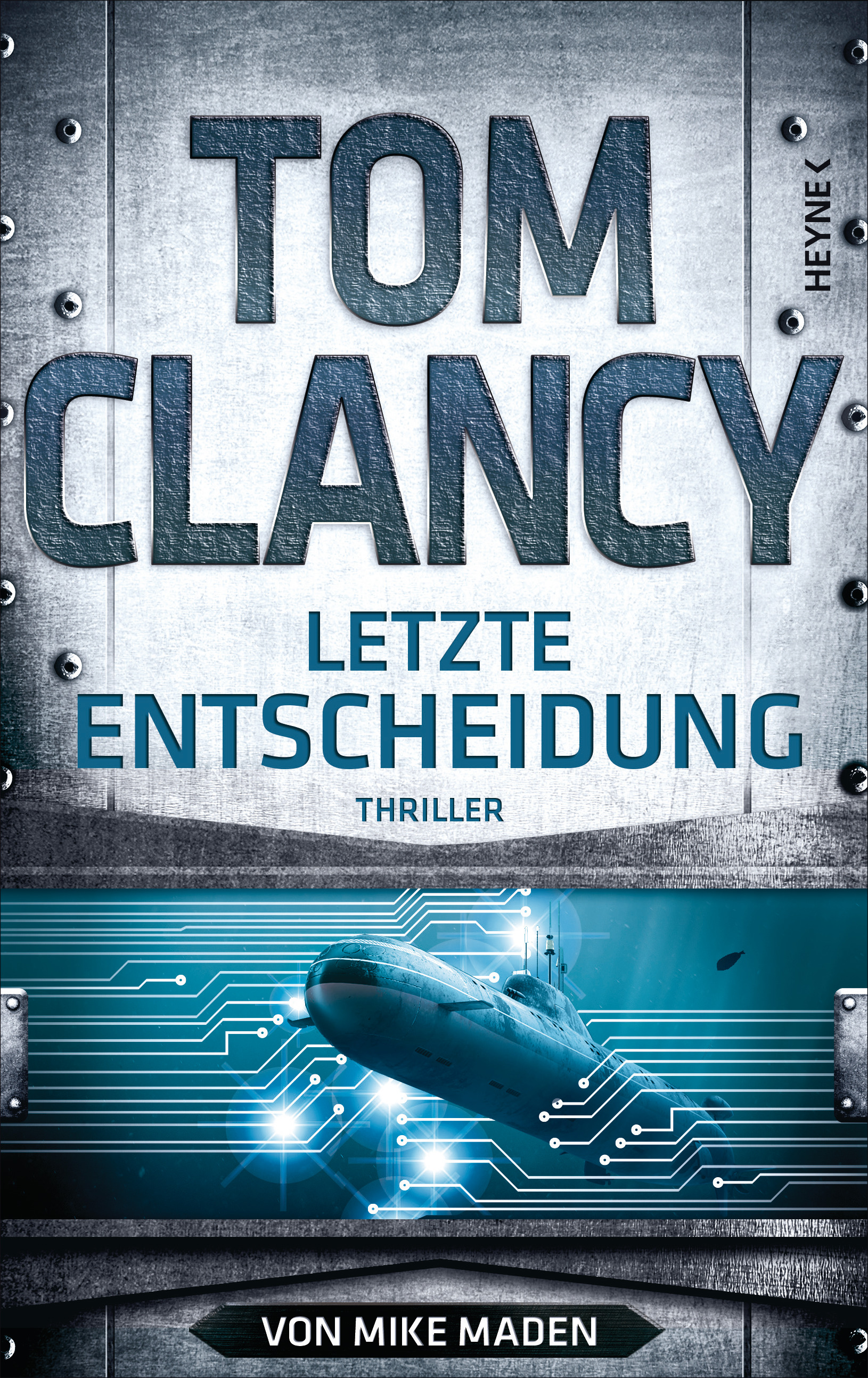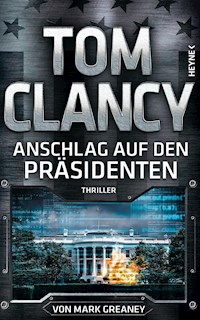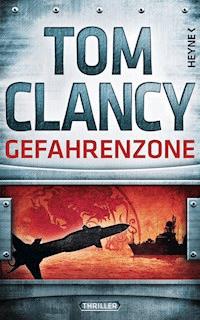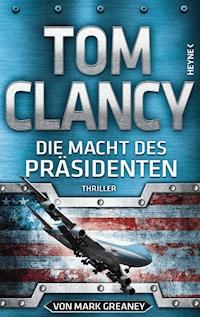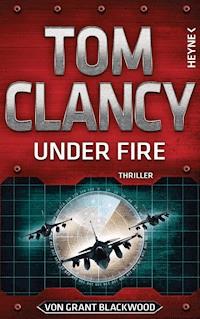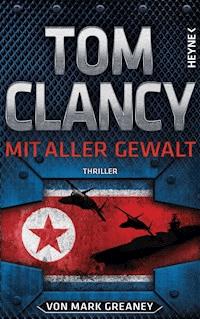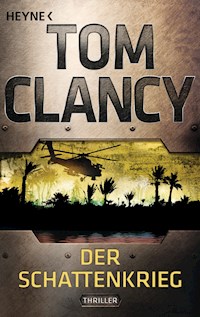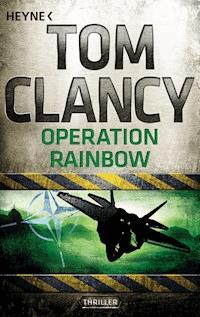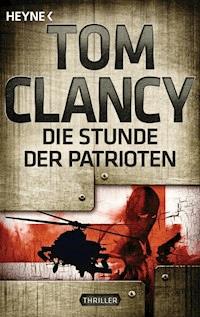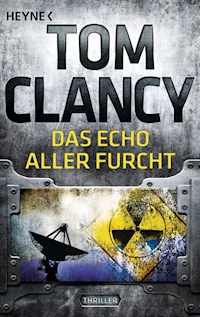
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JACK RYAN
- Sprache: Deutsch
Der Kalte Krieg scheint Vergangenheit, die Weltmächte verhandeln im Zeichen der Kooperation und setzen auf eine friedliche Zukunft. Doch hinter den Kulissen tickt eine gefährliche Zeitbombe, und ein seltsamer Bombenfund genügt, um einen weltumspannenden tödlichen Konflikt zu entfachen. Jack Ryan, Amerikas Geheimdienstmann für Top-Secret-Fälle, muss einen nahezu aussichtslosen Kampf gegen die Zeit gewinnen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1516
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Die Weltmächte verhandeln im Zeichen der Kooperation und setzen auf eine friedliche Zukunft. Doch hinter den Kulissen in Ost und West tickt noch immer eine gefährliche Zeitbombe; denn die Abwehrsysteme der Großmächte drohen von den politischen Ereignissen überrollt zu werden. Da löst ein einziger Funke im Krisenherd Naher Osten den nächsten Konflikt aus, der zu einer internationalen Bedrohung auswachsen könnte, und schon übernehmen die längst totgeglaubten »Falken« wieder das Ruder. Ein neues Kapitel des Kalten Krieges beginnt. Für Jack Ryan, Amerikas Geheimagent für Top Secret-Fälle, ein nahezu aussichtsloser Wettlauf mit der Zeit. Was wird siegen: Vernunft oder blinder Vernichtungswahn? Tom Clancy ist mit diesem Buch ein unvergleichlich hellsichtiger Politthriller gelungen. Diesmal bestimmt nicht nur ausgefeilte Technik das Spiel. Gefährliche politische Verwechslungen und extreme persönliche Konflikte in einer nicht allzu fernen Zukunft entscheiden über die furchtbarste aller möglichen Realitäten: die brutale Rückkehr des Kalten Krieges, eingefangen in einem genialen Szenario.
Autor
Tom Clancys Karriere als Autor sucht selbst in Amerika ihresgleichen. Jahrelang hatte der gelernte Versicherungsmakler die Idee zu einem Technothriller mit sich herumgetragen – bis zum Oktober 1984. In einem unbekannten Verlag erschien damals Jagd auf Roter Oktober, ein Romanerstling, der die Bestsellerlisten im Sturm eroberte und inzwischen auch in der Verfilmung mit Sean Connery und Alec Baldwin die internationale Kinowelt begeistert hat.
Tom Clancy
Das Echoaller Furcht
Roman
Deutsch vonHardo Wichmann
Impressum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel „The Sum of All Fears“ bei G. P. Putnam’s Sons, New York
Copyright © 1991 der Originalausgabe by Jack Ryan Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 der deutschsprachigen Ausgabe by Blanvalet Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von © Shutterstock/caesart
KvD Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-08992-4V009
www.goldmann-verlag.de
Setze den unerschrockensten Seemann, den kühnsten Flieger und den tapfersten Soldaten an einen Tisch, und was kommt dabei heraus? Die Summe ihrer ängste.
Winston Churchill
Die zwei Thronprätendenten trafen sich mit allen ihren Mannen zu Verhandlungen auf dem Feld am Camlann. Beide Seiten waren voll bewaffnet und argwöhnten sehr, die anderen könnten eine List oder ein Stratagem versuchen.
Die Unterhandlungen verliefen glatt, bis ein Ritter von einer Viper gebissen wurde und sein Schwert zog, um das Reptil zu töten. Als die anderen die blanke Waffe sahen, fielen sie augenblicklich übereinander her. Es folgte ein schreckliches Gemetzel. Die Chronik ... [Morte d’Arthur] betont, das Blutbad sei hauptsächlich so ungemein gewesen, weil die Schlacht ohne Vorbereitung und Vorbedacht stattfand.
Herman Kahn: Vom thermonuklearen Kriege
Danksagung
Wie immer, gibt es Menschen, denen ich zu danken habe:
Russ für seine engelsgeduldige Unterweisung in Physik (die Schnitzer sind meine, nicht seine); Barry für Einblicke; Steve für seine Denkweise; Ralph für Analysen; John für die Juristerei; Fred für Zugang; Gerry für seine Freundschaft; vielen anderen, die meine endlosen Fragen und Ideen ertrugen – selbst die dummen; und allen friedliebenden Menschen, die wie ich hoffen, daß wir nun endlich über den Berg kommen, und die bereit waren, darüber zu reden.
Prolog:
Der zerbrochene Pfeil
»Wie der Wolf im Pferch.« Diese Zeile von Lord Byron zitierten automatisch die meisten Kommentatoren, wenn sie den syrischen Angriff auf die von Israel besetzten Golanhöhen am Samstag, den 6. Oktober 1973 um 14 Uhr Ortszeit schilderten. Wahrscheinlich hatten die literarisch gebildeten unter den syrischen Offizieren genau das im Sinn, als sie letzte Hand an ihre Pläne für eine Operation legten, die den Israelis mehr Panzer und Artillerie entgegenschleudern sollte, als sich Hitlers Panzergeneräle jemals träumen ließen.
Die Schafe jedoch, die die syrische Armee an diesem grausigen Tag im Oktober vorfand, glichen eher angriffslustigen Widdern als den sanftmütigen Tieren der Pastorale. Obwohl im Verhältnis eins zu neun unterlegen, waren die beiden israelischen Brigaden auf dem Golan Elite-Einheiten. Den Norden der Höhen hielt die 7. Brigade, deren Linien, eine raffinierte, in Starrheit und Flexibilität fein ausgewogene Verteidigungsanlage, kaum nachgaben. Einzelne starke Stellungen wurden hartnäckig gehalten und lenkten die syrischen Vorstöße in felsige Hohlwege, wo sie von Panzerreserven, die hinter der Demarkationslinie lauerten, abgeschnitten und zerschlagen werden konnten. Als am zweiten Tag Verstärkung nachrückte, war die Lage noch unter Kontrolle – wenn auch nur knapp. Am Ende des vierten Tages lag die syrische Panzerarmee, die über die 7. Brigade hergefallen war, in rauchenden Trümmern.
Die Barak-(»Blitz«-)Brigade hielt den südlichen Abschnitt der Höhen und hatte weniger Glück. Hier begünstigte das Terrain die Verteidiger nicht so sehr, und hier schienen die syrischen Verbände auch fähiger geführt worden zu sein. Binnen Stunden war die Barak-Brigade in mehrere Teile zersprengt worden. Zwar sollte sich später erweisen, daß jedes Bruchstück gefährlicher als ein Vipernnest war, doch für den Moment nutzten die syrischen Panzerspitzen die Lücken rasch aus und jagten auf ihr strategisches Ziel, den See Genezareth, zu. Was im Lauf der nächsten 36 Stunden passierte, sollte das israelische Militär auf die schwerste Probe seit 1948 stellen.
Am zweiten Tag traf Verstärkung ein. Sie mußte praktisch Mann für Mann aufs Gefechtsfeld verteilt werden, um Lücken zu schließen oder versprengte Einheiten zu sammeln, die unter der Gefechtsbelastung auseinandergebrochen und, was es noch nie zuvor in der Geschichte des Staates Israel gegeben hatte, vor den angreifenden Arabern geflohen waren. Erst am dritten Tag gelang es den Israelis, ihre Panzerkräfte zu konzentrieren und die drei syrischen Stoßkeile zu umzingeln und dann zu zerschlagen. Die Syrer wurden von einem wütenden Gegenangriff auf ihre eigene Hauptstadt zurückgeworfen und hinterließen ein entsetzliches Schlachtfeld, übersät mit Leichen und ausgebrannten Panzern. Am Ende dieses Tages empfingen die Soldaten der Barak und der 7. Brigade einen Funkspruch des israelischen Oberkommandos:
IHR HABT DAS VOLK ISRAEL GERETTET.
Was keine Übertreibung war. Dennoch erinnerte man sich außerhalb Israels, von Militärakademien einmal abgesehen, seltsamerweise kaum an die heroische Schlacht. Wie beim Sechs-Tage-Krieg erregte der Bewegungskrieg im Sinai die Bewunderung der Welt: die Überquerung des Suezkanals, die Schlacht um die »chinesische« Farm, die Einkesselung der ägyptischen 3. Armee – und dies, obwohl die Kämpfe auf den Golan-Höhen weitaus furchterregender waren und zudem noch näher der Heimat stattfanden. Die Überlebenden dieser beiden Brigaden wußten, was sie geleistet hatten, und ihre Offiziere konnten sicher sein, daß diese Schlacht bei Berufssoldaten, die verstanden, welches Können und welchen Mut eine solche Abwehr erforderte, zusammen mit den Thermopylen, Bastogne und Gloucester Hill in Erinnerung bleiben würde.
Jeder Krieg hat seine ironischen Aspekte, und der Jom-Kippur-Krieg stellte da keine Ausnahme dar. Wie die meisten ruhmreichen Abwehrschlachten war auch diese Aktion im Grunde überflüssig. Die Israelis hatten Nachrichtendienstmeldungen falsch interpretiert, die, hätte man nur zwölf Stunden früher darauf reagiert, sie in die Lage versetzt hätten, existierende Pläne umzusetzen und vor Beginn der Offensive die Truppen auf den Golanhöhen zu verstärken. Zu dem heroischen Abwehrkampf hätte es gar nicht zu kommen brauchen. Unnötig die Verluste, die so hoch waren, daß man sie erst nach Wochen einer stolzen, aber schwergetroffenen Nation bekanntgab. Hätte man den Informationen entsprechend gehandelt, wären die Syrer trotz ihrer starken Ausrüstung mit Panzern und Geschützen noch vor der Demarkationslinie massakriert worden. Doch bekanntlich bringen Massaker wenig Ruhm. Warum die Aufklärung versagte, wurde nie richtig geklärt. Gelang es dem berühmten Mossad nicht, die Pläne der Araber zu erkennen? Oder schlug die politische Führung Israels die Warnungen, die sie erhielt, in den Wind? Diese Fragen erregten natürlich sofort die Aufmerksamkeit der Weltpresse, insbesondere was den ägyptischen Vorstoß über den Suezkanal und den Durchbruch der vielgerühmten Bar-Lev-Linie anging.
Ebenso ernst, aber weniger beachtet war ein grundlegender Fehler, den der sonst so weitsichtige israelische Generalstab Jahre zuvor gemacht hatte. Trotz ihrer Feuerkraft war die israelische Armee mit Artillerie unterversorgt, dies ganz besonders, wenn man sowjetische Maßstäbe anlegte. Anstatt sich auf starke Konzentrationen mobiler Kanonen zu verlassen, stützten sich die Israelis auf große Zahlen von Mörsern mit geringer Reichweite und auf Kampfflugzeuge. Dies führte dazu, daß die israelischen Artilleristen auf dem Golan im Verhältnis eins zu zwölf unterlegen und einem mörderischen Gegenfeuer ausgesetzt waren, ganz zu schweigen von ihrer Unfähigkeit, die belagerten Verteidiger adäquat zu unterstützen. Dieser Irrtum kostete viele Menschenleben.
Wie so oft wurde dieser schwere Fehler von intelligenten Männern und aus guten Gründen begangen. Ein Kampfflugzeug, das die Syrer auf dem Golan angegriffen hatte, konnte schon eine Stunde später seine tödliche Ladung auf die ägypter am Suezkanal herabregnen lassen. Als erste moderne Luftwaffe hatte die IAF systematisch die Umlaufzeiten ihrer Flugzeuge verkürzt. Das Bodenpersonal wurde ähnlich gedrillt wie die Mechaniker an den Boxen beim Autorennen, und sein Geschick und seine Schnelligkeit verdoppelten praktisch die Schlagkraft jeder Maschine. Das machte die IAF zu einem hochflexiblen und gewichtigen Instrument. Unter diesem Aspekt erschien eine Phantom oder eine Skyhawk natürlich wertvoller als ein Dutzend Geschütze auf Selbstfahrlafetten.
Was die israelischen Planer nicht in Erwägung gezogen hatten, war die Tatsache, daß die Araber von den Sowjets aufgerüstet wurden und daher auch die sowjetische taktische Doktrin eingeimpft bekamen. Die sowjetischen Konstrukteure der SAM-Luftabwehrraketen, deren größte Herausforderung die als überlegen geltenden NATO-Luftwaffen waren, gehörten schon immer zur Weltspitze. Russische Planer sahen in dem kommenden Oktoberkrieg eine hervorragende Gelegenheit, ihre neuesten taktischen Waffen und Methoden zu testen. Und sie versäumten sie nicht. Die Sowjets lieferten ihren arabischen Kunden ein SAM-Netz, von dem die Nordvietnamesen oder die Streitkräfte des Warschauer Paktes damals nicht zu träumen wagten: eine massive Phalanx von tief gestaffelten Raketenbatterien und Radarsystemen, und dazu die neuen mobilen SAM-Abschußgeräte, die zusammen mit den Panzerspitzen vorrücken und den Schutzschirm für die Bodenverbände vergrößern konnten. Die Mannschaften, die diese Systeme bedienen sollten, waren gründlichst ausgebildet worden; viele in der Sowjetunion, wo sie von allem, was Sowjets und Vietnamesen über amerikanische Taktiken und Technologien gelernt hatten, profitierten. Immerhin stand zu erwarten, daß die Israelis die Methoden imitierten. Von allen arabischen Soldaten sollten nur die in der Sowjetunion ausgebildeten Männer den Vorkriegserwartungen gerecht werden, denn sie neutralisierten praktisch zwei Tage lang die israelische Luftwaffe. Wären die Bodenoperationen nach Plan verlaufen, hätte das gereicht.
Hier nimmt die Geschichte ihren eigentlichen Anfang. Die Lage auf dem Golan wurde sofort als sehr ernst eingeschätzt. Die kargen und konfusen Informationen, die von den fassungslosen Stäben der beiden Brigaden eingingen, verführten das israelische Oberkommando zu der Annahme, daß man auf dem Golan die taktische Kontrolle verloren hatte. Der schlimmste Alptraum schien Wirklichkeit geworden zu sein: Unvorbereitet war man überrascht worden. Die Kibbuzim im Norden waren gefährdet. Israelische Zivilisten und Kinder bewegten sich in der Bahn syrischer Panzerverbände, die nach Belieben und praktisch ohne Warnung von den Höhen hinunter nach Galiläa rollen konnten. Die erste Reaktion der Stabsoffiziere war fast panisch.
Ein guter Stabsoffizier jedoch plant auch Panik ein.
In einem Land, für das seine Gegner die physische Vernichtung zum Kriegsziel erklärt haben, kann keine Verteidigungsmaßnahme als zu extrem gelten. Schon 1968 hatten die Israelis die nukleare Option in ihren Kriegsplan aufgenommen. Am 7. Oktober ging um 3.55 Uhr Ortszeit und gerade 14 Stunden nach Beginn der Kampfhandlungen der Befehl für die OPERATION JOSUA per Telex an den Fliegerhorst bei Beer Scheba.
Israel verfügte damals nur über wenige Kernwaffen – und streitet bis heute ihren Besitz ab. Eine große Anzahl wäre auch im Notfall nicht gebraucht worden. In einem der zahllosen unterirdischen Bombenbunker bei Beerscheba lagen 12 recht gewöhnlich aussehende Objekte, die sich von anderen, zur Montierung unter Tragflächen taktischer Kampfflugzeuge gedachten Waffen lediglich durch rot und silbern gestreifte Markierungen an den Seiten unterschieden. Sie hatten keine Leitflossen, und an der stromlinienförmigen Verkleidung aus poliertem Aluminium mit kaum sichtbaren Nähten und einigen Ösen sah nichts ungewöhnlich aus. Das hatte seinen Grund. Ein flüchtiger Beobachter konnte sie leicht für Treibstofftanks oder Napalmbomben halten, Objekte also, die kaum einen zweiten Blick wert waren. In Wirklichkeit aber handelte es sich um zwei Plutoniumbomben mit einer nominalen Sprengkraft von 60 Kilotonnen: genug, um das Herz einer Großstadt zu vernichten, Tausende von Soldaten im Feld zu töten oder – mit Hilfe von separat gelagerten, aber leicht an der Verkleidung zu befestigenden Ummantelungen aus Kobalt – eine ganze Landschaft auf Jahre hinaus zu vergiften.
An diesem Morgen herrschte in Beer Scheba hektischer Betrieb. Nach dem Feiertag Jom Kippur, den die Menschen des kleinen Landes mit Gottesdiensten und Familienbesuchen begangen hatten, strömten noch immer Reservisten auf den Stützpunkt. Die Männer, die die heikle Aufgabe ausführen mußten, Flugzeuge mit ihren tödlichen Bordwaffen zu bestücken, hatten schon viel zu lange Dienst getan. Ihre Konzentration ließ nach. Selbst die Neuankömmlinge litten unter Schlafmangel. Ein Waffentrupp, den man aus Sicherheitsgründen über den Auftrag im unklaren gelassen hatte, versah unter den Augen zweier Offiziere einen Schwarm A-4 Skyhawks mit Kernwaffen. Die Bomben wurden auf Wagen unter die mittleren Aufhängevorrichtungen der vier Flugzeuge gerollt, vorsichtig mit einem Kran angehoben und dann eingehängt. Weniger erschöpften Mitgliedern des Bodenpersonals hätte auffallen können, daß die Entsicherungsvorrichtungen und Leitflossen noch nicht an den Bomben befestigt worden waren. Wer dies wahrnahm, mußte zweifellos zu dem Schluß kommen, daß der für diese Aufgabe zuständige Offizier zu spät dran war – wie fast jeder an diesem kalten und verhängnisvollen Morgen. Die Nasen der Waffen waren mit Elektronik vollgepackt. Der eigentliche Zündmechanismus und die Kapsel mit dem spaltbaren Material, zusammen als »Physikpaket« bekannt, befanden sich natürlich schon in den Bomben. Im Gegensatz zu amerikanischen Kernwaffen waren die israelischen nicht für den Lufttransport in Friedenszeiten bestimmt. Deshalb fehlten ihnen die umfangreichen Sicherungen, die die Firma Pantex bei Amarillo in Texas in US-Kernwaffen einbaute. Das Entsicherungssystem bestand aus zwei Komponenten; eines wurde an der Spitze befestigt, das andere war in die Leitflossen integriert. Im großen und ganzen waren die Bomben für amerikanische oder sowjetische Maßstäbe sehr primitiv – so primitiv wie eine Pistole im Vergleich zu einem Maschinengewehr, aber wie jene auf kurze Entfernung ebenso tödlich.
Nachdem die Entsicherungsvorrichtungen angebracht und aktiviert worden waren, mußten nur noch eine Entsicherungstafel im Cockpit des Kampfflugzeugs installiert und eine Kabelverbindung zwischen Maschine und Bombe hergestellt werden. An diesem Punkt wurde die Waffe »zur Kontrolle vor Ort freigegeben«, das heißt, den Händen junger, aggressiver Piloten anvertraut. Deren Aufgabe war es, sie in einem »Idioten-Looping« genannten Manöver auf einer ballistischen Bahn ins Ziel zu bringen und sich möglichst unbeschadet zu entfernen, bevor sie detonierte.
Der ranghöchste Waffenoffizier auf dem Stützpunkt hatte die Option, gemäß den Umständen und mit Genehmigung der beiden überwachenden Offiziere die Entsicherungskomponenten anbringen zu lassen. Zum Glück war dieser Offizier von der Vorstellung, halbscharfe Atombomben auf einem Flughafen herumliegen zu haben, der jeden Augenblick von arabischen Piloten angegriffen werden konnte, alles andere als begeistert. Trotz der Gefahren, die seinem Land im Morgengrauen dieses kalten Tages drohten, hauchte der gläubige Jude ein Dankgebet, als in Tel Aviv kühlere Köpfe die Oberhand gewannen und den Befehl für die OPERATION JOSUA widerriefen. Die erfahrenen Piloten, die den Einsatz hatten fliegen sollen, kehrten in ihre Bereitschaftsräume zurück und vergaßen die Aufgabe, die man ihnen gestellt hatte. Der ranghöchste Waffenoffizier gab sofort Anweisung, die Bomben zu entfernen und an ihren sicheren Aufbewahrungsort zurückzubringen.
Das zu Tode erschöpfte Bodenpersonal begann, die Bomben abzumontieren. In diesem Augenblick erschien ein anderes Team auf seinem Wagen, um die Skyhawks mit Raketenwerfern des Typs Zuni zu bestücken. Ziel dieses Einsatzes: der Golan. Der Auftrag: Angriff auf die syrischen Panzerkolonnen, die von Kafr Shams aus auf Baraks Sektor der Frontlinie vorstießen. Die Männer beider Trupps drängten unter den Flugzeugen hin und her. Zwei verschiedene Teams versuchten gleichzeitig, ihren Auftrag zu erledigen: Eines war bemüht, Bomben abzunehmen, das andere hängte Zunis unter den Tragflächen auf.
Beerscheba wurde natürlich nicht nur von diesen vier Kampfflugzeugen benutzt. Maschinen, die den ersten Einsatz des Tages am Suezkanal geflogen hatten, kehrten zurück – oder auch nicht. Der Aufklärer RF-4C Phantom war abgeschossen worden, und seine Eskorte, ein Jäger F4-E, erreichte den Stützpunkt knapp mit nur einem funktionierenden Triebwerk und einer zerschossenen Tragfläche, aus der Treibstoff rann. Der Pilot hatte bereits eine Warnung gefunkt: Der Feind setzt eine neuartige Luftabwehrrakete ein, vielleicht die neue SA-6, auf deren Suchradar die Warnanlage der Phantom nicht reagiert hatte. Der Aufklärer war ohne Warnung in die Falle geflogen, und er selbst sei nur mit Glück den vier Geschossen, die auf ihn abgefeuert wurden, entkommen. Noch ehe der Jäger vorsichtig aufsetzte, hatte die Nachricht das Oberkommando der israelischen Luftwaffe als Blitzmeldung erreicht. Der Pilot der Phantom folgte einem Jeep zu den bereitstehenden Löschfahrzeugen, doch als die Maschine zum Stillstand kam, platzte am Hauptfahrwerk der linke Reifen. Die Strebe wurde beschädigt, knickte ab, und die zwanzig Tonnen schwere Maschine knallte auf den Asphalt. Leckender Treibstoff entzündete sich und hüllte das Flugzeug in einen kleinen, aber tödlichen Feuerball. Einen Augenblick später begann die 20-Millimeter-Munition der Bordkanone zu explodieren, und eines der beiden Besatzungsmitglieder schrie in den Flammen. Feuerwehrleute griffen mit Wassernebeln ein. Die beiden Männer, die die Atombomben bewachten, waren dem Brand am nächsten und stürzten auf die Unfallstelle zu, um den Piloten aus den Flammen zu ziehen. Alle drei wurden von Teilen der detonierenden Munition getroffen. Ein Feuerwehrmann drang mutig in das Feuer zu dem zweiten Mann der Besatzung vor und konnte den Schwerverletzten in Sicherheit bringen. Andere Feuerwehrleute luden die blutenden Offiziere und den Piloten in Krankenwagen.
Dieser Brand lenkte die Waffentrupps, die unter den Skyhawks arbeiteten, ab. An Maschine 3 wurde eine Bombe zu früh gelöst und zerquetschte dem Vorarbeiter am Kran die Beine. In dem nun ausbrechenden Chaos verlor das Team die Übersicht. Der Verletzte wurde schnellstens ins Stützpunktlazarett gebracht, und die drei abmontierten Bomben karrte man zurück in ihren Bunker. In der Hektik des ersten Kriegstages fiel offenbar niemandem auf, daß ein Bombenkarren einen leeren Schlitten trug. Unteroffiziere erschienen an der Startlinie, um die Maschinen einer abgekürzten Prüfung auf Flugklarheit zu unterziehen. Vom Bereitschaftsschuppen kam ein Jeep herüber. Vier Piloten mit Helmen und Karten in der Hand sprangen heraus.
»Was, zum Teufel, ist das?« fauchte Leutnant Mordecai Zadin, ein schlaksiger Achtzehnjähriger, den seine Freunde Motti nannten.
»Anscheinend Treibstofftanks«, erwiderte der Unteroffizier, ein freundlicher, kompetenter Reservist von 50 Jahren, der in Haifa eine Autowerkstatt besaß.
»So’n Quatsch!« versetzte der vor Erregung fast zitternde Pilot. »Für den Golan brauch’ ich keinen Extrasprit.«
»Ich kann ihn ja abmontieren, aber das dauert ein paar Minuten.« Motti dachte kurz nach. Er war ein Sabra von einem Kibbuz im Norden des Landes und erst seit fünf Monaten Pilot. Nun sah er, wie seine Kameraden in ihre Maschinen stiegen und sich anschnallten. Der syrische Angriff rollte auf sein Heimatdorf zu, und er bekam plötzlich Angst, bei seinem ersten Kampfeinsatz zurückgelassen zu werden.
»Scheiß drauf! Schrauben wir das Ding ab, wenn ich zurückkomme.« Zadin kletterte flink die Leiter hinauf. Der Unteroffizier folgte ihm, schnallte ihn fest und warf über seine Schulter hinweg einen Blick auf die Instrumente.
»Alles klar, Motti! Paß auf dich auf.«
»Wenn ich zurück bin, will ich meinen Tee.« Er grinste so diebisch, wie es nur ein Junge in seinem Alter fertigbringt. Der Unteroffizier schlug ihm auf den Helm.
»Bring mir bloß meinen Vogel heil zurück.« Er sprang hinunter auf den Beton und zog die Leiter weg. Dann nahm er eine letzte Sichtprüfung vor. Motti ließ inzwischen die Triebwerke an, ging auf Leerlauf, bewegte Steuerknüppel und Pedale, sah auf Kraftstoff- und Temperaturanzeige. Alles in Ordnung. Er schaute zum Piloten des Führerflugzeuges hinüber und winkte: startklar. Dann zog er das Kabinendach herunter, warf dem Unteroffizier einen letzten Blick zu und salutierte zum Abschied.
Mit seinen achtzehn Jahren war Zadin für die Verhältnisse in der israelischen Luftwaffe nicht besonders jung. Er war wegen seiner raschen Reaktionen und seiner jungenhaften Aggressivität ausgewählt worden und hatte sich seinen Platz in der besten Luftwaffe der Welt hart erkämpfen müssen. Motti flog für sein Leben gern und hatte Pilot werden wollen, seit er als kleiner Junge ein Trainingsflugzeug des Typs Bf-109 gesehen hatte. Er liebte seine Skyhawk. Das war ein Flugzeug für richtige Piloten und kein elektronisches Monstrum wie die Phantom. Die A-4, ein kleiner, schnell reagierender Raubvogel, jagte schon bei der leichtesten Bewegung des Knüppels los. Und nun der erste Kampfeinsatz. Motti hatte überhaupt keine Angst. Es fiel ihm gar nicht ein, um sein Leben zu fürchten – wie alle Teenager hielt er sich für unsterblich, und ein Kriterium bei der Auswahl von Kampfpiloten ist, daß sie keine menschlichen Schwächen zeigen. Dennoch war dies für ihn ein besonderer Tag. Nie hatte er einen schöneren Sonnenaufgang gesehen. Er war von einer übernatürlichen Aufmerksamkeit, hatte alles wahrgenommen: den starken Kaffee zum Wachwerden, den staubigen Geruch der Morgenluft in Beer Scheba, nun den Duft nach Öl und Leder im Cockpit, das leise Rauschen im Kopfhörer und das Prickeln in seinen Händen, die am Steuerknüppel lagen. So einen Tag hatte Motti Zadin noch nie erlebt, und er dachte nicht eine Sekunde daran, daß das Schicksal ihm einen weiteren verweigern mochte.
Die vier Maschinen rollten in perfekter Formation ans Ende der Startbahn 01. Das schien ein gutes Omen für den Abflug nach Norden, einem nur 15 Flugminuten entfernten Feind entgegen. Auf einen Befehl des Kommandanten, der selbst erst 21 war, drückten alle vier Piloten die Schubhebel bis zum Anschlag durch, lösten die Bremsen und sausten los in den stillen, kühlen Morgen. Sekunden später waren sie in der Luft und stiegen auf 5000 Fuß. Dabei bemühten sie sich, den zivilen Flugverkehr um den Ben Gurion International Airport, der seltsamerweise noch in Betrieb war, zu meiden.
Der Hauptmann gab die üblichen knappen Befehle: Aufschließen, Triebwerk, Bordwaffen, elektrische Systeme prüfen. Auf MiG und eigene Maschinen achten. Sicherstellen, daß die Anzeige der Freund/Feind-Kennung IFF grün ist. Die 15 Minuten Flugzeit von Beerscheba zu den Golanhöhen vergingen rasch. Zadin hielt angestrengt nach dem vulkanischen Steilhang, bei dessen Eroberung sein älterer Bruder vor sechs Jahren gefallen war, Ausschau. Den kriegen die Syrer nie zurück, sagte er sich.
»Schwarm: Rechts kurven auf Steuerkurs null-vier-drei. Ziel: Panzerkolonnen vier Kilometer östlich der Linie. Augen auf! Achtet auf SAM und Flak.«
»Führer, Vier. Panzer in eins«, meldete Zadin gelassen. »Sehen aus wie unsere Centurion.«
»Gutes Auge, Vier«, erwiderte der Hauptmann. »Das sind unsere.«
»Achtung, Abschußwarnung!« rief jemand. Augen suchten die Luft nach einer Gefahr ab.
»Scheiße!« rief eine erregte Stimme. »SAM im Anflug, tief in zwölf!«
»Hab’ sie gesehen. Schwarm: Formation auflösen!« befahl der Hauptmann.
Die vier Skyhawks zerstreuten sich. Mehrere Kilometer entfernt hielten 12 SA-2-Raketen mit Mach 3 auf sie zu. Auch die SAM drehten nach links und rechts ab, aber so schwerfällig, daß zwei zusammenstießen und explodierten. Motti flog eine Rolle nach rechts, zog den Knüppel an seinen Bauch, ging in den Sturzflug und verfluchte dabei das zusätzliche Gewicht an der Tragfläche. Knapp 30 Meter über dem felsigen Boden fing er die Skyhawk ab und jagte donnernd über die jubelnden Soldaten der belagerten Barak-Brigade hinweg auf die Syrer zu. Als geschlossener Angriff war der Einsatz im Eimer, aber das war für Motti jetzt nicht so wichtig: Er wollte ein paar syrische Panzer abschießen. Als er eine andere A-4 sah, schloß er auf und begann mit ihr den Bodenangriff. Vor ihm tauchten die gewölbten Türme syrischer T-62 auf. Ohne hinzusehen, legte Zadin einen Schalter um und machte seine Waffen scharf. Vor seinen Augen erschien das Reflexvisier der Bordkanone.
»Achtung, noch mehr SAM.« Der Hauptmann klang immer noch gelassen.
Mottis Herzschlag stockte: Ein ganzer Schwarm kleinerer Raketen – sind das die SA-6, vor denen man uns gewarnt hat? schoß es ihm durch den Kopf – fegte über die Felsen hinweg auf ihn zu. Er sah auf die Anzeige seiner Warnanlage; sie hatte die angreifenden Flugkörper nicht erfaßt. Instinktiv ging Motti höher, um Raum zum Manövrieren zu gewinnen. Vier Raketen folgten ihm in etwa drei Kilometer Abstand. Scharfe Rolle nach rechts, spiralförmiger Sturzflug, ein Haken nach links. Das täuschte drei der Raketen, aber die vierte ließ sich nicht abhängen und detonierte ganze dreißig Meter von seiner Maschine entfernt. Motti hatte das Gefühl, als sei seine Skyhawk zehn Meter zur Seite geschleudert worden. Er kämpfte mit der Steuerung und fing das Flugzeug knapp überm Boden ab. Ein flüchtiger Blick ließ ihn erstarren. Ganze Segmente seiner Backbordtragfläche waren zerfetzt. Akustische Warnsignale im Kopfhörer und Leuchtsignale am Instrumentenbrett meldeten das Desaster: Hydraulik leck, Funkgerät defekt, Generator ausgefallen. Doch die mechanische Steuerung funktionierte noch, und seine Waffen konnten mit Batteriestrom feuern. Nun sah er die Quälgeister: eine Batterie von SA-6, die aus vier Flapanzern, einem Radarwagen und einem schweren, mit Flugkörpern beladenen Lkw bestand. Sein scharfer Blick machte sogar die über vier Kilometer entfernten Syrer aus, die gerade hastig eine Rakete auf die Abschußrampe schafften.
Aber auch er wurde entdeckt, und nun begann ein Duell, das trotz seiner Kürze nichts ausließ.
Motti ging behutsam so tief, wie es seine schlagende Steuerung erlaubte, und nahm das Ziel sorgfältig ins Reflexvisier. Er hatte 48 Zuni-Raketen, die in Vierersalven abgeschossen werden konnten. Aus zwei Kilometer Entfernung eröffnete er das Feuer. Irgendwie gelang es dem syrischen SAM-Trupp, noch eine Rakete zu starten. Vor ihr hätte es eigentlich kein Entkommen geben dürfen, doch wurde der Radar-Annäherungszünder der SA-6 von den vorbeifliegenden Zunis ausgelöst, was zur Selbstzerstörung des Flugkörpers in sicherer Entfernung führte. Motti grinste grimmig hinter seiner Maske und feuerte nun Raketen und 20-Millimeter-Geschosse auf den Trupp von Männern und Fahrzeugen. Die dritte Salve traf, vier weitere folgten; Motti machte weiter, um das ganze Zielgebiet mit Raketen zu beschießen. Die SAM-Batterie verwandelte sich in ein Inferno aus brennendem Dieselöl und Raketentreibstoff und explodierenden Sprengköpfen. Ein gewaltiger Feuerball stieg vor ihm auf, den er mit einem wilden Triumphgeschrei durchflog: Die Feinde waren vernichtet, die Kameraden gerächt.
Lange währte das Hochgefühl nicht. Ganze Aluminiumbleche riß der Fahrtwind bei etwa 750 Stundenkilometern aus seiner linken Tragfläche. Die A-4 begann heftig zu vibrieren. Als Motti abdrehte, um zurückzufliegen, knickte der Flügel ganz ab, und die Skyhawk brach in der Luft auseinander. Sekunden später wurde der junge Krieger auf den Basaltfelsen des Golan zerschmettert. Niemand von dem Schwarm kehrte von diesem Einsatz zurück.
Von der SAM-Batterie war so gut wie nichts mehr übrig. Alle sechs Fahrzeuge waren in Fetzen gerissen, und von der 90 Mann starken Bedienungsmannschaft war nur der kopflose Rumpf des Batteriechefs zu identifizieren. Er, wie auch der junge Kämpfer, hatten ihrem Land treu gedient, aber ihre Taten blieben wie so oft unbesungen. Drei Tage später erhielt Zadins Mutter ein Telegramm, in dem stand, ganz Israel habe an ihrem Schmerz teil. Ein schwacher Trost für eine Mutter, die nun zwei Söhne verloren hatte.
Doch es gab ein Ereignis, das als Fußnote zu diesem ansonsten unkommentierten Vorfall in die Geschichte eingehen sollte. Eine nicht scharfgemachte Atombombe, die sich von dem auseinanderbrechenden Kampfflugzeug gelöst hatte, war weiter nach Osten geflogen. Weit von den Trümmern der Skyhawk entfernt, hatte sie sich direkt neben dem Hof eines Drusen in den Boden gebohrt. Drei Tage später bemerkten die Israelis das Fehlen der Bombe, und sie waren erst nach dem Ende des Oktoberkrieges in der Lage, die einzelnen Umstände dieses Verlustes zu rekonstruieren. Die sonst so findigen Israelis standen vor einem unlösbaren Problem. Die Bombe mußte irgendwo hinter den syrischen Linien liegen – aber wo? Welche der vier Maschinen hatte sie getragen? Bei den Syrern Erkundigungen einzuziehen kam nicht in Frage. Und konnte man den Amerikanern reinen Wein einschenken, bei denen man sich das »spezielle Nuklearmaterial« so geschickt und diskret, daß man jederzeit seinen Besitz dementieren konnte, beschafft hatte?
So blieb die Bombe liegen, ohne daß jemand von ihr wußte – bis auf den Drusen, der sie mit Erde bedeckte und weiter sein steiniges Feld bestellte.
1
Die längste Reise
Arnold van Damm lümmelte sich in seinem Drehsessel mit der Eleganz einer in die Ecke geworfenen Stoffpuppe. Jack hatte ihn nie ein Jackett tragen sehen außer in Gegenwart des Präsidenten, und selbst dann nicht immer. Bei formellen Anlässen fragte sich Ryan, ob Arnie den bewaffneten Agenten des Secret Service an seiner Seite überhaupt brauchte. Die Krawatte hing lose unterm aufgeknöpften Kragen; ob die jemals fest geschlungen gewesen war? dachte Ryan. Die blauen Hemden aus dem Sportversandhaus L. L. Bean waren grundsätzlich aufgekrempelt und an den Ellbogen schmuddelig, weil van Damm sich beim Aktenstudium auf seinen unaufgeräumten Schreibtisch stützte. Van Damm war knapp 50, hatte schütteres Haar und ein verknittertes Gesicht, das an eine alte Landkarte erinnerte, aber seine blaßblauen Augen blickten hellwach, und seinem scharfen Geist entging nichts. Das waren die Qualitäten, die man vom Stabschef der Präsidenten erwartet.
Er goß Diät-Coke in einen großen Becher, der auf der einen Seite das Emblem des Weißen Hauses und auf der anderen seinen Namen trug, und musterte den stellvertretenden Direktor der CIA, kurz DDCI, mit einem Gemisch aus Sympathie und Argwohn. »Durst?«
»Ich könnte ein richtiges Coke vertragen«, versetzte Jack grinsend. Van Damms linke Hand verschwand, und dann schleuderte er eine rote Aluminiumdose hinüber, die Ryan knapp über seinem Schoß schnappte. Die Erschütterungen machten das Öffnen riskant, und Ryan hielt die Dose beim Aufreißen demonstrativ auf van Damm gerichtet. Ob man den Mann nun mag oder nicht, dachte Ryan, Stil hat er, und der Posten ist ihm nicht zu Kopf gestiegen. Den wichtigen Mann kehrt er nur heraus, wenn es sein muß, und vor Außenstehenden. Bei Insidern spart er sich das Theater.
»Der Chef will wissen, was da drüben los ist«, begann der Stabschef.
»Ich auch.« Charles Alden, der Sicherheitsberater des Präsidenten, betrat den Raum. »Entschuldigen Sie die Verspätung, Arnie.«
»Das würde uns ebenfalls interessieren«, erwiderte Jack. »Und zwar schon seit zwei Jahren. Wollen Sie unseren besten Vorschlag hören?«
»Klar«, meinte Alden.
»Wenn Sie wieder mal in Moskau sind, halten Sie nach einem großen weißen Kaninchen mit Weste und Taschenuhr Ausschau. Und wenn es Sie in seinen Bau einlädt, nehmen Sie an und erzählen mir dann, was Sie tief unten vorgefunden haben«, sagte Ryan in gespieltem Ernst. »Bitte, ich bin kein rechter Ultra, der nach der Rückkehr des Kalten Krieges jammert, aber damals waren die Russen wenigstens berechenbar. Inzwischen geht es im Kreml so zu wie bei uns – vollkommen chaotisch. Komisch, ich verstehe erst jetzt, welche Kopfschmerzen wir dem KGB bereitet haben. Die politische Dynamik dort drüben ändert sich von Tag zu Tag. Narmonow mag der trickreichste Ränkeschmied der Welt sein, aber jedesmal, wenn er zur Arbeit geht, hat er eine neue Krise zu bewältigen.« »Was für ein Mensch ist er eigentlich?« fragte van Damm. »Sie kennen ihn doch.« Alden hatte Narmonow getroffen, van Damm aber noch nicht.
»Ich bin ihm nur einmal begegnet«, dämpfte Ryan.
Alden machte es sich in einem Sessel bequem. »Moment, Jack, ich habe Ihre Personalakte gesehen, und der Chef auch. Ich hätte es fast geschafft, ihm Respekt vor Ihnen einzuflößen. Zwei Intelligence Stars, für die Geschichte mit dem U-Boot und für den Fall Gerasimow. Sie sind ein stilles Wasser, das läßt tief blicken. Kein Wunder, daß Al Trent so viel von Ihnen hält.« Jack hatte den Intelligence Star, die höchste Auszeichnung der CIA für Leistungen im Feld, sogar dreimal verliehen bekommen, aber die Urkunde für den dritten Stern lag in einem Tresor und war so geheim, daß selbst der Präsident sie nicht kannte und auch nie zu sehen bekommen würde. »Also werden Sie Ihrem Ruf gerecht und reden Sie.«
»Er ist der seltene Typ, der im Chaos erfolgreich agiert. Ich kenne ärzte, die so sind, Unfallchirurgen zum Beispiel, die noch immer seelenruhig in der Notaufnahme arbeiten, wenn alle anderen Kollegen schon längst ausgebrannt sind. Manche Menschen genießen Druck und Streß, Arnie, und Narmonow gehört dazu. Er muß eine Konstitution wie ein Pferd haben ...«
»Das trifft auf die meisten Politiker zu«, merkte van Damm an.
»Beneidenswert. Wie auch immer, weiß Narmonow, wo es langgeht? Ja und nein, würde ich sagen. Er hat eine Ahnung, wo er sein Land hinsteuern will, aber wie er ans Ziel kommt und was er dann anfängt, weiß er nicht. Der Mann hat Mut.«
»Sie mögen ihn also.« Das war keine Frage.
»Er hatte die Möglichkeit, mich so einfach, wie ich gerade die Dose aufgemacht habe, umzubringen, ließ es aber bleiben«, gab Ryan lächelnd zu. »Das nötigt mir einige Sympathie ab. Nur ein Narr könnte den Mann nicht bewundern. Selbst wenn wir noch Feinde wären, verdiente er Respekt.«
»Aha, wir sind also keine Feinde mehr?« Alden grinste ironisch.
»Wie könnten wir Gegner sein?« fragte Jack mit gespielter Überraschung. »Sagte der Präsident nicht, das gehöre der Vergangenheit an?«
Der Stabschef grunzte. »Politiker reden viel. Dafür werden sie bezahlt. Wird Narmonow es schaffen?«
Ryan schaute angewidert aus dem Fenster und ärgerte sich, daß er die Frage nicht beantworten konnte. »Betrachten wir es einmal so: Andrej Il’itsch muß der taktisch ausgekochteste Politiker sein, den das Land je hatte. Aber er vollführt einen Drahtseilakt. Gewiß, er hat mehr Format als alle anderen, aber erinnern Sie sich noch an die Zeit von Karl Wallenda, dem weltbesten Seiltänzer? Der Mann endete platt auf dem Gehsteig, weil er einen schlechten Tag hatte in seinem Beruf, in dem man sich keinen Schnitzer leisten kann. Auch Andrej Il’itsch gehört in diese Kategorie. Schafft er es? Das fragt man sich schon seit acht Jahren. Ja, glauben wir – oder ich – aber ... tja, das ist eine Terra incognita, die wir noch nie betreten haben, und er auch nicht. Jeder Meteoreloge kann bei seiner Vorhersage auf eine Datenbasis zurückgreifen. Unsere beiden besten Spezialisten für russische Geschichte haben im Augenblick vollkommen entgegengesetzte Meinungen. Das sind Jake Kantrowitz von der Uni Princeton und Derek Andrews an der Hochschule Berkeley. Gerade vor zwei Wochen hatten wir sie beide in der Zentrale in Langley. Ich persönlich neige zu Jakes Einschätzung, aber die leitenden Analytiker der UdSSR-Abteilung geben Andrews recht. Und da stehen wir. Wenn Ihnen der Sinn nach dogmatischen Auslassungen ist, schauen Sie in die Presse.«
Van Damm knurrte. »Wie sieht die nächste Krise aus?«
»Der Knackpunkt ist die Nationalitätenfrage«, sagte Jack. »Wie wird die Sowjetunion zerfallen – welche Republiken werden sie verlassen –, wann und wie, friedlich oder mit Gewalt? Dieses Problem, mit dem Narmonow täglich zu tun hat, bleibt.«
»Das predige ich schon seit einem Jahr. Wann wird sich eine neue Ordnung abzeichnen?«
»Moment, ich bin derjenige, der sagte, Ostdeutschland bräuchte ein Jahr Übergangszeit. Ich war damals der größte Optimist in Washington und lag um elf Monate falsch. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist wilde Spekulation.«
»Wo schwelt es sonst noch?« fragte van Damm.
»Im Nahen Osten, wie üblich.« Ryan sah die Augen des Stabschefs aufleuchten.
»Dort planen wir bald eine Initiative.«
»Viel Glück«, meinte Ryan sarkastisch. »Daran basteln wir schon seit 1973 unter Nixon und Kissinger herum. Die Lage hat sich zwar etwas abgekühlt, aber die grundlegenden Probleme existieren nach wie vor, und früher oder später wird es dort wieder losgehen. Positiv ist, daß Narmonow sich nicht einmischen will. Mag sein, daß er seine alten Verbündeten unterstützen muß – der Waffenhandel ist für ihn ein Dukatenesel –, aber wenn es zu einem Konflikt kommt, wird er, anders als seine Vorgänger, keinen Druck ausüben – siehe den Krieg am Golf. Denkbar, daß er weiter Waffen in die Region schleust – ich halte das zwar für unwahrscheinlich, kann mich jedoch nicht festlegen –, aber er wird einen arabischen Angriff auf Israel lediglich unterstützen und selbst keine Schiffe umdirigieren oder Truppen in Alarmbereitschaft versetzen. Ich bezweifle sogar, daß er säbelrasselnden Arabern den Rücken stärken wird. Andrej Il’itsch sagt, sowjetische Waffen seien für die Verteidigung bestimmt, und das glaube ich ihm auch – trotz der Hinweise, die wir von den Israelis erhalten.«
»Steht das fest?« fragte Alden. »Das Außenministerium sagt etwas anderes.«
»Das Außenministerium irrt«, gab Ryan fest zurück.
»Dann liegt Ihr Chef aber auch falsch«, betonte van Damm.
»In diesem Fall, Sir, muß ich bei allem Respekt anderer Auffassung sein als der Direktor.«
Alden nickte. »Jetzt verstehe ich, warum Trent Sie mag: Sie reden nicht wie ein Bürokrat. Wie konnten Sie sich als Mann, der sagt, was er denkt, so lange halten?«
»Vielleicht bin ich bloß ein Aushängeschild.« Ryan lachte und wurde dann ernst. »Bitte denken Sie darüber nach. Narmonow hat mit seinem Vielvölkerstaat so viel zu tun, daß eine aggressive Außenpolitik ebenso viele Gefahren wie Vorteile bergen würde. Nein, er verkauft lediglich Waffen gegen harte Währung, und auch nur dann, wenn die Luft rein ist. Das ist ein Geschäft und weiter nichts.«
»Wenn wir also eine friedliche Lösung finden ...?« meinte Alden versonnen.
»Finden wir vielleicht sogar Narmonows Unterstützung«, ergänzte Ryan. »Schlimmstenfalls bleibt er im Hintergrund und murrt, weil er nicht mitmischen kann. Aber sagen Sie, wie wollen Sie im Nahen Osten Frieden schaffen?«
»Mit Druck auf Israel«, versetzte van Damm schlicht.
»Das halte ich aus zwei Gründen für unklug. Erstens ist es falsch, Israel unter Druck zu setzen, bevor seine Bedenken über die Sicherheit ausgeräumt sind, und dazu kann es erst kommen, wenn die Grundfragen gelöst sind.«
»Wie zum Beispiel ...?«
»Der Kernpunkt des Konflikts.« Die Sache, die alle übersehen, fügte Ryan in Gedanken hinzu.
»Klar, es geht um die Religion, aber diese Narren glauben doch im Grunde an dieselben Dinge!« grollte van Damm. »Letzten Monat habe ich in den Koran geschaut und alles gefunden, was wir in der Sonntagsschule beigebracht bekamen.«
»Wohl wahr«, stimmte Ryan zu. »Für Katholiken und Protestanten ist Christus ja auch der Sohn Gottes, was sie aber nicht davon abhält, sich in Nordirland gegenseitig abzuschlachten. Nirgendwo ist ein Jude sicherer als in Ulster. Dort sind die Christen miteinander so beschäftigt, daß sie für Antisemitismus gar keine Zeit haben. Arnie, für Nordirland und Nahost gilt eine Maxime: Ganz gleich, wie gering uns die religiösen Differenzen vorkommen mögen, für die Betroffenen sind sie ein Motiv zum Töten. Und dieser Unterschied muß für uns ausschlaggebend sein.«
»Hm, das stimmt wohl«, gestand der Stabschef widerwillig. Er dachte kurz nach. »Haben Sie Jerusalem im Sinn?«
»Genau.« Ryan trank sein Coke aus und pfefferte die Dose in van Damms Papierkorb. »Drei Religionen ist die Stadt heilig, beherrscht aber wird sie nur von einer, die mit einer der beiden anderen im Streit liegt. Angesichts der explosiven Lage in dieser Region könnte man sich für die Stationierung einer Friedensstreitmacht aussprechen – aber welcher? Denken Sie nur an die Zusammenstöße mit islamischen Fanatikern in Mekka. Arabische Friedenstruppen in Jerusalem würden die Sicherheit Israels bedrohen. Spricht man sich für den Status quo aus, also nur israelische Streitkräfte, nehmen die Araber Anstoß. Die UNO können wir gleich vergessen. Israel hätte Einwände, weil die Juden in diesem Forum nicht sehr beliebt sind. Die Araber würden sich an den vielen Christen in einer Friedenstruppe stoßen. Und uns gefiele die Sache auch nicht, weil man uns bei der UNO nicht gerade liebt. Der einzig verfügbaren internationalen Organisation mißtrauen alle Beteiligten. Eine Pattsituation.«
»Dem Präsidenten liegt viel an dieser Initiative«, betonte der Stabschef. Offenbar wollte die Administration den Eindruck erwecken, daß etwas getan wurde.
»Dann soll er halt den Papst um Vermittlung bitten, wenn er ihn wieder mal sieht.« Ryans respektloses Grinsen erstarrte für einen Augenblick. Van Damm glaubte, daß er innehielt, weil er nichts Despektierliches über den Präsidenten, gegen den er eine Abneigung hatte, sagen wollte. Doch dann wurde Ryans Gesicht ausdruckslos. Arnie kannte ihn nicht gut genug, um diese Miene zu deuten. »Moment mal ...«
Der Stabschef lachte in sich hinein. Ein Besuch beim Papst konnte dem Präsidenten nicht schaden und kam bei den Wählern immer gut an. Anschließend konnte er dann bei einem öffentlichen Essen mit Vertretern von B’nai B’rith, der jüdischen Loge, demonstrieren, daß er ein Herz für alle Religionen hatte. In Wirklichkeit ging der Präsident jetzt, da seine Kinder erwachsen waren, nur noch zur Schau in die Kirche. Und das war ein amüsanter Aspekt: Die Sowjets kehrten auf ihrer Suche nach gesellschaftlichen Werten zur Religion zurück, von der sich die amerikanische Linke schon seit langem abgewandt hatte. Van Damm war ursprünglich ein überzeugter Linker gewesen, aber 25 Jahre praktische Regierungsarbeit hatten ihn eines Besseren belehrt. Inzwischen mißtraute er Ideologen beider Flügel aus Überzeugung. Als Pragmatiker suchte er nach Lösungen, die den Vorteil hatten, tatsächlich zu funktionieren. Sein politischer Tagtraum hatte ihn vom Thema abgelenkt.
»Haben Sie etwas im Sinn, Jack?« fragte Alden.
»Nun, wir gehören doch alle Offenbarungsreligionen an, nicht wahr, und haben heilige Schriften.« Vor Jacks innerem Auge tauchte eine Idee auf.
»Und?«
»Und der Vatikan ist ein richtiger Staat mit diplomatischem Status, aber ohne Militär ... nun ja, die Schweizergarde ... Die Schweiz ist neutral und noch nicht einmal UN-Mitglied. Dort legen die Araber ihr Geld an, dort amüsieren sie sich ... Hm, ich frage mich, ob er da mitmachen würde ...« Ryans Miene wurde wieder ausdruckslos, doch plötzlich sah van Damm seine Augen aufleuchten: Ihm mußte etwas eingefallen sein. Er fand es immer faszinierend, so einen Geistesblitz mitzuerleben, zog es aber vor, zu wissen, worum es ging.
»Wie bitte? Wer soll bei was mitmachen?« fragte der Stabschef etwas gereizt. Alden wartete einfach ab.
Ryan erläuterte.
»Es wird doch hauptsächlich um die heiligen Stätten gestritten, nicht wahr? Ich könnte mal mit Leuten in Langley reden. Wir haben einen guten Draht ...«
Van Damm lehnte sich zurück. »Was sind das für Kontakte? Sollen wir mit dem Nuntius sprechen?«
Ryan schüttelte den Kopf. »Der Nuntius, Kardinal Giancetti, ist ein netter alter Herr, der aber nur repräsentiert. Sie sind schon lange genug hier und wissen das, Arnie. Wer mit jemandem sprechen will, der sich auskennt, wendet sich an Pater Riley in Georgetown. Er war mein Doktorvater, und wir verstehen uns gut. Riley hat einen direkten Draht zum General.«
»Und wer ist das?«
»Das Oberhaupt der Gesellschaft Jesu, Francisco Alcalde SJ, ein Spanier. Er lehrte zusammen mit Pater Tim Riley an der Universität San Giovanni Bellarmine in Rom. Beide sind Historiker, und Pater Tim ist der inoffizielle Vertreter des Ordens hier. Haben Sie ihn nie kennengelernt?«
»Nein. Ist er die Mühe wert?«
»Aber sicher. Riley ist einer der besten Lehrer, die ich je hatte, und kennt Washington wie seine Westentasche. Er hat auch vorzügliche Kontakte beim Home Office.« Ryan grinste, aber van Damm verstand den Witz nicht.
»Könnten Sie ein diskretes Mittagessen arrangieren?« fragte Alden. »Nicht hier, sondern irgendwo anders?«
»Ich schlage den Cosmos Club in Georgetown vor. Pater Tim ist dort Mitglied. Der Universitätsclub ist günstiger gelegen, aber ...«
»Schon gut. Ist er verschwiegen?«
»Kann ein Jesuit ein Geheimnis wahren?« Ryan lachte. »Sie sind bestimmt kein Katholik.«
»Wie schnell ließe sich das einrichten?«
»Wäre Ihnen morgen oder übermorgen recht?«
»Und seine Loyalität?« fragte van Damm aus heiterem Himmel.
»Pater Tim ist US-Staatsbürger, und er ist bestimmt kein Sicherheitsrisiko. Andererseits ist er Priester und hat einen Eid geschworen, der ihn einer Autorität verpflichtet, die für ihn über der Verfassung steht. Sie können sich darauf verlassen, daß der Mann seinen Verpflichtungen nachkommt, aber vergessen Sie, welcher Art diese sind«, warnte Ryan. »Herumkommandieren kann man ihn auch nicht.«
»Arrangieren Sie das Essen. Riley klingt ganz nach einem Mann, dem ich begegnen sollte. Richten Sie ihm aus, ich wollte nur seine Bekanntschaft machen«, meinte Alden. »Morgen und übermorgen bin ich um die Mittagszeit frei.«
»Wird gemacht, Sir.« Ryan stand auf.
Der Cosmos Club befindet sich in einem herrschaftlichen Haus, das einmal dem Diplomaten Sumner Welles gehört hatte. In Jacks Augen wirkte es nackt, weil ihm 150 Hektar Hügelland, ein Stall mit Vollblütern und vielleicht ein Fuchs fehlte, dem der Besitzer nicht allzu entschlossen nachstellte. Eine solche Umgebung aber hatte das Anwesen nie besessen, und Ryan fragte sich, warum Welles, der sich in Washington so gründlich auskannte, jenen Bau, der so offensichtlich im Widerspruch zu den Realitäten der Stadt stand, an diesem Platz und in diesem Stil errichtet hatte. Die Kriterien für die Mitgliedschaft in dem laut Satzung für die Intelligenzija gedachten Club gründeten sich nicht auf Reichtum, sondern auf Leistung – in Washington war er als Ort bekannt, wo die Konversation kultiviert und die Küche unterentwickelt war. Ryan führte Alden in ein kleines Privatzimmer im ersten Stock.
Pater Timothy Riley SJ erwartete sie, eine Bruyèrepfeife zwischen den Zähnen und die Washington Post vor sich auf dem Tisch. Daneben stand ein Glas mit einem Rest Sherry. Er trug ein ungebügeltes Hemd und ein knittriges Jackett. Seine Soutane, die er bei einem der besseren Schneider in der Wisconsin Avenue maßschneidern ließ, hob er sich für offizielle Anlässe auf. Der steife Kragen war strahlend weiß, und dem Katholiken Ryan schoß plötzlich durch den Kopf, daß er nicht sagen konnte, woraus das Ding gemacht war. Gestärkte Baumwolle? Zelluloid, wie der Vatermörder zu Großvaters Zeiten? Wie auch immer, das einengende Stück mußte den Träger an seinen Platz im Dies- und Jenseits erinnern.
»Hallo, Jack!«
»Tag, Pater Riley.« Ryan machte die Männer miteinander bekannt, sie gaben sich die Hand und setzten sich an den Tisch. Ein Kellner erschien, nahm die Getränkebestellung auf und schloß beim Hinausgehen die Tür hinter sich.
»Nun, Jack, wie gefällt Ihnen der neue Job?« fragte Riley.
»Er erweitert den Horizont«, antwortete Ryan und ließ es dabei bewenden. Der Priester mußte schon über seine Probleme in Langley Bescheid wissen.
»Wir haben einen Friedensplan für den Nahen Osten, und Jack meinte, Sie seien der richtige Mann für ein sondierendes Gespräch«, schnitt Alden das Thema an. Er mußte unterbrechen, als der Kellner mit Getränken und Speisekarten zurückkam. Sein anschließender Diskurs über die Friedensplan-Idee dauerte mehrere Minuten.
»Interessant«, meinte Riley, als er alles gehört hatte.
»Was halten Sie von dem Konzept?« wollte der Sicherheitsberater wissen.
»Hochinteressant.« Der Priester verfiel in Schweigen.
»Wird der Papst ...?« Ryan gebot Alden mit einer Handbewegung Einhalt. Riley ließ sich ungern drängen, wenn er nachdachte. Immerhin ist bei Historikern der Faktor Zeit weniger entscheidend als bei ärzten.
»Sicherlich eine elegante Lösung«, bemerkte Riley nach einer halben Minute. »Nur die Griechen werden große Schwierigkeiten machen.«
»Die Griechen? Wie das?«
»Am streitsüchtigsten ist im Augenblick die griechisch-orthodoxe Kirche. Wegen der banalsten administrativen Details geraten wir immer wieder aneinander. Seltsamerweise sind die Imams und Rabbis im Augenblick umgänglicher miteinander als die christliche Geistlichkeit. Wie auch immer, die Probleme zwischen Katholiken und Orthodoxen sind vorwiegend verfahrenstechnischer Natur – wem welche Stätte anvertraut wird, wer in Bethlehem die Mitternachtsmesse liest. Eigentlich schade.«
»Sie sagen, der Plan müsse scheitern, weil zwei christliche Kirchen sich nicht einigen können?«
»Ich sprach von Schwierigkeiten, Dr. Alden, nicht davon, daß der Plan aussichtslos ist.« Riley verstummte wieder. »Sie werden die Troika ausbalancieren müssen ..., aber angesichts der Natur des Vorhabens wird man Sie wohl unterstützen. Die Orthodoxen werden Sie sowieso hinzuziehen müssen; die kommen nämlich sehr gut mit den Moslems aus.«
»Wie das?« fragte Alden.
»Nach der Vertreibung des Propheten Mohammed aus Medina durch vorislamische Heiden gewährte das orthodoxe Katharinenkloster im Sinai ihm Zuflucht. Die Mönche versorgten ihn, als er Freunde nötig hatte. Mohammed war ein ehrenhafter Mann, und das Kloster genießt seitdem den Schutz der Moslems. Seit über tausend Jahren hat trotz aller häßlichen Vorfälle in der Region niemand diesen Ort gestört. Am Islam ist vieles bewundernswert, was wir im Westen wegen der Fanatiker, die sich Moslems nennen, oft übersehen. Er hat edle Gedanken und eine respektable intellektuelle Tradition hervorgebracht, mit der bei uns leider kaum jemand vertraut ist«, schloß Riley.
»Gibt es andere mögliche Probleme?« fragte Jack.
Pater Tim lachte. »Der Wiener Kongreß! Jack, wie konnten Sie den vergessen?«
»Wie bitte?« platzte Alden gereizt heraus.
»1815, das weiß doch jedes Kind. Bei der Neuordnung Europas nach den Napoleonischen Kriegen mußten sich die Schweizer verpflichten, nie mehr Söldner in andere Länder zu senden. Aber da finden wir bestimmt einen Ausweg. Darf ich das einmal kurz darlegen, Dr. Alden? Die Leibwache des Papstes besteht aus Schweizern, so wie früher die des Königs von Frankreich, die dann beim Ausbruch der Revolution getötet wurde. Einem ähnlichen Schicksal entkam die päpstliche Garde einmal nur knapp, aber sie konnte sich so lange verteidigen, bis eine kleine Abordnung den Heiligen Vater im abgelegenen Castel Gandolfo in Sicherheit bringen konnte. Söldner waren der wichtigste Exportartikel der Schweiz und weithin gefürchtet. Die Rolle der Schweizergarde im Vatikan ist inzwischen vorwiegend repräsentativ, war aber früher durchaus stark militärisch. Wie auch immer, Schweizer Söldner hatten einen so abschreckenden Ruf, daß der Wiener Kongreß die Schweiz zu der Verpflichtung zwang, ihre Soldaten nur im eigenen Land und im Vatikan einzusetzen. Dies ist, wie ich sagte, aber nur ein Randproblem. Die Schweiz beteiligt sich bestimmt mit Begeisterung an diesem Projekt, das ihrem Prestige in einer Region, wo viel Geld steckt, nur förderlich sein kann.«
»Sicher«, merkte Jack an. »Besonders, wenn wir das Material stellen – Panzer M-1, Bradley-Schützenpanzer, Elektronik für die Kommunikation ...«
»Jack, das kann doch nicht Ihr Ernst sein«, sagte Riley.
»Doch, Pater. Allein aus psychologischen Gründen muß die Truppe schwere Waffen haben. Man muß demonstrieren, daß man es ernst meint. Ist das erst einmal geschehen, kann der Rest der Schweizergarde in seiner Designerkleidung von Michelangelo und bewaffnet mit Hellebarden herumstolzieren und in die Kameras der Touristen grinsen. Aber im Nahen Osten muß man schweres Kaliber auffahren.«
Das sah Riley ein. »Gentlemen, mir gefällt die Eleganz des Konzepts, weil es an das Edle im Menschen appelliert. Alle Beteiligten behaupten, an einen Gott zu glauben, wenngleich unter verschiedenen Namen. Jerusalem, die Stadt Gottes ..., hm, das ist der Schlüssel. Bis wann brauchen Sie eine Antwort?«
»Sehr dringend ist es nicht«, antwortete Alden. Riley verstand: Das Weiße Haus war an der Sache interessiert, aber es gab keinen Grund zur Eile. Andererseits sollte sie auch nicht zuunterst in einem Aktenstoß landen. Es handelte sich eher um eine Anfrage über informelle Kanäle, die zügig und diskret zu erledigen war.
»Nun, der Vorgang muß die Bürokratie passieren, und der Vatikan hat die älteste Verwaltung der Welt.«
»Aus diesem Grund haben wir uns an Sie gewandt«, meinte Ryan. »Ihr General kann diese Sesselfurzer bestimmt umgehen.«
»Aber Jack! So spricht man doch nicht von den Fürsten der Kirche!« Riley platzte fast vor Lachen.
»Vergessen Sie nicht, ich bin Katholik und verstehe das.«
»Ich nehme Verbindung auf«, sagte Riley. Noch heute, versprach sein Blick.
»Aber diskret«, betonte Alden.
»Diskret«, stimmte Riley zu.
Zehn Minuten später war Pater Timothy Riley auf der kurzen Rückfahrt zu seiner Dienststelle in Georgetown schon in Gedanken mit dem Vorschlag beschäftigt. Ryan hatte Pater Rileys Kontakte und ihre Bedeutung richtig eingeschätzt. Der Pater faßte sein Schreiben in attischem Griechisch ab, der Philosophensprache, derer sich außer Plato und Aristoteles nie mehr als 50000 Menschen bedient hatten. Er hatte sie beim Studium am Woodstock Seminar gelernt. Er schloß die Tür zu seinem Arbeitszimmer, wies seinen Sekretär an, keine Gespräche durchzustellen, und schaltete seinen Computer ein. Zuerst lud er ein Programm, das die Verwendung des griechischen Alphabets ermöglichte. Riley hatte seine Maschinenschreibkünste dank Sekretär und Computer so gründlich verlernt, daß er für das Dokument – neun zweizeilig beschriebene Seiten – über eine Stunde brauchte. Dann zog er eine Schreibtischschublade auf und gab die Kombination für den in einem Aktenschrank versteckten kleinen, aber sicheren Safe ein. Hier lag, wie Ryan schon lange vermutete, ein Chiffrenbuch, in mühseliger Arbeit handschriftlich erstellt von einem jungen Priester aus dem Stab des Ordensgenerals.
Riley mußte lachen; normalerweise brachte man Geheimcodes nicht mit der Priesterschaft in Verbindung. Als Admiral Chester Nimitz 1944 dem Generalvikar der US-Streitkräfte, John Kardinal Spellman, die Ernennung eines neuen Bischofs für die Marianen nahelegte, holte der Geistliche ein Chiffrenbuch hervor und gab über das Fernmeldenetz der US-Marine die entsprechenden Anweisungen. Wie jede andere Organisation brauchte auch die katholische Kirche gelegentlich eine sichere Nachrichtenverbindung; der Chiffrierdienst des Vatikans existierte schon seit Jahrhunderten. Im vorliegenden Fall war der Schlüssel ein langes Zitat aus einem Diskurs von Aristoteles mit sieben fehlenden und vier auf groteske Weise falsch geschriebenen Wörtern. Ein Chiffrierprogramm erledigte den Rest. Nun mußte er eine neue Kopie ausdrucken. Anschließend schaltete er den Computer ab und löschte so das Kommuniqué. Der Ausdruck ging per Fax an den Vatikan und kam anschließend in den Reißwolf. Die ganze mühselige Aktion hatte drei Stunden gedauert, und als Riley seinem Sekretär mitteilte, er sei wieder fürs Tagesgeschäft verfügbar, wußte er, daß er bis tief in die Nacht würde arbeiten müssen. Im Gegensatz zu normalen Geschäftsleuten fluchte er aber deswegen nicht.
»Das gefällt mir nicht«, sagte Leary leise und schaute durchs Fernglas.
»Mir auch nicht«, stimmte Paulson zu. Er hatte durch sein Zielfernrohr mit zehnfacher Vergrößerung zwar ein engeres Gesichtsfeld, sah aber mehr Details. Nach dem Subjekt fahndete das FBI schon seit über zehn Jahren. Der Mann, dem der Mord an zwei FBI-Agenten und einem Vollzugsbeamten zur Last gelegt wurde, John Russell (alias Richard Burton, alias Red Bear), war in einer Organisation untergetaucht, die sich »Warrior Society« nannte, die Gesellschaft der Sioux-Krieger. Viel von einem Stammeskrieger hatte John Russell indes nicht. Er war in Minnesota geboren, weit vom Sioux-Reservat entfernt, und als kleiner Krimineller im Gefängnis gelandet. Dort hatte er seine ethnische Herkunft entdeckt und sich sein verdrehtes Bild vom amerikanischen Ureinwohner zurechtgezimmert – das Paulson eher an Bakunin als an den Indianerhäuptling Cochise erinnerte. Russell hatte drei terroristische Akte begangen, bei denen drei Bundesbeamte umkamen. Dann war er abgetaucht. Früher oder später aber macht jeder Flüchtige einen Fehler, und diesmal war John Russell an der Reihe. Die »Warrior Society« finanzierte sich mit Drogenschmuggel nach Kanada, und ein FBI-Informant hatte von dem riskanten Unternehmen Wind bekommen.
Sie waren in den gespenstischen Ruinen eines Bauerndorfes sechs Meilen von der kanadischen Grenze entfernt. Das Geiselrettungsteam des FBI, für das es wie üblich keine Geiseln zu retten gab, fungierte als Antiterroreinheit der Behörde. Die zehn Mann des Trupps, angeführt von Dennis Black, unterstanden der administrativen Kontrolle des örtlich zuständigen FBI-Agenten, genannt SAC, und genau an diesem Punkt war es bei der Behörde mit der sonst üblichen Perfektion gründlich vorbei. Der lokale SAC hatte einen komplizierten Plan für einen Hinterhalt ausgeklügelt, der allerdings schon übel begonnen und dann fast in einer Katastrophe geendet hatte: Drei Agenten lagen nach Verkehrsunfällen im Krankenhaus, zwei andere hatten schwere Schußverletzungen erlitten. Im Gegenzug war ein Subjekt mit Sicherheit getötet und ein zweites vermutlich verwundet worden. Die anderen drei oder vier – auch da war man nicht ganz sicher – hatten sich in einem ehemaligen Motel verbarrikadiert. Fest stand jedenfalls, daß entweder in der alten Herberge die Amtsleitung noch funktionierte oder, was wahrscheinlicher war, die Subjekte über ein Funktelefon die Medien verständigt hatten. Das Resultat war eine Riesenkonfusion, die einem Trupp Zirkusclowns alle Ehre gemacht hätte. Der SAC bemühte sich, den Rest seines professionellen Rufes zu retten, indem er die Medien zu seinen Gunsten manipulierte. Nur wußte er noch nicht, daß mit Fernsehteams aus Denver oder Chicago nicht so leicht umzuspringen war wie mit jungen Lokalreportern. Die Profis ließen sich nicht an der Nase herumführen.
»Dem Kerl reißt Bill Shaw morgen den Arsch auf«, merkte Leary leise an.
»Damit ist uns auch nicht geholfen«, versetzte Paulson.
»Was gibt’s?« fragte Black über den gesicherten Funkkanal.
»Bewegung, aber keine Identifizierung«, antwortete Leary. »Schlechtes Licht. Die Kerle mögen blöd sein, aber verrückt sind sie nicht.«
»Die Subjekte haben einen TV-Reporter mit Kamera verlangt, und der SAC hat zugestimmt.«
»Dennis, Sie haben doch nicht etwa ...?« Paulson fiel fast das Fernrohr aus der Hand.
»Doch«, erwiderte Black. »Der SAC sagt, er hat hier den Befehl.« Der Verhandlungsexperte des FBI, ein erfahrener Psychiater, sollte erst in zwei Stunden eintreffen, und der SAC wollte für die Abendnachrichten etwas zu bieten haben. Black wäre dem Mann am liebsten an die Kehle gesprungen, aber das ging natürlich nicht.
»Ich kann ihn nicht wegen Unfähigkeit festnehmen«, sagte Leary mit der Hand überm Mikrofon. Das einzige, was den Kerlen noch fehlt, ist eine Geisel, fügte er in Gedanken hinzu. Liefern wir ihnen ruhig eine, dann kriegt unser Psychiater wenigstens etwas zu tun.
»Die Lage, Dennis?« fragte Paulson.
»Auf meine Befehle hin sind die Eingreifrichtlinien in Kraft«, erwiderte Dennis Black. »Es kommt eine Reporterin, 28, blond, blaue Augen, etwa einsfünfundsechzig; begleitet von einem Kameramann, farbig, etwa einsneunzig. Ich habe ihm Anweisungen gegeben, wie er sich annähern soll. Der Mann hat Köpfchen und spielt mit.«
»Roger, Dennis.«
»Seit wann sind Sie an der Waffe, Paulson?« fragte Black noch. Laut Dienstvorschrift durfte ein Scharfschütze bei voller Alarmbereitschaft nur 30 Minuten an der Waffe bleiben; danach tauschten Beobachter und Schütze die Positionen. Offenbar war Black der Ansicht, daß irgend jemand sich an die Vorschriften halten mußte.
»Seit 15 Minuten, Dennis, alles klar ... Ah, da kommt das Fernsehen.«
Sie lagen nur 115 Meter vom Eingang des Motels entfernt in Stellung. Die Sicht war schlecht. In 90 Minuten ging die Sonne unter. Ein stürmischer Tag; ein heißer Südwestwind fegte über die Prärie. Die Augen brannten vom Staub. Am schlimmsten war, daß die Querböen eine Geschwindigkeit von über 60 Stundenkilometern erreichten und damit sein Geschoß um bis zu 20 Zentimeter ablenken konnten.
»Team steht bereit«, verkündete Black. »Ermächtigung zum Eingreifen ist gerade gegeben worden.«
»Ein totales Arschloch ist er also nicht«, erwiderte Leary über Funk. Er war so aufgebracht, daß es ihm gleich war, ob der SAC nun mithörte oder nicht. Wahrscheinlich bepißt er sich gerade wieder, dachte er.
Scharfschütze und Beobachter trugen Tarnanzüge und hatten zwei Stunden gebraucht, um ihre Positionen einzunehmen; nun verschmolzen sie mit den knorrigen Bäumen und dem struppigen Präriegras. Leary beobachtete, wie sich das Fernsehteam dem Motel näherte. Die Frau ist hübsch, dachte er, aber ihre Frisur und ihr Make-up haben unter dem scharfen trockenen Wind gelitten. Der Kameramann hätte bei den Vikings Verteidiger sein können und war vielleicht schnell und zäh genug, um Tony Wills, dem sensationellen neuen Halfback, einen Angriffskorridor freizumachen. Leary verdrängte den Gedanken.
»Der Kameramann trägt eine kugelsichere Weste. Die Frau nicht.« Schwachsinn, dachte Leary. Dennis muß ihr doch gesagt haben, was das für Kerle sind.
»Dennis sagt, der Mann sei gewitzt.« Paulson richtete sein Gewehr auf das Gebäude. »Bewegung an der Tür!«
»Passen wir alle auf«, murmelte Leary.
»Subjekt 1 in Sicht«, verkündete Paulson. »Russell kommt raus. Scharfschütze 1 hat Ziel erfaßt.«
»Hab’ ihn!« meldeten drei andere Stimmen gleichzeitig.
John Russell war ein Hüne – einssechsundneunzig, gut 110 Kilo schwer –, ein ehemaliger Athlet, der nun verfettete. Sein Oberkörper war nackt; er trug Jeans, und ein Stirnband hielt sein langes schwarzes Haar. Auf der Brust hatte er Tätowierungen, einige vom Fachmann, die meisten aber im Gefängnis mit Kopierstift und Spucke angefertigt. Er war ein Typ von der Sorte, der die Polizei lieber bewaffnet entgegentritt. Die lässige Arroganz seiner Bewegungen verriet seine Verachtung für Regeln und Gesetze.
»Subjekt 1 trägt einen großen schwarzen Revolver«, meldete Leary dem Rest des Teams. Smith & Wesson? spekulierte er. »äh, Dennis ..., hier kommt mir was komisch vor.«
»Was?« fragte Black sofort.
»Mike hat recht«, sagte Paulson dann, der sich Russells Gesicht durchs Zielfernrohr genau ansah. »Der steht unter Drogen, Dennis, der hat was drin. Rufen Sie das TV-Team zurück!« Aber dafür war es zu spät.
Paulson hielt Russells Kopf im Fadenkreuz. Für ihn war Russell nun kein Mensch mehr, sondern ein Subjekt, ein Ziel. Wenigstens war der SAC vernünftig genug gewesen, dem Team begrenzte Erlaubnis zum Eingreifen zu geben, so daß sein Leiter für den Fall, daß etwas schiefging, alle ihm angemessen erscheinenden Maßnahmen treffen konnte. Auch Paulson hatte spezifische Anweisungen. Sowie das Subjekt einen Agenten oder Zivilisten lebensgefährdend bedrohte, konnte er mit seinem Finger auf den Abzug seines Gewehrs einen Druck von 2650 Gramm ausüben und damit das Geschoß losjagen.
»Immer mit der Ruhe, alle Mann«, flüsterte der Scharfschütze. Sein Zielfernrohr Marke Unertl war mit Fadenkreuz und Strichplatte ausgerüstet. Erneut schätzte Paulson automatisch die Distanz, achtete weiter auf die Böen und hielt Russells Ohr im Fadenkreuz.
Die Szene hatte eine grausige Komik. Die Reporterin lächelte und bewegte ihr Mikrofon beim Interview hin und her. Der massige schwarze Kameramann hatte seine Minicam am Auge, mit der aufgesteckten grellen Lampe, die von Batterien, die an seinem Gürtel befestigt waren, betrieben wurde. Russell redete eindringlich, aber Paulson und Leary verstanden nichts, weil der Wind zu heftig war. Seine Miene war von Anfang an zornig gewesen, und sie glättete sich nicht. Er ballte die Linke zur Faust, und die Finger seiner rechten Hand schlossen sich automatisch um den Knauf der Pistole. Der Wind preßte die Seidenbluse der Reporterin an ihre durchscheinenden Brüste. Leary fiel ein, daß Russell den Ruf hatte, ein zur Brutalität neigender Sexualathlet zu sein. Aber der Ausdruck des Mannes war sonderbar leer. Einmal starrte er teilnahmslos, dann wieder fuhr er leidenschaftlich auf; diese durch Drogen erzeugte Instabilität mußte den psychischen Druck auf den vom FBI Umstellten noch verstärken. Plötzlich wurde er unnatürlich ruhig.
Leary verfluchte den SAC. Wir sollten uns ein Stück zurückziehen und abwarten, bis die Kerle mürbe sind, dachte er. Die Lage hat sich stabilisiert. Die kommen hier nicht weg. Wir könnten übers Telefon verhandeln und sie hinhalten ...
»Achtung!«
Mit seiner freien Hand hatte Russell die Reporterin am Oberarm gepackt. Sie versuchte sich zu befreien, verfügte aber nur über einen Bruchteil der Kraft, die dazu nötig war. Der Kamermann nahm eine Hand von der Sony. Er war groß und stark und hätte Erfolg haben können, aber seine Bewegung provozierte Russell. Die rechte Hand des Subjekts zuckte.