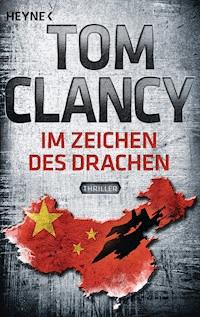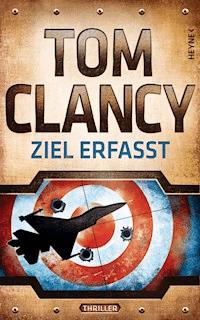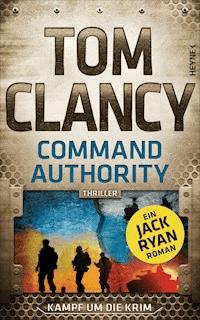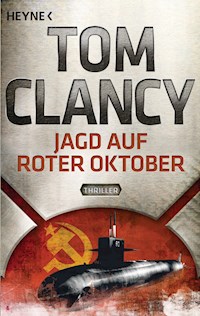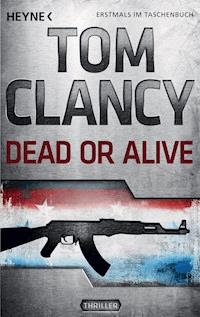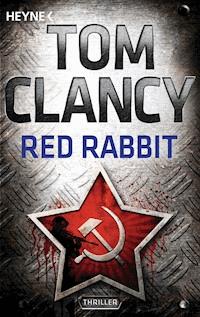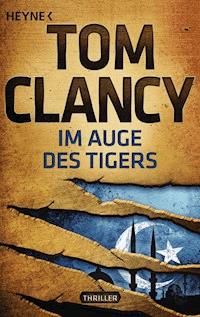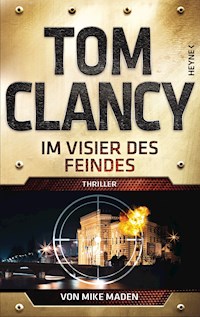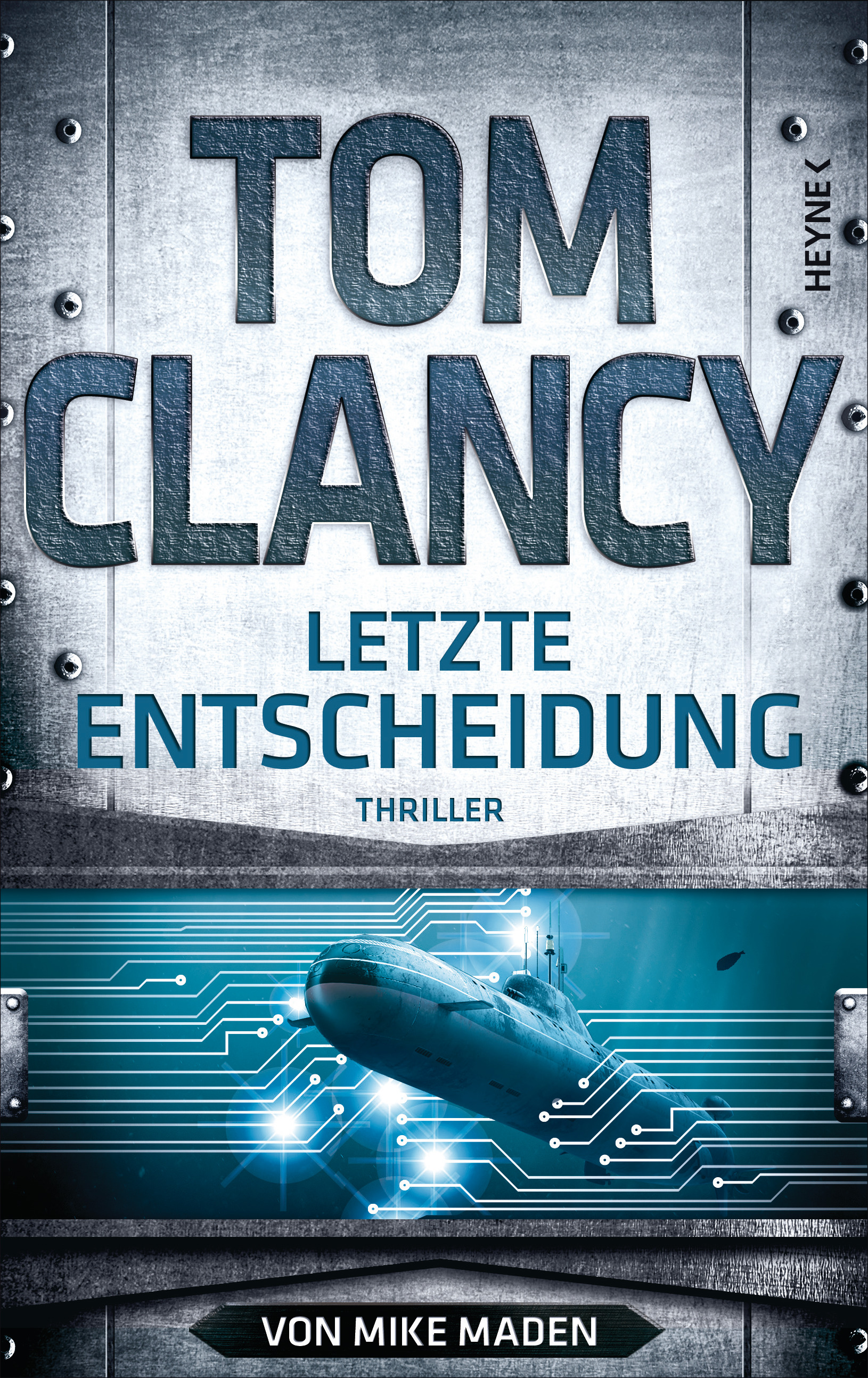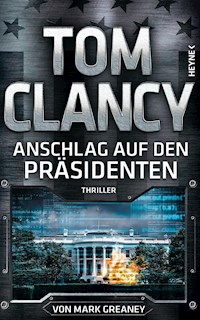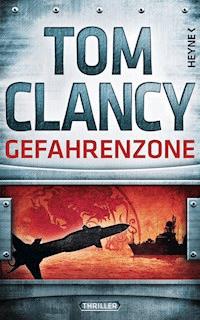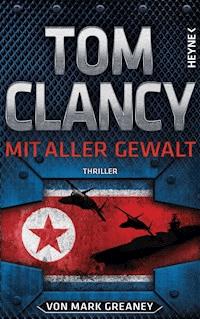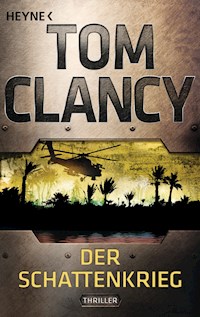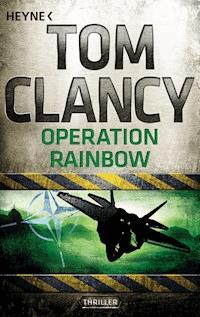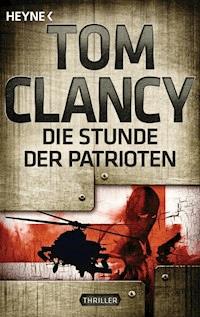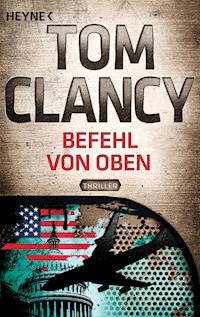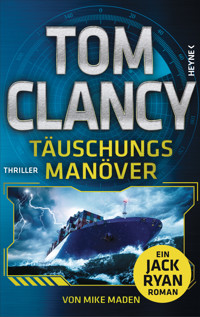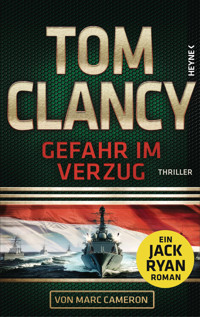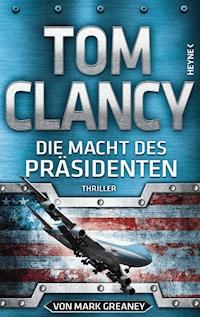
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JACK RYAN
- Sprache: Deutsch
Eine schwimmende Erdgasanlage vor der litauischen Küste explodiert nach einem Bombenanschlag. Ein venezolanischer Staatsanwalt wird gemeuchelt. Bei einem Handstreich gegen einen russischen Truppenzug gibt es Dutzende Tote. Eine anarchische Welt ist die beste Tarnung, den eigentlichen Plan mit scheinbar zusammenhanglosen Übergriffen zu verschleiern. Nur ein Mann erkennt das Muster hinter all den perfiden Terroranschlägen rund um die Welt. Kann US-Präsident Jack Ryan den skrupellosen Drahtzieher zur Strecke bringen – oder stürzt das gestörte Gleichgewicht der Kräfte die Welt ins bodenlose Chaos?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 978
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
TOM
CLANCY
UND
MARK GREANEY
DIE MACHT DES
PRÄSIDENTEN
THRILLER
Aus dem Amerikanischen von Karlheinz Dürr
und Reiner Pfleiderer
Das Buch
Eine schwimmende Erdgasanlage vor der litauischen Küste explodiert nach einem Bombenanschlag. Ein venezolanischer Staatsanwalt wird gemeuchelt. Bei einem Handstreich gegen einen russischen Truppenzug gibt es Dutzende Tote. Eine anarchische Welt ist die beste Tarnung, den eigentlichen Plan mit scheinbar zusammenhanglosen Übergriffen zu verschleiern. Nur ein Mann erkennt das Muster hinter all den perfiden Terroranschlägen rund um die Welt. Kann US-Präsident Jack Ryan den skrupellosen Drahtzieher zur Strecke bringen – oder stürzt das gestörte Gleichgewicht der Kräfte die Welt ins bodenlose Chaos?
Nicht selten wurden Tom Clancys gedankliche Planspiele von der Realität eingeholt.
Die Autoren
Tom Clancy hatte mit seinem ersten Thriller, Jagd auf Roter Oktober, auf Anhieb internationalen Erfolg. Der Meister des Techno-Thrillers stand seitdem mit allen seinen großen Büchern an der Spitze der internationalen Bestsellerlisten. Tom Clancy starb im Oktober 2013.
Mark Greaney hat Internationale Beziehungen und Politikwissenschaften studiert. Als Koautor von Tom Clancy hat er zu Recherchezwecken mehr als 15 Länder bereist und an Militär- und Polizeiübungen teilgenommen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
Commander In Chief
bei G.P. Putnam’s Sons, New York.
Copyright © 2015 by The Estate of Thomas L. Clancy, Jr.;
Rubicon Inc.; Jack Ryan Enterprises, Ltd.; Jack Ryan Limited Partnership
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Werner Wahls
Covergestaltung: © Nele Schütz Design Covermotiv: Shutterstock (Ivan Cholakov, freelanceartist, Bestpix)
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-20648-2 V003
www.heyne.de
Hauptpersonen
Regierung der Vereinigten Staaten
JACK RYAN: Präsident der Vereinigten Staaten
SCOTT ADLER: Außenminister
MARY PAT FOLEY: Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste
ROBERT »BOB« BURGESS: Verteidigungsminister
JAY CANFIELD: Direktor der Central Intelligence Agency (CIA)
DAN MURRAY: Justizminister
ARNOLD VAN DAMM: Stabschef des Präsidenten
PETER BRANYON: CIA-Stationschef in Vilnius, Litauen
GREG DONLIN: CIA-Personenschützer
Militär der Vereinigten Staaten
ADMIRAL ROLAND HAZELTON: United States Navy, Admiralstabschef der Navy
COMMANDER SCOTT HAGEN: United States Navy, Kapitän der USS James Greer
LIEUTENANT COMMANDER PHIL KINCAID: United States Navy, Erster Offizier der USS James Greer
LIEUTENANT DAMON HART: United States Navy, Waffenoffizier der USS James Greer (DDG-102)
LIEUTENANT COLONEL RICHARD »RICH« BELANGER: United States Marine Corps; Bataillonskommandeur der Rotationstruppe Schwarzes Meer
Der Campus
GERRY HENDLEY: Direktor von Hendley Associates/Direktor des Campus
JOHN CLARK: Operationsleiter
DOMINGO »DING« CHAVEZ: Leitender Außenagent
DOMINIC »DOM« CARUSO: Außenagent
JACK RYAN JR.: Außenagent/Analyst
GAVIN BIERY: Leiter der IT-Abteilung
ADARA SHERMAN: Logistik- und Transportleiterin
Die Russen
WALERIJ WOLODIN: Präsident der Russischen Föderation
MICHAIL »MISCHA« GRANKIN: Sekretär des Sicherheitsrats im Kreml (russischer Geheimdienst)
ARKADIJ DIBUROW: Aufsichtsratsvorsitzender des russischen Erdgasunternehmens Gazprom
ANDREJ LIMONOW (IWANOW): russischer Private-Equity-Manager
WLAD KOSLOW (POPOW): Geheimagent des Sicherheitsrats im Kreml.
JEGOR MOROSOW: Geheimagent des Sicherheitsrats im Kreml
TATJANA MOLCHANOWA: Nachrichtenmoderatorin des Senders Nowaja Russia (Kanal sieben)
Weitere Personen
MARTINA JAEGER: niederländische Auftragskillerin
BRAAM JAEGER: niederländischer Auftragskiller
TERRY WALKER: Präsident und Geschäftsführer von BlackHole Bitcoin Exchange, Kryptowährungshändler
KATE WALKER: Ehefrau von Terry Walker
NOAH WALKER: Sohn von Terry und Kate Walker
Eglė Banytė: Präsidentin Litauens
Marion SchÖngarth: Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland
SALVATORE: italienischer Paparazzo
CHRISTINE VON LANGER: ehemalige CIA-Mitarbeiterin
HERKUS ZARKUS: litauischer Glasfasertechniker; Milizsoldat
LINUS SABONIS: Direktor des Litauischen Departement für Staatssicherheit
Akronyme und Abkürzungen
ARAS: Litauische Anti-Terror-Polizei
ASROC: Rakete zur U-Boot-Bekämpfung
ASW: Anti-Submarine Warfare, U-Boot-Abwehr
CIA: Central Intelligence Agency
CIWS: Nahbereichsverteidigungssystem
CNO: Chief of Naval Operations, Admiralstabschef der Navy
DIA: Defense Intelligence Agency, militärischer US-Nachrichtendienst
FSB: Federalnaja Sluschba Besopasnosti, russischer Inlandsgeheimdienst
JSOC: Joint Special Operations Command, teilstreitkräfteübergreifende Kommandoeinrichtung der US-Streitkräfte
NATO: North Atlantic Treaty Organisation, Nordatlantikpakt-Organisation
NGA: National Geospatial-Intelligence Agency, Nationale Agentur für Geografische Aufklärung
NSA: National Security Agency, Nationale Sicherheitsbehörde
ODNI: Office of the Director of National Intelligence, Büro des Direktors der nationalen Nachrichtendienste
ONI: Office of Naval Intelligence, Nachrichtendienst der US Navy
RAT: Remote Administration Tool, Fernwartungssoftware
SAU: Search and Attack Unit, Such- und Angriffseinheit
SIPRNet: Secret Internet Protocol Router Network, geheimes Computernetzwerk der amerikanischen Nachrichtendienste
TAC: Tactical Air Controller, Fliegerleitoffizier
TAO: Tactical Action Officer, Taktischer Einsatzoffizier
USWE: Undersea Warfare Evaluator, Controler für Unterwasser-Gefechtsführung
VJTF: Very High Readiness Joint Task Force, Einsatzgruppe mit sehr hoher Einsatzbereitschaft der Nato
Prolog
Die Norweger verkauften ihren geheimen U-Boot-Stützpunkt an die Russen, und zwar über eBay.
Kein Scherz.
Tatsächlich wurde die Transaktion über Finn.no, das regionale Pendant zu der Online-Handelsplattform, abgewickelt, und der Käufer war nicht der Kreml, sondern ein Privatmann, der die Anlage umgehend an einen russischen Staatskonzern verpachtete. Gleichwohl war der Stützpunkt die einzige nichtrussische militärische Dauereinrichtung an der strategisch wichtigen Barentssee, und allein die Tatsache, dass die Nato den Kauf überhaupt duldete, sagte alles über die Kriegsbereitschaft des Bündnisses.
Und der Vorgang verriet auch einiges über die russischen Absichten. Als der Käufer auf »kaufen« klickte, trat Norwegen den Stützpunkt der Königlich Norwegischen Marine Olavsvern für rund fünf Millionen Dollar ab, also für ein Drittel des Preises, den das Land eigentlich verlangt hatte, und für ein mickriges Prozent dessen, was die Nato einst in seinen Bau gesteckt hatte.
Mit diesem Geschäft schlugen die Russen zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie erwarben eine strategisch günstig gelegene Anlage, die sie nach Belieben nutzen konnten, und entzogen sie gleichzeitig dem Zugriff des Westens.
Olavsvern ist ein imposanter Komplex wie aus einem James-Bond-Film. Nördlich des Polarkreises nahe der Stadt Tromsø in eine Bergflanke gehauen, bietet er direkten Zugang zum Meer und verfügt über ein unterirdisches Tunnelsystem, massive U-Boot-Bunker mit sprengsicheren Toren, ein Trockendock, das große Kriegsschiffe aufnehmen kann, einen 3000 Quadratmeter großen Tiefwasserkai, Mannschaftsquartiere mit Notstromversorgung und 15 000 Quadratmeter Landfläche, die, da tief in den Fels getrieben, gegen einen direkten Atomangriff geschützt sind.
Zum Zeitpunkt des Verkaufs verdrehten die Befürworter – darunter auch der norwegische Ministerpräsident – jedes Mal die Augen, wenn jemand das Geschäft als unklug kritisierte: Der Käufer habe versprochen, dass die Russen die Einrichtung zur Versorgung ihrer Ölplattformen nutzen würden – schließlich bohrten sie überall in der Barentssee, sodass daran nichts Verwerfliches sei. Doch die Tinte unter dem Vertrag war kaum trocken, da war die Ölindustrie auch schon vergessen, und die gewaltige U-Boot-Höhle nahm eine Flotte von Forschungsschiffen auf, die im Auftrag eines von Kreml-Insidern geführten Staatskonzerns unterwegs waren. Und Kenner der russischen Kriegsmarine und der nachrichtendienstlichen Infrastruktur in der Arktis wussten, dass Forschungsschiffe häufig Hand in Hand mit Kreml und Staatskonzernen arbeiteten, Überwachungsmaßnahmen durchführten und sogar Mini-Kampf-U-Boote in internationalen Gewässern manövrieren ließen.
Der norwegische Ministerpräsident, der den Handel gebilligt hatte, schied bald darauf aus dem Amt und wurde neuer Nato-Generalsekretär. Wenig später versetzten die Russen ihre Nordflotte in volle Gefechtsbereitschaft und verstärkten ihre Aktivitäten in der Barentssee um das Fünffache gegenüber den letzten Tagen, als Olavsvern noch ein wachsames Auge auf sie gehabt hatte.
Der russische Präsident Walerij Wolodin stand mit zufriedener Miene in der arktischen Kälte, denn er dachte gerade an Olavsvern, obwohl er sich rund 400 Kilometer weiter östlich befand.
Es war ein verheißungsvoller Morgen hier in der Sajda-Bucht, der Heimat der 31. U-Boot-Division, und Wolodin dachte deshalb an den großen Stützpunkt in Norwegen, weil er sich völlig darüber im Klaren war, dass die heutige Operation nicht die geringsten Erfolgsaussichten gehabt hätte, wäre Olavsvern noch von der Nato betrieben worden.
Der russische Präsident stand im Bug der Pjotr Weliki, eines atomgetriebenen Raketenkreuzers der Kirow-Klasse, der das Flaggschiff der Nordflotte bildete. Er trug einen Burberry-Mantel, der bis oben hin zugeknöpft war, und eine Wollmütze, die dafür sorgte, dass ein Großteil der Körperwärme dort blieb, wo sie hingehörte, nämlich im Körper. Direkt hinter ihm stand der Kommandeur der 31. U-Boot-Division und deutete in den Nebel vor ihnen. Wolodin sah zunächst nichts, doch als er angestrengter spähte, bemerkte er einen riesigen Schatten, der sich aus den morgendlichen Dunstschleiern schälte.
Etwas Großes glitt gemächlich und geräuschlos in ihre Richtung.
Wolodin musste an einen bestimmten Augenblick beim Kauf von Olavsvern denken. Norwegische Medienvertreter hatten die für die Genehmigung des Deals zuständigen Minister in Erklärungsnot gebracht, als sie auf die Gefahr hinwiesen, die vom Nachbarn Russland ausgehe. Ein freimütigerer Minister hatte schulterzuckend geantwortet: »Wir sind Mitglied der Nato, aber wir sind auch ein kleines und friedliches Land. Amerika hingegen ist groß und kriegerisch. Jack Ryan wird Norwegens Sicherheit gewährleisten, falls es eines Tages nötig sein sollte. Was spricht dagegen, dass wir unser Geld für die wirklich wichtigen Dinge ausgeben und es Amerika überlassen, für uns zu kämpfen, wo es das doch so gerne tut?«
Wolodin schmunzelte jetzt, während er in den Nebel über dem grauen Wasser blickte. Jack Ryan würde keine Zeit für Norwegen haben. Schon wahr, der amerikanische Präsident liebte den Krieg, und eine Bedrohung Skandinaviens wäre ihm Vorwand genug, doch Wolodin wusste etwas, was nur wenige auf der Welt wussten, am wenigsten Jack Ryan.
Auf Amerika kam jede Menge Arbeit zu. Nicht hier in der Arktis, aber sonst fast überall.
Der lautlos nahende Schatten nahm langsam Gestalt an, und bald war er für alle an Deck der Pjotr Weliki zu erkennen. Es handelte sich um den Stolz der neuen russischen Kriegsmarine. Ein großes, neues, mit ballistischen Raketen bewaffnetes Atom-U-Boot der Borei-Klasse.
Hätte die Nato hier in der Arktis noch einen Stützpunkt unterhalten, so wäre das Boot möglicherweise bemerkt und von westlichen Schiffen über und unter Wasser verfolgt worden, bevor es sichere tiefere Gewässer erreicht hätte. Und das wäre aus Sicht des russischen Präsidenten jammerschade gewesen. Umso schöner, dass die Norweger ihre strategisch bedeutsame Basis für einen Appel und ein Ei verscherbelt hatten.
Wolodin strahlte vor Zufriedenheit. Fünf Millionen Dollar waren ein Schnäppchenpreis für die russische Seeherrschaft in der Arktis.
Das neue U-Boot hatte natürlich einen Namen, es hieß Knjas Oleg. Aber Wolodin bevorzugte für dieses wie auch für die vier anderen, die bereits im Dienst der Flotte standen, den ursprünglichen Code-Namen. »Projekt 955A« klang irgendwie gut und war für seinen Geschmack eine passende Bezeichnung für Russlands mächtigste und geheimste Waffe.
Dieses Boot der Borei-Klasse stand für die vierte Generation von strategischen, atomgetriebenen Unterwasserkreuzern, die von den Amerikanern SSBN genannt wurden (Ship Submersible Ballistic Nuclear). Mit seinen 170 Metern Länge und 13 Metern Breite war es sehr groß, wenn auch nicht das größte U-Boot, das Wolodin je gesehen hatte. An Größe wurde es von Booten der Typhoon-Klasse, einer der Vorgängerinnen der Borei, noch übertroffen. Dafür war die Knjas Oleg weitaus moderner. Sie konnte bis zu 480 Meter tief tauchen und unter Wasser bis auf 30 Knoten beschleunigen. Außerdem ermöglichte ihr der Wasserstrahlantrieb eine, wie U-Boot-Fahrer sagen, hohe Schleichfahrtgeschwindigkeit, was bedeutete, dass sie bei sehr geringer Geräuschentwicklung schnelle Fahrt machen konnte und deshalb verdammt schwer aufzuspüren war.
Die meisten ihrer neunzig Besatzungsmitglieder einschließlich Kapitän Anatolij Kudinow standen jetzt an Deck und salutierten ihrem Präsidenten, als sie an der Pjotr Weliki vorbeifuhren.
Projekt 955A war den Amerikanern kein Geheimnis, allerdings kannten sie weder die genaue Anzahl noch die Leistungsfähigkeit dieser Boote, noch wussten sie, dass die Knjas Oleg bereits in Dienst gestellt war. Wolodin war sich sicher, dass schon bald, und zwar etwas weiter nördlich in den eisigen Gewässern der Kola-Bucht, ein amerikanischer Satellit registrieren würde, dass ein Boot der Borei-Klasse den schützenden Hangar verlassen hatte und aus der Sajda-Bucht auf die Barentssee hinaussteuerte.
Aber das spielte keine Rolle. Es dürfte ein paar Stunden dauern, bis die Amerikaner realisierten, dass sie die Knjas Oleg vor sich hatten, dann aber würden sie das Interesse verlieren, da sie nicht ahnten, dass das neueste Boot der Borei-Klasse bereits im operativen Einsatz für die Flotte war. Tagelang würden sie glauben, es unternehme lediglich eine weitere Probefahrt, aber dabei würde es nicht bleiben, denn Wolodin hatte nicht die Absicht, diese Mission zu verheimlichen.
Nein … Wolodin schickte dieses U-Boot auf eine Einschüchterungsmission, und deren Erfolg hing davon ab, dass alle Welt erfuhr, worum es dabei ging und wo sich das Geschehen in etwa abspielte.
Ebenfalls hinter Wolodin an Deck des schweren Raketenkreuzers stand, umringt von seinen Stellvertretern, der kommandierende Admiral der 12. Hauptverwaltung des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation. Als Verantwortlicher für alle seegestützten Kernwaffenkräfte war er heute hierhergekommen, um nicht nur der Knjas Oleg eine gute Fahrt zu wünschen,sondern auch den Kampfmitteln, die in den Waffenkammern des U-Boots geladen waren.
An Bord des schwimmenden Titans, der jetzt in nur 100 Meter Entfernung an Präsident Wolodin vorüberglitt, befanden sich ein Dutzend ballistische Bulawa-Raketen, die mit jeweils zehn nuklearen Gefechtsköpfen bestückt waren. Sie befähigten die Knjas Oleg, 120 Atomexplosionen auszulösen, sodass sich ohne allzu große Übertreibung sagen ließ, dass das U-Boot in der Lage war, die Vereinigten Staaten von Amerika in ein rauchendes Trümmerfeld von der Größe eines Kontinents zu verwandeln.
Allerdings nur wenn es nahe genug an die Ostküste der USA herankam, um das amerikanische Raketenabwehrsystem zu unterlaufen. Wolodin sprach leise in die kalte Morgenluft, in der sich seine Worte in Dampf verwandelten. »Amerika. Washington, D. C.«
Die Männer, die hinter ihm im Bug standen, sahen einander an. Falls dies ein Befehl war, so erübrigte er sich. Jeder wusste, dass die Knjas Oleg das Zielhatte, bis auf mindestens 45 Meilen an die Hauptstadt des Gegners heranzukommen.
Nun hatte Wolodin keineswegs die Absicht, die Vereinigten Staaten in Schutt und Asche zu legen, auch wenn er 120 Atomsprengköpfe in ihre Hoheitsgewässer schickte. Doch er war fest entschlossen, die amerikanische Bevölkerung – Männer, Frauen und Kinder – in Angst und Schrecken zu versetzen und ihr auf diese Weise klarzumachen, dass Russlands territoriale Integritätviele TausendKilometer von ihrer Heimat entfernt sie einen feuchten Kehricht anging.
Wolodins Plan, der in den folgenden Wochen in die Tat umgesetzt werden sollte, war umfangreich, doch die Entsendung der Knjas Oleg war sein Eröffnungszug auf dem Schachbrett, und aus diesem Grund war er den weiten Weg hierher in die Arktis geflogen, um Kapitän Kudinow seinen Respekt zu zollen und den Männern durch seine Anwesenheit die Bedeutung der Mission vor Augen zu führen.
Das Boot, das Wolodin gerne »Projekt 955A« nannte, verschwand nun wieder lautlos im Nebel, kurz nachdem es, aus der Sajda-Bucht kommend, in die Kola-Bucht gesteuert war. Walerij Wolodin starrte weiter in die wabernden Nebelschwaden, und seine Militärführer sahen ihm dabei zu.
Die Empfindungen, die sein Gesicht ausdrückte – Stolz und Erregung –, waren echt, doch in seinem Innern regte sich auch ein anderes Gefühl, das er sich keinesfalls anmerken lassen wollte.
Besorgnis. An Angst grenzende Besorgnis.
Der heutige Tag stellte nur eine einzelne Facette dar, das Boot nur ein einzelnes bewegliches Teil eines komplizierten Mechanismus, einer facettenreichen Operation, die den gesamten Globus umspannen sollte.
Walerij Wolodin blickte stolz und hoffnungsfroh in die Zukunft, doch gleichzeitig war er sich darüber im Klaren, dass diese Sache klappen musste.
Sie musste klappen, sonst war er ein toter Mann.
1
Die Independence war ein Schiff, doch ihre Aufgabe bestand nicht darin, von hier nach da zu fahren. Stattdessen lag sie im Hafen von Klaipėda an der litauischen Küste vor Anker, und dort blieb sie auch, durch Befestigungs- und Verankerungsvorrichtungen, stählerne Verbindungsbrücken und eine massive Pipelinemit einer langen Pier verbunden.
Ein Jahr zuvor war der Supertanker unter großem Trara in den Hafen eingelaufen, denn jeder wusste, dass er für die Litauer eine Wende einläuten würde. Und obwohl er jetzt ortsfest im Wasser dümpelte und nicht mehr viel von einem Schiff hatte, hatte er seine Aufgabe erfüllt.
Independence war nicht nur ein Name, dieser Name war auch Programm. Die »Unabhängigkeit« war eine schwimmende Anlage zur Lagerung und Wiederverdampfung von verflüssigtem Erdgas (Liquified Natural Gas, LNG), die erste ihrer Art.
Jahrzehntelang war Litauen von russischem Gas und Strom abhängig gewesen. Nach Lust und Laune und je nach politischer Wetterlage hatte Russland den Gaspreis erhöhen oder die Liefermenge drosseln können. Dies hatte es in den letzten Jahren mehrmals getan, und mit den zunehmenden Spannungen zwischen den baltischen Staaten und Russland war offenkundig geworden, dass Litauens Abhängigkeit vom Wohlwollen des Nachbarn eine Gefahr für die Sicherheit des Landes darstellte.
Eine LNG-Importanlage sollte das ändern. Dank der Independence und der Hafen-Pipeline konnte verflüssigtes Erdgas aus Norwegen per Tanker angeliefert, in die Wiederverdampfungsanlage gepumpt und dort in das im Land benötigte Gas umgewandelt werden. Sollten die Russen also wieder einmal den Hahn ihrer Gas-Pipelines zudrehen oder den Preis in horrende Höhen treiben, brauchten Litauen und seine verbündeten Nachbarn nur auf die Ausweichmöglichkeit zurückzugreifen, die ihnen die Independence bot.
Die Wiederverdampfung von Flüssigerdgas ist ein komplexer und technisch anspruchsvoller Prozess, aber überraschend leicht zu verstehen. Damit eine größere Gasmenge transportiert werden kann, muss sie verflüssigt, sprich um den Faktor 600 verdichtet werden. Zu diesem Zweck wird das Erdgas auf minus 160 °C heruntergekühlt. Bei dieser Temperatur wird die verflüssigte Form des Rohstoffs in speziell dafür ausgelegten Tankschiffen transportiert, im vorliegenden Fall von Norwegen nach Litauen. Dort wird das LNG in die Speichertanks der Independence gepumpt, wo das Wiederverdampfungssystem die Flüssigkeit mittels Propan und Meerwasser erwärmt und in den Gaszustand zurückverwandelt. Über Rohre wird das Gas durch den Hafen von Klaipėda und dann durch eine 18 Kilometer lange Pipeline zur Messanlage geleitet. Von dort geht es direkt an die litauischen Haushalte und versorgt sie mit der in den langen baltischen Wintern dringend benötigten Heizenergie.
Das 330-Millionen-Dollar-Projekt erfüllte schon aus rein ökonomischer Sicht seinen Zweck. Am selben Tag, als die Independence den Betrieb aufnahm, senkte Russland seinen Gaspreis, um mit dem norwegischen Gas konkurrieren zu können.
Aber zu sagen, dass die Russen darüber nicht glücklich waren, wäre eine starke Untertreibung gewesen. Konkurrenz bei Energieexporten in Europa war Moskau ein besonderer Dorn im Auge. Es hatte sich an sein Monopol gewöhnt und es dazu benutzt, seine Nachbarn unter Druck zu setzen, das Land reich zu machen und, am wichtigsten von allem, die zahlreichen wirtschaftlichen Probleme Russlands zu übertünchen. In typischer Übertreibung hatte sich der russische Präsident Walerij Wolodin sogar zu der Behauptung verstiegen, dass die Inbetriebnahme der LNG-Anlage einem kriegerischen Akt gleichkäme.
Litauen war, wie viele andere ehemalige sowjetische Satellitenstaaten, harsche Töne aus Moskau gewohnt, sodass die Regierung in Vilnius Wolodins Drohungen einfach ignorierte und große Mengen Erdgas über russische Pipelines und kleinere Mengen norwegisches LNG per Schiff über die Ostsee importierte, und die Independence diente den anderen Staaten der Region gewissermaßen als Vorbild bei der Entwicklung von Alternativen in der Energieversorgung.
Das übrige Europa hatte beim Bau und bei der Lieferung der Independence an Litauen die Hand im Spiel gehabt. Stabilität in der Region lag schließlich in allseitigem Interesse, und Nato-Staaten, die von Russland mithilfe von Energieexporten unter Druck gesetzt oder regelrecht erpresst werden konnten, bildeten ein schwaches Glied in der Kette.
Daher galt die Formel: Solange Litauen in puncto Energie auf die Independence setzte, setzte Europa als Ganzes in puncto Sicherheit auf die Independence.
Ein deutscher Elektroinstallateur mittleren Alters entdeckte beim Gang über die Pier eine im Wasser treibende Leiche, und das rettete ihm das Leben.
Er war am frühen Morgen zur Arbeit gekommen, um fehlerhafte Schaltkreise in der Entladepumpstation zu reparieren, stand dann aber mit seinem Kleinlaster vor einem verschlossenen Tor. Überzeugt, dass er schneller in der Pumpstation war, wenn er zu Fuß weiterging, statt zu warten, bis jemand mit einem Schlüssel kam, machte er sich auf den Weg über die 420 Meter lange Pier, wobei der Ärger darüber, dass sich der Morgen alles andere als gut anließ, seine Schritte beschleunigte. Er hatte erst ein Viertel der Strecke zurückgelegt, als er nach links blickte und dort, wo der Scheinder Pierbeleuchtung endete, etwas im Wasser dümpeln sah.
Zunächst hielt er es für ein größeres Stück Treibgut, doch er blieb stehen, um sich zu vergewissern. Er trat an das Geländer, zog eine Stirnlampe aus seinem Rucksack, knipste sie an und leuchtete, sie mit beiden Händen haltend, aufs Wasser hinaus.
Ein Taucher im Neoprenanzug und mit silberner Sauerstoffflasche auf dem Rücken trieb, Arme und Beine von sich gestreckt, mit dem Gesicht nach unten im Wasser.
Der deutsche Elektriker sprach wenig Litauisch, rief aber trotzdem: »Labas! He! Labas?«
Der Taucher, gut 20 Meter von der Pier entfernt, reagierte nicht. Beim genaueren Hinsehen bemerkte der Elektriker, dass lange blonde Haare den Kopf umschlingerten und die Gestalt eher klein und schmal war. Wahrscheinlich eine Frau, und eine ziemlich junge.
Er kramte umständlich nach seinem Walkie-Talkie, doch als er es endlich heraushatte, fiel ihm ein, dass noch gar niemand auf seinem Kanal sein würde, da die Kollegen erst in etwa einer Stunde auftauchen würden. Und da er obendrein vergessen hatte, welcher Kanal für Notrufe genutzt wurde, rannte er über die Pier zurück in Richtung Hafenpolizeirevier.
Diese in Panik getroffene Entscheidung machte den deutschen Elektriker zum Glückspilz des Jahres in Litauen.
Mehrere Hundert Meter von dem aufgeregten Elektriker entfernt lag die Independence an diesemkalten Oktobermorgen im ruhigen, dunklen Wasser, ins Licht der Deckbeleuchtung getaucht und an den Schiffsanleger mit der Pumpstation angedockt.
Schiff und Anleger waren nicht etwa mit dem litauischen Festland verbunden, sondern mit der Insel Kiaulės Nugara im Kurischen Haff an der Hafeneinfahrt von Klaipėda. Im Wasser darum herum herrschte tagsüber starker Hafenverkehr, doch jetzt, acht Minuten nach vier in der Frühe, war der Bereich zwischen der LNG-Anlage und dem Seetor an der Haffmündung leer bis auf zwei kleine Festrumpfschlauchboote, die langsam und nahezu geräuschlos das Wasser durchkreuzten. Die Sicherheitsleute in den Booten hatten keine Ahnung, dass der Elektriker über die Pier rannte, denn der riesige Supertanker versperrte ihnen die Sicht auf den Mann.
Die Boote fuhren bei ihrer Patrouille im Abstand von 20 Metern aneinander vorbei. Die Männer an Bord tauschten übers Wasser hinweg Blicke, doch im Lauf einer Schicht kamen sie so häufig dicht aneinander vorbei, dass sie nicht jedes Mal Grüße riefen oder winkten.
Hier im Hafen galten relativ strenge Sicherheitsvorschriften, und man hatte alle möglichen Vorkehrungen gegen Terroranschläge vom Meer oder vom Land her ergriffen. Doch wenn die Wachleute in der Pumpanlage, auf der Insel, auf der Independence und in den Patrouillenbooten auch einigermaßen wachsam waren, so glaubte doch keiner, dass etwas Ernstes passieren könnte.
Nun ja, letzten Monat waren Demonstranten in kleinen Holzkähnen aufgekreuzt und durch das Seetor auf die Anlage zugefahren. Sie schwenkten bunte Protestschilder, auf denen ein Ende der Globalisierung gefordert wurde, und einer rief den Hafenarbeitern durch ein Megafon Schmähungen zu. Außerdem führten sie mit Öl gefüllte Milchkannen mit, die sie auf den Supertanker zu schleudern gedachten, um die Dringlichkeit ihres Anliegens zu veranschaulichen.
Den Demonstranten war offenbar nicht ganz klar gewesen, womit sie es zu tun hatten. Es war ihnen gleichgültig, dass die Anlage Erdgas und nicht Öl aufbereitete und dass ihr mitgebrachtes Öl unweigerlich im Wasser landen würde.
Natürlich hatten die beiden Patrouillenboote die Holzkähne aufgebracht und die Demonstranten festgenommen, bevor sie nahe genug an den Supertanker herankamen, um ihm in irgendeiner Weise gefährlich werden zu können.
Solche Aktionen waren die größte Bedrohung, die sich die Sicherheitsleute vorstellen konnten, denn die Independence war ein unglaublich robustes Schiff. Sie besaß eine doppelte Außenhaut aus Stahl, und das tiefgekühlte LNG im Innern wurde von wärmeisolierten Membrantanks geschützt. Eine vom Ufer aus von Hand abgefeuerte Panzerabwehrgranate, Molotow-Cocktails oder unkonventionelle Spreng- und Brandsätze konnten dem Kasten wenig anhaben.
Voll beladen mit 170000 Kubikmetern Flüssiggas, barg die Independence die Energie von 55 Atombomben, doch ihre Tanks enthielten nur ein Achtel des maximalen Fassungsvermögens, und noch einmal: Es bedurfte schon einer Bombe von enormer Sprengkraft, um die Bordwand zu durchbrechen und das Gas zu entzünden.
Die Patrouillenboote fuhren im Abstand von nur etwa 200 Metern östlich an dem LNG-Tanker vorbei, doch es herrschte ungewöhnliche Dunkelheit. Die Männer in den Booten hätten übermenschlich scharfe Augen besitzen müssen, um zu sehen, dass vor ihnen etwas Ungewöhnliches geschah. Und so fuhren beide Boote weiter. Das eine nach Norden, das andere nach Süden.
In ihrem Kielwasser stiegen mehrere Reihen kleiner Luftblasen an die dunkle Wasseroberfläche, wo sie sich rasch verflüchtigten. Die Wachboote hatten nichts bemerkt und setzten ihre Patrouille einfach fort.
Am Ende der Pier hielt der Elektriker einen Sicherheitsbeamten in einem Pick-up an und erklärte ihm in gebrochenem Englisch, dass er im Haff eine Frauenleiche entdeckt habe. Der Beamte reagierte skeptisch, aber respektvoll. Er forderte den Deutschen auf, in den Wagen zu steigen und ihn zu der Stelle auf der Pier zu dirigieren.
Der Elektriker hatte gerade die Tür geschlossen, da veranlasste ein Lichtblitz die beiden Männer, durch die Windschutzscheibe nach vorn zu dem riesigen Schiff zu blicken. Ein Leuchten stieg von der Rückseite des Tankers empor, sodass er sich als dunkle Silhouette dagegen abhob, dann schoss eine Stichflamme in den Himmel, zerriss die Dunkelheit, und ein Feuerball machte die Nacht zum Tag.
Der Sicherheitsbeamte am Steuer des Pick-ups wusste ganz genau, dass die Independence trotz ihrer robusten Bauweise im Grunde genommen eine riesige Bombe war. Er warf den Rückwärtsgang ein, trat aufs Gaspedal und raste 200 Meter zurück, buchstäblich verfolgt von einer Serie donnernder Explosionen, die die Pier erschütterten und Trümmerteile und Druckwellen in alle Richtungen sandten.
Schließlich rutschte der Pick-up rückwärts in den Straßengraben neben der Zufahrt zur Anlage. Wachmann und Elektriker sprangen aus dem Wagen und warfen sich in den Schlamm.
Sie spürten die Hitze über sich, hörten einen Splitterregen ringsum niederprasseln, hörten die Sirenen von der Pier, vor allem aber hörten sie das donnernde Ende von Litauens neuem Hoffnungsträger.
Das Bekennerschreiben der Täter gelangte auf dem heute üblichen Weg an die Öffentlichkeit: Ein Twitter-Account wurde angemeldet und nur ein einziger Tweet gepostet. Dieser war mit einem neunminütigen Video verlinkt, das mit der Nachtaufnahme einer Gruppe von vier maskierten Männern und einer Frau begann, die offenbar irgendwo an einer dunklen Landstraße standen.
Das minderwertige Nachtsicht-Objektiv der Kamera verlieh den Bildern eine gespenstische Wirkung, als die fünf Personen durch einen Wald schlichen, doch für Militärexperten bewegten sie sich weniger wie ausgebildete Spezialkräfte als wie spielende Kinder. Ein Mann durchschnitt mit einem Bolzenschneider einen Stacheldrahtzaun, dann schlüpfte er mit den anderen durch das Loch, direkt neben einem Schild mit der Aufschrift:
ZONE PROTÉGÉ
Weiteres Umschleichen von Asphaltstraßen und Betongebäuden, ein wackeliger Zoom auf einen Wachposten, der in der Ferne auf einem Turm saß. Dann wurde mit dem Bolzenschneider eine Kette an einem Frachtcontainer durchtrennt, und bald schleppten die fünf Vermummten Kisten durch das Loch im Stacheldrahtzaun.
Schließlich ein hell erleuchteter Raum, in dem die fünf Kisten nebeneinander aufgereiht auf dem Boden standen, mit geöffneten Deckeln. Jede Kiste enthielt ein halbes Dutzend brotlaibgroße Pakete. Die einzig erkennbare Beschriftung auf den Paketen lautete Composition Four.
Wieder hätte jeder Militär ohne Mühe erkannt, dass es sich um C4 handelte, einen militärischen Plastiksprengstoff.
Und um eine beträchtliche Menge.
Eine Frau sprach Englisch mit französischem Akzent. Sie hielt etwas in die Höhe, das sie als Sprengkapsel bezeichnete, und behauptete, dass sämtliche Utensilien amerikanischer Herkunft und aus einem Nato-Lager in Frankreich entwendet worden seien.
Dann erneuter Szenenwechsel. Die Kamera war wieder draußen im Dunkeln und lieferte grieselig grüne Nachtaufnahmen. Fünf Menschen in Taucheranzügen mit Schnorchelmasken knieten am Rand eines Gewässers, neben ihnen stapelten sich Sauerstoffflaschen und Westen. Durch ein Teleobjektiv nahm die Kamera wackelige Bilder der Independence, der LNG-Anlage und des Hafens dahinter auf.
Eine Nahaufnahme des Ufers zeigte neben den Tauchern ein couchtischgroßes, vollständig in schwarzen Kunststoff gehülltes Objekt. Mit Gurten seitlich daran festgeschnallt waren mehrere Taucherwesten und oben eine Tauchflasche. Eine andere Frauenstimme sprach jetzt aus dem Off und erläuterte die Szene. Wie Behörden später feststellten, wies ihr Akzent darauf hin, dass sie aus Barcelona stammte.
»Der Sprengkörper wurde durch die daran befestigte Tauchausrüstung schwimmfähig gemacht. Die Revolutionäre ließen ihn zu Wasser und tauchten ihn so tief ein, dass er unter der Oberfläche verschwand. Dann brachten sie ihn in das über einen Kilometer entfernte Ziel.«
Die fünf verschwanden in der Dunkelheit, wobei sie den Sprengkörper im Wasser vor sich herschoben.
Die Kamera blieb am Ufer zurück, dann erneuter Schnitt. Jetzt nahm die riesige Independence die Bildmitte ein, von Scheinwerfern hell erleuchtet. Mehrere Sekunden lang geschah nichts, dann blitzte an der diesseitigen Bordwand des Schiffes eine Explosion auf, Flammen schlugen empor, sekundäre und tertiäre Detonationen folgten, von denen einige die Person an der Kamera, die aus sehr großer Entfernung gefilmt haben musste, merklich zusammenzucken ließen.
Am Ende des Videos wurden die Fernaufnahmen von der Zerstörung der litauischen Flüssiggasanlage abrupt durch das Bild einer Person ersetzt, die an einem kleinen Tisch saß. Ihr Gesicht war mit einer Skimaske vermummt, doch die sichtbaren Hautpartien um den Mund und die zierliche Statur ließen vermuten, dass es sich um eine weiße und wohl auch junge Frau handelte.
An der Wand hinter ihr hing eine weiße Flagge. In der Mitte der Flagge prangte ein Kreis, der offensichtlich den Planeten Erde darstellte und von einem Gewirr von Pipelines durchzogen war. Oben ragte ein Ölbohrturm aus dem Kreis, unten hing ein roter Tropfen, der vermutlich Blut symbolisierte.
Am unteren Flaggenrand stand Le Mouvement pour la Terre.
Die Bewegung für die Erde.
Die Frau sprach englisch. Ermittler sollten später herausfinden, dass es sich um die Frau mit dem katalanischen Akzent handelte, die einen Teil des Videos kommentiert hatte.
»Sie sind soeben Zeuge der Eröffnungssalve eines Krieges geworden. Zu lange sind gewaltsame und zerstörerische Akte der Energieindustrie gegen unseren Planeten unerwidert geblieben.
Diese Tage sind nun vorbei. Wir werden im Namen von Mutter Erde zurückschlagen.
Es wird keinen Frieden geben, bis unsere Forderungen erfüllt werden. Die Bewegung für die Erde wird für alle Beispiele von Habgier und Materialismus zulasten von Mutter Erde, die wir finden, Vergeltung üben. Wir fordern andere auf, sich unserem Kampf anzuschließen und gemeinsam mit uns dem Planeten wieder sein natürliches Gleichgewicht zurückzugeben.
Wir ehren unsere Schwester Avril, die bei der Schlacht in Litauen auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Die Öl- und Gasindustrie soll wissen: Ihr Geist leuchtet uns als eine Fackel in dem Kampf, den wir in ihrem Namen weiterführen.«
In den letzten Sekunden des Videos schwenkte die Kamera zur anderen Seite des Zimmers. Dort standen vier Männer und Frauen, alle schwarz gekleidet und maskiert, und grüßten mit erhobenen Fäusten. Mehrere trugen automatische Waffen.
Acht Stunden nach der Explosion wurde die Leiche der 24-jährigen Avril Auclair, einer französischen Staatsbürgerin und ehemaligen Studentin, aus dem dichten Ried im Haff gezogen. Sie wurde schnell identifiziert, da in dem YouTube-Video von einer »Schwester Avril« die Rede gewesen war und eine Frau dieses Namens den Behörden, die die bisweilen gewalttätige ökoterroristische Bewegung in Europa beobachteten, wohlbekannt war.
Auclair hatte auf sich aufmerksam gemacht, als sie zwei Jahre zuvor von Greenpeace ausgeschlossen worden war und daraufhin die Pariser Büroleiterin der Organisation mit Faustschlägen traktiert hatte. Laut Polizeibericht waren Meinungsverschiedenheiten in taktischen Fragen der Grund. Auclair war für Greenpeace zu radikal gewesen und hatte sich für ihren Rauswurf dadurch bedankt, dass sie die 60-jährige Büroleiterin verprügelte. Das Opfer hatte am Ende auf eine Anzeige verzichtet, und Auclair war komplett von der Bildfläche verschwunden und sechs Monate lang nicht mehr aufgetaucht.
Eine gerichtliche Untersuchung ihres Todes ergab später, dass der Manometer ihrer Tauchflasche defekt war und eine volle Flasche angezeigt hatte, obwohl sie in Wirklichkeit leer war. Man kam zu dem Schluss, dass sie bei der Aktion unter Wasser das Bewusstsein verloren haben und dann ertrunken sein musste. Unklar hingegen blieb, warum sie so weit entfernt vom Explosionsort gefunden worden war, genau in der entgegengesetzten Richtung von der Stelle, wo die Taucher im Video ins Wasser gestiegen waren. Niemand hatte eine Erklärung dafür, wie sie an die Pier hatte getrieben werden können, es sei denn, sie war einer ganz anderen Aufgabe nachgegangen als die Gruppe, die den Sprengsatz am Rumpf des Schiffes angebracht hatte.
Doch es war ein vergleichsweise unwichtiges Rätsel, denn anhand des Videos war sie von ihrer Mutter als die erste Sprecherin identifiziert worden, und in Anbetracht des Lebens, das sie geführt hatte, überraschte es niemanden sonderlich, dass sie bei einem ökoterroristischen Anschlag den Tod gefunden hatte.
Auch die Videoaufnahmen vom Sprengstoffdiebstahl wurden kurze Zeit nach der Explosion der Independence als echt bestätigt, als französische Behörden einen bislang geheim gehaltenen Diebstahl von mehreren Hundert Pfund C4 und Zündern aus einem Militärdepot westlich von Montpellier bekannt gaben.
Europäische Polizisten und Geheimdienstbeamte eröffneten umgehend die Jagd auf eine Ökoterror-Gruppe, von der bis dato noch niemand gehört hatte.
2
Das gut aussehende holländische Paar fiel hier in Caracas auf. Beide waren groß, der Mann gut eins fünfundneunzig, die Frau fast eins achtzig. Beide hatten rotbraunes Haar in einem identischen Ton, doch während seines kurz gestylt war, wehte ihres in schulterlangen Locken im warmen Herbstwind.
Selbst hier im gehobenen und exklusiven Viertel Los Palos Grandes, in dem Touristen und betuchte ausländische Geschäftsleute zum Straßenbild gehörten, drehten sich Köpfe nach ihnen, denn sie waren besonders attraktiv und elegant. Sie trugen schicke Business-Kleidung mit einem Hauch von Extravaganz: Sie schlenkerte eine große, orangerote Hermès-Tasche, die mehr als das durchschnittliche Jahreseinkommen eines venezolanischen Arbeiters kostete, er trug eine Piaget-Uhr aus Weißgold, für die man doppelt so viel hinblättern musste, wie sie für die Tasche bezahlt hatte.
Sie waren Ende dreißig, vielleicht auch Anfang vierzig. Er wirkte etwas älter, und nach dem Ring an seiner Hand und dem mächtigen Klunker an ihrer zu urteilen, waren sie wohl verheiratet.
Sie schlenderten Arm in Arm durch den Parque del Este an der Avenida Francisco de Miranda, und sie kicherte von Zeit zu Zeit über etwas, was er sagte. Dann bogen sie ab, erklommen die Treppe zum Parque Cristal, einem 18-stöckigen, würfelförmigen Gebäude mit Blick nach Süden über die Avenida auf den Park, und steuerten auf die Eingangslobby zu, wobei sie den Blick hoben, um die bemerkenswerte Architektur zu bewundern.
Direkt hinter ihnen hielt ein Lincoln Navigator am Straßenrand, und zwei Männer stiegen aus. Einer öffnete die Tür für einen Mitfahrer auf dem Rücksitz, einen Fünfzigjährigen mit teurem Anzug und schütterem Haar. Der wuchtete erst seinen Aktenkoffer durch die Tür, dann sich selbst, und während der Lincoln sich wieder in den Verkehr nach Westen einfädelte, stiegen die drei Männer die Stufen zum Parque Cristal hinauf, nur wenige Meter hinter dem Paar aus Holland.
Der mittlere der drei Latinos hieß Lucio Vilar de Allende und mochte auf einen zufälligen Beobachter zunächst wie ein ganz normaler Geschäftsmann wirken, der in dem großen Bürogebäude zu tun hatte. Bis ihm vielleicht auffiel, dass er von zwei ernsten Männern mit offenen Jacketts und aufmerksam schweifenden Blicken flankiert wurde, und er begriff, dass der Mann in der Mitte nicht irgendwer war, denn die meisten Menschen in Caracas erkannten Leibwächter, wenn sie welche vor sich hatten. So eine Stadt war das.
Lucio Vilar hatte Personenschutz, weil er einer von Venezuelas obersten Bundesanwälten war. Heute reiste er sozusagen mit leichtem Gepäck – nur mit zwei Bodyguards, dem gepanzerten SUV und einem Fahrer mit Uzi in der Mittelkonsole –, denn er war nicht in amtlichen Geschäften unterwegs. Er hatte sich den Nachmittag freigenommen, um seinen Sohn in der Schule zu besuchen, und nun war er auf dem Weg zur Mutter seines Kindes, um mit ihr über die Schulnoten des Jungen zu sprechen.
Seine Exfrau arbeitete hier im Parque Cristal in einem Immobilienbüro und hatte eingewilligt, sich mit ihm in dem Café im Dachgeschoss zu treffen.
Vilar blickte auf seine Uhr und beschleunigte seine Schritte, und die Leibwächter blieben an seiner Seite.
Vilar dachte an Familienangelegenheiten, als er die Lobby betrat, doch das hinderte ihn nicht daran, die attraktive Frau direkt vor ihm zu bemerken. Mit ihren hohen Absätzen war sie einen Kopf größer als er und daher kaum zu übersehen. Er kam dicht hinter dem weißen Paar, das sich, wie er deutlich hören konnte, auf holländisch unterhielt, bei den Aufzügen an. Als ein Fahrstuhl kam, die Tür aufging und die beiden einstiegen, legte Vilars Chefleibwächter seinem Schützling sanft eine Hand auf den Arm. Es war ein Hinweis, lieber auf einen leeren Aufzug zu warten, doch Lucio Vilar ignorierte die Hand und folgte den Holländern, sodass sich seine Leibwächter gehorsam anschlossen.
Vilar nickte dem Paar zu, als es sich umdrehte.
»Guten Tag«, grüßte die Frau auf englisch.
»Guten Tag«, erwiderte Vilar. Sein Englisch war nicht so gut wie ihres, aber brauchbar. »Sie sind aus Holland, wie ich höre. Ich habe Amsterdam besucht. Sehr schön.«
»Genau wie Ihr Land, Señor«,sagte die Frau mit einem sympathischen Lächeln.
Einer der beiden Leibwächter drückte den Knopf für den 18. Stock und der Holländer den für den 17. Als sich der Aufzug in Bewegung setzte, trat die Frau in die vordere Ecke. Ihr Mann stellte sich rechts neben sie, direkt vor die Tür, mit dem Gesicht nach vorn.
»Es ist immer schön, ausländische Gäste hier zu sehen«, fügte Vilar hinzu. »Machen Sie Urlaub?«
Die Frau schüttelte den Kopf. »Leider nicht. Wir sind geschäftlich hier.«
»Ich verstehe«, sagte Lucio Vilar und sah erneut auf die Uhr.
Aber Lucio Vilar verstand überhaupt nicht.
Martina Jaeger hob den Blick zu der digitalen Stockwerkanzeige über der Tür. Sie hatten das Restaurant im vierten Stock passiert, ohne dass der Aufzug angehalten hatte und jemand zugestiegen war. Damit standen die Chancen gut, dass sie ohne Unterbrechung bis in den siebzehnten Stock hinauffahren würden.
Lucio Vilar lächelte sie an und schien die kurze Fahrt dazu nutzen zu wollen, sein Englisch zu üben. »Darf ich fragen, was für Geschäfte Sie nach Caracas führen?«
Aber Martina hörte nicht hin. Auf holländisch sagte sie: »Im achten.«
Braam Jaeger, immer noch mit dem Gesicht zur Tür, antwortete ruhig in derselben Sprache: »In Ordnung.«
Lucio Vilar runzelte, von der Frau ignoriert, die Stirn, sagte aber nichts mehr.
Als der Aufzug den achten Stock erreichte, ließ Martina Jaeger die Hermès-Handtasche von der Schulter gleiten, hob sie hoch und hielt sie in die obere Ecke der Kabine.
Die beiden Leibwächter brauchten weniger als eine Sekunde, um zu begreifen, was sie tat. Die große Holländerin deckte die Überwachungskamera ab.
Braam Jaeger blickte weiter zur Aufzugtür und drehte sich nicht um, doch gerade als die beiden jüngeren Männer an Vilars Seite auf das Tun der Frau reagierten, tauchten zwei Pistolen mit Schalldämpfern hinter den Seiten seiner Anzugjacke auf und richteten sich nach hinten auf die Leibwächter. Er hatte sie über Kreuz unter der Jacke aus der Hüfte gezogen, und jetzt führte seine linke Hand die eine Pistole rechts und seine rechte Hand die andere links um seinen Körper herum. Er blickte nach oben zu dem Spiegelbild in der glänzenden Metalltür.
Beide Waffen feuerten gleichzeitig. Obwohl gedämpft, ließ das Bellen zweier automatischer Pistolen die enge Kabine erdröhnen.
Die beiden Leibwächter wurden nach hinten gegen die Wand geworfen und sackten dann in die Knie, beide mit einem Loch mitten in der Stirn. Sie hatten ihre Waffen gezückt, die jetzt ihren Händen entglitten. Der Mann links fiel eine Sekunde langsamer als der Mann rechts, aber beide stürzten mit dem Gesicht voraus auf den Boden des Aufzugs.
Lucio Vilar de Allende stand reglos da, den Aktenkoffer in der rechten Hand, die toten Personenschützer beiderseits zu seinen Füßen.
Braam Jaeger drehte sich um, steckte die Waffe in seiner Rechten geübt in das Holster unter der Jacke zurück und hob die andere hoch.
Vilars Stimme war ein heiseres Flüstern. »Ich … ich verstehe nicht.«
Die Worte waren begreiflicherweise an den Mann mit der Pistole gerichtet, doch die Antwort kam von Martina Jaeger, die mit der Handtasche immer noch die Kamera abdeckte. »Nein? Ich finde, das ist doch offensichtlich. Jemand da draußen mag Sie nicht besonders.«
Und damit schoss Braam dem obersten Strafverfolger Venezuelas ins rechte Auge. Vilars Kopf schlug gegen die Rückwand der Kabine, dann sackte er zu Boden, genau zwischen seine Leibwächter.
Braam feuerte noch zweimal in den bereits reglosen Körper. Nur um ganz sicherzugehen, dass die Zielperson auch tot war. Beim zweiten Bellen der schallgedämpften Pistole spritzten ein paar Blutstropfen auf Martinas fliederfarbene Pumps von Louboutin.
»Verdomme!«, rief sie.
»Het spijt me« – Tut mir leid –, erwiderte Braam, ging in die Knie und fühlte dem Staatsanwalt den Puls. Er war zweifelsfrei tot.
Er las die Patronenhülsen auf – die alle noch heiß waren –, während Martina Jaeger mit der freien Hand ihre Bluse aufknöpfte. Sie öffnete nur zwei Knöpfe unter ihren Brüsten und schälte ein schwarzes Stoffquadrat ab, das mit Isolierband an ihre Haut geklebt war. Sie hob es in die Höhe und drückte es hinter der Handtasche auf das Kameraobjektiv.
Dann ließ sie die Handtasche sinken und blickte zur Stockwerkanzeige. »Vijftien«, sagte sie. Sie drehte sich um und sah zu, wie Braam sich mit denaufgelesenen Patronenhülsen aufrichtete.
Sie sagte: »Eine pro Leibwächter und drei für die Zielperson.«
Weiter sagte sie nichts. Aber Braam begriff sofort, was sie meinte. Er hatte nur vier Patronenhülsen eingesammelt. Er kniete sich wieder hin und suchte die fünfte. Sie war unter den rechten Unterarm der Hauptzielperson gerollt. Er steckte sie ein, während Martina vor ihn hintrat, um ihn vor Blicken zu schützen, falls jemand vor dem Aufzug wartete, wenn er ihr Stockwerk erreichte.
Im 17. ging die Tür auf. Der Stock wurde gerade renoviert und war deshalb leer. Braam zog einen kleinen Keil aus der Jackentasche und klemmte die offene Tür damit fest, dann stiegen sie aus und eilten zur Treppe, wobei Martina unterwegs aus ihren Pumps schlüpfte.
Sie verließen die Tiefgarage des Parque Cristal in einem Audi A8 eine Minute und vier Sekunden, bevor die ersten Alarmglocken schrillten, und fuhren auf der Autobahn Caracas – La Guaira nach Norden in Richtung Flughafen. Sie legten den größten Teil der Strecke schweigend zurück. Sie hatte so etwas schon öfter getan, und obwohl die Stresssubstanzen, die ihr zentrales Nervensystem überschwemmten, Puls und Blutdruck nach oben trieben, blieben sie äußerlich ruhig und gelassen.
Braam parkte den Wagen auf dem Parkplatz des Playa Grande Caribe Hotel & Marina an der karibischen Küste, jeder nahm einen Reisetrolley aus dem Kofferraum und betrat, ihn hinter sich herziehend, das Hotel. Sie schlenderten am Empfangstresen vorbei durch die große Anlage und hinten wieder hinaus, dann einen gewundenen Fußweg entlang, der zum Jachthafen führte. Dort stiegen sie in eine kleine graue Jolle. Braam warf den Motor an, und sie fuhren zu einer 13 Meter langen Jacht hinaus, die im Hafen ankerte.
Braam ließ den Motor an, während Martina die Leinen losmachte, und Augenblicke später jagten sie aus dem Hafen hinaus auf die offene See.
Mit einem Auge das Meer im Blick behaltend, konsultierte Braam seinen Laptop. Im Browser war eine Wettervorhersage für die Karibik geöffnet. Die Aussichten für die nächsten vierundzwanzig Stunden waren günstig, und das war wichtig, denn sie wollten bis drei Uhr in der Frühe in Curaçao sein. Um halb sieben am nächsten Morgen ging ein Direktflug nach Amsterdam, und die Jaegers hatten Tickets und die feste Absicht, am nächsten Abend zu Hause zu sein.
Zwanzig Minuten nachdem sie in See gestochen waren, trat Martina mit zwei Champagner-Gläsern in den Händen auf die Brücke. Sie reichte eines Braam, der am Ruder saß, und sie prosteten sich zu.
Ein Paar würde sich jetzt vielleicht küssen, aber sie waren keines. In Wirklichkeit waren Braam und Martina Jaeger Geschwister, und sie arbeiteten als Auftragskiller für den russischen Geheimdienst.
3
Drei Tage nach der Explosion der Flüssiggas-Anlage in Litauen saßen zwei gut gekleidete Geschäftsmänner an einem Tisch in einem kleinen Restaurant neben der Haupthalle des Warschauer Zentralbahnhofs. Der ältere der beiden war annähernd fünfzig, kräftig gebaut und hatte dunkles, lockiges Haar, das einen erheblichen Grauanteil aufwies. Der Jüngere war Mitte dreißig, hatte kurzes braunes Haar und einen gestutzten Vollbart.
Die Männer tranken Kaffee und blickten von Zeit zu Zeit auf ihre Uhren. Der Ältere las in einer englischsprachigen Zeitung, der Jüngere hielt ein Smartphone in der Hand, saß aber die meiste Zeit nur mit übereinandergeschlagenen Beinen da und ließ gelangweilt den Blick durch den Bahnhof wandern. Äußerlich unterschieden sich die beiden überhaupt nicht von gut zwei Dutzend anderen Geschäftsleuten in der Haupthalle, die paarweise unterwegs waren, und nur unwesentlich von rund dreihundert anderen, die im Bahnhof standen oder saßen.
Wenn die Männer miteinander sprachen, dann auf englisch, doch nicht einmal das war in einer so kosmopolitischen Stadt wie Warschau ungewöhnlich.
Eine Durchsage zur bevorstehenden Abfahrt des Eurocitys nach Berlin um 9.55 Uhr hallte auf polnisch, deutsch und schließlich englisch aus den Lautsprechern, und die Männer standen auf, schulterten Umhängetaschen, ergriffen Aktenkoffer und steuerten auf die Treppe zu, die zu den Bahnsteigen hinabführte.
Auf dem Weg durch die von Menschen wimmelnde Halle sagte der Jüngere leise etwas. Sein Partner hätte ihn unmöglich verstehen können, hätte er nicht – wie auch der andere – einen Minisender von der Größe eines Hörgeräts im Ohr gehabt.
»Was ist, wenn er nicht aufkreuzt? Steigen wir dann trotzdem in den Zug?«
»Es bringt doch nichts, in Warschau herumzusitzen, wenn wir keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort haben«, antwortete der Ältere. »Seine Platzreservierung ist alles, was wir haben. Wir nehmen den Zug und sehen dann weiter. Vielleicht haben wir ihn im Bahnhof nur übersehen, und er ist schon eingestiegen.«
Dominic Caruso nickte, ohne etwas zu erwidern, aber eigentlich wäre er lieber noch etwas länger in Polen geblieben. Sie waren erst am Vorabend angekommen, aber er spürte, dass die Stadt nach seinem Geschmack war. Ihre Geschichte war faszinierend, das Bier und das Essen gut, und die wenigen Menschen, denen er begegnet war, hatten einen netten, unverkrampften Eindruck gemacht. Außerdem war ihm aufgefallen, dass die Frauen umwerfend aussahen, wenngleich das für ihn kein Grund war, zu bleiben. Er hatte zurzeit eine feste Beziehung, und so sagte er sich, dass es wahrscheinlich ganz gut war, wenn er gleich in den nächsten Zug stieg.
Auf dem Bahnsteig verharrten die beiden Männer noch einen Augenblick und sahen sich um. Scharen von Reisenden strebten in alle Richtungen, zu viele, als dass die beiden Amerikaner in dem Meer von Gesichtern ihre Zielperson hätten ausmachen können. Trotzdem nahmen sie sich Zeit und hielten nach etwaigen Agenten Ausschau, die für die Zielperson den Bahnsteig beobachteten und nach möglichen Beschattern absuchten.
Weder Domingo Chavez noch Dominic Caruso bemerkte etwas Verdächtiges, und so stiegen sie in ihren Erste-Klasse-Wagen am Ende des Eurocitys nach Berlin und setzten sich in ein Sechser-Abteil mit Glasschiebetür zum schmalen Gang. Sie nahmen die Fensterplätze, damit sie den Bahnsteig weiter im Auge behalten konnten.
»Viel mehr Polizei, als ich erwartet hätte«, bemerkte Chavez.
Caruso nickte, während er mit den Augen den gesamten Bahnsteig bis zur Treppe am anderen Ende absuchte. »Das ist wegen der Geschichte oben in Litauen. Ein neuer Terrorakteur, der in der Lage ist, so was durchzuziehen, macht alle europäischen Regierungen nervös.«
»Ja, aber für wie lange?«
»Schwer zu sagen«, räumte Caruso ein und fragte sich ebenfalls, ob die verstärkte Polizeipräsenz hier in Europa, obwohl ganz anderen Gründen geschuldet, die unliebsame Folge haben würde, sie bei ihrem Observationsauftrag zu behindern.
Er schob die Bedenken beiseite und setzte die Beobachtung fort.
Ihre Zielperson hier in Polen hieß Jegor Morosow und galt als hoher Offizier des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB(Federalnaja Sluschba Besopasnosti). Er war Ende vierzig und sah, was die Aufgabe der beiden Amerikaner zusätzlich erschwerte, so unscheinbar aus wie die meisten Vertreter seines Metiers.
Chavez und Caruso arbeiteten für einen privaten amerikanischen Nachrichtendienst, der sich selbst »der Campus« nannte, und waren mithilfe der Recherche- und Analyseabteilung ihrer Organisation einer auf Zypern registrierten Briefkastenfirma auf die Spur gekommen, die Beziehungen zum Kreml und dem russischen Geheimdienst unterhielt. Die CIA hatte Morosow bereits als Geheimagent identifiziert, aber der Campus hatte ihn hier in Warschau aufgespürt, nachdem er eine mit der zyprischen Briefkastenfirma verknüpfte Kreditkarte benutzt hatte, die auf einen seiner bekannten Tarnnamen lautete. Als die beiden Amerikaner in Warschau eintrafen, hatte Morosow bereits aus seinem Hotel ausgecheckt, aber es stellte sich heraus, dass mit seiner Karte zwei Erste-Klasse-Tickets für den Eurocity nach Berlin an diesem Morgen reserviert worden waren.
Die Männer besaßen zwar ein Foto Morosows aus dessen polnischem Visumsantrag, aber sie hatten keine Ahnung, mit wem er zu reisen gedachte, warum er nach Berlin fuhr und was er hier im Westen trieb.
Trotzdem waren sie hier. Schließlich hatten sie sich in den letzten Monaten mit russischen Finanznetzwerken beschäftigt, und Morosow war ein Name mit einem Gesicht, der mit einer Firma in einem dieser Netzwerke in Verbindung stand. Sie wussten nicht sonderlich viel über ihn, aber er war alles, was sie hatten, und so waren sie auf ihn angesetzt worden.
Doch jetzt sah es ganz so aus, als würde er gar nicht kommen.
»Das könnte ein dröger Tag werden«, sagte Dom Caruso.
»Na ja, diese ganze Ermittlung ist mehr Kopf- als Fußarbeit. Jack junior und die anderen Analytiker sind die Köpfe und wir beide nur die Füße und Augen, deshalb haben wir diesen aufregenden Job bekommen.«
Caruso nickte, während er den Blick schweifen ließ. Dann blinzelte er heftig vor Überraschung, als traute er seinen Augen nicht. »Ich fass es nicht. Da ist er.«
Die Zielperson ging in Lederblouson und Jeans draußen vor dem Fenster den Bahnsteig entlang, in der Hand eine große Ledertasche. Ein, zwei Meter dahinter – und im Gleichschritt mit ihm – zog eine Frau einen Rollkoffer hinter sich her. Sie war viel jünger als er, hatte dunkles Haar und helle Haut. Für Dom sah sie nicht wie eine Polin aus, auch nicht wie eine Russin, doch andererseits, so sagte er sich, war er mit den Frauen hier drüben noch nicht so vertraut, dass er sich ein Urteil erlauben konnte.
Aber Chavez dachte dasselbe. »Ich würde sagen, die Unbekannte ist Nordafrikanerin. Marokko. Algerien. Vielleicht auch Spanierin oder Portugiesin.«
Caruso nickte. Der ältere Domingo Chavez war schon viel länger dabei als er und traf mit seinen ersten Vermutungen gewöhnlich ins Schwarze.
»Sie könnte was viel Besseres kriegen als einen Typ wie Morosow«, fügte Caruso hinzu.
»Frankensteins Braut könnte was viel Besseres kriegen als einen Typ wie Morosow.«
Der Russe und seine Reisegefährtin stiegen in denselben Wagen wie Chavez und Caruso, was keineswegs nur reines Glück war. Von den sechs Wagen des Zugs war nur einer erster Klasse.
Dom stemmte sich aus seinem Sitz, trat an die Glasschiebetür und spähte den Gang hinunter. Er sah, wie die Frau Morosow in das Abteil zwei Türen weiter folgte.
Augenblicke später sprang der Schaffner auf den Bahnsteig hinaus, stieß in seine Pfeife und stieg wieder ein, worauf die mächtige E-Lok die sechs Wagen aus dem Bahnhof zu ziehen begann.
Sie waren kaum ein paar Minuten unterwegs, da beschlossen Chavez und Caruso, zunächst einmal den gesamten Zug nach möglichen Gegenobservanten abzusuchen, bevor sie sich der Frage zuwandten, wie sie an ihre Zielperson und die junge Frau näher herankommen konnten. Sie verließen ihr Abteil, schlenderten an Morosows Abteil vorbei, ohne hineinzusehen, und durchquerten den Speisewagen. Dahinter ging es in den ersten Wagen der zweiten Klasse. Darin saßen rund ein Dutzend Männer, alle in schwarzen Sportanzügen mit roten Zierstreifen. Chavez und Caruso hatten sie kurz vor dem Einsteigen im Bahnhof gesehen und nahmen an, dass sie eine Fußballmannschaft waren. Die meisten von ihnen trugen Kopfhörer, nur ein paar unterhielten sich. Zwei hätten dem Aussehen nach Trainer sein können, doch der Rest hatte das richtige Sportleralter und die entsprechende Figur.
Chavez und Caruso gingen weiter in den nächsten Wagen, wo sie nur Touristen, ein paar Männer und Frauen in Geschäftskleidung und mehrere Senioren vorfanden.
Im zweitletzten Wagen fielen ihnen drei Männer zwischen dreißig und vierzig auf, die, zwei Weiße und ein Schwarzer, beieinander saßen. Sie trugen Jeans und North-Face-Jacken. Einer der Weißen hatte einen hochwertigen Rucksack mit Außennetz im Militärstil auf dem Schoß. Der Schwarze trug eine Taucheruhr, und der zweite Weiße hatte ein Panasonic Toughbook, einen Laptop mit robustem Gehäuse, der häufig beim Militär und bei privaten Sicherheitsdiensten Verwendung fand.
Der letzte Wagen war voller Touristen, Familien mit kleinen Kindern und Rentnern.
Zurück in ihrem Abteil, sprachen die Männer über die Eindrücke, die sie bei ihrem Erkundungsgang gewonnen hatten. »Die drei Typen im fünften Wagen sind eindeutig aus der Branche«, sagte Dom.
»Schon«, erwiderte Chavez. »Aber unser Mann ist vom FSB. Ein Begleitteam für Morosow würde sich niemals so ausstaffieren. Viel zu auffällig.«
Caruso sann darüber nach und nickte zustimmend. »Was ist mit der Fußballmannschaft? Im Unterschied zu dir kann ich Kyrillisch nicht lesen.«
»Tja«, sagte Chavez. »Auf ihren Anzügen stand FC Luschany. Keine Ahnung, wer oder was das ist.«
Dom konsultierte sein Smartphone. Nach einer Minute sagte er: »Da hätten wir sie. Eine Amateur-Fußballmannschaft aus der Ukraine.«
»Kannst du herausfinden, was sie hier treiben?«
Ein wenig Tipperei auf dem Smartphone lieferte Dom weitere Informationen. »Kommende Woche findet in Leipzig ein Amateur-Turnier statt.«
»Okay«, sagte Chavez. Er nahm nicht ernstlich an, dass zwölf als Fußballer verkleidete Schurken im Zug saßen, wollte sie aber trotzdem überprüfen. »Wenn wir die Fußballer und die drei Superagentenausschließen, befindet sich meines Erachtens niemand mehr im Zug, der einen genaueren Blick wert wäre. Abgesehen von Morosow und seiner Freundin, versteht sich.«
»Gut«, sagte Caruso. »Willst du näher ran?«
Chavez nickte. »Wir können uns im Speisewagen an einen Tisch setzen und zu Mittag essen. Von dort können wir durch die Fenster der Verbindungstüren ihr Abteil im Auge behalten. Die Sicht ist nicht ideal, aber wenigstens kriegen wir so mit, wenn jemand kommt oder geht. Wenn die Frau aufs Klo geht, versuche ich, ein Foto von ihr zu machen. Sehr viel mehr können wir nicht tun.«
»Ich könnte ihr oder Morosow eine Wanze verpassen.«
Chavez schüttelte den Kopf. »Das wäre zu riskant. Als wir noch mehr waren, wäre das vielleicht eine Option gewesen, aber jetzt, wo wir nur noch zu zweit sind, müssen wir es auf die dezente, clevere Tour angehen.«
Caruso sah ein, dass Chavez recht hatte. Das Team war jetzt kleiner als früher, und jeder Tag im Außeneinsatz erinnerte sie daran.
4
John Clark spürte die ungeheure Wirkung, die vom Nationalfriedhof Arlington ausging – die Würde der über 250 Hektar großen Anlage und das Schicksal der 400 000 dort Begrabenen ließen ihn nicht unbeeindruckt. Tatsache aber war, dass John Clark nicht viel von Friedhofsbesuchen hielt.
Das war kein Zeichen für mangelnden Respekt vor den Toten. Ganz im Gegenteil. Wer Grabsteine verehrte, versäumte es in seinen Augen, die Toten so in Erinnerung zu behalten, wie sie in Erinnerung behalten werden wollten. Im Lauf der Jahre hatte er viele Freunde verloren, und ihm war es wichtig, sie alle in Erinnerung zu behalten, aber dazu, so sagte er sich, brauchte er nicht ihre letzte Ruhestätte aufzusuchen.
Doch trotz aller Vorbehalte war er heute hier und stand ohne Schirm, den er im Auto vergessen hatte, im kalten Regen am Grab eines Freundes.
Auf dem Grabstein stand sehr wenig, und das wenige entsprach nur teilweise der Wahrheit.
SAMUEL REID DRISCOLL
FIRST SERGEANT
U.S. ARMY
26. 7. 1976 – 5. 5. 2016
PURPLE HEART
AFGHANISTAN
Der Name stimmte, obwohl er sich Sam genannt hatte. Auch Rang und Teilstreitkraft stimmten, nur hatte Sam die Army Rangers schon Jahre vor seinem Tod verlassen. Das Geburtsdatum war korrekt, doch zwischen dem tatsächlichen Todestag und dem, der in den weißen Marmor gemeißelt war, lagen mehrere Wochen. Clark wusste das mit absoluter Gewissheit, denn er war nur zwanzig Meter von Sam entfernt gewesen, als er starb.
Und wenn Afghanistan nicht irgendwie in die Höhe gehoben und an die Südgrenze der Vereinigten Staaten verfrachtet worden war, dann war auch sein Sterbeort nicht korrekt.
Sam Driscoll war nämlich in einem dunklen Flur einer Luxusvilla eine Autostunde von Mexico City entfernt von einem nordkoreanischen Geheimagenten erschossen worden.
Nein, in der Grabinschrift wurde das nicht erwähnt.
Und ja, die falschen Angaben und Halbwahrheiten auf Sam Driscolls Grabstein ärgerten Clark ein wenig, doch er sah ein, dass es so besser war. Man hätte schlecht auf den Grabstein schreiben können, dass Sam als Agent für einen inoffiziellen Spionagedienst namens Campus gearbeitet hatte, und schon gar nicht, dass er in Mexiko die Leute gejagt hatte, die hinter dem nur knapp gescheiterten Mordanschlag auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten steckten.
Sam war gut gewesen, ohne Zweifel verdammt viel besser als der Nordkoreaner, der ihn getötet hatte – und der im selben Augenblick durch Sams Hand gestorben war. Aber Sam hatte es mit zwei Angreifern zu tun gehabt, und obwohl er sie beide erledigte, hatte der eine mit dem letzten Atemzug noch einen Glückstreffer gelandet.
Im Kampf gibt es keine Garantien. Wenn Männer erbittert um ihr Leben kämpfen, Mann gegen Mann, und mit einer Mündungsgeschwindigkeit von 300 Metern pro Sekunde heißes Blei aufeinander abfeuern, passiert zwangsläufig Scheiße, und Sam war sie passiert.
John Clark stand im Regen und dachte noch einmal kurz an jene Nacht in Cuernavaca, aber dann kehrten seine Gedanken zu seinem eigenen Leben, seiner eigenen Sterblichkeit zurück. Das ließ sich kaum vermeiden, wenn man in diesem riesigen Steingarten stand, in dem jede weiße Gedenktafel an einen weiteren Mann oder eine weitere Frau erinnerte, alle mit ihrer ganz eigenen Geschichte, ihrem ganz eigenen Ende.
Es gab hunderttausend Arten zu sterben. Das einzige Gemeinsame all dieser Gedenksteine war, dass praktisch jeder, der unter ihnen begraben lag, in irgendeiner Weise den Vereinigten Staaten von Amerika gedient hatte und dass viele von ihnen, sehr viele, ihr Leben in Ausübung dieses Dienstes verloren hatten.
Genau wie Sam.
Es war nicht fair.
John Clark war siebenundsechzig Jahre alt. Sam Driscoll war 27 Jahre jünger als er gewesen, und viele andere Männer und Frauen, die hier begraben lagen, waren halb so alt wie Sam gewesen, als sie vor ihren Schöpfer traten.
Nein, alles andere als fair.
Hätte Clark gekonnt, dann hätte er die Kugel, die Sam Driscoll niedergestreckt hatte, mit seinem Herzen aufgefangen, aber er hatte sich die meiste Zeit seines Lebens in Gefahr begeben, und wenn er etwas gelernt hatte, dann dass das alles nicht den geringsten Sinn ergab und dass bei einem Feuergefecht der Zufall immer eine beherrschende Rolle spielte, egal wie gut man war.
Sein Blick wanderte über die vielen Tausend weißen Grabsteine.
Alles kann passieren, auch die Guten können sterben.
Langsam, ganz langsam erinnerte er sich an die Blumen in seiner Hand.
Wenn Clark nicht der Typ war, der an Gräbern stand, so gehörte er erst recht nicht zu der Sorte, die mit Blumen durch die Gegend lief. Aber das war nicht seine Idee gewesen. Nein, er löste nur ein Versprechen ein.
Bei Sams Beerdigung hatte er Edna Driscoll, die Mutter des Toten, kennengelernt. Sie wusste nicht, wie ihr Sohn gestorben war. Sie wusste nur, dass ihr Sohn den Dienst bei der Army quittiert hatte und zu einem Privatunternehmen gewechselt war, das Aufgaben im Bereich der inneren Sicherheit wahrnahm. Sie begriff, dass seine Arbeit streng geheim war und dass er nicht darüber sprechen durfte, aber sie ahnte nicht, dass sie sich als noch gefährlicher erweisen sollte als sein Dienst beim 75. Ranger-Regiment.
Bei der Beerdigung drückte er der hageren und verhärmten Frau sein tief empfundenes Beileid aus, doch als sie ihn nach den näheren Umständen des Todes ihres Sohns fragte, konnte er ihr nur sagen, dass er für sein Land gestorben war.
Das war die reine Wahrheit, und er hoffte, sie würde genügen, aber er erlebte das nicht zum ersten Mal, und er wusste Bescheid.
Es genügt nie.
Seine Frau Sandy war ihm zu Hilfe gekommen, wie schon bei vielen Beerdigungen zuvor. Sie mischte sich in das Gespräch ein, stellte sich vor und brachte Edna Driscoll auf andere Gedanken. Sie hatte Mitleid mit ihr, und nach der Beerdigung schlug sie der Frau vor, miteinander in Kontakt zu bleiben.
Es war ein Akt der Freundlichkeit, der einer Witwe aus Nebraska, die ihren Sohn verloren hatte, Gelegenheit gab, eine Beziehung zu den Menschen zu knüpfen, mit denen er gedient hatte, auch wenn sie nicht begriff, wer oder was sie waren.
Sandy kontaktierte Edna ein paar Tage später und berichtete ihr, dass die private Sicherheitsfirma im Rahmen des Vergütungspakets für ihren Sohn ein Pensionskonto eingerichtet habe, das nun ihr gehöre, und als Sandy ihr den Betrag nannte, der sich auf dem Konto befand, war Edna Driscoll noch verwirrter, was den Arbeitgeber ihres Sohnes anging.
Drei Millionen Dollar waren für sie eine schockierend hohe Summe, und doch kein Ausgleich für ihren Verlust.