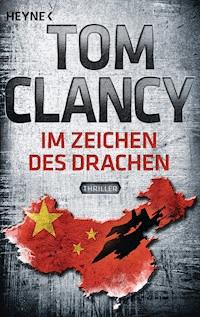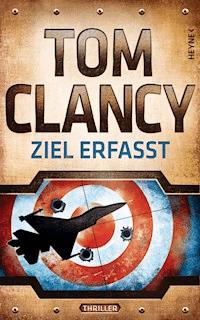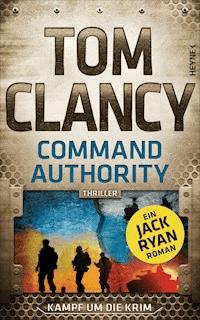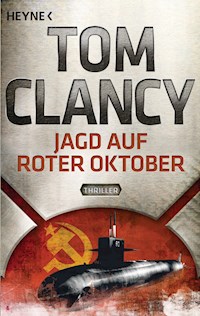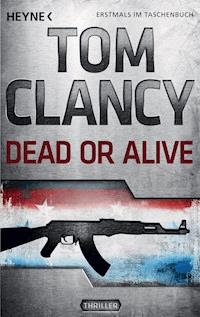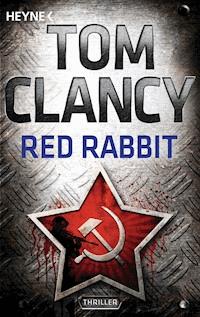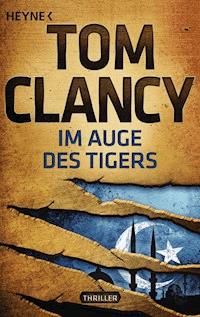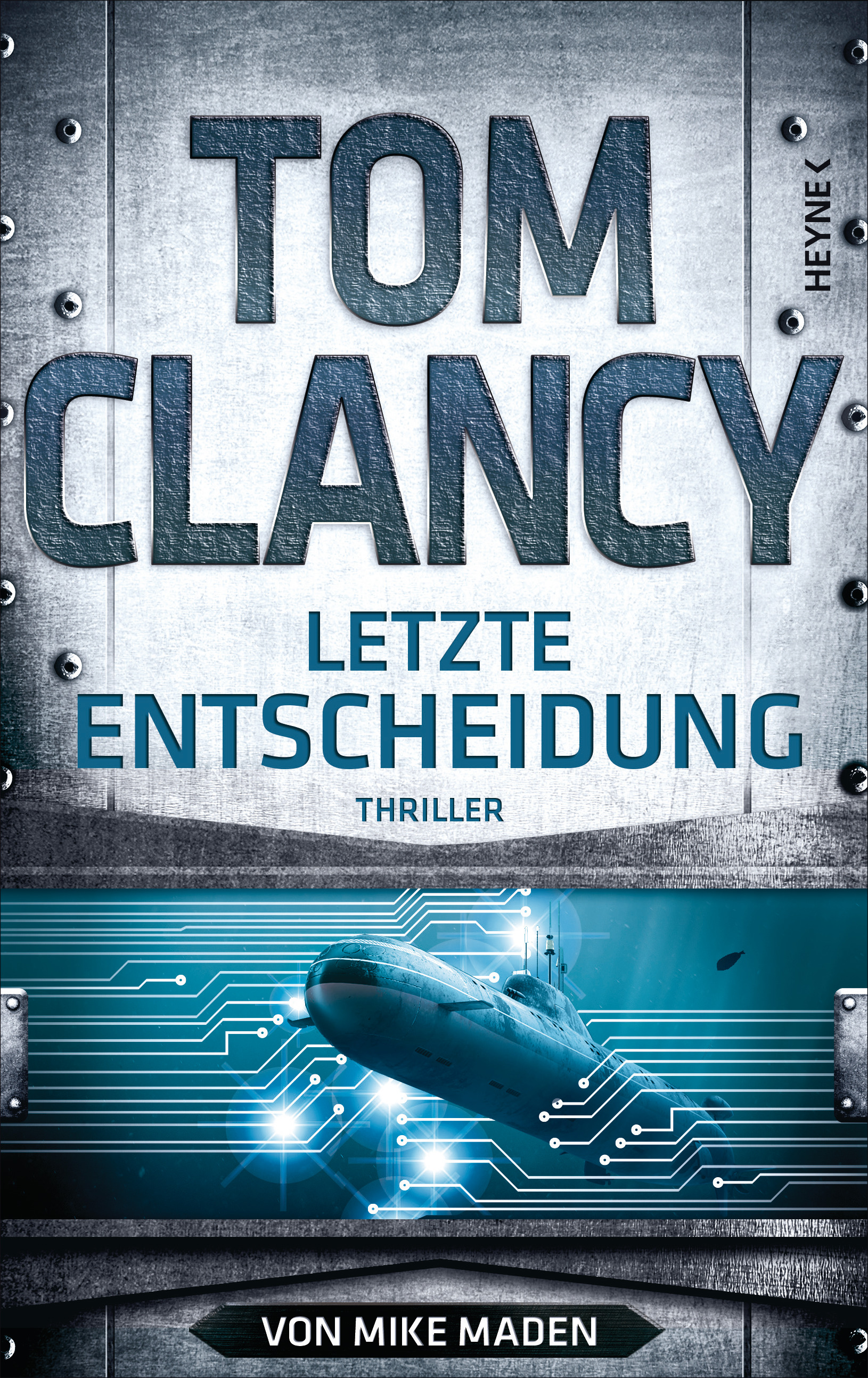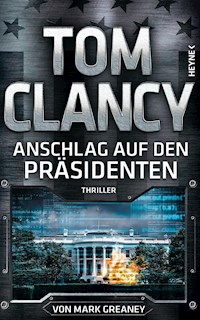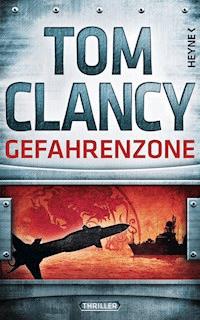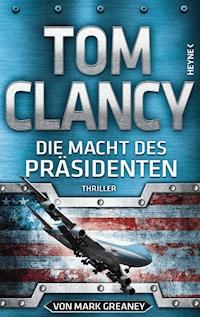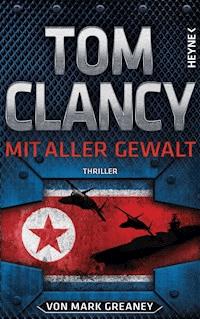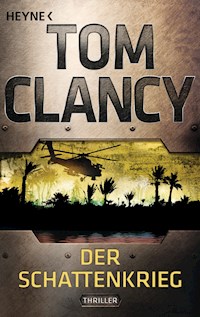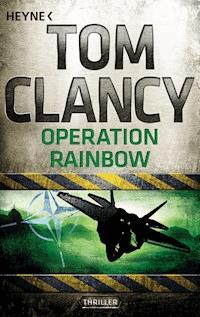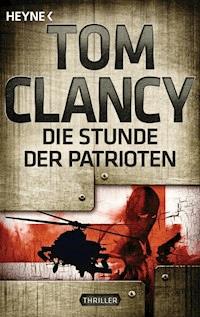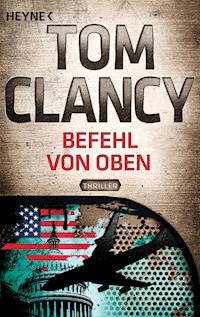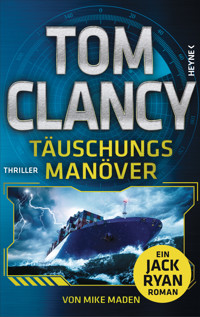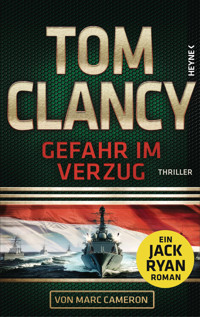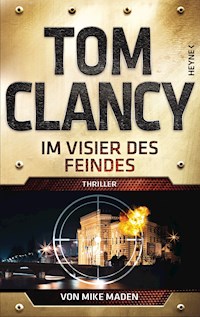
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JACK RYAN
- Sprache: Deutsch
Jack Ryan jr. auf Mission im Balkan
Auf dem Balkan braut sich ein neuer Krieg zusammen: Al-Kaida will Bosnien-Herzegowina gezielt durch Anschläge destabilisieren. Jack Ryan junior, der dort als Finanzanalyst auf Mission ist, nimmt sich der Sache an. Dabei ist ihm nicht nur Al-Kaida, sondern auch das geheimnisvolle Eiserne Syndikat auf den Fersen. Doch Jack Ryan junior gibt nicht auf. Es gilt, den nächsten Weltkrieg zu verhindern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ZUMBUCH
In Sarajevo trifft Jack Ryan jr. Aida wieder – das Mädchen, dessen Augenlicht Ryans Mutter vor fünfundzwanzig Jahren im Krieg gerettet hat. In ihrer Heimat braut sich erneut ein Krieg zusammen, und Jack will Aida beistehen. Dabei muss er sich nicht nur mit der serbischen Mafia herumschlagen, sondern auch mit Attentätern des geheimnisvollen Eisernen Syndikats.
Etwas sagt ihm, dass er es hier mit mehr zu tun hat als mit lokalen Reibereien: Im schlimmsten Fall können die Konflikte im Balkan zu einem neuen Weltkrieg führen. Also trotzt er der Anweisung, sich zurückzuziehen, stellt sich dem Feind allein – und bringt dadurch Aida in Gefahr.
ZUMAUTOR
Tom Clancy, der Meister des Technothrillers, stand seit seinem Erstling Jagd auf Roter Oktober mit all seinen Romanen an der Spitze der internationalen Bestsellerlisten. Er starb im Oktober 2013.
Mike Maden ist Koautor und Experte für internationale Friedens- und Konfliktforschung sowie für Technologie im internationalen Zeitalter, worüber er seine Doktorarbeit schrieb.
TOM
CLANCY
UND
MIKE MADEN
IM VISIER
DES FEINDES
THRILLER
Aus dem Amerikanischen von Reiner Pfleiderer
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Line of Sight
bei G.P. Putnam’s Sons, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Redaktion: Werner Wahls
Copyright © 2018 by The Estate of Thomas L. Clancy, Jr.; Rubicon, Inc.; Jack Ryan Enterprises, Ltd.; Jack Ryan Limited Partnership
Copyright © 2021 der deutschen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung © Nele Schütz Design
unter Verwendung der Motive von Shutterstock.com (Eky Studio, Eky Studio, Sanele Babic)
Herstellung: Helga Schörnig
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN 978-3-641-26795-7V001
www.heyne.de
Europa ist heute ein Pulverfass, und seine Regenten agieren wie Männer, die in einer Munitionsfabrik rauchen. Ein einziger Funke kann eine Explosion auslösen, die uns alle verschlingt. Ich weiß nicht, wann es zur Explosion kommt, aber ich kann sagen, wo. Irgendetwas Verrücktes auf dem Balkan wird der Beginn der Katastrophe sein.
Otto von Bismarck zugeschriebener Ausspruch beim Berliner Kongress 1878.
Hauptpersonen
Regierung der Vereinigten Staaten
JACKRYAN: Präsident der Vereinigten Staaten
SCOTTADLER: Außenminister
MARYPATFOLEY: Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste
ROBERTBURGESS: Verteidigungsminister
JAYCANFIELD: Direktor der CIA
ARNOLDVANDAMM: Stabschef des Präsidenten
Der Campus
GERRYHENDLEY: Direktor von Hendley Associates/Direktor des Campus
JOHNCLARK: Operationsleiter
DOMINIC »DOM« CARUSO: Außenagent
JACKRYANJR.: Außenagent/Leitender Analyst
GAVINBIERY: Leiter der IT-Abteilung
ADARASHERMAN: Außenagentin
BARTOSZ »MIDAS« JANKOWSKI: Außenagent
LISANNEROBERTSON: Logistik- und Transportleiterin
Weitere Personen
DR. CATHYRYAN: Ärztin und First Lady der Vereinigten Staaten
KEMALTOPAL: Botschafter der Türkei in Bosnien-Herzegowina
TARIKBRKIC: Kommandeur von al-Qaida auf dem Balkan.
SHAFIQWALIB: Hauptmann, Syrisch-Arabische Armee
ASLANDSCHABRAILOW: Leutnant, Landstreitkräfte
der Russischen Föderation
AIDACURIC:Inhaberinvon Happy Times! Balkan Tours
EMIRJUKIC: Geschäftsführer von HappyTimes! undReiseleiter
DRAGANKOLAK: Offizier, Nachrichten- und Sicherheitsdienst von Bosnien-Herzegowina (OSA-OBA)
1
Seven Corners,
Virginia
Dr. Guzman rieb sich die müden Augen. Sie war Ärztin geworden, um Kranke zu heilen, nicht um endlos Berichte zu schreiben. Aber hier saß sie und tippte schon seit Stunden.
Mal wieder.
Aber egal. Das war der Preis, den sie dafür bezahlte, dass sie die freie Klinik für die Ärmsten der Armen, hauptsächlich Migranten, leitete.
Sie blickte auf die Uhr. Die Lieferung verspätete sich. Sobald sie eintraf, würde sie diesen letzten Budgetbericht abschließen, nach Hause fahren und sich eine dringend benötigte Mütze Schlaf gönnen.
Ein Geräusch im Hinterzimmer erschreckte sie. Sie schaute von ihrem Laptop auf und lauschte.
Nichts.
Wahrscheinlich nur wieder die Ratten, sagte sie sich. Ekelhaft.
Sie nahm sich vor, morgen auf dem Weg hierher bei Lowe’s noch ein paar Fallen zu kaufen.
Sie versenkte sich wieder in ihre Tabellenkalkulation und richtete die tränenden Augen auf die leeren Spalten, die sie noch mit Zahlen zu füllen hatte. Ihre Finger erstarrten.
Der beißende Geruch von Schweiß und Dope stieg ihr in die Nase, bevor sie das Messer an der Kehle spürte.
Ein Mann stand hinter ihr. Packte sie an den Haaren.
»Die Medikamente sind im Safe«, sagte sie auf Spanisch, ihrer Muttersprache. »Ich kann ihn nicht öffnen.«
Die Stimme hinter ihr lachte. »Ich will keine Drogen, du Schlampe«, sagte sie auf Englisch. »Wir machen Party.«
Guzman sprach leise ein Gebet und verfluchte ihre Dummheit. Wegen der Lieferung hatte sie die Hintertür unverschlossen gelassen. Das bedeutete, kein Alarm. So war er reingekommen.
Und wenn der Alarm nicht losging, kam auch keine Hilfe.
Der Mann packte sie an der Schulter und drehte den Stuhl herum. Mit einem nikotingelben Grinsen, in dem ein Goldzahn aufblitzte, schaute er auf sie herab. Seine nackten, sehnigen Arme waren mit Tattoos zugekleistert, aber was ihr wirklich Angst einjagte, war sein kahl rasierter Schädel. Sein ganzer Kopf, vom Halsausschnitt aufwärts, war ein Wirrwarr aus blauer Tinte. MS prangte an seinem Hals und auf seiner Stirn eine 13.
Sie kannte ihn. Er war letzte Woche hier gewesen, ein Wrack. Hepatitis C und Tripper. Er hatte einen Namen – Lopez – angegeben, sich aber nicht ausgewiesen. Sie vermutete, dass der Name falsch war. Aber das spielte keine Rolle. Er war krank, und sie war Ärztin. Sie hatte ihn behandelt. Auch wenn er ihr unheimlich war.
Aber jetzt?
»Sie müssen das nicht tun«, sagte sie mit bemüht fester Stimme.
»Müssen muss ich nicht. Ich will.« Grinsend trat er näher, drängte seine Gürtelschnalle dicht vor ihr Gesicht und legte die Klinge flach auf ihre Wange. »Und du auch. Wenn du weiterleben willst.«
»So nicht.«
Ein leiser Pfiff von hinten.
Der Gangster wirbelte herum und zog dabei einen verchromten Ruger .357 unter dem Hemd hervor. Ein wahrer Revolverheld.
Aber eine größere Hand war schneller. Sie packte den 4-Zoll-Lauf, riss ihn nach oben, dann nach außen und zur Seite.
Schnell, aber nicht schnell genug.
Sehnen rissen im Handgelenk des Gangsters, aber sein Zeigefinger schlug gegen den Abzug der gespannten Waffe. Eine Magnum-Patrone feuerte mit ohrenbetäubendem Knall in eine Deckenfliese und erhitzte den Lauf in der Rechten des Mannes. Doch er ließ nicht los.
Seine linke Faust schmetterte gegen das Kinn des Gangsters und ließ ihn in den Knien einknicken. Er sackte bewusstlos zu Boden.
Das alles war blitzschnell gegangen.
Dr. Guzman hatte keine Zeit gehabt zu schreien, geschweige denn zu helfen. Aus großen Augen starrte sie den Mann an, der jetzt vor sie hintrat. Er war groß, muskulös. Schwarzes Haar, blaue Augen.
Noch unter Schock, brachte sie nur heraus: »Wer sind Sie?«
Der Mann steckte den Ruger in den Hosenbund.
»Meine Schwester Sally schickt mich. Damit.« Er deutete auf einen Rucksack, den er ein paar Meter entfernt auf dem Boden abgestellt hatte. »Antibiotika. Sie hat gesagt, dass Sie damit knapp sind.«
»Dr. Sally Ryan?«
»Ja.«
»Dann müssen Sie Jack Ryan sein.«
Er zuckte mit den Schultern und lächelte.
»Junior.«
2
Idlib,
Syrien
Der syrische Kämpfer stand auf dem Dach des Wohnhauses, beschirmte seine alternden Augen vor der tief stehenden Sonne und beobachtete die Kinder, die sieben Stockwerke unter ihm auf der Straße spielten. Schwitzend und lachend jagten sie in den langen Schatten der Häuser hinter dem Ball her wie Bienen hinter einem Hund, ohne auf ihre ängstlichen Mütter zu hören, die ihnen zuriefen, sie sollten nach Hause kommen und aufräumen. Er schmunzelte.
Kinder waren überall gleich.
Die Waffenruhe war ein Segen. »Allah sei Dank«, murmelte er vor sich hin. Er sah auf seine Uhr. Eine nervöse Angewohnheit. Das schwindende Licht verriet ihm, dass bald die Stimme des Muezzins aus den Lautsprechern ertönen und zum Maghrib rufen würde.
Anfangs hatte er getobt, als sein Bataillonskommandeur, ein Iraker, den Waffenstillstand mit dem Schlächter Assad und seinen Zahlmeistern, den gottlosen Russen, verkündet hatte. Doch in den letzten neun Wochen hatten sie Zeit gehabt, sich auszuruhen, Waffen, Lebensmittel, Treibstoff und Bargeld einzuschmuggeln und sich neu zu formieren. Jetzt waren sie gegen jeden Angriff aus der Nähe gewappnet, und mit ihren Stinger-Raketen hielten sie die gefürchteten russischen Jets und Helikopter fern. Alle hochrangigen Kommandeure der Al-Nusra-Front waren hier stationiert, selbst der Emir wohnte in Idlib, nur drei Häuserblocks entfernt. Solange die Waffenruhe andauerte, war es hier so sicher wie sonst nirgends in Syrien.
Der Krieg schien jetzt weit weg. Eine ferne, schmerzvolle Erinnerung. So viel Blut vergossen, und wofür? Das Leben war besser als der Tod, oder etwa nicht?
Er hatte Verlangen nach einer Zigarette, selbst jetzt noch, nach all den Jahren. Doch Zigaretten waren haram, und mehrere Männer aus seiner Einheit waren exekutiert worden, nur weil sie geraucht hatten. Aber vielleicht ein starker Kaffee nach dem Abendgebet, sagte er sich und folgte mit den Augen den schwarz gekleideten Frauen, die durch die Straße trippelten und händeklatschend und schreiend versuchten, die lachenden Kinder in die Häuser zurückzutreiben.
Der Adhaˉn begann, eine kräftige Stimme rief die Gläubigen zum Gebet. Die vertrauten Worte wärmten seine Seele. Die Moschee würde heute Abend voll sein.
Er ergriff sein Gewehr und ging zur Treppe. Vielleicht war der Krieg tatsächlich vorüber, und diese Kinder würden endlich in Frieden leben können. Allah sei Dank.
Fünfzehn Kilometer südlich von Idlib
Eine Schweißperle rollte Hauptmann Shafiq Walib übers Gesicht, obwohl das Klimagerät über ihm auf Hochtouren lief. Der syrische Offizier starrte auf den Bildschirm vor ihm, und seine rechte Hand schwebte über dem Hauptabschussknopf.
Der Bildschirm bestätigte den Bereitschaftsstatus der Feuerleitrechner in den Trägerfahrzeugen der sechs TOS-2-Flammenwerfer »Sternfeuer«, die in der Nähe postiert waren. Alle sechs verfügten über einen Raketenwerfer mit siebzig Rohren, der auf ein schwer gepanzertes Chassis des T-14-Kampfpanzers montiert war, und waren mit seiner Befehlskonsole verbunden.
Er und Major Gretschko saßen auf ihren Posten in dem engen Schützenpanzer BMP-3K, Walibs mobilem Kommandostand. Offiziell fungierte der russische Major bei der heutigen Operation nur als Berater, doch in Wirklichkeit beurteilte Gretschko Walibs Führungsfähigkeit im Gefecht und das neue TOS-2-System.
Walib warf einen verstohlenen Blick auf Leutnant Aslan Dschabrailow, der neben der Luke saß. Der junge, breitschultrige Tschetschene befehligte die Kommandos, die seine Einheit schützten. Die blassgrauen Augen des Mannes verrieten einen scharfen Verstand, an seiner Hüfte hing eine viel benutzte Zehn-Millimeter-Glock. Die Tschetschenen waren wilde, brutale Kämpfer – eine Klasse für sich, die besten in diesem Krieg, jedenfalls auf seiner Seite. Dschabrailow war ein Mann zum Fürchten.
Der Major checkte ein letztes Mal den GLONASS-Empfänger – das russische Gegenstück zu GPS – und den Laserleitstrahl. »Zielerfassung bestätigt. Feuerbereit, Hauptmann.«
Walib strich mit Daumen und Zeigefinger seinen Schnurrbart glatt und zögerte.
»Stimmt was nicht, Hauptmann?«, fragte Gretschko.
Walib war syrischer Patriot. Er hatte kein Problem damit, Terroristen zu töten, zumal ausländische. Der syrische »Bürgerkrieg« wurde dieser Tage von allen möglichen Leuten ausgetragen, nur nicht von Syrern. Aber sie kämpften alle nur als Stellvertreter für die Amerikaner und Russen, die das syrische Volk fröhlich auf dem Altar ihrer Großmachtambitionen opferten.
Er hasste sie alle, heute besonders.
»In Idlib sind keine Zivilisten mehr, Hauptmann«, sagte Gretschko. »Nur Al-Nusra-Banditen, die Frauen, die sie großgezogen haben, und die Kinder, die später entweder selbst Banditen werden oder welche in die Welt setzen. Das ist ein demografischer Krieg. Entsprechend müssen wir kämpfen.«
Das war nicht der Krieg, zu dem sich Walib freiwillig gemeldet hatte. Er hätte nie gedacht, dass die schrecklichen Waffen unter seinem Kommando dazu missbraucht werden könnten, Unschuldige abzuschlachten.
Doch wenn er sich Gretschkos Befehl widersetzte, würde der Russe die Jarygin PJa aus dem Holster ziehen, sein Gehirn an die Stahlwanne des BMP pusten und einfach einem von Walibs Leutnants in den anderen Fahrzeugen den Feuerbefehl geben.
Damit wäre nichts gewonnen. Walib würde sein Leben hingeben, nur um todgeweihten Zivilisten eine Galgenfrist von wenigen Minuten zu verschaffen.
Er hasste sich. Er hasste diesen Krieg.
Aber sinnlos zu sterben hasste er noch mehr.
»Ich kontrolliere nur den Spin von Gyro Nummer elf«, sagte Walib. Eine Notlüge. »Einsatzbereit.«
»Dann können Sie ja ungehindert feuern. Nun machen Sie schon.« Gretschkos Bulldoggenaugen verengten sich.
»Jawohl, Herr Major.« Walib klappte die Schutzkappe über dem Abschussknopf auf und drückte darauf, bevor er es sich anders überlegen konnte.
Augenblicklich zündeten die französischen Feststofftriebwerke der 122-Millimeter-Raketen. Das Gedröhn war entsetzlich, wie der Schrei Gottes, selbst im Innern des im Leerlauf befindlichen Kommandofahrzeugs. Jede halbe Sekunde jagte eine drei Meter lange Rakete kreischend aus ihrem Rohr. Ein brachialer Chor des Todes.
Fünfunddreißig Sekunden später waren alle vierhundertzwanzig Raketen abgefeuert und wuchteten annähernd fünfzehn Tonnen thermobarische Munition in die Luft. Der TOS-2-Feuerleitrechner stimmte Abschusszeitpunkte und Flugbahnen so aufeinander ab, dass alle Gefechtsköpfe gleichzeitig im Ziel einschlugen, wodurch die gegenseitige Zerstörung von Gefechtsköpfen verhindert und die Sprengwirkung verstärkt wurde.
Gretschko starrte begierig auf seinen Bildschirm, auf dem ein Live-Videobild zu sehen war, geliefert von der in Israel entwickelten Forpost-M-Drohne, die hoch über Idlib kreiste und zudem den Laserleitstrahl für die Raketen aussendete.
»Gleich ist es so weit«, feixte Gretschko. »Höchste Zeit, dass wir die Kakerlaken ausräuchern.«
Aber Walib wollte es nicht sehen. Er war bereits draußen und bellte Befehle an seine Männer, die hektisch Vorbereitungen für einen zügigen »Shoot-and-scoot«-Stellungswechsel trafen, der einzigen Schutzmaßnahme gegen etwaiges Gegenfeuer feindlicher Batterien.
Walib stapfte durch die dicken Abgas- und Staubwolken, die noch in der Luft wirbelten, Tränen der Wut und Scham in den Augen.
Leutnant Dschabrailow stand neben dem Kommandofahrzeug und beobachtete den syrischen Hauptmann mit lebhaftem Interesse.
Idlib, Syrien
Die lasergesteuerten TOS-2-Sternfeuer-Raketen schlugen in einer Todeszone von 280 x 280 Metern ein, die etwa acht dicht bewohnte Häuserblocks umfasste. Mit dem neuen Leitsystem wäre eine viel kleinere Zielfläche möglich gewesen, allerdings hätte es dann eine weit geringere Opferzahl gegeben.
Die Kaskade einschlagender Gefechtsköpfe setzte Wolken von Brennstoff in den Straßen frei, vermischt mit Aluminiumpulver, dem Sprengstoff PETN und Ethylenoxidgas. Die entzündlichen Wolken drangen durch Ritzen und Spalten nahezu jeder Moschee, jedes Wohnhauses und jedes Ladengeschäfts in dem betroffenen Gebiet. Keller, Dachböden, Küchen, Toiletten und Schlafzimmer füllten sich innerhalb von Nanosekunden mit dem todbringenden Gemisch, es blieb keine Zuflucht.
Als Nächstes explodierten im Innern der Gefechtsköpfe Zerlegeladungen aus konventionellem Sprengstoff, entzündeten den explosiven Nebel und verwandelten ihn in eine glühende Plasmawolke. Jene Menschen, die den Einschlagstellen im Freien am nächsten standen, verbrannten augenblicklich zu Asche.
Sie zählten zu den Glücklicheren.
Die durch die Detonation erzeugte Druckwelle verursachte die ersten Zerstörungen, indem sie Tausende Kilo Druck pro Quadratzentimeter ausübte – genug, um den Rumpf eines U-Boots aus dem Zweiten Weltkrieg zu zerquetschen. Wer nicht sofort durch die ungeheure Wucht der Stoßwellen getötet wurde, erlitt schwerste Verletzungen. Gliedmaßen wurden ausgerissen oder gebrochen, Alveolen und Bronchiolen in den Lungen zum Platzen gebracht. In Koronar- und Zerebralarterien bildeten sich Embolien, Därme wurden perforiert, Haarzellen im Innenohr zerstört, Augen aus ihren Höhlen gerissen.
Die zerstörerische Kraft der sich ausbreitenden Druckwelle drückte Mauern, Fenster und Türen ein. Die Stadt selbst wurde zu einer Art Schrapnellgranate und schleuderte brennende Backstein-, Glas-, Holz- und Metallsplitter in den Feuersturm, der Weichteilgewebe und ungeschütztes Fleisch zerfetzte.
Aber das war noch nicht das Schlimmste.
Das Aluminiumpulver in der sich ausdehnenden Plasmawolke bremste deren Verbrennungsgeschwindigkeit, sodass der gesamte Luftsauerstoff verbraucht wurde. Das Ergebnis waren ein starker Unterdruck und ein Feuerball von annähernd 3000 Grad – doppelt so heiß wie der Schmelzpunkt von Stahl. Doch es war die Sogwirkung des Unterdrucks, die den größten Schaden anrichtete.
Keines der Gebäude, die noch standen, bot Schutz gegen diese Sogwirkung, die in puncto Energie und Zerstörungskraft ihrem Gegenteil gleichkam und glutheiße, orkanartige Winde erzeugte. Schreiende Überlebende wurden von herabstürzenden, tonnenschweren Trümmern erschlagen, in Kellern lebendig begraben, von zersplitterten Balken und verbogenen Metallteilen aufgespießt. Wer unter den Trümmern noch am Leben war, schnappte wie ein Karpfen nach Sauerstoff, den es nicht mehr gab, und erstickte in wenigen Minuten.
Auf den Straßen lachten keine Kinder mehr.
Der Feuerball der thermobarischen Sprengköpfe war kaum verglüht, da explodierten die ersten Gasleitungen, Benzintanks und andere Behälter mit entzündlichen Stoffen, fachten die Brände in den Trümmern zusätzlich an und verwandelten sie in ein unlöschbares Flammeninferno.
Innerhalb von Sekunden waren Tausende getötet und Tausende weitere verletzt worden. Und innerhalb von Stunden würden viele der Verletzten ebenfalls sterben.
Die Zerstörungskraft entsprach der einer taktischen Atombombe, doch die Waffe selbst war rein konventionell und laut internationalen Verträgen völlig legal.
Sie schuf die Hölle auf Erden.
3
Weißes Haus,
Washington, D. C.
Jack Ryan junior löffelte den Rest des deftigen Bœuf bourguignon und kratzte am Teller, als er das letzte herzhafte Fleischstück herausfischte.
»Einen Nachschlag, mein Sohn?«, fragte Cathy Ryan.
»Jederzeit, aber zwei Portionen genügen«, antwortete Jack. Bœuf bourguignon war sein Leibgericht, und niemand konnte es besser zubereiten als seine Mutter. Heute Abend war Jack mit seinen Eltern allein – die Zwillinge waren zu einer dreitägigen ökologischen Exkursion in die Virginia Wetlands gefahren, und seine ältere Schwester hatte im Krankenhaus Bereitschaftsdienst.
Jack und seine Eltern saßen an dem runden Tisch im privaten Esszimmer der First Family. Cathy Ryan hatte es in einem Craftsman-Stil renovieren lassen, der den klaren Linien und der robusten Funktionalität original amerikanischer Designkonzepte den Vorzug gab.
»Ich hoffe, du hast noch Zeit für den Apfelkuchen«, sagte sie und stand auf.
»Willst du mich auf den Arm nehmen?«, fragte Jack. Der Apfelkuchen seiner Mutter war sein absoluter Lieblingsnachtisch. Sein Argwohn wuchs. »Wieso bin ich eigentlich hier?«
»Braucht eine Mutter einen besonderen Grund, um für ihren Sohn zu kochen?«, konterte sie.
»Wenn eine Mutter so beschäftigt ist wie du, ja, dann braucht sie einen besonderen Grund.«
»Ich habe dich eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, und du fliegst bald nach Europa. Mir war klar, dass du dich nur mit einem selbst gekochten Essen zu einem Besuch überreden lässt.« Sie blickte zu ihrem Mann, der sich, Lesebrille auf der Nase, in einen Aktenordner vertieft hatte, der auf dem Esstisch lag. »Hab ich nicht recht, Liebling?«
Senior grunzte. »Was? Ja. Das Essen war köstlich.«
Cathy runzelte zum Schein die Stirn. »He, mein Bester. Was ist da interessanter als wir?«
Senior schaute weiter in die Akte. »Ich würde es dir ja sagen, aber du hast keine Freigabe.«
Cathy Ryan sprang auf, wandte sich ihrem Mann zu, ließ sich in seinen Schoß plumpsen und schlang die Arme um seinen Hals. Dann beugte sie sich dicht an sein Ohr und flüsterte laut. »Wir haben Mittel und Wege, Sie zum Sprechen zu bringen, Mr. President.«
Senior lachte, klappte den Ordner zu, nahm die Brille ab und legte die Arme um die Taille seiner Frau. Die beiden tauschten einen Blick. Er flüsterte ihr etwas ins Ohr. Sie kicherte und versetzte ihm einen Nasenstüber.
Junior sah ihnen zu. Sie schmusten wie zwei verliebte Teenager. Das berühmteste Power-Paar der Welt. Sein Vater war der wohl bedeutendste Staatschef seiner Generation und diente in einer Stadt, die für skrupellosen Ehrgeiz und Eitelkeiten berüchtigt war, selbstlos in jeder Krise dem nationalen Interesse. Und seine Mutter war eine brillante Ärztin und kam ihren Pflichten als First Lady mit Eleganz und Würde nach. Sie war für seinen Vater der Fels in der Brandung.
Doch für Jack waren sie einfach nur Mom und Dad.
Er kam sich wieder wie ein kleiner Junge vor, der am Familientisch saß, aber in einem positiven Sinn. So hart sie auch arbeiteten, die Familie stand für sie immer an erster Stelle. Was er an Stärke, Ehrgefühl und Tugenden besaß, hatte er von diesen beiden. Er beneidete sie. Er und Yuki hatten ihre aufkeimende Romanze auf Eis legen müssen, da der Beruf sie beide zu stark in Anspruch nahm, und Skype war einfach nicht genug. Das wurde zu einem schmerzlich vertrauten Muster in seinem Privatleben. Er fühlte bereits die Leere ihrer Abwesenheit, so kurz ihre Affäre auch gewesen war. Seine Eltern waren in seinem Alter schon verheiratet gewesen. Selbst John Clark, der ewige Krieger, war verheiratet, und das seit vielen Jahren, und eine seiner Töchter war mit Ding verehelicht. Und Jacks Cousin Dom und Adara waren zusammen. Die Leistung keines Campus-Mitarbeiters schien darunter zu leiden, dass er eine feste Beziehung hatte.
Was also stimmte nicht mit ihm?
Alle drei Ryans standen auf, räumten den Tisch ab und trugen das Geschirr in die Küche. Senior kochte eine Kanne koffeinfreien Kaffee, während Cathy den Kuchen auftrug und Jack das Vanilleeis aus dem Kühlschrank holte. Die Küche war klein, aber groß genug für die wenigen Gelegenheiten, bei denen die First Family für sich selbst kochte. Da rund um die Uhr einige der besten Köche des Landes zur Verfügung standen und die beiden älteren Ryans mehr als Vollzeit arbeiteten, war selber kochen ein seltener Luxus.
Zehn Minuten später kratzte Junior das letzte Stück Granny Smith vom Teller, schob es in den Mund und genoss den süß-säuerlichen Geschmack, der genau so war, wie er ihn in Erinnerung hatte.
»Ich wünschte, du würdest dir diesen grässlichen Bart abrasieren«, sagte seine Mutter. »Ich vermisse dein Gesicht.«
»Ich bleibe mir nur treu«, erwiderte Jack. Er verschwieg ihr, dass er sein Aussehen deshalb regelmäßig veränderte, um nicht so schnell erkannt zu werden. Immerhin war er der Sohn berühmter Eltern, auch wenn die beiden alles getan hatten, ihre Kinder aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Manchmal trug er sogar Kontaktlinsen, um seine Augenfarbe zu ändern.
Nach der letzten Operation hatte er sich mit dem Gedanken getragen, in das Outfit eines glatt rasierten Börsenmaklers zu schlüpfen, der er mehr oder weniger ja auch war. Aber ohne Gesichtsbehaarung fühlte er sich etwas ungeschützt, auch wenn es manchmal am sichersten war, sich hinter dem Offensichtlichen zu verstecken. Er hatte beschlossen, den Bart zu behalten, aber zu stutzen.
Senior hatte sich wieder in die Geheimakte vertieft.
»Noch ein Stück Kuchen?«, fragte Cathy ihren Sohn.
»Nein, danke. Ich bin pappsatt.« Junior lächelte. »Das Essen war ausgezeichnet. Danke.« Er trank seinen restlichen Kaffee und setzte die Tasse ab. »Tja, ich muss dann langsam. Morgen geht mein Flieger.«
»Du fliegst doch ins ehemalige Jugoslawien, nicht wahr?«, fragte Cathy.
»Zuerst nach London, dann nach Ljubljana in Slowenien.«
»Dort soll es schön sein. Schick auf jeden Fall Fotos, ich bin neugierig. Was für finanzielle Interessen hat Hendley Associates da drüben?«
Senior spähte über den Rand der Brille hinweg, die auf seiner Nase saß. Seine Frau wusste nichts vom Campus – dem geheimen Team für Sondereinsätze, dem Jack ebenfalls angehörte. Sie wusste lediglich, dass Jack als Analyst für das Finanzunternehmen Hendley Associates arbeitete, das durch seine höchst erfolgreichen Investitionen und Treuhanddienstleistungen die Spezialoperationen des Campus finanzierte.
»Es geht um ein Unternehmen, das einen Börsengang an der NASDAQ anstrebt. Wir sollen uns ihre vorläufigen Finanzzahlen ansehen.«
»Klingt … langweilig«, sagte Cathy.
»Zahlen erzählen eine Geschichte, wenn man sie zu lesen versteht«, gab Senior zu bedenken und sah Jack an. »In dieser Hinsicht bieten Finanzanalysen ganz besondere Chancen, bergen aber auch Risiken.«
Junior schmunzelte über die Zweideutigkeit. Gerry Hendley traf alle Personalentscheidungen und informierte den Präsidenten nicht immer, wenn er dessen Sohn auf einen gefährlichen Einsatz schickte. Auch Jack tat das nicht.
»Nach dem, was man so hört, besteht in Slowenien nur ein einziges Risiko, nämlich dass man zu viel Sahnetorte isst.«
Jacks Vater schmunzelte. »Gut zu wissen.« Er wandte sich wieder seiner Lektüre zu.
Nur eine Handvoll Leute wussten, dass es die Idee des Präsidenten gewesen war, die Firma ins Leben zu rufen, und dass sein Freund, der frühere Senator Gerry Hendley, beide Seiten des Unternehmens leitete. Der Campus war eine private, geheimdienstliche Organisation und gegründet worden, um auf Wunsch des Präsidenten verdeckte Operationen durchzuführen, die normale Regierungsbehörden nicht übernehmen wollten oder konnten.
In einer vollkommenen Welt hätte es den Campus nicht geben müssen, aber der Sumpf aus skrupellosem Eigennutz namens Washington war alles andere als vollkommen, selbst nach Einschätzung der größten Schleimer unter seinen Bewohnern. In den Augen des Präsidenten war die Stadt ein riesiger Ringelpiez mit Anfassen, der nur gelegentlich durch Phasen der Klarheit und Zielstrebigkeit unterbrochen wurde, und nur dann, wenn das nationale Interesse den eitlen Pfauen auf dem Hill richtig vermittelt und begreiflich gemacht wurde.
»Also, ich habe mich gefragt«, sagte Cathy, »ob du mir nicht einen Gefallen tun könntest, wenn du da drüben bist.«
»Klar. Was du willst.«
Cathy ging zu einem Stuhl in der Ecke, auf dem eine braune Ledertasche stand. Sie ergriff sie und trug sie zum Tisch, entnahm ihr einen Ordner und legte ihn vor Jack hin, ehe sie sich setzte.
»Ich habe alte Krankenakten aus dem Johns Hopkins ausgemistet und bin dabei auf die hier gestoßen.«
Jack schlug den Ordner auf, der aus dem Jahr 1992 stammte. Unter dem steifen grünen Deckel kam ein Foto seiner Mutter zum Vorschein, sechsundzwanzig Jahre jünger, im weißen Arztkittel, auf ihrem Arm ein kleines Mädchen mit leuchtend blauen Augen und blondem Haar, das in die Kamera lächelte. Das heißt, mit einem blauen Auge. Das andere bedeckte ein dicker Verband.
»Ihr Name ist oder war Aida Curic. Sie war erst drei Jahre alt, als man sie damals zu mir brachte. Sie musste wegen einer Splitterverletzung am Auge operiert werden. Das war im Krieg.«
»In welchem?«, fragte Jack. »Nach dem Zerfall Jugoslawiens 1991 gab es mehrere.«
Senior klappte seine Akte zu. »Deine Mutter meint den Bosnienkrieg, in dem Serben, Kroaten und Bosniaken um ihre Unabhängigkeit kämpften – und ums Überleben. Sagt dir der Begriff ›ethnische Säuberungen‹ etwas?«
Jack nickte. »Klar. Eine Bevölkerungsgruppe versucht, eine andere auszurotten. Üble Sache.«
»In Bosnien wurde der Begriff erfunden. Bürgerkriege sind die schlimmsten. Es war der blutigste Konflikt auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg – schlimmer noch als die Invasion in der Ukraine vor ein paar Jahren. Schätzungen zufolge sind etwa 140 000 Menschen umgekommen, weil die UNO und die Europäer lange tatenlos zugesehen haben. Luftschläge der NATO waren nötig, um den Krieg zu beenden.«
»Wenn meine beiden Hobbyhistoriker einen Moment Zeit hätten, würde ich die Geschichte von Aida gerne zu Ende erzählen. Natürlich nur, wenn es recht ist.«
»Entschuldige«, sagten beide Jacks.
»Also, wie durch ein Wunder gelang es mir, ihr Auge und ihre Sehkraft zu retten. Nach dem Krieg holten ihre Eltern sie wieder nach Bosnien, und wenig später hörten sie auf, mir zu schreiben.« Cathy stiegen Tränen in die Augen. »Ich habe diese blauen Augen tausendmal in meinen Träumen gesehen, und ich weiß nicht, wie viele Kerzen ich im Lauf der Jahre für sie angezündet habe. Manchmal, wenn ich deiner Schwester Sally in die Augen geschaut habe, habe ich ihre gesehen. Ich weiß nicht, warum Aida eine solche Wirkung auf mich hatte, aber sie hatte sie, und schließlich musste ich sie vergessen. Doch als ich gestern auf ihre Akte gestoßen bin, hat das etwas in mir aufgerührt. Seitdem muss ich die ganze Zeit an sie denken.«
Cathy griff wieder in die Ledertasche und brachte einen verschlossenen Brief zum Vorschein. »Könntest du, wenn du da drüben bist, eventuell ein wenig Zeit erübrigen und nach Sarajevo fliegen, sie ausfindig machen und ihr den von mir geben?«
Sie reichte ihn Jack. Auf dem sonst leeren Umschlag stand nur der Name Aida in der eleganten und peniblen Handschrift seiner Mutter.
»Hast du versucht, ihre Adresse zu googeln?«, fragte Jack.
Cathy zuckte mit den Schultern. »Natürlich, aber Curic ist ein verbreiteter Name, deshalb ist nicht viel dabei herausgekommen. Auf Facebook war es nicht besser – und bei Twitter im Übrigen auch nicht.«
»Das FBI ist die größte Detektei der Welt, und du bist mit dem Chef verheiratet. Warum rufst du dort nicht an?«
»Weil es eine Privatangelegenheit ist. Ich werde meinen Mann nicht bitten, zu meinem persönlichen Nutzen öffentliche Mittel bereitzustellen.«
»Also ich stehe nicht auf der Gehaltsliste des Staates und werde es gerne tun. Ich wollte schon immer mal nach Sarajevo. Es soll eine tolle und geschichtsträchtige Stadt sein.«
Senior nickte. »Geschichtsträchtig, allerdings.«
Als Präsident Durlings Nationaler Sicherheitsberater hatte er Fotos von den Gräueltaten auf allen Seiten gesehen und Augenzeugenberichte darüber gelesen, als 1991 der Krieg ausbrach. Er hatte Durling zum Handeln gedrängt, doch die Europäer forderten die Amerikaner zur Zurückhaltung auf und versprachen, sich selbst um die Angelegenheit zu kümmern. Drei Jahre später steuerte ein japanischer Selbstmordpilot seine Maschine ins Washingtoner Kapitol, als dort eine Vollversammlung des Kongresses stattfand, und tötete Hunderte, darunter auch Präsident Durling, die Richter des Obersten Gerichtshofs und viele andere, ehe wenig später ein neuer Krieg im Nahen Osten ausbrach. Damals hatte der frisch vereidigte Präsident Ryan an der Situation in Jugoslawien nichts ändern können. Nach wie vor hatten die Menschen gelitten, und viele waren sinnlos gestorben, und bis heute fühlte sich Ryan mitschuldig, weil die Vereinigten Staaten nicht versucht hatten, den Krieg gleich nach Ausbruch im Alleingang zu stoppen.
Senior wiederholte fast im Flüsterton: »Sehr geschichtsträchtig.«
»Macht es dir auch wirklich nichts aus?«, fragte Cathy ihren Sohn. »Ich will dir keine Umstände machen.«
»Du machst mir keine Umstände. Es wird mir ein Vergnügen sein.«
4
Hama,
Syrien
Leutnant Dschabrailow folgte Hauptmann Walib um den TOS-2-Raketenwerfer »Sternfeuer« herum, der im Hof neben der Moschee parkte und mit Tarnnetzen vor den neugierigen Augen im Weltraum kreisender amerikanischer Satelliten geschützt war. Die Netze dämpften zudem das gleißende Sonnenlicht und sorgten für eine willkommene Abkühlung. Der groß gewachsene Tschetschene überragte den schmächtigen Syrer um Haupteslänge. Beide trugen Pistolen in Holstern. Walib ließ die drei russischen Soldaten zur Mittagspause wegtreten, während er mit Dschabrailow an dem Fahrzeug eine Inspektion vornahm.
»Ich habe noch mal über Ihren Vorschlag nachgedacht, Leutnant.«
»Und?«, fragte der Tschetschene.
Walib kniete in den Staub und kontrollierte ein Kettenglied. Oder tat jedenfalls so.
»Ihr … Kommandant. Ist er vertrauenswürdig?«
»So vertrauenswürdig wie Sie.«
Walib richtete sich wieder auf und sah Dschabrailow ins Gesicht. »Das bedeutet?«
Der große Tschetschene warf einen prüfenden Blick in die Runde. Sie waren allein. Trotzdem senkte er die Stimme und zuckte mit den Schultern. »Das bedeutet, dass ich seit unserer letzten Unterredung nicht an die Wand gestellt und erschossen worden bin. Also vertraue ich Ihnen. Und das bedeutet wohl auch, dass Sie mir vertrauen. Für meinen Kommandanten bürge ich mit meinem Leben.«
Walibs Augen verengten sich und musterten den anderen erneut. »Sie bürgen mit unser beider Leben.«
»Ich verstehe.«
»Und Sie haben keine Zweifel, dass wir es schaffen können?«
»Sonst würde ich hier nicht stehen.« Dschabrailow sah sich erneut um. »Und Sie sind sich sicher, dass Sie das durchziehen wollen? Danach gibt es kein Zurück mehr.«
Walibs Züge verhärteten sich. »So sicher wie noch nie. Lieber sterbe ich, als dass ich einen Rückzieher mache. Zweifeln Sie an mir?«
Der Tschetschene schüttelte den Kopf. »Ich vertraue auf Ihren Hass, Bruder. Und auf den Willen Allahs.«
»Dann wollen wir nicht mehr darüber sprechen. Und ich bin immer noch Ihr Vorgesetzter und nicht Ihr Bruder.«
»Jawohl, Herr Hauptmann. Was schlagen Sie vor, wann legen wir los?«
»Je eher, desto besser«, antwortete Walib, wandte sich ab und setzte seine halbherzige Inspektion fort. »Vor dem nächsten Feuereinsatz in dreizehn Tagen.«
»Wie wär’s mit heute Nacht?«
Walib wirbelte wieder herum. »Heute Nacht? Wäre das überhaupt möglich?«
Dschabrailow gestattete sich ein leichtes Grinsen. »Es ist alles vorbereitet.«
»Sie sind sich Ihrer Sache zu sicher, Leutnant. Sie konnten nicht wissen, wie meine Antwort ausfallen würde. Bis vor einer Stunde wusste ich es selbst nicht.«
»Ich habe gesehen, was beim Abschuss in Ihnen vorgegangen ist, Hauptmann.« Dschabrailows Gesicht verfinsterte sich. »Vor nicht allzu langer Zeit ist es mir ähnlich ergangen.« Seine Miene hellte sich ebenso schnell wieder auf. »Und ich wusste es auch deshalb, weil Allah mir sagte, dass es sein Plan sei.«
»Sie meinen den Plan Ihres Kommandanten?«
»Mein Kommandant ist ein Diener des Allmächtigen, so wie ich auch.« Der Tschetschene lächelte. »Und auch Sie, Hauptmann.«
»Vielleicht«, erwiderte Walib. »Wir werden es bald erfahren.«
»Was genau schlagen Sie dann für heute Nacht vor?«
In der folgenden Viertelstunde sprachen sie in gedämpftem Ton, während sie das klobige Panzerfahrgestell mit dem aufmontierten mächtigen Raketenwerfer in Augenschein nahmen und so taten, als prüften sie es auf Schäden, die Reparaturen erforderlich machten. Keiner, der ihnen von Weitem zusah, hätte sich etwas dabei gedacht oder auf das kurze Salutieren geachtet, mit dem sie den Gruß der dankbaren Wachen erwiderten, als die wieder ihre Posten bezogen.
Die zwei Verschwörer schieden voneinander. Jeder schlug eine andere Richtung ein, und die Entschlossenheit der Verdammten beschleunigte ihre Schritte.
Präsidentengebäude, Sarajevo,Bosnien-Herzegowina
Der türkische Botschafter schlürfte starken, schwarzen Kaffee aus einer Tasse aus feinem Porzellan. Seine Augen strahlten hinter einer Nickelbrille hervor, die auf einer markanten, scharfen Nase saß, darunter ein dichter, gepflegter Schnurrbart, so grau meliert wie sein nur noch spärlich vorhandenes Haar. Dies verlieh Botschafter Topal ein durchaus angenehmes, aber eulenhaftes Äußeres, das allerdings gut zu seinem Ruf als geduldiger und umsichtiger Diplomat passte.
Er saß am Schreibtisch dem bosnischen Präsidenten gegenüber, einem moslemischen Bosniaken. Tatsächlich war der Mann nur einer von drei bosnischen Präsidenten. Wenn ein Kamel ein Pferd war, das sich ein Komitee ausgedacht hatte, wie es im Sprichwort hieß, dann war der Präsident dieser ethnisch und kulturell gespaltenen Republik ein dreiköpfiges Kamel, ein kollektiver Staatschef: Er bestand gewissermaßen aus drei Präsidenten, einem Kroaten, einem Serben und einem Bosniaken. Immerhin waren die drei Präsidenten einer Meinung – wenigstens im Moment.
Topal hatte den bescheidenen Posten in der kleinen, aber unruhigen Republik aus mehreren Gründen angenommen. Einer war seine Faszination für ihre komplizierte Politik und Verwaltung. Bosnien-Herzegowina, kurz »Bosnien«, bestand aus zwei politischen Entitäten, die wie Staaten waren: der Föderation Bosnien-Herzegowina, in der überwiegend Kroaten und Bosniaken lebten, und der Republik Srpska, die mehrheitlich von Serben bevölkert wurde. Der neue Staat war das Produkt eines europäischen Projekts am Ende des Bosnienkriegs mit dem Ziel, die drei verfeindeten Bevölkerungsgruppen in einer friedlichen, liberalen und demokratischen Republik zu vereinen. Bislang hatte das Experiment funktioniert, wenn auch mehr schlecht als recht.
Doch seit einigen Jahren, ungefähr seit Topals Amtsantritt als Botschafter, erhoben ethnonationalistische Kräfte aus jeder Bevölkerungsgruppe die Forderung nach Unabhängigkeit voneinander. Und in den letzten Monaten war es überall in Bosnien zu kleineren aufständischen Aktionen gekommen, die offenbar auf das Konto wieder erstarkender ethnischer Milizen gingen. Regierungsgebäude wurden mit Parolen besprüht, Schaufenster eingeworfen, Autos in Brand gesteckt. Zum Glück waren bei diesen Akten des Vandalismus keine Menschen zu Schaden gekommen – zumindest noch nicht.
Serben, Kroaten und Bosniaken waren in den sozialen Medien gleichermaßen aktiv, überhäuften einander mit Vorwürfen, die sich auf Gegenwart und Vergangenheit bezogen, und maßten sich gleichzeitig eine moralische Überlegenheit über die »Fanatiker« an, die sie »unterdrückten«. Politiker aller Lager begannen auf lokaler und nationaler Ebene, ihre jeweilige ethnonationalistische Fahne hochzuhalten, weil sie sich von den zunehmenden Spannungen Vorteile versprachen. Und dies, obwohl die nationalen Polizei- und Sicherheitskräfte ihre Bemühungen verstärkten, Inlandsterror-Aktionen aufzudecken und zu verfolgen.
Die Spitzen der politischen Parteien entwickelten zusammen mit den drei bosnischen Präsidenten – den nominellen Chefs ihrer jeweiligen Parteien – einen ungewöhnlichen Plan, um die wachsenden Spannungen einzudämmen. Sie beschlossen, am selben Tag, an dem die allgemeinen Wahlen stattfanden, also in nur sechs Wochen, ein Referendum über die nationale Einheit abzuhalten. Sie wollten damit zeigen, dass die große Mehrheit der Bosnier – orthodoxe Serben, katholische Kroaten und muslimische Bosniaken – für den Verbleib in einem vereinten demokratischen Staat war. Und damit verbunden war die Hoffnung, dass ein erfolgreiches Referendum den erstarkenden nationalistischen Kräften einen Dämpfer verpassen und den regierenden Parteien, die es befürworteten, gleichzeitig die Wiederwahl sichern würde.
Die Initiative wurde von Demokraten jeder Couleur begeistert begrüßt und fand in den Meinungsumfragen breite Zustimmung, besonders in der Wirtschaft. Wenn Bosnien sich Hoffnungen auf einen EU-Beitritt in naher Zukunft machen wollte, musste es unter Beweis stellen, dass es eine stabile, funktionierende und pluralistische Demokratie war.
Die religiösen Führer aller drei Glaubensrichtungen unterzeichneten einen gemeinsamen Brief, in dem sie das Referendum befürworteten und sich für den Erhalt der nationalen Einheit aussprachen als einen praktischen Akt des Vertrauens in Gott und zueinander.
Doch in den folgenden Monaten verkehrten sich die Meinungsumfragen ins Gegenteil, vor allem als die Gewalt eskalierte. Nun bestand die reale Gefahr, dass das Referendum zur Einheit scheiterte. Und sollte es dazu kommen, würde Bosnien ohne Zweifel auseinanderfallen. Was im Jahr zuvor noch als einfache, vernünftige Lösung erschienen war, hatte sich mittlerweile zu einer gesellschaftlichen und politischen Krise erster Ordnung ausgewachsen.
Dies erklärte auch, dachte Topal im Stillen, warum der ihm gegenübersitzende bosniakische Präsident heute Nachmittag so erregt war.
»Es ist mir egal, was sie sagen. Das ist kein Akt religiöser Erneuerung«, erklärte der Präsident in Bezug auf die kürzlich erfolgte Ankündigung von serbisch-orthodoxer Seite, einen Erneuerungsgottesdienst abzuhalten. Sein rundes, glatt rasiertes Gesicht rötete sich mit jedem Wort mehr. »Es ist schlicht und einfach ein politischer Akt, der darauf abzielt, das Einheitsreferendum zum Scheitern zu bringen. Und Ivanovic weiß das. Und trotzdem will er daran teilnehmen. Was denkt er sich nur dabei?«
Topal stellte seine Tasse samt Untertasse auf den kleinen Tisch vor ihm. »Was soll Präsident Ivanovic denn sonst tun? Der Bischof ist sein Bischof, und seine orthodoxen Bürger sind Wähler. Wenn er dem Erneuerungsgottesdienst fernbleibt, sieht es so aus, als wäre er derjenige, der ein politisches Spiel treibt. Im Übrigen hätte noch vor zwei Wochen keiner von uns gedacht, dass das ein Problem werden könnte. Ich mache Präsident Ivanovic keinen Vorwurf. Ich glaube, da sind andere Kräfte am Werk.«
»Das glaube ich auch. Und wir wissen beide, welche.«
Bis zu dem serbisch-orthodoxen Erneuerungsgottesdienst waren es nur noch zwei Wochen. Als der Bischof von Sarajevo ihn für die örtliche Metropolie angekündigt hatte, und zwar als Freiluft-Taufgottesdienst im Olympiastadion, in dem mittlerweile Fußball gespielt wurde, rechnete man mit ein paar hundert, allenfalls ein paar tausend Teilnehmern. Wie die meisten Europäer begeisterte sich der durchschnittliche Bosnier gewöhnlich mehr für seinen örtlichen Fußballklub als für die Ausübung seiner Religion.
Doch mit der Bekanntgabe durch den Patriarchen der serbisch-orthodoxen Kirche – einen Staatsbürger der Republik Serbien, nicht der bosnischen Republik Srpska – wuchs das Interesse. Und als auch noch der Patriarch von Moskau, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, seine Teilnahme zusagte, kannte der Erneuerungseifer kein Halten mehr. Letzten Schätzungen zufolge hatten dreißigtausend orthodoxe Serben aus der ganzen Region die Absicht, das Stadion zu füllen, darunter viele von jenseits der serbischen Grenze.
»Für mich steht außer Frage, dass das den serbischen Nationalismus anheizt«, sagte der Präsident. »Und wenn Serben aufgerüttelt werden, dann werden es auch die katholischen Kroaten, von unseren Leuten gar nicht zu reden.«
Topal schüttelte den Kopf. »Keine Demokratie überlebt Identitätspolitik. Bosnier müssen sich immer an erster Stelle als Bosnier verstehen. In Ihrem Land werden alle Religionen respektiert, jeder hat die gleichen Rechte, und es hat Frieden geherrscht. Aber das alles gerät in Gefahr, wenn ethnische Identität wichtiger wird als demokratische Ideale.«
Der Präsident lehnte sich in seinem Stuhl zurück und legte die Fingerspitzen aneinander. »Wenn Bosnien zerfällt, wird es Ärger geben, genau wie früher.« Sein rundes Gesicht verfinsterte sich, überwältigt von den schmerzlichen Erinnerungen an Krieg und Völkermord.
»Mein Land steht Ihnen, Herr Präsident, und allen Bosniern zur Seite, besonders unseren muslimischen Brüdern und Schwestern. Ich denke, wir haben bewiesen, dass wir fest entschlossen sind, Sie und Ihre Demokratie zu unterstützen.« Topal war Diplomat genug, um die vielen Hundert Millionen türkischen Lira unerwähnt zu lassen, die seine Regierung in den letzten zehn Jahren nach Bosnien gepumpt hatte, viele davon unter seiner Regie.
»Die Türkei ist unser bester Freund, und wir sind für Ihr anhaltendes Engagement dankbar. Unsere beiden Regierungen verstehen, dass ein Scheitern der Demokratie in Bosnien eine Existenzkrise heraufbeschwören würde. Die Nationalismen würden sich weiter ausbreiten, und regionale Instabilität wäre die unvermeidliche Folge. Wenn sich Kroaten und Bosniaken bedroht fühlen, könnten andere Nationen – selbst die NATO – gegen die Serben intervenieren, um einen weiteren Genozid zu verhindern.«
Topal seufzte. »Ja. Und wenn die Serben bedroht werden, dann werden die Russen zugunsten ihrer slawischen Brüder eingreifen, um wiedergutzumachen, dass sie es in den Jugoslawienkriegen versäumt haben, Serbien vor der NATO zu schützen.«
»Wieder die NATO gegen Russland?« Der Präsident seufzte. »Wir sprechen vom Dritten Weltkrieg.«
»Das wäre eine Katastrophe, deshalb ist meine Regierung bereit, Sie und das Einheitsreferendum in jeder erdenklichen Weise zu unterstützen.« Topal beugte sich vor und lächelte. »Nur Mut, mein Freund. Noch ist Bosnien nicht verloren. Ich vertraue darauf, dass die demokratischen Kräfte siegen werden. Und wer weiß? Vielleicht wird der Erneuerungsgottesdienst zu etwas Positivem führen. Eine Glaubenserneuerung kann eine gute Sache sein.«
»In Anbetracht der Geschichte unseres Landes bin ich da weniger zuversichtlich. Aber ich danke Ihnen für Ihren Zuspruch und Ihre Freundschaft.«
Der Präsident erhob sich, und Topal folgte seinem Beispiel. Sie gaben sich die Hand. Der türkische Botschafter erhaschte durchs Fenster einen Blick auf einen Schwarm Rotdrosseln, der im Synchronflug ein hohes Minarett umkreiste. Er lächelte in sich hinein.
Ein wahrhaft gutes Zeichen.
5
Hama,
Syrien
Gretschkos schwerer Stiefel stand auf dem Gaspedal des kleinen UAZ-Kübelwagens, dessen Federung so miserabel war, dass er in seinem Sitz durchgeschüttelt wurde wie die Bohnen in einer Rumbakugel. Der UAZ zog eine Wolke aus aufgewirbeltem Staub und Granitsplitt hinter sich her und schlingerte so rasant, wie es der arg strapazierte Vier-Zylinder-Motor zuließ, die gewundene Straße zum Steinbruch entlang. Laut fluchend schaltete Gretschko in den engeren Kurven herunter, und der Lichtkegel der Scheinwerfer huschte über das verschlungene Labyrinth aus schroffen Felswänden, während er auf die Steinbruchsohle zuraste.
Sein Stiefel stieg auf die Bremse, und der Geländewagen kam vor der schweren Stahltür des Munitionsdepots, das tief in die Granitwand hineingehauen war, rutschend zum Stehen. Der Ort war für die Lagerung von Munition höchst ungewöhnlich, jedoch aus der Luft nicht zu sehen und daher auf keiner amerikanischen oder israelischen Liste mit Zielen für Luftangriffe verzeichnet. Über den Stahlbetonwänden türmten sich zusätzlich mehrere Hundert Tonnen Gestein, ein undurchdringlicher Schutzschild für den explosiven Inhalt.
Gretschko sprang in einer Staubwolke aus dem Wagen und stürmte an dem großen, abgedeckten Kamaz-Lkw mit Sechsradantrieb vorbei, der an der Seite parkte. Im Scheinwerferlicht des Kübelwagens bemerkte er auf einer der halb offenen Stahltüren dunkle Blutspritzer, die seine schlimmsten Befürchtungen bestätigten. Walibs Anruf hatte seinem Abend bei der talentierten, von ihm bevorzugten Vertragshure, einer rothaarigen Ukrainerin mit hohen Wangenknochen und unterentwickeltem Selbstwertgefühl, ein jähes Ende bereitet. Aber die Panik in der Stimme des Hauptmanns hatte ihn seinen Ärger vergessen lassen und davon überzeugt, dass der Syrer der Situation nicht gewachsen und die starke Hand eines Russen vonnöten war.
Gretschkos Augen gewöhnten sich an das trübe Licht im Munitionsbunker. Eine lange Spur aus Blut und Staub führte von der Tür zu Walib, der neben einem auf dem Boden liegenden Körper kniete. Gretschko ging in die Hocke und betrachtete das junge Gesicht des Toten. Einer der russischen Wachleute, ein Unteroffizier. An den Namen konnte er sich nicht erinnern. Der Schlitz in der Kehle war wie ein breites, blutiges Grinsen unter dem glatt rasierten Kinn.
»Was zum Teufel ist hier passiert, Hauptmann?«
»Weiter hinten liegen noch zwei Tote.« Walib erhob sich, während Gretschko eine Hand auf die starren Augen des jungen Unteroffiziers legte und sie sanft schloss.
Gretschko sprang auf, mit dem Rücken zu Walib. »Wir kriegen die Schweine, die das getan haben.«
Da bemerkte er, dass an der hinteren Wand Dutzende Kisten mit 122-Millimeter-Raketen fehlten. Er deutete auf die Lücken. Im übrigen Raum stapelten sich Kisten mit thermobarischen 220-Millimeter-Raketen, die für das System TOS-1A »Sonnenglut«, das noch im Land im Einsatz war, benötigt wurden.
»Walib! Die 122er!«
»Ja, ich weiß. Sie sind weg. Und ein Schmel ist auch weg«, sagte Walib, womit er einen RPO-A »Hummel« meinte, einen tragbaren thermobarischen Raketenwerfer.
»Machen Sie sofort eine Bestandsaufnahme«, sagte Gretschko, griff nach seinem Mobiltelefon und drehte sich um. »Ich verständige die Sicherheit …«
Walibs Pistole war auf ihn gerichtet.
»Nicht nötig. Ich weiß genau, wie viele Raketen fehlen.«
Gretschkos Augen weiteten sich vor Zorn. »Du dreckiger Verräter!«
Walib schmetterte ihm den Pistolengriff gegen die breite Stirn. Die Haut platzte auf, und Blut quoll aus der Wunde. Der Russe taumelte unter der Wucht des Hiebs, fiel aber nicht. Fassungslos wischte er sich mit dem behaarten Handrücken das Blut aus den Augen. Er wurde wieder klar im Kopf, stieß einen Schrei aus und packte Walib mit seinen dicken Fingern an der Gurgel. Doch der Syrer war darauf gefasst und hämmerte ihm den Stahlgriff der Pistole ein zweites Mal auf den Schädel. Gretschko stöhnte und knickte in den Knien ein. Mit einem widerlichen, dumpfen Geräusch schlug sein Kopf auf dem Beton auf wie eine reife Melone, die auf einen heißen Bürgersteig fiel.
Walib steckte die Pistole ins Holster.
»Warum haben Sie ihn nicht einfach erschossen?«, fragte Dschabrailow von der Tür her.
Ohne den Blick von Gretschko zu wenden, rief Walib über die Schulter: »Hier drin? Wollen Sie, dass Ihre Männlichkeit gegrillt und Ihr Gesicht frittiert ist wie eine Falafel, wenn Sie mit Ihren Jungfrauen zusammenkommen?«
Der Tschetschene grinste. »Wir müssen uns beeilen.«
Walib spuckte auf den Russen. »Eine letzte Sache noch, Leutnant, dann können wir gehen.«
Dschabrailow steuerte den schweren Lastwagen auf einem zweispurigen Asphaltband nach Westen, als ein greller Lichtblitz den mondlosen Himmel hinter ihnen durchzuckte.
Walib auf dem Beifahrersitz blickte auf die Uhr. Der Zeitzünder hatte perfekt funktioniert. Er stellte sich vor, wie die dicken Stahltüren des Bunkers im vernichtenden Feuer der weiß glühenden Gase wie Butter zerschmolzen, die Stichflammen im Steinbruch verpufften und nur Granit und Staub versengten, ohne dass ein einziger Zivilist Schaden nahm.
Walib hatte nicht nur das restliche thermobarische Arsenal zerstört, sondern damit gleichzeitig auch alle Spuren verwischt. Von den Leichen würde nichts übrig bleiben – nicht einmal Asche –, und nichts würde darauf hindeuten, dass die Kisten mit den Raketen, die der Lastwagen beförderte, gestohlen worden waren. Die Russen würden davon ausgehen, dass sämtliche Vermissten – die Wachleute, Gretschko, Dschabrailow und er selbst – bei einem Überfall durch die israelische Sajeret Matkal oder die iranische Quds-Einheit getötet worden seien. Die Möglichkeit eines Unfalls würden sie von vornherein ausschließen.
Zum ersten Mal seit langer Zeit war Walib glücklich. Und der Grund dafür war, dass er Gretschko eigenhändig getötet hatte. Das überraschte ihn. Er war Artillerieoffizier, kein Infanterist. Er hatte nie zuvor im Zorn oder im Nahkampf getötet. Vor heute Nacht war er sich nicht einmal sicher gewesen, ob er dazu überhaupt fähig war. Aber es war ihm schockierend leichtgefallen, das wütende Schwein zu töten, und es hatte ihm Genugtuung verschafft, die Wachen mit vorgehaltener Waffe zu zwingen, die Kisten mit den Raketen zu verladen, ehe Dschabrailows tückische Klinge sie wie Schlachtlämmer fällte. Auch ihretwegen hatte Walib keine Schuldgefühle. Rache schmeckte süßer, als er erwartet hatte.
Und heute Nacht war erst der Anfang.
Er lächelte.
»Was ist denn so lustig, Bruder?«, fragte Dschabrailow.
»Die Russen werden uns für das glorreiche Opfer, das wir gebracht haben, wahrscheinlich eine Tapferkeitsmedaille verleihen.«
»Eine Medaille wäre schön«, witzelte der Tschetschene. »Zu schade, dass wir sie nicht abholen können.«
»So wenig wie Gretschko.«
Die Erinnerung daran, wie der Kopf des Russen auf den Beton geklatscht war, brachte Walib erneut zum Lächeln. Vielleicht hatte Dschabrailow ja recht. Vielleicht vollstreckten sie wirklich den Willen Allahs. Walib hatte nie zuvor erlebt, dass ein Plan die erste Feindberührung überstand. Das allein war schon ein Wunder.
Alle Komponenten waren jetzt im Spiel. Vorausgesetzt, die Wachleute an dem Kontrollpunkt vor ihnen waren wie versprochen bestochen worden, hatten sie das Gröbste hinter sich. Der fremde Tschetschene – ein gewalttätiger und merkwürdiger Verbündeter – hatte bislang immer Wort gehalten. Walib freute sich auf die Begegnung mit Dschabrailows geheimnisvollem Kommandanten, denn dann begann die eigentliche Arbeit.
Kein Zweifel, Walib war jetzt ein anderer Mensch. Ein Mensch mit einer Mission.
Aber machte ihn das schon zum Mudschahed?
Wieder sah er auf die Uhr. Sie waren dem Zeitplan sogar voraus. »Wir werden noch vor Sonnenaufgang an der Küste sein.«
»Inschallah«, sagte der Tschetschene.
Walib tätschelte den schweren, schwarzen Pelican-Koffer zwischen ihnen, dessen Inhalt wichtiger war als das andere Gerät, das sie gestohlen hatten, sogar noch wichtiger als die Raketen auf der abgedeckten Ladefläche hinter ihnen. »Ja, das kann man wohl sagen.«
Inschallah.
6
Achtopol,
Bulgarien
Es war ein bescheidenes Haus mit einer unbezahlbaren Aussicht, oben auf dem Kamm einer Landzunge, die ins Schwarze Meer hinausragte.
Wladimir Wasilew besaß viele Häuser in ganz Europa, die weitaus größer waren und eine noch herrlichere Aussicht boten, doch Bulgarien war seine Heimat, hier hatte er sterben wollen.
Jeden Morgen, wenn er erwachte, flimmerte die aufgehende Sonne über dem weindunklen Wasser, und Licht strömte zum Fenster herein. Die Morgendämmerung war weniger eine Verheißung für den kommenden Tag als vielmehr eine funkelnde Erinnerung daran, dass er eine weitere angsterfüllte Nacht überlebt hatte. Und einen weiteren Tag hatte, um sich seinen allerletzten Wunsch zu erfüllen.
Die kleine, ghanaische Krankenpflegerin wechselte seinen Katheter mit routinierter Sachlichkeit, ohne bei der intimen Aufgabe zu lächeln oder die Stirn in Falten zu legen. Ihre üppigen Brüste spannten unter einem eng anliegenden, grünen Kittel, der ihren mächtigen Hintern nur mühsam im Zaum zu halten vermochte. Genau der Typ Frau, den Wasilew bevorzugte. Noch vor einem Jahr hätte er sie mit Kaviar vom Ossietra-Stör und edlem Champagner auf seiner Jacht verführt oder, wenn sie seinem Charme widerstanden hätte, mit Gewalt genommen. Doch heute Morgen regte sich nichts in seinen Lenden, obwohl ihre behandschuhten Hände an seiner schlaffen Männlichkeit herumfingerten.
Sie beendete ihre Arbeit, zog die Handschuhe aus und reinigte sich die Hände mit einem antiseptischen Gel, ehe sie ihn in einem nervösen, trällernden Englisch fragte, ob er noch etwas brauche.
Wasilew schüttelte den großen Kopf, auf dessen eingefallenen Wangen weiße Stoppeln sprossen. Sein Fleisch war blassgrau und mit braunen Leberflecken gesprenkelt wie der Hut eines Pilzes. Er hatte keinen Appetit, nur einen unstillbaren Durst von der Kanüle, die ihm unablässig Sauerstoff in die Nase blies. Beim direkten Trinken von Flüssigkeit erstickte er fast. Er konnte seiner ausgedörrte Kehle nur mit Eiswürfeln aus der großen Tasse auf dem Nachttisch Linderung verschaffen.
»Ist er noch da?«
Die Schwester nickte. »Er ist vor einer Viertelstunde gekommen. Ich habe mir gedacht, es ist Ihnen lieber, wenn er wartet, bis …«
»Schicken Sie ihn jetzt rein.« Er bezahlte ihr zu viel, um höflich zu sein.
»Selbstverständlich.«
Wasilew stellte mit einer Fernbedienung sein Bett höher, als seine Nummer zwei eintrat, ein groß gewachsener Tscheche – genau genommen ein Sudetendeutscher aus dem Erzgebirge – mit spröder, gelblicher Haut wie altes Pergament. Der lebenslange Raucher war nur fünf Jahre jünger als Wasilew und trotz seines leichenhaften Aussehens kerngesund. In all den Jahren, die Wasilew ihn kannte, hatte er keinen einzigen Tag im Krankenhaus verbracht.
Der Tscheche trug einen Stuhl zum Bett und nahm seinen Tirolerhut aus grünem Filz ab. »Wladimir, wie fühlst du dich heute Morgen, alter Freund?«
»Heute Nacht habe ich geträumt, dass Krabben auf mir herumkriechen und mir mit riesigen, roten Scheren die Eingeweide herausreißen.«
Der Tscheche schüttelte düster den Kopf. »Meine Frau ist an Krebs gestorben. Ich weiß, was das für Schmerzen sein müssen.«
»Trink eine Flasche Batteriesäure und scheiße eine Schachtel Dachpappennägel, dann hast du eine schwache Ahnung davon, was das für Schmerzen sind.«
»Es tut mir leid.«
»Nein, das tut es dir nicht. Du bist froh, dass nicht du in dem Bett hier liegst und ich auf dem Stuhl da sitze.«
Wasilew zuckte unter plötzlich einsetzenden Schmerzen zusammen. Er drückte auf den Morphium-Knopf in seiner Hand und verabreichte sich die nächste Dosis. Das Morphium wirkte immer weniger. Als die Schmerzen endlich nachließen, fragte er: »Bringst du mir Neuigkeiten von Rhodes?«
Der Tscheche schlug die Augen nieder und befingerte nachdenklich die rotgefleckte Feder, die im Hutband steckte.
Kein gutes Zeichen, wie Wasilew wusste.
»Leider noch immer kein Glück.«
»Glück? Mit Glück hat das nichts zu tun. Es kann doch nicht so schwer sein, einen Mann umzubringen, der in einer Gefängniszelle eingesperrt ist.«
»In einer amerikanischen Gefängniszelle«, protestierte der Tscheche. »Noch dazu in einem Bundesgefängnis. Und als ehemaliger Senator steht er unter strenger Beobachtung.«
»Du brauchst nicht mehr Glück«, sagte Wasilew. »Du brauchst mehr Geld. Erhöhe das Kopfgeld. Auf fünf Millionen Dollar.«
»Das ist eine hohe Summe.«
»Meine Geduld ist langsam am Ende. Ich fliege morgen in die Pariser Klinik.«
»Dann also fünf Millionen.« Der Tscheche hob die Augenbrauen. »Wie lange wirst du weg sein?«
»Zwei Monate, mindestens. Aber was bleibt mir denn anderes übrig?«
»Es ist ein kluger Schritt. Und es ist Paris.«
»Pah«, stieß Wasilew hervor und winkte mit einer ädrigen Hand ab. »Es handelt sich um eine medizinische Einrichtung am Stadtrand, und ich schmore in einem Quarantänekäfig ohne Erfolgsgarantie. Aber mein Arzt sagt, dass ich ohne diese neue, experimentelle Behandlung allenfalls noch sechs Monate zu leben hätte.« Der alte Bulgare zuckte zusammen. »Er hat sich fast in die Hose gepisst, als er mir das gesagt hat, daher vermute ich, dass es eher weniger sind.«
»Du wirst das schon schaffen. Ich habe mich über diese CAR-T-Zell-Therapie informiert. Sie ist das Allerneueste, was die westliche Medizin zu bieten hat.«
Seit seinen Recherchen schwankte der Tscheche zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Die Verzweiflung rührte daher, dass sich die bahnbrechende Therapie bei der Behandlung von Kindern mit Blutkrebserkrankungen als sehr wirkungsvoll erwiesen hatte. Bei der Therapie wurden dem Patienten natürliche, krebsbekämpfende T-Zellen entnommen, millionenfach vermehrt und gentechnisch so verändert, dass sie zu kleinen, zielsuchenden Raketen wurden, die, wenn sie dem Körper wieder zugeführt wurden, an den speziellen Krebszellen andockten und sie zerstörten. Theoretisch hatte Wasilew durchaus gute Chancen. Für den Tschechen hieße das, noch mehr Jahre unter der Knute des alten Killers, und er selbst wurde ja auch nicht jünger.
Seine einzige Hoffnung gründete sich auf andere klinische Studien, wonach die Bilanz bei der Behandlung fester Erwachsenentumoren wie bei Wasilew durchwachsen gewesen war. Die Chancen auf ein Ableben des bulgarischen Schlächters standen fünfzig zu fünfzig. Wasilews Todeslisten-Wahn hätte ein Ende und der Aufstieg des Tschechen könnte beginnen.
»Für die halbe Million Dollar, die mich das im Monat kostet, sollte ich es allerdings schaffen«, sagte Wasilew, keuchend vor Anstrengung. Er grinste verschmitzt. »Nach dieser Wunderbehandlung werde ich vielleicht ewig leben.«
»Nichts würde mich mehr freuen.« Der Tscheche erschauderte innerlich, verbarg seine Verachtung aber hinter einem Lächeln.
Wasilews Fixierung auf die Todesliste grenzte an Wahnsinn. Sie hatte das Eiserne Syndikat Millionen und mehrere wertvolle Mitarbeiter gekostet und ihm obendrein unnötige Aufmerksamkeit seitens staatlicher Behörden eingetragen. Zum Glück hatte ihre Organisation die Polizei und Sicherheitsbehörden der meisten Industrieländer bereits vor Jahren unterwandert, sodass Ermittlungen gegen das Syndikat schon im Keim erstickt werden konnten. Sonst wären sie mittlerweile alle hinter Gittern oder tot.
Hätte er das Sagen, dachte der Tscheche, hätte er die Todesliste abgeschafft, noch bevor das Morden begann. Rache um ihrer selbst willen war schlecht fürs Geschäft. Aber der Tscheche ergab sich in sein Schicksal. Solange die Todeskandidaten lebten und Wasilew atmete, hatte die Liste Vorrang vor allem anderen, auch vor dringenden geschäftlichen Angelegenheiten.
Der Tscheche hatte kurz in Erwägung gezogen, seinen bulgarischen Boss zu töten, als er diesem Wahnsinn verfiel, den Gedanken jedoch schnell wieder verworfen. Wasilew hatte ein System zum Schutz seiner Person errichtet, das »garantierter gegenseitiger Vernichtung« gleichkam. Falls Wasilew vor der Zeit unter verdächtigen Umständen das Zeitliche segnen sollte, würde ein geheimes Netzwerk von Killern seinen Tod rächen und zuallererst den Tschechen ins Visier nehmen, den ersten Anwärter auf den begehrten Thron, selbst wenn er unschuldig war. Dieser Umstand war dem Tschechen Anreiz genug, alles für Wasilews Sicherheit zu tun.
Die einzige andere Möglichkeit, Wasilews Wahnsinn zu beenden, bestand darin, die Todesliste so schnell wie möglich abzuarbeiten, bevor sie alle ruiniert waren.
Wasilew lachte grunzend. »Du bist ein guter Freund und ein guter Lügner. Das Syndikat wird in guten Händen sein, wenn du die Zügel übernimmst.«
Der Tscheche nickte. »Danke.«
Die Miene des Bulgaren verfinsterte sich. »Aber vergiss nicht: Rhodes muss vor mir sterben, sonst …«
Der Tscheche nickte grimmig, und der Hoffnungsfunke, der in ihm aufgeglommen war, erlosch wieder. »Ich verstehe.«
Dass Rhodes sterben musste, war klar. Es war das »sonst«, das ihn ernstlich beunruhigte. Es war Wasilews kryptisches Versprechen, ihn und seine Lieben noch aus dem Grab heraus abzuschlachten, wenn er diesen letzten Auftrag nicht erfüllte.
Er fürchtete Wasilew mehr als jeden anderen Menschen, den er je gekannt hatte, obwohl sie seit Jahrzehnten befreundet waren. Sein sterbenskranker Boss war einst Leiter des »Mordbüros« gewesen – der höchst geheimen Killerabteilung im mittlerweile aufgelösten Bulgarischen Komitee für Staatssicherheit. Wasilews Talent zum Töten wurde nur noch von seiner unbändigen Rachsucht gegen jene übertroffen, die ihn verraten oder im Stich gelassen hatten.
Am Ende des Kalten Kriegs hatten Wasilew und er zusammen mit mehreren Genossen aus Sicherheitsdiensten in ehemaligen Sowjetrepubliken das Eiserne Syndikat gegründet und ihre Mordkompetenzen und Geheimdienstressourcen zu einem riesigen kriminellen Netzwerk verflochten, dem inzwischen auch viele Kollegen im Westen angehörten. Wasilew hatte es von Beginn an geleitet, und der Tscheche war der Nächste in der Reihe.
Aber nur, wenn er diesen letzten Auftrag erledigte.
»Und der letzte Mann? Haben wir einen Namen?«, fragte Wasilew.
Der Tscheche beugte sich grinsend vor. »Ja. Wir haben ihn vor zwei Tagen in Erfahrung gebracht.«
»Wer ist es?«
Der Tscheche sagte es ihm. Er nannte ihm auch den Arbeitgeber des Mannes und berichtete von dessen direkter Verbindung zu Tervel Zvezdev, Wasilews Adoptivsohn, der letztes Jahr abgeschlachtet und zu Katzenfutter verarbeitet worden war. Die Amerikaner hatten Teile der zerstückelten Leiche eingelegt in einem Kimchi-Glas entdeckt – ein makabrer Scherz.
Keiner, der mit Zvezdevs schrecklichem Tod in Verbindung stand, lachte noch.
Wasilew hatte eine Todesliste mit den Namen derer erstellt, die er für Zvezdevs Ableben verantwortlich machte, darunter auch der Nordkoreaner, der keine Woche nach der Entdeckung Zvezdevs wegen einer anderen Angelegenheit von einem Exekutionskommando seiner eigenen Regierung erschossen worden war. Dass er an dem Koreaner nicht persönlich Rache nehmen konnte, erboste Wasilew und machte es für ihn und mithin für die gesamte Organisation umso dringlicher, dass der Rest auf der Liste liquidiert wurde. Zehn waren bereits erledigt, zwei blieben noch. Rhodes und dieser letzte Mann.
Wasilews Augen weiteten sich hoffnungsvoll. »Und?«
Der Tscheche zögerte, sein Grinsen erstarb. »Wir halten seine Firma, seine Wohnung und sogar sein Lieblingsrestaurant unter ständiger Beobachtung.«
»Er lebt also noch?« Wasilew brach in heftiges Husten aus, ein anhaltendes, seehundartiges Bellen und abgehacktes Röcheln, das einen gelblichen Auswurf aus der verkrebsten Lunge nach oben beförderte. Der Tscheche half ihm, sich aufzusetzen. Wasilews Gesicht war rot angelaufen, und lange, zähe Speichelfäden hingen von seiner wulstigen Unterlippe.
Der Tscheche griff nach der Kunststoffschale neben dem Bett und hielt sie Wasilew an den Mund. Er kämpfte selbst gegen einen Brechreiz an, während er zusah, wie der Bulgare blutige Schleimklumpen in die Schale spie.
Plötzlich stand die ghanaische Pflegerin in der Tür, die Augen sorgenvoll geweitet. »Ist alles in Ordnung …«
»RAUS!«, brüllte Wasilew sie an und schlug die Schale beiseite, sodass der eklige Glibber auf den Boden spritzte und sie nur knapp verfehlte.
»Ich komme später wieder«, erwiderte sie kleinlaut und flitzte wieder hinaus.
Wasilew japste vor Anstrengung nach Luft. Der Tscheche ließ ihn sanft wieder ins Bett zurücksinken und griff nach einem Papiertuch, um ihm den Mund abzuwischen, doch Wasilew schlug seine Hand weg.
»Ich will seinen Tod«, zischte er mit wogender Brust. Seine blutunterlaufenen Augen stierten zum fernen Horizont des offenen Meers.
Der Tscheche wischte sich mit dem Tuch sorgfältig den Schleim von der Hand. »Der Mann ist verreist. Er könnte überall sein …«
Wasilews Augen verengten sich. Er rang immer noch nach Atem. »Ich möchte seinen Kopf … in einer Schachtel … in meinen Händen … bevor ich sterbe.«
»Ich habe unsere besten Leute auf ihn angesetzt.«
»Ich scheiß auf deine besten Leute … und auf dich … wenn ihr das nicht hinkriegt.«
»Ich weiß.«
Wasilew packte den Tschechen mit seiner leberfleckigen Hand am Revers und zog ihn zu sich heran.
»Tu das für mich … ja … ich bitte dich … und dann … gehört das Syndikat dir.«
Wasilew bekam erneut einen Hustenanfall und drückte den Morphiumknopf.
»Ich hole die Schwester.«
Der Tscheche stürzte zur Tür, insgeheim hoffend, dass es um Wasilew geschehen sei, doch er wusste es besser. Der unstillbare Hass des Mannes war sogar stärker als sein metastasierender Krebs. Er hatte keine Wahl, er musste die verfluchte Liste vollends abarbeiten.
Senator Rhodes erledigen.
Und Jack Ryan junior töten.
7
Bei Vucevo, Republik Srpska,
Bosnien-Herzegowina
Der Kleinbus war mit acht fröhlichen Deutschen vollgepackt, Frischluftfanatikern in den Zwanzigern, darunter ein frisch vermähltes Paar. Er fuhr auf der zweispurigen Asphaltstraße mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit nach Süden, im Schlepp einen Anhänger mit zehn robusten Kajaks. Bewaldete Hügel säumten die Straße zu beiden Seiten, und in der Ferne ragten die schroffen Gipfel des Dinarischen Gebirges empor.
Der zweiunddreißigjährige Fahrer, Emir Jukic, war ein Bosniake aus Sarajevo und chauffierte seit mehreren Jahren abenteuerlustige Touristen zu seiner bevorzugten Kajakeinstiegsstelle an der Drina. Tatsächlich war er der wichtigste Fahrer von Happy Times! Balkan Tours. In seiner Zeit bei der Firma hatte er Reisende bis hinunter ins griechische Piräus oder zum Pauschalskiurlaub nach Österreich gefahren. Er kannte die Straßen und Ortschaften, die Berge und Flüsse seiner Heimat wie seine Westentasche. Seine funkelnden dunklen Augen, sein ansteckendes Lächeln und seine fundierten Kenntnisse der bosnischen Geschichte machten ihn bei Touristen sehr beliebt, sodass er mehr Stammkunden hatte als alle anderen Fahrer in Diensten des erfolgreichsten Reiseveranstalters der Region.