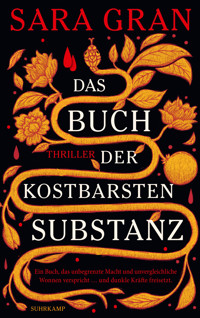12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Claire DeWitt ist zurück
Mit Claire DeWitt kehrt eine der überzeugendsten Ermittlerfiguren auf die Krimi-Bühne zurück. Von inneren Dämonen gepeinigt und den Rauschmitteln nicht abgeneigt, dafür aber mit fast schon überirdischem Spürsinn und Kampfgeist ausgestattet, löst sie ihre Fälle mit Bravour. Mal unkonventionell, mal gesetzwidrig, aber stets im Dienste der Wahrheit. In ihrem neuen Fall entgeht Claire DeWitt knapp einem Anschlag. Trotz zahlreicher Blessuren nimmt sie die Verfolgung des Attentäters auf. Nicht die beste Idee, wie sich zeigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Mit Claire DeWitt kehrt eine der überzeugendsten Ermittlerinnenfiguren auf die Krimi-Bühne zurück. Von inneren Dämonen gepeinigt und den Rauschmitteln nicht abgeneigt, dafür aber mit fast schon überirdischem Spürsinn und Kampfgeist ausgestattet, löst sie ihre Fälle mit Bravour. Mal unkonventionell, mal gesetzwidrig, aber stets im Dienste der Wahrheit. In ihrem neuen Fall entgeht Claire DeWitt knapp einem Anschlag. Trotz zahlreicher Blessuren nimmt sie die Verfolgung des Attentäters auf. Nicht die beste Idee, wie sich zeigt.
Claire DeWitt ist klug, ehrlich und philosophisch. Sie gibt sich keine Mühe, sympathisch oder kompetent zu wirken, und ist getrieben von einer grenzenlosen Neugier auf das Leben und seine Geheimnisse.
»Eine der originellsten Figuren der jüngeren Kriminalliteratur, als hätte David Lynch einen Roman von Raymond Chandler verfilmt.« CNN
Zum Autor
Sara Gran schreibt Romane, Drehbücher und gelegentlich auch Essays. Sie lebt im kalifornischen Los Angeles. Bislang hat sie fünf Romane veröffentlicht, darunter mit »Die Stadt der Toten« und »Das Ende der Welt« zwei Romane um die Ermittlerin Claire DeWitt. »Die Stadt der Toten« wurde mit dem Deutschen Krimi Preis ausgezeichnet.
Sara Gran
Das Ende der Lügen
Kriminalroman
Aus dem amerikanischen Englisch von Eva Bonné
Wilhelm Heyne Verlag
München
Tötet alle weisen Männer. Verbrennt alle Bücher. Das Königreich der Wahrheit ist dein Geburtsrecht, und zwischen dir und dem Königreich steht nur dein monströses, idiotisches Ich.
Jacques Silette, Détection
Kapitel 1
Der Fall des Unendlichen Asphalts
Oakland, 2011
Mit einem plötzlichen, erschreckenden Ruck kam ich zu Bewusstsein. Meine Augen klappten auf, hinein fuhr ein Strahl aus weißem, gleißendem Schmerz. Ich konnte nichts sehen als blendendes Licht. Ich kniff die Augen wieder zu.
Ich rang nach Luft …
Erinnere dich, erinnere dich.
Kann sein, dass ich schrie, denn ich hörte Schreie, und dann nahm ich wahr, wie jemand meine Hand drückte und sagte: »Alles okay. Alles okay.«
Ich verstummte.
Gedanken schlugen in meinem Kopf auf. Ein Unfall. Ich hatte einen Autounfall gehabt.
Ich erinnerte mich an ein riesiges Stück Metall, das die Fahrertür meines Autos durchbohrt hatte, und fing wieder zu schreien an.
»Okay, ganz ruhig«, sagte die Stimme. Sie gehörte einem Mann, ziemlich jung, vermutlich weiß.
Andere Geräusche legten sich um die Stimme, ich spürte kühle Luft im Gesicht. Ich war irgendwo draußen.
Wieder Geschrei, diesmal aber nicht von mir.
»Bin gleich zurück«, sagte der junge Mann. »Alles okay. Bitte nicht bewegen.«
Er ließ meine Hand los und verschwand.
Ich wusste, wer ich war, konnte es aber nicht in Worte fassen. Mein Name steckte irgendwo in meiner Kehle und schaffte es nicht, in den Mund aufzusteigen.
Ich versuchte, mich zu bewegen. Einige Körperteile gehorchten, andere nicht. Ich versuchte, den Arm zu heben. Mein Verstand brauchte mehrere Anläufe, um die richtigen Verbindungen zwischen Nerven, Muskeln und Gehirn herzustellen, aber nach einer Weile funktionierte es, und ich konnte mir eine Hand an die Augen heben. Ich versuchte wieder, sie zu öffnen. Es klappte, tat aber immer noch weh. Ich bemühte mich, nicht zu schreien. Meine Hand hob sich rot und schwarz von einem brutal hellen Hintergrund ab. Ein stechender Schmerz schoss in mein linkes Auge, ich kniff die Lider zu.
Ganz langsam, als wollte ich einen Verband entfernen, öffnete ich die Augen wieder. Sie gewöhnten sich an das Licht, und ich gewöhnte mich an den Schmerz.
Ich sah mich um. Ich war in Brooklyn. Nein, ich war in San Francisco. Nein, Oakland.
Ja. Oakland.
Alles in mir fing zu kreischen an, am lautesten das Adrenalin.
Denk nach, denk nach.
Wer war ich?
Claire DeWitt. Ich bin Claire DeWitt, und ich bin …
Eine weitere Erinnerung landete mit einem dumpfen Schlag:
Ich war im Auto unterwegs gewesen, erst auf der Interstate 80 und dann auf der 880 und …
Ich hatte einen Lincoln gesehen, Baujahr 1982. Der hatte sich durch die Fahrertür gebohrt.
Wer hatte am Steuer gesessen? Und wie konnte ich das herausfinden?
Die Erinnerung an den Crash stürzte auf mich ein und löschte alles andere aus. Mir wurde schwarz vor Augen.
Denk nach, denk nach.
Ich erinnerte mich: Ich bin Claire DeWitt.
Wollte ich früher nicht Detektivin werden?
Ja, wollte ich, und es hatte funktioniert.
Ich war Claire DeWitt, und ich war die beste Detektivin der Welt.
Denk nach, Claire, denk nach.
An welchem Fall arbeitete ich gerade?
Anscheinend lag ich auf einer Art Trage oder Pritsche. Ich setzte mich auf. Mein linkes Bein und fast alle Rippen heulten auf. Ich befand mich in einem Krankenwagen. Das grelle Licht kam von oben, die Türen standen offen. Ich schaute hinaus.
Die Sonne war untergegangen, der Himmel dunkel. Von meinem Auto war nur noch ein Haufen Schrott und Glassplitter übrig. Die Schreie – nicht meine, die anderen – stammten von einer Frau, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite neben einem Bündel stand, entweder ein Kleiderhaufen oder ein schwer verletzter Mensch. Ich sah, dass die Frau heftig aus einer Kopfwunde blutete. Ein Sanitäter – vermutlich derselbe, der eben noch meine Hand gehalten hatte – versuchte, ihre blutige Stirn zu untersuchen.
Überall blinkten und zuckten die Lichter von Polizeiautos und Krankenwagen, auf dem schwarzen Asphalt funkelten Scherben und Metallsplitter. Um den Kreis aus Ersthelfern hatte sich ein zweiter, größerer Kreis aus Schaulustigen gebildet, etwa ein paar Dutzend Leute. Über der ganzen Szene hing der Nebel eines schweren Verkehrsunfalls, es roch nach Rauch, Blut und Chaos.
Erinnere dich, erinnere dich.
Ich war Claire DeWitt, die beste Detektivin der Welt, und jemand hatte versucht, mich umzubringen.
Ich holte tief Luft. Die Frau kreischte und blutete. Ich hatte sie kurz vor dem Unfall gesehen, sie hatte beim Aufprall des Lincoln am Straßenrand gestanden.
»Heilige Scheiße«, hatte sie gerufen, »der will sie umbringen!«
Der.
Mein erster Hinweis.
Ich versuchte, mich auf den Lincoln zu konzentrieren, ohne von der Erinnerung überwältigt zu werden. Der Fahrer hatte einen Volltreffer gelandet. Der Wagen war direkt auf mich zugerast und hatte sich in die Fahrerseite meines Kia gebohrt.
Nein, kein Unfall. Versuchter Mord.
Mein zweiter Hinweis.
Ich sah mich um. Wir befanden uns auf einer breiten Straße irgendwo in der Nähe von Fruitvale.
Ich tastete meine Kleidung ab. Keine Waffen. Warum hatte ich den Revolver nicht dabei?
Ich erinnerte mich: Er war in meinem Auto. Ich hatte ihn mit Klebeband unter dem Beifahrersitz fixiert, weil das beim Fahren sicherer ist. Keine Chance, jetzt irgendwie dranzukommen.
Ich holte noch einmal tief Luft, sah mich um und erschrak: Der Lincoln war nicht mehr da.
Das Auto war ein verdammtes Monster. Wahrscheinlich hatte es nach dem Crash nicht mal eine Delle in der Stoßstange. Wer immer versucht hatte, mich umzubringen, war vermutlich noch in der Nähe und wartete auf eine zweite Chance.
Ich sprang von der Trage und sackte zusammen. Meine Knie gaben einfach nach.
Denk nach, Claire.
Ich konzentrierte mich auf meine Beine, die sich zu stehen weigerten. Das rechte schien in Ordnung zu sein, doch das linke wollte nirgendwohin. Ich verlagerte mein Gewicht auf das rechte Bein und stemmte mich hoch. Es klappte.
Ich musterte die Unfallstelle. Eine Waffe könnte ich jetzt gut gebrauchen, und den dazugehörigen Officer.
Ich zählte acht Verkehrspolizisten. In Oakland kannte ich jede Menge Cops, aber diese hier hatte ich noch nie gesehen. Sieben Männer, eine Frau.
Denk nach, denk nach.
Mein Atem ging schnell und flach, eigentlich mehr ein Keuchen. Ich zwang mich, langsamer zu atmen. Mein linkes Auge brannte, das linke Bein jaulte bei jeder Bewegung. Aber das Adrenalin dämpfte alle Empfindungen und sorgte dafür, dass der stechende Schmerz mich nach oben und vorn schob, statt mich nach unten und innen zu ziehen.
Ich wusste nicht genau, wo ich war und was ich wollte, aber plötzlich übernahm eine andere Macht. Sie war clever und gerissen und brauchte keine Worte. Ich wusste, sie würde mich am Leben halten, wenn ich sie nur machen ließ.
Ich sah mich nach einer Gehhilfe um. Da war keine. Ich versuchte, mich ohne fortzubewegen.
Der Schmerz schoss durch das linke Bein in meine Hüfte, ich erstarrte. Ich hob die Arme an, beide schienen unverletzt. Ich wagte einen zweiten Schritt, der sich kaum besser anfühlte.
Ich war mir nicht sicher, ob ich es schaffen würde.
Willst du leben?, fragte ich mich. Oder willst du hier bleiben und sterben?
Ich schluckte den Schmerz hinunter, kniff das verletzte Auge zu, sah mich um und zwang mich zum Nachdenken. Neben der Trage lag eine große blaue Regenjacke, wahrscheinlich gehörte sie einem der Sanitäter.
Ich schaute mich nach den Cops um. Die Frau stand in meiner Nähe. Sie bewachte die Unfallstelle und passte auf, dass sich niemand am Wrack meines gemieteten Kia zu schaffen machte.
Alle anderen waren beschäftigt, hauptsächlich mit der schreienden Frau.
Ich bewegte die Arme noch ein paar Mal, schüttelte das rechte Bein aus, knirschte vor Schmerz mit den Zähnen.
Losgehen oder sterben, sagte ich mir. Der Spruch war alt, und ich hatte ihn schon zu oft benutzt, aber es würde trotzdem funktionieren, denn er ist wahr.
Ich setzte mich wieder auf die Trage. Ich sah mich um, meine Gedanken rasten. An der Wand hing eine Taschenlampe. Ich zog sie aus der Halterung.
Rotes, blaues und weißes Licht zuckte durch den Krankenwagen. Ich schüttelte mir die Jacke von den Schultern, sie landete halb auf der Regenjacke. Auf der Trage lag ein dünnes, weißes Tuch, das ich über die Jacken breitete. Aus der Entfernung könnte es täuschend echt wirken.
Ich starrte die Polizistin an und zwang sie, sich zu mir umzudrehen. Hier wartet dein Schicksal, rief ich lautlos. Dies ist der Punkt, auf den dein Blick sich richten soll!
Nach einer Minute drehte sie den Kopf. Als sie sah, dass ich mich aufgerichtet hatte, öffnete sie den Mund, um ihre Kollegen zu rufen, aber ich legte mir einen Finger an die Lippen – Pssst – und zog ein zu Tode verängstigtes Gesicht. Das fiel mir leicht, weil ich wirklich Todesangst hatte.
Sie richtete ihre Aufmerksamkeit auf mich. Die Schlacht war halb gewonnen.
Ich zeigte hinter mir auf den Boden, wo die Jacken und das Tuch lagen. Die Lichter blinkten, sie konnte unmöglich sehen, ob das ein Haufen Kleidung war oder ein Mensch.
Er ist hier, formte ich lautlos mit den Lippen, ohne den Blickkontakt abreißen zu lassen.
Ich nahm den Finger vom Mund und zog ihn mir einmal quer über den Hals.
Er wird mich umbringen, bedeutete ich ihr.
Sie legte eine Hand an ihre Dienstwaffe, setzte sich in Bewegung und wagte sich Schritt für Schritt durch die Dunkelheit. Ihre Haut war glatt und schwarz, darauf schimmerte der uralte Code in Blau und Rot, Hilfe, Hilfe, Hilfe …
Langsam näherte sie sich dem Krankenwagen, wurde misstrauisch, zog die Waffe. Sie war fünf Schritte von mir entfernt, dann vier, drei, zwei, zuletzt einen.
Ich legte eine Hand an die Taschenlampe.
Ich sah immer noch ängstlich aus. Ich hatte Angst.
Sie hob die Waffe in der rechten Hand und beugte sich in den Krankenwagen.
»Nicht schreien«, sagte ich. Die Polizistin sah mich verwirrt an, und ich sog dem Universum so viel Kraft ab wie möglich und schlug ihr die Taschenlampe mit einer schnellen, flüssigen Bewegung aufs Handgelenk.
Sie ließ die Waffe fallen. Gott lächelte auf mich nieder. Die Waffe landete am Boden, ich bückte mich danach. Der Schmerz schoss durch mein Bein in meine Rippen, ich krümmte mich und sah Schwarz.
Ich fand die Waffe, richtete sie auf die Polizistin.
»Nicht schreien«, sagte ich. »Sagen Sie nichts.«
Sie sah verängstigt aus, und auch ziemlich sauer. Ich konnte es ihr nicht verdenken.
»Ich werde Ihnen nichts tun«, sagte ich, »es sei denn, Sie zwingen mich dazu. Und machen Sie sich keine Vorwürfe. Gegen Claire DeWitt kommt niemand an.«
Ich konnte mich nicht an alles erinnern, aber das wusste ich noch.
Am Ende gewinnt Claire DeWitt.
Sie sagte nichts, aber ich konnte sehen, was sie dachte: Wir werden ja sehen. Im Grunde dachte ich dasselbe. Wir werden ja sehen.
Es gibt für alles ein erstes Mal, und vielleicht war meine Zeit nun gekommen. Vielleicht würde ich dieses Mal verlieren.
»Und jetzt geben Sie mir Ihr Funkgerät«, sagte ich.
»Wie bitte?«, sagte sie.
»Ihr Funkgerät«, sagte ich. »Sie geben mir Ihr Funkgerät, ich gebe Ihnen die Waffe zurück, und dann werde ich verschwinden. Und wenn Sie nicht den Rest Ihres Lebens Telefondienst schieben wollen, weil ich jedem erzähle, wie ich Ihnen die Waffe abgenommen habe, lassen Sie mich gehen. Sie sagen, Sie wüssten nicht, was mit Ihrem Funkgerät passiert ist. Sie sagen, Sie hätten es irgendwo verloren. Okay?«
Sie schaute sich um. Sie sah aus, als wollte sie mich ins Gesicht schlagen. Sie sah aus wie …
Auf einmal hatte ich ein Gesicht vor Augen. Jung. Große, glänzende Augen. Der Attentäter? Nein. Zu dem Gesicht mit den glänzenden Augen fiel mir ein Name ein: Andray. Ich war auf der Suche nach Andray gewesen, und dann hatte ich einen Autounfall gehabt. Warum? Der Lama hatte mich angerufen und gesagt, Andray – ein alter Freund von mir, der eigentlich kein Freund war – sei in Schwierigkeiten. Der Lama war ebenfalls ein alter Freund von mir. Ich erinnerte mich an den Lama, und auch an Nick Chang und Claude und Tabitha. An alle, die ich verloren hatte – Constance und Kelly und Paul und …
Nein. Darüber könnte ich später noch nachdenken. Jetzt zählte nur, dass ich auf der Suche nach Andray gewesen war. Niemand außer Claude und dem Lama hatte davon gewusst. Vertraute ich ihnen?
Ja.
Ich würde mich wieder auf die Suche nach Andray machen, aber jetzt gab es eine Planänderung.
Zuerst musste ich mich darauf konzentrieren, mir selbst zu helfen.
Konzentrier dich, Claire.
Ich sah der Polizistin ins Gesicht. Sie war ebenso wütend wie verunsichert. Vielleicht eher wütend.
»Niemand kommt«, sagte ich, »niemand kommt, und niemand wird Ihnen helfen, denn es ist, was es ist. Es ist, was es ist, und es ist so, wie es immer sein sollte.«
Das klang merkwürdig, selbst in meinen Ohren. Meine Stimme war heiser und brüchig. Wind kam auf, eine kühle Brise streifte mein Gesicht und meine Hand und die Waffe. Mein linkes Auge brannte und zuckte.
Doch ich wusste, ich sagte die Wahrheit. So war es, so würde es immer sein, und es war genau so, wie es sein sollte.
Behauptete wer? Oder was? Dass ich auf diese Frage jemals eine Antwort finden würde, war mehr als zweifelhaft. Schon gar nicht heute. Aber ich fühlte es trotzdem, genau hier, vor dieser Polizistin, mit dieser Waffe in der Hand, an diesem Tatort mit Blutgeruch in der Luft …
Etwas hatte begonnen. Und noch viel mehr ging zu Ende.
Die Polizistin gab mir das Funkgerät, ich steckte es mir in den Hosenbund.
»Sie wollten raus ins echte Leben«, sagte ich. »Tja, willkommen!«
»Leck mich«, sagte sie und biss sich auf die Zunge.
»Du mich auch«, sagte ich, »und jetzt gibst du mir noch deinen Taser, denn irgendwie vertraue ich dir nicht mehr.«
Ich rutschte von der Trage und hangelte mich aus dem Krankenwagen.
Sie rührte sich nicht von der Stelle. Ich hielt die Waffe auf Hüfthöhe, um kein Aufsehen zu erregen, und drückte sie ihr an die Beinschlagader. Der Schuss wäre tödlich.
»Den Taser«, sagte ich.
Diesmal gehorchte sie. Sie wurde rot vor Wut.
»Da rüber«, sagte ich und zeigte auf eine Stelle gut einen Meter neben dem Krankenwagen. Sie ging hin. Ich hockte mich hin, warf die Waffe unter den Wagen und kam wieder hoch.
»Jetzt hängt alles von dir ab«, sagte ich. »Du kannst mich aufhalten und deinen Job verlieren, weil du dir von einer total unbeliebten Privatdetektivin die Waffe hast klauen lassen. Oder du lässt mich gehen, kaufst dir einen neuen Taser und vergisst das Ganze.«
»Dafür wirst du bezahlen«, sagte sie.
»Jede Wette«, sagte ich. Und dann dachte ich: Ich habe schon dafür bezahlt, und nicht zu knapp.
Sie warf sich auf den Boden und tastete nach der Waffe, und ich rannte los, beziehungsweise rannte, so gut es ging. Eigentlich war es eher ein schnelles Humpeln mit durchgestrecktem Bein. Ich biss die Zähne zusammen, um nicht zu schreien, und ich blieb erst stehen, als ich vier Querstraßen weiter in der Damentoilette einer Bar namens The Dew Drop Inn war, wo ich mir Blut und Glassplitter aus dem Gesicht wusch.
Oh, Mann. Weißer Lincoln, etwa Baujahr 1982. Ich wusste nicht gerade viel.
Während ich gerannt war, hatte ich mich an mich selbst erinnert, und an das, was mir passiert war. Ich war Detektivin. Ich löste Rätsel. Ich hatte Feinde. Der Fall der Taube mit den Gebrochenen Flügeln. Die Spur des Verlegten Pennys.
Eine Menge Leute wünschten mir den Tod. Ich hatte schon als Kind ermittelt. Ich löste Rätsel, die niemand lösen wollte. Ich hatte Fälle aufgeklärt, die einige Leben zerstört und andere gerettet hatten.
Eine Menge Leute wünschte mir den Tod, aber heute, das wurde mir klar, würde es besonders schwierig sein, mich zu töten. Seit dem Autounfall vor ein paar Wochen fuhr ich einen Mietwagen, und ich arbeitete nicht für einen Klienten, sondern auf eigene Rechnung. Was bedeutete, dass ich praktisch unmöglich zu orten war. Kein Klient, keine Spuren.
Wie gesagt, eine Menge Leute wünschten meinen Tod.
Die Frage war nur: Wer wollte, dass ich heute starb?
Kapitel 2
Spur zum Beinhaus
Brooklyn, 1985
Der Fall des Ertrunkenen Mädchens war gelöst.
Ich kannte das Mädchen im Wasser. Sie war ein Jahr jünger als ich. Ihr Herz war schwarz verkohlt, und mein erster Gedanke war: Wo immer sie jetzt auch ist, nach vierzehn Jahren im Feuer ist sie so vielleicht besser dran.
Kelly, Tracy und ich hatten gemeinsam ermittelt. Wir waren fünfzehn Jahre alt. Wir waren Detektivinnen. Wir hatten das Mädchen an einem Abend mit über dreißig Grad im warmen Wasser des Gowanus Canal gefunden, Brooklyns beschämendstem Gewässer. Ihre schmale Gestalt trieb mit dem Gesicht nach unten in einer weißen Wolke aus Kleiderstoff, ihre dunkle Haut schimmerte, die schwarzen Haare schwebten im Wasser wie Seetang.
Wir erzählten der Ermittlerin vom NYPD, die Stunden nach der Polizei und dem Coroner eintraf, was passiert war. Wir wussten, dass es mindestens bis zum Morgengrauen dauern würde, bis wir irgendjemanden für das Mädchen im Kanal interessieren konnten. Aber als die Ermittlerin dann endlich kam und wir ihr alles haarklein darlegten – der Stiefvater, die Mutter, der Selbstmord, das Geschwisterkind, das immer noch dort war –, begriffen wir, dass noch viele, viele Morgen grauen mussten, bevor irgendjemand sich für das Mädchen im Kanal interessieren würde. Erst wenn die Erde verwelkte, die Zeit stehen blieb, die Sonne zu einer Handvoll Asche verbrannt war, wenn das Jüngste Gericht bevorstand und wir aus unseren Särgen, Kanälen, Hinterhöfen und Schlafzimmern geholt und in den Himmel gerufen wurden – dann erst würde sich jemand für das Mädchen im Kanal interessieren. Vielleicht.
Viel wahrscheinlicher war, dass am Ende unsere Punkte zusammengezählt und unsere Karten gestempelt würden, dass man uns prüfte und zu dem Urteil gelangte, dass wir bis in alle Ewigkeit so entbehrlich sein würden wie heute.
Die Dämmerung kam und ging. Es wurde Mittag. Ich kehrte nach Hause zurück und versuchte zu schlafen. Ich konnte nicht schlafen, stand wieder auf und fing zu trinken an. Es war später Nachmittag.
Das Mädchen war wie ich gewesen. Wie ich, und niemand vermisste sie.
Acht Stunden später war ich wieder auf dem Spielplatz und legte mich auf eine Bank. Der Boden war voller zerbrochener Flaschen, möglicherweise war ich das gewesen. Ich war so betrunken, dass ich nicht mehr wusste, wie ich auf den Spielplatz gekommen war. Ich konnte nicht aufhören zu weinen, zu zittern und zu bluten. Offenbar hatte ich mich an den Scherben geschnitten. Da fiel es mir wieder ein. Ja, genau, nur zu dem Zweck hatte ich die Flaschen zerbrochen. Um allem ein Ende zu machen. Und niemand würde mich vermissen.
Aber zwei Menschen vermissten mich, und sie kamen, um mich zu retten.
Am ersten Tag der vierten Klasse in Brooklyns staatlicher Grundschule Nummer 108 saß ich neben Tracy Farrell. Saß ich an dem Tag zum ersten Mal neben ihr? Unterhielten wir uns da zum ersten Mal? Ich weiß es nicht mehr, aber es könnte sein. Zumindest wechselten wir an dem Tag zum ersten Mal mehr als nur ein paar Worte.
Dann entdeckte ich Tracys offiziellen Cynthia-Silverton-Detektivinnen-Decoder-Ring. Sie trug ihn am Ringfinger der linken Hand, als wäre sie verheiratet.
Cynthia Silverton, Junior-Spürnase und Teenager-Detektivin, war in meiner Jugend so etwas wie meine beste Freundin gewesen. Dass sie eine fiktive Figur war, machte es umso besser. Meine Beziehungen zu echten Menschen mit Blutkreislauf und Ansprüchen empfand ich als enttäuschend und unberechenbar. Aber Cynthia war perfekt, besonders, wenn sie einmal nicht perfekt war.
Ich kannte Cynthia aus ihren Abenteuern im Cynthia Silverton Mystery Digest, einer Mischung aus Comics, Cynthia-Silverton-Kurzgeschichten und echten Kriminalfällen, die man von zu Hause aus lösen konnte. Ich holte mir die Hefte jeden Monat aus dem Büchereibus, der als Ersatz für eine echte Bücherei in unserer Straße herumstand. In ihrer kleinen, von überdurchschnittlich viel Kriminalität geprägten Heimatstadt Rapid Falls war Cynthia die beste Detektivin. Seit ihre Eltern bei einem rätselhaften Autounfall gestorben waren, lebte Cynthia mit ihrer ergebenen, bodenständigen Haushälterin Mrs McShane zusammen. Am Community College, wo sie unter der Anleitung des weisen Professor Gold Kriminologie studierte, galt sie als Überfliegerin. Cynthias Leben in dem wohlhabenden, sonnigen amerikanischen Vorort hätte mir nicht fremder sein können als der Alltag der brasilianischen Yanomami.
Ich wusste nur, dass Cynthia Detektivin war, und irgendwie wusste ich, dass das auch auf mich zutraf.
»Hinter jedem gebrochenen Frauenherz«, sagte Professor Gold, als Cynthia am Fall des Skifahrers zu verzweifeln drohte, »steht ein Mann mit einem Presslufthammer.«
Selbstverständlich löste Cynthia den Fall. Cynthia löste jeden Fall.
Ab dem Moment, wo ich den Ring entdeckt und begriffen hatte, dass Tracy in die Geheimnisse von Rapid Falls eingeweiht war, gehörten wir zusammen. Beste Freundinnen für immer. Sie stellte mir ihre andere beste Freundin vor, die ebenfalls eingeweihte Kelly. Cynthia Silverton zog uns an wie ein Magnet.
Wir wohnten in einer Gegend, in die niemand freiwillig gezogen wäre. An so einem Ort endete man, oder man versuchte zu entkommen. Tracys Vater war Ire, die Vorfahren ihrer Mutter stammten aus Brooklyn und Europa. An ihre Mutter, die sie im Alter von zwei Jahren verloren hatte, konnte Tracy sich nicht erinnern. Tracys Vater war ein netter Kerl und ein schlimmer Alkoholiker. Er und Tracy wohnten in der Sozialsiedlung gegenüber unserer Villa, aus New York war er kaum je herausgekommen. Wenn er einen Job hatte, arbeitete er auf einem der Docks in der Nähe des Kanals, in dem wir das Mädchen mit den schwarzen Haaren gefunden hatten. Wenn er nicht arbeitete, trank er. In guten Zeiten verdiente er nicht schlecht und gab sein Geld bereitwillig für Tracy aus: Stiefel von Doc Martens, Vintage-Kleider, Bücher. In schlechten Zeiten, wenn er trank, bekam Tracy ihr Essen von mir oder Kelly.
Kelly lebte mit ihrer Mutter in einer Mietwohnung um die Ecke. Früher einmal hatte Kellys Mutter entkommen wollen, aber dann war sie früh schwanger geworden und in der Wohnung ihrer Eltern geblieben. Sie schaffte es nie, Geld zusammenzukratzen und die Wohnung zu kündigen. Genauso wenig schaffte sie es, sie als ihr Zuhause zu akzeptieren. Dass ihr Kind sie in die Falle gelockt hatte, verzieh sie ihm nie.
Unser gigantisches, bröckelndes Haus stammte ungefähr aus dem Jahr 1850 und nahm einen halben Block ein. Aus irgendeinem Grund hatte es den Stadtplaner Robert Moses ebenso überstanden wie die allumfassende Erosion des sozialverträglichen Kapitalismus. Meine Eltern hatten das Haus und alles darin geerbt. Für die DeWitts war Arbeit ein Schimpfwort. Angeblich stammten wir von Marineoffizieren oder Walfängern oder Sklavenhändlern ab. Die Geschichte variierte, je nachdem, wer sie erzählte, wie viel der Erzähler getrunken hatte und was er vom Zuhörer wollte. Andere DeWitts, Verwandte meines Vaters, kamen nur selten zu Besuch. Die meisten waren normale, anständige, wohlhabende Leute, die nichts mit uns zu tun haben wollten. Nur gelegentlich schauten ein Onkel oder ein verarmter Cousin vorbei, im Schlepptau ständig wechselnde Ehefrauen und mürrischen Nachwuchs, der viel älter war als ich. Man betrank sich, und irgendwann kam es zwischen mindestens zwei der Beteiligten zum Streit, manchmal auch zu Handgreiflichkeiten. Meistens ging es um unbedeutende Familiengeheimnisse aus der Vergangenheit, die zufällig mit Geld zu tun hatten. Selbstverständlich hatte Cousin Philip rein juristischeinen Anspruch auf ein Zweiunddreißigstel des Grundstücks an der australischen Goldküste, aber alle wussten, natürlich wissen sie es, Scheiße nochmal, jetzt tu nicht so, als hättest du keine Ahnung, dass Onkel Hammond es Josephinas Kindern vermachen wollte und es bloß nicht rechtzeitig geschafft hatte, sein Testament zu ändern. Josephinas Kinder haben den Strand geliebt wie ihre Mutter, sie zu entwurzeln war eine Schande, eine verdammte Schande!
Das Haus hatten sich meine Eltern durch ein paar komplizierte, halbseidene Schachzüge gesichert, die ich nie ganz durchschauen konnte. Meine Mutter, die bei jeder meiner Nachfragen aus einer anderen europäischen Stadt zu stammen behauptete, war sehr geschickt darin, die Leute ohne jede Gewaltanwendung auszurauben. Der Anwalt, der meinen Eltern geholfen hatte, sich das Haus anzueignen, rief regelmäßig an, um sein Honorar einzufordern. Meine Mutter lachte ihn aus. Mein Vater gab vor, kein Interesse an Geld, Statussymbolen und Häusern zu haben. Stattdessen sammelte er Bücher, trank und flirtete mit jüngeren Frauen. Wenn er abends allein in seiner Bibliothek saß, schimpfte er auf jeden, der mehr hatte als er. Also auf alle.
Die eine Hälfte der Zimmer rottete ungenutzt vor sich hin, und überhaupt hatte Brooklyn sich seit der Ankunft der ersten DeWitts sehr verändert. Die Mehrheit der Bewohner unseres Viertels war schwarz, die Minderheiten puertoricanisch und dominikanisch. Abgesehen davon gab es eine chinesische Familie in der Sozialsiedlung, eine pakistanische am Ende der Straße, dazu Tracy, Kelly und mich. Meine Familie bestand ausnahmslos aus Rassisten, was es meinen Eltern umso leichter gemacht hatte, sich das Haus unter den Nagel zu reißen. Sie waren nicht weniger rassistisch als ihre Verwandten, aber ungleich verzweifelter.
Dass Tracy an jenem Tag in der vierten Klasse den Cynthia-Silverton-Decoder-Ring am Finger trug, wunderte mich seltsamerweise kein bisschen. Damals wusste ich noch nicht, dass von dem Magazin nur wenige Hundert Kopien gedruckt und noch weniger ausgeliefert worden waren und dass ich ein Vierteljahrhundert später die letzte Ausgabe finden würde. Ich wusste nur, dass meine beste Freundin Cynthia mir alles gezeigt hatte, wofür es sich zu leben lohnte: Rätsel, Lösungen und zwei Mädchen, die mich nicht nur genug mochten, um mich zu vermissen, sondern um mich zu suchen und zu retten.
Wie sie mich gefunden haben, weiß ich nicht. Später erzählte Tracy mir, sie hätte geschlafen und von mir geträumt. Tracy schilderte mir ihren Traum, während sie und Kelly das Blut und den Dreck von mir abwuschen. Ich saß in Tracys Badewanne und konnte nicht aufhören zu weinen.
»In meinem Traum«, sagte Tracy, »musste ich dich unbedingt finden. Da hat jemand vor einem Haus auf dich gewartet. Das Haus war rosa. Eine Frau hat gewartet, ich konnte sie nicht erkennen, aber ich wusste, sie war deinetwegen da. Sie brauchte dich. Ich wusste, dass du es ohne meine Hilfe nicht in die Straße mit den rosa Häusern schaffen würdest. Die Frau hat in den Park gezeigt. Ich bin aufgewacht, und dann haben wir dich gefunden.«
Neun Jahre später stand ich in der Straße mit den rosa Häusern. Da war Tracy längst verschwunden, und Kelly redete nicht mehr mit mir.
»Ich will sterben«, sagte ich in der Badewanne.
»Wir alle werden sterben«, sagte Kelly, die immer schon sehr praktisch veranlagt war. »Aber nicht heute.«
»Niemand von uns wird sterben«, sagte die weniger praktisch veranlagte Tracy und klebte mir Pflaster auf die Handgelenke. »Weil wir einander retten werden. Wir werden uns selbst retten.«
Und irgendwie kam es genau so. Tracy rettete mich. Kelly rettete mich. Wenn ich stürzte, halfen sie mir auf die Beine. Wenn ich mich schnitt, legten sie einen Verband an.
Und später dann, als sie mich brauchten, verließ ich Brooklyn und ließ sie im Stich.
Tracy verschwand ein gutes Jahr nachdem sie meine Schnittwunden gewaschen und die Spuren meines halbherzigen Versuchs bandagiert hatte. Die Polizei suchte nach ihr, ich suchte nach ihr, Kelly suchte nach ihr. Vor diesem Fall – dem einzigen, der mir etwas bedeutete – hatte unsere Aufklärungsquote bei hundert Prozent gelegen.
Aber wie und warum Tracy eines Nachts aus der U-Bahn-Station Brooklyn Bridge verschwunden war, hatten wir nie aufklären können. Wir konnten keine Hinweise finden und keinen einzigen Zeugen, kein Gerücht und keinen Fingerabdruck.
Tracy war für uns da, bis ich keine Lust mehr hatte, für sie da zu sein. Bis ich entschied, dass die Welt zu bereisen, eine große Detektivin zu werden und mein vermeintliches Schicksal zu erfüllen wichtiger war als die Menschen, die mich wider besseres Wissen liebten.
Ich kehrte Brooklyn den Rücken und blickte nie, nie wieder zurück.
Kelly weigerte sich, mit mir zu reden, aber alle ein oder zwei Jahre rief sie trotzdem an, um mir von irgendwelchen Hinweisen zu berichten – ein Fingerabdruck, ein U-Bahn-Ticket, eine Spraydose mit Farbe.
Ich wurde die beste Detektivin der Welt, genau wie ich es mir erträumt hatte. Ich lernte Könige und Magier kennen. Ich löste die Rätsel meiner Klienten und förderte ihre Geheimnisse zutage. Ich trat in ihr Leben, riss es nieder und fand genau das, was sie brauchten, um ihr Leben wieder aufzubauen. Ich traf Menschen, die auf Erden alles besaßen außer dieser einen Sache, die sie am wenigsten wollten und am meisten brauchten: die Wahrheit.
Ich löste jeden Fall, der mir unterkam.
Außer meinen eigenen.
Kapitel 3
Der Fall des Unendlichen Asphalts
Oakland, 2011
Ein Mann namens Eric hämmerte gegen die Klotür.
»Ich bin’s, Eric«, sagte Eric immer wieder. »Jen, komm da raus und sprich mit mir. Das wäre vernünftig. Das wäre nur fair. Hör mich an. Nun komm schon!«
Ich schaute einäugig in den Spiegel. In meinem Gesicht entdeckte ich ein halbes Dutzend kleinerer Schnitte und einen großen unter dem linken Auge, der wahrscheinlich genäht werden musste. Ich würde darauf verzichten.
Ich untersuchte meinen Körper. An meiner linken Hüfte sah ich eine riesige Rötung, die vermutlich mit dem Schmerz im Bein zusammenhing. Ich hatte ihn auf den linken Oberschenkel eingegrenzt – eine heftige Prellung wahrscheinlich, vielleicht auch ein Muskelfaserriss. Über den rechten Oberschenkel und das rechte Knie zog sich eine lange Schürfwunde, die meine Jeans mit Blut getränkt und die ich nicht mal gespürt hatte, weil der andere, stärkere Schmerz sie ausblendete. Abgesehen davon hatte ich anscheinend nur innere und unsichtbare Verletzungen davongetragen. Ich spürte angeknackste Rippen. Das kalte Wasser hatte Linderung gebracht, aber mein linkes Auge brannte immer noch. Wahrscheinlich hatte ich eine Schramme auf der Hornhaut.
Ich suchte meine Taschen ab. Meine Geldbörse war weg, aber ich fand hundertachtzig Dollar in bar. Dazu hatte ich den Taser und das Funkgerät.
Ich beugte mich vor und schüttelte meine Haare aus. Das Blut schoss mir ins Gehirn, fast wurde ich ohnmächtig. Ich sah Funken und schwarze Punkte, klammerte mich ans Waschbecken und wartete ab. Glassplitter und Metallspäne rieselten zu Boden. Ich richtete mich ganz langsam wieder auf.
Niemand hatte mich durch die Bar gehen sehen. Ich wartete, bis Eric aufgegeben hatte, dann öffnete ich die Tür und suchte den Raum nach einer passenden Kombination aus Hautfarbe, Alter und achtlos abgelegter Handtasche ab.
Acht Sekunden später hatte ich sie gefunden, gleich neben der Tür. Sie war mit Freundinnen da, eine Weiße in meinem Alter mit rotblond gefärbten Haaren. Ihre Handtasche baumelte von der Rückenlehne ihres Stuhls. Sie trug enge Jeans, weiße Stiefeletten mit hohem Absatz und ein ärmelloses Shirt, das mit Sportabzeichen bedruckt war. Ihr Gesicht war kantig und voller überschminkter Aknenarben. Wahrscheinlich würde ich in Zukunft ähnlich aussehen. Ihr Blick unter dem rotblonden Fransenschnitt wirkte offen und verletzlich. Sie hatte sich gegen alle Wahrscheinlichkeiten aufgelehnt und versuchte, in einer Absteige im finstersten Teil von Oakland Spaß mit ihren Freundinnen zu haben, und irgendwie wirkte sie tatsächlich glücklich, als erlebe sie einen dieser einfachen, seligen Momente, die alle Theorie Lügen strafen und so selten sind, dass man, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, heulen könnte. Ich jedenfalls.
Es tut mir so leid, dachte ich in die Richtung der rotblonden Frau. Es tut mir so leid, dass ich ich bin und du du und dass sich unsere Wege auf diese Weise kreuzen.
Andererseits hatte mich mein Mitleid noch nie von irgendetwas abgehalten, auch heute nicht. Ich ging zum Tresen und bestellte eine Cola. Es war dunkel, und ich hielt den Kopf gesenkt, der Barkeeper und ich nahmen einander kaum wahr. Die Bar war so schummrig, dass niemand die Schnittwunden in meinem Gesicht sehen würde, und außerdem so heruntergekommen, dass keiner sich daran gestört hätte. Ich nahm die Cola und ein paar Servietten und tat so, als wollte ich hinter der Frau vorbeigehen. Ihre Stiefeletten waren aus dem gleichen weißen Leder wie ihre Handtasche, billig und wunderschön.
Hinter ihr – ich hatte den Ausgang fast erreicht – stolperte ich, verschüttete die Cola und ruinierte die weißen Stiefel der Frau.
Noch bevor sie begriffen hatte, was los war, ging ich in die Hocke und fing an, die Sauerei aufzuwischen.
»Oh mein Gott«, sagte ich, »das tut mir so leid!«
»Was?«, fragte sie, beugte sich vor und verstand. »Ach, das macht nichts. Warten Sie, ich …«
»Nein, nein, ich mache das«, sagte ich.
Sie beugte sich hinunter, um mir zu helfen.
»Ich hole noch mehr Servietten«, sagte ich. »Eine Sekunde …«
Während sie vornübergebeugt saß, richtete ich mich auf, zog die Handtasche von der Stuhllehne und ging hinaus. Die kühle Abendluft erweckte mich wieder zum Leben. Ich biss die Zähne zusammen, um den Schmerz nicht zu spüren, und humpelte davon.
Ich musste an ihren verdorbenen Abend denken, an das Geld, auf das sie dringend angewiesen war, und ich wusste, eines Tages würden wir alle in höhere Sphären aufsteigen, und ich würde für den Mist, den ich gebaut, und das Leid, das ich anderen zugefügt hatte, bezahlen müssen.
Aber bis zu dem Tag würde ich die Gewinnerin sein.
Ein paar Straßen weiter blieb ich stehen und schaltete das Funkgerät ein. Anscheinend hatte die Frau mit der blutigen Stirn eine ziemlich konkrete Beschreibung des Lincoln abgeliefert, denn inzwischen waren mindestens zwei Streifenwagen auf der Suche nach dem Auto. Ich hegte überhaupt keine Zweifel, dass der Lincoln noch fahrtüchtig war. Das Ding war ein Monster.
Ich untersuchte den Inhalt der Handtasche. Ein Handy ohne Passwortschutz und eine Geldbörse ohne Geld, dafür aber mit zwei Kreditkarten, einer Scheckkarte und einem auf den Namen Letitia Parnell ausgestellten Führerschein. Bestimmt nannten alle sie Letty.
Und ein Pillenfläschchen mit Namensetikett. Die Pillen gehörten einer gewissen Catherine Farmer, der Wirkstoff kam mir nicht bekannt vor. Dexmethylphenidat. Sicher hätte Letitia Parnell mich aufklären können, schließlich gibt es nur einen einzigen Grund, die Tabletten anderer Leute zu stehlen.
Aufputschmittel oder Tranquilizer?
Dexmethylphenidat. Ich fertigte rasch eine kleine Übersetzung aus dem Lateinischen an.
Aufputschmittel.
Ich warf mir zwei Tabletten in den Mund, schluckte sie ohne Wasser und machte mich auf die Suche nach einem Auto, das ich klauen konnte.
Der erste Wagen, den ich aufbrach, war ein ziemlich neuer BMW, der sich ums Verrecken nicht starten ließ. In den vergangenen zwanzig Jahren hatte ich nur selten Autos stehlen müssen, und das rächte sich jetzt. In den zweiten, einen älteren Ford Taurus, kam ich gar nicht erst hinein, denn die Scheibe einschlagen wollte ich nicht. Der dritte war ein 1995er Honda. Ich brauchte zwölf Minuten, um ihn zu knacken und den Motor zu starten. Ich beschloss, mich in der nahen Zukunft mit moderner Autotechnik zu befassen. Fürs Erste war ich froh, in dem alten Honda zu sitzen.
Ich fuhr zurück zum Unfallort. Die meisten Spuren waren beseitigt, übrig waren nur ein kleiner Haufen aus Scherben und Plastik und der verstörende Geruch von verbranntem Reifengummi.
Wegen der Cops machte ich mir keine Sorgen. Ich wusste, dass die Polizistin den Mund halten würde, und ihre Kollegen hatten sicher Besseres zu tun, als sich um Unfallopfer zu kümmern, die eine medizinische Behandlung ablehnten. Niemand war hinter mir her.
An der Unfallstelle lungerten immer noch ein paar Leute herum. Oder vielleicht hätten sie auch ohne den Unfall dort rumgelungert. Ich hielt neben zwei Gestalten, ließ den Motor laufen und stieg aus dem Auto. Seit dem Crash waren vielleicht zwei oder drei Stunden vergangen. Hier bekamen die Leute für ihr Geld wirklich was geboten.
»Hey«, sagte ich. Die Gestalten, zwei Afroamerikanerinnen irgendwo zwischen dreißig und fünfzig, drehten sich um und musterten mich. Die eine trug eine ausgebeulte, kurze Sporthose, Flip-Flops und ein Raiders-T-Shirt, die andere Jeans und ebenfalls ein Raiders-T-Shirt. Beide rauchten. Wahrscheinlich waren sie ein Paar, was aber nur eine Vermutung und außerdem egal war.
Keine sagte etwas. Beide sahen verwirrt aus. Ich überlegte mir, dass sie mich wohl wiedererkannt hatten, und ich lag vollkommen richtig damit.
Schließlich sagte die Frau in der Jeans: »Hey, alles in Ordnung? Waren Sie nicht vorhin …«
»Ja«, sagte ich. »Alles okay, danke. Haben Sie gesehen, was mit der anderen Frau passiert ist? Die so geschrien hat?«
»Die Sanitäter haben sie mitgenommen«, sagte die Frau in Jeans.
Die Frau in der Sporthose schlug ihr gegen die Hüfte.
»Ich will ihr keinen Ärger machen«, sagte ich schnell. »Ich brauche nur ihre Aussage, für meine Versicherung. Wissen Sie, wie sie heißt?«
Die Frauen sahen mich an und verkniffen den Mund zu einem Strich. Sie waren größer als ich und zu zweit. Nun, Letzteres ließe sich ändern. Bevor sie eine Gelegenheit bekamen, noch misstrauischer zu werden, holte ich den Taser aus meiner Gesäßtasche, hielt ihn an den nackten Oberarm der Shortsfrau und drückte auf den einzigen Knopf. Ich hörte ein leises elektrisches Sirren, die Frau zuckte und zappelte, stieß einen seltsam kehligen Laut aus und fiel um. Das Ganze dauerte nur zwei oder drei Sekunden. Bevor die Frau in Jeans zurückschlagen konnte, zog ich unter Schmerzen das linke Knie an und trat ihr in den Bauch, so hoch ich konnte. Mein Knöchel traf ihre Taille, sie klappte zusammen, ich unterdrückte einen Schrei. Ich spürte Knochen in meinem Bein, die ich nie gespürt hatte, und es fühlte sich nicht gut an.
Die Frau krümmte sich vor Schmerzen. Ich kniete nieder, spürte ein Knirschen in den unbekannten Komponenten meines von den Tabletten aufgeweckten und zugleich betäubten Beines und hielt der Frau den Taser an den Hals.
»Das tut richtig weh«, sagte ich, »und ich will Ihnen das wirklich nicht antun. Sie scheinen ein netter Mensch zu sein. Ich brauche nur ihren Namen. Den Namen der Frau, die die Sanitäter mitgenommen haben. Ich verspreche Ihnen, ich will sie beschützen, nicht bedrohen.«
Die Frau kniff die Lippen fest zusammen, aber dann wurde ihre Angst zu groß. Sie sagte: »Scheiße«, und dann noch einmal: »Scheiße«, und dann: »Daisy Ramirez. Sie heißt Daisy Ramirez.«
Auf dem Weg zum Krankenhaus fühlte es sich an, als würden die Pillen als Schaum an meinem Rückgrat emporsteigen. Ich war wie ein Handy mit leerem Akku, das jemand an die Steckdose angeschlossen hatte. Oder vielleicht lag es nur am Adrenalin, das mich – es ist mir ein bisschen peinlich – nach jeder Schlägerei berauschte.
Claude war immer noch mein Assistent, und ich hoffte, dass er, anders als das Dutzend Assistenten davor, bei mir bleiben würde. Wenn er nach dem Fall des Kali Yuga immer noch mit mir zusammenarbeiten wollte, konnte ihn eigentlich nichts mehr schrecken.
Ich vertraute ihm.
Ich schrieb ihm eine Textnachricht: 911. Ruf mich an, Prepaid.
Danach fuhr ich weiter durch das dunkle Oakland und versuchte, mich an die vergangenen Tage zu erinnern.
Der Fall der Miniaturpferde war abgeschlossen. Kein Mensch würde einen anderen wegen eines Gauls in Zwergengröße umbringen. Der Fall des Kali Yuga lag anders: Unter genau solchen Umständen wurden Menschen zu Mördern. Andererseits kam keiner der Beteiligten als Attentäter infrage, denn das Opfer war tot und die Mörderin hinter Gittern. Die Spur der Adlerträne – nein, das war im vergangenen Jahr gewesen. Ich war immer noch verwirrt. Hatte ich mir bei dem Unfall den Kopf gestoßen? Nein, wahrscheinlich stand ich bloß unter Schock.
Denk nach, Claire. Ich hatte einen Unfall gehabt – einen Unfall vor diesem. Ich war in Santa Cruz beim Lama gewesen. Nick Chang hatte mir ein neues Rezept ausgestellt. Ich war bei Bix gewesen und hatte ein Buch gestohlen …
Meine Gedanken gerieten ins Stottern. Ich hatte ein Buch gestohlen? Warum?
Nein, kein Buch. Einen Comic.
Einen Cynthia-Silverton-Comic. Ich erinnerte mich an das raue Papier an meinen Fingerspitzen und wie ich das Heft in der Jackentasche hatte verschwinden lassen. Es war in einem Loft in Downtown Oakland passiert. Ich kannte den Buchhändler.
Wie selten die Hefte waren, hatte ich erst ein Jahr zuvor erfahren, als Kelly mich angerufen hatte. Die Comics hatten in unserer Kindheit eine so große Rolle gespielt, dass sie quasi unsichtbar waren. Erst als ich sie nicht mehr hatte, dachte ich wieder an sie.
Im Internet existierte Cynthia Silverton nicht. Es gab einen einzigen, knappen Eintrag in einem Onlineverzeichnis für gedruckte Comics:
Cynthia Silverton: In geringer Auflage erschienener Comic aus einer Privatdruckerei in Las Vegas, Nevada. 1978–1989. Die Abenteuer von Cynthia Silverton, Teenagerdetektivin und Collegeanfängerin. Sehr selten, dennoch nur von mäßigem Wert.
Ich hatte eine komplette Sammlung der Hefte ausfindig gemacht. Sie gehörte einem Buchhändler in Oakland. Er wollte sie nicht verkaufen. Manche Buchhändler stellen sich wirklich an. Drogendealer sind da ganz anders, sie trennen sich gern von ihrer Ware. Immerhin hatte ich mir die Hefte ansehen dürfen.
In jeder Ausgabe gab es mindestens einen Cynthia-Silverton-Comic, einen ungelösten Fall aus dem echten Leben, eine Kurzgeschichte aus dem Archiv von Cynthia Silverton und eine Annonce:
Werde Detektiv!
Geld! Spannung! Detektive werden von Männern und Frauen bewundert. Jeder sieht zu kenntnisreichen, gebildeten Menschen auf. Unser Fernlehrgang bietet dir die Gelegenheit, bequem und von zu Hause aus einen Detektivausweis zu erwerben!
Bei Interesse konnte man sich an eine Adresse in Las Vegas wenden. Ich hatte das Heft wieder und wieder durchgeblättert, aber weder ein Impressum noch Angaben zu den Autoren gefunden, und außer der Annonce auch keine weitere Werbung.
»Aber«, hatte Kelly während unseres letzten Telefonats gesagt – dem halbjährlichen Ritual, bei dem wir uns Hinweise und Vorwürfe an den Kopf warfen –, »wenn du sie dir heute ansiehst, musst du zugeben, dass sie ziemlich merkwürdig sind, oder? Hast du nicht auch das Gefühl, sie wären für uns allein erfunden worden? Als wären es keine normalen Comics. Und hast du dich nie gefragt, warum das alles so seltsam war?«
Nein, hatte ich irgendwie nicht. Ich war die beste Detektivin der Welt, aber das größte aller Rätsel hatte ich übersehen: die eigenartig schiefe Bahn meines Lebens.
»Im Ernst«, sagte sie, »wer zum Teufel sind wir denn? Hast du dich das je gefragt? Wer zum Teufel sind wir?«
Und während ich da durch Oakland fuhr und überlegte, wer mich umbringen wollte, fiel mir noch etwas ein.
Vor fünf Tagen, kurz nachdem ich bei Bix gewesen war, hatte ich auf die Annonce geantwortet. Auf die Annonce in dem Cynthia-Silverton-Comic.
Werde Detektiv!
Geld! Spannung! Detektive werden von Männern und Frauen bewundert. Jeder sieht zu kenntnisreichen, gebildeten Menschen auf. Unser Fernlehrgang bietet dir die Gelegenheit, bequem und von zu Hause aus einen Detektivausweis zu erwerben!
Ich hatte geschrieben:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich arbeite bereits als Detektivin, würde meine Fähigkeiten aber gern verbessern. Bieten Sie auch Fort- und Weiterbildungskurse an? Oder kann ich mich trotz meines Alters und meiner Erfahrung für den Fernlehrgang einschreiben? Bitte antworten Sie an folgende Adresse: …
Mit freundlichen Grüßen
Claire DeWitt
Meinen Brief hatte ich an die angegebene Adresse geschickt.
Ich wusste nicht genau, was ich damit beabsichtigt hatte. Möglicherweise erhoffte ich mir eine Antwort. Oder vielleicht wollte ich wem auch immer beweisen, dass mir nichts entging.
Und da fiel mir noch etwas ein: Der Lincoln, dessen Fahrer mich ermorden wollte, hatte ein Kennzeichen aus Nevada gehabt.
Kapitel 4
Das Rätsel des KBSE
Los Angeles, 1999
Constance Darling, zu ihrer Zeit die beste Detektivin der Welt, lernte ich am 18. Juni 1994 in Los Angeles kennen. Vorher hatte ich mich durch die Staaten treiben lassen, im Auftrag anderer Privatdetektive gearbeitet und wahllos Fälle gelöst. Ich wollte keinen festen Job, ich wollte kein geordnetes Leben, und ich wollte von niemandem geliebt werden.
Als Tracy verschwand, war ich zwar kein Kind mehr, doch vom Erwachsensein noch weit entfernt. Zwei Jahre lang suchten Kelly und ich nach ihr. Wir fanden keinen einzigen Hinweis. Wäre ich erwachsen gewesen, hätte ich vielleicht eingesehen, dass das für sich genommen ein Hinweis war: dass die Abwesenheit von etwas ebenso aussagekräftig sein kann wie sein Vorhandensein. Dass die Stille manchmal lauter ist als ein Schrei. Zwei Jahre nach Beginn unserer Suche gab ich es auf und verließ Brooklyn. Damals redete ich mir ein, ich täte es, um mein Leben zu retten.
Ich endete in L.A., beziehungsweise meine Reise endete dort. Als ich ankam, wusste ich noch nicht, dass sie zu Ende war. Ich glaubte, auf der Durchreise zu sein, genau so, wie ich in Portland, Chicago, Nashville, Miami und einem Dutzend anderer Städte auf der Durchreise gewesen war.
An guten Tagen schlief ich in einem Motel am Sunset Boulevard, an weniger guten im Griffith Park. Ich übernahm einige kleinere Fälle und erledigte nebenbei Recherchen für einen Privatdetektiv namens Sean Risling. Sean arbeitete an einem Buch über Giftorchideen. Genau genommen sitzt er noch heute daran. Ich hatte vor, nach San Diego weiterzufahren, sobald mir das Geld ausging oder ich rausgeworfen wurde, und von dort vielleicht nach Tijuana und dann weiter nach Texas oder einmal quer durch Mexiko und vor dort nach sonstwo, warum auch immer.
Ich hatte nie mehr gewollt, als erwachsen zu werden, Brooklyn zu verlassen und Detektivin zu sein. Und da saß ich nun in einem im wörtlichen Sinn lausigen, ranzigen Motelzimmer mit Blick auf die Prostituierten am Sunset, ohne Gras und mit keinem anderen Rauschmittel als einer kleinen Flasche Fusel aus einem von L.A.s unzähligen Schnapsläden; ohne zu lieben oder geliebt zu werden, ohne Grund zu leben und ohne jede Aufgabe.
Und dann rief eines Tages Sean Risling an und sagte, Constance Darling sei in der Stadt und brauche für den HappyBurger-Mordfall tageweise eine Assistentin. Ob ich frei sei?
Mir war nichts geblieben als meine Freiheit, dazu ein paar Hundert Dollar, meine Haut, meine Knochen und mein Auto. Ich hätte mir das genaue Gegenteil gewünscht, etwas, das ich nie gesehen und für das ich keine Worte hatte. Aber selbst wenn ich gewusst hätte, was es war, hätte ich nicht gewusst, wen ich darum bitten sollte.
Der Name Constance Darling war mir ein Begriff, seit ich ein Kind gewesen war. Jacques Silette und seine erste und beste Schülerin Constance hatten bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen.
Silette, französisches Genie und visionärer Detektiv, hatte ein einziges, verstörendes Buch geschrieben: Détection. Ich und ein paar Dutzend andere fanden es brillant, wobei ein paar Dutzend wohl übertrieben ist und seine Anhänger darüber hinaus auf der ganzen Welt verstreut lebten. Détection war keine Anleitung oder Aufforderung, sich zu ändern – Détection veränderte. Man hätte es ein Buch nennen können, denn ganz bestimmt sah es wie eines aus. Der schmale, gelbe Band war als Teil einer Lehrreihe erschienen, zusammen mit Das Leben der Bienen und dem eher anspruchsvollen Physik verstehen. Aber kein Buch hatte denselben Effekt wie Détection. Es war wie ein Fluch, wie ein Virus. Silette hatte das perfekte Verhältnis von Druckerschwärze zu Papier, von Buchstabe zu Leerzeichen, von Schwarz zu Weiß gefunden, um beim Leser eine klammheimliche Veränderung anzustoßen. Und wenn man merkte, dass man sich veränderte, war es zu spät – schon hatten sich alle Abwehrmechanismen als unwirksam erwiesen und jeder Widerstand als lächerlich zwecklos. Man war jetzt ein anderer Mensch.
Andere Bücher boten Wissen, Worte und Ideen, die man verteidigen oder über die man streiten konnte. Détection wartete nur mit einem auf: mit der Wahrheit, und auf seinen 123 Seiten (US-Nachdruck von 1959) fanden wir 123 Türen, die an ein und denselben Ort führten. Jede einzelne war verschlossen, doch das Schloss ließ sich knacken, wenn man sich nur genug Mühe gab.
»Mutmaßungen«, schrieb Silette, »sind der schlimmste Feind des Detektivs. Wirf alle klugen Gedanken über Bord. Soll der Rest der Welt in Lügen ertrinken – wir sitzen im Rettungsboot der Wahrheit.«
Für ein paar Dollar erhielt man hundertfünfzig Gramm Papier und ein neues Leben in Wahrheit und Elend – das heißt, wenn man das Buch zu Ende las. Die meisten gaben nach dem ersten Satz oder der ersten Seite auf, manche sogar nach dem ersten Wort. Mehr als ein Mal habe ich gesehen, wie jemand das Buch aufschlug, ein paar Seiten überflog und es dann quer durchs Zimmer warf, oder in den Müll, oder an den Kopf des Idioten, der es empfohlen hatte, weil er glaubte, die anderen wären bereit für das Einzige, das zu haben sich lohnt: das echte Leben.
Wie also lautete die Wahrheit, die alle Knochen neu anordnen und alle Venen neu verlegen würde?