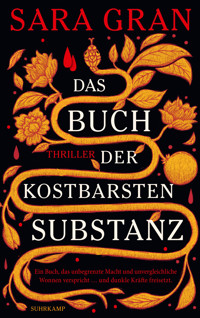9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
New York City, 1950. Josephine (»Joe«) hat es nie leicht gehabt. Ihr Leben war schon verpfuscht, bevor es richtig begann. Eigentlich müsste sie längst tot in irgendeinem Hinterhof liegen, von einer Kugel oder dem Heroin dahingerafft. Doch sie hat noch mal die Kurve gekriegt – und scheint plötzlich das Glück auf ihrer Seite zu haben: Ein wohlhabendes Paar bietet Joe 1000 Dollar; sie soll dessen verschwundene Tochter wiederfinden, die offenbar in die Unterwelt des Big Apple abgedriftet ist. Leicht verdientes Geld, denkt Joe. Aber so leicht ist es nun auch wieder nicht: Freund ist von Feind kaum zu unterscheiden, und nicht jede Falle erkennt man gleich ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Sara Gran
Dope
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
New York City, 1950: Josephine »Joe« Finnigan hat es nie leicht gehabt. Ihr Leben war schon verpfuscht, bevor es richtig begann. Den Vater kannte sie nicht, die Mutter war eine Schlampe. Lediglich die kleine Schwester Shelley hielt sie eine Zeitlang aufrecht. Dann geriet Joe über einen nichtsnutzigen Kerl an Drogen, Heroin hauptsächlich, kam auf die schiefe Bahn, geriet weiter an die falschen Leute und landete in der Gosse. Nun ist sie 36 und seit zwei Jahren clean. Sie verdingt sich zwar nach wie vor als Kleinkriminelle und Diebin, aber mit den Drogen ist Schluss.
Überraschend erhält Joe einen Auftrag, der sie mit einem Schlag sanieren könnte. Das vermögende Ehepaar Nelson vermisst seine Tochter Nadine. Die College-Studentin ist offenbar auf die schiefe Bahn geraten sein und macht mit Drogendealern gemeinsame Sache. Joe soll sie im Großstadtdschungel von New York aufspüren und zu den Eltern zurückbringen. Also begibt sich Joe wieder hinunter in die Gosse, wo sie immer noch so ziemlich jeden kennt. Doch schnell muss sie feststellen, dass eigentlich nichts so ist, wie es scheint …
Inhaltsübersicht
1
Josephine.«
Maude sprach meinen Namen tonlos aus, als wäre ich gestorben, oder als wünschte sie, es wäre so. Ich ließ mich ihr gegenüber in die Sitznische im hinteren Teil der Bar sinken, wo das Tageslicht nie hinreichte und wo sich der Geruch von schalem Bier und Zigarettenrauch nie verflüchtigte. Früher, in den dreißiger Jahren, war Maude die Geliebte eines Gangsters gewesen. Er hatte ihr die Bar gekauft, damit sie in der Zeit nach seinem Abgang versorgt war. Die Bar lag an der Ecke Broadway und West Fourth, und wer zum ersten Mal hier war, brauchte einen Moment, um zu merken, dass es in dem Laden außer Maude keine Frauen gab. Maude, und jetzt auch mich. Maudes Laden war eine Schwulenbar. Sie erlaubte den Jungs, sich bei ihr zu treffen, weil es gut für ihr Geschäft war – es war ja nicht so, als hätten sich ihnen viele Alternativen geboten. Ein noch besseres Geschäft machte sie natürlich damit, die Geheimnisse ihrer Gäste für sich zu behalten.
»Hey, Maude.« Sie sah mich an, als spräche ich eine fremde Sprache. Sie trug zu viel rosa Lippenstift und hatte sich in ein trägerloses goldenes Kleid gezwängt, das zwei Nummern zu klein für sie war. Ihr toupiertes Haar saß als großer blonder Knoten oben auf ihrem Kopf.
Ich griff in meine Geldbörse und nahm einen Goldring mit einem kleinen, schlicht eingefassten Diamanten heraus. Ein Verlobungsring. Er war gut. Ich hatte ihn einen Tag zuvor bei Tiffany’s mitgehen lassen.
Ich reichte Maude den Ring. Sie nahm ihn in ihre fette weiße Hand, zog eine Lupe aus ihrer Handtasche und musterte ihn. Sie hielt den Ring in die Höhe, so dass sich der trübe Schimmer der Wandleuchte darin verfing. Sie ließ sich Zeit. Es störte mich nicht. Jemand wählte einen Song aus der Jukebox. Ein paar Männer fingen an, paarweise zu tanzen, doch der Barkeeper blaffte sie an, sie sollten sofort damit aufhören. Die Männer gaben sich geschlagen und kehrten an ihre Tische zurück. Wenn die Cops hereinkämen und zwei Männer beim Paartanz erwischten, würden alle Anwesenden im Knast landen.
Maude musterte den Ring noch einige Male, bevor sie mich ansah und »fünfzig« sagte.
»Da würde ich im Pfandleihhaus mehr bekommen«, sagte ich. Bei Tiffany’s konnte ich mich nicht täglich blicken lassen, deswegen wollte ich einen guten Preis erzielen. Ich wollte, dass der Ring mich einen Monat lang ernährte.
»Dann versuch es dort«, sagte sie.
Ich streckte meine Hand nach dem Ring aus. Sie tippte ihn auf die Tischplatte, sah mich dabei an.
Jedes Mal lief das so.
»Hundert«, sagte sie.
Ich hielt ihr immer noch meine Hand hin. Sie betrachtete den Ring, strich leicht darüber. Wenn sie blinzelte, krümelte schwarze Wimperntusche auf ihre Wangen.
»Hundertfünfzig«, sagte sie schließlich.
Ich nickte. Sie griff in ihre kleine goldene Handtasche, zählte sieben Zwanziger und einen Zehner ab und rollte die Scheine stramm zusammen. Sie steckte mir die Rolle unter der Tischplatte durch. Ich zählte das Geld und steckte es ein.
»Danke, Maude«, sagte ich.
Sie antwortete nicht. Ich stand auf, um zu gehen, und da erst sagte sie: »Übrigens. Falls du Shelley siehst, kannst du ihr sagen, sie soll sich hier nicht mehr blicken lassen.«
Ich schaute sie an und setzte mich wieder hin. »Wo liegt das Problem?«
»Ich habe kein Problem«, sagte Maude. »Nicht mit dir. Aber mit Shelley. Sie hat mir ein Armband gebracht und geschworen, die Smaragde wären echt. Später habe ich gemerkt, dass es Strasssteine sind. Sie hat hier Hausverbot.«
»Sicher hat sie gedacht …«
»Was sie gedacht hat, ist mir egal«, sagte Maude. »Es war Strass. Auch wenn der König von Siam es ihr geschenkt hätte, wäre es mir egal. Wenn du sie triffst, kannst du ihr sagen, dass ich sie hier nicht mehr sehen will.«
Ich seufzte. »Also schön«, sagte ich. »Wirst du ihr, wenn ich dir den Verlust ersetze, beim nächsten Mal trotzdem aus der Klemme helfen?«
Maude nickte. »Ich bin nicht nachtragend, Josephine. Das weißt du doch.«
»Okay«, sagte ich niedergeschlagen. »Um wie viel hat sie dich geprellt?«
»Zweihundert«, erwiderte Maude.
»Du hast noch nie im Leben zweihundert Dollar für irgendetwas bezahlt«, sagte ich. »Nicht mal dem König von Siam.« Wir feilschten noch eine Weile. Schließlich einigten wir uns darauf, dass hundertfünfundzwanzig ausreichen würden, und dann gab ich ihr den größten Teil des Geldes, das sie mir eben zugesteckt hatte, zurück. Ich stand auf und ging. Normalerweise wäre ich noch ein bisschen geblieben, um Billard zu spielen – ein paar von den Schwulen waren richtig gut, und ich wollte in Übung bleiben –, aber ich hatte eine Verabredung in Downtown.
2
Nach Maudes Bar traf mich die Sonne draußen wie ein Schlag. Es war ein Uhr nachmittags am 14. Mai 1950 in New York City. Am Broadway winkte ich ein Taxi heran, um mich in die Fulton Street bringen zu lassen, von dort lief ich ein paar Blocks weiter, bis ich die Hausnummer 28 gefunden hatte. Es war ein ziemlich beeindruckendes Gebäude, schmal und hoch, das aussah, als wäre es in die Lücke zwischen den anderen Häusern hineingegossen worden. In die weiße Steinfassade waren Wolken und Gesichter und Sterne eingemeißelt, und ganz oben lief es spitz zusammen wie ein Kirchturm. Ein Portier in einer feschen blauen Uniform mit goldenen Tressen öffnete mir breit grinsend die Tür. Drinnen gab es saubere, rote Läufer auf Marmorböden und einen Strom von Leuten, die kamen oder gingen, beschäftigte Leute in Anzügen mit Aktenkoffern und wichtigen Terminen. In der Mitte der Lobby stand ein breiter Empfangstresen aus Marmor, hinter dem ein gutaussehender Kerl in gleicher Uniform saß und die beschäftigten Leute in die jeweils richtige Richtung dirigierte. Ich wusste bereits, wohin ich wollte.
Ein Fahrstuhlführer, auch er mit blauem Anzug und breitem Lächeln, brachte mich in die vierte Etage hinauf. Auf der vierten Etage gab es vier in Mahagonipaneelen eingelassene Mahagonitüren, jede mit einem glänzenden Türknauf aus Messing und einer Milchglasscheibe, auf der in goldenen, schwarzumrandeten Lettern ein Firmenname stand. An der ersten Tür las ich Jackson, Smith und Alexander, Rechtsanwälte. Danach kam Beauclair, Johnson, White und Collins, Anwälte. Die dritte gehörte der Kanzlei Piedmont, Taskman, Thompson, Burroughs, Black und Jackson, Kanzlei.
An der letzten Tür stand nichts. Diese Tür hatte ich gesucht.
Sie stand offen. Dahinter befand sich ein Wartezimmer, in dem eine hübsche Brünette mit weißem Kostüm und schwarzgeränderter Brille an einem Schreibtisch saß. Auf dem Boden lag ein wunderschöner Perserteppich, an der Wand hingen zwei hässliche Landschaftsansichten in Öl. Drei überdimensionierte Ledersessel standen um einen niedrigen Holztisch herum, auf dem mehrere Ausgaben des Forbes-Magazins aufgefächert lagen.
Die junge Frau lächelte mich an. Ich lächelte nicht zurück. Ich hatte keine Lust mehr zu lächeln.
»Ich möchte zu Mr. Nathaniel Nelson«, sagte ich. »Ich habe einen Termin. Josephine Flannigan.«
»Sicher, Miss Flannigan.«
Sie sprang auf und führte mich zu einer Tür hinter dem Schreibtisch. Dahinter lag ein Eckbüro, das ungefähr fünfmal größer war als das Zimmer, das ich bewohnte. Hier erwarteten mich ein noch größerer Schreibtisch, noch mehr Ledersessel und ein Mann und eine Frau. Der Mann saß hinter dem Schreibtisch. Er war etwa Mitte vierzig, hatte silbergraues Haar und große, braune Augen und trug einen dunkelgrauen Anzug, der maßgeschneidert aussah. Er wirkte müde, aber er hatte ein energisches Kinn und ein kantiges Gesicht, das aussah, als dulde es keinen Widerspruch. Als wäre er hier schon so lange der Boss, dass er vergessen hatte, dass er eigentlich der Boss von gar nichts war.
Ich holte tief Luft und atmete den Geruch von Geld ein.
Die Frau saß links vom Schreibtisch. Sie war um die vierzig und sah ziemlich unscheinbar aus. Sie war ganz hübsch, wenn man auf den nicht charismatischen Typ stand. Ihr blondes Haar war zu einem schlichten, ordentlichen Nackenknoten zurückfrisiert. Sie trug ein schwarzes Kostüm, das nichts enthüllte und genauso wenig zu verbergen hatte. Ihr übermäßig geschminktes Gesicht sah aus, als stünde sie gerade noch diesseits der Schwelle zwischen Leben und Tod.
»Mr. Nelson«, sagte ich. »Wie geht es Ihnen? Ich bin Josephine Flannigan.«
Er erhob sich, beugte sich über den Schreibtisch und schüttelte meine Hand. Er war größer, als ich gedacht hatte, größer und breiter. »Guten Tag, Miss Flannigan. Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen, Maybelline Nelson.«
Sie stand auf, und ich ergriff ihre Hand, die sich schlaff anfühlte.
Die Sekretärin ging hinaus und zog die Tür hinter sich zu. Wir setzten uns. Ich zog meine Handschuhe aus und legte sie mir über die Knie. Mrs. Nelson richtete ihren Blick über meine linke Schulter hinweg auf einen Gegenstand etwa drei Meter hinter mir. Mr. Nelson sah mich an und machte den Mund auf, doch ich war schneller. Typen wie ihn kannte ich. Wenn ich ihm das Gespräch überließ, würde ich es so schnell nicht zurückbekommen.
»Nun, Mr. Nelson, von wem haben Sie meine Telefonnummer?«
»Von Nick Paganas«, antwortete er. Ich sah ihn fragend an, bis er hinzufügte: »Ich glaube, er ist auch als Nick der Grieche bekannt.«
Ich lächelte. Ich kannte mindestens ein Dutzend Typen, die sich Nick der Grieche nannten, aber es hätte nichts gebracht, ihn das wissen zu lassen. »Ach ja, Nick«, sagte ich. »Woher kennen Sie ihn?«
Er blickte auf die Tischplatte und runzelte die Stirn. Da wusste ich, woher er Nick den Griechen kannte. Er erklärte es mir trotzdem. »Mr. Paganas, er hat mich um eine hübsche Geldsumme erleichtert, Miss Flannigan.«
»Aktien?«, fragte ich.
Mr. Nelson schüttelte den Kopf. »Grundbesitz. Er hat mir fünfzig Morgen Land in Florida verkauft. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich ein ordentliches Stück Atlantik erworben habe.«
»Sicher«, sagte ich. Ich versuchte, nicht zu lächeln. »Er ist ein Profi, Mr. Nelson. Er hat etliche Männer in bedeutenden Positionen getäuscht – Sie wären überrascht, wenn ich Ihnen die Namen nennen würde.« Ich wusste ehrlich gesagt nicht, über wen wir sprachen, doch wahrscheinlich hatte ich recht. »Ich will damit nur sagen, dass Sie sich in bester Gesellschaft befinden.«
Mrs. Nelson hielt ihre Augen starr geradeaus auf den Geist gerichtet, den sie hinter mir zu sehen meinte.
»Vielen Dank, Miss Flannigan. Wie nett von Ihnen, so etwas zu sagen. Glücklicherweise habe ich den Betrug bemerkt, bevor Mr. Paganas die Stadt verlassen konnte, so konnte ich den Schaden begrenzen. Und mehr noch. Ich sagte Mr. Paganas, dass ich die Polizei nur unter einer Bedingung nicht einschalten würde: Wenn er mir hilft, meine Tochter zu finden.«
»Und er hat mich empfohlen?«
»Ja. Er hat Sie empfohlen«, antwortete Mr. Nelson. »Er hat gesagt, Sie nähmen keine Drogen mehr, Sie seien ehrlich, Ihnen könnten wir vertrauen. Er hat gesagt, Sie würden … nun ja, Sie würden jene Orte kennen, an denen sie sich herumtreibt. Wissen Sie …« Er hielt inne und sah seine Frau an. Sie kehrte aus der Ferne zurück und erwiderte seinen Blick. Er wandte sich wieder mir zu. »Meine Tochter ist drogenabhängig, Miss Flannigan. Meine Tochter ist ein … ein Junkie.«
Ich unterdrückte ein Lachen. Ich las Zeitung. Heutzutage war jeder Spießer in Amerika überzeugt, sein Kind sei ein Junkie. Soweit ich es beurteilen konnte, rauchten die Kids ein bisschen Gras und schwänzten gelegentlich die Schule. Die Groschenromane waren voll davon – Jugendliche, die Pillen einwarfen, landeten kurz darauf beim Heroin und ermordeten schließlich mit bloßen Händen reihenweise ihre Nachbarn. Kinder aus gutem Hause, die von bösen Dealern verführt wurden. Die Dealer auf den Buchcovern trugen immer einen Schnauzbart.
Ich hatte noch nie einen Drogensüchtigen aus gutem Hause kennengelernt. Ich hatte Junkies kennengelernt, deren Eltern Geld und große Villen besaßen. Aber gut war da nichts. Und einen Dealer mit Schnauzbart hatte ich noch nie getroffen.
»Erzählen Sie mir von Ihrer Tochter«, sagte ich.
Er seufzte. »Nadine. Vor ungefähr einem Jahr …«
»Wie alt ist sie jetzt?«, fragte ich.
»Achtzehn.«
»Neunzehn«, fiel die Mutter ihm ins Wort. Sie sprach langsam, als sei ihr erst in dieser Minute klargeworden, was hier vor sich ging.
»Ja, neunzehn«, fuhr Mr. Nelson fort. »Vor ungefähr einem Jahr …«
»Es fing schon früher an«, unterbrach ihn Mrs. Nelson. Zum ersten Mal sah sie mir direkt in die Augen. »Sie fuhr am Wochenende immer öfter mit ihren Freundinnen in die Stadt.«
»Wo wohnen Sie?«, fragte ich.
»Westchester.«
»Ah.«
Sie fuhr fort: »Jedes Wochenende verbrachte sie mit ihren Freundinnen in der Stadt. Sie weigerte sich, uns in den Club zu begleiten oder ihre alten Schulfreunde zu treffen. Was ja an sich nichts Schlimmes war. Das war kurz vor ihrem Schulabschluss.«
Mr. Nelson erzählte weiter. »Aber dann kam sie nach Hause … nun ja, wir hielten sie für betrunken.«
»Inzwischen«, sagte Mrs. Nelson, »sind wir uns da natürlich nicht mehr so sicher.«
»Sie kam immer später nach Hause. Betrunken, oder was auch immer.«
»Wir fanden das ganz normal«, erklärte Mrs. Nelson. »Sie war ein junges Mädchen, und sie wollte sich amüsieren. Sie wollte ihre Freizeit lieber in der Stadt verbringen.«
»Sie wollte aufs Barnard College«, sagte Mr. Nelson. »Also schickten wir sie aufs Barnard. Wir dachten …Sie wissen schon. Wir dachten, dass sie von der Großstadt nach ein paar Jahren genug hat. Dass sie sich die Hörner abstoßen und dann heiraten oder vielleicht sogar einen Beruf ergreifen wird. Was immer sie glücklich gemacht hätte.«
»Sie hat immer so gern gezeichnet«, sagte Mrs. Nelson. »Ich dachte, vielleicht wäre sie in der Modebranche oder in der Werbung gut aufgehoben. Vielleicht hätte ihr das Spaß gemacht.«
»Aber dazu kam es nicht?«, fragte ich.
»Nein«, antwortete Mr. Nelson. »Nein. Stattdessen erhielten wir Beschwerden von der Hausdame des Studentenwohnheims, und schließlich von der Dekanin. Nadine kam zu spät nach Hause, trieb sich herum, schwänzte den Unterricht.«
»Sogar Kunst«, fügte Mrs. Nelson hinzu.
»Sogar Kunst«, wiederholte Mr. Nelson. »Und uns ging sie aus dem Weg. Wir bekamen sie kaum noch zu Gesicht. Und eines Nachts ist es dann eskaliert. Die Hausdame fand etwas in ihrem Zimmer – ein Besteck zur Injektion von Drogen.«
»Spritzen«, erklärte Mrs. Nelson. Ich nickte ernst.
»Wir wollten sie zum Arzt bringen«, fuhr Mr. Nelson fort. »Aber sie weigerte sich. Wie sich herausstellte, hätte der Arzt ohnehin nicht viel für sie tun können … Nun, ich glaube, Sie kennen sich aus damit.«
Ich nickte wieder.
»Sie versprach uns, ohne fremde Hilfe aufzuhören«, sagte Mr. Nelson. »Aber sie hörte nicht auf. Sie konnte nicht. Monatelang ging das so. Schließlich hat das College sie exmatrikuliert.«
»Und dann ist sie verschwunden«, schaltete sich Mrs. Nelson ein. »An dem Tag, an dem sie das Wohnheim verlassen musste. Wir wollten sie abholen …«
»Sie sollte mit uns nach Hause fahren.«
»Aber sie war nicht mehr da. Sie war verschwunden. Einfach so, mitten in der Nacht.«
»Seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört.«
»Wann war das?«, fragte ich.
»Vor drei Monaten«, sagte Mr. Nelson.
»Und Sie haben jetzt erst angefangen, nach ihr zu suchen?«
Sie tauschten gereizte Blicke aus. »Wir haben nach ihr gesucht«, sagte Mrs. Nelson. »Zuerst waren wir bei der Polizei …«
»Denen war es egal. Sie meinten, sie würden sich darum kümmern.«
»Aber wir haben nie wieder etwas gehört«, fuhr Mrs. Nelson fort, »von der Polizei in New York City. In Westchester machten sich natürlich alle große Sorgen um sie, aber helfen konnte uns niemand. Wir fingen an, auf eigene Faust zu suchen, ihre Kommilitoninnen zu befragen und herauszufinden, wo … wo solche Leute sich normalerweise aufhalten. Aber wir erreichten nichts. Also engagierten wir einen Privatdetektiv.« Mrs. Nelson zog ein Foto aus ihrer Handtasche. »Er fand heraus, dass sie bei einem gewissen Jerry McFall wohnte, in einer Absteige in der Eleventh Street. Doch als wir davon erfuhren, waren sie längst weg. Der Privatdetektiv konnte sie kein zweites Mal ausfindig machen.«
Sie reichte mir das Foto. Ein Mann und ein Mädchen standen an der Eleventh Street, auf der Höhe der First Avenue. Der Tag war sonnig. Das Mädchen blickte zu Boden. Sie hatte blondes Haar und helle Augen und ein kleines, symmetrisches, ziemlich unscheinbares Gesicht. Dass sie hübsch war, merkte man nur, wenn man sich die Zeit zum Hinsehen nahm – wozu sie keinen Anlass bot. Sie trug das Haar zum Pferdeschwanz gebunden, einen engen schwarzen Pulli, einen schwarzen Rock und weiße Pumps. Sie aus wie eine Kreuzung zwischen Collegestudentin und Hure. Und ziemlich unglücklich.
Der Mann sah auch nicht glücklich aus. Er trug einen Hut mit breiter Krempe und einen schicken Tweed-Anzug. Er wirkte wie ein Zuhälter. Er war dünn und hatte ein langes, schmales Gesicht. Vermutlich war er ein bisschen jünger als ich, um die dreißig, plus/minus ein paar Jahre. Seine Augen waren dunkel, das Haar unter dem Hut wahrscheinlich hellbraun. Er war weder gutaussehend noch hässlich.
»Welche Augenfarbe hat sie?«, fragte ich.
»Blau«, antwortete ihre Mutter. »Ihr Haar ist blond, so wie meins.«
»Wie groß ist sie?«
»Einen Meter sechzig«, sagte Mrs. Nelson.
Womit der Mann knapp über einen Meter achtzig wäre. Er sah aus, als wollte er dem Mädchen eine verpassen.
»Das Foto hat der Privatdetektiv gemacht«, sagte Mrs. Nelson.
»Wir haben ihn gefeuert«, fügte Mr. Nelson an. »Mehr hat er nicht zustande gebracht. Vermutlich verfügte er nicht über die nötigen Kontakte.«
»In die Unterwelt«, erklärte Mrs. Nelson.
»Wir wollen damit nur sagen, dass wir jemanden brauchen, der sich mit Drogensüchtigen auskennt, besonders mit weiblichen Drogensüchtigen. Die größte Sorge bereitet uns der Umstand, dass Nadine kein Geld hat.«
»Dieser Mann, Nick der Grieche, hat gesagt, Sie wüssten, wo solche Leute hingehen, wie sie an Geld kommen, wo sie Drogen kaufen und so weiter. Wissen Sie, Nadine hat kein Geld …«
»Wir möchten, dass sie nach Hause kommt, selbst wenn sie Drogen nimmt, wir möchten sie in unserer Nähe haben und wissen, dass sie in Sicherheit ist.«
»Wir glauben, dass Sie sie finden können«, sagte Mrs. Nelson und sah mich an. »Wir möchten, dass sie nach Hause kommt.«
»Wir glauben, dass Sie sie finden können, Miss Flannigan«, wiederholte Mr. Nelson. »Wenn Sie heute mit der Suche beginnen, zahle ich Ihnen tausend Dollar, in bar, sofort. Und noch einmal tausend, sobald Sie sie gefunden haben. Allerdings wäre das inklusive aller Spesen, also Benzin, Verpflegung und was sonst noch anfällt – auch die Reisekosten.«
Tausend Dollar. In bar.
Ich sah von einem zum anderen. Sie waren nervös und beflissen und voller Hoffnung. Ich wusste, dass sie mir nicht die ganze Wahrheit erzählt hatten. Wie gesagt, ich hatte noch nie eine Drogensüchtige aus gutem Hause kennengelernt. Vielleicht hing Mrs. Nelson an der Flasche, oder vielleicht hielt sich Mr. Nelson nebenbei eine Geliebte, oder fünf oder zehn. Vielleicht hatten sie Nadine, als sie klein war, zu oft geschlagen, vielleicht taten sie es immer noch, oder vielleicht machten sie ihr wegen der Zeugnisse die Hölle heiß oder wollten sie mit dem Nachbarsjungen verheiraten. Vielleicht nahm das Mädchen gar keine Drogen, sondern fand Westchester einfach nur sterbenslangweilig und wollte nicht dorthin zurück.
Es war egal. Wenn ich tausend Dollar Vorschuss bekam, war egal, ob ich sie überhaupt fand. Wenn und falls ich sie finden würde, könnte ich mir immer noch überlegen, was ich mit ihr machen sollte.
Ich würde mit tausend Dollar in der Tasche aus diesem Büro spazieren. Das war nicht egal.
»Ich will ehrlich zu Ihnen sein«, sagte ich. Sie wirkten mehr als bereit für die Geldübergabe, aber es konnte nicht schaden, die Daumenschrauben noch ein bisschen fester anzuziehen. »Ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Richtige für den Job bin.«
»Ich auch nicht«, sagte Mr. Nelson. »Ehrlich gesagt, Miss Flannigan, weiß ich über Sie nur, dass Sie in New York City leben und … in derselben Branche tätig sind wie Mr. Paganas. Und dass Sie früher drogenabhängig waren. Aber wie es aussieht, sind Sie unsere einzige Hoffnung.«
Wenn er Mr. Nelson tatsächlich ein Grundstück verkauft hatte, war der ominöse Mr. Paganas nicht in derselben Branche tätig wie ich. Nicht wirklich. Vielleicht hatten wir vor vielen Jahren in derselben Branche angefangen, aber während er aufgestiegen war und inzwischen Leuten wie Mr. Nelson Immobilien verkaufte, war ich abgestiegen und schlug mich als Schmuck- und Taschendiebin durch. Wahrscheinlich hatte er mich empfohlen, weil er außer mir keine Drogenabhängigen kannte und weil der Auftrag für ihn und seinesgleichen nicht lukrativ genug war. Ich atmete tief ein und langsam wieder aus und sah zwischen den beiden hin und her, als müsse ich nachdenken.
»Okay«, sagte ich, »ich übernehme den Fall.«
Sie sahen beide aus, als würde ihnen ein Gewicht von den Schultern genommen. Ich sagte, der Tausender würde für einen Monat reichen. Falls ich danach weitersuchen sollte, würden sie mehr zahlen müssen. Ich würde sie anrufen, sobald ich fündig geworden sei, und falls ich nichts fand, würde ich mich jeweils zum Wochenende bei ihnen melden. Sie waren einverstanden. Mr. Nelson gab mir einen Umschlag, in dem zehn Hundertdollarscheine steckten.
»Dann werden Sie also anrufen?«, fragte Mrs. Nelson noch, bevor ich ging. Sie sah mich flehentlich an. »Sie werden anrufen, sobald Sie etwas herausgefunden haben?«
»Selbstverständlich«, erwiderte ich. »Sie können mir vertrauen.«
3
Den Campus des Barnard College hatte ich noch nie betreten, und nach einem Vormittag dort hatte ich auch nicht vor, jemals wieder hinzugehen. Alle Häuser sahen wie Gerichtsgebäude aus, und der Campus lag so weit nördlich, dass ich glaubte, in Boston zu sein. Ich war nie über die 103rd Street hinausgekommen, wo ein Bekannter von mir in einem Café mit Stoff dealte. Als die U-Bahn dort hielt, wäre ich fast ausgestiegen, aus reiner Gewohnheit.
Den Termin beim zuständigen Dekan zu bekommen, hatte mich fast den gesamten Nachmittag des Vortages gekostet. Nun saßen wir in einem der Gerichtsgebäude in seinem Büro, einem unaufgeräumten, mit Büchern vollgestopften, stickigen Zimmer. Der Dekan war ein dürrer Mann fortgeschrittenen Alters, der einen billigen Anzug trug und kleine, verengte Augen und einen schlaffen Händedruck hatte. Es war schwierig, sich vorzustellen, dass irgendwer bei seinem Anblick gedacht hatte, Also das ist wirklich mal ein Mann, dem man junge Studentinnen anvertrauen möchte! An Nadine konnte er sich sofort erinnern.
»Ein hübsches Mädchen«, sagte er mehr als einmal. »Wirklich sehr hübsch.«
»Aha. Ich weiß. Ich habe Fotos gesehen. Dann kannten Sie sie gut?«
»Eigentlich nicht«, sagte er. »Ich bekomme selten eine Gelegenheit, die Mädchen persönlich kennenzulernen, leider. Aber als die Probleme anfingen, wurden sie mir zur Kenntnis gebracht, und daraufhin habe ich ein paar Mal mit ihr gesprochen.«
»Wirklich? Worüber?« Ich wollte nur aus diesem stickigen Zimmer raus. Draußen vor dem Fenster schien die Sonne. Überall wuchsen grüne Sachen aus dem Boden, und wohin man auch blickte, öffneten sich die Blüten. Lächelnde Studentinnen liefen über den Campus. Ich konnte mir das Mädchen auf dem Foto kaum hier vorstellen. Sie schien einer anderen Spezies anzugehören.
Er holte tief Luft und atmete geräuschvoll aus. »Nun, über den Ursprung ihrer Probleme natürlich. Sie hat Drogen genommen, und ich habe ihr davon abgeraten. Ich habe ihr die Haltung des College zu diesem Thema deutlich gemacht.«
»Ich bin mir sicher, das war sehr hilfreich«, sagte ich. »Haben Sie versucht, sie zu einer Therapie zu überreden? Sie ins Krankenhaus einweisen zu lassen? Irgendetwas in der Richtung?« Die Kuren brachten nicht viel, aber sie waren ein kleines bisschen besser als nichts. Besonders für ein junges Mädchen wie Nadine, das noch nicht allzu lange dabei war.
Der Dekan sah mich aus kleinen Augen an. »Miss Flannigan, bei manchen Problemen helfen wir gern. Heimweh, schwach ausgeprägtes Rebellentum, Schwierigkeiten im Studium – hin und wieder haben wir auch Studentinnen hier, die ein bisschen zu viel trinken. Aber ehrlich gesagt, war Nadine die erste Drogensüchtige, der ich begegnet bin. Es ist ja nicht so, dass ich ihr nicht helfen wollte. Natürlich wollte ich das. Aber es übersteigt einfach das, was wir hier zu leisten imstande sind. Das«, fügte er mit Nachdruck hinzu, als wollte er sich selbst überzeugen, »ist unserer Ansicht nach kein Problem des College, sondern fällt in den Verantwortungsbereich der Familie. Ich bitte Sie – Drogen. Auf dem Campus …« Er hob beide Hände in die Höhe und versuchte, ein mitfühlendes Gesicht zu ziehen.
»Was ist mit der Frau, die die Drogen in Nadines Zimmer gefunden hat, die Hausdame?«, fragte ich. »Könnte ich mit ihr sprechen?«
Miss Duncan, die Hausdame, wog an die hundertachtzig Pfund und hasste die jungen Mädchen, auf die sie aufpassen sollte. Ihr Zimmer im Wohnheim war ein wenig größer als die anderen Räume, für ihre Körpermasse aber immer noch zu klein. Wir saßen zusammen auf dem Sofa, während Miss Duncan mir alles über Nadine erzählte.
»Nun ja, ich hatte mit so was ja keine Erfahrung«, raunte sie. Sie trug ein schwarzes Kleid aus sehr viel Stoff, das dennoch eng saß, und ihre Augenbrauen waren zu hohen Bögen nachgezogen, was ihr ein dauerhaft überraschtes Aussehen verlieh. »Nicht, bevor ich hier anfing. Aber diese Mädchen …«
Sie verstummte. Ich lächelte. »Studentinnen. Nicht, dass ich je eine gewesen wäre.«
»Ich auch nicht«, versicherte Miss Duncan, als hätte ich das je bezweifelt. »Ich meine, wozu das Ganze? Nun ja, sicher, wenn man mit der Ausbildung etwas anfangen möchte. Wenn man etwas damit anfangen möchte. Ich meine, für eine wie mich wäre es schön gewesen. Ich hätte etwas draus gemacht. Aber diese Mädchen … nun, Sie wissen schon. Die sind alle hier, um einen Abschluss als M-R-S zu ergattern. Mehr wollen die gar nicht.«
»Verstehe«, sagte ich. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprach. »Nadines Eltern haben mir erzählt, sie habe sich für Kunst interessiert. Hat sie sich viel damit beschäftigt?«
Miss Duncan verdrehte die Augen. »Nadine war wie die anderen. Männer, Partys, Kleider – das war alles, wofür sie sich interessiert hat.«
»Wussten Sie, was mit ihr los war, bevor Sie das Besteck in ihrem Zimmer gefunden haben?«
Sie betrachtete mich schweigend. »Oh«, meinte sie dann, »Sie meinen die Spritze und dieses andere Zeug. Besteck. Nein, ich hatte keine Ahnung. Wie ich schon sagte, ich hatte mit so was keine Erfahrung, bevor ich hier anfing. Diese Mädchen haben mich eine Menge gelehrt, das können Sie mir glauben.«
»Ich kann es mir vorstellen. Kannten Sie ihre Eltern?«
Miss Duncan nickte. »Die kamen etwa einmal im Monat zu Besuch. Sie wohnen in Westchester, nicht weit von hier. Eine von diesen … Sie wissen schon. Bedeutenden Familien. Der Vater ist ein sehr bedeutender Anwalt in Manhattan. Natürlich haben alle Mädchen hier solche Eltern. Sie wissen schon, die schicken ihre Tochter aufs Barnard, damit sie die richtigen Leute kennenlernt und so weiter. Das volle Programm.«
Ich bat sie, mit Nadines Zimmergenossin sprechen zu dürfen. Es war nicht einfach, aber schließlich stand sie auf und führte mich zu einem Zimmer im ersten Stock des Wohnheims, das das Mädchen jetzt für sich allein hatte. Miss Duncan klopfte einmal an und öffnete die Tür. Das Zimmer war eng und mit zwei Einzelbetten, zwei Schreibtischen und zwei Kommoden zweckmäßig möbliert. Die eine Hälfte war offensichtlich unbewohnt: Das Bett war nicht bezogen und der Schreibtisch leer, kein Krimskrams türmte sich auf der Kommode. Am zweiten Schreibtisch saß ein junges Mädchen mit roten Haaren und schrieb in ein Heft. Sie trug einen karierten Rock, eine weiße Bluse und Sattlerschuhe. Ihre Haut war so hell, dass ihr Hals fast nahtlos ins Weiß der Bluse überging.
Miss Duncan stellte mich vor und erklärte, ich sei auf der Suche nach Nadine. Die Zimmergenossin hieß Claudia. Sie lächelte mich an.
»Sicher, wenn ich helfen kann«, sagte sie. Sie klang, als käme sie von einer Farm. Ich setzte mich auf das nicht bezogene Bett und starrte Miss Duncan an, bis sie hinausging.
»Also«, sagte ich zu Claudia, sobald die Hausdame verschwunden war, »du musst Nadine ziemlich gut gekannt haben. Das Zimmer ist furchtbar klein.«
Claudia zuckte die Achseln. »Wir standen uns nicht nahe. Ich meine, wir haben zusammengewohnt und so, aber Nadine blieb gern für sich.«
»Wie war sie?«
Claudia runzelte die Stirn. »Sie war ziemlich launisch. Und blieb gern für sich, wie ich schon sagte.«
»Sie ging nicht viel aus? Hatte keinen Freund, ging nie tanzen?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Nein, eigentlich nicht. Wenn sie nicht gerade mit ihren Freundinnen unterwegs war, blieb sie hier. Sie gehörte keinem Club an und ging auch nie mit zu den Footballspielen.«
»Mit wem war sie befreundet?«
»Das weiß ich nicht«, sagte Claudia. »Ich wusste, dass sie Freunde im Village hatte, die sie manchmal besuchte, aber ich kannte die nicht. Ich glaube, sie hatte sie schon vor dem Studium kennengelernt. Sie hatte einen Freund. Jerry irgendwer. Ich glaube, zuletzt war sie praktisch nur noch mit ihm zusammen und hat ihre anderen Freunde nicht mehr gesehen. Wenn sie nicht mit ihm aus war, saß sie meistens hier im Zimmer herum. Um zu zeichnen. Da, schauen Sie mal …« Sie zeigte auf die Zeichnung über ihrem Schreibtisch. Eine Zeichnung von Claudia. Ich kannte mich mit Kunst nicht aus, aber das Bild sah Claudia verdammt ähnlich. Ähnlicher als jedes Foto. »Die ist von Nadine. Sie hat sie mir geschenkt. Ehrlich gesagt, ist sie mir manchmal auf die Nerven gegangen. Ich meine, sie war nicht besonders freundlich, obwohl wir doch Zimmergenossinnen waren und so. Sie hat mich nie gefragt, ob ich mitkommen möchte, hat mich nie ihrem Freund vorgestellt. Und wenn sie hier war, saß sie immer nur auf dem Bett und hat gezeichnet. Wir haben nicht viel geredet. Tja, heute habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen …«
Ich sah sie an. Sie hatte ein schlechtes Gewissen. »Wusstest du von den Drogen?«
»O nein!«, rief sie und zog die Augenbrauen hoch. »Bevor ich aufs College ging, habe ich noch nicht einmal Alkohol getrunken! Ehrlich gesagt, hätte ich nie gedacht … ich meine, ich wusste nicht einmal, dass es dieses Zeug gibt. Aber dann eines Abends kam Nadine nicht nach Hause. Ich habe mir Sorgen gemacht und bin zu Miss Duncan gegangen. Na ja, die ist dann raufgekommen und hat herumgeschnüffelt und diese ganzen Sachen in Nadines Kommode gefunden. Eine Spritze und Drogen und so weiter. Ich wusste nicht einmal, was das war, bis Miss Duncan es mir erklärt hat. Ich habe gedacht, Nadine wäre krank und brauchte Medizin. Die Collegeleitung führte natürlich ein langes Gespräch mit ihr, die Eltern wurden angerufen und so weiter. Aber das half anscheinend nichts. Es wurde immer schlimmer, bis sie irgendwann kaum noch nach Hause kam, und wenn doch, na ja, dann war es nicht gerade angenehm mit ihr. Zum Schluss wurde sie exmatrikuliert, danach habe ich sie nie wieder gesehen. Sie verschwand in der Nacht, bevor ihre Eltern sie abholen wollten.«
»Du hast sie nicht gehen sehen?«, fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht einmal aufgewacht.«
Wir schwiegen beide für eine Minute. Ich hatte nicht viel Neues erfahren.