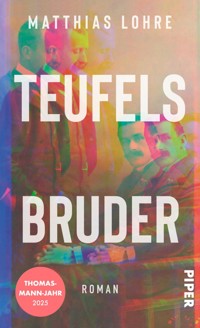9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine persönliche Geschichte, in der sich Millionen Deutsche wiederfinden
Als der Vater des Journalisten Matthias Lohre stirbt, stirbt damit auch die Beziehung zu seinen Eltern. Eine Beziehung, die sich oft fremd angefühlt hat. Die Auseinandersetzung mit seinen Eltern wird für Lohre zu einer Reise in die Vergangenheit und zu einer Suche nach Versöhnung. Er zeigt exemplarisch, womit Kinder von Kriegskindern bis heute kämpfen: mangelndem Selbstwertgefühl, Schuldgefühlen und diffuser Angst. Geprägt durch eine Katastrophe, die sie nicht erlebt, aber doch zu spüren bekommen haben. Eine ermutigende Geschichte und eine letzte Chance für alle 40- bis 60-Jährigen, die Seelentrümmer ihrer Vergangenheit aufzuspüren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Matthias Lohre
Das Erbe der
Kriegsenkel
Was das Schweigen der Eltern mit uns macht
Gütersloher Verlagshaus
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2016 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotiv: Hintergrundbild Fotostapel © okunsto – Fotolia.com
Jungen vor dem Caravan © Mieke Dalle/Image Source/Corbis
ISBN 978-3-641-18823-8V001
www.gtvh.de
In der Kindheit kann ein Leben
ohne väterliches Vorbild
ebenso wenig wie eines ohne Nähe der Mutter
folgenlos ertragen werden.
Alexander Mitscherlich
Inhalt
Anfang & Ende
Warum diese Geschichte?
Kriegskinder & Kriegsenkel
Wer ist das überhaupt?
Fremde Eltern & Fremde Kinder
Was ist bloß schief gelaufen?
Erster Weltkrieg & die Folgen
Wann entstanden die ersten Traumata?
Zweiter Weltkrieg & Nachkrieg
Was macht ein Kind zum Kriegskind?
Überlebensschuld & Lebensfreude
Konnten Kriegskinder glücklich werden?
Täter & Opfer
Was machte das Schweigen der Mittäter mit ihren Kindern?
Die deutsche Mutter & ihre Kinder
Was richtete die Nazi-Ideologie in den Seelen der Kleinsten an?
Kriegsenkel & Kriegsenkelinnen
Was macht das Erbe der Kriegsenkel mit Frauen und Männern?
Verstehen & Nicht-Verzeihen
Wie entwickeln Kriegsenkel mehr Verständnis für sich?
Mutter- & Vaterseelenallein
Wie können sich Kriegsenkel mit der Vergangenheit versöhnen?
Ende & Anfang
Wie lässt sich Abschied nehmen?
Nachwort
Dank
Literatur
Anfang & Ende
Warum diese Geschichte?
I
Die letzte Reise meines Vaters dauerte 26 Stunden, und sie endete auf der A2 nahe Herford unter einer blauen Plastikplane. Begonnen hatte sie hundertvierzig Kilometer entfernt, als mein Vater an einem Dienstagmittag in die Hosentasche griff, wo er schon immer den Autoschlüssel aufbewahrte. Dann schloss er die Fahrertür seines kleinen Peugeots auf, stieg ein und rollte vom Hof des Seniorenheims, in dem er seit wenigen Monaten lebte. Er fuhr über Landstraßen und Autobahnen, die er lange nicht befahren hatte. Dabei wurde er doch immer so nervös, wenn Unvorhergesehenes geschah. Und jetzt – alt, mager und leicht zu verwirren – konnte er Überraschungen weniger denn je gebrauchen. Trotzdem schaffte mein Vater es irgendwie bis zu einer Autobahnraststätte und hielt an. Am Mittwoch um 17:18 Uhr, Feierabendverkehr, Herbstwetter, es war schon dunkel, startete er wieder seinen Wagen und lenkte ihn auf die Auffahrt. Nach 70 Metern auf dem Beschleunigungsstreifen riss er das Steuer herum und fuhr in entgegengesetzter Richtung auf der linken Spur. Vielleicht sah er noch die Scheinwerfer des weißen Volvos, die rasend schnell näher kamen, blendende Lichter in der Dunkelheit, bevor er frontal mit ihm zusammenprallte.
Wo verbrachte mein Vater seine letzten 26 Stunden? Solange ich lebe, buchte er kein Hotelzimmer. Schlief, aß, trank er, den Routineabweichungen immer nervös gemacht haben, in dieser Zeit überhaupt? Wohin wollte er? Und warum riss er, der stolz gewesen war, noch nie einen Unfall verursacht zu haben, an diesem trüben Novembertag des Jahres 2012 auf der Autobahn seinen Wagen herum? Hatte er geahnt, dass Gedächtnislücken und Verwirrtheit sich nicht mehr allein durch Arzneinebenwirkungen und zu wenig Wassertrinken erklären ließen? Hatte er gespürt, dass seine Aussetzer etwas Schlimmeres, etwas Endgültiges ankündigten? Wollte er sterben, fast auf den Tag genau zehn Jahre nach meiner Mutter? Und nahm er dafür den Tod anderer Menschen in Kauf? Ich wusste es nicht. Aber was wusste ich, als sie noch lebten, schon über meine Eltern?
Als ich den Anruf erhalte, der die Todesnachricht bringt, ist es Nacht. Danach lege ich das Handy beiseite, gehe aus dem Schlaf- ins Wohnzimmer und greife nach dem Tablet. Das Display leuchtet im Dunkeln, ich mache kein Licht. Vielleicht in der Hoffnung, mich verstecken zu können. Vor dem Schock, der Scham und mir selbst. Vor der Nachricht aber kann ich mich nicht verbergen. Wenige Stunden nach seinem Tod gibt es schon Agenturmeldungen über den »Geisterfahrer«, mehrere Medien verbreiten sie auf ihren Internetseiten: »Der 81-Jährige starb noch an der Unglücksstelle. Der 43-jährige Fahrer des anderen Wagens musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Warum der 81-Jährige in die falsche Richtung auf die Autobahn fuhr, war zunächst unklar.«
Über und neben dem Artikel leuchten Reklamebanner. Lächelnde Menschen werben vor sattem Grün für Lebensversicherungen. Zwei Leser bewerten die Panorama-Meldung mit vier von fünf Sternen. Sogar Fotos vom grell beschienenen Unfallort gibt es schon, zum Anklicken und Vergrößern. Feuerwehrleute in Schutzanzügen, schweres Gerät, Scheinwerfer. Der frontal zusammengequetschte blaue Kleinwagen meines Vaters liegt an der Leitplanke wie ein erschöpfter Boxer in den Seilen. Ein Foto zeigt neben dem Wrack eine blaue Plastikplane. Erst nach ein paar Sekunden begreife ich, dass sie nicht Teil des Autos ist. Sondern ein Beutel. Darin liegt mein Vater.
Welche »schweren Verletzungen« hat der 43-Jährige, in dessen Wagen er gerast ist? Ich suche im Internet nach weiteren Artikeln. In einem ist von »erheblichen Verletzungen« die Rede. Sind »erhebliche« schlimmer als »schwere«? Was, wenn der Unbekannte stirbt? Dann, sagt etwas in mir, hast du nicht genug getan; du hast nicht genügt; dann hast du endgültig versagt.
Tausende Agenturmeldungen wie diese habe ich als Journalist über die Jahre gelesen. Ihre Klarheit hat mir gefallen. Keine unangebrachten Emotionen, keine unbelegten Behauptungen, nur Tatsachen: Wer hat was wann wo wie warum getan? Jetzt lese ich, fünfhundert Kilometer vom Unfallort entfernt, die nüchternen Tatsachen. Sie sollen erklären, wie mein Vater wenige Stunden zuvor gestorben ist – und ich begreife nichts. Die Wirklichkeit verbirgt sich hinter den Fakten.
Seit dem frühen Nachmittag habe ich mich gefragt, wo mein Vater stecken mag. Da habe ich eine neue Mail des Seniorenheims gelesen, in dem mein Vater seit wenigen Monaten lebte: Am Vortag habe mein Vater das Gelände verlassen und sei seither nicht zurückgekommen. Was sollten sie jetzt tun? Eilig habe ich mit allen Menschen telefoniert, zu denen mein Vater gefahren sein könnte. Es sind nicht viele. Die Polizei wurde alarmiert. Danach konnte ich nur warten. Ich habe mir vorgestellt, wie mein Vater zur selben Zeit am Rande einer Landstraße in seinem Auto sitzt, schimpfend auf den leeren Tank, das Auto und die Welt. Dann klingelte das Telefon.
Als ich spät in der Nacht zurück ins Schlafzimmer gehe, glaube ich, dass mit meinem Vater auch die Beziehung zu meinen Eltern gestorben ist. Meine Mutter ist schon zehn Jahre tot. Das seltsame Ende auf der Autobahn vereint in sich noch einmal all die Verständnis- und Ratlosigkeit, mit der wir einander zu Lebzeiten gegenüber gestanden haben. Mein Vater war nicht der Vater gewesen, den ich als Kind ersehnt hatte, und ich kein Sohn nach seinem Geschmack. Meiner Mutter hatte ich mich als kleines Kind nahe gefühlt, aber das war lange her. Meine Eltern und ich waren einander fremd gewesen. Und jetzt war es vorbei.
Ich lösche das Licht, und alles sieht danach aus, als ginge mein Leben weiter wie bisher.
II
Am Morgen danach erwache ich allein. Ich telefoniere mit meinen Geschwistern. Wir planen die Beerdigung, bringen einander auf den neuesten Stand: Der Mann, in dessen Wagen unser Vater raste, hat laut Polizei mehrere gebrochene Knochen, wird das Krankenhaus aber schon bald verlassen können. Wegen seiner traumatischen Erfahrung ergreift er therapeutische Hilfe. Ich bin ungeheuer erleichtert: Er ist nicht gestorben, ihm fehlen keine Gliedmaßen, und er hat offenbar keine bleibenden Schäden. Die Polizei stellt nach wenigen Tagen ihre Anfangsermittlungen ein. Im Blut meines Vaters hat sie weder Alkohol noch Drogen gefunden. Es gibt keinen Abschiedsbrief, niemand im Seniorenheim berichtet von verdächtigen Äußerungen. Nur ein »altersbedingter Aussetzer« also?
Die Beerdigung findet am zehnten Todestag meiner Mutter statt. Dezemberkälte, Glockenläuten, eine Handvoll Menschen in schwarzen Kleidern, gesenkte Blicke, Amen. Am Tag darauf sitze ich wieder an meinem Schreibtisch, 500 Kilometer östlich vom Grab meiner Eltern. Wenn ich vom Rechner aufblicke, kommt es mir manchmal so vor, als habe es den nächtlichen Anruf gar nicht gegeben. Nach dem Tod meines Vaters scheint sich nichts in meinem Leben zu verändern. Tot wirkt er nicht abwesender, als er es lebendig war.
Ende 2012 bin ich ein 36-jähriger Single, und wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, antworte ich: »Ich kann nicht klagen.« Allein lebe ich in Berlin-Prenzlauer Berg und tue, was ein typischer »PrenzlBerger« so macht. Meinen Kühlschrank stelle ich voll mit Bioprodukten, meine Zwei-Zimmer-Altbauwohnung bescheinen Energiesparlampen, und eine klare Trennung von Arbeit und Privatem ist mir fremd. Seit Jahren schreibe ich als Zeitungs-Redakteur politische Artikel und Kolumnen. Gerade habe ich Urlaub, aber den nutze ich, um daheim ein Manuskript zu Ende zu tippen. Seit einer Woche bin ich Waise, und scheinbar unbeeindruckt beende ich ein humorvolles Sachbuch über Geschlechterunterschiede im Film. Wenn ich nur noch Worte und Buchstaben vor mir sehe, ziehe ich Laufschuhe an. Meine Arbeitswoche hat sieben Tage, ich trainiere für den achten Marathon, und trotzdem habe ich immerzu das merkwürdige Gefühl, zu wenig zu leisten. Aber so zu denken, sage ich mir, ist heutzutage doch normal.
Das fertige Manuskript schicke ich zwei Wochen vor Abgabefrist zum Verlag. Ich bin stolz darauf, unter Druck zu funktionieren. Doch nur einen Moment, nachdem ich auf »Senden« gedrückt habe, ist es, als hätte ich nie etwas geleistet. Eilig suche ich mir eine neue Herausforderung, eine weitere Aufgabe. Nichts zu tun macht mich nervös. Bin ich nicht gerade dadurch wie alle anderen?
Zugegeben: Als mein Vater stirbt, hat noch keine Beziehung länger gehalten als ein Jahr. Aber ich habe einfach noch nicht die Richtige gefunden. Die Aussicht, mit einem anderen Menschen über Wochen zusammen zu sein, gar eine Wohnung zu teilen, fürchte ich mehr als das Alleinsein. Ist es nicht verständlich, meine Ruhe haben zu wollen, schließlich habe ich im Job genügend Stress? Hinter dem nächsten erreichten Ziel, da bin ich fast sicher, wird die Zufriedenheit schon auf mich warten. Ich muss mich nur noch ein wenig länger noch ein bisschen mehr anstrengen, eine noch effizientere Version meiner Selbst werden. Mehr arbeiten, mehr vorausberechnen, mehr vorsorgen. Mit Mitte Dreißig führe ich kein Leben, sondern eine Null-Fehler-Existenz.
Doch als »unglücklich« würde ich mich nicht bezeichnen. Geht es mir nicht besser als den meisten: gesund, mit festem Job und genug Geld zum Leben? Erst recht weit besser als den vorangegangenen Generationen, die Krieg und Hunger erlitten und trotzdem die Kraft gefunden haben, mich aufzuziehen? Ich bin ein Produkt der längsten Friedensphase, die der Kontinent je erlebt hat. Obendrein Teil der Generation Golf, deren Mitglieder als Kinder angeblich keine größere Sorge gekannt haben, als beim Beginn von Wetten, dass..? noch in der Wanne zu liegen. Habe ich da ein Recht, mich zu beklagen?
Deshalb erzähle ich fast niemandem, wohin ich an drei Abenden pro Woche gehe. Als mein Vater stirbt, stecke ich im ersten Drittel einer Psychoanalyse: insgesamt dreihundert Stunden Seelenzergliederung in Rückenlage, verteilt auf zweieinhalb Jahre. Auf einer Couch liegend, versuche ich der Zimmerdecke zu erklären, wie es mir geht. Mein »Ich kann nicht klagen« genügt hier nicht mehr. Das Dumme ist nur, dass ich keine bessere Antwort habe. Aus dem Stand könnte ich sechs Gründe aufzählen, warum die Weimarer Republik scheiterte oder was zur jüngsten Finanzkrise geführt hat, aber zu mir selbst fällt mir nicht viel ein. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin.
Langsam ahne ich, dass es womöglich gar nicht so gut ist, nicht klagen zu können.
Eines Abends, mehrere Monate später, lege ich mich todmüde ins Bett. Früher erinnerte ich mich selten an meine Träume, aber seit dem Unfall stehe ich fast jeden Morgen mit Bildern der Nacht im Kopf auf. Meist wirr, unverständlich und bald verflogen. Doch manche Träume begleiten mich in den Tag. Immer häufiger erscheint mir darin – mein Vater. Mal ist er alt und verwirrt. Mal sieht er jung aus wie auf den alten Hochzeitsfotos. In einem Traum sitzt er versteckt hinter einer Zeitung, in einem anderen huscht er eilig an mir vorüber, rempelt mich an, ohne mich zu erkennen. Mal blickt er mich vorwurfsvoll an, mal interessiert. Aber etwas tut er nie: reden. Der Vater meiner Träume schweigt. In einer Nacht entscheide ich mich, nicht länger zu warten, und spreche ihn an. Er dreht sich zu mir, und sein Mund formt Worte – aber ich höre sie nicht. Ich rufe, er möge lauter reden. Er kann mich nicht hören und spricht weiter unhörbare Sätze. Dann erwache ich, und ich ahne:
Es ist nicht vorbei. Aber was ist »es«?
III
In einer staubigen Ecke unter dem Schreibtisch stapeln sich Bücher, Zeitungsausschnitte und Notizen, und obenauf schreit ein gelber Post-it »KRIEGSENKEL«: Material für eine nie geschriebene Geschichte über die Kinder der Kriegskinder. Irgendetwas hat mich abgehalten, darüber zu schreiben. Vielleicht ja der Umstand, dass mich das Ganze nichts angeht.
Die Familiengeschichten in den Büchern ähneln einander: Alt gewordene Kriegskinder und ihre erwachsen gewordenen Kinder haben einander seit Jahrzehnten angeschwiegen. Nach einem fürchterlichen Streit, einem Aktenfund oder einem klärenden Gespräch mit einem Verwandten kommt ein traumatisches Ereignis ans Licht, dessen verdrängte Folgen die Familie bis heute prägen: die Vergewaltigung der Großmutter auf der Flucht aus dem Osten. Der Tod eines nahen Verwandten von Mutter oder Vater bei einem Bombenangriff. Die Teilnahme eines Großvaters an der Ermordung von Juden. Fast immer sind es klar benennbare Einzelgeschehnisse mit Tag und Ort: Geschichten innerhalb der Geschichte.
Es ist gut, denke ich, dass die Kriegskinder im Alter über Flucht, Nazi-Herrschaft und Bombenkrieg reden. Gut auch, wenn ihre längst erwachsenen Kinder sich fragen, was ihre traumatisierten Eltern ihnen an seelischem Erbe hinterlassen haben. Aber mit mir hat das nichts zu tun.
Mein Vater war 1931 in einer ostwestfälischen Kleinstadt zur Welt gekommen, meine Mutter 1937 in einem Dorf nahe der niederländischen Grenze. Beide wurden nicht vertrieben, und niemand in ihrem engeren Familienkreis starb im Zweiten Weltkrieg. Weder sie noch ihre Eltern erlebten politische oder ethnische Verfolgung und auch keine alliierten Flächenbombardements. Meine Eltern hatten nie behauptet, dass es ihnen damals besonders schlecht ergangen sei. Überhaupt hatten sie selten über sich geredet. Hätten sie nicht, wäre ihnen Schlimmes geschehen, davon gesprochen, zumindest im Alter? Und hatten nicht Millionen Europäer unendlich viel mehr gelitten, allen voran Juden, Sinti und Roma, die Bewohner der deutsch besetzten Gebiete, Menschen mit geistiger Behinderung, Kriegsgefangene und politisch Verfolgte?
Nein, als mein Vater stirbt, scheint mir die Idee, dass ich ein »Kriegsenkel« sein könnte, absurd, ja anmaßend: Wäre das nicht bloß der Versuch eines Wohlstandskinds, sich auf Kosten seiner Eltern einen Opferstatus zusammenzuklauben? Gibt es nicht weit näher liegende Gründe für meine persönlichen Probleme als eine Katastrophe, die ich nicht erlebt habe? Die Fragen wirken eh müßig: Meine Eltern sind tot. Falls es etwas gegeben hatte, das sie verschwiegen hatten, dann war es mit meinem Vater an einem Novembernachmittag auf der Autobahn gestorben.
In einer Nacht erscheint mir wieder mein Vater im Traum. Er blickt mich aus der Ferne an, streng, missbilligend. Nichts Neues. Doch dann erkenne ich, etwas näher, meine Mutter: ganz grün im schlanken Gesicht, mit von Schmerz verzerrten Zügen, eine Hand vor ihrem Bauch. Ein Schock. Mein Vater bemerkt es nicht. Ich rufe ihm zu, doch er scheint mich nicht zu hören. Ich will meiner Mutter zu Hilfe eilen, doch ich komme nicht von der Stelle. Meine Füße sind wie festgeklebt, alles Zerren und Ziehen bringt nichts, es erschöpft mich nur. Zwischen meinen Eltern und mir tut sich rasend schnell ein tiefes, schwarzes Loch im Boden auf, und es wächst. Sein Rand kommt immer näher, ich will weglaufen, aber ich bin wie gelähmt. Was tun? Was? Dann wache ich auf, verwirrt und atemlos.
Der Traum ragt hinein in den folgenden Tag. Seine bedrückende, quälende Stimmung begleitet mich, während ich am heimischen Schreibtisch Mails schreibe, Kaffee mache, einkaufen gehe. In der Luft hängt unsichtbarer Nebel, der alle Wahrnehmung dämpft. Erst glaube ich, das sei die Trauer über den Tod meines Vaters, aber etwas stimmt nicht. Diesen Nebel, dieses Gefühl von bleierner Schwere und Trübsinn kenne ich schon sehr lange. All das lebt in mir, so lange ich zurückdenken kann.
Noch einmal greife ich nach den Büchern, in denen Kinder von Kriegskindern das Lebensgefühl in ihren Elternhäusern schildern. Und da steht es, Schwarz auf Weiß: »In den meisten Familien hatten keine Dramen stattgefunden«, schreibt die Journalistin Sabine Bode in Kriegsenkel. »Stattdessen war die Rede von ›Nebel‹ und von ›Unlebendigkeit‹. Ein 45-jähriger Sohn bezeichnete das Klima in seinem Elternhaus als eine ›stillstehende graue Sauce‹.« Anne-Ev Ustorf schildert in Wir Kinder der Kriegskinder die diffusen Ängste ihrer Kindheit: »Schlafstörungen und Trennungsängste quälten mich. Ich fürchtete, auf dem Weg zur Schule einfach vom Erdboden verschluckt zu werden. Nachts träumte ich wiederholt, dass ich allein durch brennende Ruinenlandschaften geisterte – oder ich fiel endlos in einen schwarzen Abgrund.« Viele der etwa zwischen 1955 und ’ 75 geborenen Frauen und Männer in Deutschland und Österreich teilen ein Lebensgefühl: »Heimatlosigkeit, das Gefühl, sich nirgends verwurzeln zu können, die eingeimpfte Existenzangst, Bindungsschwierigkeiten, Identitätsverwirrungen und vor allem das Gefühl, bei den Eltern etwas wieder gutmachen zu müssen.«
Das alles habe ich schon einmal gelesen – und mich nicht angesprochen gefühlt. Doch zwischen erstem und zweitem Lesen liegen der Tod meines Vaters und der Beginn der Psychoanalyse. Diesmal erkenne ich in den Beschreibungen meine hilflosen Versuche wieder, der Zimmerdecke zu erklären, wie es mir geht. Dieselben Formulierungen, teilweise bis ins letzte Wort, dazu das Bild vom schwarzen Abgrund. Ein Zufall?
Anfangs habe ich geglaubt, in dem Traum verabschiedeten sich meine Eltern von mir. Als wollten sie mir sagen, mit ihrem Tod rücke die Chance, Antworten auf meine zu spät gestellten Fragen zu erhalten, in weite Ferne. Doch der Traum lässt mich nicht los. Die vermeintliche Aufforderung zum Abschied will sich partout nicht verabschieden. Schließlich komme ich darauf, dass der Traum anders herum Sinn ergibt: Wenn hier etwas nicht Lebewohl sagen will, sucht es dann womöglich den Kontakt zu mir? Und wenn zwischen meinen Eltern und mir ein schwarzes Loch klafft, dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit, um ihnen nahe zu kommen: Ich darf nicht länger versuchen, dem Nichts zu entkommen, denn es würde immer schneller sein als ich. Nein, ich muss das Gegenteil dessen tun, das ich immer getan habe. Ich muss mitten hineinspringen ins tiefe Dunkle, das uns trennt und mich ängstigt, und schauen, wo ich lande. In diesem Moment ahne ich nicht, wohin mich dieser Gedanke führen wird. Wer eine Reise antritt, weiß oft erst im Nachhinein, wann er sich zu ihr entschlossen hat.
Die Geschichte, wie ich meine verstorbenen Eltern suche, wäre nur für mich interessant, ginge es dabei allein um einen Postbeamten, eine Verkäuferin und ihr jüngstes Kind. Doch was ich zu erzählen habe, steckt voller Parallelen zu Millionen Beziehungen zwischen alten Eltern und ihren erwachsenen Söhnen und Töchtern. Zwischen über 70 Jahre alten Männern und Frauen und ihrem größtenteils zwischen 1955 und ’ 75 geborenen Nachwuchs. Zwischen Kriegskindern und Kriegsenkeln.
Während die »große« Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert gründlicher erforscht ist als jede andere Epoche, liegt die Historie der eigenen Vorfahren meist verborgen hinter rätselhaften Anekdoten und beredtem Schweigen. Doch in Träumen, Anekdoten, Ängsten und Zwängen drängt etwas, das über Jahrzehnte verschwiegen worden ist, danach, endlich zur Sprache zu kommen.
Hören wir zu.
Kriegskinder & Kriegsenkel
Wer ist das überhaupt?
I
Von wem reden wir, wenn wir von »Kriegskindern« und »Kriegsenkeln« reden? Für die zwischen 1929 und 1947 Geborenen hat sich der Begriff »Kriegskinder« etabliert. Sie waren zu jung für den direkten Fronteinsatz. Aber alt genug, um Hunger, Vertreibung und Bombenangriffe zu erleiden, den Verlust von Angehörigen, Trennungen und Todesangst. Der renommierte Altersforscher Hartmut Radebold schätzt, dass 60 bis 70 Prozent dieser Jahrgänge traumatische Erfahrungen gemacht haben. Genau genommen handelt es sich bei den Kriegskindern um mehrere Generationen. Wer als Flakhelfer Leichen schleppte, hat den Krieg anders erlebt als ein Säugling, der Hunger, Lärm und Kälte ausgesetzt war. Mit den Kämpfen endete nicht das Leid. Noch 1950 wohnten in Westdeutschland neun Millionen Kinder unter unzulänglichen, oft menschenunwürdigen Umständen. Ein Jahr nach Gründung der Bundesrepublik waren die Hälfte aller Lagerbewohner Kinder und Heranwachsende.
Etwa zwölf Millionen Kriegskinder leben noch. Allein 2012 starben rund 350.000 Angehörige dieser Jahrgänge. Nimmt man die vor 1929 Geborenen hinzu, starben in jenem Jahr fast 715.000 Alte. Bald werden Kriegskinder den Nachgeborenen so fremd erscheinen wie die Soldaten des Kaiserreichs.
Viele von ihnen ackern, schon lange in Rente, für Familie, Verein oder Partei, bis ein Herzinfarkt sie fällt. Andere dämmern, sich selbst und der Welt zunehmend fremd werdend, in Altersheimen dem Tod entgegen. Dabei wirkten die Deutschen, die den Zweiten Weltkrieg als Kind überlebten, schier unzerstörbar. Ihre Tüchtigkeit und Anpassungsbereitschaft halfen, das Land wieder aufzubauen. Von »früher« haben sie, wenn überhaupt, ihren Kindern nur in Floskeln erzählt: Es war für uns ja auch ein Abenteuer. Wir haben uns nie beklagt. Anderen ging es noch schlechter. Wir kannten es ja nicht anders. Du weißt gar nicht, wie gut du es hast. Solche Sätze erklären weniger, als sie verbergen. Sie vernebeln die Sicht auf das, was unter der Oberfläche schwelt und schmerzt. Diese Jahrgänge haben über Jahrzehnte etwas tief in sich verschlossen: die Erinnerung an Hunger, Flammenmeere, Flüchtlingstrecks und Todesängste. Noch mehr aber die Gefühle von Angst und Hilflosigkeit, die sie begleiten.
Zu den ältesten Kriegskindern zählt Helmut Kohl. Der 1930 Geborene löschte nach Bombenangriffen Feuer im brennenden Ludwigshafen. Sein älterer Bruder Walter starb, erst 18 Jahre alt, Ende 1944 als Soldat bei einem Tieffliegerangriff. Aus der Kinderlandverschickung schickte Helmut beruhigende Briefe nach Hause. Ihm »Mamas Marmelade« zu schicken, »hättet Ihr Euch wirklich ersparen können. Wir haben hier so gut zu essen, dass Ihr es bestimmt nötiger habt als ich.« Millionenfach mussten Kinder ihren traumatisierten Eltern Trost spenden – und erhielten selbst zuwenig davon. Halbwüchsige demonstrierten Stärke, die sie nicht besaßen.
Zu den jüngsten Kriegskindern zählt Gerhard Schröder. Seine Mutter gebar ihn 1944 auf der Flucht vor Tieffliegerangriffen auf einem Bauernhof. Der Vater starb vier Monate nach Gerhards Geburt bei Kämpfen in Siebenbürgen. Seinen Sohn hat er nie gesehen. Als Schröder mehr als ein halbes Jahrhundert später Bundeskanzler wurde, stellte er ein Porträtfoto seines Vaters Fritz in Wehrmachtsuniform auf seinen Schreibtisch. Für den Sohn blieb der fremde Vater ein Männlichkeitsideal. Die Mutter sollte stolz auf ihren Jungen werden.
So unterschiedlich die individuellen Erlebnisse, so sehr ähneln sich die Verhaltensweisen vieler erwachsen gewordener Kriegskinder. Kohl und Schröder demonstrierten eine Dickfelligkeit und dröhnende Lebenstüchtigkeit, die sich ihrer selbst immer aufs Neue versichern musste: Mich kriegt nichts klein.
Millionen andere sahen im Gründen einer eigenen Familie die Chance, die Liebe zu erfahren, die ihnen früh versagt geblieben war. Die Folge: Millionenfach mussten Kinder ihre wenig belastbaren Eltern trösten. Alltägliche Auseinandersetzungen brachten die mühsam gehaltene Balance leicht ins Wanken: Was haben wir bloß falsch gemacht? Warum tust du uns das an? Beängstigende Gefühle der Ohnmacht oder Scham hielten die zu Eltern gewordenen Kriegskinder mit aller Kraft fern, häufig zum Preis schwerer Depressionen oder scheinbar grundloser Wutausbrüche. Die Folge war eine trügerische Ruhe: der alles ein- und verhüllende »Nebel«. Doch wer nicht fühlt, kann nicht mitfühlen – etwa mit den eigenen Kindern. Heute stehen Alte und Junge einander sprach- und ratlos gegenüber.
II
Die Kinder der Kriegskinder fragen sich in ihrer Lebensmitte, warum die Zufriedenheit, die mit Wohlstand und Fleiß einher gehen sollte, sich partout nicht einstellt. Häufig bleiben Kriegsenkel lange kinderlos, ihre Beziehungen zerbrechen früh oder werden als Last erlebt. Depressionen erkennen sie erst spät als solche an, gerade weil sie keinen anderen Zustand kennen. Die Unfähigkeit zu trauern der Kriegs- und Kriegskinder-Generation hat sich im Nachwuchs fortgepflanzt – als Unfähigkeit zu vertrauen.
»Wir wuchsen unter ihrem Traumaschatten auf«, schreibt Joachim Süss, Mitherausgeber des Buchs Nebelkinder, »sodass wir uns klein, gehemmt und hilflos fühlen mussten«. Dass ihre Eltern mit ihren Nöten zu tun haben könnten, darauf kommen viele Kriegsenkel nicht. Im Gegenteil glauben sie, sie verteidigen zu müssen: Sie wussten es doch nicht besser. Sie haben getan, was sie konnten. Das kann ich ihnen nicht antun.
Erzählen Kriegsenkel von ihrem Elternhaus, berichten sie häufig von »Nebel«, einer Stimmung voller Trübsinn und bleierner Schwere. Oder von hektischer Betriebsamkeit, die keinen Platz ließ für die »kleinen« Sorgen der Wohlstandskinder. Meine Eltern haben mich nie gesehen. Sie und ich kennen einander eigentlich gar nicht. Das Gefühl von Fremdheit und Unbestimmtheit verlässt sie nicht, es wandelt sich nur. Als Erwachsene beschleicht sie das seltsame Gefühl, nicht ihr Leben zu leben.
Als das Wort »Kriegsenkel« 2008 erstmals Verbreitung fand, polemisierte die Zeit über Deutschlands »Jugend ohne Charakter«. Obwohl dem Autor Jens Jessen die Einsicht in die möglichen psychischen Ursachen verwehrt blieb, brachte er das Lebensgefühl von Millionen Deutschen auf den Punkt: »Nicht bummeln! Nicht träumen, keine falschen Hoffnungen hegen. Es ist, als ob die Eltern ihre Abstiegsangst gnadenlos an die Kinder weitergereicht hätten.« Egoismus genüge nicht als Erklärung für diese Haltung, »denn auch der Rückzug aufs Private und das ›Ich zuerst‹ sind nur der Ausdruck einer Depression, die von der Zukunft nichts erwartet«. Das gilt nicht allein für die damals Unter-30-Jährigen, sondern auch für ihre Eltern und Großeltern.
Welche Folgen das für unsere Gesellschaft hat, zeigt sich heute in vollem Maß. Die Kinder der Kriegskinder halten die Macht in Händen. Die geburtenstärksten Jahrgänge der Nachkriegszeit prägen in Unternehmen, Parlamenten und Medienhäusern das Selbstbild des Landes. In der Lebensmitte fragen sie sich, warum sich mit wachsendem materiellen Wohlstand partout nicht die erhoffte Gelassenheit einstellt: Warum sind sie häufig ohne erkennbaren Grund niedergeschlagen oder voller Angst? Warum fühlen sie sich einsam, selbst wenn sie unter Menschen sind? Warum haben sie das Gefühl, sie gingen auf schwankendem Grund? Was lässt sie Liebesbeziehungen so schnell als einengend empfinden? Warum glauben sie, nirgendwo wirklich zu Hause zu sein? Was treibt sie an, immerzu Höchstleistungen zu bringen? Warum befriedigen ihre Anstrengungen sie nicht, sondern vergrößern nur die Erschöpfung? Was drängt sie dazu, trotz allem immer mehr zu leisten, immer weiter zu gehen, wenn sie sich zugleich nach nichts mehr sehnen als innerer Ruhe? Nach dem Gefühl, endlich im eigenen Leben anzukommen?